Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Angststörungen
2.1 Begriffsbestimmungen
2.2 Prävalenz
2.3 Komorbidität
2.4 Dimensionen der Angst
2.5 Ätiologie
2.5.1 Lerntheoretische Modelle
2.5.1.1 Klassische Konditionierung
2.5.1.2 Operante Konditionierung
2.5.1.3 Lernen am Modell
2.5.2 Kognitive Theorien
2.5.2.1 Die Angsttheorie nach Lazarus
2.5.2.2 Die Angstkontrolltheorie nach Epstein
2.5.2.3 Kognitives Modell der Angst nach Beck und Emery
2.6 Klassifikation von Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen nach ICD-10
2.7 Ausgewählte Störungsbilder
2.7.1 Spezifische (isolierte) Phobie
2.7.2 Soziale Phobie
3 Psychologische Grundbedürfnisse
3.1 Das Grundprinzip der Konsistenzregulation
3.2 Klassifikation der psychologischen Grundbedürfnisse
3.2.1 Das Bindungsbedürfnis
3.2.2 Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle
3.2.3 Das Bedürfnis nach Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung ...47
3.2.4 Das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung
3.3 Zusammenfassende Betrachtung
3.4 Der GBKJ
4 Angststörungen und psychologische Grundbedürfnisse
4.1 Angststörungen und Inkonsistenz
4.2 Angststörungen und Bindung
4.3 Angststörungen und Orientierung und Kontrolle
4.4 Angststörungen und Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung
4.5 Angststörungen und Lustgewinn und Unlustvermeidung
5 Bedeutung für die Soziale Arbeit
6 Fazit
Anlagen
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Lesehinweise
Die in dieser Diplomarbeit verwendete männliche Artikulierung und Singularität der Bezeichnungen von Personen dient ausschließlich der leichteren Lesbarkeit und Handhabbarkeit des Textes. Die Artikulierung hat somit keine geschlechtsspezifische Bedeutung.
Tauchen innerhalb wörtlicher Zitate Hervorhebungen in Form von Fett- oder Kursivdrucken sowie Unterstreichungen auf, so wurden diese stets aus dem Originaltext übernommen.
Kleines Lied
Angst hat keine Freunde,
trotzdem kennt man sie gut,
denn sie macht sich lieber Feinde und sie frisst am liebsten Mut. Keiner kann sie leiden, doch sie hat jeden gern. Sie kennt auch jeden Menschen
ganz egal ob nah ob fern.
Ich bin dein kleines Lied, ich stärk dich bei Gefahr. Egal was auch geschieht,
ich bin für dich da.
Einmal in deinen Ohren
geh ich da nie mehr raus,
denn ich hab es mir geschworen: Ich schütz dich und dein Haus.
Deine Angst ist wohl auch meine, denn sie lebt von dir und mir. Im Dunkeln und alleine nah dir und mir und dir.
Wir könnten uns verbünden, wir beide du und ich
und unsere Angst ergründen. Ich lass dich nicht im Stich.
Denn ich bin dein kleines Lied, ich stärk dich bei Gefahr. Egal was auch geschieht,
ich bin für dich da.
Einmal in deinen Ohren
geh ich da nie mehr raus,
denn ich hab es mir geschworen: Ich schütz dich und dein Haus.
Jetzt bist du meine Heimat, denn in dir geht es mir gut. Dein Herz ist meine Einfahrt und dein Lauschen wird mein Mut. Wir beide unzertrennlich
jagen alle Ängste fort,
denn ich weiß du erkennst mich auch am dunkelsten Ort.
Denn ich bin dein kleines Lied…
(„Kleines Lied“, Kinderlied von Xavier Naidoo 2003)
1 Einleitung
Ergebnissen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes des Jahres 2004 zufolge erkrankt etwa jeder dritte Erwachsene der Bundesrepublik Deutschland im Laufe seines Lebens an einer psychischen Störung. Auch bei Kindern und Jugendlichen zählen die Angststörungen zu den häufigsten psychiatrischen Erkrankungen. Bei ihnen werden die spezifischen Phobien am häufigsten diagnostiziert.
Weiterhin ist mittlerweile, insbesondere durch die wissenschaftlichen Arbeiten von Grawe, anzunehmen, dass die wichtigste Ursache für die Entwicklung psychischer Störungen in einer schweren und dauerhaften Verletzung der psychologischen Grundbedürfnisse zu sehen ist.
Diese beiden wissenschaftlichen Erkenntnisse liefen bislang nebeneinander her und sollen nun im Rahmen dieser Abschlussarbeit vereint werden, um einen konkreten Zusammenhang zwischen der Befriedigung der psychologischen Grundbedürfnisse und der Entstehung von Angststörungen aufzudecken.
Diese Arbeit wird neben den verbindlichen Kapiteln „Einleitung“ und „Fazit“ aus vier weiteren Teilen bestehen. Zunächst soll der Begriff der Angststörungen näher beleuchtet werden. Dazu zählen neben allgemeinen Begriffsdefinitionen und der Darlegung der Dimensionen der Angst auch Entstehungsmodelle von Angststörungen. Lerntheoretische sowie kognitive Theorien werden an dieser Stelle erläutert. Weiterhin erfolgt eine Vorstellung der Internationalen Klassifikation von Angststörungen nach dem ICD-10. Abschließend für diesen ersten Teil sollen die Spezifische Phobie und die Soziale Phobie vorgestellt werden. Auf Ausführungen möglicher Wege aus der Angst soll in dieser Arbeit verzichtet werden, da der Schwerpunkt vielmehr auf ihrer Entstehung liegt.
Der darauf folgende Teil der Arbeit wird sich mit den psychologischen Grundbedürfnissen nach Grawe beschäftigen. Neben einer kurzen Begriffsbestimmung sowie der Erläuterung des Grundprinzips der Konsistenzregulation soll eine detailliertere Ausführung der vier Grundbedürfnisse nach Bindung, Orientierung und Kontrolle, Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung sowie Lustgewinn und Unlustvermeidung erfolgen.
Das daran anschließende Kapitel hat den Anspruch, die zuvor exemplarisch ausgewählten und vorgestellten Formen der Angststörungen daraufhin zu überprüfen, ob ihre Entwicklung in einer mangelnden oder möglicherweise auch unverhältnismäßig hohen Befriedigung der einzelnen psychologischen Grundbedürfnisse begründet liegen kann.
Das fünfte Kapitel soll die Bedeutung der bis dahin gewonnenen Einsichten über die Zusammenhänge zwischen der Befriedigung der psychologischen Grundbedürfnisse und der Entstehung von Angststörungen für die Soziale Arbeit aufbereiten und eine Anregung für die praktische Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse bieten.
2 Angststörungen
2.1 Begriffsbestimmungen
Bevor es an die Definition der Angststörungen gehen kann, bedarf es zunächst einer genaueren Betrachtung des zu Grunde liegenden Begriffs der Angst. Zwar wird dieser auch in der Alltagssprache verwendet, für die weiteren Ausführungen dieses Kapitels sollten jedoch einige wissenschaftliche Erklärungen die Grundlage bilden.
Die Begriffe Angst, Furcht und Phobie werden häufig als Synonyme verwendet, so dass eine Differenzierung erforderlich ist. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass es keine jeweils allgemeingültige und allseits anerkannte Definition dieser Begrifflichkeiten gibt. Lazarus-Mainka und Siebeneick (2000, S. 12) machen darauf aufmerksam, dass jede Angsttheorie ihre eigene Definition des Angstbegriffes hat. Sartory (1997, S. 3) beschreibt jedoch eine zunächst grundlegende Erkenntnis: „Furcht und Ängstlichkeit sind alltägliche Gefühle, die den Menschen in vielen Situationen überlebensfähig machen, da sie uns helfen, Gefahrensituationen zu entgehen.“ Es wird somit hier bereits deutlich, dass das Empfinden von Angst nicht immer krankhaft sein muss, sondern in seiner ursprünglichen Funktion einen Schutzmechanismus des Menschen vor Gefahren darstellt.
Die Etymologie des Angstbegriffs wird anschaulich von Morschitzky (2004, S. 1) vorgestellt: „Das Wort ‚Angst‘ geht auf das althochdeutsche Wort ‚angust‘ zurück, das wiederum abgeleitet wird aus dem lateinischen Hauptwort ‚angustiae‘ (‚Enge‘, ‚Enge der Brust‘) bzw. aus dem Zeitwort ‚angere‘, das ‚(die Kehle) zuschnüren, (das Herz) beklemmen‘ bedeutet.“ Der Begriff der Angst bezeichnet folglich schon ganz ursprünglich eine Emotion, die eine Enge in der Brust verursacht und den Betroffenen das Gefühl vermittelt, als werde ihnen die Kehle zugeschnürt.
Im Folgenden sollen einige exemplarisch ausgewählte Definitionen des Begriffs der Angst vorgestellt werden. Grundlegend stellt Fürntratt (1974, S. 14) fest: „Angst tritt immer auf als Reaktion, d.h. wird immer ‚ausgelöst‘, entsteht nicht von selbst.“ Er erläutert dazu weiter, dass es immer kognitive Prozesse sind, die eine Angstreaktion auslösen. Der Angstbegriff von Pschyrembel, Zink und Dornblüth (2007, S. 90) beinhaltet das Signalisieren von Bedrohung oder Gefahr und kommt damit ebenso wie auch die Begriffsbestimmung von Flöttmann (2000, S. 17) „Angst ist ein Gefahrensignal“ der oben zitierten Erkenntnis von Sartory sehr nahe. Essau (2003, S. 17) hingegen benennt Angst als einen „Gefühlszustand, der gekennzeichnet ist durch negative Emotionen und körperliche Symptome von Anspannung.“ Angst sei ein diffuses Gefühl, das sich häufig nicht genauer beschreiben lasse. Auch Rachman (2000, S. 9) erwähnt in seiner Bestimmung des Begriffs die Tatsache, dass es sich um die Erwartung eines unbestimmten Ereignisses handelt. Aus dieser Begriffsbestimmung geht hervor, was auch Essau (2003, S. 17) explizit benennt, dass nämlich die Angst eine Emotion sei, die sich auf Zukünftiges beziehe. Zuletzt sei Krohne (1975, S. 11) erwähnt, der alle bisher getroffenen Definitionen um jenen Aspekt erweitert, dass es sich um eine Situation handelt, „in der eine adäquate Reaktion des Individuums nicht möglich erscheint.“
Zusammenfassend kann also über den Begriff der Angst gesagt werden, dass es sich dabei um ein subjektives, diffuses, negatives, zukunftsbezogenes und durch eine Kognition ausgelöstes Gefühl handelt, das von körperlichen Symptomen begleitet wird, eine unangepasste Reaktion des Individuums hervorruft und ursprünglich eine real bestehende Gefahr oder Bedrohung signalisiert. Da aber nicht alle Menschen auf dieselben Reize gleich reagieren, bleiben noch Kluge und Kornblum (1981, S. 9) zu zitieren: „Ob die Wahrnehmung oder Vorstellung dieser [Bezug nehmend auf eine vorangegangene Auflistung potentiell angstauslösender Reize] oder ähnlicher Gefahrenreize von dem Betroffenen nun aber als bedrohlich beurteilt wird und Angst entsteht, hängt neben der Qualität des Reizes von der Persönlichkeitsorganisation des Individuums und seiner individuellen Vorgeschichte ab.“
Auch der Begriff der Furcht soll nun etwas genauer betrachtet werden. Rachman (2000, S. 9) definiert: „Streng genommen ist mit Furcht eine emotionale Reaktion auf eine spezifische, wahrgenommene Gefahr gemeint - auf eine Bedrohung, die eindeutig benannt werden kann, wie z.B. eine giftige Schlange.“ Durch diese Erläuterung wird der Unterschied zum Angstbegriff deutlich, da dieser zuvor als diffus und unbestimmt beschrieben wurde. Weiterhin grenzt sich Furcht von der Angst dadurch ab, dass sie eine „gegenwartsbezogene emotionale Reaktion [ist], die sich durch starke Fluchttendenzen und eine Aktivierung des gesamten sympathischen Nervensystems auszeichnet“ (Essau 2003, S. 17). Rachman (2000, S. 11) hingegen fasst jedoch ernüchternd zusammen: „Es gibt keine klare Grenze zwischen Furcht und Angst und manchmal ist es nicht möglich, zwischen den beiden zu unterscheiden.“
Zuletzt soll auch dem Begriff der Phobie Aufmerksamkeit zukommen. „Eine Phobie zeichnet sich durch den intensiven Wunsch aus, die gefürchtete Situation zu vermeiden und ruft bei Konfrontation mit der Situation große Angst hervor.“ So lautet eine im Jahre 1985 getroffene Definition von Beck und Emery, die von Essau (2003, S. 17) zitiert wird. Eine Phobie unterscheide sich in den folgenden Punkten von einer Furcht: Sie sei den Erfordernissen der Situation nicht angemessen, könne nicht erklärt werden, sei jenseits willentlicher Kontrolle, führe zur Vermeidung der gefürchteten Situation, bleibe über einen ausgedehnten Zeitraum bestehen, sei fehlangepasst und altersunspezifisch. Wie die weiter unten folgenden Ausführungen zu den Merkmalen klinischer Ängste zeigen werden, kommt die Beschreibung des Begriffs der Phobie einem pathologischen Verhalten am Nächsten.
Wie aber bisher deutlich wurde, stellt Angst nicht immer ein Krankheitssymptom dar, sondern bezeichnet in erster Linie eine biologisch festgelegte Schutzfunktion des Menschen vor Gefahren. Im Weiteren soll nun geklärt werden, unter welchen Bedingungen die gesunde menschliche Angst als eine psychische Störung anzusehen ist. Eine im Rahmen dieser Arbeit allgemein bemerkenswerte Feststellung trifft Dehmlow (2007, S. 14): „Während andere psychische Erkrankungen wie Depressionen sich meist erst im Erwachsenenalter erstmalig manifestieren, scheinen es besonders die Angststörungen zu sein, deren erstmaliges Auftreten bereits in Kindheit und Jugend zu beobachten ist.“
Pschyrembel et al. (2007, S. 90) schreiben der Angst dann einen Krankheitswert zu, wenn sie „ohne erkennbaren Grund bzw. infolge inadäquater Reize ausgelöst und empfunden wird.“ Damit ist gemeint, dass sich eine Angst dann als krankhaft darstellt, wenn sie in objektiv ungefährlichen Situationen auftritt und das ursprüngliche Signalisieren von Gefahr zu einem unangemessenen Zeitpunkt und auf einen unangemessenen Reiz erfolgt. In Bezug auf Angststörungen im Kindesalter erläutern Pschyrembel et al. (2007, S. 90) weiter, dass es sich hierbei um eine häufige psychische Störung des Kindesalters handelt, die sich sowohl durch alterstypische als auch durch altersuntypische übermäßig ausgeprägte unrealistische Angst auszeichnet. Laut Steinhausen (2006, S. 171) zeichnen sich klinisch bedeutsame kindliche Ängste dadurch aus, dass sie
- „nicht vorrübergehend sind,
- für die Entwicklungsphase unangemessen sind,
- mit starken und anhaltenden Beeinträchtigungen verbunden sind, x die normale Entwicklung beeinträchtigen,
- Probleme im sozialen Umfeld auslösen.“
Zimbardo und Gerrig (2004, S. 668) definieren Angststörungen als „psychische Störungen, die durch Erregungs- und Spannungszustände gekennzeichnet sind, verbunden mit dem Gefühl intensiver Angst ohne erkennbaren Auslöser.“ Myers (2005, S. 726) erweitert die Beschreibungen um den Aspekt, dass Angstpatienten häufig durch unangemessene Verhaltensweisen versuchen die Angst zu vermindern.
Bisher wurden allgemeine Kennzeichen einer Angststörung aufgeführt. Welche Symptome und Merkmale jedoch darüber hinaus für einzelne Störungsbilder charakteristisch sind, wird zu einem späteren Zeitpunkt dieser Arbeit darzulegen sein.
2.2 Prävalenz
Die Aussagen zur Prävalenz von Angststörungen bei Kindern variieren von Studie zu Studie, so dass kein allgemeingültiges Ergebnis zu benennen ist. Zur Krankheitshäufigkeit bemerkt Essau (2003, S. 118) auf Emmelkamp und Scholing (1997) Bezug nehmend, dass Angststörungen zu den Störungen mit der höchsten Prävalenz bei Kindern und Jugendlichen gehören. Aus einer Übersicht der Studien zu kindlichen Angststörungen geht hervor, dass etwa 10% aller Kinder und Jugendlichen „irgendwann in ihrem Leben die diagnostischen Kriterien einer Angststörung [erfüllten]“ (Essau 2003, S. 118). Laut In-Albon und Schneider (2007, S. 5) liegt das Erstauftretensalter bei etwa elf Jahren. Pschyrembel et al. (2007, S. 90) besagen hingegen, dass der Beginn von Angststörungen bei Kindern bereits ab dem dritten Lebensjahr liegen kann. Häufige Formen seien Störung mit Trennungsangst, Schulangst sowie die Generalisierte Angststörung und die später näher zu betrachtenden Phobien. Aus den Tabellen von Essau (2003, S. 122 f.) zur Verteilung von Angststörungen geht jedoch hervor, dass eine Phobie die deutlich am häufigsten auftretende Angststörung bei Kindern und Jugendlichen ist und auch Blanz und Schneider (2008, S. 747) gelangen zu dieser Erkenntnis. Die weitere Verteilung der einzelnen Störungsbilder gestaltet sich dann jedoch altersabhängig und so ist festzustellen, dass bei achtjährigen Probanden die Störung mit Trennungsangst am zweithäufigsten auftritt, wohingegen eine Stichprobe älterer Probanden ergab, dass dort die Sozialphobie an die zweite Stelle tritt. Weiterhin sind bei Essau (2003, S. 123 ff.) auch Untersuchungsergebnisse in Bezug auf das Geschlecht der Kinder und Jugendlichen veröffentlicht. So wiesen in den meisten von ihr gesammelten und in eine Übersicht gebrachten Studien Mädchen zwei- bis viermal höhere Raten von Angststörungen auf als Jungen. Zum einen könne das ihrer Meinung nach an genetischen bzw. biologisch bedingten Unterschieden liegen und zum anderen sei eine Erklärung auch in den unterschiedlichen Erfahrungen und sozialen Rollen zu suchen. Weiterhin sei auch ein unterschiedliches Coping- Verhalten von Jungen und Mädchen als Erklärung dafür zu sehen, dass Mädchen häufiger erkranken als Jungen. Diese Ergebnisse gehen aus epidemiologischen Studien hervor, wohingegen klinische Studien kaum einen Unterschied in der Häufigkeit zwischen Jungen und Mädchen hervorbrachten. Essau vermutet, dass sich ebenso viele Jungen wie Mädchen behandeln lassen, obwohl doch viel mehr Mädchen als Jungen erkranken, liege daran, dass eine Zurückgezogenheit und Schüchternheit bei Jungen eher als Störung angesehen und als behandlungsbedürftig definiert werde als bei Mädchen, denen diese Charaktereigenschaften häufig als Normverhalten zugeschrieben werden.
2.3 Komorbidität
Zur Komorbidität erklären Lazarus-Mainka und Siebeneick (2000, S. 382): „Für alle Angststörungen ist typisch, daß sie meist nicht isoliert auftreten, so daß mehr als eine Diagnose zu stellen ist.“ Ein ähnliches Zitat unterstützt diese Aussage: „Komorbidität scheint eher die Regel als die Ausnahme zu sein“ (Essau 2003, S. 132). Essau führt weiterhin auf, dass die Komorbiditätsraten zwar je nach Studie zwischen 20% und 70% schwanken, aber allgemein festzuhalten ist, dass die Rate von Begleiterkrankungen bei Jugendlichen höher liegt als bei Erwachsenen. Morschitzky (2004, S. 180) erklärt, welche Zusammenhänge zwischen Angststörungen und anderen psychischen Erkrankungen denkbar sind:
- „gleichzeitiges Auftreten von Angst und einer anderen psychischen Störung, verursacht durch eine dritte Störung (z.B. Alkoholmissbrauch), x Ängste als Ursache anderer Störungen,
- Ängste als oft bleibende Folge anderer Störungen,
- Ängste zeitlich umschrieben im Rahmen der Manifestation einer anderen Störung.“
Interessant ist es einen Blick darauf zu werfen, welche Begleiterkrankungen bei Angststörungen typischerweise auftreten und welche insbesondere bei kindlichen Angststörungen zu finden sind. So besagt Steinhausen (2006, S. 172), dass mindestens ein Drittel aller angsterkrankten Kinder Komorbiditäten mit anderen Angststörungen aufweist. Das bedeutet also, dass ein hoher Prozentsatz der Kinder mit Angststörungen nicht an einer, sondern gleich an zwei oder mehr Formen krankhafter Angst leidet. Einige Überlegungen zur Erklärung des gleichzeitigen Erkranktseins an zwei oder mehr Angststörungen stellen Essau und Petermann (1998, S. 225) an:
- „Ängstliche Verhaltensweisen einer Angststörung können einen Risikofaktor für eine andere darstellen.
- Unterschiedliche Ängste weisen dieselbe Ätiologie oder nicht spezifische Risikofaktoren auf.
- Die Symptome verschiedener Ängste überlappen sich und führen zu Störungen, die die Kriterien für mehr als eine Diagnose erfüllen.“
Am häufigsten jedoch treten kindliche Angststörungen zusammen mit affektiven Störungen auf (vgl. Blanz, Remschmidt, Schmidt & Warnke 2006, S. 539). Erklärungsmodelle für dieses Phänomen gibt es viele. Einen einfach nachzuvollziehenden kausalen Zusammenhang benennt Morschitzky (2004, S. 182): „Depressionen entstehen oft als Folge nicht bewältigbarer Ängste.“ Doch es treten auch weitere Störungen in Zusammenhang mit kindlichen Angststörungen auf. Eine übereinstimmende Häufigkeitsverteilung in unterschiedlichen Literaturquellen konnte nicht erzielt werden, weswegen das Nennen von Zahlen an dieser Stelle mehr Verwirrung stiften würde als es Klarheit hervorbringen könnte. Vielfach erwähnt wurden jedoch Hyperkinetische Störungen, Störungen des Sozialverhaltens sowie elektiver Mutismus. Sogar eine Substanzabhängigkeit zur Dämpfung der Angst kommt nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch schon im Kindes- und Jugendalter vor. Die Liste der Begleiterkrankungen erweist sich also als vielfältig und stellt somit eine zusätzliche Herausforderung bei der Bewältigung von Angststörungen dar.
2.4 Dimensionen der Angst
Wie bereits in der oben aufgeführten Definition von Angst nach Essau (2003, S. 17) deutlich wurde, besteht sie aus mehr als einer Dimension. Vielmehr läuft sie auf verschiedenen Ebenen des menschlichen Körpers ab und wird auch auf diesen empfunden. Die Ebenen werden durch eine Angstdefinition von Hackfort und Schwenkmezger aus dem Jahr 1985 deutlich, die durch Sörensen (1993, S. 3) zitiert wird: „Angst ist eine kognitive, emotionale und körperliche Reaktion auf eine Gefahrensituation bzw. auf die Erwartung einer Gefahren- oder Bedrohungssituation. Als kognitive Merkmale sind subjektive Bewertungsprozesse und auf die eigene Person bezogene Gedanken anzuführen…. Emotionales Merkmal ist die als unangenehm erlebte Erregung, die sich auch in physiologischen Veränderungen manifestieren und mit Verhaltensänderungen einhergehen kann.“
Angst äußert sich also auf den drei Ebenen, die Morschitzky und Sator (2002, S. 17) anschaulich als den „‘Dreiklang der Angst‘: Körper-Gedanken-Verhalten“ formulieren. Diese drei Ebenen sollen nun über die Definition von Hackfort und Schwenkmezger hinaus etwas näher vorgestellt werden.
Die meisten bei der Angst auftretenden körperlichen Veränderungen können objektiv gemessen werden. Darüber hinaus empfinden Patienten aber auch subjektive Symptome, die durch eine Messung nicht nachgewiesen werden können. Die Zusammenstellung der folgenden Symptome beider Kategorien erfolgt auf der Grundlage einer Auflistung von Erkenntnissen durch von Baeyer und von Baeyer-Katte (1971, S. 49), Fröhlich (1982, S. 110) sowie einer Erläuterung durch Morschitzky und Sator (2002, S.17): Anspannung oder verminderte Spannung der Muskeln („weiche Knie“), Herzrasen, Veränderung des Hautwiderstandes und der Gehirnwellen, Veränderung des Kreislaufs (Pulsbeschleunigung, Blutdruckerhöhung), verändertes Produktionsverhältnis der Nebennieren (Adrenalin- und Noradrenalinausschüttungen), Veränderung der Atmung (Beschleunigung, Luftnot), Vermehrung der Schweißsekretion, Verminderung der Speichelsekretion (Mundtrockenheit), Veränderungen des Magen-/ Darmtraktes (Appetitlosigkeit, Magendruck, Durchfall oder Verstopfung), Veränderungen des Urogenitalsystems (vermehrtes und häufigeres Wasserlassen, Menstruationsstörungen), Zittern der Extremitäten sowie eine Erweiterung der Pupillen.
Hingegen eindeutig der subjektiven Kategorie zuzuordnen sind „innere Unruhe und Spannung, Kopfdruck und Kopfschmerz, Schwindelgefühl, Schlafstörungen, Präkordialangst1, Herzdruck und Herzklopfen, Würgegefühl im Hals u.a.m.“ (von Baeyer & von Baeyer-Katte 1971, S. 49). Diese Ausführungen machen deutlich, dass das Empfinden von Angst auf sehr viele unterschiedliche Körperfunktionen Einfluss nehmen kann.
Die kognitiven Merkmale sind ausschließlich subjektiv und umfassen Gedanken, Befürchtungen und Phantasien. Die Denkweise eines angsterkrankten Menschen zeigt sich deutlich eingeschränkter als die eines gesunden Menschen. Seine Gedanken bringen ausschließlich negative Zukunftsprognosen in Bezug auf die aktuelle angstauslösende Situation hervor, wie z.B.: „Es wird bestimmt etwas ganz Schlimmes geschehen“ oder „Ich kann mir in dieser Situation nicht mehr helfen“. Durch die übermäßige Beobachtung der während der Angst ablaufenden körperlichen Veränderungen wird das Angstempfinden meist noch verstärkt. Daraus resultieren dann eine gefühlte Hilflosigkeit oder das empfundene Ausgeliefertsein, das ebenso zu den typischen Symptomen eines Angstpatienten auf kognitiver Ebene zählt (vgl. Morschitzky & Sator 2002, S. 17).
Die in der Definition angesprochenen Verhaltensänderungen (der motorische Anteil der Angst) bezeichnen Strategien, durch die Betroffene angstauslösende Situationen in Zukunft meiden können. Aber auch aktuell beobachtbares Verhalten wie das Erstarren vor Schreck, Zittern und Beben, das Zeigen einer Fluchtreaktion und panikartiges Verhalten in einer akut auftretenden angstauslösenden Situation sind damit gemeint (vgl. Morschitzky & Sator 2002, S. 17). Flöttmann (2000, S. 29) differenziert die Veränderung des Verhaltens noch einmal in Angst bewirkt Angriff, Angst bewirkt Flucht, Angst bewirkt Bindung. Jedoch geht aus den Beschreibungen der drei Komponenten der Angst hervor, dass vermutlich die meisten angsterkrankten Menschen einen Ausweg aus ihrer Befangenheit in einer Flucht suchen und der Angriff als Reaktion auf Angst eher bei gesunden Menschen zu finden ist.
2.5 Ätiologie
Zur Entstehung von Angststörungen gibt es eine Vielzahl von Theorien. Vorab ist jedoch festzuhalten, „daß es keine allgemein akzeptierte Theorie der Angst gibt. Es handelt sich eher um mehr oder weniger komplexe Konzepte, deren Schwerpunkte jeweils auf anderen Aspekten des Angstphänomens liegen“ (Sedlmayr-Länger 1985, S. 25).
2.5.1 Lerntheoretische Modelle
Die lerntheoretischen Modelle entspringen dem Behaviorismus und unter ihnen sind all jene Konzepte zu verstehen, die davon ausgehen, dass menschliche Reaktionen (und somit auch Angst) als Ergebnis eines Lernprozesses zu verstehen sind. Dabei wird jedoch unterschieden, wodurch das Verhalten modifiziert wird. Die drei populärsten Modelle erlernten Verhaltens sollen hier vorgestellt werden: Die klassische Konditionierung, die operante Konditionierung sowie das Lernen am Modell.
2.5.1.1 Klassische Konditionierung
Diese Theorie über das Erlernen von Verhaltensweisen wurde bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch Pawlow entwickelt und stellt die Grundlage aller Lerntheorien dar. „Klassische Konditionierung ist ein Vorgang des assoziativen Lernens“ (Morschitzky 2004, S.302). Der Ansatz der klassischen Konditionierung geht davon aus, „dass ein ehemals neutrales Objekt oder eine neutrale Situation zum Auslöser einer Phobie werden kann, indem das Objekt oder die Situation mit einer Angst auslösenden Erfahrung gepaart wird“ (Zimbardo & Gerrig 2004, S. 673). Meermann und Okon (2006, S. 23) weisen jedoch darauf hin, dass der Prozess der klassischen Konditionierung zwar eine Angstreaktion auf ursprünglich neutrale Reize konditionieren kann, der Angstreflex an sich jedoch genetisch im Menschen verankert ist und nicht erst durch eine Konditionierung gebildet wird.
Bevor das Lernen erfolgt, liegen ein unkonditionierter Stimulus (UCS) und eine dadurch ausgelöste unkonditionierte Reaktion (UCR) vor. Das bedeutet, dass diese Reaktion nicht gelernt wurde, sondern intuitiv ausgelöst wird. Sie stellt also einen Reflex dar. Beim Prozess des Lernens wird nun ein neuer und an sich neutraler Stimulus (NS) mit dem unkonditionierten Stimulus gepaart, worauf die unkonditionierte Reaktion weiterhin gezeigt wird. Sie wurde erneut durch den unkonditionierten Reiz hervorgerufen. Nach einigen Wiederholungen des gleichzeitigen Vorhandenseins beider Stimuli kann eine Reaktion später auch dann hervorgerufen werden, wenn nur der ursprünglich neutrale Stimulus dargeboten wird. Er wird dann jedoch als konditionierter Stimulus (CS) bezeichnet, da das darauf folgende Verhalten dann auch keine neutrale Reaktion mehr darstellt, sondern eine konditionierte Reaktion (CR). Grawe (2004, S. 96) macht darauf aufmerksam, dass Angstreaktionen in Folge des eben beschriebenen Prozesses „ohne jede Beteiligung des Bewusstseins“ erworben werden können.
Das klassische Beispiel dafür, dass auch Angst auf dem Wege der klassischen Konditionierung gelernt werden kann, bildet das Experiment des Kleinen Albert, das von Watson und Rayner im Jahr 1920 durchgeführt wurde. Im Alter von elf Monaten ließ man den Jungen mit einer weißen Ratte spielen, vor der er keinerlei Angstreaktionen zeigte. Die Ratte stellte also für ihn einen neutralen
Reiz dar. Immer dann, wenn das Kind die Ratte berühren wollte, ertönte hinter seinem Kopf ein lauter Ton, der es in einen unangenehmen Erregungszustand versetzte. Nach sieben Versuchsdurchgängen geriet der Junge bereits dann in einen Erregungszustand, wenn er nur die Ratte anblickte (vgl. Lazarus-Mainka & Siebeneick 2000, S. 150; Morschitzky 2004, S. 303). Rachman (1975, S. 90) führt darüber hinaus noch an, dass der kleine Junge diese Reaktion auch noch vier Monate später zeigte, was deutlich macht, dass einmal erlerntes Verhalten nicht ohne Weiteres wieder vergessen oder gelöscht wird. Auf diese Weise kann auch eine Reizgeneralisierung erfolgen. Das bedeutet, dass phobische Reize (im Beispiel des kleinen Albert das Wahrnehmen einer Ratte) auf alle Reize, die dem ursprünglich neutralen Reiz ähnlich sind (in seinem Fall dann auf Kaninchen, Katzen, Hunde oder Pelzmäntel), verallgemeinert werden können.
Am Beispiel des Kleinen Albert wurde deutlich, dass gerade spezifische Phobien durch klassische Konditionierung erlernte Reaktionen sein können. Trotzdem sei auf Lenné (1975, S. 238) verwiesen, der darauf aufmerksam macht, dass lange nicht jede Angst vor phobischen Objekten und im Besonderen vor Tieren durch die klassische Konditionierung erlernt wurde, sondern auch durch Erfahrungen, in der Regel negativer Art, erlangt werden kann. Myers (2005, S. 729) weist darüber hinaus darauf hin, dass auch die Soziale Phobie ein Ergebnis konditionierten Lernens sein kann, wenn sie erstmalig nach einem traumatischen Erlebnis festgestellt wird.
2.5.1.2 Operante Konditionierung
Das Konzept der operanten Konditionierung wurde durch Thorndike im Jahr 1898 beschrieben und durch Skinner in den 1960-er Jahren weiterentwickelt. Es wird häufig auch als Lernen am Erfolg bezeichnet. Dieser Ansatz liefert insbesondere eine Erklärung dafür, warum erlerntes Verhalten aufrecht erhalten wird. „Im Modell der operanten (instrumentellen) Konditionierung wird auf die Tatsache Bezug genommen, dass Verhalten durch seine Konsequenzen bestimmt und auch verändert wird. Angenehme Konsequenzen verstärken ein Verhalten in dem Sinne, dass es häufiger auftritt, während unangenehme Konsequenzen die Häufigkeit des Auftretens mindern“ (Steinhausen 2006, S. 374). Dieses Prinzip bezeichnete Thorndike als Gesetz des Effektes, weswegen die Bezeichnung des Modells auch den Begriff operant enthält. Zimbardo und Gerrig (2004, S. 263) erklären: „Als operant gilt jedes Verhalten, das von einem Organismus gezeigt wird und das anhand seiner beobachtbaren Effekte auf die Umwelt des Organismus beschrieben werden kann.“ Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Verhalten wird also durch die Art der Konsequenzen bestimmt (vgl. Morschitzky 2004, S. 304). So kann es sich für Kinder beispielsweise als Belohnung darstellen, wenn sie in angstauslösenden Situationen die volle Aufmerksamkeit der Eltern bekommen (vgl. In-Albon & Schneider 2007, S. 8).
Viererlei Arten von Konsequenzen können auf ein Verhalten gezeigt werden. Die Begriffe der positiven Verstärkung und der negativen Verstärkung bezeichnen zwei unterschiedliche Arten der Belohnung, durch die ein Verhalten gefördert wird. Durch Bestrafung, die ebenso wie auch die Belohnung auf zweierlei Arten erfolgen kann, wird ein Verhalten unterdrückt. Die Förderung sowie die Unterdrückung von Verhalten durch operantes Konditionieren lassen sich übersichtlich in einer Tabelle darstellen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1: Verstärkung und Bestrafung nach dem Modell der operanten Konditionierung
Der Verlauf der operanten Konditionierung lässt sich folgendermaßen beschreiben: Zunächst zeigt ein Organismus ein spontanes Verhalten, auf das zufällig die erwünschte Reaktion folgt. Daraufhin wird die erwünschte Reaktion belohnt, unerwünschte Reaktionen hingegen werden nicht belohnt. Somit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Person auch zukünftig häufiger jenes Verhalten zeigen wird, auf das sie eine Belohnung erfahren hat. Bleibt die Verstärkung aus, so können neu gewonnene Gewohnheiten wieder gelöscht werden (vgl. Krohne 1976, S. 30).
2.5.1.3 Lernen am Modell
„Die informelle Beobachtung zeigt, daß menschliches Verhalten -absichtlich oder unabsichtlich- weitgehend durch soziale Modelle vermittelt wird“ (Bandura 1976, S. 9). Dieser Ansatz wurde in den 1960-er Jahren von Albert Bandura als Ergebnis eines Experiments entwickelt. Ursprünglich brachte der Modellversuch zwar hervor, dass aggressives Verhalten von Kindern als Ergebnis der Beobachtung des Verhaltens anderer anzusehen ist. Aber auch zur Erklärung der Entstehung von Angst, dabei am eindeutigsten für die Entstehung spezifischer Phobien, lässt sich dieser Ansatz verwenden. Der Theorie zufolge können ängstliche Reaktionen auch schon dadurch erworben werden, „dass beobachtet wird, wie ein anderer auf einen Reiz mit Angst oder im Rahmen einer Bedrohung reagiert“ (Essau 2003, S. 167). Dieses Modell zur Erklärung der Entstehung von Angst eignet sich also auch für jene Personen, die „antizipatorische Ängste vor Situationen entwickeln, zu denen sie bisher noch überhaupt keinen Kontakt hatten“ (Meermann & Okon 2006, S. 23). Dazu führt Breton (1991, S. 50) weiter aus, dass Kinder häufig vor den gleichen spezifischen Dingen Angst haben wie ihre Eltern, da die Kopie des elterlichen Verhaltens ursprünglich ihr eigenes Überleben sichern sollte.
Anhand des Versuchs von Bandura wurde weiterhin deutlich, dass auch beim Lernen am Modell die Wirkprinzipien der operanten Konditionierung greifen. In seinem Versuch zeigten Kinder nämlich immer dann die zuvor gesehenen Verhaltensweisen, wenn die Personen, die sie beobachtet hatten, eine positive Reaktion auf ihr Verhalten erfahren hatten. Auch dann, wenn keinerlei Konsequenzen folgten, neigten die Kinder dazu, sich das gerade erst gesehene Verhalten anzueignen. Umgekehrt ahmten die Kinder das Verhalten nicht nach, wenn eine Bestrafung auf das Modellverhalten folgte. Es wird also deutlich, dass auch hier Belohnung und Bestrafung entscheidenden Einfluss darauf haben, ob Verhalten angeeignet und eingesetzt wird.
Das Beobachten von Modellen kann aber nicht nur zur Aneignung neuer Verhaltensweisen führen, sondern auch bereits gelernte Verhaltensweisen hemmen oder enthemmen. So benennt Breton (1991, S. 50) beispielsweise eine kindliche Phobie vor Hunden, die aus einem traumatischen Erlebnis heraus entstanden ist, also als Ergebnis der klassischen Konditionierung angesehen werden kann. Zeigen die Eltern keinerlei Hemmungen im Umgang mit Hunden, so kann das Kind dieses Verhalten übernehmen und die ursprünglich phobische Verhaltensweise kann dadurch enthemmt werden.
Das Lernen am Modell besteht aus vier Subprozessen, die durch Bandura (1976, S. 24 ff.) folgendermaßen unterteilt werden:
- Aufmerksamkeitsprozesse: Der Beobachter muss den vorgeführten Reaktionen ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen lassen. Nur durch eine differenzierende Beobachtung kann er die einzelnen Merkmale des dargebotenen Verhaltens erkennen.
- Gedächtnisprozesse: Der Beobachter muss die modellierten Ereignisse behalten, um sie später einmal abrufen zu können.
- Motorische Reproduktionsprozesse: Die Ausführung der neu erlernten Verhaltensweisen wird durch symbolische Repräsentationen gesteuert. Die Person muss außerdem über die motorischen Fähigkeiten verfügen, die zur Ausführen des erlernten Verhaltens notwendig sind. x Verstärkungs- und Motivationsprozesse: Die Motivation, das neue Verhalten zu zeigen, hängt, wie oben beschrieben, maßgeblich davon ab, ob positive oder negative Konsequenzen zu erwarten sind.
2.5.2 Kognitive Theorien
Mit Beginn der kognitiven Wende in den 1950-er und 1960-er Jahren wurde deutlich, dass die Lerntheorien keine ausreichende Erklärung für menschliches Verhalten liefern können. In den Mittelpunkt der Betrachtung rückten nun menschliche Kognitionen und so stellte sich heraus, dass diese, neben den Lerntheorien, einen weiteren entscheidenden Anteil an Angstempfinden haben. „Die kognitiven Angsttheorien verstehen Angst als Emotion im Sinne eines physiologischen Erregungszustandes und analysieren primär die mit den Ängsten verknüpften Erwartungen und Bewertungen“ (Morschitzky 2004, S. 311). Doch gibt es auch innerhalb dieser Wissenschaftsrichtung Unterschiede in der Annahme darüber, inwiefern kognitive Prozesse des Menschen Einfluss auf die Entwicklung von Angst haben können. So soll nun eine Vorstellung der kognitiven Modelle nach Lazarus und nach Epstein sowie eines neueren Ansatzes von Beck und Emery erfolgen.
2.5.2.1 Die Angsttheorie nach Lazarus
Ab den 1960-er Jahren entwickelte Lazarus seine Annahmen über die Entstehung von Angst. Nach seinem kognitiv-emotionalen Prozeßmodell versteht sich Angst als „ein möglicher Begleitzustand eines gefahrenbezogenen Informationsverarbeitungsprozesses, ein Korrelat von Streß“ (Sörensen 1993, S. 22). Hier wird bereits deutlich, dass das zentrale Thema im Modell nach Lazarus der Stress ist. Sörensen (1993, S. 22) erklärt, was darunter zu verstehen ist, nämlich ein „Erregungszustand des Organismus, der durch Stressoren ausgelöst wird. Als Stressoren gelten dabei die auf eine Person einwirkenden schädigenden oder aktivierenden Reize.“ Ein Stressor stellt sich umso gefährlicher für die menschliche Gesundheit dar, je schädigender er vom Individuum interpretiert wird. Die Bewertung, die der Mensch vornimmt, ist es also, die darüber entscheidet, in welchem Ausmaß ein Ereignis als Stress auslösend angesehen wird. Diesen Vorgang, bei dem eine Person die Bewertung der Umwelt vornimmt, nennt Lazarus Transaktion. Aber nicht nur bereits eingetretene Ereignisse können bewertet werden, sondern es kann auch eine antizipatorische Bewertung erfolgen. Damit ist gemeint, dass schon die Erwartung einer Beeinträchtigung durch die Analyse von Hinweisreizen als bedrohlich gewertet werden kann (vgl. Krohne 1976, S. 84). So kann beispielsweise alleine die Vermutung eines Soziophobikers später vor einer Gruppe reden zu müssen dafür sorgen, dass er in Angst verfällt. Sörensen (1993, S. 23) erklärt, wodurch die Bewertungen, die eine Person häufig unbewusst trifft, entstehen: „Diese Beurteilung hängt … ab von der sozialen Einbettung eines Menschen, d.h. von der Unterstützung und Anerkennung, die er in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen erfährt. Die soziale Einbettung übernimmt also eine Pufferfunktion in kritischen Lebensereignissen.“
Es wurde deutlich, dass diese Theorie nicht die objektiven Gegebenheiten zum Thema hat, sondern vielmehr die innermenschlich ablaufende Beurteilung einer Situation für das Verhalten eines Menschen verantwortlich macht. Eine Person „reagiert also nicht auf die objektive Situation, sondern auf die subjektiv gedeutete“ (Sörensen 1993, S. 23). Dabei müssen die Reize, die gewertet werden, nicht immer von außen an die Person herangetragen werden, sondern können auch ihren eigenen inneren Prozessen entspringen. Beteiligt am Bewertungsvorgang sind zwei Variablen: die Situationsvariable und die Persönlichkeitsvariable. Die Situationsvariable umfasst Umweltfaktoren, die bewusst oder unbewusst sein können. Sie umschreibt jedoch immer die gesamte Anordnung aller vorhandenen Reize und nicht nur einzelne Elemente. Den Gegensatz dazu bildet die Persönlichkeitsvariable. Sie bezeichnet „das kombinierte Ergebnis der biologischen und kulturellen Herkunft einer Person in Verbindung mit seiner individuellen Geschichte“ (Sörensen 1993, S. 25).
„In jedem Fall muß der Einschätzungsprozeß als permanente Überprüfung und Bewertung von Hinweisreizen angesehen werden, mit denen ein Lebewesen konfrontiert wird“ (Lazarus, Averill & Opton 1977, S. 196). Der Bewertungsprozess wird durch Lazarus in drei Phasen untergliedert:
- Erste Phase (Primary Appraisal): Die Person schätzt ein, ob eine Bedrohung von der gegebenen Situation ausgeht. Dies ist dann der Fall, wenn die Bewertung ergibt, dass ein stressinduziertes Ereignis gegeben ist. Als solches gewertet werden können Schädigungen/Verluste, Bedrohungen und Herausforderungen.
- Zweite Phase (Secondary Appraisal): Die Person schätzt ein, welche Bewältigungsmaßnahmen ihr zur Verfügung stehen. Stellt sie fest, dass ihre Fertigkeiten ausreichen, um die Situation zu händeln, so wird kein Stress entstehen. Er entwickelt sich erst dann, wenn das eigene Handlungsrepertoire nicht ausreicht, um mit der Situation umzugehen. x Dritte Phase (Reappraisal): Die Person nimmt eine Neubewertung der Situation auf Grundlage von Umweltveränderungen oder eigenen Bewältigungsversuchen vor (vgl. Krohne 1996, S. 247 ff.).
Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die oben vorgestellten kognitiven Prozesse.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Der Stressbewältigungsprozess nach Lazarus (Lazarus-Mainka & Siebeneick 2000)
Das kognitive Modell nach Lazarus hat hervorgebracht, dass Angst als Folge von Stress verstanden werden kann. Dieser hat erst dann die Möglichkeit hervorzukommen, wenn eine Situation oder ein Ereignis als bedrohlich interpretiert wird und das Individuum durch subjektive Beurteilungen zu dem Ergebnis gelangt, dass seine eigenen Handlungskompetenzen überstiegen werden.
2.5.2.2 Die Angstkontrolltheorie nach Epstein
Seymour Epstein entwickelte seine Theorie der Angst ab dem Ende der 1960-er Jahre. Im Gegensatz zum kognitiven Ansatz von Lazarus, bei dem die Bewertung eine zentrale Rolle spielt, rückt Epstein die Erwartungen, die Menschen in Hinblick auf Situationen bilden, in den Mittelpunkt der Betrachtung (vgl. Krohne 1976, S. 74). „Die zentralen Begriffe der Theorie sind Erregung (‚arrousal‘ oder ‚excitation‘) und Hemmung bzw. Kontrolle. Angst wird als Spezialfall der Erregung gesehen“ (Krohne 1996, S. 234). Erregung wird dabei von Epstein näher spezifiziert. Eine Erregung ist die Reaktion von Organismen auf Energieeingaben, wobei sie ein gewisses Niveau nicht überschreiten sollte, da dieses vom Organismus als unangenehm empfunden wird. Aus diesem Grund ist es das Bestreben des Organismus, zu hohe Erregungsniveaus zu vermeiden. Es macht einen Unterschied, ob ein Individuum einen kleinen oder einen großen Erregungsanstieg wahrnimmt. Das Ergebnis kleiner Erregungsanstiege ist eine gesteigerte Aufmerksamkeit auf die erregungssteigernden Stimuli. Geht der Erregungsanstieg allerdings zu schnell, dann führt das zu einer Verminderung der Aufmerksamkeit. Weiterhin gibt es das Phänomen der Gewöhnung. Eine Person nimmt bei wiederholter Darbietung eines stimulierenden Reizes nur noch eine geringere Erregungssteigerung wahr als zu Beginn der Reizdarbietung. Dadurch wird die Aufmerksamkeit der Person gesteigert und sie erhält so die Möglichkeit, den Reiz nicht nur auf Grund seiner Intensität zu bemerken, sondern zu überprüfen, worauf die intensive Empfindung eigentlich hinweisen soll. Daraus entwickeln sich dann Erwartungen. Durch diese Erwartungen geraten immer mehr potentielle Quellen eines Erregungsanstiegs in die Aufmerksamkeit der betroffenen Person, was dann letztendlich dazu führen kann, dass es später schon die Erwartungen sind, die zu einem Erregungsanstieg führen, ohne dass tatsächlich angstauslösende Reize vorhanden sein müssen. Um den Organismus allerdings vor einem zu hohen Erregungsniveau zu bewahren, setzt die Hemmung ein. „Mit Hemmung ist dabei der Sachverhalt gemeint, daß die Ausübung einer bestimmten (in diesem Falle auf Angst bezogenen) Reaktionstendenz durch die Ausführung anderer Reaktionen verhindert wird“ (Krohne 1976, S. 80). Sie kontrolliert den Anstieg der Erregung dadurch, dass sie schneller einsetzt, als die Erregung weiter ansteigen kann und hält die Person auf diese Weise davon ab, sich dem erregungsauslösenden Reiz weiter zu nähern. Zur Abwehr von Erregung stehen dem Organismus drei Möglichkeiten zur Verfügung: verhaltensmäßig-motorische Verteidigung (Flucht), psychologische Verteidigung (Abwehrmechanismen) und biologische Verteidigung (z.B. Ohnmacht). Durch den Umgang mit erregungsauslösenden Reizen verändert sich aber die Hemmung des Erregungsanstiegs. Die Wahrnehmung und damit der Erregungsanstieg verschieben sich von der reinen Intensität des wahrgenommenen Reizes auf Reize, die bereits einen Hinweis auf den zu erwartenden Reiz darstellen können. Das führt dazu, dass auch die Hemmung viel früher und viel angepasster einsetzen kann.
Bei der Angstauslösung sind vier Komponenten beteiligt (vgl. Krohne 1976, S. 76 f.). Primäre Überstimulation meint die Intensität und Frequenz angstauslösender Reize. Mit Kognitiver Inkongruität werden unerwartete, neuartige und mehrdeutige Ereignisse bezeichnet, die nicht mit den Erwartungen des Individuums kompatibel sind. Der Begriff der Reaktionsblockierung bezeichnet das Unvermögen des Individuums im Zustand der plötzlich eingesetzten Erregung durch die Situation auf motorischem Wege (Angriff oder Flucht) zu reagieren. Der vorangehende Erregungszustand spielt insofern eine Rolle, da schon vor der Reizdarbietung hocherregte Personen schnell auf ein noch höheres Erregungsniveau geraten können.
Epstein unterscheidet zwischen Furcht und Angst und sieht Angst als eine Weiterentwicklung von Furcht an. Angst kann erst dann entstehen, wenn die Flucht, die bei der Furcht angestrebt wird, wegen einer Blockade nicht umgesetzt werden kann (vgl. Krohne 1976, S. 77). Die Entstehung dieser reaktionshemmenden und angstauslösenden Blockaden gestaltet sich vielfältig. So kann zwischen der Stimulusunsicherheit, der Reaktionsunsicherheit und der Verzögerung einer adäquaten Reaktion unterschieden werden. Bei der Stimulusunsicherheit fehlen der Person entscheidende Informationen über den erregenden Reiz, um mit einer angemessenen Fluchtreaktion darauf reagieren zu können. Bei der Reaktionsunsicherheit zeigt sich die betroffene Person während der Bedrohungssituation unschlüssig, welche Reaktion sie zeigen soll, weil sie nicht bewerten kann, welches die beste Reaktion für diese Situation ist. Möglich ist auch, dass die Person keinerlei adäquate Verhaltensweisen in ihrem Handlungsrepertoire zur Verfügung hat. Letztlich kann auch die Verzögerung einer adäquaten Reaktion einen Umstand darstellen, der Angst erzeugen kann. Das kann dadurch erklärt werden, dass die betroffene Person über einen längeren Zeitraum keine Möglichkeit zum Spannungsabbau hat, da die als bedrohlich gewertete Situation in der Zukunft liegt. Durch diesen andauernden Zustand der Anspannung kann also auch Angst erwachsen.
Zu den Erwartungen, die bei einer häufig wiederkehrenden Konfrontation mit angstauslösenden Reizen entstehen, sei abschließend gesagt, dass sie auf zweierlei Weise Konsequenzen nach sich ziehen können. Zum einen können sie bewirken, dass eine Erweiterung der angstauslösenden Reize erfolgt, dass Betroffene nach einer Zeit also bereits auf Reize, die dem ursprünglich angstauslösendem Reiz ähneln oder ihm zeitlich nah sind, mit einem erhöhten Erregungsniveau reagieren (vgl. Reizgeneralisierung bei der klassischen Konditionierung). Zum anderen werden diese neuen, dem alten Reiz ähnlichen oder zeitlich nahen Reize, stärker gehemmt als davon unabhängige Reize (vgl. Krohne 1976, S. 80).
Epstein geht davon aus, dass Personen den Umgang mit angstauslösenden Reizen erlernen können. „Als eine Konsequenz der Bewältigungsarbeit werden selektive Hemmkontrollen entwickelt“ (Epstein 1977, S. 251). Das geschieht dadurch, dass im Innereren der Person gewissermaßen ein Repertoire an Hemmungen aufgebaut wird, auf das immer dann zurückgegriffen werden kann, wenn angstauslösende Stimuli auftauchen. Durch die vielfach wiederholten Rückgriffe auf den Bestand der Hemmungen weiß der Organismus daher instinktiv, welche Hemmung auf welchen Reiz erforderlich ist und wie stark sie eingesetzt werden muss. Personen mit Angststörungen verhalten sich Epsteins Modell zufolge gegenüber angstauslösenden Stimuli ähnlich wie Personen, die bislang nicht ausreichend mit angstauslösenden Reizen konfrontiert wurden und so keine Routine im Umgang mit ihnen erlangen konnten.
2.5.2.3 Kognitives Modell der Angst nach Beck und Emery
Nach der kognitiven Wende der 1950-er und 1960-er Jahre entwickelten sich neue kognitive Theorien, die ihren Ursprung in den Ausführungen von Lazarus und Epstein nahmen. An dieser Stelle exemplarisch für die neueren kognitiven Theorien soll das Modell nach Beck und Emery aus dem Jahr 1981 vorgestellt werden.
Dieses Modell nimmt zunächst die Definitionen der Begriffe Angst und Furcht vor. Furcht ist nach Beck und Emery (1981, S. 2) die „Bewußtheit und Berechnung einer Gefahr“, Angst hingegen „ein unangenehmer Gefühlszustand und … [eine] physiologische Reaktion die eintritt, wenn Furcht ausgelöst wird“. Die Autoren gehen davon aus, dass Menschen in furchterregende Situationen geraten und dass es vom Vertrauen in die Fähigkeiten sich selbst zu schützen abhängt, in welchem Maße diese Furcht dann von Angst begleitet wird. Situationen, die vom Individuum als sehr traumatisch erlebt werden, können laut Beck und Emery (1981, S. 4) eine „psychische Angstwunde“ hinterlassen. Das Individuum wird die Annahme treffen, erneut in diese furchtauslösende Situation zu geraten. Eine sehr lebendige visuelle Vorstellung dieser Situation wird die Folge sein, wobei die Person sich in einer unrealistischen negativen Art und Weise ausmalen wird, was in dieser Situation alles passieren könnte. Eine Unterschätzung der eigenen Bewältigungsmöglichkeiten geht mit der unrealistischen Vorstellung der gefürchteten Situation einher. Dadurch werden die emotionalen und physiologischen Reaktionen verursacht, die auch in der tatsächlichen Auseinandersetzung mit der Situation aufgetreten sind und in einer solchen Situation auch wieder auftreten würden. Alleine die Vorstellung einer furchterregenden Situation hat nun dieselbe Wirkung wie das tatsächliche Vorhandensein dieser Gefahr. Wiederholen sich diese Angstanfälle, so fürchtet der Mensch nicht mehr nur die auslösende Ursache, sondern auf ähnliche Art und Weise auch die Symptome der Angst. „Die angstauslösenden Gedanken und Vorstellungsbilder scheinen automatisch zu entstehen, automatisch aufzutauchen, ohne daß er sie beherrschen könnte. Seine Furcht generalisiert sich […], und breitet sich auf andere, für gefährlich gehaltene Objekte oder Situationen aus“ (Beck & Emery 1981, S. 4).
[...]
1 Laut http://www.duden.de/duden-suche/werke/dgfw/000/052/Prkordialangst.52128.html bezeichnet dieser Begriff „die mit einem Angstgefühl verbundene Beklemmung der Herzgegend“ (Zugriff am 19.11.2008, vgl. Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG. (2006))
- Arbeit zitieren
- Dipl.Soz.Arb./Soz.Päd Sandra Behr (Autor:in), 2009, Psychologische Grundbedürfnisse und ihre Bedeutung für die Entstehung kindlicher Angststörungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144295
Kostenlos Autor werden






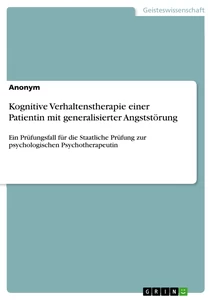


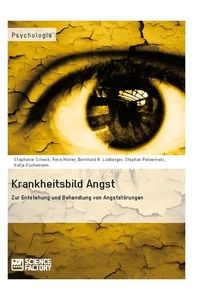












Kommentare