Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Gegenstand der Arbeit
1.2 Ziel der Arbeit
1.3 Aufbau der Arbeit
2. Raum als sozialwissenschaftlicher Gegenstand
2.1 Absolut(istisch)e und relat(ivistisch)e Raumvorstellungen
2.2 Materialistische und konstruktivistische Raumvorstellungen
2.3 Der relationale Raumansatz nach Löw
2.3.1 Die Bausteine des Raumes
2.3.2 Die Dualität von Räumen
2.3.3 Raum und soziale Ungleichheit
3. Segregation in (städtischen) Wohngebieten
3.1 Was heißt Segregation?
3.2 Mechanismen des Wohnungsmarktes
3.3 Quartiere der Ausgrenzung
4. Raumbilder
4.1 Der Globale/Lokale Raum
4.2 Der Abgekoppelte/Aufgewertete Raum
4.3 Der (De)Regulierte Raum
4.4 Der Riskante/Sichernde Raum
5. Sozialraumorientierung als Fachkonzept Sozialer Arbeit
5.1 Funktionsebenen der Sozialraumorientierung: Das SONI-Schema
5.2 Das fachlich-ethische Fundament sozialraumorientierter Sozialer Arbeit
5.2.1 Orientierung an Interessen und am Willen
5.2.2 Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe
5.2.3 Konzentration auf die Ressourcen der Menschen und des Sozialraums
5.2.4 Zielgruppen- und bereichsübergreifende Sichtweise
5.2.5 Kooperation und Koordination
5.3 Das Sozialraumbudget
5.3.1 Die Grundidee
5.3.2 Rechtliche Streitpunkte
5.4 Die Family Group Conference
6. Quartier(s)management - ein Instrument integrierter Stadt(teil)entwicklung
6.1 Die Funktionsebenen des Quartiermanagements
6.2 Die (Gesamt)Steuerung von Quartiermanagement
7. Schlussbetrachtung
7.1 Zusammenfassung
7.2 Schlussfolgerungen
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Das „Weitwinkelobjektiv“: SRO als Erweiterung und Überschreitung des bereichsbezogenen Blickfeldes
Abbildung 2: Der „Methodenmix“: SRO als Gesamtstrategie, die bereichsspezifische Methoden miteinander verknüpft
Abbildung 3: Zielsystematik im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung
Abbildung 4: Wirksamkeitsmessung operativer Maßnahmen der Stadt(teil)entwicklung
1. Einleitung
Formales: Die zu treffende Entscheidung zwischen einer „gender-sensitiven“ und kompak- ten Schreibweise fälle ich zugunsten Letzterer. Sofern es an geschlechtsneutralen Begriffen mangelt, ist die durchgängige Verwendung der (bloß grammatisch zu verstehenden) männ- lichen Form bei der Nennung von Personen(gruppen) nur deshalb vorzuziehen, weil sie die kürzere ist. Als Verfasser dieser Diplomarbeit habe ich Personen weiblichen Geschlechts stets mitgedacht und fordere den Leser (also auch die Leserin!) hiermit ausdrücklich auf, bei der Lektüre Selbiges zu tun! Ebenfalls zugunsten von Prägnanz werden oft Abkürzun- gen verwendet, die alle im Abkürzungsverzeichnis aufgelistet und nachschlagbar sind.
1.1 Gegenstand der Arbeit
„Sozialraumorientierung“ (SRO) und „sozialraumorientierte Soziale Arbeit“ (SRA) bilden als Synonyme den Oberbegriff dieser Diplomarbeit. SRO/SRA ist vorerst nur ein Schlagwort, Etikett, das es mit Inhalt und „Leben“ sinnig zu füllen, aber nicht zu überfüllen und vor ideologischen, sozialarbeiterische1 Werte konterkarierenden Aufladungs-/Vereinnah- mungsversuchen effektiv zu schützen gilt.
Spätestens seit Ende der 1990er löste die Vokabel eine breite Debatte in sozialpädago- gischen und daran angrenzenden, insbes. sozialpolitischen, -rechtlichen und -administrati- ven Fachdiskursen aus (s. etwa FoEh 2000; SPI 2001; Merten 2002b),2 deren Diskussions- niveau leider oft zu wünschen übrig ließ. So scheinen einige Autoren die Fachdebatte eher zu Selbstdarstellungszwecken zu missbrauchen als darum bemüht, mit ihren Ausführungen zur Verbesserung sozialarbeiterischer (Jugendhilfe)Leistungen zugunsten hilfesuchender Menschen tatsächlich beizutragen. Viele Einwände gegen die SRO basieren „auf unzuläs- sigen Generalisierungen, der Dramatisierung von Teilaspekten und der mutwilligen Sprachverwirrung. Hier ist die wissenschaftliche Diskussion weder dem akademischen Erkenntnisfortschritt und erst recht nicht der Praxis Sozialer Arbeit dienlich.“ (Schönig 2008: 21) Zu Recht wertet Kleve (2004: 21) die Argumentationen der Juristen Baltz, Krölls und Wiesner3 als „unangemessen“, die sich alle sehr einseitig auf ein kleines, rechtlich durchaus kritisierbares Teilsegment sozialräumlicher Arbeit (das Sozialraumbudget) konzentrieren und daraufhin ein insgesamt gut begründetes, präzise ausformuliertes sozialarbeiterisches Gesamtkonzept gänzlich ablehnen. In seiner Kritik an der Sozialraumbudgetierung diffamiert Krölls (2002) jegliches Bemühen, Jugendhilfeleistungen sparsam zu erbringen, als Angriff auf sozialarbeiterisch-fachliche sowie rechtlich verbriefte (Min- dest)Standards. Ein derartiges Pauschalurteil verkennt oder will verkennen, dass mit ganz unterschiedlichen Effekten zu rechnen ist, je nachdem, ob
- dem Jugendamt Sparziele seitens der Verwaltungsspitze befehlsartig „von oben“ diktiert oder amtsintern vom Personal selbst in einem diskursiven Prozess auf Basis strategisch- fachlicher Erwägungen beschlossen wurden,
- eingesparte Mittel im Jugendamt (z. B. zur Finanzierung sog. „Zusatzleistungen“ fürs Klientel, Fachkräfte-Fortbildungen etc.) verbleiben dürfen oder von der Verwaltungs- spitze einfach einkassiert und anderweitig verwendet werden,
- zuletzt erzielte Sparerfolge die Aberkennung des Jugendhilfeetats in bisheriger Höhe bewirken oder bei künftiger Haushaltsverteilung seitens der Verwaltungsspitze aner- kannt und entsprechend honoriert werden.
Angesichts einer z. T. leider sehr undifferenziert und hitzig geführten Fachdebatte (vgl. Merten 2002a: 9 f.) ist zuallererst zu klären, was SRA im Kern sein soll. Als energische Fürsprecher einer stärker am Sozialraum orientierten Form Sozialer Arbeit haben sich v. a. Budde, Früchtel und Hinte profiliert und sich als (Mit)Verfasser zahlreicher einschlägiger Publikationen besonders intensiv in SRO-Diskurse eingebracht (s. Literaturverzeichnis). Budde und Früchtel, tätig als Lehrende am Fachbereich Soziale Arbeit der Universität Bamberg und oft als Autorenduo in Erscheinung tretend, stimmen mit Hinte, dem Leiter des Essener Instituts für Stadtteilbezogene Soziale Arbeit und Beratung (ISSAB)4, darin überein, dass SRO in der Tradition der Gemeinwesenarbeit (GWA) steht (vgl. Früchtel u. a. 2007b: 39; Hinte 2007c: 99). GWA definiert Oelschlägel, der neben Hinte den bundesdeutschen GWA-Diskurs seit Mitte der 1970er maßgeblich geprägt hat (vgl. Lüttringhaus 2007: 15), wie folgt:
„Gemeinwesenarbeit ist eine sozialräumliche Strategie, die sich ganzheitlich auf den Stadtteil und nicht pä- dagogisch auf einzelne Individuen richtet. Sie arbeitet mit den Ressourcen des Stadtteils und seiner BewohnerInnen, um seine Defizite aufzuheben. Damit verändert sie allerdings auch die Lebensverhältnisse und Handlungsspielräume der BewohnerInnen.“ (Oelschlägel 2004: 11)
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde GWA - erste bundesdeutsche GWA- Vorläuferprojekte hatten die NS-Zeit nicht überstehen können (vgl. Oelschlägel 2001: 655 f.) - als US-amerikanisches und niederländisches Import hierzulande als sog. „Dritte Methode“ der Sozialarbeit eingeführt (vgl. Oelschlägel 2002). Im klassischen Berufsver- ständnis teilt sich Soziale Arbeit in drei (Haupt)Methoden/Arbeitsfelder auf: Ein- zel(fall)hilfe, Gruppenarbeit und GWA. Besonders in Deutschland entwickelte sich die Einzelfallhilfe im Zuge der allmählichen Professionalisierung Sozialer Arbeit zur domi- nanten Arbeitsmethode. Der einzelne Fall stand zusehends „im Zentrum von Hilfean- spruch, Zuständigkeiten und Finanzierung und damit der gesamten Organisation sozialer Hilfen und Leistungen, - wobei ‚der Fall’ oftmals nicht einmal eine Person, sondern ein bestimmtes Problem dieser Person gewesen ist“ (Riege 2007: 376). Im Zuge der Studen- tenbewegung wurde scharfe Kritik an der Einzelfallhilfe laut. „Ihr wurde vorgeworfen ent- politisierend und individualisierend zu wirken, da sie die Ursachen sozialer Not aus ihrem Handlungskonzept ausklammere und nur Symptome bekämpfe.“ (Ehrhardt 2007: 645) Als Strategie gesellschaftsverändernder Praxis erlangte GWA nun erstmals stärkere Beachtung. „Es kam vermehrt zu GWA-Projekten insbes. in sog. sozialen Brennpunkten, in denen [...] über die GWA nicht nur eine Milderung der individuellen Problemlagen erzielt werden sollte, sondern eine grundsätzliche Veränderung menschlicher Lebensbedingungen inten- diert wurde.“ (Ebd.)
Die Blütezeit der GWA währte aber nur kurz. Viele zunächst erfolgreich gestartete GWA-Projekte scheiterten langfristig an chronischer Finanzierungsschwäche, da sie keine Lobby in Politik und Interessenverbänden hatten und die Projektakteure es aufgrund ihrer politischen, dem Establishment feindlich gesonnen Grundhaltung entweder kategorisch ablehnten oder schlichtweg damit überfordert waren, eine solche gezielt aufzubauen:
„[P]erspektivisch gab es kein tragendes gesellschaftliches Umfeld für einen Arbeitsansatz, der jenseits leistungsgesetzlicher Bestimmungen die Interessen der Wohnbevölkerung eines Quartiers in den Vordergrund stellte und damit erstmal fast alle gegen sich hatte: Parlamentarische Instanzen, die nicht mehr genau wussten, wen sie nun vertreten sollten; die Jugend- und Sozialbürokratie, die das Chaos heraufziehen sah, wenn man dem vermeintlichen Anarchismus benachteiligter Bevölkerungsgruppen Raum ließ; und nicht zuletzt die Konzerne der freien Träger [...], die angesichts ihrer Abhängigkeit von staatlichen Geldern möglichst vermieden, irgendwelche Aktivitäten subversiver Art zu unterstützen.“ (Hinte 2007c: 7 f.)
Um die GWA aus ihrer prekären Lage zu befreien, veröffentlichten Boulet, Krauss und Oelschlägel 1980 ihr Buch „Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip - eine Grundlegung“. In diesem plädieren sie dafür, GWA nicht länger als isolierte, dritte Sozialarbeitsmethode, sondern als eine Grundorientierung professionellen sozialarbeiterischen Handelns zu be- greifen, als „eine grundsätzliche Herangehensweise an soziale Probleme, wo auch immer im Bereich sozialer Berufsarbeit im weitesten Sinne“ (Oelschlägel 2007 1984: 69). Ob- wohl dieser Vorschlag konzeptionell durchdacht und theoretisch gut begründet war, fand er in der sozialarbeiterischen Gemeinde kaum Beachtung. Die Vokabel GWA war bereits zu stark in Verruf geraten: „Mit GWA assoziierte man dogmatische Linke aus der 68er Zeit, unbelehrbare Besserwisser/innen auf Seiten vermeintlich Sozialhilfe missbrauchender Be- troffener oder schlichtweg Gutmenschen ohne Bodenhaftung.“ (Hinte 2007c: 9)
Um gemeinwesenarbeiterischem Gedankengut dennoch zum Durchbruch zu verhelfen, nahmen Hinte, Metzger-Pregizer und Springer einen Begriffswechsel vor. Am ISSAB ent- wickelten sie 1982 das Konzept „Stadtteilbezogene Soziale Arbeit“, welches später in „So- zialraumorientierte Soziale Arbeit“ umbenannt wurde5. Dieses nahm „einige Diskussions- linien, Erkenntnisse und methodische Prinzipien aus der GWA auf, präzisierte, ergänzte und erweiterte sie und zwar mit Blick auf die Anschlussfähigkeit zur institutionellen sozia- len Arbeit“ (ebd.).
Zwecks begrifflicher Klarheit macht es Sinn, GWA heute ganz im klassischen Sinne als abgegrenztes Arbeitsfeld und SRA/SRO ganz im Sinne des von Boulet u. a. propagierten „Arbeitsprinzips GWA“ als grundlegende Orientierung oder umfassende Strategie Sozialer Arbeit zu begreifen. „Im Arbeitsfeld GWA geht es heute um die Organisation von projekt- und themenunspezifischen Prozessen in Wohnquartieren [...] anhand direkt geäußerter [...] Interessen der Wohnbevölkerung mit dem Ziel einer ‚Grundmobilisierung’ eines Wohn- quartiers, die den ‚Humus’ für größere Einzelprojekte darstellt.“ (Ebd.: 11) Das Fach-, Rahmen- oder Hintergrundkonzept SRO kann dagegen in jedem Arbeitsfeld Sozialer Ar- beit realisiert werden und findet derzeit Beachtung „in der Fallarbeit (Hin- te/Litges/Springer 1999), der offenen Jugendarbeit (Deinet 2005), den Hilfen zur Erzie- hung (Peters/Koch 2004) und dem Quartiermanagement (s. Grimm/Hinte/Litges 2004)“ (ebd.: 11).
1.2 Ziel der Arbeit
Ziel dieser Diplomarbeit ist zu erörtern, wie eine am Sozialraum orientierte Soziale Arbeit (SRA) zur Schaffung menschenwürdiger Lebensbedingungen im Kontext der bundesdeut- schen Gesellschaft wirksam beitragen kann. Die Eingrenzung dieser Fragestellung auf die Situation in Deutschland soll Menschen in anderen Ländern ihr Recht auf ein Leben unter derartigen Bedingungen keineswegs absprechen. Vielmehr erscheint mir diese Fokussie- rung geboten, weil die professionelle, institutionelle Soziale Arbeit eng an den national- staatlichen Kontext gebunden ist. Ihre Gestaltungsmöglichkeiten hängen entscheidend da- von ab, welche Rolle ihr von der Sozialpolitik (dies schließt die Sozialgesetzgebung ein) zugewiesen und mit welchen Finanzmitteln sie von derselben ausgestattet wird. So defi- niert Schönig (2008: 16) die Soziale Arbeit „als besonderes Instrument der praktischen [insbes. der kommunalen; W. W.] Sozialpolitik“. Was ist nun unter Menschenwürde zu verstehen?
„Nach der vorherrschenden rechtsphilosophischen und juristischen Interpretation ist die Menschenwürde ein Wert der Person an sich, der nicht erworben werden muss und nicht verloren gehen kann. Sie macht das Wesen des Menschen aus. [...] Das Grundgesetz verpflichtet den Staat umfassend auf die Würde des Men- schen. Und das bedeutet für die Praxis staatlichen Handelns, wozu im weiteren Sinne auch die Praxis der Sozialen Arbeit gehört, von der großen Regierungspolitik bis zum letzten Verwaltungsakt, dass staatliches Handeln für den Menschen da ist und nicht umgekehrt der Mensch für den Staat.“ (Kappeler 2006: 7 f.; Herv.: W. W.)
Aus diesem „Wert der Person an sich“ sind die Menschenrechte abgeleitet, die ihm unver- letzlich und unveräußerlich unabhängig von Staatszugehörigkeit und über Staatsgrenzen hinweg zustehen sollen (vgl. Ebsen/Welti 2007: 642). Menschenwürdige Lebensbedingun- gen bezeichnen ein materiell-soziales Umfeld, das es Menschen ermöglicht, ihr Leben auf persönlich zufriedenstellende Weise zu führen, es „nach ihren eigenen Vorstellungen“ (Kappeler 2006: 4) zu gestalten. Laut IFSW/ISSAW (2004: 2) sollen Sozialarbeiter vier Grundprinzipien beachten, um der Würde ihrer Klienten gerecht zu werden: (1) das Recht der Betroffenen auf Selbstbestimmung achten, (2) ihre Teilhabechancen verbessern, (3) sie ganzheitlich in ihren sozialen Beziehungen wahrnehmen und (4) ihre Stärken anerkennen und fördern. Diese Prinzipien lassen sich zu folgender These verdichten: Die zentrale Auf- gabe der Sozialen Arbeit besteht darin, ihren Klienten zu einer Erweiterung ihrer Hand- lungsoptionen zu verhelfen, sodass sie ihr Leben auf persönlich zufriedenstellende(re) Weise führen können (vgl. Kessl/Reutlinger 2007: 26). Je nach Situation sind dabei ganz unterschiedliche sozialarbeiterische Vorgehensweisen, Kompetenzen und Handlungsstra- tegien gefragt. Soziale Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle „zwischen System und ‚Le- benswelt’ bzw. zwischen öffentlicher und privater Sphäre“ (Kleve 2007: 131). Sie muss sich sowohl auf die Logiken des politisch-administrativen Systems als auch auf jene des Alltags benachteiligter Privatbürger einlassen. Sie steht dabei vor der großen Herausforde- rung, sowohl
- eine system- und gesellschaftskritische (politische) als auch
- eine lebenswelt- und subjektbezogene (beraterisch-therapeutische)
Perspektive einzunehmen und diese beiden Sichtweisen zu einer sinnvollen Handlungsstra- tegie zu verknüpfen (vgl. Wolff 2002). Wenn Soziale Arbeit Erstere zulasten Letzterer fokussiert, steht sie in der Gefahr, den einzelnen Menschen mit seinen drängenden Nöten, seinem konkreten Hilfebedarf aus dem Blick zu verlieren und im Stich zu lassen. Wenn sie Letztere zulasten Ersterer fokussiert, gerät sie in Gefahr, strukturelle, politisch beheb- oder reduzierbare Missstände und Ungerechtigkeiten zu übersehen und sich als Erfüllungsgehil- fin einer sozialarbeiterischen Werten zuwider handelnden (Sozial)Politik missbrauchen zu lassen. Die SRA wird sich also letztlich daran messen lassen müssen, wie gut es ihr ge- lingt, diese beiden Blickrichtungen so miteinander zu einer Gesamtstrategie zu verbinden, dass sie zur Schaffung menschenwürdiger Lebensbedingungen im gesamtgesellschaftli- chen Kontext mit ihren Möglichkeiten entscheidend beiträgt. Dies gilt v. a. deshalb, weil die SRO - wie das 1980 propagierte Arbeitsprinzip GWA - den Anspruch erhebt, Basis- konzept der gesamten Sozialarbeit zu sein.
1.3 Aufbau der Arbeit
Im direkt anschließenden, zweiten Kapitel erfolgt eine Bestimmung des (Sozi- al)Raumbegriffs aus sozialwissenschaftlicher Perspektive. Viele sozialpädagogische Bei- träge zur SRO rekurrieren gerne auf das facettenreiche Raummodell der Soziologin Löw, ohne es aber einem tiefergehenden professionsinternen Fachdiskurs durch hinreichend sorgfältige Aufbereitung zugänglich zu machen (vgl. Hinte 2007a: 32; Früchtel u. a. 2007b: 199 ff.; Grimm 2007: 78 ff.). Um diese Lücke zumindest zu verkleinern, wird eine ausführlichere zusammenfassende Darstellung dieses Modells vorgenommen. Im Fokus stehen dabei jene Aspekte gesellschaftlichen Zusammenlebens, die bzgl. menschenwürdi- ger Lebensbedingungen besonders relevant, d. h. hinderlich oder förderlich erscheinen.
Auf Basis stadtsoziologischer Befunde befasst sich das dritte Kapitel mit dem Phänomen sozialräumlicher Segregation in Wohngebieten und dient damit der Konkretisierung der im vorangegangenen Kapitel durchgeführten Begriffsbestimmung.
Das vierte Kapitel nimmt eine Außenperspektive auf den sozialarbeiterischen SRO- Diskurs ein. Es zeigt auf, in welchem gesellschaftspolitischen Klima dieser aktuell stattfin- det und welche Raumbilder deshalb in diesem dominieren. Damit bildet das Kapitel die Überleitung von einem primär sozialstrukturellen hin zu einem primär sozialpädagogischen Blickwinkel auf Soziale Räume.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der SRO als Fach-, Hintergrund- oder Rahmenkon- zept einer ganzheitlich-integrativen Form Sozialer Arbeit und stellt damit den wichtigsten Teil, das „Herzstück“ dieser Diplomarbeit dar. Neben fachlich-ethischen Maximen, der sog. „Philosophie“ des Konzepts, werden hier auch steuerungs- und finanzierungstechni- sche sowie damit einhergehende juristische Fragen thematisiert, zu denen es sehr kontro- verse Ansichten gibt.
Das sechste Kapitel beschreibt das Quartiermanagement (QM), welches im Rahmen sog. „Programme integrierter Stadt(teil)entwicklung“ vielerorts vermehrt eingerichtet wird, um bauliche Sanierungsprojekte durch (vermeintliche) sozialarbeiterische Aktivierungs- und Beteiligungsmaßnahmen der ansässigen Bürger zu ergänzen und so die Lebensqualität in als benachteiligt eingestuften Wohngebieten zu steigern. Interessant ist, dass dabei oft auch Prinzipien alter GWA-Ansätze explizit oder implizit Beachtung finden.
Schließlich werden im siebten und letzten Kapitel die Kerngedanken dieser Arbeit zusammengefasst und einige Schlussfolgerungen gezogen.
Im Anhang findet sich zudem ein E-Mail-Interview, welches ich mit Wolfgang Hinte im April 2008 im Rahmen meiner Recherchen zur vorliegenden Diplomarbeit geführt habe. Hinte beantwortet in diesem einige Fragen, über die die mir bekannte Literatur nur wenig Aufschluss bot.
2. Raum als sozialwissenschaftlicher Gegenstand
„Will sich Soziale Arbeit an die Sozialräume ihrer [...] Adressaten annähern, benötigt sie eine Vorstellung davon, was Sozialräume sind [...], wie gesellschaftliche Verhältnisse den Sozialraum bestimmen, wie sich im Sozialraum Machtstrukturen und soziale Hierarchien abbilden [...], wie das Gesellschaftliche ein räumliches Gesicht bekommt und welche gesellschaftlichen Grenzen dabei in den Räumen markiert wer- den.“ (Lang u. a. 2005: 9)
Eine Auseinandersetzung mit dem Thema Raum findet in sozialwissenschaftlichen Diskur- sen erst seit den 1990ern in verstärktem Maße statt (vgl. Kessl/Reutlinger 2007: 20). Bis dahin war vom Raum meist nur implizit die Rede, d. h. im Zusammenhang mit Kategorien wie Stadt, Gemeinde oder Nation, auf die man i. d. R. das Hauptaugenmerk richtete. Auf die Entwicklung eines speziell sozialwissenschaftlichen Raumbegriffs wurde lange Zeit verzichtet, weil man sich von Raumanalysen offensichtlich keinen nennenswerten Er- kenntnisgewinn in Bezug auf die Erklärung sozialer Phänomene versprach. Sofern Sozialwissenschaftler den Gegenstand Raum dennoch implizit, d. h. als etwas eher Nebensächliches, in ihre Überlegungen einbezogen, geschah dies zumeist in Anlehnung an philosophische oder physikalische Denktraditionen. So liegen in den Sozialwissenschaften seit der Aufklärung zwei konkurrierende Raumvorstellungen vor (vgl. ebd.), die ihre Wurzeln im „philosophisch-physikalischen Diskurs“ (Löw 2001: 153) haben.
2.1 Absolut(istisch)e und relativ(istisch)e Raumvorstellungen
Kessl/Reutlinger (2007: 21) bezeichnen diese beiden konkurrierenden Auffassungen ein- fach als „absolute“ und „relative Raumvorstellungen“, während Löw (2001: 24) sie - et- was umständlicher - als „absolutistische“ und „relativistische Raumvorstellungen“ tituliert. Löw nimmt damit bereits bei der Benennung dieser beiden tradierten raumtheoretischen Ansichten eine explizite Wertung vor, die Kessl/Reutlinger mit ihr teilen: „Sowohl die Vorstellung des absoluten Raumes [...] als auch der Gegenentwurf des relativen Raumes [...] erscheinen verkürzt. Für eine systematische Beschreibung von Räumlichkeit sollte daher versucht werden, sich weder ausschließlich auf die eine noch auf die andere Position zu beziehen.“ (Kessl/Reutlinger 2007: 27) Weil ich mich dieser Kritik anschließe, werde ich im Folgenden konsequenterweise auch die von Löw gewählten Bezeichnungen über- nehmen.
Absolutistische Raumvorstellungen gehen von einem sog. „Container-Raum“ aus. Raum wird als ein Behälter angesehen, in dem sich alle Körper (alle Gegenstände, alle Lebewesen) befinden. Dabei wird ein Dualismus, d. h. eine Trennung zwischen Raum und Körpern behauptet, wobei „der Raum als eine den Körpern übergeordnete Realität“ (Früch- tel u. a. 2007b: 196) gilt.
Relativistische Denktraditionen schreiben dem Raum keine eigenständige, von den Körpern losgelöste Existenz zu, sondern begreifen ihn als das „alleinige Ergebnis der Beziehungsverhältnisse“ (Löw u. a. 2007: 9; Herv.: W. W.) der Körper. Die (räumliche) Lage eines Körpers kann nur im Verhältnis zu anderen Körpern bestimmt werden und ist zudem vom jeweils eingenommenen Blickpunkt eines Betrachters abhängig. „Je nachdem von welchem Punkt aus man die räumliche Lage eines Körpers betrachtet, kommt man zu einer anderen Verortung.“ (Kessl/Reutlinger 2007: 21)
2.2 Materialistische und konstruktivistische Raumvorstellungen
Raum als sozialwissenschaftlichen Gegenstand und somit als „Sozialraum“ oder „Sozialen Raum“ zu betrachten bedeutet, ihn auf die sozialen Praktiken der Spezies „Mensch“ zu beziehen. Zwischen beiden Kategorien (Raum und sozialen Praktiken) lässt sich ein Zu- sammenhang herstellen, indem man folgender Frage nachgeht: Stellt Raum eine starre, vorgegebene Ordnung bzw. Rahmenbedingung für soziale Aktivitäten dar oder ist er „menschengemacht“ und kann deshalb von Menschen jederzeit verändert oder (auf sehr ähnliche Weise) stetig reproduziert werden? Wer Ersteres bejaht, vertritt Kessl/Reutlinger zufolge einen „materialistischen“ Standpunkt. Wer dagegen von Letzterem ausgeht, nimmt diesen Autoren zufolge eine „konstruktivistische“ Sichtweise ein (vgl. ebd.: 25). Beide raumtheoretischen Standpunkte weisen sowohl Stärken als auch Schwächen (blinde Fle- cken) auf:
- Im Verständnis einer konstruktivistischen Raumtheorie tragen „alle Gesellschaftsmit- glieder [...] - wenn auch im unterschiedlichen Maße - dazu bei, Räume zu konstituie- ren. Somit wären auch arme und/oder erwerbslose Gesellschaftsmitglieder als ein Teil derjenigen zu verstehen, die diese Konstruktionsprozesse vollziehen. Nun zeigen aber die sozial immens ungleich verteilten Möglichkeiten, solche Konstruktionsprozesse zu beeinflussen oder sich überhaupt merklich an ihnen beteiligen zu können, dass diese Konstruktionsprozesse unter bestimmten sehr wirkmächtigen Einflussgrößen realisiert werden müssen. Es stellen sich also beispielsweise folgende Fragen, auf die konstrukti- vistische Theorien nur unzureichend Antwort geben können: Warum können manche Akteure deutlicheren Einfluss auf die Ordnungen des Räumlichen und die Rede vom Raum nehmen als andere? In welcher Weise erwerben bestimmte Akteursgruppen die- sen Einfluss und andere bleiben faktisch unsichtbar?“ (Ebd.) Konstruktivistische Sichtweisen neigen zur Überbetonung menschlicher Einwir- kungsmöglichkeiten auf das Räumliche und übersehen dabei leicht, dass sich (mitunter) infolge menschlicher Aktivitäten (z. B. durch das Festlegen von Staatsgrenzen, das Be- schließen von Gesetzen, den Bau von Gebäuden, die ästhetische Gestaltung von Plätzen und durch Umweltzerstörung) auch Raumordnungen manifestieren, die die Handlungs- möglichkeiten einzelner Personen, gesellschaftlicher Teilgruppen oder aller Gesell- schaftsmitglieder erweitern aber eben auch massiv einschränken können.
- In materialistischen Ansätzen stehen dagegen die „manifestierten Raumordnungen“,
sprich: „die räumlichen Arrangements, die historisch entwickelt wurden und dadurch aktuell soziale Prozesse in einer bestimmten Weise beeinflussen“ (ebd.), im Mittelpunkt theoretischer Überlegungen. Das bedeutet, dass sich materialistische Raumtheoretiker in erster Linie mit folgender Frage befassen: Welchen Einfluss üben die bestehenden räumlichen Ordnungen auf die sozialen Zusammenhänge der Menschen aus? „Von absolut grundlegender Bedeutung erscheinen aus dieser Perspektive heraus die ökonomische Ausstattung armer oder erwerbsloser Gesellschaftsmitglieder, ihre prekarisierte Wohnsituation oder die für sie fehlenden oder nur schwer zugänglichen sozialinfrastrukturellen Angebote. Eine raumbezogene Soziale Arbeit, die sich einer materialistischen Sichtweise anschließt, müsste sich daher vor allem für solche Ausstattungsfragen interessieren und zuständig erklären.“ (Ebd.: 25 f.)
Materialistische Ansätze neigen - quasi in Umkehrung zu konstruktivistischen Per- spektiven - zur Überbetonung einer vorgegebenen Ordnung, die menschliches Handeln beeinflusst und strukturiert, und somit zugleich zur Vernachlässigung sowie Unter- schätzung der Möglichkeiten des Menschen, auf bestehende Ordnungen (verändernd oder stabilisierend) einwirken zu können. Materialistische Raumtheorien können fol- gende Fragen nicht oder nur unzureichend beantworten: „Wie kommt es zur ungleichen Verteilung der Zugangs- und Beteiligungsmöglichkeiten, und welche Konstruktionsprozesse haben zur aktuellen Ordnung des Räumlichen geführt?“ (Ebd.: 26)
Beiden raumtheoretischen Ansätzen ist also eine gewisse Einseitigkeit zu bescheinigen. Der forschende Blick wird entweder auf die menschlichen Einwirkungsmöglichkeiten oder aber auf die manifestierten Raumordnungen verengt. Weil zwischen diesen beiden Ebenen jedoch ein ständiges Wechselspiel und somit auch ein Abhängigkeitsverhältnis besteht, bedarf es einer Verschränkung bzw. Synthese zwischen materialistischen und konstrukti- vistischen Raumauffassungen, um soziale Phänomene vollständig(er) in den Blick nehmen zu können. Kessl/Reutlinger bezeichnen eine derartige Synthese als „relationale[n] Raum- begriff“ (ebd.: 27), weil sie - so die Begründung der Autoren - ihren Fokus auf die Wech- selbeziehung, sprich: die Relation, zwischen beiden Ebenen („menschlichen Konstrukti- onsleistungen“ und „gegebenen Rahmenbedingungen“) richten müsste.
Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive hat sich Löw (2001) besonders intensiv mit raumtheoretischen Fragen auseinandergesetzt und ein gleichsam facettenreiches wie komplexes relationales Raumkonzept vorgelegt, welches - wie noch zu zeigen sein wird - die von Kessl/Reutlinger aufgestellte Forderung nach einer Synthese zwischen konstruktivistischen und materialistischen Annahmen einzulösen vermag.
2.3 Der relationale Raumansatz nach Löw
Löw u. a. (2007: 51) nehmen eine erste Konturierung des Raumbegriffes vor, indem sie die Begriffe „Raum“ und „Zeit“ einander zunächst kontrastierend gegenüberstellen. Raum bezeichnet den Autoren zufolge „eine Organisationsform des Nebeneinanders“, während Zeit „eine Formation des Nacheinanders“ darstellt. Raum spannt sich zwischen einer Mehrzahl von gleichzeitig nebeneinander existierenden Objekten auf und bezeichnet damit eine „Relation zwischen gleichzeitigen Platzierungen“ (ebd.). Raum kann geradezu „als der Inbegriff für Gleichzeitigkeiten“ (ebd.) angesehen werden, weil die Objekte/Körper oder „Bausteine“ (Löw 2001: 157), die den Raum konstituieren, „unaufhörlich in Bewe- gung sind“ (ebd.: 131).
Löws Raumdefinition, die sie in ihrem 2001 erschienen Grundlagenwerk „Raumsoziologie“ ausführlich entfaltet und m. W. dort erstmalig vorlegt, lautet:
„Raum ist eine relationale (An)Ordnung sozialer Güter und Menschen (Lebewesen) an Orten.“ (Löw 2001: 224; Kursivdruck i. O.).
Diese Definition gilt es, nun v. a. in solchen Komponenten zu beleuchten, die einen Er- kenntnisgewinn hinsichtlich der (sozialpolitisch wie -pädagogisch bedeutsamen) Frage nach der Herstellung menschenwürdiger Lebensbedingungen vermuten und erhoffen las- sen. Vorweg aber noch ein Hinweis: Ähnlich wie bei „Raum“ und „Zeit“ nimmt die Auto- rin auch eine grundlegende analytische Trennung zwischen den Begriffen „Raum“ und „Ort“ vor. Während Raum einen eher qualitativen Aspekt (eine Verknüpfung sozialer Gü- ter und Menschen, also sowohl ein Beziehungsgefüge als auch einen sozialen Prozess) darstellt, bezeichnet Ort eine eher quantitative Größe (ein ziemlich eindeutig mess- und abgrenzbares Territorium; einen kleinen, klar umrissenen und benennbaren Teil der Erd- oberfläche). Orte stellen den geografischen Untergrund sozialer Prozesse dar. Räume ent- stehen und wandeln sich an bzw. „auf“ Orten. Orte erfahren durch Räume eine symboli- sche Besetzung, was Aussagen zeigen wie: „Dies ist der Ort (die Stelle, der Platz), an dem einst die Berliner Mauer stand.“ Eine derartige symbolische Aufladung ist jedoch nicht „naturgegeben“, sondern vielmehr an (inter)subjektive menschliche Wahrnehmungs- und Deutungsprozesse gebunden (vgl. ebd.: 198 ff.).
2.3.1 Die Bausteine des Raumes
„Soziale Güter“ und „Menschen“6 sind in der vorliegenden Definition als Elemente, Körper oder Bausteine zu begreifen, aus denen sich ein Raum zusammensetzt. Löw betont, dass Raum erst dadurch entsteht, dass ein Beobachter zwischen diesen Elementen einen Zusammenhang, eine Verbindung, Beziehung oder Relation herstellt bzw. wahrnimmt. Weil Raum auf der „Relationenbildung“ zwischen einzelnen Elementen beruht, bezeichnet die Autorin ihr Raummodell auch als relational (vgl. ebd.: 156).7
Was ist mit „sozialen Gütern“ gemeint? Löw u. a. (2007: 64) sprechen nicht von Dingen oder Gegenständen, sondern von sozialen Gütern, um so zu betonen, dass Menschen als vergesellschaftete Wesen Gegenstände nie einfach „neutral“ oder „natürlich“ wahrnehmen, sondern diese stets „durch ein tradiertes System von Sinngebungen und damit symboli- schen Besetzungen“ betrachten. Soziale Güter lassen sich definieren als „‚Produkte ge- genwärtigen und vor allem vergangenen materiellen und symbolischen Handelns’“ (Löw 2001: 153). Im Zusammenhang mit menschlichen Handlungen kann bei sozialen Gütern entweder der materielle oder aber der symbolische Aspekt stärker in den Vordergrund tre- ten, sodass soziale Güter in „primär materielle“ und „primär symbolische“ Güter differen- ziert werden können. „Primär materielle Güter sind z. B. Tische Stühle oder Häuser, pri- mär symbolische dagegen Lieder, Werte oder Vorschriften.“ (Ebd.) Mit der Bezeichnung „primär“ wird zum Ausdruck gebracht, dass soziale Güter (je nach Kontext) vorrangig, aber nicht ausschließlich als etwas Materielles oder Symbolisches betrachtet werden kön- nen. Einerseits lassen sich soziale Güter nur aufgrund ihrer materiellen Eigenschaft anord- nen oder platzieren. Andererseits lassen sie sich nur aufgrund ihrer symbolischen Eigen- schaft (sofern es gelingt, diese zu entschlüsseln) verstehen. Im Straßenverkehr werden Hinweisschilder aufgestellt, um eine Symbolik zu entfalten. Diese Aufstellung, die einem symbolischen Zweck dient, kann aber nur vorgenommen werden, weil die Schilder auch eine Materialität aufweisen (vgl. ebd.: 154).
Neben sozialen Gütern können auch Menschen Teil einer Raumformation sein. Disko- theken werden bspw. zu ganz unterschiedlichen Räumen, je nachdem, „ob tanzende Men- schen anwesend sind oder ob es sich um leere Hallen handelt“ (ebd.). Der Raum, den man erlebt, wenn man als Neuankömmling auf einer Feier erscheint, wird nicht nur durch sozia- le Güter (Buffet, Sitzgelegenheiten, Musikanlage etc.) gebildet, sondern eben auch da- durch, dass sich die dort anwesenden Menschen(gruppen) auf eine ganz bestimmte Weise bewegen und zueinander positionieren. Die Art und Weise, wie sich zwei Menschen zuein- ander positionieren, ist raumkonstituierend und liefert Rückschlüsse über deren Bezie- hungsverhältnis: „Sozial sich Nahestehende lassen zwischen sich einen kleineren Raum entstehen als sozial Fremde. Die Grenzen dieses Raums zeigen sich sehr deutlich, wenn sie von einem Gesprächspartner [...] überschritten werden.“ (Ebd.: 154) Menschen zeichnen sich als Bausteine dadurch aus, dass sie an der Gestaltung von Räumen (in unterschiedlich starkem Ausmaß) bewusst und aktiv mitwirken können. Menschen platzieren soziale Gü- ter, andere Menschen und sich selbst, werden aber andererseits natürlich auch durch die Handlungen ihrer Mitmenschen platziert. „Darüber hinaus beeinflussen sie mit Mimik, Gestik, Sprache etc. die Raumkonstruktionen.“ (Löw u. a. 2007: 65)
2.3.2 Die Dualität von Räumen
Löw (2001: 171) überträgt die von Giddens vorgenommene gesellschaftstheoretische Dif- ferenzierung zwischen Struktur und Handeln auf ihr Raumkonzept und spricht infolgedes- sen davon, dass Räume eine Dualität aufweisen. „Dualität bezeichnet eine Zweiheit, keine Gegensätzlichkeit, wie sie in der Rede vom Dualismus zum Ausdruck kommt.“ (Ebd.) Mit seiner speziellen Schreibweise soll der in der Definition auftauchende Begriff der „(An)Ordnung“ auf die behauptete Dualität von Räumen hinweisen, welche darin besteht, dass Räumen sowohl eine Struktur- als auch eine Handlungsdimension innewohnt. Weil der (An)Ordnungsbegriff beide Dimensionen repräsentieren soll, muss er doppeldeutig verstanden werden. Er bezeichnet zum einen den Vorgang des Anordnens (Handeln), weist zum anderen aber auch auf eine bestehende gesellschaftliche Ordnung (Struktur) hin. An- ordnen meint primär etwas Prozesshaft-Dynamisches und Ordnung primär etwas Stabil- Fortdauerndes (vgl. Löw u. a. 2007: 63). Im Löwschen Raummodell gelten beide Dimensi- onen als aufs engste miteinander verwoben; wie die zwei Seiten einer Medaille bedingen sie einander, was nicht zuletzt dadurch hervorgehoben wird, dass beide Dimensionen mit einem gemeinsamen, nämlich dem (An)Ordnungs-Begriff versehen sind. (Menschliches) Handeln findet einerseits immer in einer vorgegebenen gesellschaftlichen Ordnung bzw. in vorgegebenen Strukturen statt, bringt aber andererseits eine gesellschaftliche Ordnung auch immer erst (und immer wieder neu) hervor, wirkt also strukturbildend. Kompakter formuliert: Strukturen beeinflussen Handeln, welches umgekehrt Strukturen beeinflusst (vgl. Löw 2001: 158 ff.).
Mit dieser Konzeptionalisierung löst Löw die von Kessl/Reutlinger aufgestellte Forde- rung nach einer theoretischen Zusammenführung konstruktivistischer und materialistischer Raumvorstellungen ein. Kessl/Reutlinger verstehen unter einem relationalen Raummodell ein raumtheoretisches Konzept, welches eine enge Wechselwirkung zwischen „menschli- chen Aktivitäten“ und „manifestierten Raumordnungen“ voraussetzt und fokussiert (s. 2.2). Durch die Verwendung des (An)Ordnungsbegriffs sowie die Charakterisierung von Räu- men als „Dualität zwischen Struktur und Handeln“ bringt Löw genau dies - nämlich, dass sie eine derartige Wechselwirkung annimmt und als zentral erachtet - explizit zum Aus- druck. Somit handelt es sich beim Löwschen Raummodell auch im Sinne des besagten Autorenduos um ein relationales Modell, obwohl Löw es aus einem anderen Grunde als relational bezeichnet (s. 2.3.1).
Um mehr Klarheit über beide Dimensionen zu gewinnen, werde ich sie nun getrennt in den Blick nehmen. Aufgrund ihrer starken Wechselwirkung kann eine derartige Trennung im Folgenden aber nicht strikt durchgehalten werden, sondern nur tendenziell erfolgen.
Die Handlungsebene: Beim Anordnen gilt es zwei Aktivitäten analytisch voneinander zu unterscheiden: das „Spacing“ und die „Syntheseleistung“.
Spacing meint „das Plazieren von sozialen Gütern und Menschen“ (ebd.: 178) bzw. das „Errichten, Bauen oder Positionieren“ (ebd.: 158) der einzelnen Bausteine eines Raumes. Als Beispiele benennt Löw „das Aufstellen von Waren im Supermarkt, das SichPositionieren von Menschen gegenüber anderen Menschen, das Bauen von Häusern, das Vermessen von Landesgrenzen“ und „das Vernetzen von Computern zu Räumen“ (ebd.). Bei den beweglichen Bausteinen des Raumes bezeichnet Spacing „sowohl den Moment der Plazierung als auch die Bewegung zur nächsten Plazierung“ (ebd.: 159).
Syntheseleistung meint eine wahrnehmend-kognitive Tätigkeit. Raum entsteht dadurch, dass Menschen die einzelnen Raumelemente „über Wahrnehmungs-, Vorstellungs- oder Erinnerungsprozesse“ (Löw. u. a. 2007: 64) miteinander verknüpfen. So wird ein „Ensemble von Häusern, Plätzen, Wegen und Menschen beispielsweise als das Element ‚Ferienanlage’ eingeordnet, eine bestimmte Konstellation von Möbelstücken und die Tätigkeiten der Menschen darin lässt uns den Raum ‚Wohnzimmer’ erkennen, obwohl wir das erste Mal diese Wohnung betreten“ (Früchtel u a. 2007b: 199).
Die Strukturebene: In Gesellschaften gibt es eine Vielzahl vereinheitlichter bzw. „institutionalisierter“ Räume:
„Wer durch verschiedene Städte oder auch durch unterschiedliche Stadtteile flaniert, stößt auf immer gleiche
(An)Ordnungen. Bahnhöfe in ganz Deutschland gleichen sich in der Plazierung von bunten Figuren als Wegweiser, in der Zusammenführung von Geschäften zu ‚Marktplätzen’, in der Plazierung eines überdimen- sionalen Fernsehmonitors immer mehr an. Auch in Fußgängerzonen in ganz Deutschland wiederholen sich die immer gleichen (An)Ordnungen. Räume in und um Kirchen herum, Parlamente, Friedhöfe oder Super- märkte sind unabhängig von Ort und Zeitpunkt immer gleich gestaltet. Im Supermarkt zum Beispiel sind die
(An)Ordnungen der Regale zueinander, die Plazierung der Güter im Verhältnis zu anderen Gütern [...], die
(An)Ordnung der Kassen, der Einkaufswagen und die obligatorische Schranke am Eingang institutionalisiert.“ (Ebd.: 162)
Zu ergänzen ist in diesem Zusammenhang, dass nicht nur die Platzierung sozialer Güter, sondern auch die von Menschen institutionalisiert sein kann: „Beim Empfang eines Staats- oberhauptes sind alle (An)Ordnungen festgeschrieben. Die Räume zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin etc. sind geregelt.“ (Ebd.: 164) Ebenso ist im Gericht klar festgelegt - und zwar in allen vergleichbaren Gerichten Deutschlands auf gleiche oder ähnliche Weise
- wie „sich Richter, Anwälte, Staatsanwälte, Angeklagte(r) und Publikum zu plazieren haben“ (ebd.). Löw definiert Institutionen als „auf Dauer gestellte Regelmäßigkeiten sozia- len Handelns“ (ebd.: 169).8 Die Dauerhaftigkeit von Institutionen liegt zum einen darin begründet, dass Menschen in ihrem Alltag, d. h. in den ihnen vertrauten Situationen, zu- meist auf Gewohnheiten bzw. Routinen zurückgreifen. „Das bedeutet, daß sie nicht lange darüber nachdenken müssen, welchen Weg sie einschlagen, wo sie sich plazieren, wie sie Waren lagern und wie sie Dinge und Menschen miteinander verknüpfen. Sie haben ein Set von gewohnheitsmäßigen Handlungen entwickelt, welches ihnen hilft, ihren Alltag zu ges- talten.“ (Ebd.: 161) Weil viele Routinen in Sozialisationsprozessen schon „von Kind an gelernt“ (ebd.: 166) werden, erscheinen sie den meisten Menschen als etwas so Selbstver- ständliches, Vertrautes und Notwendiges, dass ihnen der Gedanke überhaupt nicht in den Sinn kommt, sie zum Gegenstand ihrer Reflexion zu machen oder sie gar grundlegend und (selbst)kritisch infrage zu stellen. Durch ständige Wiederholung werden Routinen allmäh- lich zu einem festen Bestandteil der eigenen Persönlichkeit. Sie vermitteln dem Menschen „Sicherheiten und ‚Seinsgewißheit’“ (ebd.:163).
Zum anderen verdanken Institutionen ihre Dauerhaftigkeit dem Umstand, dass in ihnen Strukturen, d. h. Regeln und Ressourcen, „rekursiv [...] eingelagert sind“ (ebd.: 167):
„Regeln beziehen sich dabei auf die Konstitution von Sinn oder auf die Sanktionierung von Handeln. Sie implizieren Verfahrensweisen von Aushandlungsprozessen in sozialen Beziehungen bis hin zur Codifizierung. Als Strukturmerkmal können sie nicht ohne den Bezug auf Ressourcen konzeptionalisiert werden. Ressourcen sind ‚Medien durch die Macht als ein Routineelement der Realisierung von Verhalten in der gesellschaftlichen Reproduktion ausgeübt wird’.“ (Ebd.)
Leider verzichtet Löw darauf, diese doch recht abstrakt gehaltenen Ausführungen anhand eines Beispiels zu illustrieren. Daher werde ich nun versuchen, ihre knappen und generell gehaltenen Hinweise am Beispiel des Straßenverkehrs zu konkretisieren:
Zur Erinnerung: Löw definiert Institutionen als „auf Dauer gestellte Regelmäßigkeiten sozialen Handelns“ (ebd.: 169). Demnach wäre auch der Straßenverkehr als eine Institution zu verstehen: Er existiert bereits seit Langem und wird ständig von vielen Menschen ge- nutzt, die ihre Handlungen - sei es die Steuerung eines Fahrzeuges, die Überquerung einer Straße als Fußgänger u. Ä. - aufeinander abstimmen müssen. Die Funktion des Straßen- verkehrs besteht darin, den Verkehrsteilnehmern ein möglichst hohes Maß an Mobilität und Sicherheit zu gewährleisten (Regeln als Konstitution von Sinn). Für den Straßenver- kehr gibt es zahlreiche Bestimmungen und Vorschriften, die besagen, wie sich die Ver- kehrsteilnehmer in bestimmten Situationen zu verhalten haben (Regeln als Verfahrenswei- sen von Aushandlungsprozessen in sozialen Beziehungen). In diesen Vorschriften ist auch festgelegt, welche Sanktionen einem Verkehrsteilnehmer bei Fehlverhalten auferlegt wer- den können (Sanktionierung von Handeln). Um den Verkehrsteilnehmern ein hohes Maß an Mobilität und Sicherheit dauerhaft zu gewährleisten, reicht es nicht aus, Vorschriften formal festzulegen. Zur Durchsetzung bestehender Vorschriften werden im Straßenverkehr v. a. Polizeikräfte benötigt (personelle Ressourcen). Sie müssen über ein Mandat verfügen, welches ihnen gestattet, in den Straßenverkehr intervenierend einzugreifen (autorative Ressourcen). Polizeikräfte müssen zudem mit einer Vielzahl technischer Hilfsmittel (wie etwa Fahrzeugen, Überwachungskameras etc.) ausgestattet sein (materielle Ressourcen), um ihrer Aufgabe angemessen nachkommen zu können.
Was ist nun damit gemeint, dass Strukturen einen „rekursive[n] Charakter“ (ebd.: 167; Herv.: W. W.) aufweisen? Nur weil es im Straßenverkehr bestimmte Vorschriften/Regeln gibt, die von den meisten Verkehrsteilnehmern befolgt werden, können sich Menschen hier relativ sicher und reibungslos fortbewegen. Diejenigen, die gegen die Regeln verstoßen, werden sanktioniert, sofern ihr Verhalten den mit einem Mandat ausgestatteten Ordnungs- hütern auffällt. Dadurch, dass Menschen am Straßenverkehr teilnehmen und bestehende Regeln einhalten oder aber bei Fehlverhalten mit Sanktionen belegt werden, bestätigen sie mit ihrem Handeln fortlaufend bestehende Regeln. Es findet somit eine Reproduktion von Regeln statt, die den Gesellschaftsmitgliedern erst eine bestimmte Form von Handeln (hier das Fortbewegen im Straßenverkehr) ermöglichen.9
Die Aussage, dass Strukturen in Institutionen (rekursiv) eingelagert sind, bedeutet auf institutionalisierte Räume bezogen zweierlei: Es ist geregelt, wie Spacing und Synthese vorzunehmen sind bzw. vorgenommen werden sollten; es existieren Ressourcen (Machtmittel), mit denen die Einhaltung bestehender Regeln zur Raumkonstruktion um- und durchgesetzt werden können (vgl. ebd.: 171).
2.3.3 Raum und soziale Ungleichheit
Räume umfassen also zwei Dimensionen, die einander auf vielfältige Weise durchdringen, zu analytischen Zwecken aber (mit einem gewissen Unschärfegrad) gesondert betrachtet werden können: eine Handlungs- und eine Strukturdimension.
In Bezug auf Erstere gilt: Raum wird von Menschen in einem kollektiven Handlungsprozess gestaltet, verändert und/oder (über eine vergleichsweise lange Zeitdauer hinweg) reproduziert. Raum ist etwas gesellschaftlich Konstruiertes; er ist „menschengemacht“; er entsteht - gewissermaßen - erst infolge sozialer Praktiken.
In Bezug auf Letztere gilt: Raum stellt eine unentbehrliche Grundlage, eine Voraussetzung oder Rahmenbedingung des Handelns dar. Menschen können immer nur innerhalb einer bestehenden Raum- bzw. Gesellschaftsordnung agieren. Raum im Sinne einer Ordnung ist dem Handeln stets vorgängig.
Im Hinblick auf die Handlungsebene sind Menschen eher in einer aktiven, im Hinblick auf die Strukturebene eher in einer passiven Rolle zu sehen. Sie lassen sich nicht auf eine dieser beiden Rollen reduzieren, sondern sind immer beides zugleich: sowohl aktives, handlungsfähiges Subjekt als auch passives, handlungsunfähiges (d. h. von den Handlun- gen anderer abhängiges) Objekt. Allerdings kann das Verhältnis zwischen diesen beiden Aspekten der menschlichen Existenz von Individuum zu Individuum, von Bevölkerungs- gruppe zu Bevölkerungsgruppe höchst unterschiedlich ausfallen. Während die einen auf der „gesellschaftlichen Bühne“ sehr deutlich als Akteure bzw. „Hauptdarsteller“ in Er- scheinung treten, bleiben die anderen auf eine „Statisten-“ oder gar „Zuschauerrolle“ be- schränkt und somit - wie Kessl/Reutlinger (2007: 25) es ausdrücken (s. 2.2) - „faktisch unsichtbar“. Während einige Gesellschaftsmitglieder sehr großen Einfluss auf die Gestal- tung des Räumlichen ausüben können, scheinen andere dazu nicht oder in nur deutlich ge- ringerem Maße in der Lage zu sein.
Inwieweit Menschen an der Gestaltung gesellschaftlicher (Teil)Räume mitwirken kön- nen, hängt davon ab, inwieweit sie Zugang zu den strategisch wichtigen Ressourcen einer Gesellschaft haben. Als strategisch wichtig sind solche Ressourcen zu erachten, die Men- schen benötigen, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben und ihre Interes- sen/Bedürfnisse gegenüber anderen Personen wirkungsvoll vertreten und ggf. auch durch- setzen zu können. Unter Bezugnahme auf Kreckel zählt Löw (2001: 212 f.) zu derartigen Ressourcen „Reichtum“, „Wissen“, „Hierarchie“ und „Assoziation“. Aufgezeigt werden soll nun, inwieweit der Zugang zu diesen Ressourcen Menschen ein Leben unter angeneh- men Bedingungen ermöglichen bzw. ihnen dabei helfen kann, die eigenen Lebensumstände positiv (d. h. den eigenen Interessen/Bedürfnissen gemäß) zu beeinflussen:
Reichtum: Hiermit ist ein hohes Maß an Verfügungsmöglichkeiten über (primär mate- rielle) soziale Güter (s. 2.1.1) gemeint. Diese Verfügungsmöglichkeiten werden v. a. über Geld als allgemeinverbindliches, institutionalisiertes Tauschmittel der ökonomischen Pro- zesse einer Gesellschaft gesteuert. Wer über Reichtum bzw. ein ansehnliches Maß an Geldvermögen verfügt, kann z. B. leichter eine Wohnunterkunft von besonderer Qualität (hinsichtlich Größe, Ausstattung etc.) und in attraktiver Lage erwerben und/oder beziehen als jemand, der nur wenig besitzt. Der Eigentümer eines freistehenden Hauses kann „sich schon mit der Gestaltung des Vorgartens und des Hauseingangs in hohem Maße selbst in- szenieren“ (Früchtel u. a. 2007b: 200), während dem Mieter im sozialen Wohnungsbau diese Möglichkeit weitgehend verwehrt bleiben dürfte. Personen, die über Reichtum verfü- gen, haben zudem oftmals bessere Möglichkeiten der Mobilität; sie können sich leichter und schneller von Ort zu Ort bewegen, weil sie die Kosten für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel problemlos aufbringen und sich zudem den Besitz eigener Fahrzeuge leis- ten können. Wohlhabende können sich somit in mancherlei Hinsicht wesentlich besser selbst platzieren und Platzierungen verlassen als Personen mit merklich geringerem (Geld)Vermögen.
Wissen: Wer gemessen an den gesellschaftlich festgelegten Mindeststandards in mate- rieller Hinsicht arm ist, kann (sozial)staatliche Unterstützungsleistungen für sich geltend machen. Allerdings muss ein Betroffener dazu zumindest ansatzweise wissen, worauf er einen gesetzlich verbrieften Anspruch hat (z. B. Ausbildungsförderung, Wohngeld, ALG II, Kindergeld etc.) und welche Anträge er zu dessen Geltendmachung wann und wo ein- reichen muss. Ggf. ist es auch vonnöten zu wissen, wie man sich gegen eine Behörde weh- ren kann, die einem Leistungen ungerechtfertigter Weise vorenthält. Formal erworbenes Wissen, das Menschen in Form von Zeugnissen, Zertifikaten u. Ä. bescheinigt wird, stellt oftmals eine wichtige Bedingung dar, um einen persönlich angestrebten Arbeitsplatz beset- zen zu können und/oder einen bestimmten Beruf (als Angestellter oder Selbstständiger:
etwa Arzt, Koch, Erzieher, etc.) überhaupt ausüben zu dürfen.
Hierarchie: Hierarchie bezieht sich auf die Stellung, die Position oder den Rang, den Menschen im Vergleich zu anderen Gesellschaftsmitgliedern innehaben bzw. einnehmen können. Diejenigen, die über einen hohen Rang verfügen, können mitunter großen Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. So weisen Früchtel u. a. (2007b: 200) darauf hin, dass die „Bewohner eines sog. ‚gehobenen Wohngebietes’ bessere Chancen als die Be- wohner eines sog. ‚benachteiligten Wohngebietes’“ haben, „bei Planungsvorhaben der öffentlichen Hand eine für sie günstige Regelung, z. B. von Verkehrswegen, zu erreichen und unattraktive Ansiedlungen zu vermeiden“. „Die Lebenschancen“, so merkt Löw (2001: 213) an, „verteilen sich unterschiedlich, je nachdem in welchem Stadtteil man aufgewach- sen ist“.
Assoziation: Assoziation meint die Zugehörigkeit von Einzelpersonen zu bestimmten Gruppen. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe kann (in bestimmten Lebenskontexten) für eine Person selbst dann von großem Vorteil sein bzw. eine wichtige Ressource darstellen, wenn diese Gruppe und die ihr angehörigen Mitglieder innerhalb der gesamtgesellschaftli- chen Hierarchie nur einen unteren Rang besetzen. Jugendliche, die in einem „benachteilig- ten“ Wohngebiet leben und einer, nach geltendem Recht mitunter illegal agierenden Gang angehören, erfreuen sich zwar nicht gerade der Sympathie und Akzeptanz politisch ein- flussreicher, insbes. bürgerlich-konservativer Bevölkerungsgruppen. Innerhalb ihrer Le- benswelt, in der es oftmals zu gewalttätigen Ausschreitungen und Übergriffen kommt, kann die Zugehörigkeit zu einer Gang für die einzelnen Jugendlichen aber von außeror- dentlicher Bedeutung sein, da sie ihnen einen gewissen Schutz bietet und ein Gefühl von Stärke vermittelt.
Je nachdem, in welchem Maße Menschen Zugang zu den Ressourcen Reichtum, Wis- sen, Hierarchie und Assoziation haben, verfügen sie über ein geringeres oder ein höheres Maß an Lebenschancen, d. h. an Chancen, das eigene Leben und Lebensumfeld den eige- nen Bedürfnissen gemäß gestalten zu können. Soziale Ungleichheit begreift Löw (2001: 211) in Anlehnung an Kreckel als eine dauerhafte Benachteiligung bzw. Begünstigung von Einzelpersonen und/oder Gruppen gegenüber anderen, welche darauf basiert, dass Men- schen in ungleichem Maße über die besagten Ressourcen verfügen können. Auch in Bezug auf diese Ressourcen ist darauf hinzuweisen, dass zwischen ihnen eine gewisse Wechsel- wirkung besteht. Materiell-finanzieller Wohlstand kann bspw. eine wichtige Vorausset- zung für den Erwerb gesellschaftlich relevanten und anerkannten Wissens darstellen, wie der Zugang zu Wissen umgekehrt eine Bedingung für den Erwerb von Wohlstand sein kann. So können etwa nur diejenigen Gesellschaftsmitglieder eine kostspielige und privat zu finanzierende (aber eben auch hoch angesehene und auf dem Arbeitsmarkt stark nachgefragte) Berufsausbildung durchlaufen, die über entsprechende finanzielle Mittel verfügen. Umgekehrt stellt eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung, die aus eigener Tasche finanziert werden musste, oftmals eine wichtige Bedingung dar, um überhaupt einen gut bezahlten Arbeitsplatz bekommen und somit materiell-finanziellen Wohlstand aufbauen bzw. aufrechterhalten zu können.
Hamm zufolge ist Segregation „nichts anderes als das räumliche Abbild sozialer Ungleichheit in einer Gesellschaft“ (2001: 302; Herv. i. O.). Dieses Abbild ist Gegenstand des nun folgenden Kapitels.
3. Segregation in (städtischen) Wohngebieten
3.1 Was heißt Segregation?
Nach Löw u. a. (2007: 39) bezeichnet der Begriff der Segregation entweder „die Konzent- ration von Bevölkerungsgruppen in gesellschaftlichen Feldern (z. B. Arbeitsteilung) oder an städtischen Orten“. Um diese beiden Aspekte von Segregation begrifflich zu entwirren, macht es Sinn, im ersten Fall von „funktionaler“ und im zweiten von „residenzieller Seg- regation“ zu sprechen (vgl. Häußermann/Siebel 2004: 139). Letztere steht nachfolgend im Fokus.
Häußermann/Siebel definieren (residenzielle) Segregation als die „Struktur oder das Muster, in dem verschiedene soziale Gruppen verschiedene Teilgebiete einer Stadt vorrangig bewohnen“ (ebd.: 231). Weil im Rahmen dieser Arbeit der Raum- und nicht der Stadtbegriff im Vordergrund steht, soll es genügen, Städte hier in einem sehr weitgefassten Sinne als „strategische Orte der Gesellschaft, Orte von großer Dynamik, an denen Veränderungen besonders deutlich werden“ (Löw u. a. 2007: 93) zu begreifen.
Stadtbewohner unterscheiden sich einmal hinsichtlich der Ressourcen (ökonomische, soziale, kulturelle), über die sie verfügen (können). Zum anderen haben und/oder präferie- ren die Menschen ganz unterschiedliche Lebensstile10. Die Träger gleicher oder ähnlicher Lebensstile bilden gemeinsam ein Milieu11, welches darauf bedacht ist, sich von anderen Milieus symbolisch abzugrenzen. In Städten treffen verschiedene Klassen12, Schichten13, Lebensstile und ethnische Gruppierungen aufeinander, die untereinander soziale wie auch symbolische Konflikte austragen. Als Folge komplexer, z. T. recht konfliktbehafteter Prozesse, in denen unterschiedliche Schichten und Milieus ihren Lebensort finden oder zugewiesen bekommen, kann es zur Herausbildung homogener Wohngebiete kommen: wohlhabender und armer Quartiere, Arbeiterviertel, Stadtteile mit hohem Migrantenanteil usw. (vgl. Häußermann/Siebel 2004: 139).
Häußermann/Siebel unterscheiden zwischen zwei Ausprägungsformen residenzieller Segregation: der sozialen „nach vorwiegend ökonomischen Kriterien bzw. nach Klassen- und Schichtzugehörigkeit“, und der ethnischen „nach kulturellen Merkmalen“ (ebd.: 151). In der empirischen Realität überlagern sich diese beiden Kategorien oft: „Zuwanderer ge- hören meist unteren Sozialschichten an oder werden diesen zugeordnet.“ (Ebd.) Zwischen beiden Formen zu differenzieren macht dennoch Sinn, da sich aus dieser Unterscheidung
[...]
1 Mit dem Sammelbegriff „Soziale Arbeit“ scheint die klassische Trennung zwischen Sozialarbeit und -pädagogik in der Fachwelt weitgehend hinfällig geworden zu sein. Diesem Trend folgend verwende ich beide Begriffe und die daraus ableitbaren Adjektive (sozialarbeiterisch/-pädagogisch) synonym, obgleich sich gewiss immer noch gute Gründe finden lassen, an dieser Unterscheidung (generell oder punktuell) festzuhalten (vgl. Thole 2005).
2 Einige zentrale Auslöser, die SRO zum breit diskutierten Gegenstand machten, seien genannt: der KGSt- Bericht 12/1998, der die Einführung von Sozialraumbudgets im Jugendhilfebereich empfahl sowie dement- sprechende, zeitgleich stattfindende oder in Reaktion auf diesen Bericht erfolgende Umsetzungsversuche in verschiedenen deutschen Gemeinden (s. hierzu Hinte u. a. 2003); das 1999 infolge landesspezifischer Vorläu- ferprogramme gestartete Bund-Länder-Prgramm „Soziale Stadt“ (s. http://www.sozialestadt.de/programm/) und damit einhergehende Partnerprogramme wie „Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ (E&C) (s. http://www.eundc.de/); die vom „Sozialpädagogischen Institut im SOS-Kinderdorf e. V.“ (SPI) 2001 veröffentlichte rechtswissenschaftliche Untersuchung Münders über die Vereinbarkeit der SRO mit den Regelungen des SGB VIII (s. SPI 2001).
3 Jeweils nachzulesen in Merten 2002b
4 Zu näheren Informationen über das ISSAB s. dessen Website: http://www.uni-essen.de/issab/
5 Zu den Gründen der Umbenennung s. das von mir mit Hinte geführte Interview im Anhang. 4
6 Es würde den Rahmen sprengen, hier auf „Lebewesen“ im Allgemeinen einzugehen (s. dazu Löw 2001: 154).
7 Zugleich betont Löw (2001: 156), dass es nicht ausreicht, bloß die Relationen zwischen den Elementen zu betrachten. Um einen ganz bestimmten Raum (in empirischer wie auch analytischer Hinsicht) begreifen, d. h. in seinen ganz speziellen Merkmalen sehen, erkennen, beschreiben und verstehen zu können, muss man unbedingt auch Erkenntnisse über seine einzelnen Bausteine gewinnen.
8 Sie führt weiter aus, dass Institutionen einerseits „soziale Gebilde mit organisatorischen Formen sein können wie die Bauaufsichtsbehörde oder der Tanzkurs als Initiation in die öffentlichen Verhaltensweisen“ (Löw 2001: 169). Andererseits können sie aber auch „gesellschaftlich vorarrangierte Muster des Handelns“ (ebd.) darstellen. Wenn Menschen ihren Wohnraum bspw. so gestalten wie die Kataloge bestimmter Möbelhäuser es ihnen nahelegen oder wie es andere Personen tun, die über ein ähnliches Einkommen verfügen, dann orientieren sie sich an derartig vorarrangierten Mustern (vgl. ebd.: 169 f.).
9 Löw (2001: 167 f.) selbst veranschaulicht den rekursiven Charakter von Strukturen am Beispiel der Spra- che.
10 Lebensstil definieren Häußermann/Siebel (2004: 229) als die „Gestaltung der Lebensweise bestimmter Personen oder Personengruppen“, welche „spezifische materielle, kulturelle und ökonomische Präferenzen“ umfasst. Hradil (2000: 204) weist darauf hin, dass Lebensstile ein erhebliches Maß an Wahl- und Entschei- dungsfreiheit voraussetzen und daher von erzwungenen Lebensweisen (wie z. B. in Gefängnissen) deutlich zu unterscheiden sind.
11 Schulze (2005: 267) begreift (soziale) Milieus als „Gemeinschaften der Weltdeutung“. Sein Milieubegriff gründet in der Annahme, dass es sich bei der deutschen (Nachkriegs-)Gesellschaft um eine egalitäre und liberale handelt, die keine Knappheitsgesellschaft (mehr) ist, sondern (nunmehr) eine Erlebnisgesellschaft, in der der Einzelne über ein hohes Maß an Freiheiten und Möglichkeiten verfügt, das eigene Leben so zu gestal- ten, wie er es gerne möchte. Während die Bildung von Milieus in der Knappheitsgesellschaft auf dem Prinzip der Beziehungsvorgabe, d. h. auf äußeren, materiellen und statusbezogenen Bedingungen/Zwängen (Privat- besitz, Berufsstand, Wohnort, Religion usw.) beruht, basiert sie in der Erlebnisgesellschaft primär auf der freien Beziehungswahl (vgl. ebd.: 170). Das Individuum fühlt sich zu anderen Personen(gruppen) hingezo- gen, die seine Vorstellungen vom schönen, guten und gelingenden Leben teilen und ihm daher sympathisch und angenehm erscheinen (vgl. Peuckert 2001b: 301). Die Mitglieder eines Milieus bestärken und bestätigen sich in ihren weltanschaulichen Auffassungen wechselseitig; sie schauen voneinander ab, was normal ist und gleichen sich immer wieder neu einander an (vgl. Schulze 2005: 174).
12 (Soziale) Klasse bezeichnet eine „Bevölkerungsgruppierung, deren Mitglieder durch eine strukturell gleiche Stellung im Wirtschaftsprozeß, eine ähnliche soziale Lage und gemeinsame Interessen verbunden sind“ (Peuckert 2001a: 171). Stark beeinflusst durch Überlegungen von Marx/Engels und deren Werk „Manifest der Kommunistischen Partei“ (1848) impliziert bzw. akzentuiert der Klassenbegriff oftmals ein politischkämpferisches (kapitalismus- und herrschaftskritisches) Element: den (Klassen)Kampf zwischen den privilegierten und den unterprivilegierten, den herrschenden und den unterdrückten sowie den besitzenden und den besitzlosen Bevölkerungsgruppen. Ebenfalls auf Marx/Engels zurückreichend, wird mitunter behauptet, dass eine (zunächst) zunehmende Polarisierung der Gesellschaft stattfinde und es zusehends zu einer Herausbildung zwei sich feindlich gesonnener Lager käme (vgl. Bellebaum 2001: 21 f.).
13 (Soziale) Schicht meint die (zumeist vertikale) Untergliederung der Gesellschaftsmitglieder nach bestimm- ten Statusmerkmalen (z. B. Einkommen, Beruf, Bildung). Diejenigen, die ein und derselben Schicht angehö- ren, besitzen einen gleich oder ähnlich hohen Status und sind von den Mitgliedern höher oder tiefer gelager- ter Schichten jeweils durch eine Schichtgrenze getrennt (vgl.: Peuckert 2001b: 297). „Eine allgemein aner- kannte Definition von S. [Schicht] gibt es bis heute nicht. Einige Soziologen sprechen erst dann von einer S., wenn sich die entsprechende Bevölkerungsgruppe aufgrund ihres mehr oder weniger ausgeprägten Bewusst- seins ihrer Gleichartigkeit und Zusammengehörigkeit von anderen Bevölkerungsgruppen im Sinne eines Höher oder Tiefer abhebt. [...] Andere Autoren definieren den S.begriff allgemeiner und bezeichnen damit eine Bevölkerungsgruppe, deren Mitglieder bestimmte gemeinsame Merkmale besitzen und sich dadurch von anderen Bevölkerungsgruppen in einer als hierarchisches Gefüge vorgestellten Sozialstruktur unterscheiden.“ (Ebd.: 298) Während der Verwendung des Klassenbegriffs oftmals eine kämpferisch-programmatische Ab- sicht zugrunde liegt, wird der Schichtungsbegriff eher in deskriptiv-analytischer Hinsicht genutzt (vgl. ebd.: 173 f.).
- Arbeit zitieren
- Willfried Werner (Autor:in), 2008, Der Beitrag sozialraumorientierter Sozialer Arbeit zur Schaffung menschenwürdiger Lebensbedingungen in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143760
Kostenlos Autor werden







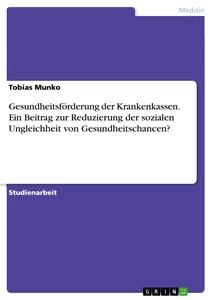















Kommentare