Leseprobe
Inhalt
1. Geistige Behinderung als konstitutiver Begriff einer heilpädagogischen Fachrichtung
1.1 Die große Sprachverwirrung
1.2 Sorgenkind und/oder Mensch? – Aktuelle Diskussion in der Geistigbehindertenpädagogik
1.3 „Sprachprobleme der Pädagogik“ – Anstöße zur Fragestellung
1.4 Hypothese und Aufbau der Arbeit
2. Wesen, Funktion und Macht der Sprache
3. Aspekte zu Wurzeln und Gebrauch des Begriffs der geistigen Behinderung
3.1 Sprachwissenschaftliche Aspekte
3.1.1 Geist
3.1.2 Behinderung
3.1.3 Geistige Behinderung
3.2 Historische Aspekte
3.2.1 Vorläuferbegriffe
3.2.2 Etablierung des Begriffs der (geistigen) Behinderung
3.3 Interdisziplinäre Aspekte
3.3.1 Behinderung aus der Sicht der WHO
3.3.2 Behinderung als individuelle Kategorie
3.3.3 Behinderung als soziale Kategorie
3.3.4 Behinderung als rechtliche Kategorie
3.4 Auswertung
4. „Geistigbehinderte gibt es nicht!“ – Auf der Suche nach alternativen Begriffen
4.1 Anforderungen an einen möglichen Alternativbegriff
4.2 „Kognitives Anderssein“ oder „besonderer Förderbedarf“?
5. Umgang mit dem Dilemma – eine Terminologie des Vorbehalts
5.1 „Der Sprache Zucht auferlegen“ – Konsequenzen für den eigenen Sprachgebrauch
5.2 Zusammenfassung und Ausblick
6. Literatur
1. Geistige Behinderung als konstitutiver Begriff einer heilpädagogischen Fachrichtung
Sind die Begriffe nicht genau, ist die Sprache nicht im Einklang mit der Wahrheit der Dinge. Ist die Sprache nicht im Einklang mit der Wahrheit der Dinge, können die Dinge nicht zum Erfolg geführt werden. Können die Dinge nicht zum Erfolg geführt werden, dann werden die Sitten und die Musik nicht blühen.
Konfuzius (zitiert nach Bünting 1971, 160)
1.1 Die große Sprachverwirrung
Laut Studierendenausweis bin ich für den Studiengang ›Lehramt Sonderpädagogik‹ an der Heilpädagogischen Fakultät eingeschrieben. Meine erste Fachrichtung wird am ›Seminar für Geistigbehindertenpädagogik‹ gelehrt, die zweite behandelt die ›Sondererziehung und Rehabilitation der Körperbehinderten‹. Außerdem muss ich Veranstaltungen in ›Allgemeiner Heilpädagogik‹ und ›Soziologie der Behinderten‹ belegen. Die Seminare thematisieren z.B. ›Religionspädagogik mit Menschen mit geistiger Behinderung‹, die ›Familie mit geistig behinderten Kindern‹ oder den
›Unterricht mit geistigbehinderten Schülern‹. Am Ende des Studiums erhalte ich die Befähigung zum Lehramt an der ›Schule für Geistigbehinderte‹. Dort werden unter anderem Kinder unterrichtet, von denen die einen sagen, sie seien ›mongoloid‹, die anderen, dass sie das ›Down-Syndrom haben‹. Ebenso werde ich dort ›Kindern mit schwersten Behinderungen‹ und Menschen begegnen, die mit dem Wort ›schwerstmehrfachbehindert‹ bezeichnet werden. Diese kleine Auswahl endet mit dem oft zu hörenden, wohlmeinenden „Sind wir nicht alle irgendwie behindert?“.
Eine scheinbar babylonische Sprachverwirrung begegnet jedem, der auch nur einen flüchtigen Blick auf die Begriffe wirft, die im deutschen Sprachraum im Zusammenhang mit dem Phänomen ›Behinderung‹ gebraucht werden – sowohl in der Alltags- als auch in der Fachsprache. Die große Vielfalt von Begriffen, die offenbar synonym verwendet werden, lässt auf Ungenauigkeit und Unsicherheit bei der Wortwahl schließen. Entweder will oder kann man sich nicht auf ein einheitliches Begriffs-inventar einigen. Die Worte, die von Heilpädagogen benutzt werden, scheinen im wahrsten Sinne des Wortes ›nicht in Ordnung‹ zu sein. Lindmeier stellt sogar die Frage, ob man von der Heilpädagogik überhaupt als „paradigmatisch grundgelegte(r) Wissenschaft“ (1993, 16) sprechen kann, da sie mit „weitgehend ungeklärten Grundbegriffen“ (ebda.) operiere. Wo aber liegen die Ursachen dieser Sprachverwirrung?
Ein zentrales Problem scheint mir das Verständnis von ›Behinderung‹ zu sein: Ist sie ein Zustand, ein Prozess oder eine Eigenschaft? Also: Ist ein Mensch behindert, wird er behindert oder hat er eine Behinderung? Handelt es sich um eine Behinderung, wenn ein Kind mit einem zusätzlichen Chromosom Nr. 21 auf die Welt kommt? Oder wenn ein Mensch aufgrund einer Schädigung des Pyramidalsystems mit einer spastischen Lähmung lebt? Liegt eine Behinderung vor, wenn ein Kind das Lerntempo seiner Klasse auf Dauer nicht mithält?
Es ist problematisch, in dieser Vielzahl von unklaren Begriffen und ihren Varianten einen eigenen Sprachgebrauch zu entwickeln, der zum einen den Menschen, um die es in der Geistigbehindertenpädagogik geht, gerecht wird, d.h. sie nicht diskriminiert und nur über ihre Probleme definiert, und der zum anderen geeignet ist, sich sowohl innerhalb der Wissenschaft als auch im Alltag über das Phänomen ›Behinderung‹ zu verständigen. Die Schwierigkeiten, die ich im Laufe des Studiums bei dieser Aufgabe festgestellt habe, stellen die Motivation dar, dieser Frage intensiver nachzugehen.
Diese Arbeit soll also unter dem Eindruck der skizzierten sprachlichen Verwirrung den für meine Fachrichtung konstitutiven Begriff der ›geistigen Behinderung‹ auf seine Tauglichkeit untersuchen. Ein Blick auf ein aktuelles Beispiel sowie die fach-interne Diskussion kann erste Anhaltspunkte für die Suche nach Antworten bieten.
1.2 Sorgenkind und/oder Mensch? – Aktuelle Diskussion in der Geistigbehindertenpädagogik
Gerade in diesem Jahr ist die Diskussion um die Ablösung diskriminierender Begriffe einer größeren Öffentlichkeit bewusst geworden: Die seit 1964 bestehende „Aktion Sorgenkind“, die mit Lotterie-Erlösen viele Projekte von und für Menschen mit Behinderungen unterstützt, wurde am 1. März 2000 publikumswirksam in „Aktion Mensch“ umbenannt. Die Organisation selbst nennt drei Gründe: Zum einen unterstütze man mit den Erlösen nicht mehr nur Kinder, sondern Menschen aller Altersklassen. Desweiteren sei ein neuer Name nötig geworden, um jüngeren Menschen, bei denen man mit dem alten Namen kein Interesse für das eigentliche Anliegen gewinnen könne, ein „Verständnis von Normalität (…), das behinderte Menschen miteinschließt“ (Aktion Mensch 2000) nahezubringen. Das in meinen Augen gewichtigste Argument aber ist wohl das negative Bild von Behinderung, das der Begriff ›Sorgenkind‹ impliziert. Man assoziiert einerseits Unmündigkeit und Abhängigkeit der Betroffenen, andererseits Unglück und Belastung für deren Familien. Darüber hinaus lässt das Wort bei dem gemeinten Personenkreis „wenig Spielraum für ein positives, optimistisches Selbstbild“ (ebda.). Die neue Kampagne, die mit großem Werbeaufwand publik gemacht wurde, stellt sich also ausdrücklich in die Tradition der people-first -Bewegung, die sich in den siebziger Jahren in den USA formierte. Sie seien es satt, Geistigbehinderte genannt zu werden, so die Aktivisten damals, sie seien schließlich people first – in erster Linie Menschen.
An den Reaktionen, die die „Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch e. V.“ im Zuge der Umbenennung erreichten, lassen sich interessante Motive herausarbeiten, die für diese Arbeit von Belang sind. So wird von zahlreichen positiven Zuschriften berichtet, die den neuen Namen und das dahinterstehende Bemühen um eine nicht-diskrimierende Sprache begrüßten. Dagegen gab es auch zögerliche Stimmen, besonders von älteren Leuten, die zwar das Anliegen verstanden, aber eher den vertrauten und über 36 Jahre bewährten Begriff behalten hätten. Andere wiederum stellten die Frage, ob das Wort ›Mensch‹ nicht zu allgemein sei und das Anliegen der Organisation verschleiere. Beobachter aus der Wirtschaft äußerten Bedenken, einen so bekannten und erfolgreich platzierten Markennamen wie „Aktion Sorgenkind“ ohne Not zu ändern.
Diese Aspekte finden ihre Entsprechung in der Diskussion, die man innerhalb der Geistigbehindertenpädagogik (bzw. der gesamten Heilpädagogik) um den Begriff der (geistigen) Behinderung führt. Zunächst möchte ich die Literatur zur Begriffsproblematik in drei Gruppen einteilen. Zum einen wird der Behinderungsbegriff in den einschlägigen Einführungen und Überblickswerken problematisiert mit der Intention, die Zielgruppe der Geistigbehindertenpädagogik zu beschreiben (Bach 1979/1985, Bleidick 1984/1999, Eberwein 1994, Fornefeld 2000, Haeberlin 1996, Speck 1997/1999 u.a.). Daneben finden sich einzelne Aufsätze, die sich – gerade vor dem Hintergrund des so genannten Paradigmenwechsels in der Heilpädagogik – kritisch mit Behinderung als Begriff auseinandersetzen (z.B. Knauer 1998, Palmowski 1997, Sander 1994). Schließlich gibt es noch eine Gruppe von Monographien und Sammelbänden, die sich ausschließlich und sehr ausführlich mit der Begriffsproblematik beschäftigen (Lindmeier 1993, Neumann 1997, Eberwein/Sasse 1998, Bleidick 1999). Die Vielfalt der Beiträge deutet auf die große Relevanz des Themas hin.
Die Positionen, die von den Autoren bezogen werden, decken – ähnlich der ›Sorgenkind‹-Problematik – ein breites Spektrum ab. Es gibt Stimmen, die den Begriff trotz offensichtlicher Mängel wie seiner Stigmatisierungsgefahr und seiner Unschärfe beibehalten wollen. So beklagt Blasel (1990), dass der Begriff der geistigen Behinderung „fast nichts zum Verständnis des Individuums“ (117) beitrage. Er halte aber an der „üblichen Sprachregelung“ (ebda.) fest, da ihm keine alternativen Begriffe zur Verfügung stehen, die nicht genauso undifferenziert seien. Auch Speck spricht dem Behinderungsbegriff die Wissenschaftlichkeit ab und kritisiert seine Orientierung am Defizitären, will ihn aber trotzdem beibehalten, „weil er einfach weitestgehend zur Sprachgewohnheit geworden ist“ (31996, 20). Schon 1974 hatte Thalhammer in einem gemeinsam mit Speck verfassten Werk erklärt, dass man auf geistig behinderte Menschen „lediglich hinweisen“ könne, sie aber „begrifflich nicht zu fassen“ seien (1974, 9).
Dieser Haltung stehen diejenigen gegenüber, die „auf der Suche nach neuen Begriffen“ (Schöler 1994) sind. Ein Ansatzpunkt liegt in der Verwendung des Terminus „sonderpädagogischer Förderbedarf“, der das Stigma ›Behinderung‹ vermeiden soll und nicht zwangsweise den Besuch einer Sonderschule nach sich zieht. Möckel hatte schon 1982 empfohlen, den Terminus Behinderung „zu vermeiden, wo wir können“ (31), konnte aber keine Alternative aufzeigen. Mittlerweile hat sich bei vielen Autoren ein scheinbar weniger diskriminierender people-first -Sprachgebrauch (Kinder/Erwachsene/Schüler/Menschen mit geistiger Behinderung) etabliert, um das Mensch- und Personsein in den Mittelpunkt zu stellen. Aber auch hier wird die Begriffsproblematik nicht gelöst, sondern buchstäblich nur verschoben. In letzter Konsequenz fragen Schley (1991) und Knauer (1998) dann auch: „Braucht die Päda-gogik einen Behinderungsbegriff?“.
Eberwein (1998 u.a.) verneint diese Frage in radikaler Weise und vertritt damit eine wieder andere Sichtweise: „Sich lediglich auf begriffliche Änderungen einzulassen, dient nur der professionellen und individuellen Selbstbefriedigung der Sonderpädagogen.“ (1997, 87). Für ihn manifestiert sich im Behinderungsbegriff das Paradigma einer veralteten Sonderpädagogik, die ihren Besitzstand zu wahren versucht. Die von ihm favorisierte und leidenschaftlich vertretene Integrationspädagogik verzichtet auf derartige Etiketten, da sie grundsätzlich von der Verschiedenheit ihrer Klientel ausgeht.
Sander wiederum stellt zu der Diskussion fest:
Im Gespräch mit ausländischen Fachkollegen habe ich öfter wahrgenommen, daß das bei uns verbreitete Bestreben nach ausführlichen Begriffs-“Klärungen“ am Beginn von Untersuchungsberichten und Abhandlungen Erstaunen oder auch stille Heiterkeit auslöst. Umständliche terminologische Erörterungen über Sachverhalte, von denen jeder Experte ein hinreichend klares Vorverständnis hat, gelten vielleicht sogar als ›typisch deutsch‹. (1994, 99)
Diese Kritik an scheinbar überflüssigen Begriffsdiskussionen geht meiner Ansicht nach fehl, da sie polarisiert und die Handlungsorientierung der Pädagogik gegen einen reflektierten Gebrauch ihrer Sprache ausspielt. (Abgesehen davon ist auch in der englischsprachigen Geistigbehindertenpädagogik die Reflexion der Fachsprache ein Thema; dazu Fernald 1995, Hastings 1994). Vielmehr ist das Thema dieser Arbeit kein Selbstzweck – denn nichts anderes meint Sanders Vorwurf –, sondern legt Einstellungen und Wertungen offen, die sich wiederum auf die Praxis auswirken.
Festzuhalten bleibt: Die „Terminologieproblematik“ ist in der Heilpädagogik „zu einem eigenständigen Thema des jeweiligen Faches“ geworden (Palmowski 1997, 148) und wird durchaus lebhaft und kontrovers diskutiert. Bleidick, der den Begriff ›Behinderung‹ einst zur Zentralkategorie der Disziplin machte, bilanziert: „Komplette perturbatio ist allenthalben anzutreffen.“ (1996, 30).
Die Diskussion um Begrifflichkeiten führt unweigerlich zu der grundsätzlichen Frage nach Funktion, Wesen und der offensichtlich nicht zu unterschätzenden Macht der Sprache. Auch hier finden sich bereits einige Anregungen in der sonderpädagogischen Literatur. Bach misst Begriffen die „Funktion von Wegweisern“ (1996, 36) bei. Als Spiegel und „unbestechlicher Gradmesser“ (1995, 154) für gesellschaftliche Einstellungen wird Sprache bei Antor und Bleidick charakterisiert. Auch der so genannte Paradigmenwechsel in der Heilpädagogik wird sprachwissenschaftlich begründet, wenn Palmowski einem realistischen ein konstruktivistisches Sprachverständnis gegenüberstellt, das ›Behinderung‹ als „Kategorie des Beobachters“ (1997) versteht.
Diesen ersten Schlagworten folgt nun der Versuch, die „Sprachprobleme“ in ein Schema einzuordnen, um so eine konkrete Fragestellung entwickeln zu können.
1.3 „Sprachprobleme der Pädagogik“ – Anstöße zur Fragestellung
Fooken (1989) stellt in seinem gleichnamigen Aufsatz ein grundsätzliches Problem der Pädagogik dar: die Unschärfe vieler wissenschaftlicher Begriffe. Seine Gedanken sind meiner Ansicht nach gut geeignet, um Fragestellungen für diese Arbeit zu entwickeln. Der Autor geht zunächst davon aus, dass es trotz der Fülle der Sprache zu wenig Wörter für die vielfältigen Erfahrung des Menschen gebe. Daher sei besonders eine Wissenschaft wie die Pädagogik, die sich mit komplexen sozialen Zusammenhängen auseinandersetzt, darauf angewiesen, neue Begriffe zu prägen, um neuen Inhalten aus der Erfahrungswelt Rechnung tragen zu können. Bei diesem Prozess der Wortneubildung entstehen allerdings oft Unklarheiten und Missverständnisse. Im folgenden erarbeitet er fünf Typen von Wortschatzerweiterungen. Sie alle scheinen mir auch im Hinblick auf die Diskussion um den Begriff ›geistige Behinderung‹ relevant zu sein.
Ein oft zu beobachtender Vorgang ist das Zusammensetzen von Wörtern (10) wie
z. B. bei dem Begriff ›Heilpädagogik‹. Die beiden Bestandteile scheinen sich auf den ersten Blick gegenseitig in ihrer Bedeutung zu begrenzen (Heilpädagogik als eine spezielle Art der Pädagogik), bergen aber auch das Potential für Missverständnisse, denn jedes Wort bringt „seine eigene Bedeutungsproblematik“ (12) mit sich. Wenn also im Vorfeld nicht eindeutig geklärt ist, worauf sich die Begriffe ›Heil(en)‹ und ›Pädagogik‹ in der Erfahrungswelt beziehen, potenziert sich diese Unklarheit und der neue, zusammengesetzte Begriff bleibt vage und wird somit unbrauchbar.
Diese Arbeit muss demzufolge die Worte ›Geist‹ und ›Behinderung‹ einordnen, sowohl in Hinblick auf ihre Etymologie als auch auf die Geschichte ihrer Verwendung.
Die zweite Beobachtung betrifft die Wortbildung durch Ableitungen (14). Indikatoren für solche zusammenfassenden Substantive sind Suffixe wie -ung oder -ismus (z.B. Professionalisierung). Dieses Mittel stellt eine Möglichkeit dar, komplexe Vorgänge unter einem bestimmten Gesichtspunkt zu typisieren und so in möglichst kurzer Form wiederzugeben. Der Autor stellt zwar den Nutzen knapper Aussagen fest, warnt aber gleichzeitig vor unzulässigen Verkürzungen, die dem oft komplexen Sachverhalt, den sie bezeichnen sollen, nicht gerecht würden.
›Behinderung‹ fasst viele höchst unterschiedliche Phänomene (z.B. Schulversagen und Gehörlosigkeit) als Oberbegriff zusammen. Es ist nach der Zweckmäßigkeit (z.B. in sozial- und schulpolitischer Hinsicht) zu fragen, aber auch nach der Gefahr, das Individuum zugunsten einer Kategorie aus den Augen zu verlieren.
Der dritte Typ betrifft Fachwörter mit Bedeutungserweiterung (19). So kann Hospitalismus beispielsweise in einem streng medizinischen Sinne als „Schädigung während eines Aufenthalts in einer klinischen Institution“ (23) verstanden werden, in einem erweiterten Sinne aber auch die für Pädagogik und Psychologie relevante Verhaltensstörung aufgrund mangelnder Zuwendung und Anregung bezeichnen. Unsicherheit resultiert also daraus, dass ein Wort in verschiedenen Wissenschaften gebraucht und so „auf unterschiedliche Bereiche der Wirklichkeit bezogen“ (24) wird.
›Geistige Behinderung‹ wird ebenfalls von mehreren Wissenschaften (Medizin, Psychologie, Soziologie, Pädagogik u.a.) thematisiert. Für diese Arbeit ergeben sich daher folgende Fragen: Kann man hier auch einen uneinheitlichen Gebrauch des Wortes feststellen? Wie wirkt sich die Perspektive des einzelnen Faches auf die Sichtweise von ›geistiger Behinderung‹ aus? Welchen Stellenwert hat die juristische Dimension (z. B. Sozialrecht, Schulrecht)?
Ein weiteres Potential für „Schein-Klarheiten“ (13) tritt laut Fooken auf, wenn
alltagssprachliche Begriffe als Fachwörter (24) benutzt werden. Ein Wort erhält durch die Verwendung im wissenschaftlichen Sprachgebrauch eine zusätzliche Komponente. Zum genauen Verständnis sind nun erst Erklärungen nötig, die die fachliche von der umgangssprachlichen Bedeutung abgrenzen. Besonders problematisch ist dieser Vorgang, wenn einzelne Bedeutungsaspekte beibehalten, andere hinzugefügt und wieder andere ausgeklammert werden. So kann ein vertrautes Wort, dessen Sinn vermeintlich auf der Hand liegt, zu großen Missverständnissen führen (z.B. ›Rolle‹ in einem alltagssprachlichen Gebrauch und als Zentralbegriff der Soziologie).
Bezogen auf die Thematik dieser Arbeit müssen folgende Fragen gestellt werden: Wie wird ›Behinderung‹ alltagssprachlich verstanden? Wann und warum ist es zu einem wissenschaftlichen Begriff geworden? Welche Begriffe wurden davor verwendet?
Der fünfte Typus der Worterweiterung bezieht sich auf metaphorische verwendete Wörter (28). Hierbei wird einem bereits vorhandenen, bekannten Bedeutungsfeld eines Wortes ein weiteres hinzugefügt. Oft finden Verknüpfungen zwischen Punkten aus verschiedenen Bereichen statt, z. B. „von Räumlichem mit Sozialem“ (40) wie beim Wort ›Einstieg‹. Ursprünglich auf den Zugang zu einem Raum bezogen, kann man damit in einem übertragenen Sinne den Beginn einer pädagogischen Situation bezeichnen. Die neue Bedeutung geht über die ursprüngliche räumlich-wahrnehmbare Dimension hinaus und ist so meist nur im Kontext zu verstehen. Fooken spricht sich zwar nicht gegen Metaphern aus, fordert aber, ihre grundsätzliche Unschärfe mitzudenken, da sie immer nur auf Ähnlichkeit, nie aber auf Gleichartigkeit zweier Sachverhalte beruhen.
Auch dieser letzte Typus der Wortbildungsprobleme trifft auf den hier zur Debatte stehenden Begriff ›geistige Behinderung‹ zu. So weist Kobi darauf hin, dass ›Behinderung‹ „zunächst weder ein pädagogischer Begriff noch ein erzieherischer Sachverhalt“ ist, sondern „Situationen in der (physischen) Gegenstandswelt“ bezeichnet, „in denen bestimmte Bewegungen oder Prozesse aufgehalten und in ihrem üblichen oder vorgesehenen Verlauf gehemmt werden“ (1988a, 61). In diesem Zusammenhang muss gefragt werden, wie ›Behinderung‹ zu einem pädagogischen Begriff wurde und welche zusätzlichen Bedeutungs-Komponenten gegenüber der Alltagssprache dies zur Folge hat. Auch die Bedeutung des Terminus ›Geist‹ muss mitbedacht werden.
1.4 Hypothese und Aufbau der Arbeit
Betrachtet man nun das zuvor skizzierte Ringen um Begriffe innerhalb der Geistigbehindertenpädagogik und die Ausführungen Fookens, so ist die in 1.1 beschriebene Verwirrung nicht kleiner geworden. Wohl aber sind zwei Pole zu erkennen, zwischen denen sich die Diskussion bewegt: Auf der einen Seite scheint ein Begriff nötig, um sich überhaupt zu dem Phänomen ›geistige Behinderung‹ zu äußern, auf der anderen Seite gibt es viele Anzeichen für die Unbrauchbarkeit dieser Terminologie. Daher formuliere ich folgende Hypothese: Der Begriff ›geistige Behinderung‹ ist notwendig und unbrauchbar zugleich.
Die Auswertung der Thesen Fookens haben bereits die Untersuchungsaspekte und konkreten Fragen vorgegeben, die nur noch in eine Reihenfolge gebracht werden müssen. Zunächst scheint es sinnvoll, einige grundsätzliche Aussagen zum Phänomen Sprache zu machen (2). Der Untertitel dieser Arbeit – vom „Idioten“ zum „Menschen mit besonderem Förderbedarf“ – wird im dritten Kapitel aufgenommen. Nach einer sprachlichen Analyse der Begriffe ›Geist‹, ›Behinderung‹ und ›geistige Behinderung‹ (3.1) werden hier historische Aspekte wie Vorläuferbegriffe und die Etablierung des heutigen Sprachgebrauchs in den Blick genommen (3.2). Danach wird die Mehrdimensionalität des Behinderungsbegriffs im Zusammenhang mit interdisziplinären Aspekten beleuchtet (3.3). Im folgenden Kapitel wird nach Alternativmöglichkeiten gefragt (4). Das Resultat dieser Reflexionen schließlich wird mich vor die Entscheidung zugunsten eines eigenständigen Sprachgebrauchs stellen (5).
Die Ausführungen fragen nach der Notwendigkeit und Brauchbarkeit eines Begriffs, nämlich der Bezeichnung des Phänomens ›geistige Behinderung‹. Wenn Aussagen zum Begriff gemacht werden, werden nicht notwendigerweise auch Aussagen zum Phänomen gemacht. Das Phänomen wird in seiner Vielschichtigkeit und Komplexität als gegeben vorausgesetzt und nicht näher dargestellt oder analysiert werden können.
2. Wesen, Funktion und Macht der Sprache
Die Sprache ist aber durchaus kein blosses Verständigungsmittel, sondern der Abdruck des Geistes und der Weltansicht des Redenden …
Wilhelm von Humboldt (zit. nach Kutschera 1993, 289)
Da in dieser Arbeit der Begriff der ›geistigen Behinderung‹ als sprachliches Phänomen untersucht werden soll, ist es unerlässlich, zunächst nach (a) Wesen und
(b) Funktion von Sprache zu fragen und einige linguistische Grundannahmen zu skizzieren. Danach soll (c) die Macht der Sprache thematisiert werden.
(a) Was also ist Sprache? Die wissenschaftliche Antwort auf diese Frage versucht die Disziplin der Linguistik zu geben. Lyons bemerkt dazu, dass diese Aufgabe „kaum weniger tiefgreifend als die vergleichbare Frage ›Was ist Leben?‹“ sei (1987, 11). Diese Komplexität spiegelt sich in den verschiedenen linguistischen Teilgebieten (Morphologie, Syntax, Phonologie usw.) wider, von denen für diese Arbeit vornehmlich die Gebiete der Semantik (Lehre von der Wortbedeutung), der Etymologie (Lehre von der Herkunft der Wörter) und der Soziolinguistik (Lehre von der Wechselwirkung von Sprache und Gesellschaft) wichtig sein werden. Angesichts der mitunter kontroversen Diskussion unter den linguistischen Schulen erscheint es mir sinnvoll, anhand einiger Definitionen Wesensaspekte von Sprache vorzustellen, über die weitgehend Konsens herrscht.
„Sprache ist eine ausschließlich dem Menschen eigene, nicht im Instinkt wurzelnde Methode zur Übermittlung von Gedanken, Gefühlen und Wünschen mittels eines Systems von frei geschaffenen Symbolen.“ (Sapir, nach Lyons 1987, 13) Diese 1921 formulierte Definition beinhaltet bereits wichtige Gesichtspunkte, wie z. B. das deutliche Bemühen, den Menschen über die Sprache vom Tier, das instinktgeleitet kommuniziert, abzugrenzen. Dafür sprechen auch die Begriffe ›Gedanke‹, ›Gefühl‹ und ›Wunsch‹, die im allgemeinen nur dem Menschen zugeschrieben werden und dem Instinkt des Tieres gegenübergestellt werden.
Ein anderer Aspekt dieser Definition ist die kommunkative Funktion der Sprache, die im weiteren Verlauf dieses Abschnitts behandelt werden soll. Auch die Form der Sprache wird von Sapir näher bestimmt, wenn von „frei geschaffenen Symbolen“ die Rede ist. Bloch/Trager (in Lyons 13) präzisieren in ihrer Bestimmung von Sprache, dass es sich um „willkürliche Lautsymbole“ handelt, denen feste Korrelate in der Welt zugeordnet werden. Das impliziert zum einen die Konzentration der Linguistik auf die Lautsprache und ihre schriftliche Umsetzung, zum anderen, dass Sprache der menschlichen Willkür unterliegt und somit kein einmal festgelegtes, statisches, allgemeingültiges System ist, sondern stets auch dem Wandel der Zeit und der Mode unterliegt: Wenn deutsche manager heute in ihrem office über global players der new economy sprechen, dokumentieren sie damit die veränderten Bedingungen einer globalisierten Wirtschaftswelt und ändern willkürlich die Sprachsymbole ihrer Vorgänger, die noch als Geschäftsführer in Büros saßen. Doch werden Wörter nicht nur durch andere ersetzt, sie unterliegen auch Bedeutungsänderungen: Jugendliche, die heute etwas als geil bezeichnen, denken dabei wohl kaum noch an Lüsternheit, wie es die Generation vor ihnen getan hat.
Doch Sprache ist nicht nur Lautsprache, obwohl die klassische Linguistik diesen Standpunkt vertritt. Fromkin/Rodman behaupten noch vorsichtig: „Sprache ist ein System, das Laute (oder Gesten) mit Bedeutungen verbindet.“* (1993, 20), während Schneider eindeutig offener formuliert: „Sprache ist ein System von Signalen, die von zwei oder mehr Lebewesen benutzt und im großen und ganzen verstanden werden“. (2000, 16)
Diese sehr weite Sichtweise von Sprache eröffnet meiner Ansicht nach die Lösung eines Konflikts, dem sich die Heilpädagogik angesichts scheinbar nicht-sprechender Menschen gegenübersieht.
„Wo Menschen leben, gibt es Sprache“**, behaupten Fromkin/Rodman (1993, 25). Ist aber auch der Umkehrschluss statthaft, wonach der Mensch ohne Sprache nicht denkbar ist, der in letzter Konsequenz besagt, dass Sprache den Menschen konstituiert, ein unverzichtbares Wesensmerkmal, ein „anthropologisches Bestimmungsstück“ (Antor/Bleidick 1995, 166) sei?
Antor/Bleidick weisen mit dieser Zuspitzung auf die Tendenz der pädagogischen Anthropologie hin, die oben angeführte linguistische Argumentation zu übernehmen und den Menschen über Sprache zu definieren und auf diese Weise vom Tier abzugrenzen. Dieser Anspruch manifestiere sich in Flitners programmatischen Satz „Ich spreche, also bin ich, ›ich bin Sprache‹.“ (1968, 9) Für die Heilpädagogik stellt sich die Frage, ob angesichts beeinträchtigter Sprache bei vielen Menschen mit Behinderungen dieser Standpunkt überhaupt haltbar ist, weil diesen dadurch ein minderwertiges Menschsein unterstellt oder gar ganz abgesprochen werde. Die Autoren postulieren deshalb eine Anthropologie, die mit menschlichen Behinderungen auch Behinderungen der Sprache als „konstitutiv für das Dasein des Menschen“ (166) in den Blick nimmt. So müsse man die Möglichkeit der Kommunikation mit Menschen, die sich nicht lautsprachlich äußern, dennoch a priori als „Basisnorm“ (167) unterstellen, auch wenn dies vermeintlich wider die Realität geschehe. Der Heilpädagogik stelle sich also nicht die Frage nach der Möglichkeit, sondern der Realisierung solcher Kommunikation unter erschwerten Bedingungen.
Diese Perspektive kann sich aber nur eröffnen, wenn man Sprache nicht nur als Lautsprache versteht, sondern Gestik, Mimik, Muskeltonus, Körperausscheidungen und andere Möglichkeiten, sich zu äußern, miteinbezieht. Dies korrespondiert mit Watzlawicks Grundthese, dass man nicht nicht kommunizieren könne (Watzlawick u.a. 1969, 53). Die Aufgabe des Heilpädagogen angesichts eines Menschen, der sich nicht lautsprachlich äußert, besteht für mich demnach darin, die Bedeutung, die dieser nach der Fromkin/Rodman-Definition in ein Zeichen legt, zu erkennen. Schneiders Definition zufolge kann es auch eine eigene Sprache zwischen lediglich zwei Menschen geben. Eine solche würde realisiert, wenn man unter erschwerten Bedingungen nach einer Möglichkeit der Kommunikation sucht und sie findet.
Fazitartig möchte ich festhalten, dass ich mich Schneiders offener Definition anschließe. Sprache ist demnach jede Form von Kommunikation, die auf dem Austausch und dem Verständnis von Zeichen beruht, denen von den Kommunikationspartnern übereinstimmend Bedeutung zugewiesen worden ist. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass der Autor Sprache unter einen Vorbehalt stellt, ihr immer einen Rest an Unschärfe und Vagheit zuspricht, wenn er sagt, dass Verständigung nur „im großen und ganzen“ möglich ist.
(b) Eine der ältsten und bekanntesten Aussagen über die Funktion von Sprache ist wohl der zweite biblische Schöpfungsbericht Gen 2. Dort heißt es:
Gott, der Herr, formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte es heißen. Der Mensch gab Namen allem, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. (Gen 2,19–20a)
Mittels der Sprache unterscheidet der Mensch die Dinge seiner Erfahrungswelt. Indem er sie benennt, kommt im biblischen Weltbild seine vorrangige Stellung in der Schöpfung zum Ausdruck. Er unterscheidet sich von seinen Mitgeschöpfen und macht so seine Position ihnen gegenüber deutlich. Der Theologe Scharbert erklärt: „Die Fähigkeit, den Dingen und den Tieren Namen zu geben, ist nach altorientalischem Denken der Ausweis für die geistige Inbesitznahme der Umwelt. Was man benennen kann, dessen Wesen und dessen Beziehung zum eigenen Ich hat man durchschaut und erkannt.“ (1983, 52)
Dies leitet über zu einer der zentralen Fragen der Sprachwissenschaft: Wie ist das Verhältnis von Sprache, Denken und Wirklichkeit? Whorf hat sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eindringlich mit dieser Frage beschäftigt und dabei vor allen Dingen auf seine Beobachtungen bei Naturvölkern zurückgegriffen. Obwohl seine Ergebnisse heutzutage teilweise als überholt gelten, bleibt doch sein linguistisches Relativitätsprinzip bestehen. Es besagt, dass unser Denken vom Rahmen der Muttersprache abhängig ist und wesentlich von ihr bestimmt wird. Whorf beschreibt die Muttersprache als Abkommen, mit dem wir „die Natur aufgliedern, sie in Begriffen organisieren und ihnen Bedeutungen zuschreiben“ (1963, 12) Wir projizieren demnach die Bedingungen unserer jeweiligen Sprache auf unsere Umwelt und zergliedern sie mit Hilfe von Begriffen in Sinneinheiten. Kann es dann aber eine für alle Menschen unabhängig von ihrer Sprache bestehende, allgemeingültige Realität geben?
Beantwortet wird diese Frage in den Ausführungen des Heilpädagogen Palmowski (1997), die ein auf konstruktivistischen Gedanken beruhendes Sprachverständnis der klassischen Position des Realismus gegenüberstellen. Sprache wurde und wird traditionell als Abbild der Wirklichkeit gesehen. Dieses realistische Denken geht davon aus, dass Sprache die Wirklichkeit exakt repräsentieren kann. Sie dient also vornehmlich der Information, indem sie etwas objektiv Beobachtbares beschreibt. „Wahre und zeitlos gültige, definitive Aussagen sind nach dieser Auffassung möglich.“ (1997, 149)
Der konstruktivistische Standpunkt Palmowskis setzt an einer anderen Stelle an: Ausgangspunkt ist hier der Mensch, der eine Beobachtung und daraufhin eine Aussage macht. Diese Beobachtung findet mit seinen „subjektiven Filter(n), Erwartungshaltungen, Überzeugungen und subjektiven Theorien“ (149) statt, d.h. die
Beobachtung ist abhängig vom Beobachter, die Beschreibung ist abhängig vom Beschreibenden. Vor diesem Hintergrund kann es keine zeitlos gültigen Aussagen mehr geben. Sprache ist nicht informativ, sondern formativ, sie erschafft gleichsam Wirklichkeit. Wie sich diese Position auf das Verständnis von Behinderung auswirkt, wird im dritten Kapitel untersucht werden.
Aus den Thesen Whorfs und Palmowskis lässt sich schlussfolgern: Sprache ist nie neutral und kann es nicht sein. Zum einen ist unser Denken abhängig von der Sprache, in die wir hineingeboren sind, d.h. wir benutzen Begriffe, die tradiert sind und eine Geschichte bezüglich Gebrauch, Wandel und Semantik haben. Sie sind also von vornherein geprägt und enthalten Werturteile. Schneider zieht daraus die Konsequenz, besonders abstrakten Begriffen gegenüber, d.h. Begriffen, die kein dingliches, greifbares Korrelat in der Welt haben, eine große Skepsis an den Tag zu legen, sie immer wieder neu zu überprüfen und sie gegebenenfalls abzuschaffen. Er macht darauf aufmerksam, dass wir allein aus der Tatsache, dass etwas einen Namen habe, auf seine Existenz schließen. „Die Benennung schafft das Benannte.“ (2000, 174). Behalten wir diese Aussage für die Analyse des Begriffs ›Behinderung‹ im Hinterkopf. Zum anderen fließen nach konstruktivistischer Lesart die eigenen Wertungen immer mit in den Sprachgebrauch ein. Ein Begriff kann verraten, wie ich Unterscheidungen treffe und die Welt sehe. Palmowski zitiert ein Beispiel von Foersters: „Ich zeige jemandem ein Bild, und frage ihn, ob es obszön sei. Er sagt ›Ja‹. Ich weiß jetzt etwas über ihn, aber nicht über das Bild.“ (149)
Aus diesen beiden Punkten folgere ich für diese Arbeit, dass man aus den Begriffen, die ein Mensch benutzt, seine Werturteile und Einstellungen ablesen kann. Kurz: sie transportieren sein Menschenbild. Dasselbe gilt natürlich für mich als Autor. Aufgrund der Tatsache, „daß mit der Benennung fast jeden Gegenstandes zugleich eine Werttönung und ein Hinweis verbunden ist, wie man sich ihr gegenüber verhält bzw. verhalten soll“ (Topitsch 1968, 18), habe ich bereits durch die Wahl von people-first -Formulierungen eine Entscheidung getroffen. Da das Ergebnis dieser Arbeit eine Entscheidung zugunsten eines dezidierten Sprachgebrauchs und dessen Begründung darstellen wird, werde ich im letzten Kapitel gleichzeitig mein Menschenbild ausführlicher beschreiben.
Mit der Aneignung bzw. Konstruktion von Realität, der Ordnung der Welt und den darin enthaltenen Werturteilen sind beileibe nicht alle Funktionen von Sprache erfasst. Sie scheinen mir aber für die Zielsetzung meiner Arbeit die wichtigsten zu sein. Die Möglichkeit der Kommunikation durch Sprache als im Alltag vermutlich meist gebrauchter Funktion ist kurz erwähnt worden. Zusammenfassend charakterisiert Schneider die verschiedenen Aufgaben in bilderreichen Worten. Sprache ist für ihn der „machtbesessene Zauberer“, „wütende Aggressor“, „schrullige Ordner der Welt“, „große Tröster“ und „stark hinkende Kurier“ (2000, 88) Mit dieser ironischen Betrachtungsweise weist er schon auf die Unzulänglichkeiten, Gefahren und auch die große Macht hin, die der Sprache seiner Meinung nach innewohnen.
(c) Sprache kann aufdecken und verhüllen. Sprache kann verletzen und trösten. Sprache kann befehlen und verzeihen. Sprache kann verraten und verschweigen. Sprache kann zum Tode verurteilen und heiligsprechen. Kurzum, Sprache ist ambivalent und hat eine enorme Macht. Drei Beispiele:
Die Macht des Wortes ist uns aus einem alten Märchen bekannt: Das ›Rumpelstilzchen‹ tyrannisiert die Menschen, und niemandem gelingt es, seine Kraft zu brechen. Die Titelfigur rühmt sich angesichts der erfolglosen Versuche mit dem Vers „Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß“. Erst das Wissen um seinen Namen kann schließlich seine unheilvolle Herrschaft beenden und verleiht dem Sprecher Macht über ihn.
Ein weiteres Beispiel begegnet uns wieder in der Genesis, diesmal im ersten, dem jüngeren Schöpfungsbericht: Im Gegensatz zum oben erwähnten älteren Bericht, in dem Gott formend tätig wird, schafft er die Welt hier allein durch das Wort („Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht.“ Gen 1,3). Das Wort des Herrschers repräsentiert seine Macht. Es ist gleichsam seine Handlung.
Schließlich werfen wir einen Blick auf die unheilvolle Geschichte des nationalsozialistischen Deutschland. Unter dem rhetorisch hochbegabten Propagandaminister
Goebbels entstand ein System der massiven Beeinflussung durch Sprache – begonnen vom Volksempfänger in jedem Haushalt, der das Wort flächenwirksam übertrug, bis zur notorischen Rede Goebbels’ im Berliner Sportpalast 1943, in der er die aufgeheizte Masse mit Suggestivfragen wie „Wollt ihr den totalen Krieg?“ auf ein aussichtsloses Unternehmen einschwor.
„Die Barbarei beginnt mit der Sprache“ stellt Möckel fest (1982). Er zieht damit eine direkte Linie von den theoretischen Wegbereitern der Euthanasie Binding/Hoche, die 1922 Begriffe wie ›lebensunwert‹, ›Ballastexistenzen‹ und
›Defektmenschen‹ verwenden, bis hin zu der konsequenten Ausführung dieser Gedanken in der so genannten Aktion T 4, bei der im Dritten Reich Zehntausende von Menschen mit Behinderung getötet wurden. Den verschleiernden Titel ihres Buches ›Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens‹ entlarvt Möckel, indem er ihn mit „Straffreiheit für die Ermordung von imbezillen Kindern“ übersetzt. „Die
eigentümliche Verkehrung des Rechtempfindens begann mit der Verkehrung der Sprache.“ (1988, 228). Diese zynische Haltung wird besonders deutlich, wenn man sich vor Augen hält, „daß der Tötungsvorgang in den amtlichen Dokumenten als ›Behandlung‹ umschrieben“ wurde (Haeberlin 1995, 118).
Doch man muss nicht erst Märchen, Theologie oder Geschichte bemühen. Auch im Alltag begegnet uns die Macht der Sprache und natürlich auch deren Missbrauch. Ein ähnliches Phänomen kann man am Beispiel human resources festmachen. Mit diesem Begriff werden in Kreisen der Wirtschaft die Angestellten eines Unternehmens bezeichnet. Das Wort hat „etwas latent Inhumanes. Was daran liegen mag, dass er sich a) mit ›Menschenmaterial‹ übersetzen ließe und b) Austauschbarkeit suggeriert: als wären Human resources auch nur eine Sorte von vielen (…)“ (Rutenberg, 3). Der Mensch tritt hinter seiner Funktion zurück. Er wird verdinglicht.
Gleiches passiert, wenn man Menschen auf ein Merkmal reduziert und sie damit identifiziert. ›Der Spastiker‹, ›der Rheumatiker‹, ›der Geistigbehinderte‹ (so z.B. in den Richtlinien der SfGb 1980) – diese Klassifikationen treten mit dem Anspruch auf, Menschen „mit Haut und Haaren in ihrer ganzen Existenz erfaßt zu haben, so als ob die Klassifizierung (…) den Einzelnen seiner Individualität beraubte und nichts von ihm übrigließe, was vielleicht ebenfalls der Benennung würdig wäre. (…) Von der falschen Benennung zur schlechten Behandlung ist aber nur ein Schritt.“ (Schneider 2000, 181) Meiner Ansicht nach ist die unangemessene Etikettierung aber schon die schlechte Behandlung.
Der sprachliche Vorgang, der das Sein eines Menschen auf ein Merkmal verkürzt, wird als Ontologisierung bezeichnet. „Immer hebt das Wort eine bestimmte Seite heraus, aber eben dadurch verdeckt es andere Seiten“ (1971, 50), bemerkt Bollnow und fordert dazu auf, Begriffe ständig zu überprüfen und die außerhalb des Blickfeldes liegenden Seiten aufzudecken. Anderenfalls beansprucht ein Wort auch dort Geltung, „wo es durch eine spätere Entwicklung überholt ist oder sich als falsch erwiesen hat“ (49). Die Festschreibungs- und Stigmatisierungsprozesse, die mit diesen Phänomen einhergehen, werden im nächsten Kapitel erörtert.
Die Ausführungen haben schlaglichtartig gezeigt, wie sehr Sprache mit dem menschlichen Leben verwoben ist. Dabei sind ihre Bedingungen und Funktionen angesprochen worden, ihr grundsätzlich dynamisches Wesen, aber auch die Aspekte Unschärfe, Macht und Missbrauch. Das Eingangszitat des Konfuzius muss letztendlich verworfen werden, da es von einer abbildenden Funktion von Sprache und einer universalen Wahrheit ausgeht. Diese Sichtweise ist eingedenk der skizzierten Aussagen über Sprache hinfällig.
[...]
* „Language is a system that relates sounds (or gestures) to meanings.“
** „Wherever humans exist, language exists.“
- Arbeit zitieren
- Martin Rödiger (Autor:in), 2001, Vom Idioten zum Menschen mit besonderem Förderbedarf - Reflexionen zum Begriff der geistigen Behinderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14350
Kostenlos Autor werden





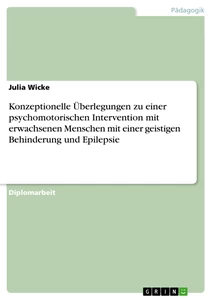














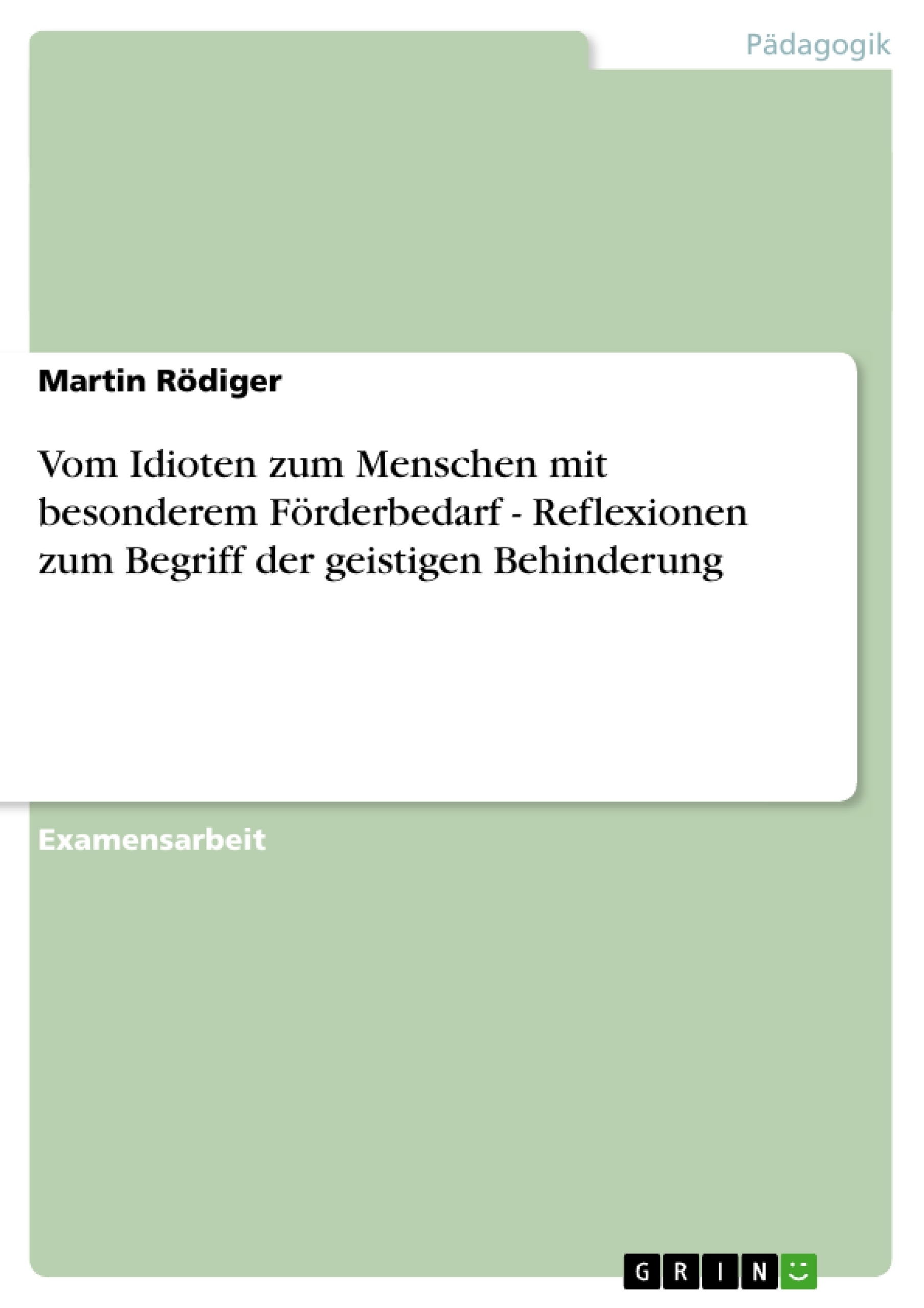

Kommentare