Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Lebensphase „Jugend“.
2.1 Erläuterung des Begriffs „Jugendphase“
2.2 Entwicklungsanforderungen und Risikoverhalten im Jugendalter
2.3 Drogengebrauch als Risiko- und Bewältigungsverhalten
3. Die stationäre Jugendhilfe
3.1 Begriffsklärung und –erläuterung
3.2 Gesetzlicher Rahmen
3.3 Praktische Augestaltung
3.4 Drogenkonsumierende Jugendliche in stationärer Jugendhilfe
4. Cannabiskonsum im Jugendalter- allgemeine Darstellung und Situationsbeschreibung aus dem Blickwinkel der stationären Jugendhilfe
4.1 Cannabis
4.1.1 Inhaltsstoffe und Wirkungsweisen
4.1.2 Cannabis in der Gesellschaft
4.2 Cannabiskonsum im Jugendalter
4.2.1 Entwicklungstendenzen und Konsummotive
4.2.2 Konsummuster und Risiken
4.3 Cannabiskonsum im Setting der stationären Jugendhilfe
4.3.1 Die Situation in der Jugendhilfe
4.3.2 Reaktionen von Fachkräften und Institutionen
4.3.3 Rechtliche Fragen
5. Elemente eines Handlungskonzeptes für die Arbeit mit cannabiskonsumierenden jungen Menschen in stationärer Jugendhilfe
5.1 Vorbemerkung.
5.2 Das Betreuungssetting.
5.3 Die Mitarbeiterebene.
5.4 Die Organisations- und Institutionsebene
5.5 Kooperationsmöglichkeiten mit der Drogenhilfe.
5.5.1 Was erwartet die Jugendhilfe von der Drogenhilfe
5.5.2 Situationsgebundene, einzelfallbezogene Kooperation
5.5.3 Tandembehandlung als Kooperationsprinzip zwischen Jugendhilfe und Drogenhilfe
6. Die Untersuchung
6.1 Die Untersuchungsmethode
6.2 Aufbau und Inhalte des Interviewleitfadens
6.3 Die Untersuchungspopulation
7. Darstellung und Auswertung der Untersuchungsergebnisse
7.1 Betreuungssetting
7.1.1 Darstellung
7.1.2 Auswertung
7.2 Mitarbeiterebene
7.2.1 Darstellung
7.2.2 Auswertung
7.3 Organisations- / Institutionsebene
7.3.1 Darstellung
7.3.2 Auswertung
7.4 Kooperationsmöglichkeiten mit der Drogenhilfe.
7.4.1 Darstellung
7.4.2 Auswertung
7.5 Gespräch mit einem Jugendlichen über seinen Cannabiskonsum
7.6 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse und Rückschlüsse
8. Weiterführende Konsequenzen für die sozialpädagogische Praxis
9. Schlussbetrachtung
10. Literaturverzeichnis.
11. Anhang
1. Einleitung
Drogenkonsum im Allgemeinen und der Konsum von Cannabis im Besonderen ist heutzutage unter Jugendlichen schon lange kein Sonderfall mehr. Folgt man den Suchtberichten der alten und neuen Bundesdrogenbeauftragten, so nimmt der Drogen- und Suchtmittelkonsum unter jungen Menschen in beunruhigendem Maße zu, sowohl der Anteil der Probierer wie derer, die regelmäßig konsumieren. Ebenfalls steigt Jahr für Jahr der Anteil an Drogendelikten, insbesondere der Anteil der Jugendlichen.
Mit dieser Situation sieht sich zunehmend auch die stationäre Jugendhilfe konfrontiert, deren betreute Jugendliche aus vielfältigen Motiven oftmals Drogen konsumieren. Meist werden legale Drogen wie Alkohol oder Nikotin verwendet, deren Konsum in unserer Gesellschaft integriert, und somit in bestimmtem Maße auch sozial erwünscht ist. Problematisch wird es für pädagogische Fachkräfte zumeist dann, wenn es sich um den Konsum von illegalen Drogen handelt. Denn diese werden vom Gesetzgeber als kulturfremde und gefährliche Betäubungsmittel eingestuft, sind demzufolge illegal, und ihr Gebrauch ist auf gesellschaftlicher Ebene logischerweise mit vielen negativen Konnotationen besetzt. Nichtsdestotrotz ist hier insbesondere Cannabis unter Jugendlichen aus stationärer Jugendhilfe ungebrochen und mehr denn je die am meisten verwendete illegale Droge.
Im Umgang mit dieser Minderheit von illegal konsumierenden Jugendlichen sehen sich viele Fachkräfte stationärer Jugendhilfeeinrichtungen zumeist handlungsunfähig. Schnell werden Ängste, eigene Unsicherheiten und Unwissen über Cannabis und dessen Konsum zu Motiven, die die Arbeit mit dem Jugendlichen in oft drastischer Weise verändern können. So schaut man entweder weg und tabuisiert, oder gerät in Panik und dramatisiert. Schnell werden angesichts dieser Reaktionsmuster Rufe nach einer Verweisung an Spezialdienste laut, und mitunter ist illegaler Drogenkonsum noch immer ein Ausschluß- bzw. Nichtauf- nahmegrund, der in den Konzeptionen von Einrichtungen verankert ist. Infolgedessen bedeutet das für denjenigen Jugendlichen (erneut) Beziehungsabbrüche in seiner Sozial- isation, was den Zugang zu ihm beim Thema Drogen nicht unbedingt erleichtern dürfte.
Man hat Angst vor einer Drogeninfektion der anderen Jugendlichen und befürchtet eine etwaige Imageschädigung der Institution durch Schuldzuweisungen von aussen. Und gerade bei diesem heiklen Thema wird die Debatte um die Ursachen von jugendlichem Drogen- konsum in der Öffentlichkeit sehr emotional geführt und geht nicht selten einher mit der Suche nach Schuldigen oder Verantwortlichen. Dies endet häufig mit Vorwürfen, die oftmals noch von den Medien propagiert – jedoch nicht hinterfragt – werden. „Ich kam in der Wohngemeinschaft mit Haschisch in Berührung.“ (Timo, 17 Jahre, in der Talkshow Jürgen Fliege auf Südwest 3, Sendung vom 19.12.02 zum Thema „Mein Kind ist auf der schiefen Bahn“).
Was bei diesen Auseinandersetzungen sowohl in der Öffentlichkeit, als auch in der Jugendhilfe selbst zumeist vernachlässigt wird, ist das Aufzeigen geeigneter Handlungs- und Lösungsansätze für die pädagogische Arbeit mit cannabiskonsumierenden Jugendlichen. Der Bedarf danach ist vor dem oben dargestellten Hintergrund eindeutig gegeben, was hierbei noch weitesgehend fehlt, ist das Entwickeln und Umsetzen konkreter Handlungs- strategien und neuer Konzepte.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit soll nun aufgezeigt werden, welche bisherigen und aktuellen Erfahrungen im Umgang mit cannabiskonsumierenden Jugendlichen in stationärer Jugendhilfe bestehen. Und, wie auf diesen Ressourcen aufbauend, ein professioneller und angemessener pädagogischer Umgang in der stationären Jugendhilfe entwickelt werden kann. Was brauchen hierfür die einzelnen Mitarbeiter oder die Teams? Wo bestehen Wissenslücken und wie bzw. wodurch können diese gefüllt werden? Wie sollten günstige Rahmenbedingungen sowohl in der Einrichung, als auch in der Zusammenarbeit mit dem Träger oder anderen Fachdiensten aussehen, damit sich Sozialpädagogen dieser Aufgabe gewachsen fühlen? Und, ganz wichtig, wo liegen Grenzen in der Arbeit stationärer Jugendhilfe und wann muss tatsächlich weiterverwiesen werden? Diese und weitere Fragen werden im Folgenden umfassend bearbeitet.
In einem ersten Teil werden dabei zunächst theoretische Ausführungen gemacht, die somit einen Zugang zum Thema Cannabiskonsum von Jugendlichen in stationärer Jugendhilfe bieten. Dadurch soll das Hinführen zu o.g. Fragestellungen ermöglicht werden, insofern des weiteren konkrete Problembereiche aufgezeigt werden, die es im zweiten und praktischen Teil zu untersuchen gilt:
Kapitel 2 beschreibt grundsätzliche, das Jugendalter betreffende Sachverhalte. So soll auf Entwicklungen und zu bewältigende Aufgaben währen der Jugendphase eingegangen werden, da der Autor davon ausgeht, dass diese eng mit Drogenkonsum von jungen Menschen zusammenhängen.
Kapitel 3 gibt ferner Aufschluss über Entwicklungen, Aufgaben und Ziele stationärer Jugendhilfe, erläutert dabei den gesetzlichen Rahmen und verdeutlicht in Grundzügen die praktische Ausgestaltung im pädagogischen Alltag durch das Beispiel einer Jugendwohngruppe. Darüber wird verdeutlicht, wie stationäre Jugendhilfe in der Vergangen- heit mit drogenkonsumierenden Jugendlichen gearbeitet bzw. nicht gearbeitet hat.
Kapitel 4 bildet nun einen Schwerpunkt, indem hier der Cannabiskonsum Jugendlicher zuerst unter jugendspezifischen Gesichtspunkten, und anschließend aus dem Blickwinkel der stationären Jugendhilfe beleuchtet wird.
Zunächst sollen in 4.1 allgemeine, substanzspezifische Informationen zu Cannabis gegeben, und seine Bedeutung innerhalb der Gesellschaft betrachtet werden.
In 4.2 geht es konkret um die heutige Bedeutung von Cannabis für Jugendliche. Hierbei werden aktuelle Entwicklungen, ebenso wie Konsummotive und Konsumrisiken vor dem Hintergrund dieser Entwicklungsphase dargestellt.
Abschließend soll in 4.3 auf die Relevanz des Cannabiskonsums bezüglich stationärer Jugendhilfe aufmerksam gemacht werden. Zunächst erfolgt eine Situationsbeschreibung, bevor dann gängige Reaktions- und Verhaltensmuster von Mitarbeitern und Institutionen beschrieben werden, die sehr oft auch im Zusammenhang mit rechtlichen Fragen und Unsicherheiten stehen. Diese werden hier ebenfalls angeschnitten.
In Kapitel 5 werden dann vor diesem Hintergrund konkrete Elemente eines möglichen Handlungskonzeptes für die Arbeit mit cannabiskonsumierenden jungen Menschen vorgestellt. Deren Inhalte, Fragestellungen und Problemstellungen gehen dabei größteneils aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen des theoretischen Teils hervor und bilden gleichzeitig das inhaltliche Grundraster für die Erhebung im praktischen Teil ab.
Kapitel 6 beschreibt das konkrete wissenschaftliche und methodische Vorgehen und stellt dabei sowohl den Interviewleitfaden mit seinen konkreten Themenkomplexen, als auch die Untersuchungspopulation selbst vor.
In Kapitel 7 werden nun die aus den Interviews gewonnen Erbebnisse dargestellt und ausgewertet. Dies geschieht anhand der einzelnen – in Kapitel 5 genannten – Elemente eines möglichen Handlungskonzeptes, wobei diese erst einzeln nacheinander dargestellt bzw. ausgewertet, und abschließend zusammenfassend interpretiert werden. Ebenso bietet ein verschriftlichtes Gespräch mit einem Jugendlichen aus der Ausbildungseinrichtung des Autors einen praxisnahen Exkurs zum Thema Cannabiskonsum von Jugendlichen, dessen Erkenntnisse in der o.g. Gesamtinterpretation ebenfalls Berücksichtigung finden.
Kapitel 8 versucht, die aus dem theoretischen und praktischen Teil dieser Arbeit gewonn- enen Erkenntnisse zu integrieren, um Konsequenzen für die sozialpädagogische Praxis abzuleiten.
Kapitel 9, als Schlussbetrachtung, bietet abschließend einen zusammenfassenden Überblick über die Ergebnisse der Arbeit und liefert zudem ein persönliches Fazit des Autors.
2. Lebensphase „Jugend“
2.1 Erläuterung des Begriffs „Jugendphase“
Unter Jugendphase lässt sich ganz allgemein die Übergangsphase von der Kindheit ins Erwachsenenalter eines Menschen verstehen, obwohl es für den Bedeutungsinhalt des Jugendbegriffs weder in der Soziologie, Psychologie, noch in der Pädagogik eine eindeutige Definition gibt.
Jugend ist eine Altersphase im Lebenszyklus eines jeden Individuums, die mit dem Einsetzen der Pubertät um das 13. Lebensjahr beginnt und dann als abgeschlossen gelten kann, wenn ein Individuum seine persönliche und soziale Identität gefunden hat. Zeichen dafür sind u.a. ökonomische Selbständigkeit und soziale Verselbständigung. (vgl. Schäfers 1994, S.29 f.)
So wird das traditionelle Definitionsmuster von Jugend also vorwiegend unter biologischen und soziokulturellen Gesichtspunkten, und vor allem auch unter psychologischen Dimensionen betrachtet. Ist der Beginn dieser Lebensphase mit dem Eintreten der Geschlechtsreife in der Pubertät noch recht deutlich determiniert, so wirken die Grenzen vom Übergang zwischen Jugendalter und Erwachsenenalter auf den ersten Blick eher ungenau.
Nach Hurrelmann sind hier folgende vier Kriterien vom ausschlaggebender Bedeutung: Erstens, die Entwicklung eines eigenen Wert- und Normsystems, um die eigenverantwortliche Mitbestimmung des politischen und kulturellen Geschehens zu ermöglichen.
Zweitens, die auf eigene Bedürfnisse zentrierte Auseinandersetzung mit den Angeboten des Konsumwarenmarktes und des Freizeitmarktes einschließlich der Medien.
Drittens, die Entwicklung einer intellektuellen und sozialen Kompetenz, die als Grundlage für den erfolgreichen schulischen und beruflichen Werdegang dienen soll; und somit indirekt die eigene ökonomische und materielle Basis für die selbständige Existenz sichert.
Und viertens, die Bildung einer eigenen Geschlechtsrolle mit dem langfristigen Ziel, eine eigene Familie zu gründen und zu ernähren. (vgl. Hurrelmann 1994, S.34)
Das Eintreten in das Erwachsenenalter ist demnach gekennzeichnet durch ein starkes Streben nach Selbstbestimmung, Selbständigkeit und Autonomie, das sich oftmals durch als typisch jugendlich geltende Verhaltensweisen oder Einstellungen des Jugendlichen äußert; und verbunden ist mit verschiedenen Elementen eines bestimmten Lebensgefühls, wie z.B. Unkonventionalität oder Spontaneität.
Aus biologisch und entwicklungspsychologischer Betrachtungsweise wird die Jugendphase bzw. das Jugendalter in mehrere Altersgruppen untergliedert:
- Die 13- bis 18-jährigen im engeren Sinn (pubertäre Phase);
- Die 18- bis 21-jährigen, die sich in der nachpubertären Phase befinden und als Heranwachsende bezeichnet werden,
- Und die 21- bis 25-jährigen, die als junge Erwachsene gelten, aber aufgrund ihres wirtschaftlichen und sozialen Status und Verhaltens überwiegend noch zu den Jugendlichen gehören. (vgl. Schäfers 1994, S.30)
Da sich diese Arbeit mit jungen Menschen in der stationären Jugendhilfe beschäftigt, sollen diese vorwiegend unter der Altersgruppe der 13- / 14- bis 18-jährigen verstanden sein. Dies ergibt sich aus der praktischen Erfahrung des Autors im Arbeitsfeld der Heimerziehung und ist im Sinne des § 7 SBG VIII ebenso determiniert.
2.2 Entwicklungsanforderungen und Risikoverhalten im Jugendalter
Charakteristisch und von zentraler Bedeutung sind für das Jugendalter neben dem schon oben erwähnten Übergang im körperlichen Bereich (Geschlechtsreife, Muskelkraft) auch noch zwei andere Übergangssituationen, die für den Jugendlichen wichtige Veränderungen mit sich bringen und ihn vor erhebliche Entwicklungsanforderungen stellen.
So kommt es neben der umfassenden körperlichen Reifung auch zur Bildung einer eigenen geschlechtsspezifischen Identität. Diese wiederum zieht für den Jugendlichen bedeutende Veränderungen in seinem sozialen Gefüge nach sich. So kommt es zu einer schrittweisen Ablösung vom Elternhaus und einer damit einhergehenden, stärkeren Orientierung zur Gleichaltrigengruppe (peer-group). „Eine ganz enscheidende Folge besteht darin, daß hinsichtlich des eigenen Selbstkonzeptes nicht mehr nur die Wahrnehmung der Eltern von Bedeutung ist.“ (Landesstelle gegen die Suchtgefahren in Baden-Würrtemberg 1998, S.16)
Denn in der peer-group werden erste Intimbeziehungen und Freundschaften aufgebaut, die nun für den Jugendlichen wichtige Bezugspunkte außerhalb des Elternhauses darstellen und die elterliche Autorität zuweilen in Frage stellen. Hier gibt es auch die Möglichkeit, Grenzen zu erfahren, was wiederum Ausdruck eines gemeinsamen Lebensgefühls und Teilhabe an einer bestimmten Jugendkultur bedeuten kann. „Durch den Stellenwert, den Sexualität für Jugendliche in ihrer Entwicklung einnimmt, ist die Akzeptanz in der Gruppe oder Gemeinschaft (...) von herausragender Bedeutung. Ablehnung wird deshalb als eine tiefe Kränkung verstanden, die die Entwicklung erheblich belasten kann.“ (Landesstelle gegen die Suchtgefahren 1998, S.16)
Darüber hinaus ist der Übergang von der Schule ins Berufsleben u.a. als zentrale Entwicklungsaufgabe zu nennen, weil in der Gesellschaft der Beruf über Lebensstil, Lebenschancen und sozialen Status entscheidet, die sich somit immens auf das Selbstkonzept sowie den Selbstwert niederschlagen. Schulisches Lernen und Leistung nehmen während dieser Zeit der sozialen Orientierung enorm an Bedeutung zu.
Vor dem Hintergrund dieser und weiterer wichtiger, aber auch schwieriger Übergangsbereiche erscheint es plausibel, dass „alle Formen des Risikoverhaltens eine attraktive Funktion bei typischen Problemen und Anforderungen der Jugendphase besitzen.“ (Hurrelmann 1993, S.17)
Jedoch muss Risikoverhalten – wie z.B. Drogenkonsum – nicht immer nur Ausdruck von jugendlichen Bewältigungs- und Entspannungserwartungen sein. Insbesondere in der peer-group kommen auch soziale Motive dazu, die einerseits eine schrittweise Integration in die Erwachsenenkultur symbolisieren, wie z.B. das Probieren und Erlernen eines bewussten Umgangs mit Genussmitteln. Andererseits dient Risikoverhalten gerade im Jugendalter auch als Mittel zur Grenzüberschreitung und Distanzierung zur Erwachsenenwelt. Risikoverhalten ist somit als eigenständige Entwicklungsaufgabe anzusehen, dessen subjektive Funktionalität von vielfältigen Merkmalen begleitet werden kann:
- Demonstrative Vorwegnahme des Erwachsenenverhaltens oder bewusster Verstoß gegen elterliche Kontrollvorstellungen.
- Lösungsversuch bei frustrierendem Leistungsversagen, Ohnmachtsreaktion bei starken Konflikten im sozialen Nahraum oder Notfallreaktion auf heftige psychische und soziale Entwicklungsstörungen, etc.
- Ausdruck für sozialen Protest, gesellschaftliche Wertekritik oder Teilhabe an einer bestimmten Subkultur, u.s.w. (vgl. Hurrelmann 1993, S.18)
2.3 Drogengebrauch als Risiko- und Bewältigungsverhalten
Geht man davon aus, dass die oben geschilderten Übergangsbereiche mit ihren lebensalterspezifischen Anforderungen und Belastungen nicht angemessen verarbeitet bzw. in sehr problematischer Weise erlebt werden, so stellt der Konsum von Suchtmitteln als Antwort darauf eine riskante Bewältigungsstrategie unter vielen möglichen dar. Sie ist somit in Abhängigkeit zum biographischen Zusammenhang und zum Lebenskontext mit seinen ökologischen, ökonomischen, vor allem aber kulturellen und sozialen Bedingungen zu betrachten. (vgl. Landesstelle gegen die Suchtgefahren in Baden-Württemberg 1998. S.22)
Riskant ist diese Bewältigungsform deshalb, weil sie immer auch das Risiko kurz- bzw. langfristiger Beeinträchtigungen im physischen, psychischen und sozialen Bereich in sich birgt. Werden Suchtmittel in diesem „Risikoalter“ in unkontrollierter Weise genutzt, deutet dies daraufhin, dass das Repertoire von Mitteln zur Lebensbewältigung begrenzt ist – und es u.U. an einer funktionellen Äquivalente als Alternative zum unangemessenen Suchtmittelgebrauch mangelt. Hierbei ist „suchtähnliches Verhalten im Kinder- und Jugendalter (...) Indikator und Promoter von Entwicklungsproblemen gleichzeitig.“ (Helfferich, zitiert nach Landesstelle gegen die Suchtgefahren in Baden-Würrtemberg 1998, S.22)
Entscheidend dabei ist aber, dass gesundheitlich riskantes Verhalten von Jugendlichen kein Extremverhalten im Ausnahmezustand darstellt, sondern vielmehr beispielsweise aus Beziehungsdefiziten, aus beschädigtem Selbstwertgefühl oder aus Mangel an sozialer Anerkennung heraus entstehen kann. Deswegen muss es bei seiner Beurteilung zunächst einmal auf die subjektive Bedeutung und Funktionalität für den Jugendlichen geprüft werden, und darf nicht aus dem Blickwinkel der Zuschreibung von „abweichendem“ oder „dissozialem“ Verhalten abgewertet werden.
3. Die stationäre Jugendhilfe
3.1 Begriffsklärung und -erläuterung
Im Titel zu dieser Arbeit wurde der Begriff der stationären Jugendhilfe verwendet. Es hätte ebenfalls der Begriff Heimerziehung gewählt werden können, da:
1. dieser nach § 34 SGB VIII auch die gesetzliche Verankerung des hier behandelten Arbeitsfeldes namentlich darstellt und
2. die entsprechenden Einrichtungen (z.B. Jugendwohngruppen) einschließt.
Davon wurde jedoch abgesehen, da Heimerziehung im Kontext der Ausdifferenzierung von Betreuungsformen seit dem KJHG nicht präziser erscheint als stationäre Jugendhilfe – und schon gar nicht zeitgemäßer. Zudem besteht in der Öffentlichkeit noch immer eine starke negative Konnotation zu diesem Begriff, der somit u.U. eine sanktionierende bzw. stigmatisierende Wirkung hat. Im Folgenden werden die beiden Begriffe jedoch der Einfachheit halber synonym verwendet, da sie nach SGB VIII beide das Gleiche beinhalten:
- Hilfen zur Erziehung über Tag und Nacht außerhalb der Herkunftsfamilie.
Die eingehende Erläuterung zeigt, wie schwierig es heute ist, von einem einheitlichen Konzept von stationären Erziehungshilfen zu reden. Aufgrund der breiten Palette an Möglichkeiten der Ausgestaltung von Fremdunterbringungen, aber auch der ambulanten Betreuungskonzepte für Kinder und Jugendliche, hat sich sowohl in konzeptioneller, als auch im Sinne räumlicher bzw. regionaler Gegebenheiten in den vergangenen Jahren viel verändert.
Der 8. Jugendbericht entwickelte 1990 hierfür den inhaltlich-pragmatischen Rahmen, in dem er für die Handlungskonzepte der gesamten Jugendhilfe folgende Strukturmaximen formulierte:
- „Prävention, verstanden als Mitarbeit der Jugendhilfe an lebenswerten, stabilen Verhältnissen und an Krisen vermeidenden (...) Hilfen.
- Dezentralisierung / Regionalisierung, verstanden als Einbettung der Arbeit in den konkreten regionalen Bezug.
- Alltagsorientierung, verstanden als den sensiblen und respektvollen Umgang im sozialen Milieu der Betroffenen, die Nutzung der dortigen Ressourcen (...).
- Integration / Normalisierung, verstanden als Arbeitsstrategien, die den eigensinnigen Lebenskonstellationen und Lebensperspektiven der Betroffenen gerecht werden.
- Partizipation, verstanden als mitverantwortliche Einbeziehung von Familien und jungen Menschen in die Hilfeprozesse und eine Stärkung ihrer Rechtsposition.
- Lebensweltorientierung zwischen Hilfe und Kontrolle, verstanden als eine sensible Jugendhilfe, die sich ihrer teilweisen Zudringlichkeit bewusst ist und dieser auch Grenzen setzt (...)“
(8. Jugendbericht, zitiert nach Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 2002, S. 519)
Heimerziehung muss vor diesem Hintergrund als ein in sich differenziertes und individuell gestaltetes Angebot gesehen werden. Eingeschlossen sind darin alle möglichen und in der Praxis vorfindbaren Betreuungskonzepte wie Kleinstheime, Außenwohngruppen, Jugendwohngruppen, pädagogisch-therapeutische Wohngruppen, „die das Prinzip der institutionellen Betreuung an einem anderen Ort über Tag und Nacht verbindet.“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2002, S. 200)
In diesem Verbund der unterschiedlichen Erziehungshilfen stellt Heimerziehung letztendlich ein eigenständiges Hilfsangebot dar, das zwar im Zuge der o.g. beschriebenen Veränderungen in den Hintergrund treten und neubewertet werden sollte. Dennoch ist sie im Sinne des SGB VIII – und vielmehr aus der Praxis heraus betrachtet – „ein letztes Glied einer Kette von Hilfen (...), das ihre Funktion der ultima ratio bis heute nicht ganz verloren hat“ (Otto / Thiersch 2001, S. 453) und besonders dann gewährt wird, wenn bisherige, weniger eingreifende (z.B. ambulante) Hilfeangebote gescheitert sind.
3.2 Gesetzlicher Rahmen
Die Heimerziehung ist gemäß § 34 im SGB VIII in den Hilfen zur Erziehung verankert, die in den §§ 28 – 35 formuliert sind, und auf die ein gesetzlich einklagbarer Rechtsanspruch besteht. Hiermit soll der leistungsrechtliche Charakter dieses Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) betont werden.
Nach § 27 SGB VIII müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen für eine Hilfegewährung erfüllt sein. Danach „hat ein Personensorgeberechtigter bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall (...).“ Die einzelnen Hilfen zur Erziehung sollen sich dabei, ganz im Sinne der o.g. Strukturmaximen der Jugendhilfe, an einem spezifischen erzieherischen Bedarf im Einzelfall orientieren, und dabei den Klienten in seiner individuellen Situation berücksichtigen. Alle Erziehungshilfen sollen idealerweise in einem Verbund miteinander stehen und sich in der praktischen Arbeit einander ergänzen.
Heimerziehung ist nach § 34 SGB VIII als Unterbringung, Erziehung und Betreuung eines Kindes oder Jugendlichen außerhalb der Herkunftsfamilie über Tag und Nacht in einer Einrichtung zu verstehen. Dabei stellt sie eine auf Zeit angelegte oder dauerhafte, familienergänzende bzw. -ersetzende Hilfe in Situationen dar, in denen zu diesem Zeitpunkt ein weiterer Verbleib in der Herkunftsfamilie aufgrund familiärer und individueller Konflikte nicht möglich ist. Sie soll dabei sowohl eigene Fähigkeiten und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen, als auch die Beziehung zur Herkunftsfamilie berücksichtigen. (vgl. § 37 Abs.1 SGB VIII) Dem Bedarf im Einzelfall entsprechend, ist die Hilfeleistung über das Alltagserleben hinaus mit pädagogischen oder therapeutischen Angeboten zu verknüpfen und soll ferner mit Ausbildungs- oder Beschäftigungsmöglichkeiten verbunden werden. Heimerziehung soll letztendlich die Rückkehr in die Herkunftsfamilie ermöglichen, oder die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten, oder aber auf ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben abzielen.
Neben dieser offiziellen Zielsetzung der Heimerziehung, besteht jedoch zudem der Anspruch an jede der in diesem Arbeitsfeld tätige Institution, individuelle und konzeptionell verankerte Schwerpunkte, Methoden und Leitbilder iher professionellen Arbeit auszuarbeiten. Die daraus sich ergebenden Zielvorstellungen sind notwendig für eine klientenzentrierte Arbeit, die im Einzelfall jedoch erst nach Aufnahme des Kindes oder Jugendlichen in Interaktion mit ihm entstehen können. Deshalb bildet im Bereich aller Erziehungshilfen das Erstellen eines individuellen Hilfeplans nach § 36 SGB VIII die Grundlage der Arbeit, bei welchem Kinder und Jugendliche gemäß ihres Entwicklungsstandes in allen Entscheidungen zu beteiligen sind. (vgl. § 8 SGB VIII)
Im Hinblick auf den Gegenstand dieser Arbeit sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass § 35a SGB VIII garantiert, dass sich insbesondere (stationäre) Jugendhilfe im Rahmen ihrer fachlichen Zuständigkeit Jugendlichen mit Suchttproblematiken annehmen muss und diese auch unterzubringen hat. (vgl. Post 2002, S. 168)
3.3 Praktische Ausgestaltung
Nach einigen grundlegenden Erläuterungen zu stationärer Jugendhilfe sowie der Darstellung ihrer gesetzlichen Verankerung im SGB VIII, und der sich daraus abzuleitenden Zielvorstellungen, soll nun aufgezeigt werden, unter welchen konkreten Bedingungen in der Praxis Jugendliche betreut bzw. erzogen werden. Diese Verdeutlichung geschieht hier beispielhaft anhand der Konzeption einer Jugendwohngruppe.
Denn trotz aller Ausdifferenzierung von Heimerziehung, ist das Setting Gruppe noch immer die zentrale Lebensform in stationärer Jugendhilfe. Hier spielt soziales Lernen unter den Gruppenjugendlichen und in Interaktion mit den pädagogischen Fachkräften eine wichtige Rolle. Die Gruppe kann ferner längerfristige Beziehungen außerhalb der Herkunftsfamilie bieten, in denen Werte wie Toleranz oder Solidarität, und parallel Normen wie gegenseitige Rücksichtnahme, vermittelt und internalisiert werden. Jeder einzelne lernt, für sich und die anderen Verantwortung zu tragen und erfährt dabei gleichzeitig emotionalen Rückhalt.
Das pädagogische Fachpersonal besteht aus Sozialpädagogen und Erziehern, u.a. mit Zusatzausbildung, sowie aus Praktikanten, die im Schichtdienst arbeiten und so eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung gewährleisten. Gemäß der im Hilfeplan individuell vereinbarten Zielvorstellungen, muss es in der Zusammenarbeit zu einer Fülle von pädagogischen Angeboten und Hilfestellungen kommen, die unmittelbar an den Ressourcen des Jugendlichen anknüpfen und seine Lebenswelt berücksichtigen (Interessen, soziale Kontakte, Bedürfnisse). Diese sollen im Folgenden modellhaft aufgezeigt werden:
A) Angebote bezüglich des Gruppenalltags:
- Strukturierung des Tagesablaufs
- Erlernen von konstruktiven (verbalen) Auseinandersetzungen und Förderung der sozialen Kompetenz
- Entwickeln und Verbesserung der Gruppenatmosphäre
- Gruppenpädagogische Angebote, z.B. in Form von gemeinsamen Unternehmungen
- Themenzentrierte Gruppenangebote, z.B. „Projekt 18 – wir werden volljährig“ (Rollenspiele, Quiz, etc.)
- WG-Besprechung: regelmäßiges Gremium zwischen Fachkräften und Jugendlichen, i.S. einer Partizipation in wohngruppenrelevanten Entscheidungen
- Förderung im lebenspraktischen Bereich, z.B. Einkaufen, Wäschewaschen, Behördenkontakte bewältigen
- Hygiene- und Gesundheitserziehung
B) Angebote zur Begleitung des Einzelnen:
- Herausarbeiten von Zukunftsperspektiven
- Beratung und Begleitung bei Krisen und Konflikten
- Bei Bedarf: Vermittlung in externe Beratung oder Therapie Þ Begleitung und Kooperation
- Hilfe bei der Aufarbeitung und Gestaltung der Beziehung zum Elternhaus
C) Schul- und Ausbildung srelevante Angebote:
- Hausaufgabenbetreuung und Prüfungsvorbereitung
- Enge Kooperation mit Ausbildungsstätte, Schule, Arbeitsamt etc. Þ Dokumentation
D) Die Familie betreffende Angebote:
- Alltagskontakte und Gespräche mit Familie oder Eltern
- Hausbesuche bei den Eltern
- Enge und transparente Zusammenarbeit, u.a. in Form von Kontrakten (z.B. bei Ausbildungsbegleitung) Þ zur Gewährleistung einer zielorientierten und professionellen Kooperation
E) Freizeit angebote:
- Kreativ- und Fitnessraum (mit und ohne Beteiligung einer Fachkraft)
- Organisation von Gruppenfreizeiten
- Computerzugang und -benutzung
(vgl. Jugendamt Stuttgart / Hilfen zur Erziehung 2002, Konzeption)
3.4 Drogenkonsumierende Jugendliche in stationärer Jugendhilfe
Aus Kapitel 2 geht hervor, dass der Umgang mit Drogen eine zentrale Entwicklungsaufgabe in der Sozialisation Jugendlicher darstellt.
Dieser Maßgabe folgend, hat stationäre „Jugendhilfe (...) ihren praktischen Schwerpunkt in der Sicherung von Sozialisation, denn sie richtet sich an riskant lebende Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Das bedeutet aber nicht, dass sozialisationsfördernde Maßnahmen in den Hintergrund rücken. Das gilt auch beim Thema Drogen.“ (Wieland 2002, S. 13)
Dabei sind die Problemlagen Jugendlicher, weswegen es zu einer Unterstützung durch stationäre Jugendhilfe kommt, weniger Drogenprobleme an sich, als vielmehr ein oftmals sehr problembehafteter Alltag in der Herkunftsfamilie. Drogenkonsum kann hierbei – wie schon beschrieben – u.a. als Problembewältigungsstrategie im Alltag dienen, oder / und um sich von dem Elternhaus abzugrenzen. Aufgrund dieser Vorbedingungen sieht sich stationäre Jugendhilfe in ihrem professionellen Alltag grundsätzlich mit diesem Thema konfrontiert und stellt sich zunehmend offen dieser Problematik. Doch das war nicht immer so. In den 80er Jahren wurde Jugendhilfe weitaus weniger als heute mit drogengebrauchenden Jugendlichen konfrontiert. So waren es zumeist Mitarbeiter aus z.B. der mobilen Jugendarbeit mit einem aufsuchenden Ansatz, die in Kontakt mit ihnen kamen. (vgl. Landesstelle gegen die Suchtgefahren in Baden-Württemberg 1999, Artikel 9, S. 7)
Für Heimerziehung galt jugendlicher Drogenkonsum hingegen lange Zeit als Tabuthema und führte i.d.R. zu einem Ausschluss aus der Hilfeleistung bzw. diese wurde erst gar nicht als solche gewährt – oftmals aus Ängsten der Mitarbeiter vor einer „Drogeninfektion“ der anderen Jugendlichen in der Einrichtung. Problematische Jugendliche wurden somit oftmals in Psychiatrien oder geschlossene Heime eingewiesen, „in denen Drill, ´Sicherheit und Ordnung` (...) als Erziehung galten und autoritär-hierarchische Strukturen (...)“ herrschten. (Quensel / Westphal 1996, S. 12) Und diese Verfahrensweise begann sich erst langsam, etwa mit der Heimkampagne der 70er Jahre zu verändern, und die o.g. Einrichtungsformen wurden zugunsten ambulant-offener Vorhaben weitgehend aufgelöst.
Schließlich wurden Erziehungshilfeeinrichtungen Anfang der 90er Jahre ganz massiv mit dem Drogenkonsum Jugendlicher in ihren Einrichtungen konfrontiert und immer mehr Einrichtungen stellten sich der Frage, wie mit dieser Zielgruppe konstruktiv gearbeitet werden kann. (vgl. Landesstelle gegen die Suchtgefahren in Baden-Württemberg 1999, Artikel 9, S.8)
Mit dem Inkrafttreten des leistungsrechtlichen Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) und den damit verbundenen, neuen Struktur- und Handlungsmaximen, erkannte (stationäre-) Jugendhilfe ihre Zuständigkeit und wurde in zielgruppenspezifische Angebote ausdifferenziert. Neben den bekannten ambulanten und stationären Erziehungshilfen werden nun in der Arbeit mit drogengefährdeten Jugendlichen insbesondere individuelle und flexible HzE-Settings konzipiert und erprobt:
Z.B. „Betreutes Jugendwohnen“ (BJW), „Mobile Betreuung“ (MOB), „Flexible sozialpädagogische Einzelbetreuung suchtmittelkonsumierender junger Menschen (FSE)“ (vgl. http://www.vfj-bb.de/archiv/pdf2001), usw.
Dem Bedarf und Lebenswandel der Zielgruppe Rechnung tragend, soll zum einen ein Ausgrenzen bzw. Ausscheiden aus der Jugendhilfe möglichst vermieden werden. Zum anderen soll noch mehr das unmittelbare soziale Umfeld im Rahmen einer „Cliquen- und Sozialraumorientierung“ (Landesstelle gegen die Suchtgefahren in Baden-Württemberg 1999, Artikel 9, S. 10) ernstgenommen und miteinbezogen werden.
4. Cannabiskonsum im Jugendalter- allgemeine Darstellung und Situationsbeschreibung aus dem Blickwinkel der stationären Jugendhilfe
4.1 Cannabis
4.1.1 Inhaltsstoffe und Wirkungsweisen
Cannabinoide gehören neben Alkohol zu den ältesten populären psychoaktiven Substanzen. Unter diesem Begriff versteht man „alle Stoffe, Mittel, Substanzen, die aufgrund ihrer chemischen Natur Strukturen oder Funktionen im lebenden Organismus verändern, wobei sich diese Veränderungen insbesondere in den Sinnesempfindungen, in der Stimmungslage oder in anderen psychischen Bereichen oder im Verhalten bemerkbar machen.“ (Scheerer / Vogt, zitiert nach Kähnert 1999, S. 23)
Klassifiziert werden diese Substanzen in legale und illegale, sowie bei zuletzt genannten zusätzlich in harte bzw. weiche Drogen (als i.F. gängige Bezeichnung – Anm. d. Verf.). Zu letzteren gehören auch die Cannabisprodukte Haschisch, Marihuana und Haschischöl, die man aus dem Hanf (Cannabis sativa) gewinnt. Sie bilden eine eigene Klasse unter den illegalen Drogen, da sie weder zu den Stimulanzien, Tranquilizern oder Halluzinogenen, noch zu den Narkotika gezählt werden können und dennoch in ihrer Wirkung einen Teil von allen diesen Stoffgruppen enthalten. Die tabakartige Mischung Marihuana wird aus den zerriebenen Stengeln, Blüten und Blättern der weiblichen Pflanze gewonnen, Ausgangspunkt für Haschisch ist hingegen der Pflanzenharz. Eine seltenere Erscheinungsform ist das o.g. Öl, welches durch das Pressen von Haschisch entsteht. (vgl. Kähnert 1999, S, 26)
Der wichtigste psychoaktive Inhaltsstoff der Cannabispflanze ist das Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC), wobei sie noch etwa 60 weitere Cannabinoide beinhaltet, von denen die meisten vermutlich Modulatoren des THC sind, d.h. sie intensivieren oder reduzieren dessen Wirkung. (vgl. Fromberg 1996, S. 37)
Nicht alle Pflanzentypen haben den gleichen THC-Gehalt: Der Fasertyp mit dem Cannabidiol (CBD) als Leitcannabinoid hat z.B. weniger als 0,3%, ist somit praktisch nicht psychoaktiv und kann zur Produktion von Hanffasern verwendet werden. Der Drogentyp Haschisch hat ferner mit 5-20% einen deutlich höheren THC-Gehalt als Marihuana (ca. 3-5%). (vgl. Grotenhermen 2001, S. 17) THC ist vor allem in den Blütenspitzen der Cannabispflanze enthalten. Die Blätter enthalten eher wenig, die Stängel gar kein THC.
Nach Cannabiskonsum können im körperlichen Bereich Wirkungen wie gesteigerte Herz- und Pulsfrequenz, vermehrter Durst und Hunger, stärkeres Schwitzen, Schmerzminderung, Erweiterung der Luftwege und Senkung des Augeninnendrucks beobachtet werden. Die psychischen Effekte sind sehr vielfältig und reichen von verändertem Zeitgefühl und der Intensivierung von Sinneseindrücken über Entspannungen und Wohlempfinden bis hin zu Euphorie und sogar Glücksgefühlen. Bei der Hauptkonsumform, dem Rauchen, können diese Wirkungen je nach Menge und Toleranz des Konsumenten bereits nach wenigen Minuten einsetzen und bis zu 3-4 Stunden bestehen bleiben. Überdosierungen von Cannabis sind eher selten zu beobachten und lösen u.U. Halluzinationen und Wahnvorstellungen aus. Ebenso kann eine latent vorhandene, psychische Erkrankung zum Vorschein gebracht werden (sog. Cannabisinduzierte Psychose). Deren Auftreten hängt allerdings weniger mit Cannabis an sich zusammen, als vielmehr mit der individuellen Konstitution des Konsumenten und den Begebenheiten seines psycho-sozialen Umfeldes. Am Ende eines Rausches können sich Trägheitsgefühle und Sedierungen einstellen. (vgl. Kähnert 1999, S. 27)
Die chemische Struktur von THC ähnelt keinem bekannten Neurotransmitter, Psychedelika oder Sedativa. Jedoch wurde 1990 ein spezifischer Rezeptor (Transmembranprotein) entdeckt, an dessen Außenseite THC bindet. Diese Rezeptoren befinden sich im Hippocampus (was die Wirkung des THC im Gedächtnis erklärt), in der Amygdala (Ursache für das geringe Aggressionsmaß eines Konsumenten) und in der Hirnrinde (freiere Assoziationsfäigkeit). (vgl. Fromberg 1996, S. 38)
Der im Körper vorkommende natürliche Stoff, der an diese Rezeptoren bindet, ist das 1992 isolierte Anamdamid, welches ähnlich wie THC wirkt. (vgl. Kähnert 1999, S. 27) Dieses wirkt letztlich durch Beeinflussung des Botenstoffs Serotonin im Gehirn und ist somit verantwortlich für die oben beschriebenen, anregenden und dämpfenden Effekte auf körperliche und psychische Vorgänge beim Konsumenten.
4.1.2 Cannabis in der Gesellschaft
Allen Untersuchungen nach ist Cannabis die in Deutschland am häufigsten konsumierte illegale Droge, dies gilt sowohl für die unter 25-jährigen, als auch für alle übrigen Altersklassen. Ebenso hält sich diese Tatsache in Verbreitung auf die gesamte Welt betrachtet. Schätzungsweise konsumierten 1990 insgesamt 400 Millionen Menschen Cannabisprodukte (vgl. Freitag 1999, S. 49)
Dies macht auf Deutschland bezogen einen schätzungsweisen Anteil von etwa 2-4 Millionen aus, und nach bevölkerungsrepräsentativen Umfragen zum Konsum von Cannabis geben 20-30% aller 12-45-jährigen Bürger zu, Erfahrungen im Umgang mit dieser noch immer verbotenen Droge zu haben – Tendenz steigend. Diesem jüngst wieder ansteigenden Trend in Deutschland geht eine jahrzehntelange, sprunghafte Entwicklung voraus. Denn bis Mitte der 60er Jahre war Cannabis als Droge eher unbekannt, bevor es dann gegen Ende des Jahrzehnts zu einem starken Konsumanstieg kam, der bis Mitte der 70er wieder sank und sich dann stabilisierte. (vgl. Kleiber / Soellner 1998, S. 229)
Hinzugefügt sei an dieser Stelle auch, dass Cannabis in Europa keine Tradition als Rauschmittel hat, jedoch schon im frühen 19. Jahrhundert als Therapeutikum verwendet wurde. Ungeachtet dessen war der politische Umgang mit Cannabis zeitlebens prohibitiv und repressiv. Mit dem 1972 in Kraft getretenen Nachfolger des Opiumgesetzes, dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG), bleibt der Erwerb und Besitz weiterhin strafbar. Ferner sei Cannabis hier als eine kulturfremde Droge anzusehen und als Einstiegsdroge für härtere Substanzen einzustufen. (vgl. Thamm 1996, S. 128 ff.)
Diese gesetzliche Linie wurde bis Anfang des letzten Jahrzents politisch einhellig mitgetragen, und der 1990 von der damaligen Regierung verabschiedete „Nationale Rauschgiftbekämpfunsplan“ bildet noch immer das irrationale Spiegelbild einer kriminalisierenden und ambivalent-repressiven Drogenpolitik ab, die einerseits vollständige Abstinenz und „Schutz“ der Bürger bezüglich illegaler Drogen sichern soll. Und andererseits verzeichnen Staat und Volkswirtschaft jährliche Milliardenumsätze durch den freien Zugang zu legalen Drogen – und tolerieren so einen großen Gesundheitsschaden der Bevölkerung.
Dennoch wurden in den letzten Jahren vermehrt Stimmen nach einem liberaleren Umgang mit Cannabis laut. Obwohl mehrfach „ein legaler Zugang von Seiten der Bundesregierung abgelehnt und als ´Schwachsinn` (Seehofer, CSU am 9. Juli 1995) bezeichnet“ (Neumeyer 1996, S. 11) wurde, entschied das Bundesverfassungsgericht dennoch, dass zumindest der Besitz und Erwerb kleiner Mengen zum Eigenverbrauch nicht mehr von der Staatsanwaltschaft strafrechtlich zu verfolgen sei (s.a. § 31a BtMG).
Sicherlich kann der ansteigende ´Cannabis-Boom` auch in Zusammenhang mit dieser öffentlichen Debatte und Diskussion über die Entkriminalisierung bzw. Legalisierung gebracht werden. Jenseits dessen ist aber ein genereller Trend zum öffentlichen Bewußtseins- und Einstellungswandel zu erkennen, der nicht zuletzt auch mit der Wiederentdeckung des Hanfs als Nutz- und Heilpflanze in der Industrie bzw. Medizin zu tun hat und eine öffentliche Neubewertung zuläßt. Denn sowohl von der Sozialwissenschaft, als auch von jugendlichen Konsumenten selbst werden die Gefahren und Risiken des Cannabiskonsums eher gering eingestuft (vgl. Gantner 1998, S.3)
Und nichtsdestotrotz (oder vielleicht gerade deswegen?) geht die Mehrheit von ihnen nicht über ein Experimentierstadium hinaus und betreibt einen sozial-integrierten und unauffälligen Gelegenheitskonsum.
4.2 Cannabiskonsum im Jugendalter
4.2.1 Entwicklungstendenzen und Konsummotive
Jüngste Repräsentativerhebungen der Bundeszentrale zur gesundheitlichen Aufklärung (BzgA) bezüglich des Konsums illegaler Substanzen belegen eine anhaltende, deutliche Steigerung der Prävalenz des Cannabiskonsums in der Altersklasse der 12 bis 25-jährigen. Danach haben im Jahr 2001 bereits 26% Erfahrungen mit Cannabis gemacht. In derselben Altersgruppe waren es 3 Jahre zuvor noch 21%, bzw. 1993 erst 16% gewesen. Während alle anderen illegalen Drogen eher konstante Werte im Zeitverlauf aufweisen, hat sich die herausragende Position von Cannabis im Bereich der illegalen Drogen in den vergangenen Jahren verstärkt. (vgl. Gantner 2002, S. 1)
Wie aus den Studien ebenfalls hervorgeht, bleibt für den überwiegenden Teil der Cannabiskonsumenten der Konsum auf die Jugendphase beschränkt. Nach den Ergebnissen der Kapitel 2.2 / 2.3 kann hier der Konsum vor entwicklungspsychologischem Hintergrund als zeitweiliges jugendtypisches Experimentierverhalten angesehen werden, das u.a. z.B. dazu dient, bestimmte Stressoren als Folge von Entwicklungsaufgaben zu kompensieren. Ist diese Übergangsphase gelungen bewältigt, wird der Konsum mit dem Eintreten in die Erwachsenwelt und der damit verbundenen Rolle voraussichtlich wieder eingestellt.
Doch warum entscheiden sich Jugendliche in dieser Entwicklungsphase gerade für Suchtmittel – und insbesondere für Cannabis – als mitunter problematische Bewältigungsstrategie?
Vorauszusetzen ist, dass diese Wahl aufgrund persönlicher Motive und individueller Bedürfnisse vollzogen wird und insofern der Konsum einen „subjektiven Sinn“ für den Jugendlichen besitzt. Ein zentraler Faktor, dass Suchtmittelkonsum zum Alltagserleben von Jugendlichen gehört und somit auch alltägliches Verhaltensmuster Jugendlicher sellbst werden kann, besteht darin, dass sie schon früh den Umgang damit kennenlernen. So gehört der Konsum von Drogen zur gesellschaftlichen Normalität. Dabei werden Kinder und Jugendliche in ihrer Sozialisation mit unterschiedlichstem Drogenkonsum konfrontiert. So sind legale Drogen als Teil des Kulturkreises relativ unbeschränkt zugänglich und verfügbar und werden gar in den Medien beworben. Darüber hinaus lernen sie oftmals, durch das Modell ihrer Eltern oder anderer wichtiger Bezugspersonen, Drogenkonsum als adäquate Bewältigungsstrategie anzusehen, die in unterschiedlichsten Situationen und sehr vielfältig einsetzbar ist. (vgl. Landesstelle gegen die Suchtgefahren in Baden-Württemberg 1999, Artikel 2, S. 10).
Wie bereits in Kapitel 2.1 genannt, ist eine zentrale Aufgabe in der Jugenphase, sich mit gesellschaftlichen Norm- und Wertvorstellungen sowie Gebräuchen auseinanderzusetzen und den Umgang damit zu erlernen – dementsprechend auch in Fragen des Drogenkonsums. Dabei müssen Jugendliche Normen erlernen, die den Drogenkonsum begrenzen oder erst initiieren, aber vor allem sanktionieren. Hierbei gewinnt die Clique des Jugendlichen als weitere zentrale Sozialisationsinstanz neben dem Elterhaus enorm an Bedeutung. Sie ist „der Ausdruck des Bedürfnisses von Jugendlichen nach Orientierung, Ablösung vom Elternhaus und iher Suche nach einer eigenen Identität und Persönlichkeit.“ (Schröder / Leonhard, zitiert nach Trautmann 2002, S. 155)
Dabei unterstützen sie dieses Bedürfnis jedoch eher durch eine den gesellschaftlichen Werten und Normen entgegenstehende und abgewandte Cliquenidentität. Und nichtkonforme Verhaltensweisen und Wertvorstellungen sind oftmals Maßstäbe für die Integration von neuen Cliquenmitgliedern bzw. des Selbstverständnisses der Clique. Insofern kann auch der Sinn von Cannabiskonsum innerhalb der Gruppe bewertet werden. Als gesellschaftlich negativ sanktioniertes Verhalten erhält er hier nämlich eine identitätsstiftende Funktion und kann sogar Ausdruck eines bestimmten Lebensstils der Clique sein. Cannabiskonsum kann also folglich in Cliquen durchaus probiert, „erlernt“ oder ritualisiert werden und dabei Ausdruck von Neugierverhalten auf die Wirkung der Droge sein. Dieses kann hier ausgelebt werden, gemeinsame Erfahrungen können dabei individuelle Erfahrungen ergänzen. (vgl. Trautmann 2002, S. 155 ff.)
Neben diesen, durch äußere Einflußgrößen (Familie, Clique) geprägten, Konsummotiven gibt es aber auch individuell-drogenspezifische Motive, weswegen Jugendliche ausgerechnet Cannabis konsumieren. Es ist also anzunehmen, dass Cannabis meist nicht wahllos, sondern – wegen seiner spezifischen Wirkung – aus ganz bestimmten Motivationslagen heraus konsumiert wird. Die Gründe für die Auswahl sind u.a. von der sozialen und psychischen Disposition des Einzelnen abhängig und unterscheiden sich daher von Person zu Person. (vgl. Landesstelle gegen die Suchtgefahren in Baden-Württemberg 1999, Artikel 3, S. 1)
Aufgrund seines komplexen psychoaktiven Wirkungsspektrums (euphorisierend, dämpfend, schmerzlindernd, halluzinogen etc.) lässt sich Cannabis dementsprechend auch für eine Vielfalt von physischen, vielmehr jedoch psychischen Bedürfnissen einsetzen (s. Tabelle 1: Funktionsspektrum der Cannabiswirkung).
Tabelle 1: Funktionsspektrum der Cannabiswirkung (Therapieladen, 1998)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aus: Cannabis – Vom jugendtypischen Konsum zum problematischen Gebrauch (Gantner 2002, S. 7)
In: http://www.therapieladen.de
Zusammengefaßt lassen sich die Konsummotive von Jugendlichen wie folgt priorisieren:
1. Neugierde über die Wirkung von Cannabis.
2. Motive, die damit zusammenhängen, dass Cannabis positive Auswirkungen auf die Stimmung zugeschrieben werden bzw. man sich unter seinem Einfluss besser entspannen kann.
3. Erwartung, dass Hemmungen überwunden und soziale Kontakte erleichtert werden.
4.2.2 Konsummuster und Risiken
Eine weitere Besonderheit von Cannabis im Vergleich zu anderen illegalen Drogen besteht nicht nur in der o.g. Verbreitung und Häufigkeit des Konsums, sondern ebenso im situativen und sozialen Kontext des Konsums selbst. Überspitzt formuliert, wird heute überall „gekifft“, unabhängig vom sozialen Milieu – wider des typischen „Hippie-Klischees“ der 70er Jahre – und auch in verschiedenen situativen Kontexten. Somit hat sich Cannabis bei vielen Jugendlichen über den Party- und Freizeitkonsum hinaus einen festen Platz in deren Alltag erobert und ist zu einer populären illegalen Alltagsdroge geworden. Der in Kapitel 4.1.2 beschriebene Trend zu einer (positiveren) Neubewertung von Cannabis (z.B. als Heil- oder Nutzpflanz mit „Öko-Image“) und der damit verbundenen Teilentkriminalisierung (s. Urteil des BVG: „Geringe Mengen zum Eigenbedarf“ etc.) mag dabei m.E. eine nicht ganz unerhebliche Rolle gespielt haben. (vgl. Gantner 2002, S. 1)
Vor diesem Hintergrund bleibt festzuhalten, dass ein großer Teil der Jugendlichen körperliche als auch psychische Risiken bei Cannabis im Vergleich zu anderen illegalen Drogen – aber auch insbesodere im Direktvergleich mit Alkohol – als wesentlich geringer einstuft. Insgesamt ist als wichtiger Punkt hervorzuheben, dass die allermeisten Jugendlichen heute Cannabis mit dem Bewußtsein konsumieren, gesundheitlich kein großes Risiko einzugehen. Und auch von Experten werden die generellen Gefahren und Risiken des Cannabiskonsums im Vergleich zu früher eher gering eingeschätzt. Kleiber und Kovar (1998) kommen in einer Expertise zu den Auswirkungen des Konsums von Cannabis zu der Schlussfolgerung, dass sich die psychosozialen und pharmakologischen Konsequenzen als weniger gefährlich erweisen würden, als noch zum größten Teil angenommen wird. (vgl. Gantner 2002, S. 1 f.)
Und dennoch gibt es viele Jugendliche, die einen – mit negativen Konsequenzen verbundenen – problematischen Cannabiskonsum betreiben. Laut dem Sucht und Drogenbericht der Bundesregierung im Jahr 2000 kommt es in der Jugendphase „nicht automatisch zu einem „Auslaufen“ der Probierphase, sondern durchaus auch zu exzessiven Gebrauchsmustern und zunehmend zu missbräuchlichem Umgang mit Cannabis. (...) Wenn auch die meisten Jugendlichen nur wenig konsumieren oder den Konsum später beenden, wächst auch die Zahl von Jugendlichen, die exzessiv konsumieren, zumeist noch zusammen mit anderen Mitteln, wie Alkohol und Ecstsy.“ (http://bundesregierung.de/emagazine_entw,-39453/Sucht-und-Drogenbericht-2000.htm. 2002, S. 3 ff.)
Entscheidend für die Gefahreneinschätzung von Cannabis ist neben den pharmakologischen Aspekten also das Konsummuster, als Kombination aus den Variablen Dosis, Konsumfrequenz, Anzahl konsumierter Drogen und situativem Kontext. Von einem „weichen“ Konsummuster spricht man bei Probier- und Gelegenheitskonsum, der z.B. im Rahmen des Freizeitverhaltens geschieht, somit keinen zentralen Stellenwert im Alltag des Jugendlichen einnimmt und ferner auch nicht zur Lösung bestimmter Konflikte dient. Unter einem „harten“ Konsummuster wird ein gewohnheitsmäßiger oder exzessiver Konsum erachtet, der über besondere Anlässe hinausgeht und über einen längeren Zeitraum trotz konsumbedingt auftretender Schwierigkeiten (individuell + in Interaktion mit der Umwelt) anhält. Je höher die Dosis, je regelmäßiger der Konsum, je mehr andere Drogen konsumiert werden und je unangemessener die Situation, desto größer ist das Missbrauchs- bzw. Abhängigkeitsrisiko. Daneben sind die situativen Kontextbedingungen und das Einstiegsalter als signifikante Risikofaktoren eines problematischen Cannabiskonsums Jugendlicher zu erwähnen. (vgl. Kähnert 1999, S. 25)
Vor dem Hintergrund der oben ausgeführten Erläuterungen und den Ergebnissen aus Kapitel 4.1.1 lassen sich drei Konsumentengruppen mit verschiedenen Konsummustern und jeweils unterschiedlichen Konsummotiven ausdifferenzieren:
- Individualkonsumenten, die überwiegend alleine und zu Hause konsumieren (Gruppe A)
- Gewohnheitsmäßige Freizeitkonsumenten mit fast täglichem Konsum, die aber eine strikte Trennung zwischen Freizeit- und Arbeitsbereich einhalten (kein Konsum während Arbeit, Schule) (Gruppe B)
- Gewohnheitsmäßige Dauerkonsumenten mit täglichem Konsum im Freizeit- und Arbeitsbereich (Gruppe C)
(vgl. Landesstelle gegen die Suchtgefahren in Baden-Württemberg 1999, Artikel 3, S. 3 f.)
Zusammenfassend läßt sich festhalten, dass viele der beobachtbaren Probleme (z.B. psychische Abhängigkeit, Psychosen u.a. aus Tabelle 1) zum einen mit der Substanz an sich zu tun haben. Vielmehr müssen diese jedoch in Verbindung mit den beschriebenen Risikofaktoren (psychische Vulnerabilität, Einstiegsalter etc.) – unter Beachtung der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konsumentengruppe mit unterschiedlichen Motiven bzw. mit eher weichen („kontrolliert“) oder harten („unkontrolliert“) Konsummustern – gesehen und bewertet werden.
[...]
- Arbeit zitieren
- Benedikt Pohnke (Autor:in), 2003, Der Umgang mit Cannabis konsumierenden jungen Menschen in stationärer Jugendhilfe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14238
Kostenlos Autor werden




















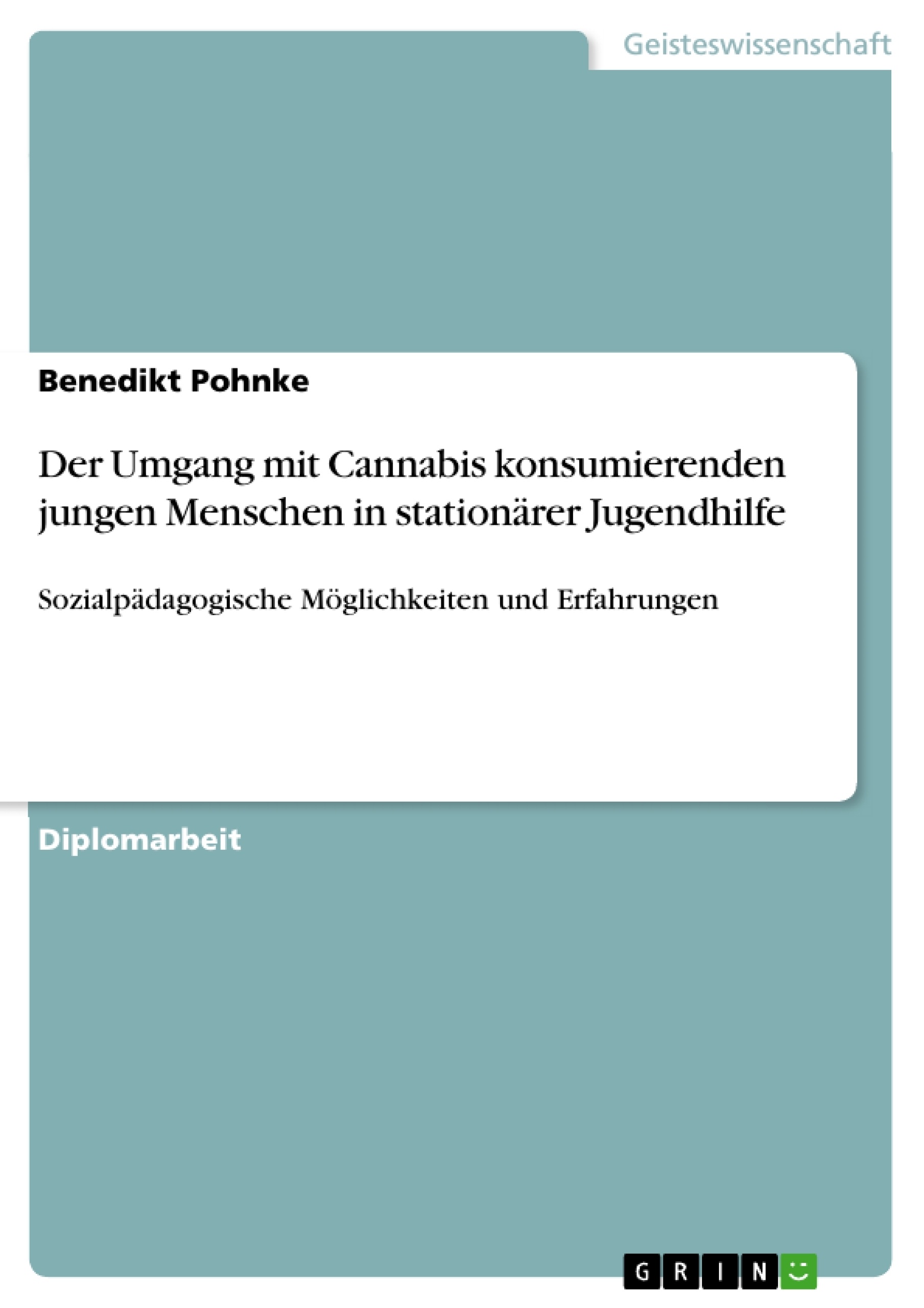

Kommentare