Leseprobe
Gliederung
Einleitung
Teil I Darlegung des theoretischen Konzeptes der Bindungstheorie
1 Entstehung und Begriff der Bindungstheorie
2 Begründer und deren grundlegende Erkenntnisse
2.1 John Bowlby
2.2 Grundlagen der Bindungstheorie
2.2.1 Die Postulate der Bindungstheorie
2.2.2 Das Konzept Bindung
2.2.3 Bindungsverhalten
2.2.4 Bindung
2.2.5 Das Explorationssystem
2.2.6 Phasen der Bindungsentwicklung
2.2.7 Mütterliches Verhalten
2.3 Mary Salter Ainsworth
2.4 Die fremde Situation
3 Bindungsqualitäten
3.1 Kategorie B :
Sicher gebundene Kinder in der Fremden Situation
3.1.1 Fürsorge verhalten von Eltern sicher gebundener Kinder
3.1.2 Auswirkungen der sicheren Bindungsqualität auf das Kind
3.2 Kategorie A: Unsicher-vermeidend gebundene Kinder in der Fremden Situation
3.2.1 Fürsorgeverhalten von Eltern unsicher-vermeidend gebundener Kinder
3.2.2 A uswirkungen der unsicher-vermeidenden Bindungsqualität für das Kind
3.3 Kategorie C: Unsicher-ambivalent gebundene Kinder in der Fremden Situation
3.3.1 Fürsorgeverhalten von Eltern unsicher-ambivalent gebundener Kinder
3.3.2 A uswirkungen der unsicher-ambivalenten Bindungsqualität auf das Kind
3.4 Kategorie D: Desorganisiert gebundene Kinder in der Fremden Situation
3.4.1 Fürsorgeverhalten von Eltern desorganisiert gebundener Kinder
3.4.2 A uswirkungen der desorganisierten Bindungsqualität für das Kind
3.4.3 Haupterscheinungsbild bei 6-Jährigen mit desorganisierter Bindung
4 Faktoren, die für die Entwicklung der Bindungsqualität von Bedeutung sind
4.1 Feinfühligkeit
4.1.1 Skalen zur Erfassung mütterlichen Verhaltens
4.1.2 Untersuchungen zur mütterlichen Feinfühligkeit
4.2 Zielkorrigierte Partnerschaft
4.3 Das internale Arbeitsmodell
4.4 Das Konzept der Bindungsrepräsentation
4.4.1 Das Adult-Attachment- Interview
4.4.2 Transgenerationale Perspektive
4.5 Haupt- und Nebenbindungsfiguren
4.6 Die Rolle des Vaters
4.6.1 Unterschiede zwischen Vätern und Müttern aus Sicht der Bindungstheorie
4.6.2 Untersuchungen zur Rolle des Vaters
4.7 Die Vertrauens- und Spielbeziehung im Dienste der Kompetenzentwicklung
4.8 Stabilität der Bindungsqualität
4.9 Bindung als Schutz- und Risikofaktor
5 Trennung von der Bindungsperson aus Sicht der Bindungstheorie
5.1 Bindungserfahrungen von Pflegekindern
5.2 Überlegungen zur Verarbeitung eines Traumas
5.3 Überlegungen zum Beziehungsaufbau des Pflegekindes zu den Pflegeeltern
Teil II Übertragung der Theorie in die Praxis
1 Fallbeispiel
1.1 Vorgeschichte der Mutter
1.2 Kindeswohlgefährdung
1.3 Mutter-Kind-Haus
1.4 Während des Pflegeverhältnisses
1.5 Die Pflegefamilie
1.6 Die Rückführung
1.7 Einleitung der sozialpädagogischen Familienhilfe
1.7.1 Erziehungskompetenzen der Mutter
1.7.2 Verhalten des Mädchens
1.7.3 Schilderungen des Mädchens über die Zeit in der Pflegefamilie
1.7.4 Erneuter Umzug
2 Interpretation des Falles
2.1 Feinfühligkeit der Mutter
2.2 Bindungsstil und Bindungsrepräsentation der Mutter
2.3 Bindung zur Mutter vor Einleitung der Vollzeitpflege
2.4 Arbeitsmodell des Mädchens vor Einleitung der Vollzeitpflege
2.5 Bindung zur Pflegemutter
2.6 Folgen von Trennung und Wiedereingliederung in die Familie
2.7 Bindungsmuster des Mädchens seit der Rückführung
2.8 Die Bindung zum Vater
3 Bindungstheoretische Unterstützungsmöglichkeiten für die Familie im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe
3.1 Überlegungen zur Arbeit mit der Mutter aus bindungstheoretischer Sicht
3.1.1 Grundhaltung der Mutter gegenüber
3.1.2 Umsetzung der Grundhaltung
3.1.3 Ziele und Umsetzung
3.2 Überlegungen zur Arbeit mit der Tochter aus bindungstheoretischer Sicht
4 “S T E E P” (Steps Toward Effective Enjoyable Parenting)
4.1 Bausteine des Programms
4.2 Das STEEP- Programm in Deutschland
5 Relevanz der Bindungstheorie und ungelöste Probleme
6 Literaturverzeichnis
7 Abbildungsverzeichnis
Einleitung:
In der vorliegenden Arbeit möchte ich die Bedeutung von Bindungen für die menschliche Entwicklung, die Folgen einer gestörten Bindung anhand der Bindungstheorie sowie deren praktische Relevanz für die sozialpädagogische Familienarbeit ausführen.
Die Bindungstheorie beschäftigt sich mit dem Bindungsaufbau des Kindes zur primären Bezugsperson. Die Qualität dieser Bindung ist, nach zahlreichen Untersuchungen, grundlegend für die Regulation von negativen Emotionen und beeinflusst somit auch die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes in nicht unwesentlichem Maße.
Die Bindungstheorie geht also davon aus, dass den primären Bezugspersonen für die Entwicklung des Kindes eine fundamentale Bedeutung zukommt und zwar umso mehr, je jünger das Kind ist. Wesentlich dabei ist, wie die Bezugspersonen mit dem Kind umgehen und so die Entwicklung seiner Persönlichkeit beeinflussen. In der vorliegenden Arbeit sollen daher die unterschiedlichen, die Bindungsqualität beeinflussenden Faktoren aufgeführt sowie theoretische Überlegungen über die Trennung von den Bindungspersonen und deren Konsequenzen herausgearbeitet werden.
Dieses Thema hat eine besondere praktische Relevanz für mich, da ich seit etwa einem Jahr als sozialpädagogische Familienhilfe in Multiproblemfamilien tätig bin. In vielen dieser Familien sind keine klaren Regeln, Strukturen und Sicherheiten zu erkennen. Zudem fallen häufige Trennungen und Beziehungsabbrüche auf.
Im Rahmen der Arbeit mit einer Familie, in der es bereits seit Geburt des Kindes immer wieder zu einschneidenden Veränderungen, z. B. in Form von Wohnungswechseln, Wechsel der Betreuungspersonen sowie Trennungen kam, führten die gängigen Herangehensweisen der sozialpädagogischen Familienarbeit nicht zu einer Verbesserung der Situation. Im Alter von zwei Jahren wurde bei dem Mädchen eine Kindeswohlgefährdung durch die Mutter festgestellt und es kam zur Unterbringung in einer Pflegefamilie. Nach etwa drei Jahren wurde die Tochter wieder in die Ursprungsfamilie rückgeführt, wobei im Rahmen des Pflegeverhältnisses kaum Kontakte zwischen Mutter und Tochter angebahnt wurden. Trotz größter Bemühungen war es mir nicht möglich, mit den herkömmlichen Methoden die Bindung zwischen Mutter und Kind in einem hinreichenden Maße zu intensivieren sowie
Einfühlungsvermögen und Verständnis der Mutter für die Situation der Tochter herzustellen.
Mit den herkömmlichen Theorien war es nur eingeschränkt möglich, die Problematiken zu erfassen und dann die richtigen Vorgehensweisen und Methoden zu wählen. Für eine gute und erfolgreiche Arbeit mit dieser Familie war es wichtig, mich in diese Theorie einzuarbeiten.
Um die theoretisch gewonnenen Erkenntnisse zu vertiefen und die Bedeutung für die praktische Tätigkeit aufzuzeigen, wird die Falldarstellung dieser Familie eine gewichtige Rolle in dieser Arbeit spielen.
Gang der Untersuchung:
Im ersten Teil der Untersuchung soll auf die beiden Gründungsfiguren der Bindungstheorie eingegangen und deren wichtigste Erkenntnisse vorgestellt werden. Nach einer kurzen Biografie von John Bowlby wird daher das Konzept von Bindung und grundlegende Elemente erläutert, um im Anschluss auf das Leben von Marry Salter Ainsworth und das von ihr konzipierte Verfahren die „Fremde Situation“ einzugehen.
Im zweiten Teil folgen Ausführungen zu den verschiedenen Bindungsmustern unter Einbeziehung des Fürsorgeverhaltens der Eltern und der Konsequenzen für das Kind, um daran anschließend diverse Faktoren aufzuzeigen, die die Bindungsqualität des Kindes beeinflussen.
Den Abschluss des theoretischen Teils bildet die Darstellung der Trennung von der Bezugsperson im Hinblick auf die Fremdunterbringung in Pflegefamilien.
Im nun folgenden praktischen Teil der Arbeit wird zunächst das bereits kurz angeführte Fallbeispiel ausführlich dargestellt.
Im zweiten Teil soll die zuvor ausgeführte Theorie auf das Beispiel aus der Praxis angewendet werden.
Im Rahmen der Interpretation werden Konsequenzen für die Arbeit mit dieser Familie aufgezeigt und durch ein auf die Bindungstheorie aufbauendes Präventionsprojekt ergänzt.
Abschließen werde ich die Arbeit dann durch meine persönliche Meinung zur Relevanz der Bindungstheorie sowie deren Schwachstellen und Probleme.
Teil I Darlegung des theoretischen Konzeptes der Bindungstheorie
1 Entstehung und Begriff der Bindungstheorie
Die Bindungstheorie entstand in der Auseinandersetzung des englischen Psychiaters und Psychoanalytikers John Bowlby mit der Psychoanalyse in den 1940er und 1950er Jahren (vgl. Grossmann/Grossmann 2003).
Folglich bestehen in der Theorie Berührungspunkte mit der Psychoanalyse, mit der sie die Auffassung teilt, dass frühkindliche Erlebnisse ein Schlüssel zur Erklärung der gesamten weiteren Entwicklung eines Menschen sind.
Bowlby erkannte aber die unbedingte Notwendigkeit von empirischer Forschung und grenzte sich klar von den nicht verifizierbaren Hypothesen der Psychoanalyse ab. Durch sein empirisches Vorgehen konnte sich die Bindungsforschung schließlich entwicklungspsychologisch und klinisch etablieren (vgl. Grossmann/Grossmann 2004 S. 33 - 34).
Klaus E. Grossmann und Karin Grossmann fassen die Theoriebildung Bowlbys wie folgt zusammen:
„Bowlby bemühte sich in seinem Leben um die Bewahrung wichtiger tiefenpsychologischer Einsichten, indem er die auf klinischen Einsichten und der Loyalität unter den Vertretern einer bestimmten Schule beruhende Lehre durch eine wissenschaftliche Theorie ersetzte und sie auf Beobachtbarem und Überprüfbarem aufbaute. An die Stelle von Phantasien setzte er tatsächliche Erfahrungen.“ (Grossmann/Grossmann 2003, S. 7)
Die praktische Umsetzung der Theorie gelang schließlich Mary Ainsworth, die 1950 zum Forschungsteam von John Bowlby gestoßen war, durch zahlreiche Feldbeobachtungen (vgl. Grossmann/Grossmann 2003).
Den Anstoß für sein lebenslanges Forschungsprojekt erhielt Bowlby in England während der Nachkriegszeit, als er als Kinderpsychiater Kontakt zu vielen Kindern hatte, die durch die Kriegswirren früh von ihren Eltern getrennt worden waren und zum Teil schwerwiegende Persönlichkeitsstörungen aufwiesen, für die sich zunächst keine befriedigende Erklärung finden ließ (vgl. Brisch 2006).
Die Bindungstheorie verbindet klinisch-psychoanalytisches Wissen mit evolutionsbiologischem[1] Denken (vgl. Grossmann/Grossmann 2004, S. 33).
Die evolutionsbiologische Komponente der Bindungstheorie tritt nach Klaus E. und Karin Grossmann durch die Annahme einer
„angeborenen Bereitschaft des Menschen und damit verbundene Notwendigkeit zur Bindung auf der Grundlage stammesgeschichtlicher Selektionsbedingungen“ (Grossmann/Grossman 2004, S. 29) hervor.
Bowlbys Theorie befasst sich mit der emotionalen Entwicklung des Menschen, mit dessen lebensnotwendigen und soziokulturellen Erfahrungen und vor allem mit den emotionalen Folgen, die sich aus negativen Bindungserfahrungen ergeben können. Sie war von Bowlby vor allem dazu geschaffen worden, um (vgl. Grossmann/Grossmann 2004) „die vielen Formen von emotionalen und Persönlichkeitsstörungen, einschließlich Angst, Wut, Depression und emotionale Entfremdung die durch ungewollte Trennung und Verlust ausgelöst werden, zu klären“ (Bowlby 2006, S. 44).
Bowlby wird zu den Pionieren der Entwicklungspsychopathologie gerechnet. Diese beschäftigt sich, im Unterschied zur Entwicklungspsychologie, mit von der Norm abweichenden Entwicklungsverläufen. Ausgehend von der Annahme, dass durch die Erforschung von normaler Entwicklung das Verständnis für abweichende Entwicklungsverläufe erweitert werden könne, teilt diese Disziplin mit der Entwicklungspsychologie deren Theorien, Methoden und Forschungsstrategien (vgl. Schleiffer 2009).
Eine der zentralen Aussagen von Bowlbys Theorie ist, dass der menschliche Säugling die angeborene Neigung hat, die Nähe einer vertrauten Person zu suchen. Fühlt er sich müde, krank, unsicher oder alleine, so wird Bindungsverhalten wie Schreien, Lächeln, Weinen, Klammern oder Nachfolgen aktiviert, welches die Nähe zur vertrauten Person wieder hersteilen soll. Das „räumliche“ Ziel dieser Verhaltensweisen ist Nähe, das Gefühlsziel ist Sicherheit. Aus den interaktiven und kommunikativen Erfahrungen, die der Säugling mir den Bertreuungsperson im Laufe der ersten Lebensjahre macht, resultiert schließlich die Bindung, die je nach Erfahrungen verschiedene „Färbungen“ bzw. Ausprägungen annehmen kann, die als unterschiedliche Qualitäten von Bindungen betrachtet werden können (vgl. Dornes 2002).
2 Begründer
Theorien werden von Menschen entwickelt. Oft, wenn nicht immer, sind sie tief mit der Biografie des jeweiligen Theoretikers verbunden und bringen etwas zur Sprache, das ihn aus sehr persönlichen Gründen interessiert. Bowlby litt wohl unter der Trennung von seinen Eltern und entsprechend wurde das Thema zu seinem Lebensthema. Diese Sichtweise ist nach Martin Dornes sicherlich vereinfacht, da auch andere nicht persönliche Faktoren eine Rolle spielen. Bei Bowlby spielten beispielsweise die Umweltbedingungen eine gewichtige Rolle. So gab es nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg - in der Zeit, in der er sich für Bindung zu interessieren begann - viele Kriegswaisen und selbst in den Fällen, in denen die Eltern noch vorhanden waren, war es im Rahmen von Evakuierungen häufig zu Trennungen gekommen (vgl. Dornes 2002).
Um die Hintergründe der Theorie besser nachvollziehen zu können, scheint es mir notwendig, im Folgenden einen knappen Einblick in die Lebensgeschichte von John Bowlby zu geben, um dann, im Anschluss daran, die Grundlagen seiner Theorie darzulegen.
Darauf folgend werde ich die Biografie der zweiten Gründungsfigur - Mary Salter Ainsworth - vorstellen sowie auf deren bedeutende Methode zur Verhaltensbeobachtung, die Fremde Situation, eingehen.
John Bowlby wurde am 26. Februar 1907 in London geboren und gilt als „Vater“ der Bindungstheorie. Er war das vierte von sechs Kindern. Sein Vater war ein erfolgreicher, vielbeschäftigter Arzt, die Mutter stammte aus einer Pfarrersfamilie. Den damaligen Gepflogenheiten folgend, wurde das Kind überwiegend von Hausangestellten erzogen. Die Familienatmosphäre wurde von Bowlby als ziemlich streng beschrieben.
Mit acht Jahren kam er auf ein Internat außerhalb Londons, in dem er sehr unglücklich war.
1925 nahm er ein Medizinstudium in Cambridge auf. Das Studium brach er allerdings ab, um an einer Schule für verhaltensgestörte Kinder zu hospitieren. Die Erfahrungen, die er dort machte, waren von großer Bedeutung für sein weiteres Leben.
Die Kinder waren während des Krieges von ihren Eltern getrennt worden und wiesen teilweise ausgeprägte Verhaltensstörungen auf, für die zunächst keine zufrieden stellende Erklärung gefunden werden konnte (vgl. Dornes 2002).
So schreibt Bowlby zu seiner Motivation, diese Lebensphase zu ergründen:
„Als ich in einer Kinderpsychiatrischen Anstalt arbeitete, traf es mich wie einen Schlag, dass es so viele ernsthaft gestörte Beziehungen zu Mutter-Figuren in der frühen Geschichte von Kindern und Jugendlichen gab, die wegen wiederholten Diebstahls - in die Klinik eingewiesen worden waren. Das veranlasste mich dazu, mich zu Forschungszwecken auf die Auswirkungen von Phasen zu konzentrieren, in denen ein Kind während der ersten fünf Lebensjahre von der Mutter-Figur getrennt ist, besonders auf solche Trennungen, bei denen das Kind an einem fremden Ort, mit fremden Personen zurückgelassen wird.“ (Bowlby 1991, S. 57)
Der Faktor, der die Diebe von den Klinikkindern unterschied, waren Hinweise auf eine längere Trennung von den Eltern; besonders auffällig war dies bei den Jugendlichen, die Bowlby als „gefühllos“ bezeichnete (vgl. Fonagay 2003).
1929 setzte er sein zuvor unterbrochenes Medizinstudium fort, mit dem Ziel, Psychoanalytiker und Kinderpsychiater zu werden, um seine Erkenntnisse über den Einfluss der Familie auf die Kindesentwicklung zu vertiefen. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm Bowlby den Auftrag, eine Abteilung für Kinderpsychotherapie in der Tavistock Clinic aufzubauen.
Bereits damals vertrat er die Auffassung, dass reale, frühkindliche Erlebnisse in der Beziehung zu den Eltern die Entwicklung eines Kindes essentiell bestimmen können und stellte damit den Stellenwert des Ödipuskomplexes[2] nach Sigmund Freud und dessen Lösung in Frage. Bowlbys Haltung bedeutete eine Abkehr von der Sexualität als wesentlichen Faktor für die emotionale Entwicklung eines Kindes (vgl. Dornes 2002).
Bowlbys erste Publikation, die sich mit der Wirkung von Umwelteinflüssen auf die frühkindliche Entwicklung beschäftigt, bezieht sich explizit auf die Erfahrungen mit jugendlichen Dieben. Er brachte damit die Erfahrungen, die er bereits zehn Jahre zuvor in dem Heim für sozial auffällige Jungen machte, in eine wissenschaftliche Form. Insgesamt studierte er 44 Fälle von Jugendlichen, wertete Aufzeichnungen aus und publizierte sie in dem Artikel "Forty-four juvenile thieves: Their characters and home life". Er wollte damit verdeutlichen, wie frühe emotionale Traumatisierungen durch Verlust- und Trennungserlebnisse die Entwicklung von Verhaltensstörungen beeinflussen können.
1958 entwickelte er in seinem Aufsatz "The nature of the child's tie to his mother" eine Theorie, nach der es ein biologisch angelegtes System der Bindung gibt. Seine Auffassung war von der ethologischen Forschung beeinflusst, insbesondere durch die Arbeiten von Nikolaas Tinbergen und Konrad Lorenz (vgl. Bolten 2009).
Weitere Überlegungen flossen 1958 in "Maternal Care and Mental Health" ein. Die Schrift basierte auf Erkenntnissen einer Studie, die Bowlby für die Weltgesundheitsorganisation WHO umgesetzt hatte und die ihn mit einem Schlag in Forscherkreisen berühmt machte. Seine Grundannahme besagt: Die lang andauernde Trennung eines Kindes von der Mutter ist, bei unzureichendem Ersatz, ein zentraler Risikofaktor für die seelische Entwicklung.
Der Forschungsgruppe von Bowlby schlossen sich unter anderen auch Mary Salter Ainsworth und James Robertson an.
Robertson drehte gemeinsam mit Bowlby einen beeindruckenden Dokumentarfilm mit dem Titel: ,,A two year old goes to hospital“. Dieser Film zeigt die verschiedenen Phasen des Verhaltens eines zweijährigen Mädchens, das ohne seine Mutter im Krankenhaus aufgenommen wird: Protest, Trauer und Anpassung. Das Echo auf diesen Film war sehr zwiespältig. Bowlby nutzte ihn aber,um gemeinsam mit Robertson die Besuchspraktiken in Kinderkliniken zu verändern. Heute wird die Mitaufnahme von Müttern in pädiatrischen Krankenhäusern bei der Einweisung von Kleinkindern nur noch selten in Frage gestellt (vgl. Brisch, 2006).
John Bowlby starb 1990 im Alter von 83 Jahren. Seine Ablehnung gegenüber strafender Kindererziehung war heftig. Er verabscheute die Art, wie Kindern, unter dem Vorwand, sie nicht “verderben“ zu wollen, Liebe und Zuneigung entzogen wurde.
Als seine größte Leistung kann nach Margarete Bolten (2009) die Zusammenführung der Psychoanalyse mit der Ethologie in der Bindungstheorie betrachtet werden (vgl. Bolten 2009, S. 57).
Im Folgenden soll ein Einblick in die Bindungstheorie und deren zentrale Bestandteile gegeben werden.
2.2 Grundlagen der Bindungstheorie
Bowlby betrachtet Mutter[3] und Säugling als Teilnehmer in einem sich wechselseitig bedingenden und selbstregulierenden System. Die Bindung zwischen Mutter und Kind innerhalb dieses Systems unterscheidet sich von „Beziehung“ dadurch, dass „Bindung“ lediglich als ein Teil des komplexen Systems der Beziehung verstanden werden kann (vgl. Brisch 2006).
Die Kernaussage Bowlbys Theorie ist:
Das Band, das sich fast immer zwischen einem Kind und dessen Mutterperson entwickelt, ist die Folge bestimmter vorprogrammierter Verhaltensmuster im Kind, die sich schnell und gezielt auf die Person richten, die sich um das Kind kümmert. Der Effekt ihrer Aktivierung ist es, Kind und Mutterperson nah zusammenzubringen und - zu halten - daher der umfassende Begriff „Bindungsverhalten“. Obwohl sich dieses Verhalten am häufigsten während der Kindheit zeigt, ist es charakteristisch für jedes menschliche Wesen jeden Alters. Bindungsverhalten schließt Weinen und Rufen mit ein - was Fürsorge hervorrufen soll - Nachlaufen, Berühren, Anklammern und auch heftigen Protest immer wenn ein Kind allein oder bei Fremden zurückgelassen wird (vgl. Bowlby 1991).
2.2.1 Die Postulate der Bindungstheorie
Ihre Grundannahmen heben die Bindungstheorie als eine Theorie der sowohl normalen als auch der abweichenden, pathologischen Entwicklung von anderen Theorien der Persönlichkeitsentwicklung und Psychopathologie ab. Bowlbys fünf wichtigste Postulate sind:
(1) Für die seelische Gesundheit des Kindes ist kontinuierliche und feinfühlige Fürsorge (siehe auch Kapitel 4.1 Feinfühligkeit) von großer Bedeutung.
(2) Es besteht eine biologische Notwendigkeit mindestens eine Bindung aufzubauen, deren Funktion es ist, Sicherheit zu geben und gegen Stress zu schützen. Eine Bindung wird zu einer erwachsenen Person aufgebaut, die vom Kind als stärker und weiser empfunden wird, so dass sie Schutz und Versorgung gewährleisten kann. Das Verhaltenssystem, das der Bindung dient, existiert gleichrangig und nicht nachgeordnet mit den Verhaltenssystemen, die der Ernährung, der Sexualität und der Aggression dienen.
(3) Eine Bindungsbeziehung unterscheidet sich von anderen Beziehungen vor allem darin, dass bei Angst das Bindungsverhaltenssystem aktiviert und die Nähe der Bindungsperson aufgesucht wird, wobei dann das Erkundungsverhalten aufhört (das Explorationsverhaltenssystem wird deaktiviert). Andererseits hört bei Wohlbefinden die Aktivität des Bindungsverhaltenssystems auf und Erkundungen sowie Spiel setzen wieder ein (siehe auch Kapitel 2.2.5 Das Explorationssystem).
(4) Individuelle Qualitätsunterschiede von Bindungen können an dem Ausmaß unterschieden werden, indem sie Sicherheit vermitteln (siehe auch Kapitel 3 Bindungsqualitäten).
(5) Mit Hilfe der kognitiven Psychologie erklärt die Bindungstheorie, wie früh erlebte Bindungserfahrungen geistig verarbeitet und zu inneren Modellvorstellungen (Arbeitsmodelle) von sich und anderen werden (siehe auch Kapitel 4.3 Das internale Arbeitsmodell)(vgl. Bowlby 2006).
Obwohl die Bindungsforschung zunächst nur das Verhalten kleiner Kinder bei Trennung untersuchte, wurde sie im Laufe der Zeit auf die ganze Lebensspanne ausgeweitet. Die Bindungstheorie erweist sich dort als tragfähig, wo eine schwächere
Person, unabhängig von ihrem Alter, den Schutz und die Fürsorge einer stärkeren Person benötigt (vgl. Grossmann/Grossmann 2004).
2.2.2 Das Konzept Bindung
Bindung ist nach Marry Ainsworth definiert als eine im Gefühl verankerte Beziehung, die eine Person zwischen sich und einer anderen Person ausbildet, die sie räumlich aneinander bindet und zeitlich Bestand hat (vgl. Main 1977). Bindungen sind selektiv und spezifisch. Eine schwächere Person bindet sich an eine Person, die ein häufiger Interaktionspartner ist und von der sie erwartet, dass sie Schutz und Fürsorge gewährt (vgl. Grossmann/Grossmann, 2004). Bowlby betonte, wie wertvoll Bindungen für das Überleben seien, da die Nähe zur Fürsorgeperson nicht nur größere Sicherheit biete, sondern auch weitere Vorteile wie Nahrung, Informationen über die äußere Welt, soziale Interaktion und Schutz vor räuberischen Wesen (vgl. Fonagy 2003).
Eine Person kann an mehr als eine Person gebunden sein, aber nicht an viele. Viele Kinder sind an mehrere Bezugspersonen gebunden, wobei es meist eine eindeutige Hierarchie der Bindungspersonen gibt (siehe Kapitel 4.5 Haupt- und Nebenbindungsfiguren).
Die Gefühle, die mit Bindungen einher gehen, können sehr unterschiedlich sein und je nach Situation variieren. So kann eine Bindung sicherlich mit Zuneigung und Liebe, aber auch mit Trennungsleid und Sehnsucht verbunden sein.
Trennungsleid ist dabei ein wesentliches Merkmal einer unterbrochenen Bindung im Unterschied zu einer freundschaftlichen Spielbeziehung (vgl. Grossmann/Grossmann, 2004).
2.2.3 Bindungs verhalten
Eine Bindung besteht noch nicht während der Geburt, sondern entwickelt sich erst im Laufe des ersten Lebensjahres. Sie entsteht aus den Verhaltensweisen eines Säuglings, die Nähe und Kontakt zu einem Erwachsenen herstellen und erhalten sollen (vgl. Main 1977). Das menschliche Neugeborene kommt vorbereitet mit bestimmten Verhaltensweisen auf die Welt, die gewährleisten, dass es von Anfang an durch seine
Bewegungen, seine Laute, seine Mimik und besonders sein Schreien deutlich signalisieren kann, was es braucht (vgl. Grossmann/Grossmann 2004). Diese Verhaltensweisen, durch die Nähe begründet und aufrecht erhalten werden soll, können in folgende Gruppen unterteilt werden:
(1) Signale, durch die das Kind die Aufmerksamkeit der Fürsorgeperson erregt (z. B. Lächeln)
(2) Aversive Verhaltensweisen (wie z. B. Schreien), die aber demselben Zweck dienen
(3) Aktivitäten der Körpermuskulatur (primäre Fortbewegung), durch die das Kind zur Fürsorgeperson gelangt
Das gesamte Verhaltenssystem dient dem allgemeinen Zweck, größtmögliche Nähe und Kontakt zur betreuenden Person in einer Vielzahl von Kontexten herzustellen (vgl. Fonagy 2003).
Die Gesamtheit dieser Verhaltensweisen werden Bindungsverhaltensweisen genannt. Die umsorgende Person - meist die Mutter - erkennt normalerweise diese Zeichen und wird versuchen, den Mangel zu beseitigen. Die bemutternde Person wird durch ihr fürsorgliches Verhalten zur Bindungsperson. Das heißt, der Säugling wird das Bindungsverhalten zunehmend auf diese Person richten. Dabei ist das Kind immer ein aktiver Interaktionspartner, der seinerseits signalisiert, wann Bedürfnisse nach Nähe und Schutz auftauchen und befriedigt werden sollen (vgl. Brisch 2006).
Bindungsverhalten ist somit jedes Verhalten, das Nähe oder Kontakt mit den besonderen Personen fördert oder herstellt. Weinen, rufen, sich nähern und berühren sind solche Verhaltensweisen. Da diese auch gegenüber Personen geäußert werden können, die nicht besonders bevorzugt und in Zeiten von Stress nicht aufgesucht werden, stehen sie zur Bindung nicht in einem Eins-zu-Eins-Verhältnis. Nach Bowlby und Ainsworth aktiviert Stress unweigerlich die Systeme des Bindungsverhaltens: die erforderliche Nähe variiert mit der Situation (vgl. Main 1977).
Die Bindungsverhaltensweisen behalten ihre Aufgabe - Nähe herzustellen - ein Leben lang, auch wenn diese Verhaltensweisen von älteren Kindern oder Erwachsenen eher in symbolischer und kulturell akzeptierter Form gezeigt werden z. B. durch Seufzen und Klagen statt Weinen, telefonisches oder schriftliches Rufen, das Anführen sachlich logischer Gründe für einen Besuch bei den Eltern usw. Die speziellen Muster von Bindungsverhalten, die von einem Individuum gezeigt werden, hängen zum Teil von Alter, Geschlecht und aktuellen Umständen ab und teilweise von Erfahrungen, die es bereits mit Bindungspersonen gemacht hat. Von großer Bedeutung sind Muster und Fürsorgepraktiken (siehe Kapitel 3 Bindungsqualitäten), um individuelle Unterschiede bei Persönlichkeitsentwicklung und seelischer Gesundheit zu verstehen (vgl. Bowlby 1991).
2.2.4 Bindung
Es ist wichtig, zwischen einer bestehenden Bindung und Bindungsverhalten zu unterscheiden. Bindungsverhalten wird nur unter Belastung gezeigt, aber eine Bindung besteht kontinuierlich über Raum und Zeit hinweg (vgl. Grossmann/Grossmann 2004).
Die Bindung bzw. Bindungsbeziehung ist eine Untergruppe der so genannten emotionalen Beziehungen, bei der eine bestimmte Person große emotionale Bedeutung für eine andere hat und deshalb nicht austauschbar ist. Die Nähe zu dieser Person wird angestrebt und eine Trennung löst Kummer aus.
Eine emotionale Beziehung wird dann zu einer Bindungsbeziehung, wenn der Einzelne daraus Sicherheit und Trost schöpfen kann. Während emotionale Beziehungen aber symmetrisch oder asymmetrisch sein können, sind Bindungsbeziehungen normalerweise zutiefst asymmetrisch: Die bemutternde Fürsorgeperson gewährt Schutz und wird als stark und helfend und das Kind als schutzbedürftig und hilflos wahrgenommen. Wenn aber ein Elternteil Sicherheit und Schutz bei einem Kind zu finden sucht, wird dies wohl Störungen beim Kind hervorrufen (vgl. Fonagy 2003).
Das wirft die Frage auf, woran man zuverlässig erkennt, ob ein Kind eine Bindung zu einer anderen Person entwickelt hat.
Eine Bindung zu einer Person besteht dann, wenn sich diese Person im Zentrum der Orientierung des Kindes, vor allem in belastenden Situationen und in fremder Umgebung, befindet (vgl. Grossmann/Grossmann 2004).
Mary Ainswort entwickelte eine Reihe von Kriterien, die auf das Bestehen einer Bindung zu einer anderen Person hinweisen. Diese wurden durch Karin und Klaus E. Grossmann (2004) in folgender Weise interpretiert:
1. „Das Kleinkind nutzt eine Bindungsperson als sicheren Hafen, also Ort der Sicherheit und des Schutzes, besonders in der fremden Umgebung. Bei Angst flieht es zur Bindungsperson. Ohne sie sind unvertraute Situationen belastender als mit ihr.
2. Eine Bindungsperson funktioniert als Sicherheitsbasis des Kleinkindes, von der aus es exploriert. Dabei vergewissert es sich stets wo die Bindungsperson ist und ob sie auf es achtet, selbst wenn es nicht direkt mit ihr spielen will.
3. Das Kleinkind protestiert in unvertrauter Umgebung gegen eine Trennung von der Bindungsperson. Es vermisst sie, wenn sie nicht da ist und lässt sich gut von ihr beruhigen.
4. Das Kleinkind wird eifersüchtig wenn die Bindungsperson Zuneigung zu einem anderen Kind zeigt.
5. Keine Bindung besteht wahrscheinlich dann, wenn das Kind keine Bevorzugung dieser Person bei Belastung erkennen lässt, sich wenig um ihren Verbleib kümmert, kein Trennungsleid oder Vermissen zeigt und keine Erleichterung und keinen Sicherheitsgewinn aus ihrer Gegenwart zieht.“ (K. Grossmann/K.E. Grossmann 2004, S. 219)
Um eine bestehende Bindung beobachten zu können, muss man auf eine unfreiwillige Trennung warten oder sie gezielt provozieren (siehe Kapitel 2.4 Fremde Situation) (vgl. Grossmann/Grossmann 2004). Unter diesen Umständen kann dann bei einem Kind Bindungsverhalten erwartet werden.
Wenn ein Kind müde, krank oder hungrig ist, sollte es bei einer Bindungsperson Schutz suchen. Auch wenn es in einer fremden Umgebung alleine ist oder wenn ihm fremde Menschen zu nahe kommen, sollte es unruhig werden und zur Mutter flüchten. Tut es dies nicht, ist entweder die Person keine Bindungsperson für das Kind oder es hat zu oft erfahren, dass eine Bindungsperson es nicht beruhigen wird, d. h. dass diese ihre Schutzfunktion zu selten oder gar nicht ausgeübt hat (vgl. Grossmann/Grossmann 2004).
Es gibt aber dennoch Kinder, die keine Bindung zu Bezugspersonen herstellen konnten, obwohl diese grundsätzlich physisch verfügbar sind. Nienstedt und Westermann nennen dieses Phänomen „psychisch elternlose Kinder“. Berücksichtigt man, dass sich bei einer minimalen zeitlichen und regelmäßigen Verfügbarkeit eine
Bindung entwickelt, wird deutlich, warum die Bindungslosigkeit dieser Kinder - die somit nicht einmal eine Minimalerfahrung gemacht haben - so schwer in ihrer weiteren Persönlichkeitsentwicklung wiegt. Es sind Kinder, die keine elterlichen Bezugspersonen erfahren haben, geschweige denn verinnerlichen konnten (vgl. Cappenberg 2005).
2.2.5 Das Explorationssystem
Das Bindungssystem wird in der Bindungstheorie als eigenständiges System mit dem Ziel, Schutz und Sicherheit zu erreichen, betrachtet.
Ohne Exploration und spielerisches Entdecken ist es einem Kind allerdings nicht möglich, seine Umwelt zu erkunden und neue Erfahrungen zu machen. Dies stellt einen wichtigen Grundstein für die Lernprozesse und die allgemeine Entwicklung des Kindes dar.
Bowlby nahm deshalb an, dass es neben dem Bindungsverhalten eine weitere Gruppe von Verhaltensweisen geben muss, die abwechselnd mit dem Bindungsverhalten auftreten und zwar immer dann, wenn sich die Kinder sicher fühlen.
Dieses Verhalten bezeichnete er als Explorationsverhalten und meinte damit das neugierige Erkunden der Umgebung.
Bindungs- und Explorationsverhalten stehen in einer wechselseitigen Beziehung. Kinder suchen dann die Nähe zur Bezugsperson, wenn sie unsicher sind oder sich unwohl fühlen (vgl. Bolten 2009). Das Explorationsverhalten bricht abrupt ab.
Die Abwesenheit der Bindungsfigur bzw. die Wahrnehmung einer Gefahr in Anwesenheit einer Bindungsfigur, die als nicht schützend erlebt wird, verhindert somit die Exploration.
Wenn sich das Kind allerdings sicher fühlt und die Bindungsfigur als unabdingbare sichere Basis erlebt, erkundet und exploriert es seine Umgebung. Deshalb kann, nach Peter Fonagay (2003) und vielen anderen Vertretern dieser Theorie, davon ausgegangen werden, dass sich eine sichere Bindung (siehe Kapitel 3) vorteilhaft auf eine Reihe kognitiver und sozialer Fähigkeiten auswirkt.
Erlebt das Kind also Angst und Furcht, wird Bindungsverhalten aktiviert, um die Nähe der primären Bindungsperson wieder herzustellen und somit Schutz zu gewährleisten.
Ist die schützende Person dann wieder verfügbar, sind diese Verhaltensweisen nicht mehr notwendig und die Angst und Furcht des Kindes wird abgeschwächt bzw. ganz aufgegeben. Das Kind kann wieder explorieren (vgl. Fonagy 2003, S. 15).
Die folgende Abbildung soll die Gegensätzlichkeit und Wechselseitigkeit der beiden Systeme verdeutlichen.
Kind fühlt sich sicher Kind fühlt sich unsicher
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Wechselseitigkeit von Exploration und Bindungsverhalten
2.2.6 Phasen der Entwicklung einer Bindung
Die Entwicklung einer Bindung durchläuft typischerweise vier Phasen. Die im Folgenden verwendeten Bezeichnungen für diese beziehen sich auf Karin Grossmann und Klaus E. Grossmann (2004), da mir deren Interpretation besonders anschaulich schien.
In der ersten Phase, der Phase der „unspezifischen sozialen Reaktionen“ kommen soziale Reaktionsweisen wie Horchen, Schreien oder Umklammern fast reflexartig vor und werden noch nicht spezifisch auf eine Person gerichtet (vgl. Grossmann/ Grossmann 2004). Während dieser Zeit kann der Säugling noch nicht zwischen Personen unterscheiden bzw. nur sehr beschränkt, indem er z. B. durch Hörreize unterscheidet. Nach John Bowlby dauert diese Phase von der Geburt bis mindestens zur 8. Woche, häufiger aber bis zur 12. Woche (vgl. Bowlby 2006/1975, S. 256 - 259).
In der zweiten Phase, die sich etwa bis zum 6. Monat erstreckt, reagiert der Säugling deutlich schneller und besser auf die Äußerungen und Verhaltensweisen der Mutter sowie der ihm vertrauten Personen. In dieser Phase, der „unterschiedlichen sozialen
Reaktionsbereitschaft“, richtet er nun seine sozialen Äußerungen bevorzugt an eine primäre Bezugsperson. Diese kann ihn z. B. eher zum Lachen oder zum Vokalisieren bringen und er lässt sich von ihr besser trösten und beruhigen.
Die dritte Phase, die Phase des „aktiven und initiierten zielkorrigierten Bindungsverhaltens“ findet etwa zwischen dem 6. Und dem 18. Lebensmonat statt (vgl. Grossmann/Grossmann 2004). Während dieser Phase ist das Kind nicht nur zunehmend wählerischer in seiner Behandlung von Personen, auch sein Repertoire an Sozialverhaltensweisen, aus denen sich die Bindungsverhaltensweisen deutlich hervor tun, erweitert sich. Das Kind beginnt nun der weggehenden Mutter verstärkt zu folgen, begrüßt sie bei ihrer Wiederkehr und nutzt die Mutter als sichere Basis von der aus es erkunden kann. Gleichzeitig nehmen die freundlichen und unterschiedslosen Reaktionen auf alle anderen Personen ab. Bestimmte Personen werden als untergeordnete Bindungspersonen ausgewählt, andere dagegen nicht. Fremde werden mit größerer Vorsicht behandelt und rufen nach und nach Alarm- und Rückzugsverhalten hervor (vgl. Bowlby 2006/1975).
Der mobile Säugling kann nun deutlich selbstbestimmter agieren, er kann sich zur Mutter hin oder sich von ihr weg bewegen. Durch Mimik oder Laute kann er auf die Bindungsperson einwirken, sie „korrigieren“ indem er sie z. B. durch Schreien zu sich holt. Weiterhin hat der Säugling nun eine rudimentäre Vorstellung von seiner Mutter als Quelle von Schutz, Trost und Wohlbehagen. In dieser Phase wird die Angst, von der Bindungsperson getrennt zu werden, besonders deutlich.
Die vierte Phase, die Phase der „zielkorrigierten Partnerschaft‘, beginnt erst, wenn das Kind sprechen kann und versteht, was die Bindungsperson beabsichtigt und wie es mit ihr verhandeln kann. Das Kind beginnt nun, die Motive der Bezugsperson zu verstehen und mit ihr zu verhandeln. Weiterhin geht die Trennungsangst zurück und das internale Arbeitsmodell bildet sich aus (vgl. Grossmann/Grossmann 2004). Auf diese Phase soll aber im Kapitel 4.3 genauer eingegangen werden, da sie für die weitere Entwicklung von herausragender Bedeutung ist.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass - nach John Bowlby - ein Kind in der ersten Phase eindeutig noch nicht gebunden ist. In Phase drei hingegen ist davon auszugehen, dass sich bereits eine Bindung ausgebildet hat. Ob und inwieweit ein
Kind in der zweiten Phase gebunden ist, hängt demnach von der jeweiligen Definition von „Bindung“ ab (vgl. Bowlby 2006/1975, S. 256 - 259).
2.2.7Mütterliches Verhalten
Ainswoth arbeitete die mütterliche „Feinfühligkeit“ in Bezug auf die Signale des Säuglings als entscheidende Determinante der mit einem Jahr festgestellten Qualität der Bindung heraus.
Feinfühliges Verhalten der Bezugsperson besteht darin, dass diese in der Lage ist, die Signale des Kindes wahrzunehmen, sie richtig zu interpretieren und sie auch angemessen und prompt zu befriedigen. Der Säugling entwickelt häufiger zu derjenigen Bezugsperson eine sichere Bindung, die durch ihr Pflegeverhalten seine Bedürfnisse feinfühlig in der oben beschriebenen Art und Weise befriedigt.
Werden dagegen die Bedürfnisse in der Interaktion mit der Bezugsperson gar nicht, nur unzureichend oder inkonsistent - etwa in einem für den Säugling nicht vorhersagbaren Wechsel zwischen Verwöhnen oder Überstimulation und zu großer frustrierender Ablehnung - beantwortet, entwickelt sich häufig eine unsichere Bindung (vgl. Brisch 2006).
Wie aber wird die Bindungsqualität festgestellt? Marry Ainswoth, eine kanadische Psychologin, die Bowlby in den 1950er Jahren kennen gelernt hatte, entwickelte Ende der 1960er Jahre eine Prozedur, mit deren Hilfe dieser zentrale Aspekt der MutterKind-Beziehung gemessen werden kann.
Sie ging davon aus, dass die Qualität der Bindung bei ein- und eineinhalbjährigen Kindern an ihren Reaktionen auf kurze Trennungen von der Mutter und vor allem an der Art und Weise, wie sie die Mutter bei deren Rückkehr begrüßen, abgelesen werden kann.
Sie entwickelte eine Standardprozedur zur Untersuchung dieses Trennungs- und Begrüßungsverhaltens, die so genannte „Fremde Situation“, die für die Bindungstheorie eine fundamentale Rolle spielt (vgl. Dornes 2002). Die Methode soll daher gleich ausführlicher dargestellt werden. Aber zunächst einige Informationen zur Person Mary Salter Ainsworth.
2.3 Marry Salter Ainsworth
Wenn John Bowlby als Vater der Bindungstheorie gilt, so darf Mary S. Ainsworth gewiss als „Mutter“ dieses psychologischen Ansatzes bezeichnet werden. In langjähriger Zusammenarbeit mit Bowlby festigte die Forscherin seine theoretischen Überlegungen empirisch.
Die im Dezember 1913 in Glendale (Ohio) geborene Mary Ainsworth wuchs in einem bürgerlichen Elternhaus auf.
Abb. 3: Mary Ainsworth, Quelle: pep Wöchentliche Ausflüge zur Bibliothek waren in ihrer Familie normal. Ainsworth sagte, dass ihre Eltern „hohen Wert auf eine gute aufgeschlossene geisteswissenschaftliche Erziehung” gelegt hätten. William McDougalls Schrift „Character and the Conduct of Life“, die sie mit 15 Jahren erstmals las, weckte ihren Wunsch, Psychologin zu werden (vgl. Dornes 2002).
Ihr Psychologiestudium nahm sie 1929 an der Universität von Toronto auf. Den Master absolvierte sie 1936. In ihrer Promotion im Jahr 1939 setzte sie sich mit der „Sicherheitstheorie“ von William Blatz auseinander, die besagt, dass Säuglinge und Kleinkinder Sicherheit und Vertrauen zu den Eltern entwickeln müssen, bevor sie bereit sind, sich in unbekannte Situationen zu begeben. Bereits in diesem Stadium ihrer Biografie wurde der Zusammenhang zwischen sicherer Bindung in der Kindheit und der damit verbundenen Fähigkeit zur unabhängigen Exploration deutlich. In dieser Theorie finden sich wesentliche Gedanken, die später in die Bindungstheorie eingingen (vgl. Bolten 2009).
Mehrere Jahre dozierte sie an der Universität. 1942 trat sie als Freiwillige in das Frauencorps der kanadischen Armee ein, in der sie den Rang eines Majors erreichte. Nach der Armee kehrte Ainsworth an die Universität von Toronto zurück, um dort weiter zu unterrichten.
Nach der Heirat mit Leonard Ainsworth im Jahr 1950 begleitete sie ihren Ehemann nach London. Dort fand sie eine Anstellung in Bowlbys Forschungsgruppe. Die Wissenschaftler untersuchten die Auswirkungen von frühen Mutter-Kind-Trennungen auf die kindliche Persönlichkeitsentwicklung. Durch die neue Mitarbeiterin erhielten die Untersuchungen neue Impulse - die Gruppe kam zu der Überzeugung, dass Persönlichkeitsentwicklungen von Kindern und Trennungen von der Mutter nur dann erforscht werden können, wenn die „normalen“ Mutter-Kind-Beziehungen in den Blick genommen werden (vgl. Brisch 2006).
Leonard Ainsworth übernahm 1954 eine Stelle beim East African Institute of Social Research in Uganda. Mary Ainsworth folgte ihm und begann in Uganda mit der längsschnitllichen Untersuchung von Mutter-Kind-Beziehungen im freien Feld. 1956 zog das Ehepaar Ainsworth nach Baltimore. Mary Ainsworth lehrte dort an der John Hopkins Universität.
Die Veröffentlichung der Auswertungen zum Uganda-Projekt „Infancy in Uganda“ erschien 1967. Ainswoth hatte in Uganda eine Skala zur Messung der mütterlichen Feinfühligkeit entworfen (siehe Kapitel 4.1.2 Untersuchungen zur mütterlichen Feinfühligkeit), die für ihre weitere Forschung von außerordentlicher Bedeutung werden sollte. Auch eine erste Klassifikation einjähriger Kinder in sicher gebundene, unsicher gebundene und noch nicht gebundene wurde vorgenommen (vgl. Dornes 2002).
„Dabei wurde das Schreiverhalten der Kinder als Indikator ihrer Bindungsqualität betrachtet. Als sicher gebunden wurden Kinder angesehen, die wenig schrien, als unsicher die Vielschreier und als noch nicht gebunden diejenigen, die kein spezifisches Bindungsverhalten der Mutter gegenüber zeigten, d. h. die sich z. B. von fremden Personen genauso gut trösten ließen wie von der Mutter.“ (Domes 2002, S. 26)
1962, zwei Jahre nach der Scheidung von Leonard, setzte sie ihre Studien zur MutterKind-Bindung in Baltimore fort.
Ihr neues Projekt, die Baltimore-Studie, basierte auf der Analyse von siebenundzwanzig Eltern-Kind-Paaren, deren Interaktion anhand von Direktbeobachtungen im elterlichen Haushalt untersucht und dokumentiert wurde. Die Familien wurden im Abstand von drei bis vier Wochen jeweils etwa drei bis vier Stunden lang beobachtet. Untersucht wurden: die face-to-face Interaktion, die Häufigkeit kindlichen Weinens, der kindliche Gehorsam, das Begrüßen der Mutter usw. Für alle diese Verhaltensweisen ergaben sich signifikante Unterschiede in Abhängigkeit von der mütterlichen Feinfühligkeit.
Es wurde festgestellt, dass 84 % der sicher gebundenen Kinder, die feinfühlige Mütter haben, wesentlich kooperativer gegenüber deren Wünschen waren als unsicher gebundene. Hingegen folgten nur 38 % der unsicher gebundenen Kinder den Forderungen der Mutter (vgl. Dornes 2002).
Marry Aisworth legte sehr großen Wert auf die direkte Beobachtung und verfeinerte ihre Methode zur Untersuchung der Eltern-Kind-Beziehung immer mehr. Auf der Basis der Untersuchung von einjährigen Kindern in deren natürlicher Umgebung entwickelte sie schließlich eine standardisierte Verhaltensbeobachtung im Labor, die „stränge situation“ (Fremde Situation), die in der Folge für die Bindungstheorie eine enorme Bedeutung gewann.
Die Ergebnisse dieser experimentellen Untersuchung bestätigten die Erwartungen, nämlich dass Kinder bei Anwesenheit der Mutter mehr explorierten als bei Abwesenheit und auch mehr als bei Anwesenheit eines Fremden.
Besonders aufschlussreich waren die Verhaltensweisen, die die Kinder zeigten, wenn die Mutter den Raum verließ oder wenn sie zurückkehrte (vgl. Bolten 2009). Die Analyse dieser Verhaltensweisen ist der Kern der Fremden Situation, die im Folgenden kurz dargestellt werden soll.
1999 starb Mary Ainsworth im Alter von 86 Jahren nach längerer Krankheit in Charlottesville, Virginia (vgl. Dornes 2002).
2.4 Fremde Situation (strange situation)
Auf der Basis der Untersuchung an einjährigen Kindern in deren natürlicher Umgebung entwickelte Ainsworth eine standardisierte Verhaltensbeobachtung im Labor, die „strange Stiuation“ - oder Fremde Situation - um Bowlbys Bindungsmodell in einer standardisierten Situation beobachtbar zu machen. Diese Testsituation ermöglichte, bei 12 - 18 Monate alten Kindern sowohl das Bindungsverhalten als auch das Explorationsverhalten zu aktivieren. Angenommen wurde, dass durch die Trennung von der Bezugsperson in der für das Kind fremden Umgebung das Bindungsverhalten aktiviert wird und somit die Qualität der Mutter- Kind-Bindung beobachtet werden kann. In Anwesenheit der Mutter sollten die Kinder sich sicher fühlen und in der Lage sein, die Umgebung zu erkunden. Wenn die Mutter das Kind verlässt, sollte das Kind mit Bindungsverhalten (Weinen, Suchen, Rufen, Nachfolgen, Anklammern usw.) reagieren. Jedoch beobachteten die Forscher nicht bei allen Kindern das zuvor hypothetisch angenommene Bindungs-und Explorationsverhalten (vgl. Bolten 2009). Die Durchführung erfolgt in 8 Episoden - jede ist maximal 3 Minuten lang -, die nach einem festgesetzten Schema ablaufen, so dass die Situation für alle Kleinkinder vergleichbar ist.
Folgende Abbildung beschreibt die Abfolge der Episoden und die Schwerpunkte der Beobachtung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Stuhl der Mutter steht dabei deutlich abseits vom Spielzeug, so dass klar zwischen Bindungs- und Explorationsverhalten unterschieden werden kann (vgl. Grossmann/Grossmann 2004).
Es wurden drei Gruppen von Kindern identifiziert. Die sicher gebundenen Kinder, die unsicher-vermeidend gebundenen Kinder und die ambivalent-vermeidend gebundenen Kinder. Allerdings zeigte nur die erste Gruppe der Kinder das vorhergesagte Wechselspiel zwischen Bindungs- und Explorationsverhalten. Bei den beiden anderen Gruppen war entweder das eine oder das andere Verhalten stärker ausgeprägt (vgl. Bolten 2009). Im Folgenden sollen diese Gruppen von Bindungsqualitäten mit ihren Auswirkungen ausführlich erläutert werden.
3 Bindungsqualitäten
In Ainswoths Baltimore-Studie waren 68 % der Kinder sicher gebunden, 20 % vermeidend und 12 % ambivalent.
Interkulturelle Untersuchungen in Deutschland, Japan und Israel haben gezeigt, dass die Häufigkeitsverteilung in anderen Kulturen variieren kann (vgl. Dornes 2002).
Das Bindungsverhalten ist keine angeborene Eigenschaft, sondern wird vor allem durch die Merkmale der Mutter-Kind-Beziehung geprägt.
Die verschiedenen Bindungsmuster entwickeln sich also aus der Anpassung des Kindes an das Verhalten seiner Bezugsperson. Mütterliches und kindliches Verhalten stehen dabei in einer wechselseitigen Beziehung (vgl. Bolten 2009).
3.1 Kategorie B: Sicher gebundene Kinder in der Fremden Situation
Bei diesen Kindern ist in der Fremden Situation eine angemessene Balance zwischen Nähe zur Bezugsperson und explorativem Verhalten zu beobachten (vgl. Brisch 2006). Die Bindungsperson dient diesen Kindern als sichere Basis zur Erkundung der Umwelt und Meisterung von Herausforderungen angesichts neuer Situationen sowie als Halt gebende und notfalls auch Grenzen setzende Instanz.
Sicher gebundene Kinder suchen in belastenden Situationen aktiv die Nähe zur Bindungsperson, sie lassen sich trösten und nutzen sie als sichere Basis (vgl. Scheuerer-Englisch 2004).
Von einer Fremden lassen sich sicher gebundene Kinder kaum trösten, aber unter Umständen zur Neuaufnahme des Spiels überreden.
Sie suchen Nähe und Körperkontakt wenn die Mutter zurückkommt, begrüßen diese freundlich und beginnen nach kurzer Zeit wieder mit ihr zu spielen (vgl. Mende 2000). Dabei kommunizieren sie belastende Gefühle von Kummer und Ärger offen und geben damit der Bindungsperson klare Signale über ihre aktuellen Bedürfnisse. Dies ermöglicht eine korrekte Eischätzung der Beziehungssituation als Handlungsgrundlage (vgl. Scheuerer-Englisch 2004).
Sicher gebundene Kinder sind zuversichtlich in Bezug auf die Verfügbarkeit der Bindungsperson. Das heißt, während des gesamten Ablaufs der Fremden Situation zeigen sie ein positives Verhalten gegenüber ihrer Mutter (vgl. Brisch 2006).
[...]
[1] Nach William R. Charlesworth versteht man unter Ethologie „die umfassende Erforschung des Verhaltens in seiner natürlichen Umgebung“ (Charlesworth 1977, S. 14).
[2] Nach Freuds Theorie durchlaufe jedes Kind die so genannte "ödipale oder "phallische Phase“, welche zwischen dem dritten bis fünften Lebensjahr auftrete und von sexuell-triebhaften sowie aggressiven Wünschen geprägt sei. In dieser Phase fühle sich das Kind zum jeweils gegengeschlechtlichen Elternteil hingezogen und sehe dabei den gleichgeschlechtlichen Elternteil als großen Konkurrenten an (vgl. Barth 1997).
[3] Wenn in dieser Arbeit von "Mutter" gesprochen wird, ist aus Gründen der Einfachheit immer die primäre Bezugsperson gemeint. Also diejenige Person, die mit dem Kind quantitativ den häufigsten Kontakt hatte, was in unserer heutigen Gesellschaft im Allgemeinen die Mutter ist.
- Arbeit zitieren
- Anja Ostermann (Autor:in), 2009, Bindungstheorie. Bedeutung für die sozialpädagogische Familienarbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142245
Kostenlos Autor werden


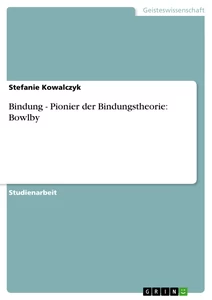


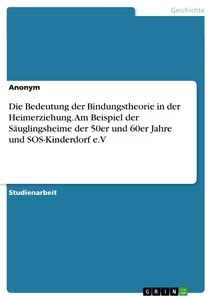








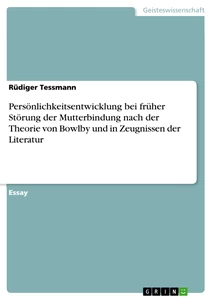
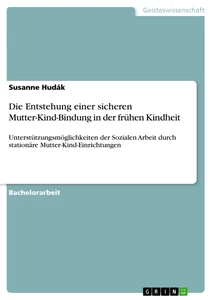

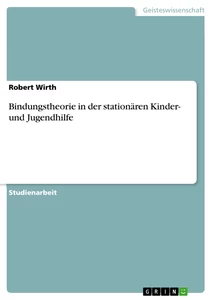





Kommentare