Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
I. EINLEITUNG
II. DAS MUSEUM ALS MEDIUM
2.1. Begriff und Geschichte - Entwicklung des Museums
2.2. Das Phänomen Musealisierung - Die Musealisierung der Gegenwart
2.3. Museum und Repräsentation
2.3.1. Faktoren der Repräsentation
2.3.1.1. Das Objekt
2.3.1.2. Die Kontextualisierung
2.3.1.3. Die kommunikativen Strategien
2.3.1.4. Der Rezipient und die Rezipientenaktivität
2.4. Die Konstruktion von Bedeutung
2.5. Das Museum als Ort der Vermittlung - "Lernort Museum"
2.5.1. Museumspädagogik - Versuch einer Verortung
2.5.2. Von der Museumspädagogik zur Museumsdidaktik
2.5.3. Museumsdidaktik
2.6. Das Museum als kommunikativer Ort mit Freizeitqualitäten
2.6.1. Das Museum in Konkurrenz mit anderen Medienformen
2.7. Zusammenfassung: Das Museum als Medium
III. MULTIMEDIA - NEUE MEDIEN - HYPERMEDIEN
3.1. Das Museum entdeckt Multimedia
3.2. Neue Medien und das Museum
3.3. Hypermedien
3.4. Traumgebilde: Universalmedium
3.4.1. Eine Maschine, der nichts unmöglich
3.4.2. Echt oder Unecht? - Das tatsächliche Bild
3.4.3. Die Perspektive des Rezipienten im hypermedialen Raum
3.5. Zusammenfassung: Multimedia - Neue Medien - Hypermedien
IV. MULTIMEDIA IN MUSEEN
4.1. Medien im Museum und Museumskommunikation
4.2. Der gegenwärtige Einsatz der Multimedia-Technologien im Museum ..
4.2.1. Das Haus der Geschichte der BRD als Fallbeispiel
4.2.1.1. Einsatz audiovisueller Medien im Haus der Geschichte
4.2.1.2. Medienkonzeption der Dauerausstellung
4.2.1.3. Erfahrungen und Ausblick
4.2.2. Hamburger Kunsthalle - Galerie der Gegenwart als Fallbeispiel
4.2.2.1. Das Medienkonzept
4.2.2.2. Medienziele
4.2.3. Resümee aus der Besucherforschung
4.3. Bildungspark oder Erlebnisstätte - Versuch einer Bilanz
4.4. Museum und Multimedia - Entwicklungstendenzen
4.4.1. Mobile Computing im Museum
4.4.2. Die CD-ROM
4.4.3. Museum und Internet
4.4.3.1. Das Projekt LEMO: Lebendiges virtuelles Museum Online
4.4.4. Vernetzung von Museen
4.5. Zusammenfassung: Multimedia im Museum
V. SCHLUSSBETRACHTUNG
VI. GLOSSAR
VII. QUELLEN UND LITERATURVERZEICHNIS
DANKSAGUNG
FÜR MARTA
In diesem Rahmen, möchte ich mich für die Geduld und die allgegenwärtigen Unterstützung bei meinen Töchtern Marta Melanie, Marta Maria und Charlotte, sowie für das Verständnis bei meinem Sohn Leonard bedanken.
Zudem, mein tiefster Dank, für die unschätzbare Hilfe meiner Eltern.
I. EINLEITUNG
„Die neuen Informationstechniken werden im Zweifelsfall den Museen aufgezwungen werden, auch wenn sie sich ihnen verschließen wollen: Die sich in der Gesellschaft entwickelnden Standards der Informationsvermittlung werden Erwartungshaltungen beim Besucher herausbilden, denen auch das Museum auf Dauer wird entsprechen müssen.“ (RICHARTZ 1995)
Museen sind Orte, die heute neben den klassischen Funktionen des Sammelns, Bewahrens, Erforschens, die zentrale Aufgabe der Bildung besitzen. Wenn vom Bildungsauftrag der Museen die Rede ist, wird die Vorbemerkung nötig, dass Bildung begrifflich außerordentlich eng mit Lernen verbunden ist; es gibt keine Bildung, ohne dass gelernt wird. Und Lernen ist - ein wenig anders als "Bildung" - sehr stark mit negativen Assoziationen, Vorurteilen und emotionsgeladenen Bewertungen besetzt. Deshalb vorweg noch eine Prämisse: Lernen ist nicht das Gleiche wie Arbeit, aber auch nicht das Gleiche wie Spaß. Lernen wird oft mit Arbeit assoziiert, weil schulische Erfahrungen mit Lernen oft bedrückende, anstrengende, aber auch entfremdete Elemente aufweisen. Lernen muss jedoch nicht zwangsläufig in diesem Sinne verstanden werden: Lernen kann Freude machen, lebendig sein, phantasievoll und kreativ eigene Interessen verwirklichen. Aber wiederum ist Lernen auch etwas anderes als Freude, Spaß, Erlebnis oder Unterhaltung. Lernen setzt eine zielgerichtete Auseinandersetzung mit einem Gegenstand voraus; und Lernen steht in einem engen Zusammenhang mit der Entwicklung menschlicher Identität. Lernen ist etwas, was in der Person und mit der Person geschieht und das während und durch eine Interaktion erfolgt. Vor diesem Hintergrund wird untersucht, was das Museum als einen Ort der Vermittlung ausmacht, denn das Museum der Gegenwart ist nicht mehr nur Ausstellungsort, sondern vor allem auch Lernort. Schon für Alfred Lichtwark, der ab 1886 die Hamburger Kunsthalle leitete, hatte das Museum einen öffentlichen Bildungsauftrag wahrzunehmen und deshalb entschieden kunstpädagogisch vorzugehen. Mit seinem berühmt gewordenen Satz: „Wir wollen nicht ein Museum, das dasteht und wartet, sondern ein Institut, das thätig in die künstlerische Erziehung unserer Bevölkerung eingreift.“1, war nicht nur der pädagogische, sondern auch der künstlerische Aspekt gemeint: die Mitwirkung am zeitgenössischen Bild von Kunstgeschichte. Wie Klaus Weschenfelder und Wolfgang Zacharias fordern, dass „[d]ie Bildungsaufgabe des Museum sich nicht darin erschöpfen [kann], allein fachliche Information über das Sammelgut bereitzustellen. Es muß darüber hinaus das Museum als Medium und als Ort besonderer Kommunikation nutzbar gemacht werden für eine gesellschaftliche Entwicklung. [Da] nicht mehr die Thesaurierungsfunktion [sammeln, bewahren, dokumentieren, ausstellen, interpretieren etc.] des Museums im Vordergrund [steht], sondern die Aufgabe, die Sammeltätigkeit in einen verantwortungsvollen, gesellschaftlich wertenden Kontext zu stellen. Das Museum hat also zweierlei Verantwortung: eine Verantwortung für die Erhaltung des kulturellen und natürlichen Erbes und eine Verantwortung für die weitere Entwicklung der menschlichen Gesellschaft. Damit wird auch die Bildungsfunktion der Museen neu bewertet.“2 Fast jedes Museum ist heute als fester Bestandteil der modernen Informationsgesellschaft zu sehen. Durch die rasanten Entwicklungen der Informationstechnologie haben Museums- Inhalte eine neue Dimension bekommen: Sie sind Informations-Einheiten, die in der erkennbar werden Wissensgesellschaft auch außerhalb des Ortes Museum wertvoll und wesentlich sind, d.h. dass das Museum die neuen Technologien sowohl intern als auch extern nutzen kann.
"Neue Medien" bzw. "Multimedia" in Museen charakterisiert eine Thematik, die gegenwärtig und aktuell ist, diesbezüglich befindet sich der theoretische Diskurs erst in der Entwicklung. Begriffe wie "Besucherforschung", "Besucherorientierung" oder "Publikumsverhalten" finden erst allmählich Anwendung. Bis auf wenige Standardwerke, beispielsweise Compania Media (1998), Weschenfelder/Zacharias (1992), Noschka-Roos (1994), Fast (1995), Wohlfromm (2002), Billmann (2004), liegt aktuelle Literatur zum größten Teil nur in Aufsatzform vor oder ist derzeit nur im World Wide Web (www) veröffentlicht. Die Annäherung an das Thema erfolgt aus diesem Grunde deduktiv, nicht zuletzt, weil es nur in wenigen Fällen möglich ist, wissenschaftliche Standpunkte gegeneinander zu diskutieren. Die dieser Arbeit zugrunde liegende Fachliteratur stammt größtenteils aus den Bereichen der Pädagogik, Kunstgeschichte, Museologie, Medien - und Informationswissenschaft und schon innerhalb einer Disziplin werden dem Begriff »Museum« oder »Multimedia« die verschiedensten Formen subsumiert. Museen sind z. B. Kunst-, Technik- oder Spezialmuseen. Neuen Medien bzw. Multimedia können nicht nur CD-ROM und Internet benennen, sondern beispielsweise auch interaktives Fernsehen, Virtual Reality oder Handy meinen. Einer systematisch orientierten Konzeption folgend bedarf es zunächst einmal einer differenzierten Erörterung des Handlungsschauplatzes, des Museums selbst, um die museumspädagogische Arbeit auf eine breite und gesicherte Basis zu stellen. Diesbezüglich erfolgen im zweiten Teil ein historischer Abriss der Entwicklung von Museen sowie der Versuch einer Verortung des Begriffs ›Museumspädagogik‹. Hieran wird die Kommunikationssituation im Museum analysiert und die Faktoren benannt, die dort an der Konstruktion von Bedeutung beteiligt sind. Insofern wird dabei herausgearbeitet, welche Kommunikationsmechanismen als museumsspezifisch aufgefasst werden können und von Relevanz bei der Formulierung von Anforderungen an mediale Anwendungen sind. Des Weiteren wird im 2. Kapitel aufgezeigt, dass ›Museumsmacher‹ auf didaktische Mittel angewiesen sind, um ihren Vermittlungsauftrag gerecht werden zu können, d.h. dass gerade die museumspädagogische Arbeit, vor allem aber kommunikative Arbeit, diesem Vermittlungsauftrag der Museen zwischen Objekt und Besucher insofern entsprechen muss. Museumsbesucher besitzen die unterschiedlichsten Interessen, Bedürfnisse wie Vorabinformationen und genau an dieser Stelle können interaktive multimediale Anwendungen ansetzen, indem sie den Besuchern unterschiedliche Informationsebenen anbieten. Untersuchungsgegenstand des 3. Kapitels sind somit die spezifischen Eigenschaften der ›Neuen Medien‹, dabei wird auf die Begrifflichkeit von ›Multimedia - Neue Medien - Hypermedien‹ eingegangen. Im Hinblick auf den Anwendungsbereich Museum wird auch die Möglichkeit der perspektivischen Standortveränderung in multimedialen Anwendungen diskutiert. Der vierte Teil befasst sich mit der Schnittmenge der vorausgegangenen Kapitel, mit Neuen Medien im Museum und zeigt das Nutzungsspektrum sowie den gegenwärtigen Einsatz multimedialer Anwendungen auf. Im Vordergrund der Überlegungen steht die Grundannahme, dass die Nutzung multimedialer Anwendungen in Museen den Prinzipien der klassischen Museumsarbeit nicht widerspricht, sondern dass sie eher den charakteristischen Anforderungen der Museumskommunikation entgegenkommen und sich dadurch zur Nutzung anbieten. Anhand von zwei Fallbeispielen, die in Bezug auf Präsentation und Vermittlung in Kontextmuseum und Objektmuseum unterschieden werden, lässt sich die Grundannahme untermauern, dass das besondere Potential medialer Anwendungen der spezifischen Kommunikationssituation im Museum entgegenkommt, d.h. auch, der so oft prognostizierte Verdrängungswettbewerb findet nicht statt. Die Neuen Medien haben die Medienlandschaft verändert und diese Entwicklung wird fortschreiten, dennoch in der bisherigen Geschichte der gesellschaftlichen Kommunikation hat es noch keinen Fall der vollständigen Verdrängung eines Mediums gegeben.
II. DAS MUSEUM ALS MEDIUM
2. 1. Begriff und Geschichte - Entwicklung des Museums
Als »Museum« bezeichnete Orte sind nicht nur zahlreich, sondern auch sehr heterogen.3 Bei genauerem Hinsehen erweist es sich als ziemlich problematisch, eine Definition zu finden, die dem Museumswesen in seiner heutigen Ausformung gerecht wird und dabei die Maßgaben bezüglich der Aufgaben und Bestimmung des Museums beinhaltet. Zu den Grundlagen des zeitgenössischen Museumswesens gehören neben den allgemein kulturgeschichtlichen Aspekten ebenso die sozialen wie psychologischen Ursachen und Bedingungen des menschlichen Sammelns dazu. Weschenfelder und Zacharias führen in psychologisch nachvollziehbarer Weise die Institution »Museum« auf den Sammeltrieb des Menschen zurück, da die Lust am Sammeln ein „intuitiver Trieb“ sei, der schon beim Kleinkind ausgeprägt wäre.4
Etymologisch lässt sich das Wort »Museum« vom Griechischen »mouseίon« herleiten. In der Antike war das Mouseίon der Musensitz bzw. Musentempel zunächst einfach nur eine den Musen geweihte Stätte. Später bezeichnete es öffentliche Sammlungen im kultischen Bereich, aber auch Lehrstätten und Schulen. Das im 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria gegründete Mouseίon für die Sammlungen von Ptolemäus Philadelphos beinhaltete neben Büchern und wissenschaftlichen Instrumenten auch Kunstwerke. Festhalten lässt sich, dass die im antiken Griechenland als Mouseίon bezeichneten Kultstätten zwar Kunst- und Raritätensammlungen mit einschlossen, konstitutiv aber die Idee einer Akademie vorlag.5
Die Museen heutiger Ausprägung haben nach Walter Grasskamp (1981) ihren Ursprung in den privaten, kirchlichen oder herrschaftlichen Sammlungen des Mittelalters und ihre Wurzeln liegen in den Schatzhorten, Reliquien-, Kunst- und Raritätenkammern, Naturalienkabinetten etc. In den so genannten Schatz- und Wunderkammern der feudalen Herrscher der Renaissance wurden Relikte der klassischen Antike, Statuen, Inschriften, Gemmen, Münzen und Manuskripte, magische Gerätschaften, Goldschmiedearbeiten und andere Kuriositäten wahllos zusammengetragen, mit dem Ziel, durch die Anhäufung von Werten und bedeutenden Schätzen Macht und Reichtum zu demonstrieren.
„Die Exklusivität dieser Kunst- und Wunderkammern des 16. und 17. Jahrhunderts hielten auch die Gemäldegalerien und Antikenkabinette des 18. Jahrhunderts bei, wobei je nach der Großzügigkeit und dem Reputationsdrang der feudalen Sammler bereits Künstlern und Bürgern Besuchsmöglichkeiten eingeräumt wurden, die jedoch in der Regel von der persönlichen Erlaubnis des Sammlers oder seiner Verwalter abhängig waren.“6 Jedoch werden auch diese mittelalterlichen Schatz- und Wunderkammern nicht als die direkten Vorfahren der heutigen Museen anerkannt. Es verdanke sich das heutige Museumswesen vielmehr einem Paradigmenwechsel, der eng mit der Aufklärung, also mit der Entstehung der kulturellen Moderne, gekoppelt ist.7 Die heute existierende Museumskultur, als bürgerliche, zumindest als programmatisch demokratisch gedachte Bildungsinstitution, ist allerdings erst ein Erzeugnis der letzten zweihundert Jahre. Zu den ersten Museen im heutigen Sinn gilt das British Museum8 (1753) in London und der Louvre (1793) in Paris. Der Louvre (zunächst: Musée Français, dann Musée Central des Arts, schließlich Musée Napoléon), das erste öffentliche Museum mit enteignetem Kunstbesitz von Adel und Kirche sowie napoleonischer Kriegsbeuten, galt mit öffentlichen Führungen, Katalogen und freiem Eintritt als staatliche Bildungsinstitution.9 In Deutschland hingegen gehen die ersten öffentlichen Museen meist auf monarchische Initiativen10 zurück, die „[...] zwar auch auf den Gedanken der Aufklärung [basierten], aber durch ihre Mischung von feudaler Repräsentation und bürgerlicher Geschichtsdemonstration [...] den emanzipierten Bildungscharakter des franzosischen Revolutionsmuseums [modifizierten]“.11 Im 18. Jahrhundert etablierten sich Museen also in Form eigener Gebäude, die im zunehmenden Maße für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Der Aufgabenbereich der Museen bestand nun nicht mehr nur ausschließlich in der reinen Zur-Schau-Stellung, sondern auch in der wissenschaftlichen Bearbeitung, systematischen Klassifizierung und Forschungsarbeit wie in der Entwicklung von Auswahl-, Organisations- und Präsentationsprinzipien.12 Museumsgründungen, die auf private und bürgerliche Initiativen zurückgehen, entstanden nach 1848, wie beispielsweise das Bremer Kunstmuseum, getragen vom Bremer Kunstverein oder das heutige Wallraff-Richartz-Museum in Köln 1861, gestiftet durch Johann Heinrich Richartz.13 Die bedeutende Zeit der großen europäischen Museumsbauten wurde das 19. Jahrhundert: ›Altes‹ und ›Neues‹ Museum Berlin, Alte Pinakothek München, National Gallery London, Rijksmuseum Amsterdam, Neue Eremitage St. Petersburg, Kunsthistorisches Museum Wien. Das Konzept der Museen des 19. Jahrhunderts war universal, die Bestände der Sammlungen erhoben den Anspruch auf Vollständigkeit wie Ganzheit und wuchsen kontinuierlich an, da die Bezugnahme auf Geschichte, Tradition und Herkunft die identitätsstiftende Kraft jener Zeit war und im bürgerlichen Museum ihre Institutionalisierung fand. Jedoch wurde damals die Institution Museum als kulturelles Gedächtnis zwingend notwendig, da sich das kulturelle Selbstverständnis über Vergangenheit und deren Traditionen definierte und deshalb Objekte als Zeugen des Vergangenen benötigte. „Das Museum war bereits die Institution, die die soziale Selbstvergewisserung durch die Vergegenwärtigung historischer Prozesse durch Objekte, ›Zeugen‹, stützen soll.“14 Im Gegensatz zur Kunst- und Wunderkammer, in der Kuriositäten und Raritäten gesammelt wurden, war und ist das Museum ein Medium, das sich über den Bezug zur Vergangenheit definiert.
Das Museumswesen des 19. Jahrhunderts ist allerdings auch durch eine „[...] zunehmende und bis in die Gegenwart reichende Spezialisierung“15 gekennzeichnet, vor allem der eher nicht-künstlerischen Museen. War der Begriff »Museum« im frühen 19. Jahrhundert noch gleichzusetzen mit Kunstmuseum (d.h. klassisches Altertum, Spätgotik, Renaissance), öffnete es sich ein wenig später für bis dahin eher unbeachtet gebliebene Gebiete und Epochen: Kunstgewerbe, Völkerkunde und Kulturgeschichte. An der Spitze der Museumshierarchie standen nach wie vor die Kunstmuseen als Bewahrer der europäischen Hochkultur, in ihnen sah das Zeitalter die Höchstleistungen der zivilisierten Menschheit.16 Als man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf die erste Phase der Industrialisierung zurückblicken konnte, vollzog sich als Reaktion eine weitere Differenzierung der Museumstypen, die Museen öffneten sich dann auch für Technik und Naturwissenschaften. Eine pädagogisierende, auf die Öffentlichkeit ausgerichtete Diskussion mit den Konsequenzen, der erweiterten Öffnungszeiten, Kooperationen mit Schulen und Ansätzen musealer Vermittlungsarbeiten, war ab der Jahrhundertwende im Zuge der allgemeinen Volksbildungsbewegung zu verzeichnen. Die Entwicklung des Museums als Institution kam während der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts weitgehend zum Stillstand und nach 1945 waren die Restaurationsarbeiten die zentrale Aufgabe der Museen. Erst die 60er Jahre brachten durch die bildungspolitischen Diskussionen und Auseinandersetzungen das Museumswesen wieder in Bewegung und die Bedeutung musealer Vermittlungsarbeit ist heute unbestritten, sowie dass die Berücksichtigung des Publikums ein Allgemeinplatz geworden ist. Heute steht „das Museum [...] anderen Herausforderungen gegenüber, die sein Selbstverständnis, seine Aufgaben, seine Finanzierung, seine Form betreffen.“17 Festhalten lässt sich, dass sich das Museum zwar sehr zaghaft, aber doch stetig wandelte vom individuellen Statussymbol des Adels zum staatlichen Statussymbol: „Während sie [die Museen] vorher vor allen Dingen der Repräsentation oder der Dokumentation persönlicher Macht einzelner dienten, wurden sie nun als Bauwerk und mit ihren Sammlungen zum Prestigeträger des Staates.“18
So spiegeln die Museen, wie wir sie heute kennen, nur eine äußerst kurze Phase innerhalb der Kunstgeschichte wider, denn die Ansätze, die das Museum und seine Vorformen durchlaufen haben, sind vielgestaltig. Zwei Aspekte sind jedoch gleich bleibend:
„1. Das mediale Prinzip der Ausstellung von Objekten hat sich bei allen Unschärfen und Unterschiedlichkeiten bewährt. Nach wie vor besuchen Menschen Museen und Ausstellungen. Der Kontakt mit den ›Originalen‹ hat offenbar einen Reiz, den andere mediale Erfahrungen nicht ersetzen können.
2. Das Museum ist immer Abbild des kulturellen Selbstverständnisses der Gesellschaft, in der es existiert. Welche Gegenstände als erhaltens- und ausstellenswert befunden werden, nach welchen Prinzipien sie geordnet werden oder auch nicht, gibt Auskunft über den Begriff von Geschichte, den die jeweiligen kulturellen Bilder- oder Meinungsmacher haben oder bewußt konstruieren. Die Art der Vermittlungsarbeit in Museen und die Öffnung für bestimmte Publika zeigen Bildungsstrukturen und -ideal einer Epoche.“19
2. 2. Das Phänomen Musealisierung - Die Musealisierung der Gegenwart
Das alles veraltet und nichts ewig währt, ist keine Neuigkeit. Relativ neu ist, dass fast alles immer schneller veraltert, denn gleich wo man hinschaut, wenn der Blick spezialisiert und die Wahrnehmung dafür geschärft ist: Alltägliche und hochkulturelle Musealisierungsphänomene.20 „Die Dinge, die Zeiten und Bedeutungen, die Ordnungen und Orientierungen sind durcheinandergeraten - sie mischen sich neu, oder besser, sie halten sich in Bewegung und geraten dadurch untereinander in immer wieder veränderte Konstellationen, Beziehungen: Die neue Unübersichtlichkeit (Habermas) macht die Welt unzuverlässig und ohne den vermeintlichen Sinn, aufs Ganze gesehen.“21
Das 20. Jahrhundert mit seinen revolutionären Entwicklungen und technischen Fortschritten hat eine Kurzlebigkeit von technischen Geräten aller Art, Wohnungseinrichtungen, Kunststilen etc. hervorgebracht und „[i]m Gegensatz zur Verlangsamung des menschlichen Reproduktionszyklus [...] werden die Eltern von Gegenständen immer jünger, ja, sie scheinen kaum der Pubertät entwachsen, schon gebären sie ihre Nachfolger und siechen dahin. Was aber geschieht mit diesen Abfallprodukten der postmodernen Evolution? Werden sie weggeworfen? Nein. Es mag nicht überraschen: Sie werden zu Museumsobjekten.“22
Immer noch ist für unser spezifisch modernes kulturelles Zeit-Verhältnis die progressive Intensität unserer Zuwendung zur Vergangenheit, dies ist am Vorgang der zunehmenden Musealisierung unserer kulturellen Gegenwart deutlich ablesbar, denn die Museumsdichte nimmt dramatisch zu. Zählte das Handbuch der Museen für die Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 1971 gut 1500 Museen, lag deren Zahl im Jahre 1981 bereits bei knapp 1800 und 1998 über 5000.23 Die Zahlen charakterisieren deutlich den Trend, dass immer mehr Lebensbereiche zum Gegenstand musealer Behandlung werden: Neben die klassischen Gattungen der Kunstmuseen, natur- und technikhistorischen sowie kulturgeschichtlichen Museen sind Spezialmuseen getreten; Post-, Schmuck-, Erotik-, Sanitärbedarf-, Fußballmuseen etc. haben ihren Platz wie ihre Besucher. Die Auswahl der Objekte und Gegenstände, die als »museumswürdig« bzw. »erhaltenswert« eingestuft wurden, war bei dem frühen Museum und seinen Vorgängern noch folgend definiert: auserlesen, wertvoll, selten, einzigartig, etc., zunächst in der Kunst, später im 19. Jahrhundert dann auch in kultur- und technikhistorischen sowie in naturwissenschaftlichen Gebieten. Heute dagegen erleben wir eine Aufwertung all dessen, was als »alt« erachtet wird, und dass muss nicht einmal sehr alt sein. Auch die Eigenschaften, wie beispielsweise selten oder wertvoll, sind nicht mehr die einzigen Kategorien, um Objekte als erhaltenswert für die Nachwelt zu qualifizieren. Nach Wohlfromm, ergeben sich „[a]us dieser allgemeinen Hochschätzung des ›Alten‹ zwei Tendenzen, die sich vielleicht als ›postmoderner Historismus‹ auf der einen Seite und als ›Musealisierung der Gegenwart‹ auf der anderen Seite bezeichnen lassen.“24 Unter ›postmoderner Historismus‹ wird in diesen Kontext „[...] die nostalgische Hinwendung zu Zeiten, in denen die Entwicklung noch nicht so schnell fortschritt, mit dem Ziel, Geschichte und Vergangenes in unserer Zeit weiterleben zu lassen, verstanden werden.[...] Mit ›Musealisierung der Gegenwart‹ ist dagegen der Trend gemeint, immer jüngere und immer alltäglichere Dinge oder Phänomene als erhaltenswert und in Vorahnung des Ablaufs ihrer funktionalen Lebensphase als bedeutsam zu bewerten.“25 Michael Fehr bezeichnet diese Gegebenheit als „paradoxe[s] Phänomen, [...], daß Industriegesellschaften, also Gesellschaften, die durch raschen technischen Wandel, hohen Objektverschleiß und schwindendes Traditionsbewußtsein gekennzeichnet sind, historische Objekte dennoch überaus wichtig nehmen und in eigens dafür errichteten Institutionen, den Museen, zu erhalten versuchen.“26 Es lässt sich außerdem beobachten, das nicht nur ein dringendes Bedürfnis zur Erhaltung von Kulturgütern besteht, sondern auch die Bereitschaft und das Interesse der Öffentlichkeit, sich in die dafür geschaffenen Institutionen (Museen und Ausstellungen) zu begeben und diese zu betrachten. Die Besucherzahlen in der Bundesrepublik haben sich in den 90er Jahren beim Stand von über 90 Millionen Besuchern pro Jahr eingependelt.27 Im Jahr 2004 wurden insgesamt über 100 Millionen Besucher registriert.28 Es scheint, dass die Museen und Ausstellungen von beiden Seiten tangiert werden, im Hang der Besucher zum postmodernen Historismus und der Musealisierung der Gegenwart, der neue Wirkungsbereiche erschließt. Da die Vergangenheit offensichtlich immer näher rückt, ist das Museum nicht mehr ausschließlich eine Institution des Vergangenen, sondern muss vor allem dessen Verbindung zum Heute, zum Gegenwärtigen herstellen, eben weil sich die Gegenwart so schnelllebig erneuert, ist ein Medium notwendig, das die historischen Prozesse, die zur Gegenwart geführt haben, beschreibt und diese überhaupt erst als Bestandteil eines Prozesses verständlich macht. Und Museen sind Medien, die dies leisten sollten.
Ein wesentlicher Bestandteil der offiziellen Definition des ICOM29, des International Council of Museums, ist jener Aspekt, dass das Museum ein Konservierungs- und Ausstellungsort von Relikten früherer Epochen unserer kulturellen Evolution sei. Nun nimmt jedoch für jeden erkennbar „[...] die Menge der Kulturrelikte pro Zeiteinheit mit der Geschwindigkeit zu, mit der sich unsere Kultur von Wissenschaft bis zur Wirtschaft und von der Technik bis zur Kunst strukturell ändert. Je rascher unsere Zivilisation sich evolutionär ändert, um so größer wird in jeder Gegenwart der Anteil derjenigen Zivilisationselemente, die evolutionär bereits ausselektiert, also veraltet sind.“30 Demzufolge läßt sich festhalten, dass mit dem „[...] änderungsgeschwindigkeits- abhängigen Anfall von Kulturrelikten pro Zeiteinheit auch die Museumskapazität zunehmen [muß]“31, wenn das Museum der kulturelle Ort der Bewahrung und Präsentation von Kulturgütern und -relikten ist. Unweigerlich lässt das die Frage aufkommen: Aus welchen Gründen wirft gerade die sogenannte Wegwerfgesellschaft nichts mehr weg, sobald sich nur ein Hauch des Historischen oder Nostalgischen erkennbar zeigt? Oder wie Herrmann Lübbe seine Schlüsselfrage formuliert, die zum Verständnis der kulturellen Verfassung unserer Gegenwart aufkommen mag: „Wieso werden abgelegte Gebrauchsgegenstände, Plunder also, heute massenhaft in den Adelsstand von Antiquitäten erhoben?“32 Eine psychologisierende Erklärung des Phänomens liegt eventuell nahe, greift nur nicht den Kern der Frage und befriedigt dadurch nicht so recht: „Weil die Postmoderne uns mit ihrer Schnellebigkeit überfordert, keine verläßlichen Zukunftsprognosen mehr möglich sind, der persönliche Kontrollverlust lebensbestimmender Faktoren immer mehr Vertrauen in unbekannte Größen erfordert, persönliche, ›authentische‹ Umwelterfahrung in Konkurrenz mit medialem Erleben tritt, hat das Interesse an konkret erinnerbarer, die eigene Erfahrung bestätigende Geschichte, Konjunktur. Je näher die dargestellte Geschichte, desto besser.“33 Eine "Krise der Linearität" wie Vilém Flusser es formuliert oder eine "temporale Identitätsdiffusion" wie Lübbe es nennt, d.h. ein Durcheinander von Zeiten, Ordnungen und Orientierungen zu konstatieren ist nur folgerichtig.34 Nur wodurch resultieren das Interesse und die Bereitschaft an dieser nahen Darstellung von Geschichte bzw. historischen Abläufen? Lässt sich aus dieser Anteilnahme wirklich eine Kompensation dessen ableiten, was an Beständigkeit nicht mehr erfahrbar ist? „Durch die progressive Musealisierung kompensieren wir die belastenden Erfahrungen eines änderungstempobedingten kulturellen Vertrautheitsschwundes.“35 Oder ist es die Freude, der Genuss am Bekannten allein, der dann als Erlebnis zählt? Norbert Bolz deutet das Interesse an Geschichte als fetischistische Neigung: „Das Chaos der Geschichte verwandelt sich in eine Requisitenkammer des Heimischen. [...] Geschichte wird zum Museum. [...] Mit Mnemosyne36 hat das allerdings wenig zu tun - Postmoderne ist keine Gedächtniskultur. An die Stelle von Erinnerung und Eingedenken treten Zitat, Recycling, Sampling und Konsum. Daß Museen heute so beliebt sind und häufig frequentiert werden, zeugt also gerade nicht für historisches Bewußtsein. Das neue Interesse an der Geschichte ist fetischistisch. Die Erinnerung wird konkret zum Souvenir. Gerade weil wir in einer Zeit nach dem Ende der Geschichte leben, wird Geschichte als ästhetisches Präparat und Zeit-Alibi interessant. Museen sind die Souvenirläden der Weltgeschichte.“37 Die sichtbare äußerliche Veränderung, die seit einigen Jahren in den Museen zu beobachten ist, passt natürlich gut in dieses Bild. Museumsshops wie die obligatorischen Museums-Cafés sind Bestandteil eines jeden Hauses und müssen nicht unbedingt als Ergänzung des Museumsbesuches genutzt werden, da sie durchaus eine eigene Anziehungskraft besitzen. „Ich meine, [so argumentiert Bolz] man muß Museen wie auch naturschutzparkartige präparierte Landschaften im Kontext von Phänomenen wie Weltausstellung, Messe, Kaufhaus und Mall sehen. Sie präsentieren uns nach dem unüberbietbaren Muster von Disneyland die Welt als Vorstellung und Ausstellung.“38 Als Fazit lassen sich zwei Bedürfnisse am Phänomen Musealisierung ablesen, die für das Museum und seine Entfaltung bedeutsam sind: „Erstens das Bedürfnis nach Wiedererkennen, Bekanntheit, Vertrautheit in einer schnellebigen Zeit: d.h. das Entdecken von persönlichen Bezügen. Zweitens das Bedürfnis nach Erkenntnis im Sinne von Einsicht in die Prozeßhaftigkeit von Geschichte und Verortung der eigenen Gegenwart darin.“39
2. 3. Museum und Repräsentation
In ihrer Entfaltung haben die Museen wie auch ihre Vorläufer mit den verschiedenartigsten Modellen versucht, die "Welt" abzubilden. In den früheren Ansätzen des Museums ist ein explizit universalistischer erkennbar: „Die Welt sollte konzentriert, verkleinert dargeboten werden. Besonders dankbare Objekte der Betrachtung sind in dieser Hinsicht die Kunst- und Wunderkammern des 16. und 17. Jahrhunderts [z.B. Miniaturversionen des Universums]. Gewöhnlich unterteilt in die beiden Objektgattungen ›Naturalien‹ und ›Artefakte‹, sonst aber von rätselhafter Struktur, zeigen sie natürlich nicht die verkleinerte Welt, aber ein Abbild der Vorstellung von ›Welt‹.“40 Diesen universalistischen Anspruch vertreten die Museen des 20. und 21. Jahrhunderts nicht mehr, wichtig bleibt jedoch die Feststellung, dass die Ordnung der Dinge im Museum ein Abbild der Vorstellung über einen gewissen Komplex ist. Oft gerät dabei Folgendes aus dem Blickfeld: „Das Museum kommt durch seine vermeintliche Objektivität (›die Dinge lügen nicht‹) authentisch und unbestechlich daher. Daß jedoch auch heute jede museale Zur-Schau-Stellung lediglich ein Abbild einer Vorstellung, das nach ihm eigenen inszenatorischen Gesetzen realisiert wird, und nicht die objektive Darstellung eines Sachverhaltes ist, [...].“41 Und wie Henrietta Lidchi es beschreibt, geht es nicht nur um die Interpretation von Sachverhalten oder Begebenheiten, sondern um die Konstruktion von Bedeutungen: „[...] a museum does not deal solely with objects but, more importantly, with what we could call, for the moment, ideas - notions of what the world is, or should be. Museums do not simply issue objective descriptions or form logical assemblages; they generate representations and attribute value and meaning in line with certain perspectives or classificatory schemas which are historically specific. They do not so much reflect the world through objects as use them to mobilize representations of the world past and present.”42
2.3.1. Faktoren der Repräsentation
Im Museum ist eine Fülle von Faktoren an dieser Konstruktion von Bedeutungen beteiligt. Die wesentlichsten Faktoren sind „[...] das Objekt, seine Kontextualisierung, die kommunikativen Strategien, die zur Vermittlung von mit dem Objekt verbundenen Informationen benutzt werden, und der Rezipient.“43
2.3.1.1. Das Objekt
„Die Historizität von musealen Objekten verbietet den Schluß, daß Anschaulichkeit auch ›Bedeutung‹ erschließt.“
(WESCHENFELDER; ZACHARIAS 1992)
Von vornherein stimmt die Annahme, dass es ohne Objekt kein Museum gibt nicht ausschließlich, soll jedoch für die folgende Betrachtung als Hypothese gelten. Wie die Auseinandersetzung um das Phänomen Musealisierung gezeigt hat, kann schlicht alles zum Museumsobjekt werden. Im Folgenden soll als "Objekt" ein herkömmliches und klassisches, wie in seiner Größe eingeschränktes, materielles Museumsobjekt verstanden werden, um eine theoretisch fundierte Erörterung zu ermöglichen, wie beispielsweise ein Bild, eine Skulptur, ein ausgestopfter Säbelzahntiger oder eine Vase, eine Maschine. Eine Klassifizierung von Museumsobjekten findet meist in der museumstheoretischen Literatur statt, um die Genese der Bedeutung bzw. des Bedeutungswandels differenzierter charakterisieren zu können.
Beispielsweise werden folgende Klassen unterschieden:
- „Natürliche (im Zweifelsfall konservierte) Gegenstände, die ›nur‹ materielle Qualitäten mitbringen und nicht mit von Menschen beigegebenem Symbolgehalt angefüllt sind, z.B. Fossilien, Flora, Fauna.
- Gebrauchsgegenstände, die vom Menschen geschaffen oder bearbeitet wurden, jedoch nicht mit symbolischer Bedeutung aufgeladen sind, sondern nur das bedeute(te)n, wozu sie gemacht waren, z.B. Werkzeuge, Maschinen.
- Gebrauchsgegenstände, die mit Symbolgehalt angefüllt sind, z.B. rituelle Kleidung.
- Kunstwerke als explizit mit Symbolgehalt angefüllte Objekte, die nicht zum Gebrauch geschaffen sind.“44
Die Grenzziehungen zwischen derartigen Objektklassen sind dennoch problematisch, da sich auch Zweck und Bedeutung dieser Objekte ändern können.45 Das lässt die Frage aufkommen: Wie exakt verhält sich die Aussagekraft von Objekten? Wohlfromm dazu: „Im Objekt wirken zwei Kompetenten aufeinander: die Gestalt, die physische Existenz, die irgendwo ›dabei‹ war, und die Bedeutung, Aussagekraft [...], die es transportieren soll.“46 Diese beiden Kräfte bezeichnet Gottfried Korff als Materialität und Medialität. „Die Materialität sichert Dauerhaftigkeit und Anschaulichkeit. Im Vergleich zu anderen Zeichen, wie etwa Emotionen und Gedanken, sind Dinge, Objekte, Artefakte oder Überreste besonders konkret und permanent. Dies sind Eigenarten, die augenscheinlich auf der physischen Struktur der Dinge basieren. [...] Unbestritten ist [...], daß Dinge eine Erinnerungskraft besitzen; zumindest wird man der ›Erinnerungsveranlassungsleistung‹ von Dingen einen hohen Rang zumessen müssen. Auf ihr beruht die Arbeit des Museums. Aus der Materialität des Museums leitet sich dessen zweites Spezifikum ab: die Medialität. Dinge sind Zeugen, die Informationen über Vergangenes zu geben imstande sind. [...] Museumsobjekte sind [...] Kommunikationswerkzeuge zwischen dem Sichtbaren und Unsichtbaren, zwischen der Materialität des Anschaubaren und der ›Immaterialität‹ des Erinnerbaren.“47 Und das hat zur Folge, dass nicht Abbilder besichtigt werden wollen, sondern Originale, Echtes, Eigentliches und Authentisches, denn die Funktionsweise des Museums beruht auf Authentizität, auf dem Prinzip der ›Zeugenschaft‹.48 Natürlich ist der Umgang mit den Begriffen »Original« oder »Authentizität« durchaus heikel und ob die Unterscheidung von Echtheit und Abbild noch oder gerade heute in unserer Zeit zutrifft und relevant ist, soll an anderer Stelle wieder aufgegriffen werden. Für den Besucher allerdings, und darin besteht das delikate Detail, ist es überhaupt nicht nachprüfbar, ob er ein ›echtes‹ Objekt oder eine Reproduktion vor sich hat, ob das Objekt korrekt ausgewiesen ist oder nicht. Diese »Faszination des Authentischen« führt Korff erneut auf die ambivalenten Qualitäten des Objektes zurück: „Den Grund für die ›Faszination des Authentischen‹ bildet das den Objekten eingelagerte Spannungsverhältnis von sinnlicher Nähe und historischer Fremdheit, das Ineinander von zeitlich Gegenwärtigem und geschichtlich Anderem. Diese Ambivalenz bewirkt, daß Originalobjekte Vergangenheit nicht nur heranrücken, sondern sie auch fernhalten - aufgrund der eigenartigen Fremdheit, die authentischen Dinge inkorporiert ist. Dem Gegenstand zugleich nah und fern zu sein, in den Horizont einer anderen Zeit einzurücken und doch in der eigenen zu bleiben - von diesem Spannungsverhältnis geht die Präsentation und Inszenierung historischer Objektensembles in Museen und Ausstellungen aus.“49 Zu bedenken ist jedoch, wenn von historischen Objekten die Rede ist, dass es sich um einen bereits selektierten Bestand handelt, denn nur solche Objekte stehen noch zur Verfügung, die materiell die Jahre oder Jahrtausende überdauern konnten. Aus diesen bereits dezimierten Beständen, wurden wiederum nur einige Objekte nach bestimmten und historisch wechselnden Kriterien ausgewählt. Und meist wurde und wird diese Entscheidung von einzelnen Personen getroffen, die mit dem jeweiligen individuellen Verständnis von Fachgebiet, Thematik oder Historie urteilen. In Museen findet daher eine doppelte Selektierung statt, weil zunächst entschieden wird, welche Objekte überhaupt in die Bestände des Hauses aufgenommen werden und dann wiederum, welche Objekte überhaupt der Öffentlichkeit präsentiert werden. Festhalten lässt sich jedoch, dass Objekte mit Eintritt ins Museum einem Funktionswandel unterliegen, „[...] der sowohl ihre Herauslösung aus dem ursprünglichen Zusammenhang als auch ihre Position innerhalb des neuen strukturellen Gefüges betrifft.“50 Die Aufgabe des Museums besteht nun darin, Objekte neu zu positionieren, zu inszenieren, es erfolgt also die Re- Kontextualisierung der Objekte, wobei die Rekonstruktion nie vollständig gelingen kann. Allerdings ermöglicht die Mehrdimensionalität des symbolischen Objekts auch, es je nach den Ausstellungsintentionen in verschiedene Beziehungszusammenhänge zu setzen und dadurch unterschiedliche Themen über das Artefakt zu beleuchten.
2.3.1.2. Die Kontextualisierung
„Die aufbewahrten Gegenstände haben keine Väter mehr, sie sind Waisen und haben sich durch sich selbst zu legitimieren. Sie haben weder einen bestimmten Adressaten noch eine Bestimmung überhaupt, keinen Gebrauchswert, keine sozialen Funktionen. Sie haben keinen eigenen Inhalt mehr, und wie bei Texten ist jede Lektüre Interpretation, eine enteignete Aneignung.“ (DÉOTTE 1988)
Wohlfromm nennt drei Aspekte von Bedeutungsverschiebung, die durch die Neupositionierung von Objekten erfolgt:
„1. Die ursprüngliche Position der Objekte im Umfeld anderer Objekte geht verloren (die Tasse steht nicht mehr neben dem Salzstreuer im Regal, sondern neben anderen Tassen in der Vitrine, das Altarbild hängt nicht mehr in der Kirche).
2. Der ursprüngliche Nutzen eines Objektes für den Menschen (so er konkret war) ist nicht mehr vorhanden (aus der Tasse wird nicht mehr getrunken, vor dem Altarbild wird nicht mehr gebetet).
3. Der Kreis der Personen, die mit dem Objekt in Kontakt treten, verändert sich (die mit Diamanten besetzte Fürstenkindtasse wird nicht mehr nur durch das Fürstenkind und seine Amme angesehen, nicht nur Gläubige betrachten das Altarbild).“51
Konkret ist damit gemeint, „[...] daß durch die Adressierung an eine größere Öffentlichkeit eine zusätzliche Verfremdung eintritt, die interpretationsbedürftig ist, [...].“52 Allerdings ist zu bemerken, was den Bereich der Kunstmuseen betrifft, dass der Zielort von Kunst heutzutage schon während der Produktion oder Schaffensperiode möglichst das Museum ist. Der Verlust von ursprünglicher Bedeutung oder der zusätzliche Verfremdungseffekt, der hier thematisiert wird, stellt keine Wertung im negativen Sinne dar. Die Neupositionierung von Objekten in Museen oder Ausstellungen hat das Bestreben eines Erkenntnisgewinns. „Und Erkenntnisgewinn wird nicht (oder nur nicht) durch Rekonstruktion von originären Strukturen, sondern durch Strategien wie Vergleiche, Gegenüberstellungen und Chronologien befördert.“53 Objekte werden demzufolge in einen neuen Kontext gestellt, bzw. zugeordnet. Dennoch liegt in der Errichtung bzw. Ausgestaltung eines Ausstellungskontextes, was die Auswahl der Objekte, ihre Positionierung, die Inszenierung und die Vermittlungsstrategien betrifft, immer eine Interpretation der Themen- oder Problemstellung. „Die Museen [...] werden zu den Bühnen der Geschichte, die Museumsleute sind die Regisseure dieses historischen Theaters, in dem, dinglich, inszeniert wird, wie es hätte gewesen sein sollen [...].“54
2.3.1.3. Die kommunikativen Strategien
Objekte erklären sich nicht von allein und erzählen weder ihre Geschichte noch ihre Bezüge. Haben die jeweiligen Verantwortlichen einer Ausstellung, z.B. der Kurator, eine Aussage, eine Botschaft etc. im Sinn, müssen sie sich kommunikativer Strategien bedienen. Mit kommunikativen Strategien werden im Folgenden solche Elemente des Ausstellungskomplexes definiert, die weder Objekte sind, noch direkt mit deren Gruppierung und Positionierung zu tun haben. Vermittelnde Strategien sind Techniken zur Bildung eines Ausstellungskontextes. Im Weitesten, gehören Raum- und Lichtarchitektur dazu, im engeren Sinne werden Führungen, Texte, Tonaufnahmen, Filme, interaktive Anwendungen verstanden, wobei das Augenmerk auf der letztgenannten Gruppierung liegen soll. Die Problematik um die es im Folgenden geht, liegt nicht in einer Klassifizierung der verwendeten Vermittlungsstrategien bzw. Methoden, wie Wegweiser, akustische oder audiovisuelle Materialien, sondern in der Fragestellung über die Notwendigkeit solch vermittelnden Strategien im kommunikativen Prozess des Museums. Wohlfromm bemerkt kritisch, dass „[man] im deutschen Sprachraum [...] mit der Bereitschaft zur progressiven Nutzung kommunikativer Strategien (von Vorzeigehäusern abgesehen) noch nicht sehr weit gediehen [ist]. Die theoretische Position dazu ist gekennzeichnet durch Furcht vor Überpädagogisierung und Textlastigkeit, die aber nicht durch alternative Konzepte aufgefangen wird.“55 Und natürlich hängt die Wahl wie die Gestaltung der Vermittlungsstrategien im Wesentlichen von der Thematik oder der Art der Ausstellung ab, z.B. ob auf Assoziationen, Sinneswahrnehmungen oder Fakten hin konzipiert wird. Da Kunstausstellungen auf sinnliche Eindrücke und Atmosphäre bauen, wird man Vermittlungsstrategien nur fakultativ einsetzen im Gegensatz zu Kontextausstellungen, in denen andere Konventionen gelten, denn die Fülle und Unmittelbarkeit von Informationen scheint da eher Richtlinie zu sein. „Vermittlungsstrategien [können] den Rezipienten unter Nutzung unterschiedlicher Medien verschiedene Ansätze und Tiefen von Kommunikation anbieten.“56 In ihren Überlegungen formulieren Gottfried Korff und Martin Roth zwei Strategien: „Das Museum wäre überfordert, wenn es die Benennung und Beschreibung und - noch wichtiger - die aufgrund der Fragmentarik nötige Re-Dimensionierung der Objekte nur sprachlich, auf dem Wege der Textinformation, bewältigen wollte. [...] Das heißt: Über die Inszenierung - als dem Museum besonders adäquate Präsentationsform - muß nachgedacht werden, insbesondere dann, wenn sie als Mittel der Information und Interpretation eingesetzt werden soll.“57 Es scheint also, dass es „zwischen ausführlichen Texttafeln und der im Zweifel eher unkonkret bleibenden Vermittlung durch ›Inszenierung‹, [...] keine Möglichkeiten [gibt]. Im anglo-amerikanischen Raum wird eher über eine Optimierung kommunikativer Strategien nachgedacht: Daß die meisten davon letztendlich auf Sprache - gesprochener oder geschriebener - basieren, ist dabei eher selbstverständlich als störend. Von Gewicht ist doch, wie Sprache verwendet und was durch sie vermittelt wird, nicht, wie lang die Texte sind.“58 Das scheint allgemein, was den Komplex ›Museen und neue Medien‹ insgesamt betrifft, eine Frage der Mentalitäten zu sein: „In den USA akzeptiert man die neue Situation relativ schnell, nähert sich ihr neugierig, optimistisch und aufgeschlossen, aber auch so pragmatisch, daß man bereit ist, Fehler und Unfälle schnell zu akzeptieren und zu einer strategischen Korrektur zu benutzen. In Deutschland ist man zunächst mißtrauisch, besinnt sich aufs Grundsätzliche, um erst einmal Distanz zu gewinnen, und beruhigt sich damit, daß die Veränderungen nicht so schnell und so radikal stattfinden werden, wie es den Anschein haben könnte. Wenn man dann etwas macht, möchte man es ganz besonders gut machen und theoretisch möglichst absichern. Von daher entsteht in den USA der Forschungsbedarf eher als eine Bilanzierung dessen, was vor sich geht, in Deutschland eher als eine Vorraussetzung dafür, daß etwas vor sich gehen wird.“59 Wohlfromm bemerkt zudem kritisch, dass „[k]ommerzielle Ausstellungsmacher oder auch auf Massenbesuche ausgerichtete Museen, die unbekümmerter mit medialen (und finanziellen) Mitteln umgehen können, [...] oft auch nicht den Rezipienten im Sinn [haben], sondern [...] den kleinsten gemeinsamen Nenner [visualisieren], was gestalterisch interessant, aber inhaltlich wenig erfreulich sein kann.“60 Zum Beispiel, das 1998 eröffnete, 258 Mio. $ teure Museum of New Zealand „is keyed to the attention span of a nine-year-old. Floor and ceiling lighting ensures that there is no central focus of visual attention. For that you’ll need to board the Time Warp thrill rides. You don’t move on them but the hydraulic seats bump and jerk while you’re shown computer-generated movies of prehistoric and futuristic New Zealand. High in price and low in information content, they’d be perfect for sideshow alley”.61
Dies ist aber auch in traditionell arbeitenden Museen bzw. Ausstellungen der Fall. Der Rezipient wird häufig durch ein mangelndes mediales Abstraktionsvermögen der Kuratoren in die letzte Reihe gestellt, da sich die Konzipienten oft nicht vorstellen können oder realistisch genug sind, dass Rezipienten mit einem zwei Stunden Besuchs(und nicht mit zwei Jahren Planungszeit), mit oder ohne Hintergrundinformationen, oder mit Klein- bzw. Kleinstkindern in ein Museum kommen und alle von dem Besuch profitieren wollen.62 Die Aufgabe des Mediums Museum demzufolge ist, sich den Rezipienten und dessen Bedürfnisse als ein Gegenüber zu vergegenwärtigen, ohne die inhaltlich bindenden Ansprüche abzutreten zu müssen.
2.3.1.4. Der Rezipient und die Rezipientenaktivität
„Der Besucher - das unbekannte Wesen.“ (FOERSTER 1997)
Diese Formulierung bezieht sich auf die Aufklärungswelle der 1960er Jahre und charakterisiert das Bemühen um Aufklärung, was damals die gesellschaftliche und historische Aufklärung der Besucher als Zielvorstellung des Museums mit einbezog.63 Und natürlich nimmt im Gefüge der bedeutungskonstruierenden Faktoren der Rezipient eine besondere Stellung ein. Anders als das Objekt, die Kontextualisierung oder die Kommunikationsstrategien ist der Rezipient kein intentional ausgewählter oder gestaltender Bestandteil des Museums, er ist das Ziel all dieser Bemühungen. Über die Komplexität der Evaluationsversuche zur Bestimmung des "typischen" Besuchers schreibt Bernd Rese: „Präzise Aussagen über Museumsbesucher im Sinn einer anthrophogenen Bedingungsfeldanalyse sind nicht zu leisten. Zahllose Untersuchungen, die Einstellung, Vorbildung und Interesse oder auch bestimmte schichten- und alterspezifische Merkmale aufzeigen, bestätigen, daß es den Museumsbesucher nicht gibt.“64 Quantitativ jedoch geht die bisherige Besucherforschung davon aus, dass „[...] alles in allem genommen weniger als die Hälfte der bewegungsfähigen Bevölkerung außerhäuslich aktiv ist und öffentliche Einrichtungen in Anspruch nimmt.“65 Dabei blieben auf Museen bezogen nach Heiner Treinen „[...] 15-20% der städtischen erwachsenen Bevölkerung als realistisch anzunehmendes Besucherumfeld übrig.“66 Entgegen dem Klischee, dass Senioren zu den 'treusten' Museumsbesuchern zählen, die allein ins Museum gehen und die dort ausgestellten Werke bewundern, sind nach Walter Hochreiter, die über 50jährigen Personen im Museumspublikum eindeutig unterrepräsentiert.67 Dennoch, erst durch seine Anwesenheit sowie durch die Rezeption des Ausstellungsdisplays schafft der Museumsbesucher das Museum. Das heißt, es gilt nicht nur: ohne Objekte kein Museum, sondern auch: ohne Besucher kein Museum, denn eine Ausstellung wäre bedeutungs- wie wirkungslos, wenn niemand sie ansehen würde. „Doch [...] als Empfänger, als Projektionsfläche [nach Wohlfromms Argumentation] ist der Rezipient grundsätzlich mißverstanden, da er aktiv an der Konstruktion von Bedeutung beteiligt ist - freilich nicht an einer feststehenden. Treffender ist die Vorstellung des Rezipienten als ungleichmäßig lichtempfindlich beschichtetes Material, auf das der Text, der Film der intentional designten Ausstellung projiziert wird. Jeder Rezipient gestaltet die Oberfläche seines Trägermaterials selbst, indem er die Stellen bestimmt, auf denen sich die intentionalen Aussagen des Museums oder der Ausstellung abzeichnen können.“68 Semiologische Modelle, die sich mit Kommunikation im Museum beschäftigen bzw. auf diese übertragen werden, konzentrieren sich eher auf die Konstruktion von Bedeutungen, ohne dass der Rezipient und die Variationen seiner Verständnismöglichkeiten berücksichtigen werden. Roland Barthes Analyse der Fotoausstellung The Family of Man in »Mythen des Alltags«69 ist dafür ein Beispiel: Durch die Untersuchung des Inhalts, der Klassifizierung, der Auswahl, der Hängung sowie der die Fotografien beschreibende Text stellt Barthes die Konstruktion einer mythischen menschlichen Gemeinschaft fest. Barthes Analyse wird durch Eilean Hooper-Greenhill folgend zusammengefasst: „The meaning of the photographs, Barthes is telling us, is constituted through ideology, and taken as a whole the meanings of the objects and the exhibition construct an essentialist myth of human harmony, as opposed to the social reality of conflict and competition. This myth serves to maintain the status quo, and preserve the definitions of the world made by existing power groups.”70 Nach Wohlfromm „[...] besteht bei dieser Art von Untersuchungen [semiologische Untersuchungen, die sich mit versteckten Aussagen oder ideologischen Subtexten beschäftigen] ein Problem in zweifacher Hinsicht: 1. sind die von den Autoren ermittelten Subtexte nicht mittels Evaluation mit den Erfahrungen anderer Rezipienten abgeglichen. Es ist nicht klar, wie viele Menschen den Text der ›Family-of- man‹- Ausstellung so gelesen haben wie Barthes; 2. negiert dieser Zugang die Aktivität des Rezipienten bei der Konstruktion der Aussage des Textes. Im Gegenteil entwirft er ein Bild des Rezipienten, der dem ideologischen Subtext ohne eigene Aktivität ausgeliefert ist.“71 Durch solche Studien, wie eben erläutert, werden die Vermutungen bzw. Annahmen des stets interpretativen und potentiell manipulativen Charakters von Ausstellungen gestützt und dennoch vernachlässigen sie die Relevanz des Rezipienten für die Konstruktion von Bedeutung. Denn erst durch die Anschaulichkeit und Einprägsamkeit, das Erforschen und Durchqueren, oder das eventuelle Anfassen von Objekt- und Ausstellungsinszenierungen durch Rezipienten lassen diese lebendig werden. Ernst Bloch stellt in einer seiner philosophischen Parabelgeschichten »Der Rücken der Dinge« die Fragen: „[...] was ›treiben‹ die Dinge ohne uns? wie sieht das Zimmer aus, das man verläßt?“72 Die Dingwelt ist nicht nur Instrumentarium, sondern ein Gegenüber, eine Eigenwelt - so die sinnsuchend-interpretierende Spekulation: „Das Leben hat sich unter und auf den Dingen angesiedelt, also auf den Objekten, die keine Atmung und Speise brauchen, ›tot‹ sind, ohne zu verwesen, immer vorhanden, ohne "Mythen des Alltags" (1964), französischer Originaltitel "Mythologies", die semiologische Methode kulturkritisch auf die französische Gesellschaft der fünfziger Jahre anzuwenden. Mythenanalyse wird bei Barthes zur Ideologie- und Gesellschaftskritik. Barthes will die formale Logik des Mythos erschließen und dies unter Zuhilfenahme der Semiotik. Der Begriff "Semiotik" wurde 1706 vom englischen Philosophen John Locke eingeführt und bezeichnet die Lehre, die Wissenschaft von den Zeichen, Zeichensystemen und Zeichenprozessen.
unsterblich zu sein; auf dem Rücken dieser Dinge, als wären sie der verwandteste Schauplatz, hat sich Kultur angesiedelt.“73 Mit anderen Worten formuliert bedeutet das, dass „[d]er Rezipient [...] durch seine Präsenz und sein Interesse die Ausstellung nicht nur zum Leben [erweckt] und [...] ihr Sinn [verleiht], indem sie betrachtet wird, sondern durch: a) seine selektive Wahrnehmung und b) seine persönliche Deutung konstruiert jeder Rezipient bzw. jede Mehrheit (im Sinne: mehr als eine Person, die auf die gleichen Codes reagiert) das Ergebnis, das letztendliche Bild der Ausstellung mit. Denn die wahrnehmende Interpretation des Rezipienten verleiht nicht nur den Objekten subjektive Bedeutung oder Bedeutungsbezüge. Was in einem dreidimensionalen Text, also in einem Raum, einer Vitrine, einem Arrangement, überhaupt wahrgenommen wird, welche Bezüge wie verstanden werden, ist entscheidend für die subjektive Konstruktion von Bedeutung.“74 Maßgeblich wird das Verhalten des Rezipienten auch durch Momente disponiert, die im ersten Augenblick nichts mit den Objekten oder dem Design im Museum zu tun haben. Entscheidend für die Dauer des Museumsbesuches, das kommunikative Verhalten und die Intensität der Betrachtung der Ausstellungsexponate ist der soziale Kontext, in dem ein Museum- bzw. Ausstellungsbesuch stattfindet. „Eine Evaluierung im National History Museum in London zeigt, daß Paare sich am längsten aufhalten, dafür aber kaum miteinander kommunizieren. Erwachsenengruppen bleiben kurz und schauen sich die Exponate nur oberflächlich an. Singles lesen Erläuterungen sehr genau, widmen sich aber weniger den Exponaten oder interaktiven Angeboten, davon Männer weniger als Frauen, obwohl die Geschlechtsverteilung der Single Männer zu Frauen 2:1 ist, usw.“75
Wie schon im Vorfeld erläutert, den "typischen" Museumsbesucher gibt es nicht.
Auf der Grundlage detaillierter soziologischer Analysen lassen sich dennoch Besucher allgemein beschreiben und ihre Erwartungshaltungen können deutlich herausgearbeitet werden. Besucher erwarten demnach von einem für sie typischen Museum
- ein wissenschaftliches Institut, das zugleich bildet und unterhalten soll,
- einen spannenden und zugleich entspannenden Museumsbesuch,
- eine seriöse Einrichtung, die korrekte Informationen gibt und sie erwarten
- eine jederzeit freie Auswahl aus einem interessanten Angebot.76
[...]
1 Lichtwark: Die Aufgaben der Kunsthalle. Antrittsrede gehalten vor Senat und Bürgerschaft am 9. Dezember 1886. In: Lichtwark 1887, S. 14; vgl. dazu auch: Klausewitz 1975, S. 39 f.
2 Weschenfelder; Zacharias 1992, S. 364; Umstellungen: C.B.; siehe dazu auch: Billmann 1994, S. 45
3 „Nach neueren Zählungen gab es auf der Welt zu Ende des zwanzigsten Jahrhunderts etwa 38.000 Museen - mehr als 20.000 davon in Europa, [...]. Es ist allerdings - nicht zuletzt aus Gründen der Abgrenzung des Museumsbegriffes - völlig unmöglich, einen exakten Überblick über die tatsächliche Anzahl bestehender Museen zu erhalten. Daher sind die angegebenen Zahlen aus mehreren Gründen bestenfalls als minimale Näherungswerte anzusehen: Der Begriff selbst ist nicht geschützt; jeder Mensch kann ohne jegliche Voraussetzungen ein Museum behaupten; zahlreiche Ortsmuseen, private Museen und Firmenmuseen finden oft keinen Eingang in offizielle Listen. Andererseits beruhen Museumsverzeichnisse meist auf den Angaben der Einsender und sind daher nicht immer so objektiv, wie es zu wünschen wäre.“ Waidacher 2005, S. 18; Auslassung: C.B.
4 Weschenfelder; Zacharias 1992, S. 24
5 Vgl. Herles 1996, S. 14
6 Grasskamp 1981, S. 18
7 Vgl. Fehr 1988, S. 113
8 Das British Museum, als wissenschaftliche Institution verstanden, war das erste Museum, das nicht auf eine ursprünglich fürstliche Sammlung zurückging. „Dieses frühe bürgerliche Museum, das späterhin auch Kunstsammlungen einbezog, war noch keineswegs unbeschränkt zugänglich: ein Besuch mußte Wochen zuvor angemeldet und genehmigt werden, Datum und Dauer des Besuchs wurden mit der Genehmigung bindend festgelegt. Dar Besuch durfte 2 Stunden nicht überschreiten und war ohnehin nur 15 gentlemen gleichzeitig gestattet, die vom Museumspersonal mehr beaufsichtigt als geführt wurden. Hohe Eintrittspreise taten ein übriges, um den Kreis der Besucher auf Privilegiert zu beschränken.“ Grasskamp 1981, S. 19
9 Vgl. Wohlfromm 2002, S. 12 f.; vgl. dazu auch Grasskamp 1981, S. 21 ff.
10 Das fürstliche Museum Fridericianum entstand zwischen 1769 und 1779 in Kassel als erster selbständiger Museumsbau Europas, war aber nur ausgewählten Wissenschaftlern und Studenten zugänglich. 1775 richteten Mechel und Mannlich in München die Sammlungen ihrer königlichen Auftraggeber für die Öffentlichkeit ein, eine ungehinderte Zugänglichkeit aller Klassen des Volkes oder nur ein ungehinderter Einlass des Bürgertums gehörte jedoch keineswegs zu ihren Programmen. Vgl. Grasskamp 1981, S. 36
11 Hense 1985, S. 35; Auslassung, Umstellungen: C.B.
12 Vgl. Wohlfromm 2002, S. 13
13 Vgl. ebd., S. 13; vgl. dazu auch: Hense 1985, S. 37
14 Ebd., S. 13-14
15 Wolf 1983, S. 15; Auslassung: C.B.
16 Vgl. Wohlfromm 2002, S. 14
17 Ebd., S. 15; Auslassung: C.B.
18 Baacke 1975, S. 150; Einfügung: C.B.
19 Wohlfromm 2002, S. 15
20 Der Begriff »Musealisierung« ist eine Sprachschöpfung jüngeren Datums. Vermutlich findet der Begriff das erste Mal in der 1963 verfassten These von der »Musealisierung als Kompensation« von Joachim Ritter seine Anwendung. Ursprünglich scheint es sich in diesem Sinn um einen geschichtsphilosophischen Fachbegriff zu handeln. In welcher Weise das Wort »Musealisierung« nun im Kontext zum Begriff und der Idee »Museum« steht, charakterisiert Zacharias folgend: „Das Wort 'Musealisierung' dynamisiert den statischen Begriff Museum [...] in etwas Prozeßhaftes.“ Zacharias 1986, S. 54; Auslassung: C.B.
21 Zacharias 1990, S. 9
22 Wohlfromm 2002, S. 15; Auslassung, Umstellung: C.B.
23 Vgl. Lübbe 1990, S. 40
24 Wohlfromm 2002, S. 16; Umstellung: C.B.
25 Ebd., S. 16; Auslassungen: C.B.
26 Fehr 1989, S. 182; Auslassung, Einfügung: C.B.
27 Vgl. Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 1998: 95.342.524 gemeldete Besucher.; Hervorhebung: C.B
28 Vgl. Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2004: „Von den in diese Erhebung für 2004 einbezogenen 6.177 Museen (4.749 Museen in den alten, 1.428 Museen in den neuen Bundesländern) haben 4.878 Museen Besuchszahlen gemeldet. Addiert man diese Besuchszahlen, so ergibt das: 103.235.469 Besuche. 77.775.422 Besuche (2003: 73.980.639) wurden in 3.994 Museen (2003: 3.745) der alten Bundesländer gezählt, 25.460.047 Besuche in 1.247 Museen (2003: 24.381.177 Besuche in 1.184 Museen) der neuen Bundesländer. Im Vergleich zu 2003 ist die Besuchszahl insgesamt um 4.873.653 Besuche (5,0 %) gestiegen (2003: 98.361.816 Besuche).“; Hervorhebung: C.B.
29 Das ICOM definiert den Begriff »museum« folgend: „A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of society and its development, and open to the public which acquires , conserves, researches, communicates and exhibits, for purpose of study, education and enjoyment, material evidence of people and their environment.“ ICOM Statutes 1990, zitiert in: Vieregg 1994, S. 49
30 Lübbe 1990, S. 41; Auslassung: C.B.
31 Ebd., S. 41; Auslassung, Umstellung: C.B.
32 Ebd., S. 41
33 Wohlfromm 2002, S. 18
34 Vgl. Flusser 1988 zitiert nach: Zacharias 1990, S. 9 sowie Lübbe 1989, S. 29
35 Lübbe 1989, S. 13
36 Mnemosyne ist in der griechischen Mythologie die Göttin des Gedächtnisses, Tochter des Zeus und Mutter der Museen.
37 Bolz 1995, S. 159
38 Ebd., S. 159; Einfügung: C.B.
39 Wohlfromm 2002, S. 20
40 Ebd., S. 20; Einfügung: C.B.
41 Ebd., S. 20; Auslassung: C.B.
42 Lidchi 1997, S. 160
43 Wohlfromm 2002, S. 21; Auslassung: C.B.
44 Ebd., S. 22
45 Vgl. Pomain 1990, S. 44
46 Wohlfromm 2002, S. 24; Auslassung: C.B.
47 Korff 1995, S. 22; Auslassungen: C.B.
48 Vgl. Wohlfromm 2002, S. 25
49 Korff; Roth 1990, S. 17
50 Wohlfromm 2002, S. 28; Auslassung: C.B.
51 Wohlfromm 2002, S. 29
52 Ebd., S. 29; Auslassungen: C.B.
53 Ebd., S. 29
54 Zacharias 1990, S. 16; Auslassungen: C.B.
55 Wohlfromm 2002, S. 33
56 Ebd., S. 34; Einfügung: C.B.
57 Korff; Roth 1990, S. 23; Auslassung: C.B.
58 Wohlfromm 2002, S. 34; Auslassung, Einfügung: C.B.
59 Wersig 1998, S. 104
60 Wohlfromm 2002, S. 34-35.; Umstellungen: C.B.
61 Dutton, Denis: National embarrassment. In: The Weekend Australian. Wellington: June 6-7 1998, S. 23 zitiert nach: Wohlfromm 2002, S. 35
62 Vgl. Wohlfromm 2002, S. 35
63 Vgl. Foerster 1997, S. 141
64 Rese 1995, S. 147
65 Treinen 1996, S. 114; Auslassung: C.B.;
66 Ebd., S. 114; Auslassung: C.B.
67 Vgl. Hochreiter 1994, S. 201; Die empirische Studie des Museumssoziologen Hans-Joachim Klein (1984) ergab u. a., dass das Durchschnittsalter der Besucher relativ niedrig ist, und dass nur jeder fünfte Besucher allein das Museum betritt, wozu allerdings die Besuche der Schulklassen beitragen und sich statistisch betrachtet bemerkbar machen. Vgl. ebd., S. 101; „Die politische Faustformel 'jeder Bundesbürger geht durchschnittlich einmal im Jahr ins Museum' ist nicht richtig. Etwas vier Fünftel der Bevölkerung besuchen Museen nicht oder nur gelegentlich. Die Besucherzahlen kommen vornehmlich durch Schulen oder eine Gruppe von tendenziell regelmäßigen Besuchern / Innen zustande, die 10% der Bevölkerung kaum übersteigen dürfte. Die Museen verzeichnen zwar insgesamt viele Besuche, aber wenig BesucherInnen. [...]Die Alterstruktur des Museumspublikums weicht von der Gesamtbevölkerung auffallend ab: Danach sind die BesucherInnen der Museen deutlich jünger als die Gesamtbevölkerung: Der Museumsbesuch scheint mit zunehmenden Lebensalter offensichtlich seltener zu werden.“ (Vieregg 1994, S. 108-109)
68 Wohlfromm 2002, S. 36; Auslassung, Einfügung: C.B.
69 Vgl. Barthes 1964, S. 16-19; The Family of Man war der Originaltitel der Fotoausstellung, die aus den Vereinigten Staaten nach Frankreich (Paris) kam und von den Franzosen mit La grande Famille des Hommes (Die große Familie der Menschen) übersetzt wurde. Die Fotoausstellung stellte die Universalität der menschlichen Gesten im alltäglichen Leben in allen Ländern der Welt dar. Der französische Denker Roland Barthes (1915 - 1980) gehört zu den prominentesten Kulturtheoretikern des 20. Jahrhunderts. Barthes versucht in dem ideologiekritischen Kurzessay
70 Hooper-Greenhill, Eilean: A new communikation model for museums. Leicester 1991, S. 50 zitiert nach: Wohlfromm 2002, S. 36
71 Wohlfromm 2002, S. 37; Auslassung, Einfügung: C.B.
72 Bloch 1990, S. 177
73 Ebd., S. 179
74 Wohlfromm 2002, S. 37
75 Vgl. McManus, Paulette M.: Making sense of exhibits. In: Kavanagh, Gaynor (Hg.): Museum Languages. Objects and Texts. Leicester 1991, S. 35-46; zitiert nach: Wohlfromm 2002, S. 37-38
76 Vgl. Rese 1995, S. 147
- Arbeit zitieren
- Marta Cornelia Broll (Autor:in), 2007, Das Museum als Medium. Multimediaeinsatz in Museen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140661
Kostenlos Autor werden










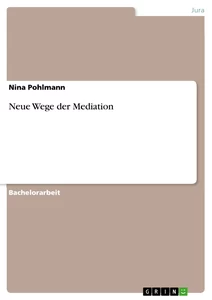


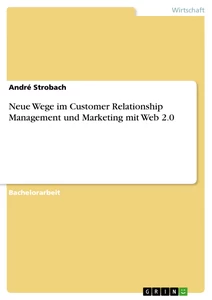






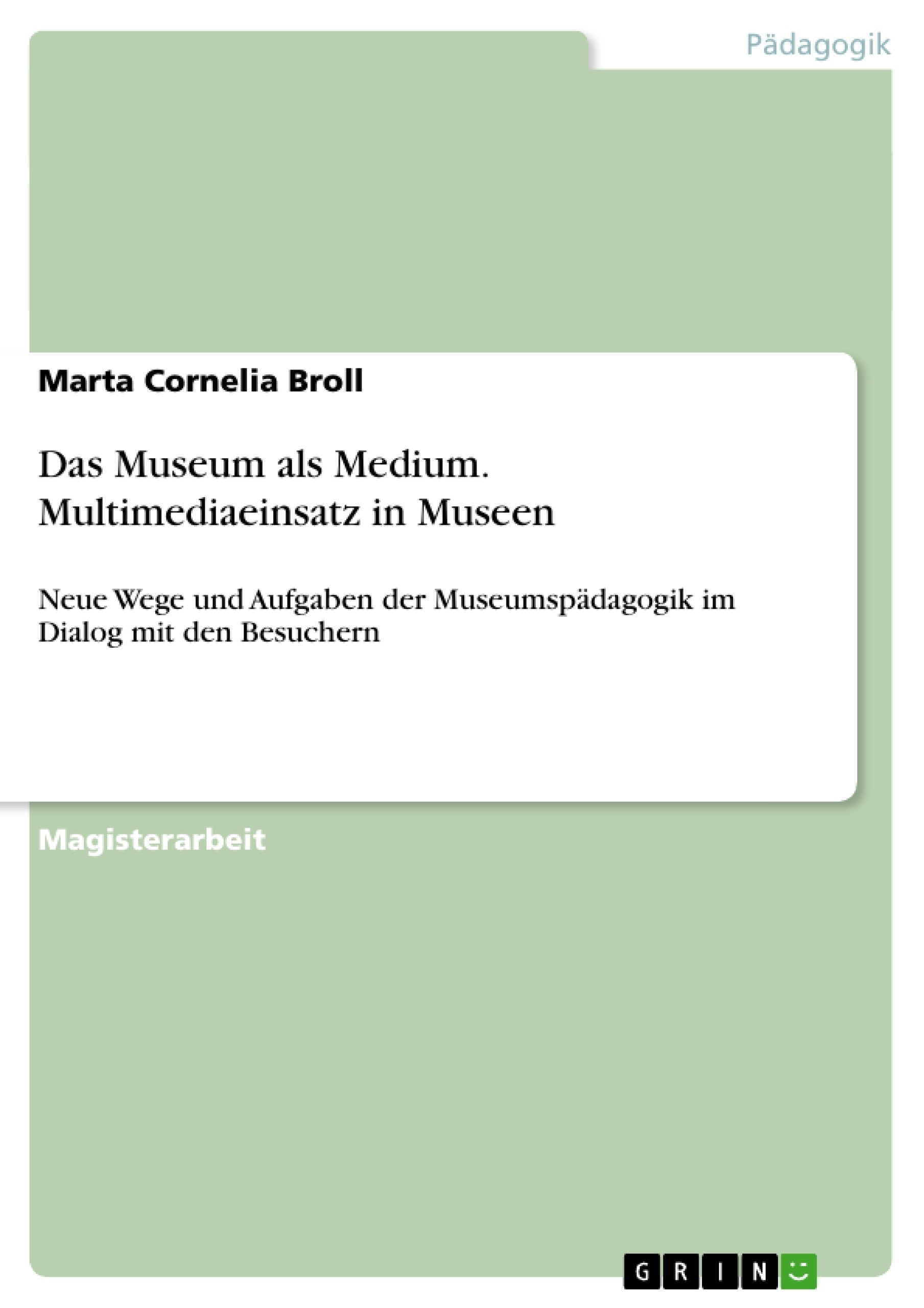

Kommentare
Lieber Mathias Pürzl,
wenn Sie die Literaturliste sehen, wird klar, dass es sich nicht nur ausschließlich um Anja Wohlfromm handelt. Die Arbeit beinhaltet sehr viele Zitate, die gekennzeichnet sind,weil es mir wichtig schien, andere Ansichten/Perspektive u.s.w.zur Thematik mit einfließen zu lassen. Ich nehme mir jedoch die Kritik gern an, da dies auch schon in der Auswertung bemängelt wurde.
Broll
Ich habe noch nie jemanden so viele Zitate (vor allem vorrangig von einer Autorin - Wohlfromm) in eine Ausarbeitung pressen sehen.
Mein Tip: Lieber gleich Anja Wohlfromm lesen.