Leseprobe
INHALT
KAPITEL 1: IDENTITÄTEN UND MASKEN DER MODERNE
1.1 GNOTHI SEAUTON - EIN VORWORT
1.2 DER VERSUCH EINER DEFINITION
1.3 DAS ICH IN DER PHILOSOPHIE
1.3.1 COGITO E(R)GO SUM - BIN ICH?
1.3.2 DER TOD DES ICHS - ES LEBE DIE FREIHEIT!
1.3.4 WAS TUE ICH?
1.3.5 IST DAS ICH FREI?
1.4 PSYCHOLOGISCHE UND SOZIOLOGISCHE BETRACHTUNG
1.4.1 INDIVIDUUM ODER DIVIDUUM?
1.4.2 KOLLEKTIVE IDENTITÄT
1.4.3 DIE MASLOWSCHE BEDÜRFNISPYRAMIDE
1.4.4 EGOISMUS - WENN NUR DAS EIGENE ICH ZÄHLT
1.4.5 WENN EIN UNTERNEHMEN SPRICHT
1.5 WAS BLEIBT ÜBRIG? - EINE FRAGE DES SELBSTS AN DAS ICH
KAPITEL 2: DER FILM ZELIG
2.1 VORWORT
2.2 WOODY ALLEN - EIN NEUROTISCHES GENIE?
2.2.1 SEIN LEBEN
2.2.2 SEINE FILME
2.3 DER FILM
2.3.1 DER PLOT
2.3.2 SPEZIALEFFEKTE, KAMERAFÜHRUNG UND SCHNITT
2.4 DIE CHARAKTERE
2.4.1 DR. EUDORA FLETSCHER (MIA FARROW)
2.4.2 LEONARD ZELIG (WOODY ALLEN)
2.4.3 DIE MENSCHEN IN ZELIG
2.4.4DIE INTELLEKTUELLEN
2.5 INTERPRETATION
2.5.1 DER FASCHISMUS - WARUM ZELIG DER PERFEKTE NAZI IST
2.5.2 ZELIG, DAS JUDENTUM UND WOODY ALLEN
2.5.3 DIE VERWANDLUNG - WIESO ZELIG AUCH NUR EIN KÄFER IST
2.5.4 DER EWIGE JUDE - WESHALB ZELIG EIN VERDAMMTER IST
2.6 DIE QUADRATUR DES KREISES - EIN FAZIT
2.7 FILMOGRAPHY
2.8 LITERATURVERZEICHNIS
KAPITEL 1: IDENTITÄTEN UND MASKEN DER MODERNE
1.1 GNOTHI SEAUTON - EIN VORWORT
Masken und Identitäten. Dies ist das Thema der vorliegenden Arbeit. Sie soll Einblicke in die spannende Frage nach der Identität geben, in ihre Vielfältigkeit, ihre verschiedenen Erscheinungsformen, und gleichermaßen auch kritisch hinterfragen: Was ist Identität oder was stellen wir uns darunter vor?
Nicht erst heute denken wir intensiver über diese Fragestellung nach. Bereits vor über 2500 Jahren konnte man die Inschrift »Erkenne Dich selbst« im Apollo-Tempel in Delphi lesen. Sie scheint uns Menschen bereits seit der Antike zu beschäftigen, womöglich aber noch sehr viel länger.
Auch die Begriffe »Individuum«, »Ich«, »Selbst«, und »Sein« sind von großer Bedeutung und werden daher im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls behandelt und erklärt. Wie stehen diese Begriffe im Verhältnis zur Identität? Sind sie Synonyme oder doch eigenständige Begriffe für etwas Eigenes?
Zwar ist das Wort »Identität« wohl jedem ein Begriff, doch dabei bleibt es meistens auch - bei einem Begriff, in den jeder seine eigene Meinung platziert. Gemein ist aber allen Ansichten, dass es sich bei dem Gebilde Identität um etwas mit Kontinui- tät, Konstanz und Zuverlässigkeit handelt. Wenn wir einen ehemaligen Schulfreund nach zehn Jahren wieder treffen, so ist es vielleicht nicht mehr die gleiche Person, aber er ist immer noch identisch »mit sich selbst«. Sein Kern (andere würden viel- leicht Seele sagen), die Substanz, das Bewusstsein, ist derselbe. So hilft uns die Identität uns im Leben besser zurecht zu finden, Dinge und Leute, die wir kennen, wiederzufinden. Und sie hilft uns auch gleichermaßen, uns selbst zu erkennen. Bin ich wirklich ich? Wer sagt mir, dass ich nicht jemand anderes bin? Oder bin ich gar nicht mehr? Bin ich noch derjenige, der diese Fragen stellt, oder schon ein anderer? Viele dieser Fragen führen uns zu logischen und sprachlichen Paradoxa, die uns Menschen immer noch ein Rätsel sind. So ist der Verlust der Identität gleichbedeu- tend mit dem Ich-Verlust. Aber was genau ist denn nun Identität? Letztlich ist es schwierig eine exakte Formulierung zu finden - ähnlich den Begriffen Zeit, Liebe und Moral. Sie sind relativ und stehen im Kontext mit einem anderen Subjekt, aus dem sich dann vielleicht ein Sinn erkennen lässt. Die Identität ist keineswegs eine Metaphysik, sie ist die Suche eines jeden Menschen nach einem Halt, einem fixen Punkt im Leben. In einer konsumorientierten Gesellschaft, die keinen Gott mehr kennt und zwischen hedonistischen Menschen, die sich selbst am wichtigsten sind und in einer Zeit ohne Werte, in der der Sinn des Lebens sich selbst vergessen hat, kehrt der Mensch zum Anfang aller Dinge zurück, zu dem, was er am ehesten noch glaubt kontrollieren und überblicken zu können, zu seinem eigenen Ich, seiner eige- nen Identität, die er glaubt zu kennen; eine Wahrheit, die nie unwahr sein kann. In der sich ständig verändernden und sich erneuernden Moderne ist die Identität ge- wissermaßen die letzte Bastion, die das Individuum glaubt, noch wirklich festhalten zu können, um darin sich selbst über die Zeiten hinweg zu erkennen. Denn was ist der Mensch, der sich selbst nicht mehr erkennt? Macht uns das nicht gleichwertig mit einem Stein, der von einem Ort zum anderen gestoßen wird und nicht weiß, wo er eigentlich herkommt? Das Sich-Selbst-Erkennen ist somit für viele Menschen der Moderne der Sinn des Lebens und der Weg zu einem glücklichen Leben.
So banal und trivial die Frage nach der Identität auf den ersten Blick sein mag, umso komplexer ist sie in der Tat und bedarf daher einer genaueren Betrachtung und Erörterung. Sie ist etwas Konstantes und doch nicht wirklich begründungsfä- hig, allgegenwärtig und doch nie greifbar. Gerade dies aber gibt der Identität ihre Macht. Wir schauen empor und sehen darin ein Ideal, dass es zu ergründen gilt. Vielleicht sind es gerade die Suchenden, die sie wirklich gefunden haben. Ein Pro- zess, der sich selbst findet und doch nie gefunden werden kann. Man kann sich dieser Frage der Identität aus vielen Richtungen nähern (oder ent- fernen) und somit bietet sie auch sehr viele Interpretationsmöglichkeiten. Viele Philosophen, Mathematiker, Mediziner, Psychologen und Soziologen haben sich mit diesem Thema bereits befasst und verschieden interpretiert. Ich werde in meiner Arbeit einen anderen Weg einschlagen und dieses komplexe Thema sowohl wissen- schaftlich als auch philosophisch hinterfragen. Anschließend werde ich im zweiten Teil meiner Arbeit den Woody Allen-Film »Zelig« im Hinblick auf das Thema Iden- tität analysieren und deuten. »Zelig« scheint mir hierfür ein ideales Instrument zu sein, um das Thema noch weiter zu vertiefen. Der Hauptcharakter Leonard Zelig - gespielt von Woody Allen selbst - ist von einer eigentümlichen Charaktereigenschaft geprägt: Er passt sich an die Menschen in seiner Umgebung an und kopiert deren Eigenschaften und Aussehen. Er hat also gewissermaßen nicht nur eine, sondern unendliche viele Identitäten und Rollen im Leben, die er sich selbst auferlegt hat. Es gilt zu klären, ob hier noch die Rede von einer eigenen Identität sein kann, oder ob dies eher der Versuch ist, seinem eigenen »Ich« zu entfliehen. Die tiefgründigen Ursachen hierfür und die Konsequenzen werden ebenso in dieser Arbeit behandelt wie auch der Vergleich mit der Legende des Ahasver, dem sogenannten »ewigen Juden«. Dieser soll sich einer Legende nach unter den Menschen auf halten und ständig in neue Rollen schlüpfen.
Um aber den Film »Zelig« zu verstehen, muss man zuerst Woody Allen verstehen. Daher werde ich in dieser Arbeit kurz auch auf das Leben und die filmischen Werke von Woody Allen eingehen und einen groben Überblick geben. Es gibt nicht wenige, die ihn als Genie bezeichnen, aber es gibt auch einige, die ihn als »wahnsinnigen Neurotiker« bezeichneten. Fest steht, dass Woody Allen viele qualitative Filme produziert hat, die eine genauere Analyse wert sind.
1.2 DER VERSUCH EINER DEFINITION
Bevor man tiefer in die Materie der Identität taucht, sollte geklärt und konstatiert werden, was wir unter diesem Begriff verstehen oder wie wir diesen Begriff für uns definieren. Denn ansonsten wird es sehr schwer, von »der« Identität zu sprechen. Zunächst einmal sehen wir uns die Etymologie des Wortes an:
Diese leitet sich aus dem lateinischen »idem« ab - der-, dasselbe - was vollkommene Gleichheit oder Übereinstimmung mit dem, was er/sie/es ist oder als was er/sie/ es bezeichnet wird,[1] bedeutet. Es ist also ein Synonym für Gleichheit. Nach dem Brockhaus ist der Begriff definiert als die »Gleichheit mit sich selbst«. Was wir hierunter zu verstehen haben, wird leider im Brockhaus nicht weiter erläutert und soll unserem Anspruch als Definition nicht genügen.
Weiter gefasst ist Identität, in der Sprache der Mathematik die Abbildung einer Menge, in der jedes Element sich selbst zuordnet, wodurch alle Paare (Elemente, Bild) die Gestalt (a,a) besitzen.[2]
Ferner wird Identität in der Mathematik auch als sogenannter Identitätssatz der klassischen Logik festgelegt. Dieser besagt: 2=2, oder X=X. Also eine in sich wahre (logische) Aussage.
So gerne wir uns natürlich mathematischer Formeln bedienen, um uns bestimmte Sachverhalte in der Welt logisch zu erklären, ist es in diesem Falle leider dennoch nicht ganz so einfach abzuhandeln. Denn der Mensch ist viel mehr als nur die Sum- me seiner Einzelteile und die emotionale Komponente könnte durch die Naturwissenschaft alleine nicht wirklich erfasst werden.
Dieser Widerspruch wird vor allem durch den englischen Mathematiker, Staatstheoretiker und Philosophen Thomas Hobbes sehr deutlich zur Sprache gebracht:
»Werden in diesem Schiff nach und nach alle Planken durch neue ersetzt, dann ist es numerisch dasselbe Schiff geblieben; hätte aber jemand die herausgenommenen alten Planken auf bewahrt und sie schließlich sämtlich in gleicher Richtung wieder zusammen- gefügt und aus ihnen ein Schiff gebaut, so wäre ohne Zweifel auch dieses Schiff numerisch dasselbe Schiff wie das ursprüngliche. Wir hätten dann zwei numerisch identische Schiffe, was absurd ist.«[3]
Wir müssen also den Begriff Identität viel weiter fassen als nur in einem numeri- schen, logischen oder mathematischen Ausdruck. Viel treffender ist daher die klas- sische Definition der Identität nach dem Leibniz-Gesetz, welches wie folgt lautet: »Zwei Dinge sind identisch, wenn sie in allen ihren Eigenschaften ununterscheidbar sind.« Wenn wir den Begriff hingegen als Synonym für Gleichheit übersetzen, so ist dies nicht ganz unproblematisch. Bezogen auf den Menschen stellt sich hier die Frage, Gleichheit mit was? Gleichheit mit sich selbst? Eine Art »mit sich selbst im Reinen sein«? Wir sollten festhalten, dass der Begriff Identität - wenngleich dieser mit Gleichheit übersetzt wird - ein Differenzbegriff ist. Denn wenn alle Menschen im tatsächlichen Sinne gleich wären, könnten wir uns gar nicht unterscheiden. Erst durch die Differenz zu anderen Personen oder Gruppen sind wir unterscheidbar, oder besser gesagt, identifizierbar.
Richtig knifflig wird es vor allem mit dem Leibniz-Gesetz, wenn man sich die Si- tuation von eineiigen Zwillingen sich vor Augen führt. Diese sind genetisch (also naturwissenschaftlich) exakt identisch. Obgleich diese sich auch oftmals in Ihren Vorlieben und Eigenschaften ähneln, kann man nicht sagen, dass sie identisch sind. Denn wir haben zwei Individuen vor uns, die unabhängig voneinander und frei entscheiden können und deren Entscheidungen durchaus differieren. Ergo hat auch das Leibniz-Gesetz seine Grenzen und beschreibt noch nicht adäquat genug den Identitätsbegriff.
Betrachten wir daher das ganze einmal aus der Sicht der Psychologie. Psychologisch betrachtet ist die Identität die als »Selbst« erlebte innere Einheit unserer Person.[4]
Dies ist das sogenannte Selbstbild, welches durchaus von dem Fremdbild, also dem Eindruck, den andere von Aussen betrachtet von uns haben, differieren kann. Die Eigen-Identität oder das Selbstbild scheint aber einen nicht komplett bewussten Kern zu haben. Sie wird teilweise eben auch fremdbestimmt, z.B. durch unsere Er- ziehung, Interaktion mit anderen Menschen und Dingen, und wiederum durch die Reaktionen der Außenstehenden auf diese. Die Eigen-Identität ist also eine reflexive und rekursive Einheit und scheint auch eine multiple zu sein. So kann ein Mensch verschiedene Identitäten haben: In der Familie der Bruder, bei der Arbeit der Chef, in der Fußballmannschaft der Torwart und so weiter und so fort. Im Kern meines Selbst weiß ich und sehe ich als Person allerdings eine Kontinuität meines Selbst und mir ist bewusst, dass diese Identitäten sich teilweise überscheiden und in der Summe meine Person definieren. Ich kann also in der Betrachtung meines Selbst eine Einheitlichkeit feststellen.[5] Erik Erikson, ein deutsch-amerikanischer Psycho- analytiker und Vertreter der psychoanalytischen Ich-Psychologie, unterscheidet zwi- schen »persönlicher Identität« (personal identity) und »Ich-Identität (ego identity). Persönliche Identität ist nach Erikson die reine Tatsache des Existierens, also eine solche, die alleine durch unsere Existenz in dieser Welt sich selbst definiert hat. Im Gegensatz dazu beschreibt die Ich-Identität einen »Zuwachs an Persönlichkeitsreife, den das Individuum am Ende der Adoleszenz der Fülle seiner Kindheitserfahrun- gen entnommen haben muss, um für die Aufgaben des Erwachsenenlebens gerüs- tet zu sein.«[6] Es handelt sich um das vorher beschriebene Gefühl der Gleichheit, nämlich der Gleichheit mit sich selbst, das Bejahen der eigenen Persönlichkeit.
Nach Lothar Krappmann, ein anerkannter deutscher Soziologe und Pädagoge, wird Identität über Sprache vermittelt und ist nichts Starres. Sie erfindet sich durch die Kommunikation eines Individuums mit seinen Mitmenschen in jeder Situation neu. Dies geschehe über eine sogenannte »Umgangssprache«, die gewisse Funktionen erfüllen muss.[7] Aber ist nicht die Kontinuität eines der wesentlichen Merkmale ei- ner Identität? Nach Krappmann ordnet das Individuum die gemachten Erfahrungen mit diversen Gesprächspartnern zu einer möglichst konstanten Biographie.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Für Krappmann ist es von größter Bedeutung seine Identität vor Schaden zu bewah- ren.[8] Hierfür muss das Individuum zum einen den sozialen Erwartungen gerecht werden (social identity), zum anderen soll das Individuum seine eigenen spezi- fischen Erwartungen vermitteln und sich damit als einzigartig zeigen (personal identity).[9] »Im Falle der ›social identity‹ wird verlangt, sich den allgemeinen Erwar- tungen unterzuordnen, im Falle der ›personal identity‹ dagegen, sich von allen an- deren zu unterscheiden. Es wird also zugleich gefordert, so zu sein wie alle und zu sein wie niemand.« (ebd., 78)
So sieht Krappmann das Individuum in einem ständigen Balanceakt zwischen sozialer und persönlicher Identität, wodurch sich die sogenannte Ich-Identität definiert. (Also eine Aufteilung, wie wir sie in ähnlicher - wenn auch nicht identischer - Form auch bei Freud finden.)
Die Gefahr hierbei ist, dass das Individuum diesen Balanceakt nicht schafft und sich beispielsweise nicht von der sozialen Identität abheben kann und die Erwartun- gen der anderen vollständig übernimmt (siehe Film »Zelig«). Oder aber das Indivi- duum ignoriert die Erwartungen der anderen völlig und geht in seiner Einzigartig- keit auf. In beiden Fällen ist eine »Nicht-Identität« nach Krappmann die Folge.
»Für jedes Individuum ist seine balancierende Ich-Identität ein ständiger Versuch, sich gegen Nicht-Identität zu behaupten ... Mit Menschen ohne Ich-Identität ist es nicht möglich zu interagieren.« (ebenda, S. 79)
Folglich ist für ihn eine Identitätsbildung ohne Interaktion mit anderen Menschen nicht denkbar.
Bei dem Psychologen und Pädagogen Thimm findet sich Krappmanns Konzept der balancierten Ich-Identität und dessen Sichtweise von Einzigartigkeit als einer Forde- rung an das Individuum ebenso wie die doppelte Gefahr einer Nicht-Identität durch Aufgabe der persönlichen Identität einerseits und durch Aufgabe der sozialen Iden- tität andererseits.[10]
Individualisierung ist ein Prozess, bei dem sich die Art des Eingebundenseins des Individuums in die Gesellschaft verändert.[11] Das Individuum entwickelt und erarbeitet sich seinen Charakter in Wechselwirkung mit seiner Gesellschaft ständig neu. Wir können dies an unserer eigenen Person bereits erkennen. Die unserer Ansicht nach positiven Eigenschaften unserer Umgebung eignen wir uns an und stoßen die, welche uns nicht zusagen, ab. Goethe formulierte sehr treffend:
»Nenne mir Deinen Freund und ich sage Dir wer Du bist.«
1.3 DAS ICH IN DER PHILOSOPHIE
1.3.1 COGITO E(R)GO SUM - BIN ICH?
Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, was das komplexeste Ding im Univer- sum ist: Das menschliche Gehirn! Es gibt nichts, was dieses Ding an Komplexität übertrifft, nicht einmal das ganze Universum ist so hochkomplex wie dieses Stück Fleisch in unserem Kopf mit seinen Milliarden von Zellen und Synapsen. Irgendwo in dieser Masse steckt unser Bewusstsein und das sogenannte Ich - oder die Vor- stellung eines Ichs. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das im Stande ist, über sich selbst, sein Bewusstsein, seine Existenz und seine Zukunft nachzudenken.
Es stellt sich die Frage, woher wir eigentlich wissen, dass wir existieren. Die Frage scheint zuerst absurd und fremd. Denn wir setzen normalerweise voraus, dass wir existieren, denn sonst würden wir gar nicht eben genau darüber nachdenken können, oder? Es war ein gewisser französischer Philosoph namens René Descartes, der diese Frage nach dem eigenen ich und gleichzeitig auch die Welt der Philosphie auf den Kopf stellte. Denn wenn es kein Ich gibt, so kann auch nichts anderes Wahres existieren. Zu unserem Glück aber fand Descartes eine unumstößliche absolute Wahrheit der Existenz - das fundamentum inconcussum.
René Descartes formuliert diesen seinen Ansatz folgendermaßen - präzise und prägnant:
Cogito ergo sum.
»Nun hatte ich beobachtet, dass in dem Satz: Ich denke, also bin ich überhaupt nur dies mir die Gewissheit gibt, die Wahrheit zu sagen, das ich klar einsehe, dass man, um zu denken, sein muss.« (Discours de la méthode, Teil IV).
Ursprünglich lateinisch als »Cogito ego sum« formuliert, später auf französisch »Je pense, donc je suis.«, bedeutet dies: Ich denke, also bin ich. Wie auch oben von De- scartes formuliert, kann man zwar an allem zweifeln, aber wir wissen mit absoluter Sicherheit, dass wir zweifeln, und dass es unser Ich ist, das dies in diesem Moment betreibt. Um aber zweifeln oder denken zu können, muss man existieren, da »ich« ja sonst nicht zweifeln könnte.
Erst im Nachhinein wurde aus dem »Cogito ego sum« das gängigere »Cogito ergo sum«, entsprechend des französischen »donc«. Allerdings ist bekannt, dass Descartes bewusst das »ego« formuliert hatte, da »ego« im Lateinischen zur beson- deren Betonung des Ichs benutzt wird. Das war auch die Absicht von Descartes. Es ging ihm vor allem um das »Ich« und nicht um die logische Folge aus dem »Cogi- to«.
D.h. also, nach Descartes, Zweifeln grundlegend ist, um das Selbst zu erkennen. Es führt uns auf die Spuren unserer Existenz und somit unseres Ichs. Descartes sieht den Schlüssel der Welt in dem ego des Menschen, in seiner Rationalität und seinem Bewusstsein.
1.3.2 DER TOD DES ICHS - ES LEBE DIE FREIHEIT!
In dieser Arbeit wurde bereits auf einige Merkmale des Ichs eingegangen und nun kommt ein weiterer Aspekt, der bewusst erstmal nicht angesprochen wurde: Gibt es das Ich überhaupt? Anders als nämlich Descartes’ Dualismus und Cogito, ging Ernst Mach[12] so weit zu sagen, dass es gar kein Ich gibt und dass Geist und Körper ein und dasselbe sind. Jahrtausende lang sprach die Philosophie und der Mensch vom »Ich« und nun stellte Mach genau dies in Frage.
»Das Ich ist keine unveränderliche, bestimmte, scharf begrenzte Einheit.
Das Ich ist unrettbar. Teils dieser Einsicht, teils die Furcht vor derselben führen zu den absonderlichsten pessimistischen und optimistischen, religiösen und philosophischen Verkehrtheiten.«[13]
Eine ähnliche Ansicht vertrat schon der schottische Philosoph David Hume. Nach ihm war das Ich gar nichts Reales, sondern nur in der Vorstellung existent. Wenn man aber das Ich definieren müsste, so sei es eine »Zusammensetzung der Wahr- nehmungen«.
Ist es tatsächlich so? Machen wir uns als Mensch selbst etwas vor? Eine absolute Wahrheit darüber wird man wohl noch lange Zeit suchen und vielleicht auch nie finden. Aber wäre es denn so schlimm, wenn das Ich nur eine Illusion ist? Reicht uns das nicht, da wir doch immer noch ein und dieselbe Person sind? Der Soziologe Niklas Luhmann meint: »Man ist Individuum, ganz einfach als der Anspruch, es zu sein. Und das reicht aus.«
1.3.4 WAS TUE ICH?
Nehmen wir mal an, es gibt das Ich. Er ist so sehr existent wie unser Körper. (Wir ignorieren die Tatsache, dass auch unser Körper vielleicht gar nicht existiert und setzen all dies als gegeben voraus.) Wenn es das Ich gibt, was soll es tun? Die Frage ist abstrakt, aber dennoch nicht unberechtigt. Es war das Jahr 1730 in Königsberg, als ein gerade mal 6-jähriger Junge, von dieser Fragestellung ausgehend, folgenden Satz formulierte:
»Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.«
Es war Immanuel Kant, der zu den bedeutendsten Philosophen der abendländi- schen Philosophie zählt. Später entwickelte er ein eigenes Modell der physikalischen Welt und versuchte die Welt, alleine durch seine eigenen Schlussfolgerungen, ohne mathematische Ableitungen, zu ergründen. Sein eigentlicher Schwerpunkt war aber die Moralphilosophie. Er suchte im Bewusstsein des Menschen nach Gesetzmäßig- keiten, um daraus eine allgemeine Moral für alle Menschen zu finden. Die Erkennt- nis liegt nach Kant nicht in den Dingen der Welt, sondern im menschlichen Denken (Transzendentalphilosophie). Er versuchte 4 grundlegende Fragen zu ergründen:
1. Was kann ich wissen? (Erkenntnistheorie)
2. Was soll ich tun? (Ethik)
3. Was darf ich hoffen? (Religionsphilosophie)
4. Was ist der Mensch? (Anthropologie)
In seinem mächtigen Werk Kritik der reinen Vernunft schrieb er:
»Der Verstand schöpft seine Gesetze nicht aus der Natur, sondern schreibt sie die- ser vor.« Anders als Rousseau (siehe 1.4.1 Individuum oder Dividuum?) geht es nicht darum, ob der Mensch von Natur aus gut ist, sondern ob sein Menschsein ihn ver- pflichtet, gut zu sein. Auf der Suche nach diesem fand er heraus, dass das einzig Gute im Menschen der Gute Wille sei. Somit formulierte er seinen berühmten kate- gorischen Imperativ:
Handle stets so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.
In der Fähigkeit des Menschen, gut sein zu können, sah er die Verantwortung und die menschliche Pflicht, gut zu sein.
1.3.5 IST DAS ICH FREI?
Auf die obige Frage werden wohl die meisten eine Antwort für sich parat haben. Aber vielleicht sollte man sich diese Frage dennoch stellen: Bin ich wirklich frei? Mit dem Titel »Das Sein und das Nichts« formulierte Jean-Paul Sartre seine Arbeit und beschrieb, dass der Mensch das einzige Tier sei, das nicht nur an das Jetzt, sondern auch über die Zukunft - seine Zukunft - nachdenken kann. Das einzige Existenzielle am Menschen sind nach Sartre seine Gefühle: der Ekel, die Angst, die Sorge. Er nannte seine Philosophie Existenzialismus. Diese Philosophie und deren Spuren zeigen sich auch in Zelig, der im zweiten Teil dieser Arbeit analysiert wird. Da dies eben so wichtig für das Verständnis des Ichs (und auch den Film Zelig) ist, wird im Folgenden, ohne den Rahmen dieser Arbeit zu sprengen, darauf eingegan- gen.
Nach Sartres Auffassung definiert sich der Mensch nicht durch eine vorgegebene göttliche Instanz, sondern durch seine eigenen Taten:
»Der Mensch ist das, was er vollbringt. […] Es gibt Wirklichkeit nur in der Tat.«[14]
Jeder ist für sein Handeln und sein Schicksal verantwortlich. Sartre sah in der Frei- heit des Menschen seine Selbstverwirklichung. Er sah den Menschen zur Freiheit verdammt. Erst wenn der Mensch sich dessen bewusst wird, erkennt er auch sich selbst.
»Der Mensch ist zuerst ein Entwurf; nichts existiert diesem Entwurf vorweg, und der Mensch wird zuerst das sein, was er zu sein geplant hat«.
Grundsätzlich besitzt der Mensch die Fähigkeit sein Leben und sein Ich zu jedem Zeitpunkt zu verändern, auch wenn er am Ende scheitert. Somit scheint Sartre eine Antwort auf viele Fragen der Identität zu geben, die heute in der Moderne immer lauter werden. Er sieht den Menschen in der Mächtigkeit, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, anstatt sich dies von einer anderen Instanz diktieren zu las- sen. Sogar in einem »unfreien« Zustand, beispielsweise als Gefangener, kann der Mensch nach Sartre durch die Auflehnung gegen die Situation der Unfreiheit seine menschliche Freiheit zeigen.[15]
Mit dieser Freiheit wächst aber auch die Verantwortung, wie oben beschrieben.
Denn dies bringt die Verantwortung, da ich zur Freiheit bestimmt bin, mich gegen jede Tyrannei und Sklaverei zu behaupten. (Es wundert daher auch nicht, dass sich Sartre zu seiner Zeit der Résistance gegen die Nazis und deren Kollaborateure anschloss.) Ich kann und darf mich selbst daher nicht als »Mitläufer« in eine Sklaverei degradieren, wie das beispielsweise Zelig im gleichnamigen Film später tut, um sich der Verantwortung der eigenen Handlungen zu entziehen. Wer frei ist, der ist verantwortlich und wer verantwortlich ist, der ist frei.[16]
Lange Zeit stand der Begriff der Freiheit im Vordergrund und man vernachlässigte, dass der Freiheit auch eine Verantwortung folgt. Diese Symbiose ist nicht überlebensfähig, wenn Eines der Paare nicht da ist.
1.4 PSYCHOLOGISCHE UND SOZIOLOGISCHE BETRACHTUNG
1.4.1 INDIVIDUUM ODER DIVIDUUM?
Der Begriff des Individuums ist im Zusammenhang der vorliegenden Arbeit sicherlich ein wichtiger, gar unverzichtbarer Bestandteil der Analyse zur Identität. Daher wird im Folgenden ein kurzer Abriss zu dieser Begrifflichkeit vorgenommen, welcher aber nur als »Skizze« verstanden werden sollte.
Zunächst sehen wir uns wieder die Etymologie des Wortes an: Diese stammt aus dem Lateinischen und bedeutet unteilbar oder nicht zu Teilendes. Darunter versteht man nach der Definition der meisten Lexika etwas Einzelnes in seiner Gesamtheit mit all seinen Eigenarten und Eigenschaften, das nicht geteilt werden kann, ohne seine Eigenart zu verlieren. Es bezeichnet also ein Einzelwesen bzw. das Singuläre. Ausgehend von dieser Definition kann man sagen, dass die meisten Philosophen den Begriff nach Ihrer eigenen Lehre und Idee definierten und keine einheitliche Beschreibung hierfür unter den Philosophen existiert. Man kann aber sagen, dass der Begriff Individuum zumeist für das menschliche Ich im Zusammenhang zur Gesellschaft verwendet wird. Der Begriff des Individuums setzt ein Bewusstsein und die Fähigkeit zu denken voraus. Ausserdem wird der Begriff benutzt, »um die Eigenschaften bzw. Interessen von einzelnen Individuen von denen einer Personen- mehrheit (Gemeinschaft) zu betonen [bzw. zu differenzieren]«.[17] Ein Individuum trifft also eigenständige - von der Gesellschaft unabhängige - Entscheidungen und kann mit seiner Meinung von den gesellschaftlichen Normen abweichen. In diesem Sinne kommt es unserer Definition der Identität also sehr nahe, wenn- gleich es nicht dasselbe beschreibt. Identität hat - im menschlichen Kontext - zwangsläufig auch etwas mit Gegebenem zu tun, wie z.B. mit der Herkunft. Das Individuum kann sich aber auch (als hinreichendes Kriterium) nur durch seine von der Gesellschaft abweichenden Meinung definieren. Diese Unterscheidung ist sehr graduell aber entscheidend. Denn Identität hat - wenn man es den so bezeichnen kann - weniger mit »wollen« zu tun als mit »sein«. Es ist allerdings offensichtlich, dass beide Begriffe, Individuum und Identität, eine Eigenständigkeit und Differenz beschreiben und daher auch nicht selten gleichbedeutend verwendet werden. Je nach Epoche und Kultur kann der Begriff des Individuums aber eine andere Gewichtung haben. Heute, in der Moderne, im europäischen und nordamerikani- schen Kulturraum, wird das Individuum sehr stark betont. Alles scheint scheinbar »individuell« zu sein. »Individualität ist der elementare Tatbestand unserer Welt. Alles ist individuell, und alles will sich, sofern es wollen kann, in seiner Individu- alität erhalten.«[18] Wenn man sich die gängigen Werbeanzeigen und Spots ansieht, stellt man fest, dass dieses Wort oder ein diesem verwandtes Wort sehr oft benutzt wird. Dies liegt natürlich auch daran, dass in unserer Gesellschaft die Menschen nach Selbstverwirklichung streben bzw. streben können und nach der Maslowschen Pyramide (siehe 1.4.3 Die Maslowsche Bedürfnispyramide) dies das höchste erreichba- re Ziel des Menschen darstellt. Dieser starke Wunsch nach Eigenständigkeit wird auch als Individualismus bezeichnet. Ein Individualist handelt und denkt also nicht unbedingt gesellschaftskonform. Was aber, wenn in einer Gesellschaft ausnahms- los alle zu Individualisten werden? Ist es dann noch individuell, ein Individualist zu sein? Also etwas zu tun, was alle anderen ebenso tun? Hier scheiden sich die Geister. So ist in diesem Sinne ein Individualist nicht unbedingt ein nach absoluter Individualität strebender Mensch. Ganz im Gegenteil. So könnte solch ein »Indivi- dualist« auch durchaus ein Mensch sein, der im Gegensatz zum in der Gesellschaft vorherrschenden Konsens nach absoluter Individualität, eher einen Kollektivismus anstrebt.
Einer der bedeutendsten Philosophen und Denker in diesem Zusammenhang ist Jean-Jacques Rousseau, der auch als Wegbereiter der Französischen Revolution gilt. Nach seiner Auffassung war das Individuum per se von Natur aus gut und erst die Gesellschaft mache es zum »Barbaren«. Denn Interessenkonflikte in der Gesell- schaft verleiten die Individuen nach Rousseau zu Hass und Übel. Zwar schloss er eine Rückkehr in den »Naturzustand« aus, verfasste aber gleichzeitig sein politi- sches Hauptwerk »Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechtes«. Darin beschreibt er, wie das freie Individuum seine Freiheit im Zustand der Ge- sellschaft behalten kann. Grundlage dafür ist seine Abhandlung zum Sozialvertrag (contrat social). Dieser sollte gewährleisten, dass sich jeder wieder so frei fühlen kann wie im Naturzustand. D.h. es sollte keine Unterdrückung der Knechte durch den Eigentümer geben - ein »schlechter« Gesellschaftszustand - wie ihn der Genfer Rousseau kritisiert.
Natürlich hat auch diese Theorie von Rousseau seine Schwachpunkte. Er setzt den Menschen auf einen Thron des Guten, den der Mensch niemals einnahm. Denn ist es nicht eben gerade diese »schlechte« Gesellschaft, die den barbarischen Menschen Einhalt gebietet? Was wäre denn der Mensch, ohne Regeln, Gesetze und Werte? Ge- rade dies unterscheidet den Menschen von anderen Geschöpfen, sich verständigen und einigen zu können, für das Wohl aller. Zwar redet Rousseau von einem Sozial- vertrag in der Gesellschaft, aber braucht der Mensch denn so etwas? Wir haben die Verfassung und die Menschenrechte, die bereits den Mensch als solchen in Schutz nehmen. Freilich ist Rousseaus Ansicht daher nicht selten als realitätsfern und naiv kategorisiert worden. Viel naheliegender scheint da schon der kategorische Impera- tiv Kants (siehe 1.3.4 Was tue ich?). Denn Kant sah in jedem Menschen das Poten- zial, ungeachtet der Gesellschaft, gut handeln zu können, wenn man nach bestem Wissen und Gewissen handelt. Kant meinte sogar, dass das Endresultat einer Tat nicht so relevant sei, solange der Gute Wille den Ausgangspunkt einer jeden Handlung bestimme.
1.4.2 KOLLEKTIVE IDENTITÄT
Der Begriff der Identität wird oftmals als die der Individuen verstanden. Das ist aber nicht ganz richtig. Denn historisch betrachtet diente die Identität bereits in den frü- heren Zeitaltern schon als Organisationsprinzip zur Wahrung der Stabilität. Nach Jan Assmann begegnen wir der kollektiven Identität bereits in Altägypten. Das mul- tiethnische Reich verlangte nach einer expliziten Identifikation der Individuen mit dem sogenannten Selbstbild einer Gruppe. Bei Begegnung mit anderen Gruppen musste eine Reflexivität sichergestellt sein. So dienten verschiedene Riten, Zeichen und kulturelle Symbole als Maßnahmen, sich die Zughörigkeit ständig zu vergegen- wärtigen. »Alles kann zum Zeichen werden, um Gemeinsamkeit zu kodieren«[19]. So dienten die monumentalen Bauwerke Ägyptens nicht nur als Grabstätte und Symbole der Macht, sondern auch als kulturelles Gedächtnis.
Betrachtet man die Situation heute, ist es nicht sehr viel anders. Das verheerende Ereignis des elften September zeigte, dass Bauwerke durchaus als Symbole der kollektiven Identifikation fungieren können. So ist es für den Westen und die USA ein Symbol der Überlegenheit und der kulturellen Zivilisation, zu dessen Identität sich alle Mitglieder dieser Nation bekennen. Auf der anderen Seite war es für die Terroristen ein Symbol der Unterdrückung, welche dies ihrerseits identitätsstiftend nutzten, um Leute unter dieser Flagge zu rekrutieren.
Man muss also im Hinterkopf haben, dass nicht nur ein Individuum, sondern auch eine Gruppe oder Nation von Individuen eine kollektive Identität haben, leben und ansteuern kann.
1.4.3 DIE MASLOWSCHE BEDÜRFNISPYRAMIDE
Alles, was der Mensch - oder in diesem Falle das »Ego« - tut, geschieht aus einer Motivation heraus. Dies geschieht bewusst oder auch unbewusst, aber es gibt immer eine Motivation.
Früher wurde die Frage nach dem »Wer bin ich?« sicherlich weitaus weniger gestellt als es heute in unserer Gesellschaft der Fall ist. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es früher auch gar nicht relevant war. Man war froh, über die Runden zu kommen.
Fragen darüber hinaus wurden nicht gestellt. Interessant wird diese Frage erst, wenn der Mensch seine Existenz weitestgehend abgesichert hat und nicht mehr ums tägliche Überleben kämpfen muss. Somit hat er auch Zeit für die gehobenen Bedürfnisse. Dieses menschliche Verhalten hat der US-amerikanische Psychologe Abraham Maslow 1943 in einem Modell beschrieben, die sogenannte Maslowsche Bedürfnispyramide. Demnach beschreibt Maslow die menschlichen Bedürfnisse und Motivation in einer Art Hierarchie, die aufeinander auf baut. Diese besteht aus 5 Stufen, wie folgt beschrieben:
1. Grund- und Existenzbedürfnisse: Freiheit, Nahrung, Gesundheit, Sexualität, etc.
2. Sicherheit: Absicherung von Leben, Hab und Gut; Recht/Ordnung,
3. Sozialbedürfnis: Familie und Freunde, Kommunikation, Liebe
4. Anerkennung und Wertschätzung
5. Selbstverwirklichung: Individualität, Talententfaltung
Stellt man sich dieses Modell wie eine Pyramide vor, so steht Punkt fünf ganz oben und stellt den Gipfel aller menschlichen Bedürfnisse dar. Dieser kann nur erklom- men werden, wenn alle anderen Bedürfnisse davor vollkommen befriedigt worden sind. D.h., von diesem Modell ausgehend, dass es dem Menschen, der keine Aner- kennung erhält für seine Person, Leistungen und Fähigkeiten, nicht möglich ist, seine eigene Individualität auszuleben und zu entfalten. Wie bereits beschrieben, ist das Ego - wenngleich es auch erstmal gegensätzlich klingt - von anderen abhängig ist. Und zwar mehr als es selbst denkt.
1.4.4 EGOISMUS - WENN NUR DAS EIGENE ICH ZÄHLT
Es wurden bereits diverse Herangehensweisen an das Thema Identität aufgezeigt und nun wird im Folgenden ein besonderer Fall der Identität respektive des Iden- titätszustands behandelt: der Egoismus. Dies ist ein Sonderfall, da dies streng ge- nommen eine menschliche Eigenschaft ist, die in uns allen schlummert. Nur ist sie bei dem Einen etwas ausgeprägter als bei dem Anderen. Jedoch sind im Grunde alle Menschen mit dieser Eigenschaft von Geburt an ausgestattet. Versuchen Sie ein Kleinkind oder gar ein Baby dazuzubringen das Spielzeug zu teilen oder gar den Lolly. Man wird feststellen, dass das kein so einfaches Unterfangen ist wie vielleicht angenommen. Denn zuerst zählt immer das eigene Ich, nicht wahr?
Bezeichnenderweise kommt der Begriff des Egoismus von »ego,« welcher lateinisch übersetzt »ich« bedeutet. Dazu muss allerdings gesagt werden, dass im Lateinischen die Pronomen sich eigentlich unmittelbar durch die Endungen der Prädikate erge- ben, wie z.B. »sum«, übersetzt »ich bin«, oder »est«. übersetzt »er ist«. D.h., es nicht immer erforderlich das Wort »ego« zusätzlich zu nutzen. Geschieht dies dennoch, dann meistens, um das »ich« im Satzbild noch einmal deutlich hervorzuheben.
Auch im deutschen Sprachgebrauch ist das Wort Ego geläufig. Es bezeichnet das »Ich« bzw. das »Selbst« und wird in der Psychologie und Philosophie häufig als Sy- nonym für das »Ich« verwendet. Umgangssprachlich bezeichnen wir im Deutschen mit Sätzen wie etwa »Er hat ein großes Ego« eine selbstbewusste Person, die sich seines Wertes bewusst ist. Dies kann allerdings unter Umständen auch einen nega- tiven Beigeschmack haben, so dass diese Person als arrogant oder egoistisch verstan- den wird.
Das Suffix -ismus wird zur Klassifizierung bzw. Charakterisierung verwendet und verweist auf eine extreme Haltung. Es gibt auch andere Ismen, wie etwa Kapitalismus, Sozialismus, Dualismus, welche einfach nur ein gesellschaftliches Thema mit neutraler Wertigkeit beschreiben.
Was aber bedeutet Egoismus genau? Nun, als Egoist bezeichnet man normalerweise jemanden, der dieser »Gruppe« der Egoisten angehört. Der Egoist bzw. die Egoistin ist eine Person, die einzig und allein seine eigenen Bedürfnisse befriedigt und die anderen übergeht oder ignoriert. Allerdings liegt man falsch, wenn man denkt, dass Egoismus prinzipiell schlecht ist. Im Grunde ist nämlich – wie einleitend erklärt - jeder Mensch ein »kleiner Egoist«.
»Auch wenn wir einem anderen Menschen nachgeben und eigene Bedürfnisse zurückstellen, verfolgen wir damit ein Ziel. So gibt man beispielsweise bei einem Streit deshalb nach, weil wir Angst haben, nicht gemocht zu werden[…].«[20]
Der Evolutionsbiologe Josef Reichholf geht sogar noch einen Schritt weiter und be- hauptet: »Das egoistische Grundprinzip gilt für jedes Lebewesen, egal ob Bakteri- um, Baum oder Mensch.«[21] Denn die Natur kenne kein selbstloses Verhalten.
[...]
[1] Alter, 2002, S.1
[2] Schuh & Mitwirkende Fachleute 1980, S.196
[3] T. Hobbes: Grundzüge der Philosophie. Erster Teil. Lehre vom Körper
[4] Wermke, Kunkel-Razum, Scholze-Stubenrecht, 2005, S. 435
[5] Fröhlich, 1994, S. 212
[6] Erikson, 1974, S. 123
[7] Krappmann, Soziologische Dimension der Identität, 1993, S. 13
[8] Haeberlin/Niklaus, 1978, S. 41
[9] Krappmann, L.: Soziologische Dimensionen der Identität, 1993.
[10] Thimm, 1975, 137-140
[11] Flavia Kippele: Was heißt Individualisierung? Die Antworten soziologischer Klassiker, 1998
[12] Ernst Mach lebte von 1838 bis 1916 und war ein bekannter Physiker, Philosoph und Wissenschaftler. Nach ihm wurde die Mach-Zahl benannt, die die Geschwindigkeit im Verhältnis zur Schallgeschwindigkeit beschreibt.
[13] Precht, Wer bin ich und wenn ja wie viele?, 2007
[14] Jean-Paul Sartre, Das Sein und das Nichts, Rowohlt, 1993
[15] Schönherr-Mann, 2005, S. 11
[16] Ebenda
[17] http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Individuum.html, 10.08.2009
[18] Volker Gerhardt: Individualität: das Element der Welt, 2000, S.18
[19] Assmann, 1999, S. 139
[20] http://www.focus.de/wissen/bildung/egoismus/psychologie_aid_26199.html, 26.08.2009
[21] http://www.focus.de/wissen/bildung/egoismus/evolutionsbiologie_aid_26211.html, 26.08.2009
- Arbeit zitieren
- Mustafa Celikkaya (Autor:in), 2009, Masken und Identitäten der Moderne, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139566
Kostenlos Autor werden















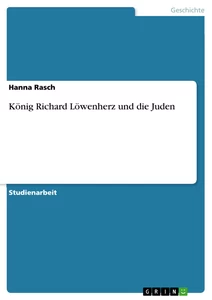




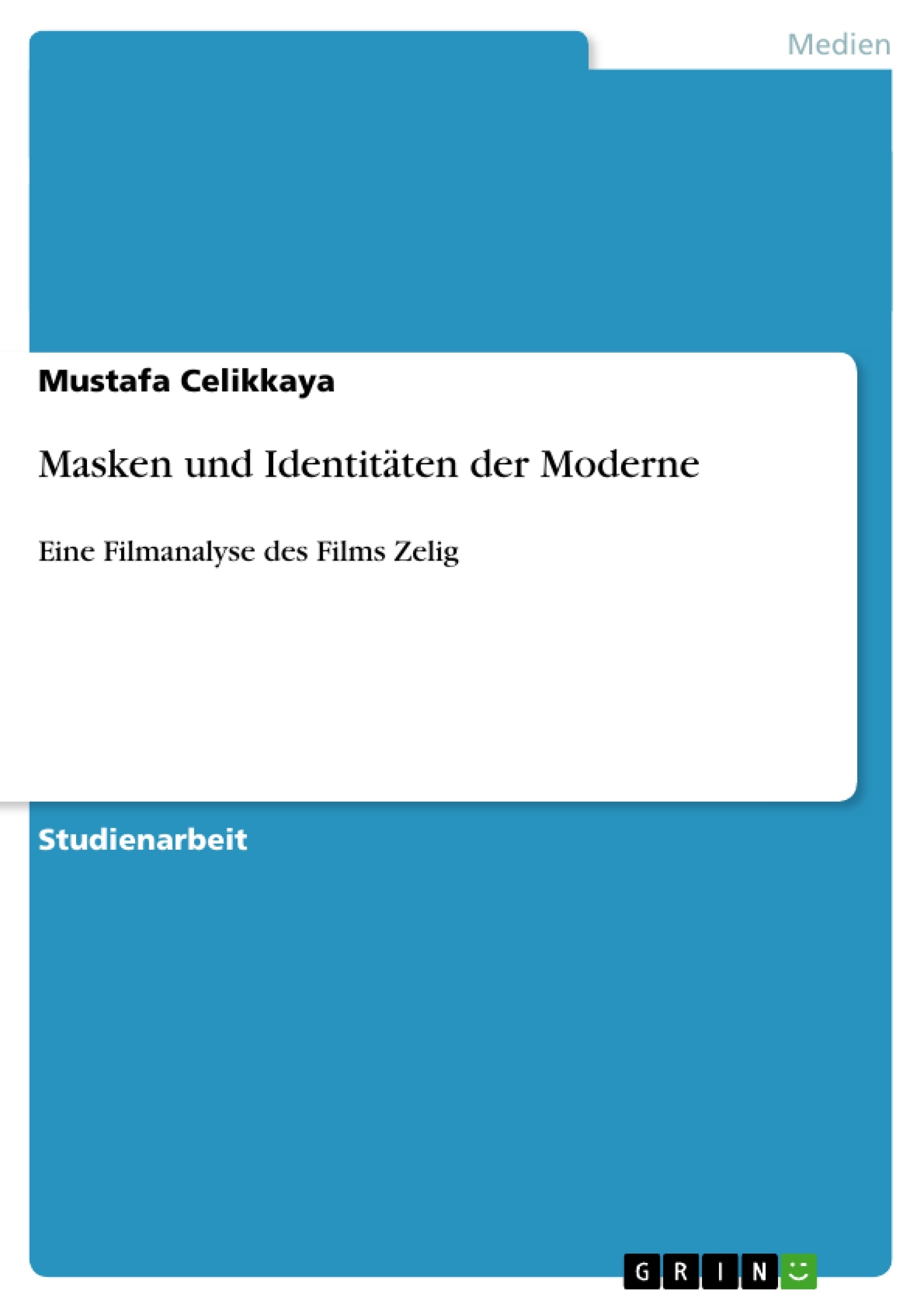

Kommentare