Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG
GRUNDLAGEN
1 GENETISCHES ÜBERLEBEN
1.1 Zwischen den Disziplinen - Von der Soziobiologie zur Evolutionspsychologie
1.2 Artwohl oder Eigennutz?
1.3 Konflikt und Kooperation
1.3.1 Der Kampf der Geschlechter
1.3.2 Konflikte im Familienverband
1.3.3 Egoismus, Altruismus oder Egoistischer Altruismus?
1.4 Erbe und Umwelt: Ist der Mensch ein Sklave seiner Gene?
1.5 Exkurs: Moral in der Soziobiologie - Die Tendenz zur Doppelmoral
KRIMINALITÄT ALS RESULTAT NATÜRLICHER SELEKTION?
2 MORD
2.1 Kritische Betrachtung zu „Der Mörder in uns - Warum wir zum Töten programmiert sind“ von David Buss
2.2 Mordphantasie
2.3 Allgemeine statistische Muster: Wer tötet wen?
2.4 Mord in Partnerschaften
2.4.1 Mordmotive
2.4.2 Statistische Muster bei Partnermorden
2.4.3 Prädikatoren für Mord
2.4.4 Das Töten von Nebenbuhlern
2.5 Mord in der Familie
2.5.1 Filizid
2.5.1.1 Wenn Eltern ihre leiblichen Kinder töten
2.5.1.2 Das gefährliche Leben der Stiefkinder
2.5.2 Parentizid - Wenn Kinder ihre Elter töten
2.5.3 Siblizid - Geschwistermord
2.6 Mord als evolutionäre Anpassungsleistung - Status und Reputation
2.6.1 Männliche Reputation
2.6.2 Weibliche Reputation
3 SCHLUSSBETRACHTUNGEN
3.1 Zusammenfassung
3.2 Diskussion
LITERATURVERZEICHNIS
EINLEITUNG
Themenfindung
Mord. Wie kommt man dazu, sich in der Magisterarbeit mit den Abgründen der Menschheit zu beschäftigen? Die Antwort liegt im Blickwinkel. Verbrechen verströmen eine subtile Faszination; die Frage nach den Hintergründen: Was trennt uns selbst von solch einer Tat? Doch noch viel interessanter wird dieser Bereich im Lichte der Soziobiologie. Ist der Mensch prädestiniert für Mord? Ist wirklich jeder dazu fähig? Man möchte glauben, dass solch deviantes Verhalten nur bei kranken oder gestörten Persönlichkeiten zu Tage tritt. Doch die Soziobiologie und die Evolutionspsychologie sehen das ganz anders. Diese Disziplinen graben tief nach den Wurzeln des Menschen und suchen dort nach Antworten auf solche Fragen.
Früher hat schon die Humansoziobiologie für empörtes Raunen gesorgt. Der Mensch hat seit jeher eine Sonderstellung beansprucht und sich weigerte, sich auf eine Stufe mit allen anderen Lebewesen zu stellen. Wie kann man also menschliches Verhalten mit dem Verhalten von Tieren erklären wollen? Diese Frage stellt sich mittlerweile - auch im Hinblick auf die Evolutionspsychologie - nicht mehr. Doch geht der Versuch, kriminelles Verhalten mit soziobiologischen und evolutionspsychologischen Erklärungen greifbar zu machen noch einen Schritt weiter. Ob dies immer gut gelingt und ob es gerechtfertigt ist, den Menschen sozusagen als „das vernunftbegabte Tier“ zu sehen, bleibt vorerst dahin gestellt.
Der Mörder in uns Diese Arbeit befasst sich mit den Ansätzen verschiedener Forscher zum Thema „Mord“ und soll aufzeigen und feststellen, was soziobiologische Erklärungen auf diesem schwierigen Terrain zu leisten vermögen. Die Grundlage dabei bildet die Arbeit „Der Mörder in uns“ von David M. Buss, welcher nach Martin Daly und Margo Wilson einen umfassenden Überblick über das Thema bietet. Ziel ist hier, das Thema so objektiv wie möglich zu behandeln und zu jedem Zeitpunkt herauszustellen, dass es sich lediglich um eine Erklärung des Umstandes, nicht aber um eine Legitimation, handelt.
In seinem Buch setzt sich der texanische Psychologe ausführlich mit dem Thema Mord und der Antwort auf die Frage „warum wir zum Töten programmiert sind“ auseinander. Der Kern von Buss‘ Annahmen ist seine „Logik der evolutionären Theorie des Mordes“. Vornehmlich soll herausgestellt werden, wie überzeugend David Buss‘ Theorie und seine Antworten auf diese Frage sind.
Sind kriminelle Handlungen tatsächlich in der Lage, unseren Reproduktionserfolg - und damit unser genetisches Überleben - in der Welt zu erhöhen? Sind wir sogar genetisch dazu programmiert? Ist der Mensch ein Sklave seiner Gene?
Grundlagen
Um einen Überblick darüber zu bekommen, was es bedeutet, sich dem Thema „Mord“ von einer soziobiologischen oder evolutionspsychologischen Seite her zu nähern, ist es nötig, sich zuvor mit den Grundlagen der Evolution des Verhaltens vertraut zu machen. Die Soziobiologie beginnt bei der Erforschung des Tierreichs, und ebenfalls werde ich in dieser Arbeit zunächst damit beginnen, die Grundlagen des genetischen Überlebens zu skizzieren. Dies wird sich allerdings nur in einem kleinen Rahmen bewegen. Zur Vertiefung eignen sich die Werke „Was ist Soziobiologie“ von Franz M. Wuketits, „Sociobiology and Behaviour“ von David P. Barash, „Sociobiology - The New Synthesis“ von Edward O. Wilson und „Das egoistische Gen“ von Richard Dawkins.
Datenlage
In der BRD existiert leider keine genaue Aufstellung der Morde als Beziehungstaten. Die Daten des Bundeskriminalamtes Wiesbaden, beispielsweise die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) erfasst nur die groben Kategorien „Verwandtschaft“, „Bekanntschaft“, „Landsmann“, „flüchtige Vorbeziehung“ und „keine Vorbeziehung“.1 Daher lassen sich die Ergebnisse der Forscher, welche sich vornehmlich auf kanadische und amerikanische Daten beziehen, kaum auf Deutschland anwenden. In den USA findet durch das SHR und das FBI seit den späten 50er Jahren eine genaue Erfassung der Täter-Opfer-Beziehung statt. (Eichenmüller et al. 2006: 4) Die Daten des Statistics Canada unterscheiden ebenfalls nicht grundsätzlich zwischen genetischer Verwandtschaft und Stiefverwandtschaft. Des Weiteren sind für die BRD keine Statistiken über die Mordmotive verfügbar.
Die Mordraten sind in Amerika wesentlich höher, als im Bundesgebiet. 2005 wurden in Amerika 16692 Morde registriert, im Vergleich dazu in der Bundesrepublik Deutschland nur 794.2 (Quelle: FBI, Uniform Crime Reports, 1950 - 2005, Bundeskriminalamt, Polizeiliche
Kriminalstatistik 1987 - 2007) Auch wenn man die Bevölkerungszahlen mit einbezieht, stellt sich heraus, dass es in Amerika pro 100000 Einwohner 5,6 Morde gab, in der BRD auf die selbe Einwohnerzahl nur einen.
Tötungsdelikte
Es ist schwierig kanadische, amerikanische und deutsche Daten zu vergleichen, da sich bei der Registrierung von Tötungsdelikten die Kodierungen oftmals unterscheiden und von der Gesetzeslage abhängig sind. Im deutschen Strafrecht sind diverse Tatbestände für Tötungshandlungen zu finden, Grundtatbestand ist § 211 StGB Mord beziehungsweise der § 212 StGB Totschlag. § 211 (2) StGB Mord:
„Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.“ (Quelle: Bundesministerium der Justiz)
§ 212 (1) StGB Totschlag:
„Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.“ (Quelle: Bundesministerium der Justiz)
Sind diese Kriterien nicht erfüllt und hat der Angeklagte den Tod eines anderen verschuldet ohne „Mörder“ zu sein, wird er nach § 212 StGB bestraft. Des Weiteren § 213 StGB, den minder schweren Fall des Totschlags.
„War der Totschläger ohne eigene Schuld durch eine ihm oder einem Angehörigen zugefügte Misshandlung oder schwere Beleidigung von dem getöteten Menschen zum Zorn gereizt und hierdurch auf der Stelle zur Tat hingerissen worden [ist] […]“ (Quelle: Bundesministerium der Justiz) Darüberhinaus gibt es nach §227 StGB schwere Körperverletzung mit Todesfolge. Das amerikanische Strafrecht unterscheidet homicide unter anderem in murder § 1111:
Murder is the unlawful killing of a human being with malice aforethought. Every murder perpetrated by poison, lying in wait, or any other kind of willful, deliberate, malicious, and premeditated killing; or committed in the perpetration of, or attempt to perpetrate, any arson, escape, murder, kidnapping, treason, espionage, sabotage, aggravated sexual abuse or sexual abuse, child abuse, burglary, or robbery; or perpetrated as part of a pattern or practice of assault or torture against a child or children; or perpetrated from a premeditated design unlawfully and maliciously to effect the death of any human being other than him who is killed, is murder in the first degree. Any other murder is murder in the second degree. (Quelle: Conrell University Law School) manslaughter § 1112:
Manslaughter is the unlawful killing of a human being without malice. It is of two kinds: Voluntary—Upon a sudden quarrel or heat of passion.
Involuntary—In the commission of an unlawful act not amounting to a felony, or in the commission in an unlawful manner, or without due caution and circumspection, of a lawful act which might produce death. (Quelle: Conrell University Law School) Die Polizeiliche Kriminalstatistik unterscheidet Mord und Körperverletzung mit Todesfolge ebenfalls in den Erhebungen, das U. S. Bureau of Statistics hingegen bezieht sich nur auf homicide.
Um die Benennung in dieser Arbeit einheitlich zu gestalten, halte ich mich an die von Wilson und Daly vorgeschlagene Definition „ ... those interpersonal assaults and other acts directed against another person (for example, poisonings) that occur outside the context of warfare, and that prove fatal.“ (Daly & Wilson 1988b: 14) In „Der Mörder in uns“ wird homicide ausschließlich mit Mord übersetzt und dieser Übersetzung werde ich mich anschließen.
1 GENETISCHES ÜBERLEBEN
Die Soziobiologie beschäftigt sich mit der biologischen Angepasstheit von Organismen, (Voland 1993: 1) wobei die Evolutionsbiologie den größeren Rahmen bildet, in dem sich die Soziobiologie befindet. Der Kern der Soziobiologie spiegelt sich in der Annahme, dass Verhaltensweisen Ergebnisse der Evolution durch natürliche Auslese sind. Sie stellt sich als Verbindungslinie zwischen verschiedenen Disziplinen dar, die zum Verständnis des sozialen Verhaltens von Tieren und Menschen beitragen. Dadurch hat sie den Anspruch, durch vergleichende Arbeiten allgemeine Gesetzmäßigkeiten zu enthüllen, welche für alle Lebewesen gültig sind.
Wilson beschreibt im letzten Kapitel seines monumentalen Werkes „Sociobiology - The New Synthesis“, dass menschliche Sozialstrukturen im Wesentlichen tierischen Sozialstrukturen gleichen. Sie sind ist ebenso auf evolutive, genetische Grundlagen zurück zuführen, ebenso wie das Moralverhalten. (Wilson 1975: 547ff) Schon Darwin konnte deutlich machen, dass der Mensch nicht nur in seinem Körperbau, sondern auch in seinem Sozialverhalten als Ergebnis der Evolution durch natürliche Auslese der Selektion zu verstehen sei. Er nimmt an, dass soziales Verhalten in seinen verschiedenen Ausdrucksformen eine genetische Basis hat und Überlebensvorteile mit sich bringt. Laut Eckart Voland spielt das „Sozialverhalten eine ganz wesentliche Rolle in den Selbsterhaltungs- und Fortpflanzungsbemühungen der Organismen [und] unterliegt […] der formenden und optimierenden Kraft der evolutionsbiologischen Vorgänge.“ (Voland 1993: 1)
Der Mensch teilt etwa 99,5 Prozent seiner Evolutionsgeschichte mit den Schimpansen (Trivers, in Dawkins 1978: V). Daher liegt es nahe, dass das Verhalten sowohl von Schimpansen als auch von Menschen die gleichen Wurzeln hat. Rangordnungen und Dominanzstreben findet sich bei beiden Spezies, aber nur der Mensch verfügt als einzige Spezies über eine Symbolsprache. Die Strukturen unseres Sozialverhaltens sind das Resultat des Lebens in Kleingruppen, unseren Primär- oder Sympathiegruppen, was sich auch im Moralverhalten zeigt. Die Individuen solcher Kleingruppen sind einander persönlich bekannt und pflegen viele Formen von Kooperation und reziprokem Altruismus. Diese Kleingruppen zeichnet aus, dass sie gruppenfremden Individuen gegenüber sehr skeptisch sind. Sie grenzen ihre eigene Gruppe mehr oder weniger deutlich von den anderen ab. (Wuketits 2002: 83ff.) Besonders starke soziale Bande, wie sie in Kernfamilien zu finden sind, fördern den Zusammenhalt und die Kooperation und führen überdies dazu, dass die Skepsis gegenüber anderen Individuen zunimmt. Diese Steigerung der Skepsis kann allerdings im Extremfall auch in Aggression umschlagen. (Dawkins 1978: 316f.)
Nach Wuketits leben wir in der Gegenwart größtenteils in anonymen Massengesellschaften. Die typische Form der Großstädte zwingt uns dazu, in einer Ansammlung von Individuen zu leben, mit denen uns keine sozialen Bande verbinden. (Wuketits 2002: 84f.) Da der Mensch von Natur aus ein Kleingruppenwesen ist, stößt er hier auf Probleme mit seiner „Kleingruppenmoral“ und den ebenso auf Kleingruppen ausgelegten Regelwerken. Mit den abstrakten Sozietäten ist das einzelne Individuum überfordert, denn sein eigenes soziales Netzwerk besteht nach wie vor aus relativ kleinen Gruppen mit abgestuften Sympathiewerten. Die stärksten sozialen Bande knüpfen wir mit Familienangehörigen. Nah stehen uns darüberhinaus Freunde und als letzte Gruppe haben wir Bekannte, die sich immer noch von allen anderen Fremden in unserer Sympathieskala abheben. (Wuketits 2002: 86ff.)
1.1 Zwischen den Disziplinen - Von der Soziobiologie zur Evolutionspsychologie
Die Soziobiologie als Disziplin ist ein kritischer Bereich. Sie bewegt sich relativ interdisziplinär und daher existieren sie betreffend eine Vielfalt von Standpunkten und Betrachtungsweisen. Voland beschreibt die Soziobiologie so: „[…] getragen vom Darwinischen Paradigma offeriert sie eine neutralistische Perspektive der conditio humana.“ (Voland 1993: 1) Natürlich gibt es auch Kritiker. Soziologen wie Evelyne Sullerot befürchten eine Reduktion der Soziologie auf oder durch die Biologie (dazu auch Wuketits 2002: 13, Vowinckel 1997: 32), man könne ihrer Meinung nach eine „Situation, die die Verfechter der Biologie zur Vorsicht anhält, […] begrüßen.“ (Sullerot 1979: 61) Nach Vowinkel geht es bei der Soziobiologie eher um eine Versozialwissenschaftlichung der Biologie, doch sieht er keinen Sinn in derlei Feststellungen. (Vowinckel 1991: 536f.) Lautmann kritisiert an soziobiologischen und evolutionspsychologischen Thesen, dass für sie ein subjektiv gemeinter Sinn von sozialen Handlungen nicht existiere. Ebenso berücksichtigen Thesen dieser Art nicht, dass der Mensch sprechen, denken, und seine Handlungen begründen kann.
(Lautmann 2004: 60) Dazu kommen drastischere Ansichten wie die von Wilson, welcher die Meinung vertritt, dass jegliches Verhalten - auch beim Menschen - dazu bestimmt sei, einen Fortpflanzungsvorteil zu beschaffen. Diese Ansicht wirft Probleme auf, beispielsweise bei der Frage, warum gleichgeschlechtliches Verhalten, welches nun einmal per se non-produktiv sei, nicht bereits aufgrund von selektiver Auslese ausgestorben ist. (Lautmann 2004: 60f.) Generell wird Soziobiologen gerne eine Art „biologischer Determinismus“ vorgeworfen. (Dawkins 1978: 284)
Bei dem Versuch, biologische Grundlagen und menschliches Sozialverhalten in einen Zusammenhang zu bringen, sind noch nicht alle Fragen beantwortet. Die Soziobiologie lässt noch einige Wünsche offen, was den theoretischen Versuch betrifft. Sie stellt sich aber als eine durchaus ertragreiche Heuristik dar, welche unter anderem der Soziologie behilflich sein kann, ein „realistischeres Bild von den biologischen Fundamenten der sozialen Phänomene zu entwickeln […]“. (Meyer 1997: 30)
Die Evolutionspsychologie stellt eine Weiterentwicklung der Soziobiologie dar. Sie bezieht die mentale Ausstattung des Menschen mit ein und geht davon aus, dass der menschliche Geist aus sogenannten „Modulen“ besteht. Diese steuern in ihrem Zusammenspiel das menschliche Verhalten. (Lautmann 2004: 61) Die zweite Prämisse der Evolutionspsychologie ist, so Plümecke, dass die menschliche Psyche unter Einbeziehung einer pan- adaptionistischen Sicht auf die Entstehung des zentralen Nervensystems erforscht werde. Allerdings gibt es für die Existenz dieser Module weder paläontologische Daten zur Validierung dieser These noch neurologische Hinweise. (Plümecke 2005: 172)
1.2 Artwohl oder Eigennutz?
Ursprünglich gab es zwei unterschiedliche Ansichten in der Soziobiologie bezüglich der Frage, was denn im Kampf ums Überleben überlebt. Nach Herbert Spencer war die Grundlage die Selbsterhaltung. In einer zweiten anfänglichen Ansicht, vertreten von Konrad Lorenz und seinen Schülern, wurde angenommen, dass das Verhalten, welches Individuen an den Tag legen grundsätzlich und in jedem Falle der Erhaltung der eigenen Art diene. Diese beiden Theorien existierten mehr oder weniger nebeneinander und wurden je nach Problemlage zur Erklärung von Verhalten herangezogen. Lorenz nahm sogar an, dass selbst aggressives Verhalten unter Artgenossen nur mit Blick auf das Artwohl geschehe. (Lorenz 1955: 116) Den Individuen, gleich welcher Art, wäre eine angeborene Tötungshemmung zu Eigen. (Lorenz: 1974: 37, Dawkins 1978: 80f.) Die Feststellung, dass sehr wohl Tötungen von Artgenossen beobachtet wurden, begründete Lorenz unter anderem damit, dass diese angeborene Tötungshemmung unter dem Einfluss der Domestikation verloren gegangen sei. (Wuketits 2002: 28) Allerdings widersprechen zahlreiche Feststellungen diesen Überlegungen. Es wurden Infantizide bei Languren beobachtet; nach einer Haremsübernahme durch ein Männchen wurden die Nachkommen des alten Haremsinhabers von ihm getötet. (Eibl-Eibesfeldt 1997: 140) Gleiches gilt für Löwen. (Wuketits 2002: 28f., Eibl-Eibesfeldt 1997: 141)3 Nachdem lange Zeit Lorenz‘ Annahmen im Vordergrund standen, ist ein Paradigmenwechsel durch die Disziplin gegangen. Neuere Forschungen belegen, dass bei jedem Individuum ausschließlich das eigene Fortpflanzungsinteresse von Belang ist. Bezogen auf die Frage was denn im struggle for life überlebt, lautet die Antwort: die Geninformation. (Vowinckel 1997: 33) „Die Erhaltung und Fortpflanzung des eigenen Erbgutes hat Priorität vor der Erhaltung von Artgenossen ganz allgemein.“ (Wuketits 2002: 29) Denn gerade beim Infantizid zeigt sich, dass Artgenossen getötet werden, wenn das der Verbreitung der eigenen Gene förderlich ist. Nach Lorenz‘ Theorie wäre das höchste Ziel die Erhaltung der Art und sowohl Infantizid als auch das Töten anderer Artgenossen lässt sich mit dieser Annahme nicht erklären.
Der Paradigmenwechsel führte dazu, dass soziales Verhalten nicht mehr im Hinblick auf den Artvorteil untersucht wird. Das Augenmerk liegt nun auf den unterschiedlichen Strategien im sozialen Verhalten, mit denen die Individuen ihr eigenes genetisches Überleben sichern. Zu dieser Sicherung sind unbewusste Kosten-Nutzen-Kalkulationen nötig, denn Fortpflanzung und der Weg dorthin bringen einen erheblichen Energieaufwand mit sich. Die Ressourcen, die den Individuen dafür zur Verfügung stehen sind allerdings begrenzt. Da alle anderen Lebewesen das gleiche Ziel verfolgen, ist Wettbewerb um diese knappen Ressourcen unvermeidlich.
1.3 Konflikt und Kooperation
Bei allen Organsimen dreht sich die zentrale Frage um das genetische Überleben, genauer gesagt die Fortpflanzung. Oftmals stellt es sich aber schon als Herausforderung dar, überhaupt in ein fortpflanzungsfähiges Alter zu gelangen. Dies liegt unter anderem an einem enormen Feinddruck, dem ein einzelnes Individuum kaum Stand halten kann. Daher hat sich das Zusammenleben in Gruppen als erfolgreiche Strategie entwickelt. (Weber 2003: 51) Dabei unterscheidet man verschiedene Formen von Sozietäten. Es gibt enge persönliche Bindungen, die beispielsweise bei Pavianen zu finden sind oder offene Gesellschaften wie Brutkolonien von Vögeln. Darüber hinaus gibt es noch eine temporäre Gruppenbildung bei ursprünglich solitär lebenden Spezies zur Fortpflanzung, sogenannte Geschlechtergemeinschaften. (Wuketits 2002: 19) Für diese ist ein Minimum an sozialem Verhalten allerdings unumgänglich. Wie schon erwähnt, liegen die Vorteile eines Lebens im Gruppenverband im Schutz vor Feinden, dazu kommen eine effektivere Nahrungssuche und die Option der gemeinsamen Verteidigung von Brut- oder Weidegebieten. Da bei gemeinsamer Verteidigung von Arealen für jedes einzelne Individuum einer Gruppe geringere Kosten entstehen und trotzdem ein hoher Nutzen erzielt wird, zahlt sich das gemeinschaftliche Leben aus. (Wuketits 2002: 18f.) Das Bemühen, sich solitär Areale zu sichern, wird selektiv unterdrückt. Ein weiterer positiver Faktor ist das soziale Lernen. Die Jungtiere können sich durch „Abschauen“ von den Älteren im Verband Wissen aneignen.4 Bei größeren, wehrhaften Tieren, wie beispielsweise Eisbären, findet eher selten eine Gruppenbildung statt. Der Feinddruck ist hier geringer. Außerdem gibt es auch Ausnahmen, wie Wolfsrudel. (Wuketits 2002: 22)
Natürlich ergeben sich beim Zusammenleben von Artgenossen auch diverse Nachteile. Dazu zählen unter anderem ein erhöhtes Krankheitsrisiko, Brutparasitismus oder Degenerationserscheinungen und vor allem gesteigerte Konkurrenz um Nahrung, Raum und Geschlechtspartner. (Wuketits 2002: 25, Weber 2003: 52f.) Ein weiterer Faktor ist sozialer Stress. Er tritt auf, wenn zu viele Artgenossen gezwungen sind, auf engem Raum miteinander zu leben. Dies kann zu Panikreaktionen führen oder auch zu dem bei den Lemmingen bekannten Phänomen des Massensterbens aufgrund von Massenansammlungen an natürlichen Hindernissen. (ebd.) Aber auch wenn das Gruppenleben viele Nachteile mit sich bringt, zeigt sich insgesamt eine positive Gesamtbilanz. Wäre dies nicht der Fall, hätte sich das Gruppenleben bei der natürlichen Auslese auch nicht durchsetzen können. (Wuketits 2002: 26) Gruppen sind demnach evolutionsstabile Einheiten, welche exakt an spezifische Lebensbedingungen angepasst sind. Wuketits hält fest, dass „jede Form sozialen Verhaltens […] das von der Selektion erzwungene Resultat komplexer Wechselwirkungen zwischen anatomischen Strukturen, physiologischer Leistungsfähigkeit und ökologischen Faktoren […]“ (Wuketits 2002: 27) ist.
Das soziale Verhalten von Mensch und Tier ist bestimmt vom Fortpflanzungsinteresse, jedoch gibt es hierzu verschiedene Arten von Fortpflanzungsstrategien. Zwei unterschiedliche Strategien können verfolgt werden, um das eigene genetische Überleben zu sichern. Eine Strategie ist die Produktion möglichst vieler Nachkommen. (Wuketits 2002: 34f.) Dabei wird in jeden einzelnen sehr wenig oder nichts investiert. Aufgrund einer statistischen Wahrscheinlichkeit schaffen es wenige Nachkommen bis ins fortpflanzungsfähige Alter. Die Auster verfolgt diese Strategie; sie produziert jährlich bis zu 500 Millionen Eier. Dabei ist es nicht möglich, sich um ein einzelnes Ei individuell zu kümmern. Sie verfolgt damit die sogenannte r-Strategie5. (Dawkins 1978: 181f., Wuketits 2002: 34) Auf der anderen Seite gibt es eine sehr gegensätzliche Taktik, die sogenannte k- Strategie6. Diese Vorgehensweise umfasst die Zeugung von nur sehr wenigen Nachkommen, die aber bestmöglich betreut werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle der wenigen, aber gut betreuten Nachkommen das zeugungsfähige Alter erreichen ist sehr hoch. (Wuketits 2002: 34f.) Ein Beispiel dafür sind Elefanten. Eine Elefantenkuh gebiert nur alle vier Jahre Nachwuchs und die Tragezeit beläuft sich auf durchschnittliche 22 Monate. Die Jungen werden bis ins zeugungsfähige Alter versorgt und betreut.
Organismen gleich welcher Art können sich theoretisch unbegrenzt fortpflanzen, limitierende Faktoren sind allerdings die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen. Da Individuen der gleichen Art auf gleiche Ressourcen angewiesen sind, entsteht unter ihnen ein Kampf. Hier greift der von Darwin geprägte Begriff „survival of the fittest“. Gemeint ist damit, dass die Individuen eine möglichst optimale Eignung besitzen müssen, um genetisch zu überleben. (Wuketits 2002: 16) Mit anderen Worten: Sie müssen über Strategien verfügen, um ihre Artgenossen zu übertreffen. Eine der wichtigsten Ressourcen zeigt sich in der Geschlechtspartnerverteilung. Männchen buhlen um die Gunst von Weibchen der gleichen Art. Meist sind die Weibchen in einer Population derart begrenzt, dass nicht für jedes Männchen ein Geschlechtspartner zur Verfügung steht. Auch gibt es polygam lebende Arten, bei denen manche Männchen mehrere Geschlechtspartner um sich scharen und andere zurückstehen müssen. Darüberhinaus existiert auch zwischen den Geschlechtern ein Konflikt, da die Fortpflanzungsinteressen von Männchen und Weibchen nicht identisch sind.
1.3.1 Der Kampf der Geschlechter
Männchen und Weibchen haben unterschiedliche Fortpflanzungsinteressen, da beide Geschlechter in der Regel nicht gleich viel in ihre Nachkommen investieren. (Weber 2003: 26)
Männchen können im Laufe ihres Lebens viel mehr Nachkommen zeugen als Weibchen, denn diese können während der Tragzeit keine weiteren Nachkommen hervorbringen. Bei den meisten Arten neigen die Männchen zur Polygynie, sie können ihre Gene potentiell ohne Pause weitergeben; was nachteilig für die Weibchen ist. (Wuketits 2002: 39) Diese können die Männchen nicht in die Jungenfürsorge mit einbinden, daher sind Weibchen vielfach bemüht, das Männchen länger an sich zu binden. Nur in seltenen Fällen findet man Spezies mit polyandrischen Systemen, in denen dann die Männchen die Brutpflege übernehmen und mehrere Männchen auf ein Weibchen kommen, wie beispielsweise bei dem afrikanischen Grillkuckuck. (Goymann 2004: 513)
Trotz dieses scheinbaren Vorteils der Männchen tragen diese andere Bürden. Beim Konzept der sexuellen Auslese ist den Weibchen die Partnerwahl vorbehalten. (Weber 2003: 26) Die Männchen müssen um die Weibchen kämpfen, körperliche Vorzüge demonstrieren oder auch Lauben (Laubenvogel) bauen. (Wuketits 2002: 37) Dieser Wettbewerb hat dazu geführt, dass sich in vielen Spezies die Männchen äußerlich sehr deutlich von den Weibchen unterscheiden. Die Männchen haben sogenannte Imponierorgane entwickelt, ein Beispiel dafür ist das Pfauenrad. (Wuketits 2002: 39, Weber 2003: 28)
Abgesehen von den Konflikten, die sich zwischen den unterschiedlichen Geschlechtern ergeben, gehören zu den innerartlichen Konflikten auch die Konflikte im Familienverband. 13
1.3.2 Konflikte im Familienverband
Eltern, egal welcher Spezies zugehörig, müssen sich entscheiden, wie viel Zeit und Energie sie in ihren Nachwuchs investieren und in wieweit sie selbst für ihren Nachwuchs Risiken eingehen sollten. Besonders wenn schon Nachwuchs vorhanden ist, wird der letzte Punkt umso wichtiger. In dieser Situation bleibt abzuwägen, ob es besser ist, Zeit und Energie in die Aufzucht des Nachwuchses zu investieren, oder sich lieber auf neue Fortpflanzungsaktivitäten zu konzentrieren. Für die Eltern gibt es allerdings schon vorprogrammierte Strategien, abhängig von der Beschaffenheit der eigenen Spezies.7 Elterninvestment bezeichnet „die Gesamtheit der Maßnahmen […], die Lebewesen jeweils ergreifen um Nachkommen zu zeugen und deren eigene reproduktive Eignung zu gewährleisten.“ (Wuketits 2002: 42) Zu diesen Maßnahmen gehören auch die Brutpflege und die Brutfürsorge. Mit Brutpflege sind hier sämtliche Verhaltensweisen gemeint, die Lebewesen bei der Aufzucht ihrer Jungen an den Tag legen. Brutfürsorge hingegen meint alle Verhaltensweisen, die dem Nachwuchs schon vor der Geburt günstige Umstände bieten, wie beispielsweise Nestbau. (Wuketits 2002: 42) Wie bereits erwähnt, kommt beides nicht zwingend bei allen Spezies vor. Je länger die Lebensspanne einer Art ist, desto ausgeprägter ist das Elterninvestment. Die Brutpflege ist eine Möglichkeit, die unmittelbare Umwelt so zu kontrollieren, dass die eigenen Gene im Nachwuchs möglichst lange weiterleben. Da ebendies das höchste Ziel aller Organismen ist, erhöhen natürlich Feinde oder eine hohe Konkurrenz den Selektionsdruck auf die Entstehung von Strategien, die das Überleben der Jungen sichern. (Wuketits 2002: 43)
Mit dem Erreichen des zeugungsfähigen Alters endet jedoch das Elterninvestment. (Wuketits 2002: 42ff.) Dadurch entsteht ein Interessenkonflikt zwischen Eltern und Nachwuchs. Solange die Eltern sich ebenfalls noch in zeugungsfähigem Alter befinden, sind sie bemüht, in weitere Nachkommen zu investieren. Das Ziel der schon vorhandenen Nachkommen ist allerdings, ihre eigenen Kosten so lange wie möglich niedrig zu halten und von der Brutpflege ihrer Eltern zu profitieren.8 (Wuketits 2002: 44)
Ein weiterer Konflikt im Familienverband zeigt sich zwischen den Generationen. Bei Spezies mit höherer Wurfrate und einer schnellen Generationsfolge kann es zu Konflikten unter den Geschwistern kommen. Jedes Junge „erwartet“ optimale Betreuung von den Eltern bzw. der Mutter „erwartet“. Da dies nicht möglich ist, kommt es zu Rivalitäten unter den Geschwistern, die im Extrem im Siblizid enden. Rücksicht auf Geschwister ist nicht im genetischen Programm vorgesehen (Wuketits 2002: 46f.), was ganz im Gegensatz zu den Ansichten Konrad Lorenz‘ bezüglich der Arterhaltung und des Artwohls steht. Trotz dieser Diagnose ist immer wieder festzustellen, dass Eltern und Kinder sowie Geschwister in beachtlichem Maße miteinander kooperieren, denn Kooperation zahlt sich für das Individuum aus. Mit Kooperation ist gemeint, dass mindestens zwei Individuen ihr Verhalten aufeinander abstimmen. (Wuketits 2002: 48) Ist das Ziel die Kooperation zwischen Individuen soziobiologisch zu erklären, so muss zunächst beim Konzept der Gesamteignung oder inklusiven Fitness begonnen werden. Gesamteignung bedeutet „die reproduktive Eignung des Individuums, die sich aus dem persönlichen und dem Fortpflanzungserfolg seiner Verwandten ergibt.“ (ebd.) Daraus ist zu schließen, dass Familienangehörige nicht miteinander kooperieren um die Art zu erhalten, sondern nur um die eigenen Gene, die sich zu einem Teil auch in den Verwandten befinden, zu erhalten. Tiere besitzen kein „Bewusstsein“ über den Nutzen der Kooperation oder einer anderen Verhaltensweise. (Wuketits 2002: 52) Dies ist auch nicht notwendig, um miteinander kooperieren zu können.
1.3.3 Egoismus, Altruismus oder Egoistischer Altruismus?
"Man traue keinem erhabenen Motiv für eine Handlung, wenn sich auch ein niedriges finden lässt" (Edward Gibbon, zitiert nach Storch et al. 2007: 503)
Kooperatives Verhalten ist egoistisch motiviert, auch wenn dies meist nicht offensichtlich ist. Doch zunächst bleibt zu klären, was genau Altruismus bedeutet. Altruismus meint „uneigennütziges Verhalten, das die reproduktive Eignung des Handlungsurhebers zugunsten des Handlungsempfängers mindert.“ (Wuketits 2002: 54) Es gibt allerdings keinen wahren Altruismus; es existieren immer auch versteckte egoistische Motive, die einen Menschen dazu bringen Handlungen auszuüben, die oberflächlich altruistisch wirken. (Wuketits 2002: 54f.) Das oben erwähnte Zitat lässt sich mit einer bewährten Faustregel unterstreichen: „Kein Lebewesen investiert in andere, ohne irgendeine, wenn auch oft nur indirekte, Belohnung dafür zu erhalten.“ (ebd.) Üblicherweise stehen Altruismus und Egoismus einander konträr entgegen. Mit „egoistisch“ wird ein Verhalten beschrieben, das allgemein eigennützig ist und die Eignung des Handlungsurhebers auf Kosten des Handlungsnehmers erhöht. (Wuketits 2002: 55)
Bei der näheren Beschäftigung mit den Gründen für altruistisches und egoistisches Verhalten, liegt das Terrain der Spieltheorie nahe. Hierzu findet sich beispielsweise als wahrscheinlich bekanntestes Spiel das Gefangenendilemma von Merrill Flood und Melvin Dresher.9 Bei diesem Spiel ist die Versuchung, den anderen zu verraten groß, aber wenn beide sich gegenseitig verraten, wird dadurch die Lage von beiden schlechter. Da aber jedes Individuum nach der „Logik des Egoismus“ handelt, werden sie sich gegenseitig verraten.10 (Wuketits 2002: 57)
Dieses Beispiel handelt von einer einmaligen Situation. Es gibt aber im Alltag Spiele, die sich ständig wiederholen; hier greift die Reziprozität. Reziprozität meint „eine Form der kooperativen Wechselwirkung zwischen zwei oder mehreren Partnern, bei der einige Individuen mit zeitlicher Verzögerung die Vorteile der Kooperation genießen können“. (Weber 2003: 126) Je länger eine gegenseitige Beziehung andauert und je vertrauter sie ist, desto effektiver wird sie. Ein einfaches Beispiel für Reziprozität wäre die Tit For Tat-Strategie von Axelrod.11 Ein Beispiel für eine Tit For Tat-Strategie zeigt sich in den Warnrufen der Murmeltiere. (Wuketits 2002: 60f.) Dieser Strategie geht eine einfache Kosten-Nutzen- Kalkulation12 voraus. Warnt ein Individuum die anderen Gruppenmitglieder nicht, so lenken sie möglicherweise die Aufmerksamkeit des Feindes auf die Gruppe, einschließlich des Individuums, das den Feind zuerst erblickt hat. Das Warnen allerdings lenkt die Aufmerksamkeit des Feindes durch das Geräusch auf das warnende Individuum, was oberflächlich altruistischem Verhalten ähnelt. Das Individuum bringt sich selbst in Gefahr, um seine Gruppengenossen zu warnen. Würde dieses Individuum alleine flüchten, nimmt es durch seinen Alleingang ein größeres Risiko auf sich, da es vielleicht trotzdem - und dann alleine - den Weg des Feindes kreuzt. Das Warnen der anderen hilft also auch dem Individuum selbst. Es handelt sich in diesem Fall also nicht um wahren Altruismus, sondern um eine Form des Ego-Altruismus. (Wuketits 2002: 62) Es wird deutlich, dass Egoismus und Altruismus nicht gegensätzlich sind und sich gegenseitig ausschließen. Eigeninteressen können als Indikator für altruistisches Verhalten fungieren. Beim Menschen tritt reziproker Altruismus beispielsweise bei der Nahrungsteilung auf, in Krisenzeiten oder ganz einfach in Situationen, in denen Menschen einander Werkzeug leihen.
Es ist augenscheinlich, dass Altruismus nicht gleich Altruismus ist und die innere Bereitschaft zu altruistischen Handlungen, gleich welcher Art, nicht gegenüber jedem Individuum gleich ist; sie ist abhängig von der Vertrautheit des jeweiligen Individuums. Der nepotische Altruismus, Vertrautheitseffekt oder Nepotismus ist ein ganz zentraler Umstand für das Kleingruppenwesen Mensch. (Wuketits 2002: 63ff., Weber 2003: 54ff.) Wie schon besprochen, ist die Wahrscheinlichkeit für reziproken Altruismus umso höher, je besser sich die Individuen kennen oder je enger sie miteinander verwandt sind. Dies ist in Familienverbänden ganz besonders gegeben. So entsteht die Verwandtschaftsselektion. Das Maß für die Verwandtschaftsselektion ist der Verwandtschaftskoeffizient. (Weber 2003: 55, Wuketits 2002: 64)
Allerdings gibt es auch Familienverbände, die lockerere Bande haben. Verwandte kennen sich vielleicht nicht so gut, weil sie in unterschiedlichen Städten wohnen. Sie haben aber möglicherweise gute Freunde, mit denen sie sehr viel Zeit verbringen. In solchen Fällen kann der Vertrautheitseffekt den Verwanschaftskoeffizienten auch relativieren. (Wuketits 2002: 65) In diesem Fall wäre ein Individuum eher dazu bereit, sich altruistisch gegenüber seinem guten Freund zu verhalten, als gegenüber seinem entfernt lebenden Verwandten.
Darüberhinaus ist zu beachten, dass alle Lebewesen mit ihren Blutsverwandten die eigenen Gene teilen. (Barash 1977: 80ff., Wuketits 2002: 48f.) Hier greift wieder die Regel der inklusiven Fitness, wenn eine Person A schlechte Reproduktionschancen hat (evtl. aufgrund fehlender Ressourcen), könnte es sich für sie auszahlen, der Schwester bei der Aufzucht ihrer Kinder zu helfen. Anteilig besitzen die Kinder auch ihre Gene. Damit nepotischer Altruismus funktionieren kann, muss es allerdings auch einen Mechanismus zur Verwandtenerkennung geben. Es gibt einige Spezies, bei denen das nicht möglich ist. Der Mensch hingegen durchläuft während der Adoleszenz unterschiedliche Prägungsprozesse, die dazu führen, dass enge Vertraute, mit denen man zusammen aufwächst, auf „Planstellen für Verwandte“ gesetzt werden. Ein Indiz dafür ist, dass solche Personen quasi „automatisch“ sexuell gemieden werden, es entwickelt sich also eine Art von Inzestscheu, die Koresidenz als Indikator für Verwandtschaft erfasst.13 (Vonwinkel 1997: 35, Wuketits 2002: 97)
1.4 Erbe und Umwelt: Ist der Mensch ein Sklave seiner Gene?
„Bei nüchterner Betrachtung gibt die Soziobiologie keinen Anlass zum Glauben (oder der Befürchtung), dass der Mensch […] eine Marionette seiner Gene [sei].“ (Wuketits 2002: 13)
“Nicht wir sind die allmächtigen Regisseure des Lebens und zugleich seine Hauptdarsteller, auch wenn unsere Egozentrik dies suggeriert, sondern es sind die genetischen Programme, die die Regieanweisungen geben. […] Diese narzisstische Kränkung, die in der Degradierung vom Helden der Geschichte zum instrumentalisierten Büttel der Gene liegt, müssen wir allerdings verkraften, wenn wir menschliches Verhalten wirklich verstehen wollen.” (Voland 1997:61)
Im Laufe der Zeit stellte sich in der Forschung immer wieder eine Frage: Werden Lebewesen durch ihre Erbanlagen oder durch ihre Umwelt bestimmt? Zur Beantwortung dieser Frage gab es heftige Diskussionen. Aber mittlerweile überwiegt die Einsicht, dass Lebewesen mit angeborenen Anlagen zur Welt kommen, aber auch ständig mit einer ganz spezifischen Umwelt konfrontiert werden. Die Erbanlagen selbst sind ja das Ergebnis einer ständigen Konfrontation mit der Umwelt. Umgekehrt geben sie eine Reaktionsnorm für das Verhalten des Lebewesens vor. Der Mensch und auch alle anderen Lebewesen kommen also nicht als Tabula Rasa auf die Welt - wie früher angenommen - sondern er trägt die Spuren seiner Vergangenheit, das so genannte Primatenerbe. (Buss 2007: 45) Darüberhinaus kommt jedes Lebewesen mit der spezifischen Ausstattung seiner direkten Vorfahren zur Welt oder ist wenigstens davon beeinflusst. (Buss 2007: 38) Daher kann Erziehung nie unabhängig von den gegentischen Anlagen angesetzt werden. Trotzdem darf nicht angenommen werden, dass Gene das Verhalten invariant programmieren. Denn die Gene programmieren Entwicklungsvorgänge, welche sich im Wechsel zwischen Erbinformation und Umwelt vollziehen. Dabei definieren die Gene lediglich die Reaktion auf die Umwelt, so Voland. (Voland 1997: 57)
Darwin führte Verhaltensweisen wie Freude, Zorn etc. auf die Evolution zurück und ging davon aus, dass die Wurzeln dieser Verhaltensweisen in die Stammesgeschichte zurück verfolgt werden können. Verhaltensweisen haben sich sowohl bei Tieren als auch bei Menschen in der Evolution allmählich entwickelt und können beschrieben und erklärt werden. Laut Wuketits sind Verhaltensweisen „in der Evolution durch natürliche Auslese entstanden (und werden von dieser gefördert, wenn sie ihren Trägern Vorteile bringen)“. (Wuketits 2002: 15) Darüber hinaus kann man Verhaltensweisen als Anpassungsleistungen der jeweiligen Lebewesen an die Lebensbedingungen definieren. (ebd.) Tiere folgen beispielsweise in ihrem Fluchtverhalten einer tausendfach bewährten Verhaltensstrategie, welche in der Evolution als vorteilhaft heraus selektiert wurde, da sie dem Überleben dienlich ist. Sämtliche Formen des Sozialverhaltens (Brutpflege, Kooperation oder Nahrungsteilung in der Gruppe) können nur evolutionstheoretisch ausreichend erklärt werden. (Wuketits 2002: 17)
Man darf sich nicht vorstellen, dass Lebewesen sklavisch einem Programm folgen, jedoch ist jedes Lebewesen mit einem genetischen Programm ausgestattet, welches zumindest grundlegend einen roten Faden im Verhalten vorgibt. (Barash 1977: 284ff.) Das bedeutet, dass ein Lebewesen in einer bestimmten Situation instinktiv ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen wird, was allerdings an die jeweilige Situation angepasst ist. „Nicht jedes einzelne Verhaltensmerkmal ist also genetisch bestimmt, es ist aber jedes genetisch angelegt.“ (Wuketits 2002 : 75) Wuketits gibt dazu ein sehr anschauliches Beispiel: Wird ein Iltis in Isolation aufgezogen und ihm dann eine Ratte vorgesetzt, beginnt er sie zu jagen. Bei der Tötung der Ratte ist er allerdings sehr ungeschickt. Unter normalen Bedingungen lernen Jungtiere von ihrer Mutter, dass sie eine Ratte effektiv und schnell mit einem Nackenbiss töten können. Aufgrund seiner genetischen Anlagen hat der Iltis die Ratte demnach als Beutetier wahrgenommen, er hat aber keine effektive Tötungsstrategie erlernt. (Wuketits 2002: 75) Lernen durch Imitation ist gerade bei höher entwickelten Lebewesen grundlegend. Diese können via Imitation nicht nur lernen sondern auch Wissen weitergeben. Die besten Voraussetzungen dafür trägt der Mensch, denn er verfügt über Symbolismus, d. h. er kann seine eigenen Erfahrungen in Form von Symbolen, wie beispielsweise der Schrift, weitergeben. (Wuketits 2002: 79)
Je komplexer das Nervensystem einer Art ist, desto mehr ist Variation der angeborenen Verhaltensanlagen möglich. Also existiert hier laut Wuketits kein genetischer Determinismus. (Wuketits 2002: 72ff.) Es gibt eine Vielzahl äußerer Faktoren, die Einfluss auf das Grundprogramm des Verhaltens haben. Jedoch ist der Einfluss der Gene nicht zu unterschätzen, da jedes Verhaltensmuster im Grunde dem einen Ziel folgt die eigenen Gene weiterzugeben. Für jedes Verhaltensmerkmal ist ein ganzer Genkomplex verantwortlich und ein Gen kann auch an der Bildung mehrerer Merkmale beteiligt sein.
1.5 Exkurs: Moral in der Soziobiologie - Die Tendenz zur Doppelmoral
Jeder Mensch hat von klein auf die Unterschiede von „moralisch“ und „unmoralisch“ erlernt und weiß, „was sich gehört“ und „was sich nicht gehört“. Moral ist eine Folge unserer Stammesgeschichte. Wird Moral funktional definiert, so ist sie „[…] die Summe aller Regeln und Normen, die die Stabilität einer bestimmten Gruppe mit einiger Wahrscheinlichkeit garantiert.“ (Wuketits 2002: 98) Nachbarschaftshilfe beispielsweise gilt im Allgemeinen als moralische Regel. Diese folgt dem Gebot, dass von den Mitgliedern einer Gruppe kooperatives Verhalten verlangt. Die menschliche Moral ist eine Kleingruppenmoral. Unter den Bedingungen der Zivilisation erweist sich Moral aber häufig als Doppelmoral. Menschen tendieren ganz automatisch dazu, Taten und Handlungen mit ungleichen Maßstäben zu beurteilen. Das Gebot „Du sollst nicht töten“ ist nach Wuketits kein allgemeines Tötungsverbot, es ist letztendlich nur das Verbot, ein Mitglied der eigenen Sozietät zu töten. (Wuketits 2000: 116f., Wuketits 2002: 99)
Die Überhöhung der eigenen Gruppe und die gleichzeitige Diskriminierung anderer Gruppen sind in allen Kulturen anzutreffen. (Wuketits 2002: 100) Interaktionen zwischen vorindustriellen Stämmen sind meist ausbeuterisch. (Barash 1977: 317) Diese Universalität lässt auf eine biologische Basis schließen. (Wuketits 2002: 100) Der Mensch ist von Natur aus ein Kleingruppenwesen und verfolgt so auch eine Kleingruppenmoral. Er daher Schwierigkeiten mit den abstrakten Regulationsmechanismen von Großgesellschaften, in denen er mittlerweile größtenteils lebt. Die kurze Zeitspanne seit Gründung der Hochkulturen hat nicht ausgereicht, um diesen Konflikt beizulegen. (Barash 1977: 319) Der Mensch möchte in seinem Heim Friede haben, möchte aber andere beherrschen und verfolgt Raubzüge, um sich und seine Angehörigen zu bereichern. Daher sind zwei unterschiedliche Arten von Moralkodizes nötig. Ein individueller oder privater Kodex und ein kollektiver oder öffentlicher. Diese beiden stehen einander diametral gegenüber. Mord im ersten Moralkodex stellt sich als Verbrechen dar und Mord im zweiten bedeutet Ruhm und Reichtum. (Wuketits 2000: 220) Während die Verhaltensbiologie hier eine Art Binnenmoral der jeweiligen Sozietäten postuliert, unterstellt die Soziobiologie im Gegensatz dazu eine „[…] Moral des graduell abnehmenden Nepotismus“. (Brumlik 1997: 24)
Wie aber lässt sich unsere Moralvorstellung mit den Feststellungen über den egoistischen Fortpflanzungsdrang und das Weitergeben der eigenen - und nur der eigenen - Gene vereinbaren? Menschen, die unter Einsatz des eigenen Lebens anderen Menschen das Leben retten, werden als ehrenvoll empfunden und als Helden bezeichnet. Aber eigentlich sollte so eine Handlung dem menschlichen genetischen Programm zuwider laufen, da der Held seine eigenen Gene für die eines anderen opfert. Dieses Programm benötigt aber durchaus andere Lebewesen, da sie zur Erreichung der Ziele nötig sind (beispielweise Fortpflanzung). Der moralische Anspruch, mit anderen Artgenossen zu kooperieren und ihnen zu helfen, kann daher trotzdem als „natürlich“ bezeichnet werden. Dieser Anspruch bezieht sich allerdings oft nur auf die Klein- bzw. Sympathiegruppen. (Wuketits 2000: 99)
Doch genauso wie Menschen kooperieren und unter Umständen sogar ihr eigenes Leben für andere riskieren können, ist es ihnen auch möglich grausam zu agieren.
[...]
1 Laut Auskunft des Bundeskriminalamtes Wiesbaden, erhalten durch Emailkontakt ist eine genauere Spezifizierung bislang nicht möglich. Die diesjährige Umstellung der Erfassungssysteme lässt aber auf eine detailliertere Erfassung in der Zukunft hoffen. Mordmotive werden allerdings auch weiterhin nicht erfasst.
2 Darunter 407 Versuche.
3 Eibl-Eibesfeldt bestätigt zwar die Sichtung von Infantiziden, seiner Meinung nach liege der Grund dafür aber in Pathologien und verweist auf das oft aggressive Verhalten von Pavianen und Schimpansen. (Eibl-Eibesfeldt 1997: 140ff.)
4 Das lässt sich bei allen Säugetieren feststellen, ist aber besonders bei Primaten zu beobachten, da sie über ein komplexes Gehirn und eine dementsprechende Lernfähigkeit verfügen.
5 r = Wachstumsrate einer Population, Gesamtheit miteinander kreuzbarer Individuen in einem bestimmten geographischen Raum
6 k = Tragekapazität eines Lebensraumes
7 siehe S. 11, Absatz 2 in dieser Arbeit
8 Natürlich können auch Mischformen wie bei der Hausmaus vorkommen. Sie betreibt Brutpflege, dies aber nur sehr begrenzt. (Wuketits 2002: 44)
9 Zur Vertiefung der Spieltheorie siehe Robert Axelrod: Die Evolution der Kooperation 1988.
10 Genauergesagt handelt es sich beim gegenseitigen Verrat in diesem Fall um ein Nash-Equilibrium, d.h. es ist für den Einzelnen in jedem Fall besser den Anderen zu verraten. Dieses Nash-Equilibrium ist allerdings nicht paretoeffizient, denn es wäre besser für beide Beteiligten zu kooperieren.
11 Siehe dazu ausführlich Axelrood 1988
12 Ein bewusstes Wissen um Reziprozität ist keine Voraussetzung für reziprok- altruistisches Verhalten. Bei Tieren findet keine bewusste Kosten-Nutzen-Kalkulation statt. (Wuketits 2002: 60)
13 Trotzdem gibt es Umstände, unter welchen sich diese Inzestscheu nicht entwickelt, wie der Fall BVerfG, 2 BvR 392/07 vom 26.2.2008, zeigt. In diesem Fall zeugten die Geschwister Patrick S. und Susan K. vier Kinder miteinander. (http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20080226_2bvr039207.html)
- Arbeit zitieren
- Jessica Rudi (Autor:in), 2009, Kriminalität im Blickwinkel der Soziobiologie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139520
Kostenlos Autor werden

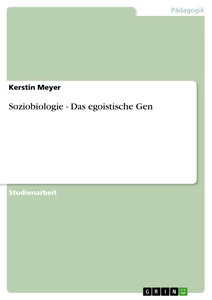








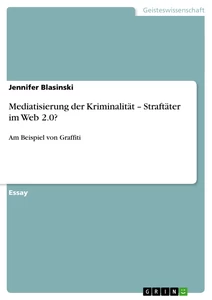







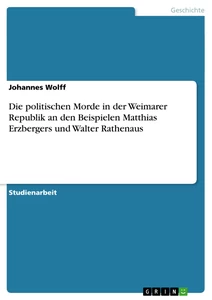



Kommentare