Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung:
2 Zur Geschichte und Definition des Problemfeldes Analphabetismus
2.1 Analphabetismus als Problem vorindustrieller Gesellschaften und "funktionaler Analphabetismus" in der Industriegesellschaft
2.2 Zu den Ursachen des Analphabetismus in der Bundesrepublik Deutschland heute
2.3 Funktionaler Analphabetismus
2.4 Die Lebenssituation funktionaler Analphabeten
2.5 Analphabeten im Strafvollzug
3. Abriß aktueller theoretischer Beiträge zur Frage des Schriftspracherwerbs
3.1 Aktuelle Theorien zur Frage des Schriftspracherwerbs bei Kindern
3.2 Vergleich des Schriftspracherwerbs bei Kindern und Erwachsenen
4. Methodisch-didaktische Ansätze für die Alphabetisierung Erwachsener
4.1 Das Alphabetisierungskonzept Paolo Freires: Lernen von der "Dritten Welf
4.1.1 Überblick über Freires Ansatz der politischen Alphabetisierung
4.1.2 Schreiben und Lernen als Bewußtseinsbildung
4.1.3 Linguistische und sprachphilosophische Anteile an Freires Konzept
4.1.4 Lernen im Dialog
4.1.5 Zur Frage der Adaptierbarkeit für die Alphabetisierung in der BRD
4.2 Methodisch-didaktische Ansätze der Alphabetisierung in der Bundesrepublik Deutschland
4.2.1 Die Lautiermethode nach Dummer und Hackethal
4.2.2 Die Morphemmethode - ein sprachsystematischer Ansatz
4.2.3 Alphabetisierung vor dem Hintergrund der Aneignungstheorie: der Fähigkeitenansatz Kampers und die Arbeit von C.Manske
4.2.4 Der Spracherfahrungsansatz
4.3 Zusammenfassende Wertung der methodisch - didaktischen Ansätze der Alphabetisierung
4.4 Beiträge zur Alphabetisierung im Strafvollzug der BRD
5. Leben und Lernen in der "totalen Institution" Gefängnis - das Ringen um Erhaltung von Identität
5.1 Bestimmung des Begriffes "Identität"
5.2 Zur Konzeption des Begriffes "Identität" als Produkt symbolischer Interaktion bei G.H. Mead
5.3 Goffmans Konzept der Identitätserhaltung durch Balance
5.4 Zur Bestimmung des Begriffes "totale Institution" bei Goffman
5.5 Die "totale Institution" aus der Perspektive der Insassen
5.5.1 Demütigungsprozesse
5.5.2 Das Privilegiensystem 5.5-3 Sekundäre Anpassung
5.5.3.1 Medien sekundärer Anpassung
5.5.3-2 Orte sekundärer Anpassung
5.5.3·3 Sozialstruktur sekundärer Anpassungsmechanismen
5.6 Die "totale Institution" aus der Perspektive der Bediensteten
5.7 Zusammenfassung und kritische Anmerkungen
5.8 Folgerungen, die aus Goffmans Untersuchung "totaler Institutionen" für die Alphabetisierung im Strafvollzug zu ziehen sind
6 Zum Selbstverständnis und zum Menschenbild des Pädagogen im Spannungsverhältnis von Therapie (Behandlungsvollzug) vs. Pädagogik (Bildungsarbeit)
7. Lernen im Strafvollzug und emanzipatorische Erwachsenenbildung?
8. Schriftspracherwerb in der "totalen Institution" als schriftsprachliches Handeln auf dem Weg zur Ich - Identität
8.1 Reorganisation von Ich - Identität und schriftsprachliche Kompetenz
8.2 Zur chronologischen Organisation des Bildungsprozesses
8.2.1 Thematische Erkundung und ikonische Kodierung (Freire)
8.2.2 Dekodierung und "wirklichkeitstransformierendes Gespräch" (Schmitz)
8.2.3 Textproduktion mit Hilfe des Spracherfahrungsansatzes
8.2.4 Repräsentation
8.2.5 Differenzierte Wiedereinführung und Übungen zum System unserer Schrift
8.3 Methodische Voraussetzungen
8.3.1 Die Gruppe als Trägerin des Bildungsprozesses
8.3.2 Lernraum als persönlicher "Freiraum"
8.3.3 Lesen durch Schreiben: Entdeckender Schriftspracherwerb im Stufenmodell und qualitative Fehleranalyse auch für Erwachsene
8.3.4 Das Lernen neu erlernen - der Kursleiter als Berater
8.4 Die thematisc\ \he Arbeit als Fundament des
Schriftspracherwerbs
8.4.1 Die Hauptthemen der Insassen (Goffman) - eine passiv - resignative Thematik
8.4.2 Die Themen der legalen Alltagsbewältigung
8.4.3 Die eigene Person - Biographie und Lerngeschichte als thematische Kategorie
8.4.4 Die Themen der besseren Zukunft
8.4.5 Die Tabuthemen der illegalen sekundären Anpassung - Erfahrung von Aktion im kleinen Widerstand und darüber hinaus
9. Zusammenfassung und Ausblick
10. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Mit der vorliegenden Arbeit soll der Versuch unternommen werden, eine für den Praktiker in der Strafvollzugspädagogik umsetzbare Konzeption des Schriftspracherwerbs im Vollzug zu erstellen. Zu Beginn meiner vierjährigen Tätigkeit als Kursleiter in Vollzeitalphabetisierungskursen im Strafvollzug wurde mir klar, daß derartige Bildungsangebote in Strafanstalten oft noch recht theorielos und nicht selten ohne Kontakt zu und Orientierung an der Arbeit von Alphabetisierungskursen der Volkshochschulen durchgeführt werden. Einen Extremfall stellt sicher die von mir beobachtete Alphabetisierungsarbeit mit Hilfe von Schulfibeln für Grundschüler dar, durch die erwachsenen Strafgefangenen in einer Vollzugsanstalt in SchleswigHolstein der Schriftspracherwerb ermöglicht werden sollte. In der Stadt, in der sich die betreffende Anstalt befindet, fanden zu gleicher Zeit an der Volkshochschule Kurse für "Lesen und Schreiben von Anfang an" statt, die von speziell geschulten Mitarbeiterinnen mit Hilfe eines erwachsenengerechten und theoretisch schon recht fundierten Konzeptes der Alphabetisierung durchgeführt wurden. Waren die hohen Mauern der Strafanstalt die Ursache für diese qualitative Differenz? Sicher nicht, denn die Anstaltspädagogen sind keine Gefangenen. Auch die Grundqualifikation, das Lehrerexamen, und die unzureichenden Arbeitsbedingungen ähneln denen der VHS-Mitarbeiter, beide arbeiten als Honorarkräfte in der Regel nebenberuflich. Aber im Arbeitsbereich des Deutschen Volkshochschulverbandes begann schon vor ca. 13 Jahren eine intensive Diskussion um das damals neu entdeckte Problem des "funktionalen Analphabetismus". Hier wurden Fachtagungen veranstaltet, Publikationen herausgegeben und Mitarbeiter fortgebildet, die heute mehrere hundert Kurse an bundesdeutschen Volkshochschulen leiten.
Die pädagogische Arbeit in der erwähnten Justizvollzugsanstalt, in der ca. 600 männliche und weibliche Strafgefangene einsitzen, war von dieser Entwicklung unbeeinflußt geblieben. In wievielen Strafanstalten wird es ähnlich sein? Hier wurde und wird Unterricht von Lehrern aus der Regelschule mit Hilfe der Inhalte und Medien der Regelschule erteilt, Lernbedürfnisse der erwachsenen Lerner bleiben unberücksichtigt, Erwachsene werden zu Kindern gemacht. Die Szenen des Versagens in der Schule, die vor allem jüngere Gefangene noch deutlich vor Augen haben, wurden und werden so neu inszeniert.
Dieses Inseldasein von Anstaltsschulen ist besonders erschreckend, wenn man erfährt, daß unsere Strafanstalten geradezu ein Sammelbecken für Analphabeten darstellen. Wehrens schätzt die Zahl der Vollanalphabeten im Erwachsenenvollzug auf 2-3%, die der funktionalen Analphabeten auf 10-15%, im Jugendvollzug gar auf 25-30% der Inhaftierten (vergi. Wehrens 1981, S. 85). Bei ca. 50 000 Strafgefangenen in der Bundesrepublik dürften mithin 6000 bis 8000 funktionale Analphabeten in den Haftanstalten allein der alten Bundesländer einsitzen (vergi. Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe 1/89, S. 42). Auf den Zusammenhang zwischen Straffälligkeit und Analphabetismus wird an anderer Stelle näher eingegangen. Durch eine Umfrage, die sich an alle bundesdeutschen Vollzugsanstalten im alten Bundesgebiet richtete, wurde vom Deutschen Volkshochschulverband ermittelt, daß 1985 an 31 Vollzugsanstalten 50 Alphabetisierungskurse mit insgesamt 265 Teilnehmern stattfanden (vergi. Fuchs-Brühninghoff 1986, S. 52). Neuere Zahlen liegen nicht vor, sie dürften aber wegen des abnehmenden Interesses der öffentlichen Hand an Resozialisierungsmaßnahmen in den letzten Jahren kaum höher liegen. Aus den genannten Zahlen geht hervor, daß nur ca. 4% der Vollanalphabeten und funktionalen Analphabeten in unseren Strafanstalten in Bildungsmaßnahmen gefördert werden. Nicht selten wird die Einrichtung von Kursen mit dem Argument abgelehnt, die betroffenen Gefangenen hätten nicht einmal das nötige Vorwissen, um in absehbarer Zeit in einem Hauptschulkurs einen Schulabschluß zu erwerben. Das Abschlußzertifikat wird hier weniger als hoffnungsvoll stimmender Meilenstein auf dem Weg zur Resozialisierung gesehen, sondern eher als ein Pluspunkt in der Erfolgsstatistik der jeweiligen Anstalt, Alphabetisierungskurse ohne formalen Abschluß und damit ohne "meßbaren" Erfolg wirken nicht als Positivum für die Selbstdarstellung gegenüber Ministerialbeamten. Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang, daß Alphabetisierung von Erwachsenen in deutschen Gefängnissen schon viel länger be trieben wird, als an Volkshochschulen. Bereits im vorigen Jahrhundert waren Anstaltslehrer damit betraut, Gefangene im Lesen und Schreiben zu unterrichten. Man habe, so Wehrens, die Lernenden im Gefängnis als "minderbegabte Analphabeten mit abnormer Persönlichkeitsstruktur" angesehen, der Unterricht sei undifferenziert und infantilisierend gewesen (vergi. Wehrens 1981, S.84). Was den Bereich des elementaren Schriftspracherwerbs angeht, ist man mancherorts offenbar auch heute kaum weiter.
Die ausdrückliche Absicht des Autors in dieser Arbeit, eine Konzeption für den Schriftspracherwerb im Vollzug vorzulegen, die dem Lernvermögen und den Lernbedürfnissen erwachsener Lerner gerecht wird, legt den Vorschlag nahe, ein in der Arbeit der Volkshochschulen bewährtes Modell einfach zu übernehmen. Dies wäre sicher schon ein Schritt in die richtige Richtung, man würde dabei jedoch übersehen, daß das Gefängnis eine andere Welt ist, eine "totale Institution", wie Goffman sie nennt (vergi. Goffman 1967, S. 13 ff). Das Leben in dieser Welt ist geprägt durch Zwangsmaßnahmen und Einschränkungen, die ein extremes Maß an Anpassung erforderlich machen. Motive werden hier nicht einfach offengelegt, Vertrauen gibt es unter den Insassen kaum und zwischen Insassen und Personal schon gar nicht, alles hat einen offenen und einen versteckten Sinn, Kommunikation verläuft mehrdimensional, oft verschlüsselt und ganz anders als "draußen". Auch ein Bildungsangebot, dem sich der Gefangene, sofern es sich um eine Vollzeitmaßnahme han - delt, ganztägig widmen kann, ist Teil der Zwangsanstalt, der Aspekt der Freiwilligkeit fehlt zunächst weitgehend. Doch auch wenn im Verlaufe der Arbeit Vertrauen entsteht, so können andere Mauern die Distanz wieder vergrößern: Ein hochgesteckter emanzipatorischer Anspruch stößt, so er in Handlungen umgesetzt werden soll, schnell an die Grenzen, die der Zwangsapparat setzen muß oder seine Vertreter setzen wollen. So kann ein Brief, den mehr als ein Gefangener unterschreibt, als "Anstiftung zum Aufruhr" bewertet und durch Disziplinarmaßnahmen geahndet werden. Will man in einer didaktischen Konzeption des Schriftspracherwerbs hier den Bezug zum Alltag und zur Lebenswelt herstellen, so muß man diese Lebenswelt erkunden und das methodische Vorgehen ihren besonderen Bedingungen anpassen. Jener Erkundung dienen in dieser Arbeit eigene teilnehmende Beobachtungen und eine ausführliche Würdigung der Berichte, die uns Erving Goffman durch sein Buch "Asyle" zugänglich macht. Er beschreibt das Ringen des Insassen um Erhaltung von Identität in der entpersönlichenden Einrichtung Gefängnis. Anerkennend, daß dieses Ringen ein hintergründiges Hauptmotiv für alle Handlungen des Gefangenen ist, soll es hier zusammengeführt werden mit dem Erwerb der Schriftsprache, der als freies Lesen durch Schreiben eben die Erhaltung von Identität oder deren Neuentdeckung ermöglichen kann. Dabei soll auch die Arbeit des brasilianischen Pädagogen Paolo Freire, des Begründers emanzipato- rischer Alphabetisierung in Lateinamerika, erwähnt und auf mögliche Teiladaptionen hin befragt werden.
Zunächst jedoch muß der mehrdeutige Begriff des Analphabetismus und des "funktionalen Analphabetismus" erläutert werden. Dann wird vom Lesen und Schreiben aus der Sicht linguistischer Theorieansätze die Rede sein und vom Schriftspracherwerb bei Kindern. Schließlich werden fünf Ansätze der Alphabetisierung vorgestellt und auf ihre Übertragbarkeit auf die Arbeit im Strafvollzug hin überprüft, bevor ich mich der Lebenswelt des Strafgefangenen zuwende und die eigene Konzeption zusammenfassend umreiße. Es wird auch zu klären sein, welchen Stellenwert der Schriftspracherwerb im Behandlungskonzept einer Strafanstalt haben sollte und welches pädagogische Selbstverständnis sich damit verbinden kann.
Dabei beziehe ich mein Vorverständnis von Alphabetisierung u.a. auf Paolo Freire. Jürgen Zimmer bemerkt zur Alphabetisierung in der "Dritten Welt", daß deren Kampagnen zu sehr zeitlich begrenzt, zu wenig thematisch den Bedürfnissen der Bevölkerung angepaßt und zu beziehungslos zu den Erfahrungen, Fähigkeiten und Vorkenntnissen der Lerner seien (vergi. ZimmerJ.; in: b:e; 7/73;S.37). Alphabetisierung darf nicht allein lerntheoretisch durchdachte Technikvermittlung sein, wenn sie bessere und bewußtere Lebensbewältigung anstrebt. Freire spricht von "conscientizacao", man könnte diesen Begriff mit "Bewußtseinsbildung" übersetzen. "Von der mythischen Wahrnehmung der Welt kommt der Mensch durch conscientizacao zu einer Distanzhaltung. Indem er aus seiner unbewußten und unreflektierten Verflechtung mit der Welt heraustritt, sie also als Objekt wahrnimmt, ist er auch fähig, sie zu beurteilen und zu kritisieren"( Zimmer 1973, S.26). Freire definiert demgemäß Bildungsarbeit dialogisch: "Echte Bildungsarbeit wird nicht von A fur B oder von A über B vollzogen, sondern vielmehr von A mit B, vermittelt durch die Welt - eine Welt, die beide Seiten beeindruckt und herausfordert und Ansichten oder Meinungen darüber hervorruft. Diese Ansichten, von Ängsten, Zweifeln, Hoffnungen oder Hoffnungslosigkeit durchsetzt, implizieren beachtliche Themen, auf deren Grundlage der Programminhait des Bildungsvorganges aufgebaut werden kann" (Freire 1973, S.76). Drecoll umschreibt das auch bei uns sich entwickelnde erweiterte Verständnis von Aphabetisierung wie folgt: "Es scheint mir deshalb wichtig, die beiden Ebenen einer funktionalen Lese- und Schreibfähigkeit im Sinne eines selbständigen und unbehinderten Bestreitens der eigenen Existenz und sozialer Unauffälligkeit einerseits und Schriftsprachkompetenz als wachsender Möglichkeit der Selbstäußerung und Aneignung des kulturellen Erbes andererseits als zwei voneinander zu unterscheidende Zielbestimmungen im Auge zu behalten, auch wenn sie im praktischen Lernprozeß immer verschmelzen werden" (Drecoll in: Drecoll u. Müller, 1981, S. 33). Diese zweifache Zielsetzung, einerseits Pragmatik oder Schriftsprachverwendung, andererseits Selbstäußerung, Selbstreflektion und Bewußtseinsbildung, soll bei der Beurteilung von Alphabetisierungskonzepten im Auge behalten werden. Zum Selbstverständnis des Pädagogen als Initiator der eben skizzierten Bildungsarbeit gerade in der geschlossenen Anstalt werde ich im sechsten Kapitel Stellung beziehen.
Mein besonderer Dank gilt dem UNESCO-Institut für Pädagogik in Hamburg, das mir durch den Zugang zu seiner umfangreichen Sammlung von Veröffentlichungen zum Thema "Alphabetisierung" sehr geholfen hat.
2. Zur Geschichte und Definition des Problemfeldes Analphabetismus
Um das Vorverständnis des Begriffes Analphabetismus zu klären, sei hier zunächst kurz auf seine Definition in einigen Nachschlagewerken verwiesen, bevor die globale Dimension des Problems und der aktuellere Begriff des "funktionalen Analphabetismus" skizziert werden.
Das DTV-Lexikon gibt das im Volksmund wohl noch heute verbreitete Verständnis der Bezeichnung "Analphabet" wieder, wenn es ihn einen des Lesens und Schreibens Unkundigen nennt und darauf hinweist, daß das Kreuz, das dieser statt einer Unterschift unter eine Urkunde setze, beglaubigt werden müsse (vergi. DTV-Lexikon 1975, S. 136). Wilhelm Hehlmann verweist im Wörterbuch der Pädagogik auf die Herkunft des Wortes aus dem Griechischen, wo es für die Bezeichnung des ungelehrten, ungebildeten Menschen benutzt wurde, was uns auf die lange Tradition des Leidens illiterater Menschen in literaten Gesellschaften hinweist (vergi. Hehlmann 1964, S.12). Das Duden Fremdwörterbuch belegt die Nebenbedeutung des Wortes "Analphabet", wenn die Wortbedeutung unter 2. mit "jemand, der in einer bestimmten Sache nichts weiß, nicht Bescheid weiß, Dummkopf' angibt (Bibliographisches Institut 1974, S.58). Gottfried Hausmann weist im Herder Lexikon der Pädagogik auf eine UNESCO-Definition aus dem Jahre 1951 hin, nach der Menschen alphabetisiert sind, die "mit Verständnis eine kurze, einfache Aussage über ihr Alltagsleben sowohl schreiben als auch lesen können" (vergi. Hausmann 1970, S. 41). Er bezeichnet Menschen, die zwar lesen, aber nicht schreiben können, als "Semialphabeten" und solche, die eine erworbene Lese-und Schreibfähigkeit verloren haben, als "Sekundäranalphabeten". Ziel neuerer Alphabetisierungskampagnen sei der "funktionale Alphabet", ein in den sechziger Jahren erstmals populärer Begriff, der uns sogleich näher beschäftigen wird.
2.1. Analphabetismus als Problem vorindustrieller Gesellschaften und "funktionaler Analphabetismus" in der Industriegesellschaft
John W. Ryan, der wie auch Hausmann als Bildungsexperte für die UNESCO tätig ist, veröffentlichte in seinem Aufsatz "Analphabetismus - eine globale Herausforderung" Zahlen aus einer jüngeren Untersuchung, derzufolge 814 Millionen Menschen, das ist ein Viertel der Weltbevölkerung, nicht lesen und schreiben können. Die meisten Betroffenen leben in Indien (300 Millionen), Afrika hat mit 60% die höchste Analphabetenrate (vergi. Ryan 1981, S.13). Ryan bezieht sich dabei auf die genannte UNESCO-Definition von Analphabetismus. Vergleicht man diese Zahlen mit UNO-Schätzungen von 1950, die die Analphabetenrate weltweit mit 44% oder 700 Millionen angeben, so wird deutlich, daß der Prozentsatz der Alphabeten durch intensive Bildungsmaßnahmen wohl leicht verringert wurde, die Gesamtzahl der Analphabeten aber bedingt durch das Wachstum der Weltbevölkerung dennoch erheblich stieg (vergi. Hehlmann 1964, S.12). In einem aktuellen Beitrag zum Weltalphabetisierungsjahr 1990 weist Ryan darauf hin, daß vor allem Frauen und Mädchen bedingt durch die Rollenverteilung in den Ländern der "Dritten Welt" illiterat bleiben. 500 Millionen der 800 Millionen Analphabeten sind Frauen. Ländliche Gebiete und die wachsenden städtischen Slums als Orte, in denen Armut und wirtschaftliche, soziale und kulturelle Randständigkeit herrsche, müßten Schwerpunkte der Bildungsarbeit sein (vergi. Ryan 1988, S.28). Die betroffenen Menschen stellen das Heer der Armen und Ohnmächtigen dar, das leider vor allem in Afrika, Asien und Lateinamerika mit zunehmender Verelendung ständig wächst. Ein Teil dieser Menschen wird allerdings die Uliteralität nicht als zentrales Problem erfahren, denn viele von ihnen leben noch in nicht literaten Kulturen oder Subkulturen, deren Gruppenschicksal zwar durch den Analphabetismus von objektiver Hoffnungslosigkeit gezeichnet ist, deren Mitglieder aber als Analphabeten nicht zu Außenseitern ihrer Gesellschaft werden. Henning Siemens schreibt dazu: "Ihr Analphabetismus muß im Rahmen ihrer Kultur nicht als defizitär gelten; traditionelle, nicht primär schriftsprachlich orientierte Kulturen bieten eigene Formen der Kommunikation und Tradierung von gesellschaftlichem Wissen" (Siemens 1988, S.47).
Anders ergeht es, wie schon die Lexikondefinitionen zeigten, lese-und schreibunkundigen Menschen in unserem Kulturkreis. Des Lesens kundig zu sein gilt als Selbstverständlichkeit, wer es nicht ist, muß dumm oder moderner formuliert "behindert" sein. Als Markstein für den Sieg über das Analphabetentum gibt Ryan den Zensus von 1912 an, demzufolge der Analphabetismus in Deutschland als nicht mehr existent galt. Ein verblüffendes Ergebnis, gab es doch nach Engelsing um 1800 nur ca. 25% "potentielle Leser" in unserem Land. Er schreibt:" Man sagt kaum zuviel, wenn man feststellt, daß noch in der ersten Hälfte des 19· Jahrhunderts sichere Kenntnis von Lesen, Schreiben und Rechnen sehr oft entweder auf häuslicher Erziehung oder auf Selbststudium beruhte" (Engelsing, R.; zitiert nach Giese 1984, S.26). Natürlich liegt in dem Zeitraum zwischen dem Beginn des 19. Jahrhunderts und dem Zensus von 1912 die Zeit der industriellen Revolution, die wegen der steigenden Anforderungen an das Grundwissen der wachsenden Arbeiterschaft auch eine Bildungsrevolution nach sich zog, und zweifellos hatten fast alle Menschen, die 1912 in Deutschland erfaßt wurden, in irgendeiner Form schulische Bildung genossen. Dennoch hält Ryan das Ergebnis des Zensus für fragwürdig. Damals genügte es, den eigenen Namen in eine Liste eintragen zu können, um als alphabetisiert zu gelten. Die damalige Volkszählung belegt somit allenfalls, das der größte Teil der deutschen Bevölkerung nach der Jahrhundertwende eine Schule besucht hatte, sie sagt nichts über die Fähigkeit der Menschen aus, Schriftspache anzuwenden.
Die UNESCO erkannte schon vor Jahren, daß es bei der Zielbestimmung der Bildungsarbeit im Bereich des Schriftspracherwerbs nicht allein darum gehen kann, Erwachsenen das Leisten einer Unterschrift und das Lesen weniger Worte zu lehren. Man stellte fest, so der Pädagoge Frank Drecoll, daß es in den Industriestaaten viele "semiliterates", viele "Halbalphabeten" gebe, Menschen, die trotz Schulausbildung die "gesellschaftliche Mindestnorm", wie Drecoll es nennt, nicht erfüllen und dadurch harten Sanktionen ausgesetzt sind (vergi. Drecoll 1981, S. 30). Eine bessere Bezeichnung als die der Halbalphabeten sieht der Autor in dem von W. S. Grey geprägten und von der UNESCO übernommenen Begriff "funktionaler Analphabet". Dazu Grey: "A person is functionally literate when he has acquired the knowledge and skills in reading and writing which enable him to engage effectively in all those activities in which literacy is normally assumed in his culture and group" (Grey; zitiert nach Drecoll 1981, S. 40). Das Neue an dieser Definition, die übrigens schon 1956 verfaßt wurde, ist die Tatsache, daß Schriftsprache nicht aus der Perspektive der Lehrplanschreiber als Summe von Teilleistungen oder entsprechend ihrer Struktur betrachtet wird, sondern als Werkzeug der Kommunikation in sozialen Situationen, eben funktional oder pragmatisch. Ob jemand Schriftsprache beherrscht oder nicht, heißt hier sinnvollerweise nicht, ob er eine festgelegte Zahl von Lernzielen erreicht hat, sondern, ob er sich in seiner Gesellschaft, Grey sagt "culture and group", in angemessener Weise schriftsprachlich ausdrücken und informieren kann.
Bernhard Gläss berichtet in seiner Schrift "Analphabetismus in Industriestaaten", die er im Auftag der UNESCO herausgab, daß der Begriff "functional literacy" allerdings erstmals von der US-Armee im zweiten Weltkrieg benutzt wurde, um "Personen, die nicht in der Lage sind, grundlegende schriftliche Instruktionen zu verstehen, die notwendig sind, grundlegende militärische Funktionen und Aufgaben zu erfüllen," zu bezeichnen (vergi. Gläss 1988, S. 48). Er gibt zu bedenken, daß "funktional" somit nicht automatisch als funktional für den Betroffenen, sondern oft primär für dessen Verwendung im Sinne der jeweiligen Gesellschaft zu verstehen sei.
Nun wird ein Einwand nicht ausbleiben, den auch Drecoll sieht: In unserer vielschichtigen Gesellschaft gibt es Tausende von Gruppen, Subkulturen und Berufen, in jeder sind die Anforderungen an die Schriftsprachkompetenz andere. Somit kann jeder für das Mitglied einer anderen Berufsgruppe oder Bevölkerungsschicht ein "funktionaler Analphabet" sein. Drecoll präzisiert daher Greys Definition durch seine eigene: "Funktionaler Analphabetismus bedeutet die Unterschreitung der gesellschaftlichen Mindestanforderungen an die Beherrschung der Schriftsprache, deren Erfüllung Voraussetzung ist zur sozial streng kontrollierten Teilnahme an schriftlicher Kommunikation in allen Arbeits- und Lebensbereichen" (vergi. Drecoll 1981, S.31). Er warnt zugleich vor einer Überfunktionalisierung etwa in dem Sinne, daß es nur darum gehe, Menschen das Lesen von Bedienungsanleitungen und Arbeitsverträgen zu ermöglichen. Drecoll sieht also den Begriff "funktional" ähnlich kritisch wie Gläss. Es dürfe auch nicht damit getan sein, eine Kulturtechnik in einem klar begrenzten Lehrgang zu erwerben, um sie dann zu "besitzen". Schriftspracherwerb müsse vielmehr der Beginn eines dynamischen Prozesses werden, einer emanzipativen Fähigkeitsentwicklung, die Gedankenaustausch ebenso ermöglicht wie "Ordnung des Denkens über Schreiben" (vergi, ebenda, S.33). Hier taucht ein qualitativ neuer Anspruch an Schriftspracherwerb auf, der uns später weiter beschäftigen soll.
Es sei aber nach der Definition des Begriffes "funktionaler Analphabetismus" noch erwähnt, daß es auch bei uns sogenannte "Vollanalphabeten" gibt, die der Schriftsprache in keiner Weise mächtig sind, da sie durch Kriegseinflüsse, Zugehörigkeit zum Volk der Sinti und Roma oder zu ausländischen Minderheiten in der BRD oder aber durch besonders problematische Sozialisationsbedingungen und lange Heimaufenthalte an einem üblichen Schulbesuch gehindert wurden. Zunächst wurde der Begriff der "functional literacy" im Rahmen der ersten Alphabetisierungsphase der UNESCO nur für die Arbeit in den sogenannten Entwicklungsländern benutzt, doch gegen Mitte der siebziger Jahre zeigten Untersuchungen in den USA, daß ein großer Teil der Bevölkerung im Sinne der UNESCO-Definition illiterat war. Drecoll und andere berichten, daß erste Informationen über das Vorhandensein funktionaler Analphabeten in der BRD gegen Ende der siebziger Jahre aus Strafanstalten kamen (vergi, ebenda, S.l). Hier konnte man Erwachsene auch mehr oder weniger gegen ihren Willen Tests unterziehen, die Möglichkeit, sich in der Anonymität zu verbergen, war geringer. Ulla Harting berichtet von der Wirkung, die die Nachricht von der Existenz erwachsener Analphabeten bei uns hervorrief: "Allein die Kunde vom Erwachsenenanalphabetismus rief Ende der siebziger Jahre Verwirrung hervor. Der schöne Schein einer alphabetisierten Nation war dahin. Es war schier unglaublich! Man unterstellte gar einer sozusagen professionell interessierten Elite, sie habe nur flott eine neue Randgruppe dingfest machen wollen" (Harting 1988, S.15). Doch es zeigte sich bald, daß diese polemische Unterstellung nicht haltbar war.
2.2. Zu den Ursachen des Analphabetismus in der BRD heute
Die Bremer Volkshochschule war die erste Einrichtung, die Kurse für "Lesen und Schreiben von Anfang an" anbot. Kaum wurden die Kursangebote bekannt, meldeten sich zahlreiche Teilnehmer. Das erstaunte umso mehr, als das Eingeständnis, nicht lesen und schreiben zu können, mit der Gefahr verbunden ist, als geistig Behinderter stigmatisiert zu werden. Die rege Nachfrage nach den neuen Bildungsangeboten, die sich an Volkshochschulen im ganzen Bundesgebiet schnell ausbreiteten, ließ es nicht länger zu, das Problem als rein psychisch-medizinisches Problem zu betrachten, es zeichnete sich immer deutlicher ein partielles Versagen unseres Bildungssystems ab (vergi. Wilhelmi, Jutta in: Betrifft Erziehung 1981, S.28).
Die geschätzte Zahl der "funktionalen Analphabeten" in der BRD wird in Ermangelung eindeutigerer Normen und empirischer Untersuchungen einmal mit 300 000, dann mit einer Million, andere Autoren sprechen sogar von drei Millionen, beziffert (vergi. Fuchs-Brühninghoff 1986, S.12). Das deutsche UNESCO-Institut für Pädagogik in Hamburg schätzte den Anteil der Analphabeten an der erwachsenen Bevölkerung der BRD Anfang der achtziger Jahre auf 0,75 bis 3,5 % (vergi, ebenda). Dies geschah auf der Grundlage von Hochrechnungen, die auf Erfahrungen in anderen europäischen Ländern basieren, aus denen empirische Erhebungen vorliegen. Das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft gab 1980 beim Arbeitskreis Orientierungs-und Bildungshilfe (AOB) in Berlin eine Studie in Auftrag, aus der deutlich wurde, daß es wegen des starken Bedarfes an zahlreichen Volkshochschulen Alphabetisierungskurse gab, daß aber vor allem didaktisch-methodische Konzepte und Mitarbeiterqualifizierung fehle (vergi, ebenda). Als Folge wurde mit Unterstützung des Ministeriums das Projekt "Entwicklung und Unterstützung von Maßnahmen zur muttersprachlichen Alphabetisierung an Volkshochschulen" von der pädagogischen Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschulverbandes in Frankfurt angeregt, das von 1982 bis 1985 durchgeführt wurde und neben zahlreichen Publikationen und Medien für die praktische Arbeit auch quantitative Untersuchungen zum Umfang der Alphabetisierungsarbeit in der BRD sowie qualitative Studien zu den Ursachen des Problems hervorbrachte. Eine Erhebung von Ulrike Kropp und Klaus Hinkelmann ergab, daß 1985 an 245 Erwachsenenbildungseinrichtungen und 31 Justizvollzugsanstalten Alphabetisierungskurse durchgeführt wurden (vergi, ebenda, S.24). Es wurden insgesamt 769 Kurse mit 5355 Teilnehmern ermittelt. Elisabeth Fuchs-Brüninghoff nennt in einem Beitrag zur Dokumentation der Expertinnentagung "10 Jahre Alphabetisierung" aus dem Jahre 1988 aktuellere Zahlen: Die Zahl der in der Arbeit tätigen Einrichtungen sei in zehn Jahren von 17 auf über 300 gestiegen, die der Teilnehmer von wenigen hundert auf ca. 10 000. Eine Medienkampagne, die das Adolf-Grimme-Institut unter Einsatz von Zeitungsanzeigen, Radio und Fernsehspots in Norddeutschland durchführte, hatte große Resonanz. Die Anzahl der Mitarbeiterinnen liege mittlerweile bei über 1000 (vergi. Fuchs-Brüninghoff in: Harting 1988, S.98). Die Steigerung der Bildungsangebote im Bereich der Volkshochschulen ist beachtlich, vor allem wenn man weiß, daß hier in der Regel in Kieingruppen von fünf bis zehn Teilnehmern und zumeist im Team-Teaching-Verfahren gearbeitet wird und daß die Teilnehmer oft mehr als zwei Jahre lang im Kurs mitarbeiten. Anerkennenswert erscheint die Arbeit der Kursleiterinnen unter dem Aspekt, daß 90 % von ihnen diese vorbereitungsaufwendige Tätigkeit auf Honorarbasis nebenberuflich oder nicht selten als hauptberufliche Honorararbeit ohne Sozialversicherung ableisten.
Angesichts der Schätzungen über die Gesamtzahl der "funktionalen Analphabeten" verdeutlichen die genannten Zahlen aber, daß nur ein sehr kleiner Teil dieser Menschen bislang Zugang zu Bildungsangeboten gefunden hat. Giese bezieht sich auf die UNESCO-Schätzung Gottfried Hausmanns, wenn er feststellt:" D.h. ca. 500 000 deutschsprachige Erwachsene leben ohne Buchstabenkenntnis und ohne die Fähigkeit, ihren eigenen Namen schreiben zu können; bei ca. 2,2 Mio. reichen die Schreib-und Lesekenntnisse für die Bewältigung einfacher alltäglicher Anforderungen (Post, Bank etc.) nicht aus" (Giese, H.W. in: Der Deutschunterricht; 6/84; S.25).
Die Bedeutung des Problems mag nun deutlich geworden sein, es drängt sich die Frage auf, wer denn diese Analphabeten sind, die trotz Schulbesuchs keine Schriftsprachkompetenz erworben oder diese wieder verloren haben. Die beispielhafte Darstellung ihres Schicksals ist auch Einstieg in die Frage nach den Ursachen, beide werden nunmehr beleuchtet.
2.3. Zu den Ursachen des "funktionalen Analphabetismus"
Wie konnte der Analphabetismus so "plötzlich" zum Problem werden? Heinz W. Giese fuhrt zwei Gründe für die scheinbar zunehmende Zahl "funktionaler Analphabeten" an: Einerseits hätten sich die Lebensbedingungen für Analphabeten in den letzten Jahren sehr verschlechtert, da viele Arbeitsplätze für ungelernte Arbeiter, die rein manuell tätig waren, verschwunden sind und zunehmend Schriftsprachkompetenz von Arbeitgebern gefordert wird. Andererseits sei man bei Behörden und Ämtern dadurch, daß neuerdings Informationen über das Problem vorliegen, erst jetzt richtig aufmerksam geworden und "entdecke" nun, da das Stigma des Analphabetentums populärer wird, Menschen, die sich vorher leichter tarnen konnten (vergi. Giese in: Balhorn u. Brügelmann 1987, S.262 ff). Giese stellt ferner fest, daß ganze Bereiche der alltäglichen "Kultur der Mündlichkeit" verschwinden, so gebe es die alten, ländlichen Familienverbände nicht mehr, in denen gemeinsam gearbeitet und auch erzählt oder vorgelesen wurde. Der Bankangestellte werde ebenso durch einen Automaten ersetzt wie der Fahrkartenverkäufer. Funktionales Lesen und Schreiben sei gefordert. Bedeutet der in dieser Weise "auftauchende" Analphabetismus, daß Menschen etwas verlernt haben, was sie dereinst in der Schule konnten? Dies ist sicherlich kein seltenes Phänomen. Drecoll bestätigt, daß viele sehr leseschwache Schulabgänger auch im Erwachsenenleben Vermeidungstendenzen beibehalten, die sie in der Schule erlernt haben, um Mißerfolgserlebnisse beim Lesen oder Schreiben zu umgehen. Er spricht von einer Regression in den "Sekundäranalphabetismus", die durch eine lernbehindernde, intolerante Umwelt nach dem Motto "schreib richtig oder gar nicht" verursacht werde (vergi. Drecoll 1981, S.36). Giese geht noch weiter. Er macht der Schule den Vorwurf, sie lehre "das bloße Beherrschen von Verschriftungstechniken und das laute Lesen", beides werde im Alltag immer weniger gebraucht. Gefordert sei das verstehende Lesen, nicht eine formale, technische Fähigkeit, sondern komplexe kognitive Verarbeitung und Produktion von Schriftsprache; schriftsprachliche Kommunikationsfähigkeit (vergi. Giese in: Balhorn u. Brügelmann 1987, S.261). Genau diese hat die Deutschdidaktik in den siebziger Jahren zum Ziel des Deutschunterrichts in der Schule erhoben. Giese wirft ihr allerdings vor, sie habe die Rolle der mündlichen Kommunikation drudi eine Fehlbeurteilung der zukünftigen neuen Medien überschätzt, die Schriftsprache und deren Gebrauch daher stark vernachlässigt, und sie habe sich in ihrem emanzipatorischen Impetus zu früh auf das "weiterführende Lesen" konzentriert und den Anfangsunterricht vergessen (vergi, ebenda). Deshalb sei der Zeitraum, in dem das Lesen und Schreiben erlernt werden konnten, faktisch immer kürzer geworden, Strategien zum Verbergen schriftsprachlicher Defizite wären somit von vielen Schülern frühzeitig entwickelt worden, Giese spricht von "Schrift-Bluff1. Er sieht die Ursache somit in einem Versagen des Grundschulunterrichts, der sich durch die Ausrichtung der Deutschdidaktik am Ziel der sprachlichen Kommunikationsfähigkeit zu wenig um die Schriftsprachkompetenz bemüht habe. Die Opfer dieser mangelnden Bemühungen um das Schreiben habe man als abweichend gekennzeichnet: "Die Folge eines solchen Begriffs vom Menschen als eines qua definitione alphabetisierten (...) war, daß die Nicht-Aneignung schriftsprachlicher Fähigkeiten vor allem in der Person des einzelnen ("Legasthenie-Konzept") oder in seinen sozio-kulturellen Lebensumständen ("Sprachbarriere-Konzept") angesiedelt werden mußten" (Giese, H. W. in: Der Deutschunterricht 6/84, S.28). Giese skizziert den Weg der Stigmatisierung vom Legastheniker in der Schule zum Analphabeten im Erwachsenenalter. So einleuchtend dieser Vorwurf an schule oder Gesellschaft ist, so einseitig erscheint er auch. Indirekt stützt Giese die These vom Verfall der Schriftkultur, der für ihn durch deren Vernachlässigung in der Schule bedingt ist, für andere Autoren durch den Einfluß der neuen Medien. Hans Brügelmann berichtet von einer amerikanischen Untersuchung des "National Assesment of Educational Progress" von 1986, die die Frage beantworten sollte, ob die heutigen Schülergeneration geringere Schriftsprachkompetenz besitzt als ihre Altersgenossen des Jahres 1971: "Die wichtigsten Ergebnisse:
1. 9-, 13-,und 17-jährige Schüler zeigten 1984 bessere Leistungen als ihre Altersgenossen 1971.
2. Vor allem die unteren Leistungsgruppen haben aufgeholt.
3. 95-98% aller 13-bis 17-jährigen können mit einfachen Texten umgehen, 84% der 17-jährigen können nach bestimmten Informationen suchen, gedankliche Bezüge in einem Text hersteilen und Grundgedanken beraus- arbeiten" (Brügelmann,H. in: Balhorn u. Brügelmann 1987, S.255).
Eine zweite Untersuchung, bei der eine repräsentative Gruppe von 21- bis 25-jährigen differenzierte, alltagsnahe Lese-und Schreibaufgaben bewältigen mußte, zeigte, daß 95% Schrift lesen und verstehen, aber nur eine kleine Teilgruppe "anspruchsvolleres Material" verstehen konnte. Brügelmann interpretiert das Ergebnis in dem Sinne, daß formale Schulleistung, hier ausgedrückt als "technische" Lese-und Schreibfertigkeiten, entgegen der These vom "Kulturverfall" nicht schlechter geworden sei, die Anforderungen an die gedankliche und kommunikative Nutzung seien aber gewachsen. Eine These, durch die er mit Giese übereinstimmt, der ausdrücklich auf das Abnehmen der keinerlei Schriftsprachkenntnisse erfordernden Hilfsarbeitertätigkeiten und die in den Alltag eindringenden Lese- und Schreibanlässe durch die Automatisierung des Zahlungsverkehrs und anderer Bereiche verweist. Einig sind sich fast alle Autoren darin, daß der Beginn der Lernstörung, die zum funktionalen Analphabetismus führte, in der Phase des Erstunterrichts, also des Schriftspracherwerbs in der Grundschule liegt. Ulla Harting meint, es liege ein multikausales Zusammentreffen von familiären, schulischen und individuellen Faktoren zugrunde, dieses habe die Menschen in der Anfangsphase des schulischen Schrifterwerbs in für sie nicht zu bewältigende Situationen gebracht, die zum Abbruch des Leselernprozesses geführt hätten. Sie sieht aber generell einen sozialen Hintergrund, den sie so kennzeichnet: "Die bedrängenden familiären, häuslichen und sozialen Verhältnisse sind u.a. zu kennzeichnen durch beengte Wohnverhältnisse, große Kinderzahl, finanzielle Schwierigkeiten, Arbeitslosigkeit, Alkoholismus oder Krankheit der Eltern bzw. eines Elternteils, Kinderarbeit, zerrüttete Ehen, Heimaufenthalte o.ä." (vergi. Harting,U. 1988, S.4 ff).
Jürgen Roth hat bei einer Befragung in zehn deutschen Obdachlosenunterkünften einen Anteil von 15% Analphabeten ausge macht, er nennt allerdings keine Einschätzungskriterien. Er verweist auf die Ghetto-Situation und die soziale Isolation dieser Orte, sowie die allgemeine Diskriminierung, Faktoren, durch die normal begabte Kinder nach Umwelterfahrung, Wortschatz und Ausdrucksfähigkeit, gemessen am Altersdurchschnitt zurückgeblieben seien. Viele Eltern litten unter den gleichen Defiziten und seien selbst Analphabeten (vergi. Roth, J. 1979, S.92).
Eine Befragung, die die Arbeitsgemeinschaft Orientierungs- und Bildungshilfe in Berlin unter 80 Kursteilnehmern durchführte, zeigte, daß trotz allgemeiner Schulpflicht viele Kinder während der Grundschulzeit nicht durchgängig die Schule besuchten. Ehling, Müller und Oswald sehen diese Tatsache im Zusammenhang mit dem Scheitern im Erstlese-und Schreiblernprozeß als erstes Zeichen für den Werdegang des Analphabeten. Die Überweisung in die Sonderschule, so die Autoren, wurde von den Betroffenen eher als Strafmaßnahme denn als Hilfe gewertet, Resignation und Selbstaufgabe waren die Folge. Sie werfen der Schulorganisation und dem methodischen Instrumentarium vor, dem lese-rechtschreibschwachen Schüler den Anschluß an den Durchschnitt geradezu zu verbauen. "Lesen und Schreiben werden aufgrund der Sanktions-und Selektionsmechanismen des Schulsystems zu angstauslösenden Pflichten, die man nur unter Zwang ausführt oder denen man sich soweit wie möglich entzieht" (Ehling,B.; Müller,H.M.; Oswald,M.L. 1981, S.10).
Marie-Louise Oswald hat anhand von 150 Kurzbiographien und vieler Intensivinterviews, die sie mit Teilnehmern von Erwachsenenbildungsveranstaltungen im Rahmen ihrer Arbeit für den "AOB" in Berlin geführt hat, 12 Thesen zu den Ursachen des Analphabetismus aufgestellt. Sie scheinen mir wegen ihrer Authentizität und ihrer Übereinstimmung mit meinen Erfahrungen mit den Teilnehmern im Strafvollzug so typisch, daß ich sie hier sinngemäß gekürzt quasi als Standartmuster der Biographie eines funktionalen Analphabeten wiedergebe:
1. Analphabeten kommen oft aus kinderreichen Familien und nehmen eine mittlere Stellung in der Geschwisterreihe ein.
2. Sie stammen aus einkommensschwachen Familien mit beengten Wohnverhältnissen.
3. Sie mußten als Kinder in der Regel gegen Entgeld oder im Haushalt bei der Geschwisterbetreuung mitarbeiten.
4. Das Familienleben war durch Scheidung oder Scheidungsabsicht, durch Streit um Geld und Alkoholkonsum gestört.
5. Die außerschulische Sozialisation weist auf eine unharmonische Jugend hin.
6. Oft erfolgte eine Unterbringung in Kinderheimen, die psychisch als Verschlimmerung der Lebenssituation erfahren wurde.
7. Die Lernstörungen, durch vorgenannte Faktoren verursacht, wurden von Lehrern als Charaktermängel betrachtet, was Diskriminierung nach sich zog.
8. Das Sitzenbleiben und die Überweisung in die Sonderschule wurden als Deklassierung erlebt und mit Selbstaufgaben und Schulschwänzen beantwortet.
9. Eine individuelle Förderung in der Grundschule gab es kaum.
10. Lehrer wurden als gleichgültige oder strafende Instanzen erlebt, die eigene Position als Hilflosigkeit.
11. Analphabeten entwickelten durch die Diskriminierung in der Schule, die schon durch schlechte Kleidung und Pflege des Kindes initiiert wurde, massive Ängste und Minderwertigkeitskomlexe.
12. In der Berufsschule wurde keine Kompensation ermöglicht, oft blieb es hier beim Fernbleiben vom Unterricht als Vermeidungsverhalten.
Das Bewußtsein der Lese- Rechtschreibschwäche führte nach dem Vermeidungsverhalten, so Oswald, zu einem "Vergessenseffekt", dieser zum sekundären Analphabetismus (vergi. Oswald,M.-L. in: Drecoll 1981, S.52 ff).
Auch Eva-Renate Heinz identifiziert die schulische LeseRechtschreibschwäche mit dem späteren funktionalen Analphabetismus. Sie nennt als LRS und Analphabetismus begünstigende Risikofaktoren drei Bereiche: Milieubedingungen, sprachliche Schwächen und die schulische Situation. "Eine bestimmte Schichtzugehörigkeit, die mit Anregungs-, Motivierungs- und Fördermängeln einhergeht, erhöht die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer LRS. Die sprachlichen Mängel der leserechtschreibschwachen Kinder sind im deutschen Sprachraum ausführlich untersucht worden" (Heinz, E.-R. in: Giese, W.u. Gläß, B. 1984, S. 103). Dabei bezieht sich Eva-Renate Heinz u.a. auf Angermaier (1976), Valtin (1972), Kossow (1973) und Anwander (1983). Sie weist an anderer Stelle auf die fatalen Folgen der Diskrepanzdefinition der Legasthenie hin, derzufolge nur Kinder als Legastheniker gefördert wurden, deren Lese-Rechtschreibschwäche im Mißverhältnis zu den übrigen Schulleistungen stand. Diese von Schlee, Spitta und anderen schon vor Jahren als unhaltbar diskreditierte Definition habe zur Folge gehabt, daß gerade die Kinder von der Förderung ausgeschlossen wurden, deren Versagen auf ungünstige Umweltverhältnisse zurückzuführen war, wäh - rend sprachlich gewandte Kinder aus der Mittelschicht gefördert wurden (vergi, ebenda, S.105). Ich muß aus eigener Erfahrung anmerken, daß der überholte Legastheniebegriff, obschon er in der Theoriediskussion längst begraben wurde, in den Köpfen der mittleren Generation der Grundschullehrer bis heute fest verankert ist. Kinder, deren IQ unter 90 oder, je nach Autor, unter 100 lag, sollten, so schlugen u.a. Angermaier und Ingenkamp vor, nicht erst in der Grundschule gefördert, sondern in die Sonderschule eingewiesen werden (vergi, ebenda, S.106). Was aus diesen Kindern wird, belegt eine Untersuchung, die Rupp (1980) und Böhm (1981) an 240 Absolventen der Hamburger Sonderschulen für Lernbehinderte des Jahrgangs 1980 durchführten. Bei 47,7% dieser Jugendlichen lag der allgemeine Kenntnisstand unter dem Level der 6. Klasse der Hauptschule, deren Rechtschreibleistung entsprach nicht ganz dem der 4. Grundschulklasse. Rupp und Böhm betrachten folgerichtig 50% der Sonderschuiabgänger als funktionale Analphabeten (vergi, ebenda, S.118).
Erinnern wir uns an die These Gieses und die von Brügelmann interpretierte Untersuchung, derzufolge die "technische" LeseRechtschreibleistung, die allein von Rupp und Böhm erfragt wurde, bei fast allen Schulabgängern heute relativ gut entwickelt sei, funktionaler Analphabetismus aber dennoch mangels pragmatischer Kompetenz auftrete, so kann man davon ausgehen, daß weit mehr als 50% dieser Schulabgänger funktionale Analphabeten sind oder sein werden. Da viele von ihnen in den folgenden Jahren jeden Schreibanlaß meiden, steigt ihre Zahl auch durch "sekundären Analphabetismus" weiter an.
Um den Zirkel zu schließen und auf das spezielle Anliegen dieser Arbeit zurückzukommen, sei ein Beitrag von H. Wehrens erwähnt, der vermerkt, daß 30-40% der erwachsenen Strafgefangenen und sogar 60-70% der Jugendstrafgefangenen nicht über den Hauptschulabschluß verfügen. Zugespitzt kann man somit sagen, daß ein beachtlicher Teil der Kinder, die wegen eines anregungsarmen Milieus, Armut der Eltern, wegen ihres Soziolektes und wegen mangelnder schulischer Förderung in den ersten Grundschuljahren im Schriftspracherwerb scheitern, als Gruppe funktionaler Analphabeten im Strafvollzug wieder auftaucht, wo sie dann, wie eingangs dargestellt, wiederum eben nicht gefördert werden. Dieses bedauerliche Phänomen ist aber, wie Giese und Brügelmann zeigten, nicht eine durch eine Verschlechterung des Lehrangebotes verursachte, neue Situation. Jedoch die diskriminierenden Folgen und der Leidensdruck der Betroffenen nehmen laufend zu, da die Anforderungen an Schriftsprachkenntnisse ständig steigen und das Vorhandensein von Analphabeten in das Bewußtsein der Öffentlichkeit gerückt ist.
2.4. Die Lebenssituation funktionaler Analphabeten
Analphabeten beginnen bereits in der Schule damit, mangelnde Schriftsprachkompetenz zu verbergen, um sich vor dem Makel der Dummheit zu schützen. Ein Beispiel für ein solches Kind erlebte ich in einer dritten Grundschulklasse, in der ich vor einigen Jahres als Deutschlehrer tätig war. Die Kinder hatten die Aufgabe bekommen, zu einer angefangenen Geschichte eine Fortsetzung zu schreiben. Alle Schüler arbeiteten in Kleingruppen bis auf R., er wollte unbedingt allein arbeiten. Ich wußte, daß er als extrem lese-rechtschreibschwacher Schüler aus problembeladenem Elternhaus eine wenig beliebte Außenseiterrolle innehatte, wollte ihn aber durch mein Eingreifen als Vermittler nicht bloßteilen und ließ ihn als einzigen für sich arbeiten. Als es um das Vorstellen der Ergebnisse ging, meldete sich R., ich bat ihn vorzulesen und er trug einen recht fundierten und gut formulierten Beitrag vor. Plötzlich bemerkte ein Mitschüler, daß R. gar nichts in sein Heft geschrieben hatte. Eine erstaunliche geistige und sprachliche Leistung, ohne Hilfe des Schreibens einen Text zu gliedern und schriftsprachlich zu formulieren, aber welche Not wird erkennbar, die schon Grundschulkinder zu einem so aufwendigen Versteckspiel treibt.
Dieses Spiel begleitet den Analphabeten Zeit seines Lebens. E. FuchsBrüninghoff, W. Kreft und U. Kropp geben die Erfahrungen einer Frau wieder, die durch die Schularbeitenhilfe für. ihre Tochter veranlaßt wurde, einen Kurs an der Volkshochschule zu belegen und die den Makel dem Kind gegenüber erfolgreich verbarg:" Mir bricht der Angstschweiß aus, wenn ich Papier und Füller sehe. Mein Herz klopft vor Aufregung, wenn mir jemand beim Schreiben über die Schulter sieht. Es ist ein bedrückendes Gefühl, Gedanken nicht niederschreiben zu können, weil sie mit Fehlern nur so gespickt sind, oder alles, was mit Schreiben zu tun hat, umgehen zu müssen" (E. Fuchs-Brüninghoff, W. Kreft, U. Kropp 1986, S.34).
Ulla Harting berichtet von dem 26-jährigen Helmut, für den die Angst, entdeckt zu werden, das Schlimmste ist. "Er kann seinen Namen schreiben, mühsam die Adresse, nicht mehr. Er macht nur Dinge, die er kennt. Er fährt mit dem Bus in das Viertel, in dem er seine Jugend verbrachte, da kennt er sich aus, braucht niemanden nach dem Weg zu fragen. Oder er besucht, wenn er mal ausgeht, immer die gleichen Lokale: eine Pizzeria und ein Hamburger-Restaurant. Hier kann ihm auch nicht passieren, was ihm zustieß, als er einmal die vertraute Umgebung verließ und woanders essen wollte. Er blätterte in einem Lokal interessiert in der Speisekarte, die er ja nicht lesen kann, und bestellte ein Schnitzel. Als die Bedienung meinte, das stehe doch gar nicht in der Speisekarte, verließ Helmut fluchtartig die Gaststätte (Harting,U. 1988, S.6,7).
Während es der oben zitierten Frau verwehrt bleibt, die eigenen Gedanken schriftlich festzuhalten und dadurch das eigene Leben besser reflektieren zu können, zeigt sich bei dem jungen Mann, daß der Analphabetismus auch den Lebensraum und die Reichweite einfachster Handlungen stark einzuschränken vermag.
Ehling, Müller und Oswald sind Fälle bekannt, in denen öffentliche Zuwendungsträger, sprich Arbeits-oder Sozialamt, Analphabeten nach Bekanntwerden ihres Problems als "geistig Behinderte" eingestuft und ihnen dadurch weitere Chancen auf einen Arbeitsplatz verbaut haben. Ohne fremde Hilfe, so betonen sie, könne ein Analphabet weder Bewerbungsunterlagen ausfüllen noch Verkehrsmittel benutzen. Sozialkontakte werden reduziert, oft besteht nur Kontakt zur eigenen Familie. Psychische Folgen seien Depression, Suizidversuche, Apathie, Drogenmißbrauch oder aggressive Überreaktionen (vergi. Ehling, B.; Müller, H.M. u. Oswald, M-L. 1981, S.12).
Die Situation von Analphabeten hinter Gittern erscheint aber, wie ich gleich aufzeigen werde, noch problematischer.
2.5. Analphabeten im Strafvollzug
In meinem ersten Kurs im Strafvollzug lernte ich den Gefangenen M. kennen. Er erzählte nach einiger Zeit, daß er eine Haftstrafe wegen Fahrens ohne Führerschein verbüße. Er konnte als Sinti von Kindesbeinen an ein Auto fahren, aber da er des Lesens und Schreibens nicht mächtig war und es in seiner Jugend noch keine Führerscheinprüfungen für Analphabeten gab, blieb ihm die Fahrerlaubnis verwehrt. Die einzige geregelte Arbeit, die ihm zeitlebens angeboten wurde, war das Fahren eines Lieferwagens für einen Verwandten, der Schrotthändler war. So fuhr er halt, und bis dato war er immerhin fünfzehnmal wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt worden. Sinnigerweise waren die ersten Urteile mit einem jeweils mehrjährigen Verbot des Führerscheinerwerbs verbunden, mittlerweile konnte er als unverbesserlicher Wiederholungstäter schon für eine Autofahrt ein halbes Jahr Gefängnis hinnehmen. Sicher nicht zuletzt die eingeschränkte Beschäftigungssituation und die ständigen Gefängnisaufenthalte zogen bei ihm eine Vielzahl von kleineren Straftaten nach sich. Sein Los in der Strafanstalt war dennoch meinem Eindruck nach etwas erträglicher, als das anderer Analphabeten. Da er in der Regel nicht der einzige Sinti war, fand er zumeist einen anderen, der über etwas mehr Schriftsprachkompetenz verfügte und der ihm kostenlos half. Außerdem gilt der Status des Analphabeten in der Sinti-Kultur nicht als Stigma, sondern eher als Zeichen konservativer Normaliät, das Selbstverständnis eines Sinti wird daher von diesem Status nicht so leicht beeinträchtigt, wie dieses bei Mitgliedern der bundesdeutschen Bevölkerungsmehrheit der Fall ist.
Wer im Gefängnis nicht zufällig einen alphabetisierten Freund hat, und Freundschaften sind in Strafanstalten etwas äußerst Seltenes, der muß für jede kleine Hilfe beim Lesen von Briefen, dem Verfassen von Anträgen oder Eingaben und dem Beantworten von Anwaltspost bezahlen. Die übliche Währung besteht aus "Koffern" (Tabakpäckchen) und "Bomben" (Kaffeepackungen), die hoch gehandelt werden. Im Gefängnisalltag spielen Anträge eine ganz besondere Rolle. Gleichgültig, ob man eine Einzelzelle oder Hafturlaub will, ob man arbeiten möchte oder ein Radio oder einen Wellensittich erwerben möchte, nichts läuft ohne schriftlichen Antrag. Selbst Telefongespräche mußten im Schleswig-Holstein bis vor kurzem noch schriftlich beantragt werden. Anträge werden oft erst nach Wochen oder gar Monaten schriftlich beantwortet, wiederum gilt es zu lesen. Zwar sollten Beamte auf der jeweiligen Station Schreibhilfe leisten, sie tun es aber, wie meine Erfahrung zeigte, oft ganz einfach nicht und bei bestimmten Schreibanlässen wie etwa Beschwerden über schlechte Behandlung durch eben diese können die Gefangenen auf diese theoretisch vorgesehene Hilfe ohnehin nicht zurückgreifen. Minderwertigkeitsgefühle und Versagensängste werden in einer Umgebung, die dermaßen auf schriftliche Kommunikation eingestellt ist wie die Strafanstalt, auf die Spitze getrieben. Hier wird mancher erwachsene Analphabet zu einem bettelnden Kind gemacht, für viele bleibt nur ein noch weiterer Rückzug in die Isolation als draußen unter Verzicht auf zahlreiche Möglichkeiten der Kommunikation und der Wahrung eigener Rechtsansprüche. Wie erwähnt, beschränken sich die sozialen Kontakte funktionaler Analphabeten oft auf den Kreis der eigenen Familie, der gegenüber der Makel nicht verheimlicht werden muß. Für den Strafgefangenen hat der Kontakt zu den Angehörigen wegen der Isolation in der Anstalt natürlich höchste Priorität, und da eine Besuchsstunde im Monat, die von Angehörigen wegen größerer Entfernung vom Wohnort oft nicht einmal wahrgenommen wird, nicht ausreicht, um Kontakte zu erhalten, spielt die Briefpost eine besondere Rolle. Der Brief von zu Hause und die Anwaltspost zwingen jeden inhaftierten Analphabeten zur Offenbarung seines Stigmas. Da der Begriff Analphabet leider primär als diskriminierendes Etikett mittlerweile Allgemeingut geworden ist, wird der funktionale Analphabet unweigerlich zum Abweichenden innerhalb einer Subkultur, die ohnehin schon aus den Gestrandeten des Gesellschaftssystems besteht. Jeder Brief ist erneut Anlaß, sich zu offenbaren und sich dem Spott von Mitinsassen und Beamten auszusetzen. Mir brachte ein Gefangener einen Brief mit der Bitte, ihn mit ihm zu lesen. Der Brief war drei Wochen zuvor in der Anstalt eingegangen, aber der Gefangene hatte ihn ungeöffnet mit sich herumgetragen aus Furcht vor dem Spott seiner Mitgefangenen und weil er als Außenseiter keinen Leser zu seinen Vertrauten zählte. Es gab in der Anstalt schriftsprachkundige Gefangene, die in ihrer Zelle eine regelrechte Schreibpraxis betrieben. Sie lasen vor, ließen sich diktieren oder verfaßten Anwalts-oder Gerichtspost fachgerecht und tippten diese per Schreibmaschine. Perfekte Selbsthilfe von Schicksalsgenossen, wenn sie nicht oft mit massiver Ausbeutung der "Kundschaft" verbunden gewesen wäre. Es gab Analphabeten, die die Hälfte ihres monatlichen Einkaufs an Tabak und Kaffee für11 Schreibhilfegebühren" verbrauchten. Dennoch ist dem Gefangenen die Hilfe eines Mitgefangenen ungleich lieber als die Bitte um Hilfe durch einen Vollzugsbeamten. Diese bewiesen dem Gefangenen in der mir bekannten Anstalt ihre Macht und Überiegenheit schon dadurch, daß sie die Postzensur für ihren Arbeitsbereich selbst durchführten und damit vor dem Betroffenen schon über den Inhalt eines eben eingetroffenen Briefes informiert waren, was gelegentlich zu ironischen Bemerkungen über den Inhalt der Post führte. Es ist leicht nachzuvollziehen, daß kaum ein Gefangener diesen" alleswissenden Machtwesen" auch noch die Beantwortung der privaten Post anvertrauen will. Leichter fällt da schon das Hilfeersuchen an den Lehrer, der nicht als Teil des allgemeinen Disziplinierungsapparates angesehen wird. Dieser Weg steht aber in der Regel nur den Teilnehmern von Bildungsveranstaltungen offen.
Heinz H. Wehrens, selbst Lehrer im Strafvollzug, schreibt zum Leben der Analphabeten im Vollzug:" Innerhalb der Gesamtpopulation der Gefangenen nehmen sie oft Außenseiterstellungen ein, werden - wenn überhaupt - nur zu niedrigsten Hilfsarbeiten in der Anstalt herangezogen und verfügen allenfalls über eingeschränkte Kontakte nach draußen" (Wehrens, H.H. in: Drecoll 1981, S. 85 ff). Wehrens stellt fest, daß neben einer kleineren Gruppe von Vollanalphabeten mit kurzen oder völlig fehlenden Schulbesuchszeiten, worunter vor allem Sinti und Arbeitsmigranten der zweiten Generation fallen, die größere Gruppe der funktionalen Analphabeten zwar längere Schulbesuchszeiten hinter sich hat, jedoch zumeist vorzeitig die Haupt- oder Sonderschule verlassen hatte. Dieser Personenkreis sei gekennzeichnet durch extrem lange Heimaufenthalte, Dauerarbeitslosigkeit und oft völliges Fehlen sozialer Bindungen (vergi, ebenda, S. 87).
Es bleibt festzuhalten, daß das Leben von Analphabeten im Strafvollzug im Vergleich zu dem funktionaler Analphabeten in Freiheit gekennzeichnet ist durch den meist völligen Verlust der ohnehin spärlichen sozialen Bindungen, durch die Auswirkungen einer in der Regel noch randständigeren Sozialisation bei recht ähnlich verlaufender schulischer Laufbahn und vor allem durch die vom System der Anstalt erzwungene Aufgabe des Verbergens ihres Stigmas, die zu erheblichen psychischen Problemen führt.
Eberhard Hollin, der sich speziell mit jugendlichen Berufsschülern ohne Lehrstelle befaßte, berichtet in einem Beitrag zu dem Sammelband von Drecoll und Müller über den ersten Erstleseunterricht, der von ihm 1971 an der JVA Werl auf Veranlassung eines Anstaltspsychologen durchgeführt wurde (vergi, ebenda, S. 57). Er betont, daß vor der Entdeckung des Problems Analphabetismus durch die Volkshochschulen in den Vollzugsanstalten alphabetisiert worden sei. Diese Feststellung verwundert nicht, wenn man liest, daß 40 % aller erwachsenen und 70 % aller jugendlichen Strafgefangenen keinen Hauptschulabschluß haben, wie Heinz Wehrens vermerkt (vergi. Wehrens, H. in: Drecoll u. Müller, 1981, S. 85). Erinnert sei an die Thesen zu den sozioökonomischen Hintergründen des funktionalen Analphabetismus von Marie-Louise Oswald. Die Strafanstalt ist somit offensichtlich ein Ort, an dem sich aufgrund bestimmter gesellschaftlicher Selektionsmechanismen überwiegend Menschen mit einer Sozialisation wiederfinden, deren Biographien durch die Stichworte instabile Familienverhältnisse, geringe sprachliche Kompetenz, Vermeidungsverhalten beim Schriftspracherwerb und -gebrauch, Sonderschulbesuch oder Schulabbruch und schließlich Straffälligkeit miteinander verbunden sind. Wehrens berichtet von einer Tagung bundesdeutscher Anstaltspädagogen 1979, auf der von 2-3% erwachsenen und 4-5% jugendlichen Vollanalphabeten und 10-15 % erwachsenen und 25-30% jugendlichen funktionalen Analphabeten die Rede war (vergi, ebenda, S.86 f.). Wenn diese Zahlen stimmen, so müßte es, geht man von der kleinsten angenommenen Zahl von 10 % funktionalen Analphabeten aus, bei 40 000 Strafgefangenen in der alten BRD mehr als 4 000 funktionale Analphabeten in unseren Strafanstalten geben. Diese Zahl steht in einem eklatanten Gegensatz zu der Feststellung, die U. Kropp in ihrer erwähnten Untersuchung zur Alphabetisierung in der BRD machte. Sie stellte fest, daß 1985 in 31 Justizvollzugsanstalten insgesamt 50 Alphabetisierungskurse mit 265 Teilnehmern durch ge führt wurden (vergi. Kropp, U. in: Fuchs-Brüninghoff et al., 1986, S. 52). Hier ist offensichtlich ein erheblicher Bildungs- und Handlungsbedarf gegeben.
Die positive Einstellung Eberhard Hollins zur Vorreiterrolle der Elementarbildung im Vollzug teilt Wehrens, wie dieser Praktiker aus dem Sozialdienst einer Strafanstalt, offenbar nicht, denn er berichtet über die einhundertjährige Tradition der Schulen in den Strafanstalten recht kritisch. Man habe die Lernenden im Gefängnis als "minderbegabte Analphabeten mit abnormer Persönlichkeitsstruktur" angesehen. Der Unterricht sei undifferenziert und infantilisierend gewesen. Erst in den letzten 15 Jahren sei dieser Unterricht durch schulische und berufsbildende Maßnahmen abgelöst worden, in denen der Lernende ernstgenommen wird. Diese seien aber durchweg abschlußbezogen, d.h. sie führen mindestens zum Hauptschulabschluß, der Lehrplan entspricht dem der Schulen für Heranwachsende (vergi. Wehrens in: Drecoll u. Müller 1981, S.84). Wehrens sieht im "Produzieren" von Abschlüssen als einzigem Maßstab für den Sinn von Schule in der Haft zu recht eine Gefahr. Analphabeten brauchen viel Zeit, sie können das Ziel Schriftsprachkompetenz nicht in dem vorgeschriebenen Zeitraum eines Hauptschulkurses, der in Schleswig-Holstein neun Monate beträgt, erreichen. Außerdem ist das Bildungsziel Schriftsprachkompetenz für Erwachsene nicht identisch mit den Zielen und dem Fächerkanon des Haupt- oder Sonderschulabschlusses. Hans-Jürgen Eberle spricht von einer "Wende" hin zu "kompensatorischen Bildungsmaßnahmen" in den siebziger Jahren. Er beklagt, daß potentiell emanzipatorische Bildungsmaßnahmen, die als Erwachsenenbildung im eigenüichen Sinne bezeichnet werden könnten und sich mit dem wirklichen Anlaß der Bildungsarbeit, der Kriminalität, befassen, dabei völlig vernachlässigt werden (vergi. Eberle, 1980, S. 117 ff).
Wie steht es um die rechtliche Legitimation von Alphabetisierungsmaßnahmen im deutschen Strafvollzug? Am 1. Januar 1977 trat das zur Zeit gültige Strafvollzugsgesetz in Kraft. Durch dieses Gesetz sollte, so der damalige Bundesjustizminister Hans-Jochen Vogel, der Resozialisierungsgedanke im Strafvollzug in den Vordergrund treten (vergi, ebenda, S. 68). Die Funktion des Gesetzes besteht laut § 1 darin, "den Vollzug der Freiheitsstrafen in Justizvollzugsanstalten und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung" zu regeln. § 2 legt das Vollzugsziel fest: "Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Vollzugsziel). Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten "(§2 Strafvollzugsgesetz 1977). Callies und Müller-Dietz betonen, daß der Schutz der Allgemeinheit zwar die Aufgabe des Vollzuges sei, alleiniges Ziel sei aber die soziale Integration des Gefangenen, dieses habe Vorrang vor anderen Aufgaben des Vollzuges. Dies Ziel, die Befähigung des Gefangenen zu sozialer Verantwortung und einem Leben ohne Straftaten soll oberste Rechtschnur für die Gestaltung des Vollzuges sein. Callies und Müller-Dietz heben hervor, daß die frühere Konkurrenz zwischen den Behandlungszielen Resozialisierung, Sühne und Sicherheit der Allgemeinheit zugunsten der Resozialisierung aufgelöst worden sei, "soziale Sicherheit" durch "Ersatz-Sozialisation" habe Vorrang (vergi. Callies u. Müller-Dietz 1979, S. 21). Der Schutz der Allgemeinheit solle als Teilaufgabe eben durch die Hilfe zur Wiedereingliederung, nicht primär durch Verwahrung, erreicht werden. Es handle sich dabei um eine Sollvorschrift, die Organisation des Vollzuges müsse zukünftig eine "Resozialisierungsstruktur" sein. Um das Ziel der Übernahme sozialer Verantwortung zu erreichen, müsse der Gefangene im Rahmen der Behandlung "Konfliktfähigkeit und ein Potential von Konfliktlösungsstrategien erlernen" (ebenda, S. 30). Weitere Paragraphen regeln die Gestaltung des Vollzuges, so verlangt z.B. der § 3 die Angleichung des Lebens im Vollzug an die allgemeinen Lebensverhältnisse, das Verhindern schädlicher Folgen des Freiheitsentzuges, worunter u.a. das Zerbrechen familiärer Beziehungen zu sehen ist, sowie die Hilfe zur Eingliederung in das Leben in Freiheit. Das Leben des Gefangenen soll "erforscht" werden (§ 6), damit der "Vollzugsplan" erstellt werden kann (§ 7), der unter anderem Angaben über "den Arbeitseinsatz sowie Maßnahmen der beruflichen Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung" und "die Teilnahme an Veranstaltungen der Weiterbildung" enthalten muß (vergi, ebenda, S.59).
In der Öffentlichkeit waren und sind andere Paragraphen des Gesetzes, die z.B. den offenen Vollzug ermöglichen und den Hafturlaub regeln, weitaus heftiger diskutiert worden als die eben erwähnten, für das Problem des Lernens im Vollzug haben diese aber zumindest theoretisch fundamentale Bedeutung. Im § 38 Absatz 1 wird Näheres über den Unterricht in der JVA ausgesagt: " Für geeignete Gefangene, die den Abschluß der Hauptschule nicht erreicht haben, soll Unterricht in den zum Hauptschulabschluß führenden Fächern oder ein der Sonderschule entsprechender Unterricht vorgesehen werden". Ferner besagt Absatz 2: "Unterricht soll während der Arbeitszeit stattfinden" (Strafvollzugsgesetz 1977, § 1 U.2). Grunau ergänzt dazu unter "Minima" Nr. 78: "Die Verwaltung hat dem Unterricht der Analphabeten und der jungen Gefangenen besondere Aufmerksamkeit zu widmen" (Grunau 1978, S.94). Der Absatz 1 entpuppt sich bei näherem Hinsehen als weniger innovativ als Absatz 2, denn der Begriff "geeignete Gefangene" besagt, daß, so sehen es auch Callies und Müller-Dietz, kein Recht auf Schulunterricht besteht, daß die Auswahl geeigneter Personen vielmehr der Anstalt überlassen bleibt. Absatz 2 stellt aber erstmals den Unterricht auf eine Ebene mit der Arbeit im Vollzug. Während dieser bislang in der Freizeit stattfand, gibt es nunmehr Vollzeitunterricht mit Entlohnung, sicher eine bedeutende Änderung des Status der Bildungsarbeit im Strafvollzug.
Eberle beklagt, daß die Erwachsenenbildungsmaßnahmen im Gegensatz zu den zu einem Abschluß führenden Bildungsmaßnahmen nicht der Arbeit gleichgestellt seien. Er bezeichnet die Verankerung der Bildungsmaßnahmen als zu vage und sieht vor allem in der beherrschenden Rolle des Anstaltsleiters, der nach § 156 unter Berufung auf Sicherheit und Ordnung jederzeit Maßnahmen aufheben und untersagen könne, eine Relativierung des pädagogischen Anspruchs, der in § 2 postuliert wird.
Im vorliegenden Kapitel wurde zunächst belegt, daß eine große Zahl von funktionalen Analphabeten in unseren Strafanstalten einsitzt und daß nur eine kleine Anzahl von ihnen Unterricht erhält. Die Aussagen des Strafvollzugsgesetzes werden mithin nicht oder nur höchst unzureichend in die Praxis umgesetzt.
Nach diesem Blick auf das Problem, zu dessen öffentlicher Thematisierung diese Arbeit beitragen soll, wende ich mich zunächst dem Schriftspracherwerb bei Kindern zu, um später Alphabetisierungsansätze für Erwachsene auch anhand von allgemeinen Kernaussagen über Schriftspracherwerb kritisch bewerten zu können.
3. Abriß aktueller theoretischer Beiträge zur Frage des Schriftspracherwerbs
Den an der Erwachsenenalphabetisierung interessierten Leser mag es befremden, daß ich hier auf so Grundlagenspezifisches wie einige Beiträge der Psycholinguistik zur Leseforschung oder den aktuellen Stand der Diskussion um den Schriftspracherwerb in der Grundschule eingehe. Dies hat weniger damit zu tun, daß ich auch Grundschullehrer bin, als vielmehr mit der engen Verbindung, die zwischen dem Schriftspracherwerb von Grundschülern und dem von Erwachsenen besteht. Grundlagen des Schriftspracherwerbs sind in diesem Sinne per se auch Grundlagenwissen der Erwachsenenalphabetisierung. Zweifellos ist es absurd, Erwachsene mit Hilfe von Fibeln für Kinder unterrichten zu wollen, aber der Lese-und Schreiblernprozeß ist bei Erwachsenen und Kindern weitgehend identisch, Lernbedürfnisse und -ziele, Vorerfahrungen und Inhalte der relevanten Texte unterscheiden sich natürlich. Doch dazu mehr an anderer Stelle. Die Biographie funktionaler Analphabeten belegt, daß diese Menschen sich und das Lernen schon beim schulischen Schriftspracherwerb aufgegeben hatten. Sie waren Kinder mit einer schweren Lese-Rechtschreibschwäche. Ein abgebrochener oder fehlgeleiteter Prozeß muß bei der Alpabetisierung wieder aufgenommen werden, allerdings mit anderen Methoden und Inhalten. Diese Einsicht drückt sich auch in einer engen Zusammenarbeit von Expertinnen des Schriftspracherwerbs in der Schule und solchen der Erwachsenenalphabetisierung aus, die u.a. in den Veröffentlichungen und auf den Tagungen der "Deutschen Gesellschaft für Lesen und Schreiben" und der "international reading assotiation" ihren Ausdruck findet.
Das Lesen scheint auf den ersten Blick eine eher simple Fähigkeit, die sich jedoch bei näherer Betrachtung als ein höchst komplexes Miteinander von Teilfähigkeiten, Relevanzstrukturen und sprachlichen Gedächtnisresiduen entpuppt. M. J. Buno versprach in einem Büchlein aus dem Jahre 1650, Kinder und Erwachsene binnen sechs Tagen zu perfekten Lesern zu machen. Er definierte das Lesen wie folgt: "Dan es bestehet die gantze Kunst in etlich und zwantzig Buchstaben: wan ihr euch die selbige bekant gemacht und die recht zusammen zusetzen / und auszusprechen wisset / so habt ihr die Kunst schon weg und gewonnen" (Buno, M. J. zitiert nach: Gümbel 1989, S. 45). Diese einfache Erklärung entspricht dem, was man auch heute noch oft als Alltagsdefinition von Lesen vorfindet. Valentin Ickelsamer war da schon im Jahre 1527 genauer, denn er erkannte, daß man nicht durch die Namen der Buchstaben, sondern durch die Lautwerte, eben lautierend zum Lesen kommt (vergi, ebenda, S. 46). Die Buchstabiermethode, die Buno beschreibt, wurde bei uns, das heißt in Preußen, 1872 abgeschafft, seither lernten Schulkinder nach der Lautiermethode lesen. Sie bildeten aus Graphemen Phoneme und synthetisierten die Phoneme zu Wörtern zusammen, so meint man zumindest. Später trat Arthur Kerns Ganzwortmethode in Konkurrenz zur Synthese. Vor dem Hintergrund der Gesaltpsychologie meinte Kern, man müsse den Leselernprozeß mit dem Einprägen ganzer Wortgestalten beginnen, erst später sollte die optische Analyse, dann die phonemische Analyse folgen. Heutigen Leselehrgänge vertreten in der Regel eine beide Ansätze verbindende, synthetisch-analytische Methodik. Auch recht neuzeitliche Lesedefinitionen können ähnlich simpel sein wie die Bunosche: Für Gagne, einen beh avions tisch orientierten Psychologen, ist das Lesen "die Produktion von Sprachiauten und die Zuordnung von Lauten zu geschriebenen Buchstabe" (Gagne, R.M. zitiert nach: Gümbel 1989, S.46). Bei Gagne handelt es sich mithin um einen rein mechanischen Vorgang nach dem Reiz-Reaktionsprinzip. Wenn ich allen Zeichen der Buchstabenschrift den passenden Laut zuordnen kann, so lese ich. Er übersieht, daß das System unserer Laute symbolisierenden Schrift mit ihren wenigen Zeichen die vielen Laute unserer Sprache nur höchst unzulänglich wiedergibt. Denken, sprachliches Vorwissen und Kontextwissen bezieht diese Definition nicht mit ein.
Andere Forscher haben diese Dimensionen einbezogen und nachgewiesen, welche Bedeutung sprachliche Erfahrungen und Fähigkeiten und komplexe Denkvorgänge beim Lesen haben. Methodische Hilfsmittel bei der Analyse des Leseprozesses waren u.a. das Tachistoskop, ein Diaprojektor, der durch einen zehntelsekundengenau steuerbaren Verschluß die Kurzpräsentation von Buchstabenreihen, Wörtern und Sätzen zuläßt, das Verfolgen der Augenbewegungen beim Lesen und die Untersuchung von Verlesungen beim lauten Lesen. Die Verlesungen ermöglichten K. S. Goodman den Nachweis, das der Leser, auch der ungeübte Anfänger, beim Lesen eines Satzes sein Vorwissen um den Kontext und das Erkennen prägnanter Wortgestalten oder Teilgestalten Hypothesen über den Sinn von Worten bildet und mit Hilfe solcher Sinnerwartung zur Bedeutungsentschlüsselung gelangt. Goodman definiert Lesen daher als "psycholinguistisch-kognitives Probierverhalten", das ein Zusammenspiel von Sprache und Denken einschließt (vergi. Goodman, K. S. in: Schwartz, E. 1977, S. 295 ff).
Schon Wilhelm Wundt unterschied 1903 zwei Typen von Lesern, den assimilierenden, der auf der Grundlage weniger, flüchtiger graphischer Hinweise mit Hilfe von Sinnvermutungen schnell, sinnentnehmend, aber ungenau liest und den apperzipierenden Leser, der buchstabengetreu, langsam und genau, aber manchmal ohne Sinnentnahme liest (vergi. Gümbel 1989, 51). Goodman u.a. haben diese Typen von Lesern in Strategien des Lesens umgedeutet, deren sich jeder Leser zeitweise bedient. Franz Thurner, der weitgehend mit Goodman übereinstimmt, unterscheidet vier Grundtechniken des Lesens:
1. Das Ausnutzen von Sinnstützen (semantische Ebene)
Die Stilform, ein begleitendes Bild, die Überschrift oder der Leseanlaß erzeugen beim Leser eine Sinnerwartung, Das Satzfragment "in der Küche wäscht die..." läßt z.B. das Wort Mutter o.ä. erwarten. Steht im Text aufgrund eines Druckfehlers "Kutter", so liest ein Proband in der Regel dennoch wegen der Sinnerwartung "Mutter", seine Bedeutungshypothese, wie es Goodman nennen würde, lautet "Mutter" (vergi. Thurner 1977, S.47). Hier werden also nicht nur, wie Gagne meinte, Buchstabensymbole in Laute übertragen.
2. Das Ausnutzen von Regeln des Satzbaus (syntaktische Ebene)
Thurner betont, daß alle Menschen, die das System der deutschen Sprache beherrschen, also auch schon Kinder beim Erstlesen, über syntaktisches Regelwissen verfügen. So könne z.B. statt "Mutter" in dem Beispielsatz nicht "Kinder" kommen, da die Verbform "wäscht" eindeutig auf ein Subjekt im Singular verweist. Die Kenntnis der gesprochenen Sprache hilft daher als syntaktisches Regelwissen beim Erlesen ganzer Sätze. .
3. Der Rückgriff auf gespeicherte Schrift-Sinn-Assoziationen (Morphemebene)
Aus dem Streit um die Ganzwortmethode, der die Diskussion um das Lesenlernen bis in die sechziger Jahre beherrschte, ist bekannt, daß sogar ganze Wortgestalten als Sinnträger gespeichert werden können. Zwar würde heute niemand mehr befürworten, daß durch das Einprägen von Wort-Sinn-Assoziationen allein das Lesen gelernt werden solle, dennoch ist das Assoziieren von Wortgestalten, Morphemen oder Signalgruppen mit Bedeutungsgehalten ein Teilaspekt des entwickelten Leseprozesses (vergi, ebenda, S. 48). Dieser Aspekt spielt in der Morphemmethode, die später als Alphabetisierungsmethode dargestellt wird, eine Rolle. Der Begriff der Signalgruppe geht auf die Arbeit Kurt Warwels zurück, der Signalgruppen wie folgt definiert:
"Solche prägnanten Teilstrukturen (Superzeichen), die nicht nur als optische Gestaltmerkmale - determinierende oder dominierende Buchstabengruppen - hervortreten oder beachtet werden, sondern bei denen als Gedächtnisresiduen eine eindeutige Zuordnung zwischen optischer Zeichengruppe und Lautgruppe besteht, werden als Signalgruppen bezeichnet" (Warwel, K. zitiert nach: Hoppe, O. u. Baurmann, J. 1984, S. 313).
[...]
- Arbeit zitieren
- Gustaf Dreier (Autor:in), 1992, Alphabetisierung im Strafvollzug. Neue Ansätze des Schriftspracherwerbs bei Erwachsenen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138342
Kostenlos Autor werden





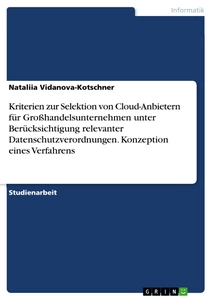






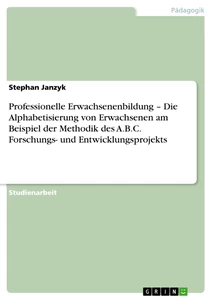









Kommentare