Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Spiel
2.1 Definitionen von Spiel
2.1.1 Scheuerls Wesensmomente
2.1.1.1 Das Moment der Freiheit
2.1.1.2 Das Moment der inneren Unendlichkeit
2.1.1.3 Das Moment der Scheinhaftigkeit
2.1.1.4 Das Moment der Ambivalenz
2.1.1.5 Das Moment der Geschlossenheit
2.1.1.6 Das Moment der Gegenwärtigkeit
2.1.2 weitere Definitionen
2.2 Funktionen des Spiels
2.2.1 Einübungs- bzw. Selbstausbildungstheorie
2.2.2 Ventilfunktion
2.2.3 Wunscherfüllung
2.2.4 Bewältigung der Vergangenheit
2.2.5 Kompensation des Sozialisationsdruckes
2.2.6 Erholung
2.3 Der Reiz des Spiels
2.3.1 Heckhausens „Aktivierungszirkel“
2.3.2 Exkurs: Flow-Modell von Csikszentmihalyi
2.4 Erwachsene und Spiel
3. Das Computerspiel
3.1 Was ist ein Computerspiel
3.1.1 Technische Merkmale
3.1.2 Verhältnis zwischen Spieler und Spielfigur
3.1.3 Zeitformen des Computerspiels
3.1.4 Systematisierung der Computerspiele nach inhaltlichen Merkmalen
3.1.5 Typologie der Computerspieler
3.2 Exkurs: Abgrenzung der Computerspiele zum klassischen Spiel und zum
Film
3.2.1 Unterschied zwischen Computerspiele und klassischen Spielen
3.2.2 Unterschied zwischen Computerspiele und Film
3.3 Interaktivität und Unterhaltung
3.3.1 Interaktivität
3.3.2 Unterhaltung
3.3.3 Erleben von klassischer und interaktiver Unterhaltung im Vergleich
3.4 Gratifikationen von Computerspielen
3.5 Modelle zur Erklärung der Zuwendung und Faszinationskraft von Computerspielen
3.5.1 Ein handlungstheoretisches Rahmenmodell unterhaltsamen Mediengebrauchs
(Klimmt)
3.5.2 Funktionsmodell des Computerspielens (Fritz)
3.6 Zusammenfassung – Motivation zur Computerspielnutzung
3.7 Mögliche Gründe für die Nicht-Nutzung von Computerspielen
4. Eigene Fragestellung
5. Empirische Untersuchung
5.1 Bisheriger Forschungsstand zu der Gruppe der Nicht-Computerspieler
5.2 Beschreibung des Untersuchungsverfahrens
5.2.1 Untersuchungsverlauf
5.2.2 Beschreibung der Stichprobe
5.2.3 Verwendete Verfahren zur Datenanalyse
6. Darstellung der Ergebnisse
6.1 Merkmale der Stichprobe
6.2 Themenbereich Freizeitaktivitäten
6.3 Themenbereich Medien
6.4 Themenbereich Computerspiele
7. Diskussion der Ergebnisse
7.1 Hypothese 1
7.2 Hypothese 2
7.3 Hypothese 3
7.4 Hypothese 4
7.5 Abschließende Erörterung der Gründe für die Nicht-Nutzung von Computerspielen
8. Grenzen der vorliegenden Arbeit und Ausblick
9. Zusammenfassung
10. Literaturverzeichnis
11. Abbildungsverzeichnis
12. Tabellenverzeichnis
13. Anhang
1. Einleitung
Die Computerspielindustrie macht jährlich Umsätze in Milliardenhöhe und steigert diese stetig (Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V.). Fast jeder Jugendliche hat bereits Erfahrungen mit dem Medium gesammelt und unter Erwachsenen nimmt das Interesse und Gefallen an Computerspielen ebenfalls zu. Somit ist die Computerspielindustrie bereits, in Bezug auf den Umsatz, mit der Filmindustrie vergleichbar. Während es der Computerspielbranche hauptsächlich um die Verkaufszahlen geht, wird in den Medien und in der Forschung eher über Gewalt und pädagogischen Nutzen von Computerspielen debattiert. Damit stehen sich zwei gegensätzliche Pole gegenüber. Auf der einen Seite die Spielindustrie, die es vermutlich sehr gern sehen würde, wenn noch mehr Menschen Computerspiele konsumieren. Auf der anderen Seite die kritischen Stimmen, die die Computerspielnutzung stark hinterfragt. Die vorliegende Arbeit soll jedoch nicht zwischen gut und böse entscheiden, vielmehr soll ein Gegenpol geschaffen werden. Damit ist gemeint, dass bisher vielseitig geklärt wurde, weshalb Computerspiele genutzt werden und ihre Nutzer so faszinieren. Doch wurde denjenigen, die keine Computerspiele spielen, bisher keine Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei wäre es so wichtig nicht nur zu verstehen, weshalb Computerspieler von dieser Tätigkeit fasziniert sind, sondern auch, weshalb manche Menschen gerade nicht davon begeistert sind. Zumal bei den Erklärungsversuchen der Computerspielmotivation oft das Bild entsteht, als ob das Spiel auf alle Nutzer die gleiche Anziehungskraft ausübt. Dies scheint jedoch ganz eindeutig nicht der Fall zu sein, wenn es trotzdem so viele Menschen gibt, die dieser Faszination widerstehen. Diese Arbeit widmet sich also der Frage nach den Gründen, die viele potenzielle Nutzer von Computerspielen dazu veranlassen, diese nicht zu spielen.
Die Untersuchung richtet sich aus diesem Grund ausschließlich an so genannte Nicht-Spieler, die zurzeit keine Computerspiele konsumieren. Sie werden zum einen direkt nach den Gründen dafür befragt, zum anderen werden ihnen Fragen zu ihrem Medien- und Freizeitverhalten gestellt, wozu auch die bisherigen Erfahrungen mit Computerspielen zählen. Ein weiteres Kriterium der Stichprobe ist, dass nur Studenten/innen an der Befragung teilnehmen, da so eventuelle Effekte, die auf den Bildungsgrad oder das Alter zurückzuführen sind, gering gehalten werden.
Der Untersuchung vorangestellt werden im theoretischen Teil dieser Arbeit zunächst Erklärungsansätze für die Faszinationskraft von Computerspielen. Daraus werden mögliche Hypothesen abgeleitet, mit deren Hilfe die Nicht-Nutzung begründet werden kann. Der Weg über die ausführliche Beschreibung der Computerspielmotivation ist nötig, da bisher keine Literatur oder Forschung die Gründe der Nicht-Spieler thematisiert hat.
Da in dieser Arbeit nur auf wenig Vorwissen bezüglich der Fragestellung zurückgegriffen werden kann, erfolgt zunächst ein Überblick über den Forschungsstand zu allgemeinen, klassischen Spielen. Darauf aufbauend folgen Erläuterungen zum Computerspiel aus technischer (3.1) und inhaltlicher (3.2 bis 3.4) Sicht, die die Erklärung der Computerspielmotivation (3.5) einleiten. Auf dieser Grundlage können Überlegungen bezüglich möglicher Gründe der Nicht-Nutzung von Computerspielen (3.7) angestellt werden.
2. Das Spiel
In diesem Kapitel sollen grundlegende Eigenschaften des klassischen Spiels erläutert werden. Dazu gehören eine allgemeine Definition (2.1), sowie die Beschreibung der Funktionen (2.2) und Reize (2.3) des klassischen Spiels. Abschließend werden die Möglichkeiten aufgezeigt, durch die das klassische Spiel auch im Leben eines Erwachsenen einen Platz findet (2.4).
2.1 Definitionen von Spiel
Über Jahrhunderte hinweg, in denen sich Wissenschaftler und Theoretiker mit dem Spielbegriff auseinandersetzten, kamen fast ebenso viele Auffassungen über den Begriff des Spiels zustande.
Das Wort wird wie ein bloßer Vereinbarungsbegriff gebraucht, der abstrahierend einen Bereich mehr oder weniger ähnlicher Erscheinungen zusammenfasst. Die Erscheinungsbereiche, aus denen die verschiedenen Theoretiker ihren jeweiligen Spielbegriff abstrahieren, decken sich dabei keineswegs. So denkt fast jeder beim Klange des Wortes Spiel an etwas anderes. (Scheuerl, 1979, S. 69)
2.1.1 Scheuerls Wesensmomente
Trotz der Unterschiede im Benutzen der Begrifflichkeit gibt es immer wiederkehrende Gemeinsamkeiten, die auf einen einheitlichen Sachverhalt deuten. Nach Scheuerl sind es folgende Wesensmomente, die das Spiel kennzeichnen:
1. Das Moment der Freiheit
2. Das Moment der inneren Unendlichkeit
3. Das Moment der Scheinhaftigkeit
4. Das Moment der Ambivalenz
5. Das Moment der Geschlossenheit
6. Das Moment der Gegenwärtigkeit
2.1.1.1 Das Moment der Freiheit
Das wichtigste Merkmal, dass das Spiel beschreibt, ist die Freiheit, die man im Spiel und bei der Tätigkeit Spielen erlangt. Auch wenn der Spielende sich an gewisse Regeln halten muss, damit der Verlauf des Spiels gesichert ist, so ist er doch im Moment des Spielens frei von den Regeln der Welt außerhalb des Spiels. Aufgrund dieser Trennung zwischen realer Welt und Spielwelt kann er bei dessen Eintritt die Sorgen und Nöte der realen Welt hinter sich lassen. Der Spielende muss sie sogar hinter sich lassen, damit er sich voll und ganz dem Spiel widmen kann und so eine „selbst- und weltvergessene Hingabe“ (Scheuerl, 1979, S. 70) erlebt. „Spiel verfolgt keinen außerhalb seiner selbst liegenden Zweck“ (Scheuerl, 1979, S. 69) Die im Spiel vollzogenen Tätigkeiten, wie z.B. einem Ball hinterher laufen oder Holzfiguren auf einem Brett bewegen, wurden nicht von der realen Welt initiiert oder ausgelöst. Sie haben auch keinen direkten Einfluss auf die reale Welt oder auf die „dem Leben förderlichen Prozesse“ (Spencer, 1886, zit. n. Scheuerl, 1979, S. 71). Ebenso sind die dem Spiel innewohnenden Tätigkeiten ohne Konsequenzen und somit auch verantwortungslos. Das Spiel unterscheidet sich somit von Betätigungen wie Arbeit und anderen Pflichten, die uns der Alltag stellt. Aber auch von Sorgen und Nöten, sowie von der Ernsthaftigkeit des Lebens ist das Spiel frei und losgelöst. Der spielende Mensch „is on vacation from reality“ (Erikson, 1965, zit. n. Scheuerl, 1979, S. 71).
2.1.1.2 Das Moment der inneren Unendlichkeit
Bislang konnte Scheuerl nur erläutern, was das Spiel nicht ist. Mit Hilfe von positiven Bestimmungsmerkmalen will er dem Wesen des Spiels nun aber auf den Grund gehen. Dazu weist er zunächst auf die psychoanalytische Auffassung vom Spiel hin. Diese geht davon aus, dass spielen nicht wirklich frei ist, sondern ein triebhafter Zwang und quasi Mittel zum Zweck, um unbewussten Bedürfnisspannungen ein Ende zu setzen. Zwar macht Scheuerl der psychoanalytischen Sichtweise Zugeständnisse: „Das Streben zum Spiel, das mit dem Streben zur Beseitigung aller Spielhindernisse identisch ist, kann in Übereinstimmung mit FREUD durchaus als triebhaft determiniert angesehen werden.“ (S. 73). Doch kann er sich den Überlegungen, dass das Spiel nicht frei ist und mit der Befriedigung der Bedürfnisse ein Ende des Spielzwangs eintritt, nicht anschließen. Vielmehr ist er der Überzeugung, dass die Spannungen des Spiels durch Wiederholungen aufrechterhalten werden sollen und demgemäß eine unendliche Ausdehnung erfolgt. „Das Spiel kann innerhalb seines Freiraums gekennzeichnet werden als ‚Bewegung von innerer Unendlichkeit’.“ (Scheuerl, 1979, S. 76). Das Spiel ist für den Spielenden selbst angenehm und eine Beschäftigung, „die man nicht beenden, sondern erhalten und immer aufs neue erzeugen will.“ (Kant, 1923, zit. n. Scheuerl, 1979, S. 74). Lediglich äußere Umstände wie Bedürfnisse oder Verpflichtungen hindern den „homo ludens“ (lat. der spielende Mensch) am Weiterspielen, weshalb er versucht, auch alltäglichen Handlungen einen spielähnlichen Zustand der „inneren Unendlichkeit“ zu verleihen.
2.1.1.3 Das Moment der Scheinhaftigkeit
Da das Spiel, wie schon beschrieben, von der Realität losgelöst ist, kann der Mensch sich dieser Scheinwelt hingeben. Kennzeichnend für diese Hingabe ist eine gewisse Leichtigkeit und Heiterkeit, welche einen Zustand des „Schwebens“ ermöglichen.
Viele Spieltheoretiker verwenden Begriffe wie Illusion und Täuschung, die laut Scheuerl dem ganzen etwas Negatives verleiht. Sie sind der Ansicht, dass diejenigen, die sich aus der realen Welt in die der Scheinhaftigkeit zurückziehen, dort einen Ersatz für mangelnde Erlebnismöglichkeiten suchen. Außerdem zeichnet sich nach deren Verständnis das Spiel durch Hin- und Herpendeln zwischen der Scheinwelt und der Realität aus.
Eine gegenteilige, positive Auffassung besagt, dass der Schein eine neue Dimension ist, die der Wirklichkeit bereichernd hinzutritt. Außerdem ist in diesem Fall kein Pendeln zwischen Schein und Realität möglich, da jeder Rückfall in die Realität das Spiel gefährdet.
Laut Scheuerl sind demnach verschiedene Ansichten mit dem Begriff des „Scheins“ verbunden und verleihen dem Wort einen doppelten Sinn. Zum einen ist das der so genannte „logische Schein“ unter dem man Begriffe wie „Illusion“, „Als-ob“ und Darstellungen oder Abbildungen von Realem zusammenfasst. Zum anderen ist der „reine Schein“ gemeint, der auch mit Begriffen wie „Bildhaftigkeit“ oder „gegenstandslos“ bezeichnet wird. „Beide Arten des ‚Scheinens’ können im Spiele gegeben sein: Der reine Schein und das illusionäre Zu-sein-Scheinen.“ (Scheuerl, 1979, S. 84). Dabei wird jedoch der „logische Schein“ meist nur zum Spielobjekt. Und diese Illusionen werden im Spiel auf der Ebene des bildhaftigen, „reinen Scheins“ irrelevant, so Scheuerl. So ist er der Meinung, „dass das Spiel in der Ebene der Bilder verbleibt, ohne in die faktische Welt der Bedürfnisse und Pflichten einzugreifen, dass es nicht ‚zur Sache’ kommt und über dem Leben schwebt, statt in ihm aufzugehen.“ (S.87)
2.1.1.4 Das Moment der Ambivalenz
Egal von welcher Seite man sich dem Wesen des Spiels nähert, so Scheuerl, in fast jeder Denk- und Forschungsrichtung trifft man auf den Begriff der Ambivalenz. Dabei kann die Doppelwertigkeit, die für das Spiel wichtig scheint, verschiedenartig interpretierbar sein. Scheuerl versucht aus phänomenologischer, philosophischer, psychologischer und biologischer Perspektive das Moment der Ambivalenz zu verdeutlichen und arbeitet dabei eine Gemeinsamkeit heraus:
„Spielen ist immer ein ‚Spielen – zwischen’. Wer von einem Wesen, einem Ding, einem Geschehnis sagt, ‚es spielt’, der sagt formal nichts anderes aus als dass es nicht entschieden festgelegt sei, … sondern dass es sich allen Richtungspolen gegenüber in einem kreisenden, pendelnden, schwebenden ‚Zwischen’ befinde.“ (S. 93)
Im Spiel kommt es vor allem auf das Gleichgewicht entgegengesetzter Tendenzen an. So kann aus einem Spiel Ernst werden oder es wird beendet, wenn aus Ambivalenz Eindeutigkeit wird. Oder wenn sich beispielsweise das Gleichgewicht im Spannungsverhältnis ändert, würde einerseits das Spiel spannungslos und endet, andererseits würden zu hohe Spannungen auftreten, die wiederum den Wunsch nach Beendigung hervorrufen. „Der ‚reine Schein’ des Spiels könnte nicht mehr ‚schweben’; er würde in sich zusammensinken und den Spieler auf die Ebene des Realen zurückfallen lassen.“ (Scheuerl, 1979, S. 91)
2.1.1.5 Das Moment der Geschlossenheit
Aus den anderen Merkmalen, so Scheuerl, lässt es sich schon auf das Merkmal der Geschlossenheit schließen. So ist z.B. das Moment der Unendlichkeit, den man sich auch als Kreisprozess mit sich ewig wiederholenden Spielhandlungen vorstellen kann, ist in sich geschlossen. Auch im Moment der Scheinhaftigkeit ist Geschlossenheit notwendig, da es eine Grenze zwischen Schein und Realität gibt. „So schließt alles Spielen Grenzsetzung ein.“ (Scheuerl, 1979, S. 94) Grenzen und Geschlossenheit sind sogar notwendig, damit das Spiel auch funktioniert, denkt man z.B. an Spielregeln, so stellen sie eine Art Begrenzung dar, welche notwendig ist, damit die Spielhandlung am Laufen gehalten werden kann. Nach Scheuerl stellen diese Regeln „Hemmungen“ dar, welche den Spieler dazu anhalten, „Maß“ zuhalten und es ihm dafür ermöglichen, den ambivalenten Schwebe-Zustand aufrechtzuerhalten. Einzig die Zeitebene ist nicht in dem Moment der Geschlossenheit mit inbegriffen, d.h. „die zeitliche Begrenztheit zwischen Anfang und Ende ist von der gestalthaften Geschlossenheit zu unterscheiden“ (Scheuerl, 1979, S. 97).
2.1.1.6 Das Moment der Gegenwärtigkeit
Scheuerl bezeichnet das Spiel auch als „stehende Bewegung“, das zwar im Moment der inneren Unendlichkeit durch pendelnde oder kreisende Bewegungen gekennzeichnet ist, aber im Moment der Gegenwärtigkeit von der real messbaren Zeit abgehoben ist.
„Es lässt ihn [den Erlebenden] alles Zeitmaß vergessen angesichts von Phänomenen, die scheinhaft in ewiger Gegenwart auf der Stelle kreisen, und die schwebend stille stehen über dem Strome der Zeit.“ (Scheuerl, 1979, S. 98)
Das Moment der Gegenwärtigkeit lässt sich laut Scheuerl auch schon im Moment der Freiheit, der Unendlichkeit und der Scheinhaftigkeit finden, selbst mit dem Moment der Geschlossenheit steht es nicht im Widerspruch.
Alles Bisherige weist darauf hin, dass sich Spiel als ein ‚Urphänomen’ verstehen lassen müsse, d.h. als ein Letztes (oder Erstes), das sich nicht mehr aus anderen Erscheinungen ableiten oder erklären lässt. … Spiel wäre das Urphänomen einer Bewegung, die durch die Ganzheit jener sechs Hauptmotive gekennzeichnet ist: durch Freiheit, innere Unendlichkeit, Scheinhaftigkeit, Ambivalenz, Geschlossenheit und Gegenwärtigkeit. (Scheuerl, 1979, S. 115)
2.1.2 weitere Definitionen
Fritz (2004) greift Scheuerls Überlegungen auf und definiert Spiel vor allem mit Gegenwärtigkeit und Lebendigkeit. Mit Gegenwärtigkeit meint Fritz ebenso wie Scheuerl das „Hier-und-Jetzt“, die Befriedigung, die ein Spiel bringt ohne jeglichen Bezug auf die Zukunft. Ein Spiel ist demnach vor allem dadurch gekennzeichnet, dass es „keiner Legitimierung in der Zukunft“ (Fritz, 2004, S. 96) bedarf. Mit Lebendigkeit beschreibt Fritz die Lebenskraft und Lebensfreude, die durch Spielprozesse zum Ausdruck gebracht werden. Möglich wird dies wiederum durch die „Funktionslust“, die dem Spielprozess innewohnt.
Karl Bühler (1927) hat den Begriff der Funktionslust geprägt und unterstützte die Auffassung vom Spiel als selbstzweckliche Tätigkeit mit der Ansicht, dass das Spiel eine Tätigkeit ist, die mit Funktionslust ausgestattet ist und ihretwegen aufrechterhalten wird. Die Lustquelle ist nach Bühler „die Tätigkeit als solche, das angemessene, glatte, reibungslose Funktionieren der Körperorgane“ (Scheuerl, 1991, S. 97). Außerdem wirke Funktionslust als „Anreiz zu immer neuer Betätigung“ (S. 97) und sei eine „entscheidende Bedingung für Wiederholungen“ (S. 97) der Spieltätigkeit.
Schlütz (2002) bündelt zwar ähnlich wie Scheuerl Kriterien für das Spiel (Freiwilligkeit, Geschlossenheit, Regelung, Zweckfreiheit, Spannung oder Ungewissheit, Fiktivität, Erfreulichkeit, Gegenwärtigkeit), doch betitelt sie nur eines davon als wirklich entscheidend. Der Aspekt der Zweckfreiheit, den Schlütz auch als Selbstzweck bezeichnet, ist ihrer Meinung nach entscheidend für jede Spielhandlung. Ähnlich wie Scheuerls Moment der Freiheit ist auch das autotelische Moment von Schlütz nicht durch außerhalb der Handlung liegende Zwecke motiviert. „Autotelisch ist eine Handlung dann, wenn sie intrinsisch motiviert, also durch sich selbst erfüllend ist.“ (S. 24). Eine durch sich selbst erfüllende Handlung wird also nur durch die reine Freude an der Handlung selbst aufrechterhalten. Um diese Freude zu erklären, greift Schlütz ebenso wie Fritz zu Bühlers Aspekt der „Funktionslust“. Um dem Wesen des Spiels gerecht zu werden, zieht Schlütz noch weitere Aspekte in ihre Definition mit ein. Somit definiert sie „Spiel als eine autotelische Handlung, die sich durch geregelte Interaktion innerhalb einer alternativ gerahmten Realität auszeichnet und ambivalenten Wiederholungs-Charakter hat.“ (S. 28). Im Grunde genommen greift sie dabei auf die von Scheuerl zusammengetragenen Momente zur Wesensbestimmung des Spiels zurück. Mit Interaktion bringt Schlütz den Aspekt des Handelns mit ein. Mit „geregelter Interaktion“ ist gemeint, dass die Handlungen, die durch vorausgegangene Handlungen beeinflusst werden, gewissen Regeln unterliegen. Wenn Schlütz von „alternativ gerahmter Realität“ spricht, dann lassen sich darin Überschneidungen zu Scheuerls Moment der Scheinhaftigkeit und Geschlossenheit finden. Sie erweitert diese allerdings um den Aspekt der Kommunikation. In der Spielwelt kommt es zu einer speziellen Art von Kommunikation, die sich von der der realen Welt unterscheidet und die Trennung von ihr so nochmals unterstreicht. Mit der Aussage, dass das Spiel einen „ambivalenten Wiederholungs-Charakter“ besitzt, drängt sich zunächst die Vermutung auf, dass darin Scheuerls Moment der Ambivalenz und der inneren Unendlichkeit wieder zu finden sind. Schlütz meint, in Anlehnung an Heckhausens „Aktivierungszirkel“, das „Wechselspiel zwischen An- und Abregung“, welches für eine „lustvolle Spannung des Spiels“ (S.29) sorgt. Dieses Spannungsverhältnis wird durch Ambivalenz aufrechterhalten. Wird aus der Ambivalenz Eindeutigkeit, ist es auch keine Spiel mehr, so hat auch Scheuerl das Moment der Ambivalenz verstanden. Die Wiederholungen des Spielprozesses sollen laut Schlütz Sicherheit verleihen. Auf diesen Aspekt geht sie nicht weiter ein, so dass an dieser Stelle nur Spekulationen über deren Sinn aufgestellt werden können. Mit Wiederholungen meint sie vermutlich der wiederholte Auf- und Abbau der Spannung im Spiel. Auch nach Scheuerls Ansicht hätten Wiederholungen den Zweck der Aufrechterhaltung des durch das Spiel entstandenen angenehmen Zustandes. Jedoch bleibt unklar, inwieweit diese Wiederholungen Sicherheit verschaffen sollen. Meiner Ansicht nach könnte es mit dem Gefühl von Kompetenz erklärt werden (im Sinne der „Funktionslust“, also des reibungslosen Funktionieren des Körpers), welches zum einen durch Wiederholungen entstanden ist und somit Sicherheit verleiht und zum anderen sich beim Spielenden durch einen angenehmen Zustand bemerkbar macht. Es könnte aber auch in Scheuerls Sinne gemeint sein, dass der Spielende durch Wiederholungen die Sicherheit darüber hat, dass auch bei der nächsten Wiederholung das angenehme Gefühl wieder eintritt.
2.2 Funktionen des Spiels
Auch wenn das Spiel als zweckfrei definiert wurde und es nur durch die Freude an der Handlung selbst aufrechterhalten wird, hat sich gezeigt, dass es unbewusste Thematiken gibt, die die Spielhandlung hervorruft. Es stellt sich nun die Frage, warum der Mensch spielt und was ihn unbewusst dazu veranlasst. So verschieden die Spieltheorien sind, so verschieden sind auch die Ansichten zur Funktion des Spiels. An dieser Stelle soll ein kleiner (wenn auch kein vollständiger) Überblick helfen, einen Eindruck dieser Vielfältigkeit zu erlangen. Dies alles sind allerdings nur Teilaspekte, die versuchen, die Wirkung des Spiels zu erklären.
2.2.1 Einübungs- bzw. Selbstausbildungstheorie
Karl Groos hat um 1900 die Ansicht vertreten, dass sowohl das menschliche als auch das tierische Spiel der Einübung und Selbstausbildung diene. Der Kerngedanke war, dass der Mensch im Spiel durch Experimentieren und Nachahmen ohne bewusste Absicht lebenswichtige Fähigkeiten auf motorischer, sensorischer, psychischer und sozialer Ebene ausbildet. Der Mensch kann so spielerisch verschiedene Handlungsstrategien einüben und sein Verhaltenspotenzial erweitern. (Fritz, 2004; Scheuerl, 1991; Schlütz, 2002)
2.2.2 Ventilfunktion
Sowohl die Überschusstheorie von Spencer als auch die Katharsistheorie von Carr sehen im Spiel eine harmlose Möglichkeit, überschüssige Kräfte auszuleben (Fritz, 2004; Oerter, 1993, 2000; Scheuerl, 1991). „Indem man spielt, ‚reinigt’ man sich vom Überschuss drängender instinktiver und triebhafter Zwänge und findet im Spielprozess ein harmloses Auslass-Ventil.“ (Fritz, 2004, S.102)
2.2.3 Wunscherfüllung
Freud (1908) ist der Ansicht, dass das Spiel dem Kind erlaubt, der Realität zu entfliehen und in der geschützten Spielwelt tabuisierte Impulse und meist aggressive Bedürfnisse auszuleben. Ohne Einschränkungen der äußeren Wirklichkeit kann das Kind nach dem Lustprinzip seine Wünsche im Spiel verwirklichen. In der psychoanalytischen Denkweise kommt dabei auch die Katharsistheorie zum Tragen, denn das Ausleben unerlaubter Triebwünsche ermöglicht ebenfalls eine „Reinigung“. (Oerter, 1993, 2000; Scheuerl, 1991)
Für Wygotski (1933) stellt das Spiel eine Lösungsstrategie des Kindes dar, welches ihm ermöglicht, seine Wünsche zu erfüllen. Diese Wünsche entstehen aus Bedürfnissen, die keine sofortige Befriedigung erfahren. Da das Kind aber noch nicht in der Lage ist, Bedürfnisse aufzuschieben und den Drang hat Wünsche, sofort zu realisieren, bietet ihm das Spiel eine Welt, in der es diese Realisierung erfahren kann. Nach Wygotski handelt es sich nicht um Einzelwünsche des Kindes, sondern meist um generelle Wünsche, z.B. groß und stark zu sein. (Oerter, 1993, 2000)
2.2.4 Bewältigung der Vergangenheit
Das Spiel dient nach Freud aber nicht nur der Wunscherfüllung, sondern auch der Bewältigung von negativen Erfahrungen. Damit erklärt er, warum ein Kind im Spiel nicht ausschließlich lustvolle Situationen inszeniert, die Freude bringen. Nachdem das Kind eine unangenehme Situation durchlebt, hat wie etwa einen Arztbesuch, versucht es, die „erlebten negativen Affekte durch wiederholtes Ausspielen der Problemsituation“ allmählich zu bewältigen (Oerter, 1993, S. 176). Möglich wird es dadurch, dass das Kind in der neu inszenierten Spielsituation eine aktive Rolle übernimmt und es so zum „Herren der Situation“ wird. (Fritz, 2004; Oerter, 1993; Schlütz, 2002)
2.2.5 Kompensation des Sozialisationsdruckes
Für manche Autoren besteht die Funktion des Spiels darin, dass die Eltern den Kindern im Spiel einen gewissen Freiraum lassen, dass das Kind dann beim Spiel eine Stärkung des Selbst erfährt und so der Sozialisationsdruck gemindert wird. Zu hoher Sozialisationsdruck entsteht, wenn Eltern durch ihre Erziehungsmaßnahmen zu „unnachgiebige Sozialisationsziele verfolgen“ (Oerter, 2000, S.57).
2.2.6 Erholung
Aus einer Zeit (18./ 19. Jahrhundert), in der Kinder schon im frühen Alter in Fabriken, im Bergbau, in der Landwirtschaft und in vielen anderen Bereichen Kinderarbeit verrichtet haben, stammt die Auffassung von Karl Groos, dass das Spiel eine Erholung von der Arbeit ist (Fritz 2004). In dieser Zeit hatte die Kindheit nicht den gleichen Stellenwert wie in heutiger Zeit, wo dem Kind in dieser Zeit Raum gegeben wird zur Entwicklung. Kinder wurden damals eher als „kleine Erwachsene“ angesehen, die schon früh an harte Arbeit gewöhnt werden sollten und mit ihrem Verdienst zum Einkommen der Familie beitrugen (Dörr, 2004).
Aber auch heute wird dem Spiel noch eine erholsame Funktion beigemessen. Sowohl im Kinder- als auch im Erwachsenenspiel können die Spielenden durch das eingangs erläuterte Moment der Freiheit entspannen.
„Erholung ist der rechtmäßige Zweck bei allem Spiel. Erholung ist Bedürfnis so wie Schlaf“ (Scheuerl, 1991, S. 28).
2.3 Der Reiz des Spiels
Die vorangegangenen Abschnitte haben sich bis jetzt damit beschäftigt, wie Spiel definiert werden kann und welche Funktionen dem Spiel zugeschrieben werden. Im Folgenden soll es darum gehen, was den Menschen am Spiel reizt.
2.3.1 Heckhausens „Aktivierungszirkel“
Bis jetzt hat sich gezeigt, dass ein Spiel eine Art Hilfsmittel ist, welches dem Spieler den Weg in eine andere Welt ebnet, in der er sich frei fühlen kann und in der seine Wünsche erfüllt werden. Welche Funktionen das Spiel hat, ohne dass es dem Spieler bewusst wird, hat sich im letzten Kapitel herausgestellt. Doch welche bewussten Anreize, nach denen sich die Spieler hingezogen fühlen, vermitteln Spiele?
Fritz (2004) hat es ganz treffend formuliert:
Oftmals ist das Leben mit seinen immer wiederkehrenden Routinen geradezu langweilig. Spielen unterbricht den täglichen Alltag, bringt Abwechslung und macht das Leben interessanter. […] Im Gegensatz zu den Routinen des täglichen Lebens erfüllt das Spiel ein lustvolles Spannungsbedürfnis der Menschen. (S.97)
Fritz (2004) greift zur Veranschaulichung zu Heckhausens „Aktivierungszirkel“. Dieser beschreibt die Prinzipien, nach welchen ein Spiel konstruiert sein muss, damit diese lustvolle Spannung erlebt werden kann. Zwei Eigenschaften sind für die Theorie des „Aktivierungszirkel“ von zentraler Bedeutung: der Aktivierungsgrad und der Aktivierungszirkel. Der Aktivierungszirkel beschreibt den Auf- und Abbau der Spannung in einem Spiel. Die Spannung steigert sich bis zum Höhepunkt, an dem die Spannung noch nicht als zu stark und bedrohlich wahrgenommen wird, und fällt dann wieder ab, um sich daraufhin erneut aufzubauen. Durch die Wiederholungen von Erregungssteigerung und Abfall entsteht eine Art Pendelbewegung, die um den mittleren Aktivierungsgrad schwingt. Der mittlere Aktivierungsgrad meint den Grad der Spannung, welcher mittig zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Extrem liegt, also zwischen Langeweile und überwältigendem Affekt. Die Kombination aus mittlerem Aktivierungsgrad und raschem Aktivierungszirkel ist laut Heckhausens Theorie ausschlaggebend für ein lustvolles Spannungserlebnis. Es gibt verschiedene „Anregungskonstellationen“, die diese Spannungen auslösen. Sie werden von Heckhausen „Diskrepanzen“ genannt und in vier Kategorien eingeteilt:
- Abweichungen: Die Diskrepanz zwischen „gegenwärtigen und früheren Wahrnehmungen“ (S. 98) vermitteln den Eindruck von etwas Neuem. Dies wiederum erzeugt Neugierde. Kann ein Spiel diese Aspekte bieten, wird es als spannend erlebt.
- Widersprüche: Spannung wird auch erzeugt durch die Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Erwartung, welche Überraschungen verursacht.
- Unstimmigkeiten: Ein weiterer Spielreiz stellt das Gefühl von Verwickeltheit dar, das sich beim Spieler dadurch bemerkbar macht, dass seine Aufmerksamkeit erhöht ist. Er versucht Zusammenhänge zu erkennen und will schließlich auf das Spielgeschehen Einfluss nehmen. Verwickeltheit entsteht aus der Diskrepanz „zwischen Teilen des gegenwärtigen Wahrnehmungsfeldes“ (S. 98).
- Unterschiede: Diskrepanzen zwischen verschiedenen Erwartungen führen dazu, dass der Spieler im Ungewissen über den Ausgang des Spiels ist. Es weiß nicht, ob er das Spiel bewältigen oder am Ende doch scheitern wird. Die Unsicherheit darüber erzeugt wiederum Spannung, die bei „mittlerem Ungewissheitsgrad“ als lustvoll erlebt wird.
Die Beschaffenheit eines Spiels, bei dem lustvolle Spannung beim Spieler erzeugt wird, fasst Fritz wie folgt zusammen: „Es muss die Neugierde ansprechen, Überraschungen bieten, Problemlösungsverhalten stimulieren oder Momente von Ungewissheit und Risiko enthalten“ (S.98).
Die Struktur eines Spielkonstruktes, das mit Hilfe der erzeugten Spannung dazu in der Lage ist, die Menschen aus ihren alltäglichen Routinen heraus zu holen und ihnen Abwechslung verschafft, ist durch Heckhausens Aktivierungszirkel beschrieben. Der Mensch sucht also nach lustvoller Spannung, um aus seinem Alltag zu entfliehen. Diese findet er im Spiel. Welchem Spiel er sich zuwendet, hängt davon ab, welche Wünsche und Erwartungen er an das Spiel stellt und wie das Spiel ihm entgegenkommt. Doch wodurch ist zu erklären, weshalb sich Menschen immer wieder denselben Spielkonstrukten zuwenden, ohne daran den Spaß zu verlieren?
Wer sich auf ein wirkliches Spiel einlässt, der will doch mit seinen Tätigkeiten auch etwas gelingen lassen: der Ball soll treffen, der Kreisel soll tanzen, Mozarts Rondo soll erklingen – und zwar so flüssig und frei, so schwebend und abgehoben von allen Tätigkeiten des Geigens und Zupfens und Schlagens, dass das Tun unwichtig wird, vergessen werden kann hinter der faszinierenden Bewegungsgestalt. (Scheuerl, 1991, S. 208)
Diese Aussage von Scheuerl lässt annehmen, dass Spiele im Allgemeinen etwas beim Spielenden auslösen, das sie dazu bewegt, die Tätigkeit fortzuführen. Dabei scheinen die Bewegungen dann automatisch und unbewusst abzulaufen, was bei der spielenden Person auf irgendeine Art Faszination und Freude auslöst. Spiel ist, wie schon in Scheuerls Definition erläutert, vor allem durch den Aspekt der Zweckfreiheit gekennzeichnet. Auch wenn die Tätigkeit „etwas gelingen lassen soll“, verfolgt sie keinen Zweck, der außerhalb der Tätigkeit liegt. Sie wird meist auch nicht durch externe Belohnungen motiviert. Solche Tätigkeiten, die nur sich selbst zum Zweck haben, werden auch als autotelische Aktivitäten bezeichnet. Da die Zweckfreiheit für das Spiel von zentraler Bedeutung ist, ist es auch von großer Wichtigkeit zu verstehen, welche Motivation dahinter steht. Mit Caillois’ Kategoriensystem und Fritz’ Modell der Reizkonfiguration von Spielkonstrukten konnte ein Überblick gegeben werden, welche Bedürfnisse autotelische Aktivitäten befriedigen können. Weshalb autotelische Aktivitäten intrinsisch belohnend sind, wird mit dem Flow-Konzept von Csikszentmihalyi am besten erklärt. Für Spiele ist die Erklärung von Flow-Erlebnissen besonders wichtig, da sie laut Csikszentmihalyi (1992) exemplarische Flow-Aktivitäten darstellen.
2.3.2 Exkurs: Flow-Modell von Csikszentmihalyi
Im Versuch, die Motivation eines Menschen zu erklären, gab es im Laufe der Zeit die verschiedensten Ansichten aus unterschiedlichen Richtungen, die veranschaulichen sollten, weshalb sich der Mensch einer bestimmten Tätigkeit hingibt. Die Erklärung für eine lustvolle Tätigkeit wird beispielsweise von manchen Psychologen als bloße Bedürfnisbefriedigung dargestellt. Im Behaviorismus hingegen legte man Tätigkeiten, bei dem der Mensch Freude empfindet, das Reiz-Reaktions-Paradigma zugrunde. Es besagt, dass das Malen eines Bildes oder das Schachspielen zu einer belohnenden Tätigkeit wird, „weil jeder Schritt des Prozesses mit einem ursprünglich belohnenden Stimulus verknüpft wird“ (Csikszentmihalyi, 1992, S. 27). In der Psychoanalyse wiederum wird vor allem damit argumentiert, dass kreatives Verhalten oder Freude auf „versteckte Manifestationen eines Konfliktes zwischen instinktiven Grundbedürfnissen und sozialen Zwängen“ (Csikszentmihalyi, 1992, S. 27) zurückzuführen sind. Für Csikszentmihalyi (1992) waren diese Erklärungen allerdings nicht zufrieden stellend, da sie nur Sinn ergeben, wenn eine ganze Reihe von Annahmen erfüllt ist. So ergibt sich z.B. die Frage, warum gerade mit einem so komplexen Spiel wie Schach ein libidinöses Bedürfnis befriedigt wird und nicht mit etwas weniger aufwendigem. Sein Ziel war es in Ergänzung zu den bestehenden Modellen ein neues Modell zu entwickeln, welches die Freude einer Tätigkeit im Augenblick der Ausführung erklärt. Die Freude versteht Csikszentmihalyi „nicht als Kompensation für vergangene Wünsche, nicht als Vorbereitung für zukünftige Bedürfnisbefriedigungen, sondern als laufenden Prozess, welcher in der Gegenwart eine lohnende Erfahrung darstellt“ (S. 29). Das Modell soll der Frage auf den Grund gehen, weshalb Aktivitäten ohne äußere Belohnung etwa durch Geld trotzdem mit meist großer Anstrengung ausgeübt werden. Bei diesen autotelischen Aktivitäten kommt es scheinbar zu einer intrinsischen Belohnung, die darin besteht, dass die Tätigkeit an sich lohnend ist. Es gibt verschiedene Gründe, aus denen heraus autotelische Aktivitäten ausgeübt werden. Zu den häufigsten Gründen gehört, dass sich einem durch diese Aktivität eine Welt erschließt, in der man Freude empfindet und dass man bei der Ausführung der autotelischen Aktivität seine persönlichen Fähigkeiten entwickeln kann.
In seinem Modell spricht Csikszentmihalyi von „flow“, welches gleichbedeutend ist mit „autotelischem Erleben“.
Autotelisches Erleben ist ein psychologischer Zustand, der auf konkretem Feedback beruht und insofern als Verstärkung wirkt, als er in Abwesenheit anderer Belohnungen das Verhalten andauern lässt. (Csikszentmihalyi, 1992, S. 44)
Der Flow-Zustand ist nach Csikszentmihalyi gekennzeichnet durch ein Gefühl des völligen Aufgehens in der Tätigkeit, bei dem ohne bewusste Eingriffe und Mühe Handlung auf Handlung folgt und somit ein Gefühl des Fließens entsteht.
An einigen Stellen ist die Ähnlichkeit mit der Definition von Spiel erkennbar. In der Tat ist Spiel auch exemplarisch für Flow-Aktivitäten. Dieser Zusammenhang zwischen Spiel und Flow zeigt auch wie wichtig es ist, bei der Beschreibung von Spiel und seinen Reizen auf das Flow-Modell von Csikszentmihalyi einzugehen.
Csikszentmihalyi (1992) nennt sechs Elemente aus denen sich Flow-Erlebnisse zusammensetzen:
1. Wenn Handlung und Bewusstsein „verschmelzen“, ist dies ein sehr deutliches Zeichen von Flow. Damit ist gemeint, dass der Handelnde seine Handlungen bewusst erlebt, aber nicht den Bewusstseinsakt selbst reflektiert. Unterbrechungen diesen Zustandes treten auf, wenn der Handelnde sich „von außen“ betrachtet und darüber nachdenkt, was er tut und ob er dies richtig macht. Die Verschmelzung ist allerdings nur dann möglich, wenn die Anforderungen der Aufgabe mit den Fähigkeiten der Person in Balance sind, d.h. die Aufgabe muss zu bewältigen sein, darf aber auch nicht zu leicht sein.
2. Als weiteres Element von Flow-Erlebnissen und Voraussetzung für das Verschmelzen nennt Csikszentmihalyi die „Zentrierung der Aufmerksamkeit auf ein beschränktes Stimulusfeld“ (S. 64). Der Handelnde muss sich ganz und gar auf seine Handlung konzentrieren und darin aufgehen. Dazu müssen jegliche Störsimuli wie z.B. Gedanken über die Vergangenheit, Zukunft oder Resultate, Belohnungen oder Wirkungen der Handlung ausgegrenzt werden.
3. Damit hängt auch das dritte Merkmal von Flow, die so genannte „Selbstvergessenheit“ zusammen. Dadurch, dass der Handelnde seine volle Aufmerksamkeit auf die Handlung lenkt und weder durch Gedanken über sich selbst oder die Zukunft gestört wird, ist es ihm möglich, für die Zeit, in der er Flow erlebt, das Bewusstsein über seinen Körper zu intensivieren und sein Selbst-Konstrukt zu verlieren. Das Selbst-Konstrukt kann verloren gehen, weil es bei Flow-Aktivitäten (wie Spiele oder Sportarten) festgelegte Regeln gibt, die jeder Teilnehmer akzeptiert. Es ist in dieser Situation nicht notwendig, dass das Selbst in seiner Hauptfunktion tätig wird, d.h. dass es zwischen den eigenen Bedürfnissen und den Erwartungen anderer vermittelt, oder dass Rollen und Vereinbarungen zwischen den Teilnehmern ausgehandelt werden.
4. Aufgrund der Übereinstimmung von den eigenen Fähigkeiten mit den Anforderungen der Handlung erfährt der Handlende ein Gefühl von Kontrolle über sich, über seine Handlungen und selbst über die Umwelt („Ich habe dann ein Gefühl, als könnte ich Energie in die Atmosphäre ausstrahlen […]. Ich weiß nicht, ob es gewöhnlich eine Kontrolle der Atmosphäre ist. Die Atmosphäre und ich werden eins.“ (Csikszentmihalyi, 1992, S. 69)). Dieses Kontrollgefühl hat positive Auswirkungen auf das Selbstkonzept und ermöglicht eine Sorgenfreiheit in Bezug auf Gefahren oder eventuellen Kontrollverlust während der Flow-Situation.
5. Die Zentrierung auf ein eingeschränktes Stimulusfeld ermöglicht eine weitere Eigenschaft von Flow: An den Handelnden werden eindeutige Handlungsanforderungen gestellt und es erfolgen genauso eindeutige Rückmeldungen. Bei den Flow-Aktivitäten sind gewisse Regeln vorgegeben, die der Handelnde akzeptiert und die ihm eindeutige Handlungsanforderungen stellen. Die Kenntnis der Regeln ermöglicht dem Handelnden auch die Ergebnisse seiner Handlung zu überblicken. Da allerdings die Handlung und die Reaktion, also die Rückmeldung, durch Übung schon automatisch ablaufen, ist der Flow nicht gestört.
6. Das letzte Element, das Flow-Erlebnisse kennzeichnet, ist dessen autotelisches Wesen. Csikszentmihalyi meint damit, dass Flow-Aktivitäten keine Ziele und Belohnungen außerhalb der Tätigkeit benötigen. Einzig die Aktivität an sich ist die Belohung und Ziel ist es, im Flow zu bleiben.
Alle diese Elemente hängen zusammen und bedingen sich gegenseitig. Csikszentmihalyi bringt es auf dem Punkt, indem er zusammenfasst:
Dank der Einschränkung des Stimulusfeldes ermöglicht eine flow -Aktivität dem Ausübenden, seine Handlungen zu konzentrieren und Ablenkungen außer Acht zu lassen. Dies führt zum Gefühl der potentiellen Kontrolle über die Umwelt. Weil flow -Aktivität klare und widerspruchsfreie Regeln aufweist, erlaubt sie ein vorübergehendes Vergessen der eigenen Identität mit allen damit verbundenen Problemen. Das Ergebnis all dieser Faktoren ist, dass man den Prozess intrinsisch belohnend findet. (Csikszentmihalyi, 1992, S. 74)
Die Menschen unterscheiden sich hinsichtlich des Flow-Erlebens nicht nur darin, wie schnell oder wie einfach es ihnen fällt, Flow zu erleben, sondern auch bei welchen Aktivitäten sie Flow empfinden. Allen Flow-Aktivitäten gemein ist allerdings, dass sie ein Gleichgewicht zwischen den Handlungsmöglichkeiten und den Fähigkeiten der Person darstellen und somit der handelnden Person eine optimale Herausforderung bieten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Der Flow-Kanal, http://www.psych.uni-potsdam.de/people/rheinberg/files/FlowErlebenVortrag/sld007-a.html (Zugriff am 12.11.07)
Wie in der Abbildung 1 zu erkennen ist, stellt sich bei einem Ungleichgewicht kein Flow ein. Übersteigen die Fähigkeiten einer Person die Handlungsanforderungen der Situation, so tritt Langeweile ein. Sind allerdings die Anforderungen höher als die Fähigkeiten der Person, betrachtet sie die Situation mit Sorge und empfindet die Spannung als Angst. Jedoch muss angemerkt werden, dass es sich dabei um die subjektive Wahrnehmung der Person handelt, also wie sie persönlich ihre individuellen Fähigkeiten einschätzt und wie hoch sie die Anforderungen der Situation empfindet. Das Flow-Erlebnis hängt somit nicht von den objektiven Bedingungen ab, sondern von der Fähigkeit der Person, die eigene Umwelt so umstrukturieren zu können, dass ein Flow-Erlebnis möglich wird. Besteht also ein Ungleichgewicht, ist es dem Handelnden auch möglich, wieder in den „Flow-Kanal“ zurückzukehren. Befindet sich die Person im Zustand der Sorge oder Angst, kann sie entweder die Anforderungen senken oder die Fähigkeiten steigern. Fühlt sie sich jedoch gelangweilt, muss sie den Anforderungsgehalt erhöhen oder ihre Fähigkeiten durch selbst auferlegte erschwerte Bedingungen senken. (Csikszentmihalyi, 1992)
2.4 Erwachsene und Spiel
Oerter (1993, 2000) hat sich im Zuge seiner Arbeiten zum Thema Spiel auch mit der Transformation des Spiels beschäftigt. Oerter versteht das Spiel als Lebensbewältigung sowohl für das Kind, das noch keine anderen Formen der Lebensbewältigung als das Spiel kennt, als auch für Erwachsenen. Im Erwachsenenalter wird jedoch das Spiel transformiert, so dass es eine andere Form der Bewältigung annimmt. Da wäre zum einen die Religion, die von Oerter (2000) als „Bewältigungsversuch angesichts des Bewusstseins von Zeitlichkeit und Endlichkeit des Daseins“ (S. 53) gedeutet wird. Ein anderer Weg der Transformation des kindlichen Spiels geht in die Richtung Kunst. Das künstlerische Schaffen, zu dem Oerter bildnerische Darstellung, Sprachproduktion, Singen und dramaturgische Gestaltung zählt, bildet sich zum einen schon spontan im kindlichen Spiel aus, andererseits wird es aber auch durch die Kultur dem Kind vorgelebt, wodurch es wiederum angeregt wird. Eine andere Art der Transformation des Spiels sieht Oerter in der Integration von Spielelementen in der Arbeitstätigkeit, da sich Spiel und Arbeit parallel zueinander entwickeln und sich Spiel im Erwachsenenalter nicht in Arbeit umwandelt. „Immer dann, wenn Arbeit über die Lebensfristung hinaus interessant und fesselnd wird, enthält sie auch Elemente des Spiels“ (Oerter, 2000, S. 53). Oerter (1993, 2000) zieht dabei Csikszentmihalyi’s Beobachtung von Flow in Arbeitsaktivitäten heran, die in ihrer Charakteristik den des Spiels gleichen. Flow-Erlebnisse können also sowohl im Spiel als auch in der Arbeit stattfinden. Daraus schlussfolgert er, dass Erwachsene in der Lage sind, Elemente des Spiels in die berufliche und außerberufliche Arbeitstätigkeit zu integrieren. Der Vorteil von Arbeit, die im Erleben dem Spiel gleicht, ist, dass Anstrengung und Stress als weniger belastend empfunden werden und dass die Tätigkeit als sinnstiftend und somit als lebensbewältigend interpretiert werden kann. (Oerter, 1993, 2000)
Neben der Transformation des Spiels sieht Oerter (1993) auch noch die Institutionalisierung des Spiels als mögliche Form von Spiel bei Erwachsenen. Im Gegensatz zur Transformation verwandelt sich das Spiel im Laufe des Heranwachsens nicht in etwas anderes, sondern wird von anderen Tätigkeiten abgegrenzt. Sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich findet diese Abschirmung statt. Die Institutionalisierung im Öffentlichen findet man meist bei Regelspielen, die durch Wettkämpfe, wie z.B. Turniere oder Weltmeisterschaften von Sportspielen charakterisiert sind. Für den Einzelnen heißt das, dass er die Spiele konsumiert, gegebenenfalls sogar als Fan einer Subkultur angehört oder auch aktiv den Sport in einer Gruppe Gleichgesinnter betreibt. Eine ähnliche Institutionalisierung ist auch im privaten Bereich zu sehen. So werden Sportaktivitäten wie Radfahren, Skifahren, Bergsteigen oder ähnliches von anderen Tätigkeiten des Alltagslebens isoliert, um sie vom Arbeitsleben herauszulösen und als Freizeit zu kennzeichnen. Diese Freizeitsportaktivitäten sind hauptsächlich durch das sensomotorische Spiel charakterisiert und werden meist unter dem Aspekt der Gesundheitsförderung betrachtet. (Oerter, 1993)
Das Spiel im Erwachsenenalter kann also verschiedene Formen annehmen. Es kann sich zum einen weiterentwickeln, so dass nur noch Elemente des Spiels erkennbar sind. Zum andern kann es in Form von Regelspielen weiter bestehen, wobei es jedoch als eigene Domäne von anderen Lebensbereichen getrennt wird. Die dritte Möglichkeit, die Oerter (Oerter, 1993) für das Spiel im Erwachsenenalter aufzeigt, ist, dass das Spiel im Privaten genauso weiter betrieben wird wie es in der Kindheit getan wurde. Dazu zählen Würfel- und Kartenspiele oder auch Gesellschaftsspiele, welche meist in Gruppen mit anderen zusammen gespielt werden. Aber auch das Ausleben eines Hobbys zählt Oerter zu dieser privaten Form des Erwachsenenspiels, welchem vorzugsweise allein nachgegangen wird und allenfalls durch „Kontakt mit Hobbyfreunden auch soziale Elemente“ (S.315) enthält. (Oerter, 1993)
3. Das Computerspiel
Das vorangegangene Kapitel hat sich mit dem klassischen Spiel beschäftigt. Das Spiel wurde anhand verschiedener Merkmale definiert und es wurde auf die Funktion und den Reiz von Spielen eingegangen. Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit den technischen und inhaltlichen Spezifika des Computerspiels. Es wird sich zeigen, dass das Computerspiel als eine Sonderform des allgemeinen, klassischen Spiels angesehen werden kann und deshalb der Großteil dessen, was im vorangegangenen Kapitel zum Spiel erläutert wurde, auch auf das Computerspiel übertragbar ist. Da sich das Computerspiel auch in mancher Hinsicht vom klassischen Spiel unterscheidet, müssen zusätzliche Erweiterungen vorgenommen werden, die aus dem Unterhaltungsbereich entnommen und dem Computerspiel angepasst werden.
3.1 Was ist ein Computerspiel
Computerspiele, Konsolenspiele, Videospiele, Arcade-Spiele, Bildschirmspiele – es gibt viele Bezeichnungen und verschiedene Arten. Trotzdem sind Computerspiele im Grunde Spiele wie sie im vorherigen Kapitel definiert worden sind. Auf sie treffen ebenfalls Scheuerls Aspekte des Spiels zu: Videospiele sind ebenfalls Zweckfreiheit, erfordern ständige Wiederholungen von Handlungsmustern, bieten die Möglichkeit einer anderen Realität/Scheinwelt, bewirken ambivalente Gefühle von An- und Entspannung, Geschlossenheit liegt in Form von Regeln und der Grenze zwischen Computerspiel und Realität vor, der Sinn und Zweck des Computerspiels liegt in der Gegenwart, also im Moment, in dem es gespielt wird. Zudem ist der Zeitverlauf im Computerspiel anders als in der Realität. Um ein Computerspiel beherrschen zu können, muss der Spieler genau wie bei anderen Spielen erst einmal bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernen (z.B. Umgang mit dem Gerät, Bedienung, Steuerung der Spielfiguren etc.). Beherrscht er diese, nutzt der Bildschirmspieler das Videospiel aus verschiedenen Gründen und zu unterschiedlichen Anlässen. Auch bei medienvermittelten Spielen können Funktionen, wie sie beim allgemeinen Spiel beschrieben wurden (Ventilfunktion, Wunscherfüllung, Entspannung etc.), unbewusster oder auch bewusster Anreiz sein, diese zu nutzen. Das Computerspiel verschafft demjenigen, der es spielt, ebenfalls lustvolle Spannung wie es durch Heckhausens Aktivierungszirkel beschrieben wurde. Fritz’ Reizkonfigurationen treffen im vollen Umfang auch auf Bildschirmspiele zu und das Flow-Modell von Csikszentmihalyi erklärt ebenfalls einen großen Teil der Faszination von Computerspielen. So gesehen ermöglicht das Computerspiel dem Nutzer, ein Spiel im Sinne der Ausführungen des vorherigen Kapitels zu spielen. Somit ist das Computerspiel „nur“ eine weitere Form des Spiels. Ein Spiel, das statt mit Hilfe eines Spielbretts und Holzfiguren mit einen Bildschirm und Tasten bedient wird. Und doch scheinen Welten zwischen einem klassischen Spiel und einem Videospiel zu liegen. Es ist also vonnöten, einen Blick auf das Computerspiel zu werfen, um sich ein Bild von dieser Welt zu machen und darauf aufbauend die Faszination, die davon ausgeht, erklären zu können.
3.1.1 Technische Merkmale
Hartmann (2006) beschreibt Computerspiele in technischer Hinsicht wie folgt:
Sie alle liegen in Form einer elektronischen Software vor, die auf einer bestimmten Computerplattform installiert ist, welche wiederum mittels unterschiedlicher Eingabegeräte getätigte Nutzereingaben verarbeiten kann und als Reaktion darauf über die audiovisuellen bzw. haptischen Darstellungsmöglichkeiten des Computersystems ein Feedback generiert. (S. 113)
Fritz (2003b/2004/2005) beschreibt das Computerspiel etwas detaillierter und unterscheidet diese Art des Spiels nach vier Geräteformen: Arcade-Games, Computerspiele, Video- oder Konsolenspiele und tragbare Videospiele. Zu den Arcade-Spielen gehören Spielautomaten in Spielhallen, auf denen man gegen Münzgeld actionreiche Spiele spielen kann. Computerspiele hingegen werden auf Computern gespielt (Personal-Computer oder AppleMacintosh) und mittels CD-Rom als Software vertrieben (ältere Spiele sind in Form von Disketten erhältlich, neue Spiele dagegen immer öfter im DVD-Format). Spielkonsolen stellen die Hardware von Video- oder Konsolenspiele dar. Sie sind eigens für den Spielgebrauch konstruiert worden und müssen an den Fernseher angeschlossen werden. Das Videospiel wird in Form von Steckmodulen, CD-Roms, DVDs oder seit neuem auch in Form von Blu-ray Discs auf der Konsole gespielt. Führende Hersteller sind Nintendo, Sony und Microsoft. Tragbare Videospiele sind kleine, handgerechte Spielkonsolen mit eingebautem Bildschirm, Lautsprecher und Stromversorgung, wie z.B. die PlayStation Portable oder der Gameboy und seine Nachfolger. Spiele werden nur in das Gerät gesteckt und schon kann es an jedem beliebigen Ort gespielt werden.
In der vorliegenden Arbeit soll im weiteren Verlauf darauf verzichtet werden, eine exakte Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten von Computerspielen vorzunehmen, da es für diesen Rahmen nicht von Belangen ist. Deshalb werden im Folgenden die Begriffe Computerspiele, Videospiele, Bildschirmspiele usw. synonym verwendet.
Neben den verschiedenen Geräteformen gibt es noch weitere technische Eigenschaften, die allen Computerspielen zu Grunde liegen, egal auf welcher Hardware sie gespielt werden. Dazu zählen beispielsweise die Grafik und der Sound, die laut Fritz (2005) wichtige Informationsquellen für den Spieler darstellen. Durch die Wahrnehmung von Bild- und Toninformationen wird es dem Spieler ermöglicht, sein Handeln auf diese Informationen abzustimmen. Aufgrund des immer weiter schreitenden technischen Fortschritts und der unterschiedlichen technischen Möglichkeiten der verschiedenen Geräteformen kommt es zu sehr unterschiedlichen Qualitäten bezüglich der Grafik eines Computerspiels. Die beweglichen Objekte eines Computerspiels heben sich von dem unbeweglichen Grafikhintergrund ab. Die grafischen Bewegungselemente bilden für den Spieler Figuren, mit dessen Hilfe er die Zusammenhänge und Regeln des Computerspiels erkennen kann. Ein weiterer Bestandteil der optischen Informationsausgabe stellen Grafiken dar, welche auch in anderen Computeranwendungen auftauchen, wie z.B. Menüleisten, Texte oder Tabellen. Akustische Signale, wie Musikuntermalungen, Geräusche oder Sprecherstimmen ergänzen die Grafik und haben die Funktion der Untermalung oder Spannungssteigerung. Durch die Geschehnisse auf dem Bildschirm kann der Spieler die Bedeutungen und Funktionen der Spielfiguren in Bezug setzen und lernt diese zu strukturieren. Hat der Spieler die Wirkzusammenhänge und Funktionsabläufe erkannt, kann er durch sein Handeln Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen. Dies geschieht mittels Steuerung der Spielfigur durch Betätigung von Gamepad, Tastatur, Maus oder Joystick. Fehlt allerdings eine Spielfigur, die als „elektronische Marionette“ Handlungsbefehle des Spielers ausführt, nimmt der Spieler stattdessen Einfluss auf gesamte Handlungszusammenhänge, wie z.B. bei Denk- oder Strategiespielen. Fritz (2005) unterscheidet die Einwirkungsmöglichkeiten danach, ob sie das Spiel unmittelbar oder mittelbar beeinflussen und ob die Lenkung direkt oder indirekt erfolgt. Seinen Angaben nach ist ein „Prügelspiel“ direkt und unmittelbar, da die Spielfigur eine Bewegung sofort (unmittelbar) und nach der Festlegung des Spielers (direkt) ausführt. Ein Strategiespiel hingegen ist mittelbar und indirekt, wenn man davon ausgeht, dass durch die Auswahl über Menüs die Reaktion zeitlich verzögert stattfindet und es kein direkter Bewegungsbefehl ist, sondern nur ein indirekter Handlungsbefehl, da sich die ausgewählten Einheiten selbstständig bewegen. Natürlich kann ein Computerspiel auch durch andere Kombinationen der Dimensionen direkt/indirekt und unmittelbar/mittelbar gekennzeichnet sein.
3.1.2 Verhältnis zwischen Spieler und Spielfigur
Sowohl die Art der Einwirkung auf das Spielgeschehen als auch der Spielinhalt haben Einfluss auf das Verhältnis von Spieler und Figur. Fritz (2004) beschreibt sechs Formen dieser Beziehung:
1. Sensumotorische Synchronisierung meint, dass die Spielfigur als „elektronische Marionette“ vom Spieler gelenkt wird, indem er direkt und unmittelbar auf die Figur bzw. auf deren Körperbewegungen einwirkt. Dabei kommt es laut Fritz zu einer „Erweiterung des Körperschemas“ (S. 245) seitens des Spielers, da dieser gefordert ist, die Bewegungen im virtuellen Raum auszuführen.
2. Die simulative Synchronisierung ist vergleichbar mit der sensumotorischen Synchronisierung. Nur lenkt der Spieler in diesem Fall keine Figur, sondern ein virtuelles Fahrzeug durch direkte und unmittelbare Steuerungsimpulse. Da das Fahrzeug keine Stellvertreterposition einnimmt, fühlt sich der Spieler als Fahrer des Fahrzeuges, der „im Bildschirm drin“ (S. 245) durch die virtuelle Landschaft fährt.
3. Mit der sensumotorischen Identifikation ist zwar auch ein direktes und unmittelbares Einwirken gemeint, jedoch nicht mehr auf eine Spielfigur, die die vom Spieler erteilten Befehle synchron umsetzt. Vielmehr sieht der Spieler das Spielgeschehen aus dem Blickwinkel der Figur. Diese Kameraperspektive vermittelt den Eindruck, dass nicht mehr nur eine Spielfigur gelenkt wird, sondern dass der Spieler quasi selbst agiert.
4. Die direktionale Identifikation umschreibt die Beziehung des Spielers zur Spielfigur, bei der durch indirekte und unmittelbare oder mittelbare Lenkung nicht auf die Bewegungen der Figuren direkt Einfluss genommen wird. Die Spielfiguren bekommen vom Spieler Befehle, nach denen sie sich eigenständig bewegen. Eine mögliche Verschmelzung findet hier nicht zwischen Spieler und Figur statt, sondern betrifft die Spielumgebung, die er geschaffen hat.
5. Eine rezeptive Identifikation findet bei Computerspielen nur in Eingangs- oder Zwischensequenzen statt. In solchen Sequenzen werden dem Spieler filmartige Szenen vorgespielt, auf die er keinen Einfluss nehmen kann, er kann sie nur rezipieren. Mit Hilfe dieser Szenen soll dem Spieler u.a. der Inhalt, die Geschichte und die Personen vertraut gemacht werden. Der Spieler kann darauf mit größerer Spielmotivation und stärkerer Identifikation mit den gezeigten Personen, Geschichten und Inhalten reagieren. Außerdem empfinden viele Spieler solche Szenen als sinnvoll oder als Belohnung für erfüllte Anforderungen.
6. Die semantische Identifikation bezeichnet die Identifikation des Spielers mit dem Spielinhalt. Diese Identifikation kann soweit gehen, dass man anmuten könnte, dass der Spielinhalt für ihn auch eine Bedeutung in der realen Welt hat. Ermöglicht wird es dadurch, dass das Spiel dem Spieler den Eindruck vermittelt, er würde menschliches Verhalten in sozialen Situationen mit der Spielfigur simulieren.
3.1.3 Zeitformen des Computerspiels
Computerspiele können laut Fritz (2004/2005) auch noch mal hinsichtlich der Zeit in zwei Gruppen eingeteilt werden. Zum einen gibt es den Realtime-Modus, der auch als Echtzeit bezeichnet wird. Bei Spielen dieser Art wird der Spieler „gezwungen“, innerhalb dieses Zeitrahmens ohne Verzögerung zu handeln, was auch bedeuten kann, dass der Spieler dadurch unter Zeitdruck gerät. Zum anderen gibt es den Turn-Modus. Bei diesem Spiel ist die Zeiteinteilung rundenbasiert, d.h. die Spielzeit wird zwischen den Runden angehalten, so dass der Spieler genügend Zeit hat, seine Handlungen zu planen. Bei der Ausführung seiner Entscheidung läuft die virtuelle Zeit weiter, in der die Auswirkungen seiner Handlung sichtbar werden.
Mit Hilfe der Speicherfunktion hat der Spieler die Möglichkeit, schwierige Spielabschnitte bis zu deren Bewältigung beliebig häufig zu wiederholen.
3.1.4 Systematisierung der Computerspiele nach inhaltlichen Merkmalen
Nach diesem Überblick über die technischen Besonderheiten des Computerspiels folgt nun ein kurzer Abriss der inhaltlichen Ebene, d.h. welche Elemente im Computerspiel auftauchen. Die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Reizkonfigurationen sind auch auf Bildschirmspiele übertragbar, dennoch gibt es auf wissenschaftlicher Seite mehrere Versuche eine Systematisierung der Computerspiele vorzunehmen. Fritz (2003a) schlägt zunächst eine „Landkarte“ mit drei grundlegenden Spielelementen vor, die einen Beitrag zum Motivierungspotential der Spiele leisten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Landkarte der virtuellen Spiele, aus Fritz (2003a)
Demnach kann jedes Spiel in der Landkarte zwischen den Ausprägungen Denken, Action und Geschichte eingeordnet werden. Eine große Gruppe von Spielen lässt sich zu der Ausprägung „Denken“ zählen. Dazu gehören vor allem Spiele, die den Nutzer vor Probleme stellen, welche er durch geplante und gut durchdachte Handlungen lösen kann. Denkspiele können unterschiedliche Schwierigkeitsausprägungen aufweisen, von einfacher Mustererkennung über abstrakten Denkspielen, die operatives Denken erfordern, bis hin zu komplexen Strategiespielen. Spiele, die der Ausprägung „Action“ zuzuordnen sind, sind meist durch Spannung und Unmittelbarkeit geprägt. Sie fordern u.a. Konzentration, Reaktionsschnelligkeit und Stressresistenz vom Spieler, da diesem meist nicht viel Zeit für durchdachte Handlungen gelassen wird. Das Repertoire an Actionspielen ist groß und reicht von Shootern über Kampfspiele bis hin zu Sport- und Autorennspielen. Spiele, die eher dem Bereich der Ausprägung „Geschichte“ zuzuordnen sind, enthalten sowohl Merkmale von Denkspielen (Rätsel/Aufgaben lösen) als auch von Actionspielen (Geschicklichkeit/Reaktionsschnelligkeit). Meist stehen bei Spielgeschichten Spielfiguren im Mittelpunkt, die vom Computerspieler gesteuert werden. Besonders charakteristisch für diese Spiele ist allerdings, dass alle Spielhandlungen, egal ob denkerischer oder actionreicher Natur, zu einer abgeschlossenen Geschichte zusammenlaufen. Dadurch, dass die einzelnen Spielszenen und Handlungsergebnisse Teil eines Ganzen sind und aufeinander aufbauen, ist diese Spielform sehr komplex, umfassend und zeitaufwendig.
Gebräuchlicher als die Verortung der Computerspiele in einer derartigen Landkarte ist allerdings die Einteilung der Spiele in verschiedene Genres. Trotz sich laufend verändernder, technischer Möglichkeiten und dem wachsenden Bedürfnis der Konsumenten nach neuen Spielideen, lässt sich eine relativ einheitliche Typologie ausmachen. Laut Dr. Müller-Lietzkow lassen sich Computerspiele in folgende Genres zusammenfassen: Actionspiele/3D- bzw. Ego-Shooter, Adventures/ Rollenspiele, Fun- und Gesellschaftsspiele/ Jump’n’Run, Sportspiele/ Rennspiele, Strategiespiele/ Simulationen, Online-Spiele (Rollenspiele, Action). Aber so vielfältig wie die Computerspiellandschaft ist, so vielfältig sind auch die Meinungen bezüglich der genauen Einteilung der Genres.
3.1.5 Typologie der Computerspieler
Deutschland ist in Europa der zweitgrößte Softwaremarkt. Weltweit belegt Deutschland sogar den fünften Platz nach den USA, Japan, Korea und Großbritannien (vgl. Müller-Lietzkow). Die Spielindustrie hat im ersten Halbjahr 2007 einen Gesamtumsatz von 550 Mio. Euro verbucht, wobei sich der Umsatz im Vergleich zum ersten Halbjahr 2006 um 17% gesteigert hat (Quelle: Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware BIU e.V. Marktzahlen). Insgesamt wurde im Jahr 2006 in Deutschland 1,12 Mrd. Euro mit Unterhaltungssoftware eingenommen (Quelle: BIU e.V. Marktzahlen). Schätzungsweise 8-9 Mio. Deutsche werden zu der Gruppe der Spieler gezählt, dazu gehören die regelmäßig-aktiven, die sehr aktiven und die Gelegenheitsspieler (vgl. Müller-Lietzkow). Wie genau sieht aber der Computerspieler aus? Mit welchen Merkmalen und Eigenschaften lassen sich Videospielnutzer charakterisieren? Die Studien von Electronic Arts (EA) aus dem Jahr 2005/2006 geben Aufschluss über unter anderem demographische Strukturen, Einstellungen, Freizeitgestaltung und Nutzungsverhalten der Computer- und Videospieler (über 14 Jahren). In der Typologie der Spieler stellt EA fünf Arten von Computerspielnutzern heraus – der Freizeitspieler, der Gewohnheitsspieler, der Intensivspieler, der Fantasiespieler und der Denkspieler. Die Mehrheit der Spieler (54%) können laut EA der Gruppe der Freizeitspieler zugeordnet werden. Der Freizeitspieler weist von allen Gruppen das höchste Durchschnittsalter auf (44 Jahre) und verfügt über ein mittleres bis hohes Einkommen. Männer und Frauen sind bei den Freizeitspielern gleich häufig vertreten. Computerspiele sind für diese Menschen nur eine Freizeitaktivität von vielen, die eher spontan und kurzfristig genutzt wird, um zu entspannen oder sich die Zeit zu vertreiben. Zu den bevorzugten Genres zählen Fun-, Sport- oder Geschicklichkeitsspiele, seltener werden hingegen Action-, Strategie- oder Fantasiespiele gespielt, da, so vermutet EA, dem Freizeitspieler die Zeit fehlt, um sich in solche komplexen Spielgeschehen einzufinden. Die Gewohnheitsspieler bilden die zweitgrößte Gruppe (24%), wobei ein Viertel davon Frauen sind. Bei ihnen hat das Computerspiel einen höheren Status als bei den Freizeitspielern, weil diese Menschen meist mit Videospielen aufgewachsen sind. Die Computerspiele haben sie ihr Leben lang begleitet und nehmen in etwa denselben Stellenwert ein wie Filme, Bücher oder Musik. Die Gewohnheitsspieler spielen zwar nicht so viel wie die Intensivspieler, verfolgen aber trotzdem interessiert die Entwicklungen auf dem Computerspielmarkt (über alle Genre hinweg). Von allen Gruppen besitzen die Gewohnheitsspieler das höchste Einkommen und sind überdurchschnittlich technikaffin, was sich in ihrer sehr guten Ausstattung an elektronischen Geräten bemisst. Laut der EA-Studie befindet sich der typische Gewohnheitsspieler gerade in einer Zeit, in der sich sein Leben durch Beenden der Ausbildung, Berufsstart, erste eigene Wohnung oder erstes Kind stark verändert und er somit auch weniger Zeit für sein Hobby „Computerspielen“ hat. Daher greift er eher zu Fun- und Sportspielen, die den schnellen Spaß garantieren. Spielklassikern aus seiner Jugend, meist Action- und Strategiespiele, ist er ebenfalls zugetan. Die Gruppe der Computerspieler besteht laut der Studie von Electronic Arts zu 5% aus den so genannten Intensivspielern, damit gehören sie zu der kleinsten Gruppe. Im Vergleich zu den anderen Spielertypen haben die Intensivspieler den höchsten Männeranteil (80%) und verbringen im Vergleich die meiste Zeit mit Computerspielen, entgegen allen Vermutungen jedoch nicht allein, sondern vorwiegend online oder im Netzwerk mit anderen. Dabei greifen die Intensivspieler mit Vorliebe zu actionlastigen Spielen und zu Ego-Shootern. Trotz allem gehen Intensivspieler, die größtenteils Anfang 20 und jünger sind, ebenso häufig Freizeitbeschäftigungen nach, welche auch von Gleichaltrigen bevorzugt werden, die nicht intensiv Computerspiele spielen. Eine weitere kleine Randgruppe bilden die Fantasiespieler (6%), die, so die Studie, meist aus Familienmenschen (Drei- oder Mehrfamilienhaushalt) mit unterem bis mittlerem Einkommen bestehen. Für die Fantasiespieler stellen Videospiele eine Abwechslung zum realen Leben mit seinen Zwängen und Verpflichtungen dar und bieten die Möglichkeit, Abenteuer zu erleben, die der Alltag nicht bieten kann. Die letzte Gruppe, die die Spieler klassifiziert, nennt Electronic Arts die Denkspieler, die mit 11% die drittgrößte Gruppe ausmachen. In den demographischen Merkmalen unterscheiden sie sich kaum von den Freizeitspielern. Einzig das Durchschnittsalter ist mit 38 Jahren aufgrund des höheren Anteils an Teens und Twens in dieser Gruppe geringer. Der Grund, weshalb diese Computerspiele einer separaten Gruppe zugeteilt werden, ist, dass sie nicht wie die Freizeitspieler auf Unterhaltung aus sind, sondern vor allem die Herausforderung suchen. Die Herausforderung besteht darin, „Probleme“ zu lösen, in dem der Spieler rätselt, knobelt, managed und sich Strategien oder Taktiken ausdenkt. Dabei bevorzugt der Denkspieler es, alleine zu spielen.
[...]
- Arbeit zitieren
- Nadine Müller (Autor:in), 2008, Warum Computerspiele nicht alle potenziellen Nutzer faszinieren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138306
Kostenlos Autor werden






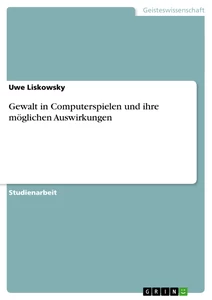













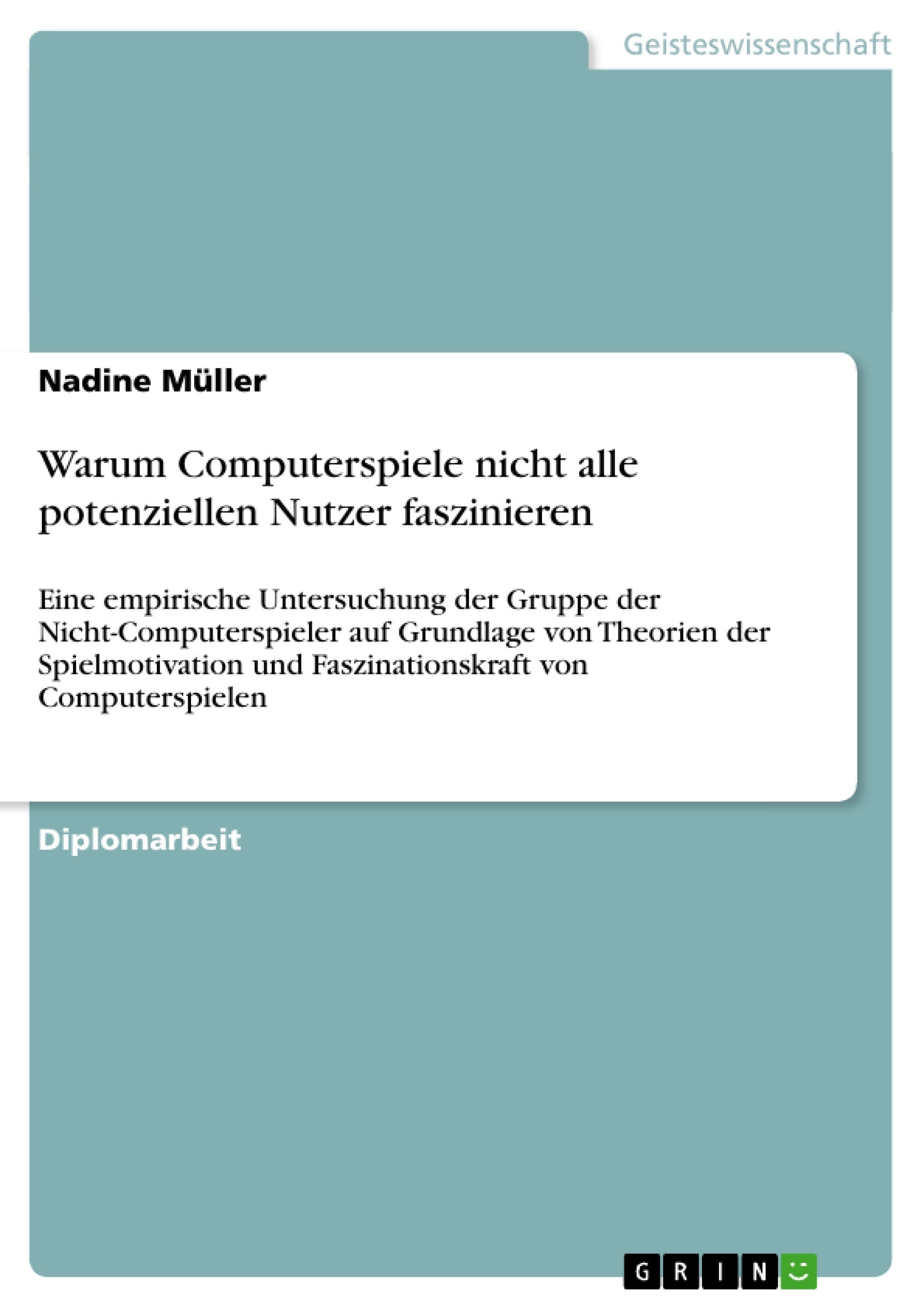

Kommentare