Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1.. Einleitung
2 „Wir sind das Volk“ - Literarische Verarbeitungen der politischen Wende
2.1 „Eine sanfte Revolution ist keine“ - Bilder der DDR-Opposition
2.1.1 „Es war mir unerträglich erschienen, vor die Wahl zwischen zwei Übeln gestellt zu sein“ - Das Bild der Opposition in Christa Wolfs Medea
2.1.2 „Sie hatte den Moment verpaßt, an dem die fröhliche Revolution zu Ende war“ - Das Bild der DDR-Opposition in Thomas Brussigs Helden wie wir und Wie es leuchtet
2.1.3 „Am Ende stehen wir alle mit leeren Händen da“ - Das Bild der DDR- Opposition in Günter Grass’ Ein weites Feld
2.2 „Sie wissen ja, wir können auch anders“ - Die Haltung der ostdeutschen Eliten zur Wende ,
2.2.1 „Aber dann wählte er, wie es ihm entsprach, die Macht. Und als ihr Mittel die Einschüchterung“ - die Haltung der Eliten zur Wende in Christa Wolfs Medea
2.2.2 „Im Prinzip ändert sich nichts“ - Die Haltung der ostdeutschen Eliten zur Wende in Günter Grass’ Ein weites Feld
2.2.3 „Wir rechneten mit Toten“ - Die Haltung der ostdeutschen Eliten zur Wende in Thomas Brussigs Wie es leuchtet
2.3 „Ich wusste, daß die Menge der im Westen kursierenden Ostmark zehn Millionen erreichte“ - Das Verhältnis der Westdeutschen zur Wende
2.3.1 „Mal sehn, was geht“ - Das Verhältnis der Westdeutschen zur Wende in Thomas Brussigs Wie es leuchtet
2.3.2 „Als ich starb, wechselte ein Hund über die Grenze“ - Das Verhältnis der Westdeutschen zur Wende in Thomas Hettches Nox
3. „Wahnsinn“ - Bilder des Mauerfalls und deren Bewältigung
3.1 „Aber wissen möchte man schon, wer den Riegel aufgesperrt hat“ - Der Mauerfall als Medienereignis
3.1.1 „Doch schon implodierte der Raum, den sein Schweigen geschaffen hatte“ - Der Mauerfall als Medienereignis in Thomas Hettches Nox
3.1.2 „Na, wer hat dem Genossen Schabowski den Spickzettel untergeschoben“ - Der Mauerfall als Medienereignis in Günter Grass’ Ein weites Feld
3.1.3 „Um mehr als eine unspektakulärere Fluchtwelle ging es ihm nicht“ - Der Mauerfall als Medienereignis in Thomas Brussigs Helden wie wir und Wie es leuchtet
3.2 „Wie von einer Katastrophe hingestreckt“ - Auswirkungen des Mauerfalls auf das epische Personal
3.2.1 „Im Film war das anders“ - Auswirkungen des Mauerfalls auf das epische Personal in Thomas Brussigs Wie es leuchtet
3.2.2 „Man muß neu begrenzen, ins Wuchernde schneiden, tief ins Lebendige hinein“ - Auswirkungen des Mauerfalls auf das epische Personal in Thomas Hettches Nox
3.2.3 „Mehr Sicherheit war kaum zu kriegen“ - Auswirkungen des Mauerfalls auf das epische Personal in Günter Grass’ Ein weites Feld
4... „Wir sind ein Volk“ - Die literarische Verarbeitung der Vereinigung
4.1 „Von diesem Einigvaterland erhoff ich mir wenig“ - Das Verhältnis von Autoren, Erzählern und Figuren zurVereinigung
4.1.1 „Zwischen Schwarz und Weiß, Recht und Unrecht, Freund und Feind - einfach leben“ - Christa Wolfs nonfiktionales Engagement gegen die Vereinigung
4.1.2 „Sie sangen Deutschland und meinten die D-Mark“ - Das Verhältnis des Erzählers und epischen Personals zur Vereinigung in Thomas Brussigs Wie es leuchtet
4.1.3 „Er hatte die Augen geschlossen“ - Das Verhältnis des Erzählers und epischen Personals zur Vereinigung in Thomas Hettches Nox
4.1.4 „In Deutschland ändert sich nichts“ - Das Verhältnis der Erzähler und des epischen Personals zur Vereinigung in Günter Grass’ Ein weites Feld...
4.2 „Haut mir ab mit Eurem Westfraß!“ - Vorwürfe der Kolonisierung
4.2.1 „Aber ich bitte Dich, Jason, letzten Endes sind es doch Wilde“ - Der Kolonisierungsvorwurf in Christa Wolfs Medea
4.2.2 „So aber war das Märchen bald aus“ - Der Kolonisierungsvorwurf in Günter Grass’ Ein weites Feld
4.2.3 „Gibt’s bei Fontane was darüber?“ - Der Kolonisierungsvorwurf in Thomas Brussigs Wie es leuchtet
4.3 „So läuft das bei uns“ - Fallbeispiele der nicht vollzogenen sozialen Vereinigung
4.3.1 „Wir standen uns als Feinde gegenüber“ - Fallbeispiele der nicht vollzogenen sozialen Vereinigung in Christa Wolfs Medea
4.3.2 „Der Paternoster ist nicht erneuert worden“ - Fallbeispiele der nicht vollzogenen sozialen Vereinigung in Günter Grass’ Ein weites Feld
4.3.3 „Wir müssen auch leben“ - Fallbeispiele der nicht vollzogenen sozialen Vereinigung in Thomas Brussigs Wie es leuchtet
4.4 „Bleibt zu hoffen, daß Dich Dein Grundmann nicht gleichermaßen nach westlicher Werteskala evaluiert“ - Deutsch-deutsche Paare
4.4.1 „Ich bin mit Jason gegangen, weil ich in diesem verlorenen, verdorbenen Kolchis nicht bleiben konnte“ - Das deutsch-deutsche Paar in Christa Wolfs Medea
4.4.2 „Selbst ihr Parfüm roch profitorientiert“ - Das deutsch-deutsche Paar in Günter Grass’ Ein weites Feld
4.4.3 „Niemand will ihre Geschichte als Unglücksgeschichte hören, ohne Chance auf ein Happy-End“ - Deutsch-deutsche Paare in Thomas Brussigs Wiees leuchtet
4.4.4 „Wie ein ängstliches Kind klammerte sie sich an ihn“ - Das deutschdeutsche Paar in Thomas Hettches Nox
5... Resümee
6 Verzeichnis der verwendeten Literatur
6.1 Primärliteratur/Quellen
6.2 Sekundärliteratur
6.3 Online verfügbare Primärliteratur / Quellen
6.4 Online verfügbare Sekundärliteratur und sonstige Informationen
1. Einleitung
Literatur ist selten zeitlos. Ihre Autoren sind soziale Wesen, die nicht losgelöst von ihrer Umwelt im ökonomischen, politischen, kulturellen, totalen Vakuum leben. Ihnen wird in ihrer Eigenschaft als Literaten, als Künstler und Intellektuelle gemeinhin ein gutes Gespür für den Zeitgeist und die unter der Oberfläche der Gegenwart wirkenden Prozesse attestiert. Selten bewahrheitete sich diese Annahme mehr als mit Peter Schneiders Episodenroman Der Mauerspringer, in dem die literarisierte Berliner Mauer bereits 1982 fiel, sieben Jahre vor ihrem realen Pendant. Schneider prophezeite, es werde länger dauern, die Mauer in den Köpfen einzureißen, „als irgendein Abrißunternehmen für die sichtbare Mauer braucht“.[1] Er sollte Recht behalten.
Schon sehr bald nach dem 09. November 1989 und dem 03. Oktober 1990 mehrten sich warnende und ernstzunehmende Stimmen, die die Möglichkeit einer sozialen Vereinigung,[2] also des Zusammenwachsens der beiden deutschen Teilnationen, äußerst skeptisch beurteilten. Terence James Reed vermutete 1993: „Nothing, it seems, divides people like unification“.[3] Und Jürgen Schröder konstatierte 1994, die „Wiedervereinigung des geteilten Landes hat ja paradoxer-, aber typischerweise keinen Zuwachs an nationaler Identität, sondern ihre Verstörung mit sich gebracht“. Er beklagte, mit jeder Woche kompliziere sich das Verhältnis zwischen West- und Ostdeutschen, jede Woche bringe neue Untaten des lange totgeglaubten „hässlichen Deutschen. Mit einem Wort: wir sind schon wieder dabei, uns selbst und das Ausland das Fürchten zu lehren.“[4] Zustimmung erhielt er noch im gleichen Jahr von Claudia Mayer-Iswandy. Sie stellte fest, die Nation befinde sich „also im Sturm“.[5]
Und auch in den Folgejahren gelangten zahlreiche Wissenschaftler unabhängig voneinander zu ganz ähnlichen Befunden: 1995 diagnostizierte Michael Schmitz, Deutschland sei „tiefer gespalten als vor dem Zusammenschluß“.[6] Jürgen Kocka stellte fest: „Der Umbruch dauert an“.[7] 1997 erklärte Eberhard Roters die „Deutsche Einheit“ gar zur „Krankheit“ und fragte: „Worum handelt es sich dabei: um Schizophrenie, um Spaltungsirrsinn“,[8] um schließlich das Bild einer „Nation mit halbseitiger Lähmung“ zu zeichnen.[9] Ähnlich illustrativ äußerte sich Günter de Bruyn 1999 in seiner Eigenschaft als „Schlichter- und Mittlerfigur zwischen dem östlichen und dem westlichen Teil Deutschlands“, als „gesamtdeutsche Konsensfigur“:[10] Die Nation habe „schlechte Laune“, stellte er fest, sie sei „vereint, aber nicht glücklich“.[11]
Selbst über ein Jahrzehnt nach der offiziellen Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten hat sich die Skepsis der Wissenschaftler nicht gelegt. Auch wenn es „mittlerweile weniger laut, ja geradezu verdächtig leise“ zugehe,[12] wie Elke Brüns 2004 unter Verweis auf Christoph Dieckmanns Essay Das schweigende Land - Ost und West driften wieder auseinander feststellte,[13] ließe sich die Reihe der mahnenden Stimmen beliebig fortsetzen. Noch immer scheinen Zweifel, was das Zusammenwachsen der beiden deutschen Teilnation betrifft, angebracht: Alexander Thumfahrt erklärte 2002 in seiner zwischenzeitlich zum Standardwerk avancierten Arbeit, dass die nationale Vereinigung auch in naher Zukunft „ein ergebnisoffenes, relativ unbestimmbares und fortdauerndes Geschehen“ sein werde, in dem es „zu unerwarteten Eigenentwicklungen und überraschenden institutionell-kulturellen Ausformungen kommen wird“.[14]
Sprachlich, auch dies ein Beleg für die empfundene Fremdheit, hat sich das (Wissen um das) bis dato fortbestehende Nebeneinander der beiden deutschen Teilnationen in Terminologien wie der einer „ostdeutschen Teilkultur“ (Dietrich Mühlberg) und im Bild der Berliner Republik als „zwei Teilgesellschaften, zwei Kulturen“ (Rolf Reißig) niedergeschlagen.[15] Dass beide Begriffe keinesfalls Momente der Berliner Republik bezeichnen, die noch aus der Zeit der realpolitischen Teilung stammen und bald der Vergangenheit angehören werden, hob Elke Brüns hervor: Vergleichbar der Selbstethnisierung in fremdkultureller Umwelt, sei nach der Vereinigung eine DDR- Identität in den neuen Bundesländern entstanden, die es zu Zeiten der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) selbst so nicht gegeben habe, führte sie aus.[16] Rolf Reißig sah die neue Identität der Ostdeutschen einerseits in der bewussten und gezielten Abgrenzung von Westdeutschen symbolisch konstruiert und inszeniert, andererseits in gelebter Erfahrung begründet.[17] Beide Analysen, sowohl die von Brüns als auch die von Reißig, deuten auf einen Entfremdungsprozess hin, der erst mit dem Fall der Berliner Mauer und/oder der politischen Vereinigung der beiden deutschen Staaten einsetzte. Wolfgang Hilbig benannte dieses Phänomen 1997 bei der Entgegennahme des Lessing-Preises:
„Vielleicht wird uns eines Tages die Erkenntnis kommen, daß erst jener Beitritt zur Bundesrepublik uns zu den DDR-Bürgern hat werden lassen, die wir nie gewesen sind, jedenfalls nicht, solange wir dazu gezwungen waren."[18]
Mit großer Berechtigung wies Brüns aber darauf hin, dass keinesfalls nur die Ostdeutschen als Akteure dieser Entwicklung in Erscheinung traten. Sie hob hervor, dass sich vielmehr Ost- und Westdeutsche gleichermaßen von einander abgrenzten, anstatt aufeinander zuzugehen.[19]
Kaum ein Deutscher, so lässt sich zusammenfassen, konnte sich mit der am 03. Oktober 1990 vollzogenen staatsrechtlichen Vereinigung und ihren politischen wie sozioökonomischen und kulturellen Folgen arrangieren.[20] Entsprechend setzten unterschiedlich intensiv wahrgenommene[21] Prozesse der nostalgischen Verklärung ein: Während die Ostdeutschen sich ihres zur „heilen Welt der Diktatur“[22] verklärten Staates erinnerten, schwelgten die Westler in Erinnerung an die „ironische Nation“ der alten Bundesrepublik.[23] Die Akzeptanz des gegenwärtigen, gesamtdeutschen Staats ist - wenigstens momentan noch[24] - erschreckend gering.
Für die Literatur blieben die politische Wende in der DDR, der 03. Oktober 1990 und die sich schleichend vollziehende Entfremdung zwischen Ost- und Westdeutschen nicht folgenlos. Klaus-Michael Bogdals fragwürdige Behauptung, „daß ohne die Vereinigung nahezu die gleichen Texte geschrieben worden wären, die wir jetzt zu lesen bekommen“,[25] darf heute mit großer Berechtigung als widerlegt gelten.[26] Wollte sich Bogdal 1998 nicht „an der angestrengten Suche nach den ,Spuren des Sturms der Geschichte’ in den nach 1989 geschriebenen Texten [...] beteiligen“,[27] so haben sich vor und nach ihm zahlreiche Literaturwissenschaftler den Gedichten und Romanen der 1990er und 2000er Jahren mit teilweise großem Erfolg und eben jenem wissenschaftlichen Interesse angenommen, das der Bielefelder Literaturwissenschaftler für müßig erklärte.
Claus Offe ist zuzustimmen, dass es sich beim Untergang der DDR um einen „forschungspragmatischen Glücksfall“ handelte. Von dem von Konrad Jarausch festgestellten „academic boom“ profitierte nicht zuletzt auch die Germanistik.[28] Gedruckte Romane, unverändert und wohl auch noch zukünftig der Hauptuntersuchungsgegenstand der Literaturwissenschaft,[29] garantieren einen hohen Erkenntnisgewinn.
Zwar mag die Philologie, wie Elke Brüns - angesichts des großen quantitativen Vorsprungs der Transformationsforschung[30] - beklagte,[31] gegenüber publikationsfreudigeren Wissenschaften noch zahlenmäßig im Rückstand liegen. Qualitativ ragen jedoch bereits heute einige literaturwissenschaftliche Arbeiten deutlich aus der selbst für Experten längst unüberschaubaren Menge der rund 53 000 Titel zu Wende und Wiedervereinigung hervor.[32]
Sowohl was ihren Umfang und Aufbau als auch was das ihnen zugrunde liegende Literaturverständnis und ihren wissenschaftlichen Ansatz betrifft, unterscheiden sich die Forschungsschriften dabei teilweise enorm. Neben die zahlreichen Literaturgeschichten, die (auch) die 1990er Jahre untersuchen,[33] treten zunehmend Arbeiten, die explizit nach den Auswirkungen von Wende, Mauerfall und Vereinigung auf den Literaturbetrieb und die Literatur fragen.
Der Saarbrücker Philologe Frank Thomas Grub stellte sich Anfang der 2000er Jahre im Rahmen seiner Promotion der Herausforderung, die Beiträge der Primär- und Sekundärliteratur zu den Themenfeldern Wende, Mauerfall und Vereinigung zu sichten und auszuwerten. Als Ergebnis seiner verdienstvollen Bemühungen erschien 2003 das zweibändige und mehr als 1000 Seiten umfassende Werk Wende und Einheit im Spiegel der deutsprachigen Literatur. Während der erste Band einen differenzierten Überblick über die Entwicklung des ostdeutschen Literaturbetriebs sowie die Situation ostdeutscher Autoren nach 1989/90 bietet, nach der Existenz einer möglichen „Wendesprache“ sowie nach den Spezifika der Wende und Vereinigung thematisierenden Diskussionen und Debatten, Tagebücher, Reportagen, Porträts und Essays, Romane, Gedichte und Dramen fragt, bietet der zweite zwischenzeitlich veraltete Band einen Überblick über die - leider nur - bis 1999 erschienene Sekundär- und Primärliteratur, zu der Grub auch Hörspiele und Features, Autobiografien, Drehbücher und sogar Bildbände zählte.[34] „Wendeliteratur“ - ein „selten [...] problematisierter“ Terminus[35] - müsse alle Gattungen mit einbeziehen, denn „die Prozesse von ,Wende‘ und Vereinigung umfassen alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens“, begründete er seine Auswahl.[36] Er kam zu dem Schluss, die Themen „Wende und Einheit“ seien unverändert „omnipräsent“ und die Zahl der Publikationen „mittlerweile kaum noch überschaubar“.[37]
Deshalb kann es, obwohl eine Bibliographie, die auch die Publikationen der zweiten Dekade nach 1989/1990 erfasst, zunehmend zum Desiderat der Germanistik gerät, unmöglich mein Anliegen sein, einen erschöpfenden Überblick über die Forschungsliteratur zu Wende und Vereinigung zu bieten. Vielmehr möchte ich mich darauf beschränken, eine, wie ich finde, bemerkenswerte Entwicklungslinie nachzuzeichnen. Seit etwa 15 Jahren beschäftigt die Literaturwissenschaft die Frage, ob mit der politischen auch die kulturelle oder wenigstens die literarische Einheit vollzogen wurde. Bei ihrer Beantwortung leistete Volker Wehdeking 1995 mit seiner heute allerdings veralteten und vergriffenen Studie Die deutsche Einheit und die Schriftsteller Pionierarbeit.[38] Daran, wie sein Befund in der Zwischenzeit diskutiert und von ihm selbst relativiert wurde, lässt sich erkennen, welche Entwicklung die Bearbeitung des von ihm bestellten Themenfelds in der Zwischenzeit durchlaufen hat.
War der Stuttgarter Literatur- und Medienwissenschaftler Mitte der 1990er Jahre noch von einer sich zwischen den Literaturen der Bundesrepublik (BRD) und der DDR vollziehenden „kulturellen Wiederannäherung“ überzeugt,[39] so stellte er in den Jahren 1999 und 2000 fest, „in den wesentlichen und miteinander verflochtenen Fragen von Herrschaft, Wirtschaft und Kultur“ zeichne sich „Skepsis gegenüber baldigem Zusammenwachsen“ ab.[40] Wehdeking erkannte einen „vom Mauerfall und der 1989 folgenden Dekade bewirkten Mentalitätswandel“,[41] der sich „von der Befreiungseuphorie“ hin „zum Alltag skeptischen Abwartens“ vollzogen habe, seit „man die lange Dauer dieses wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenwachsens ahnt“.[42] Die Schwierigkeiten beim Verschmelzen der beiden deutschen Literaturen wollte er allerdings lediglich als „Normalisierungs- und Regionalisierungsprozess“ verstanden wissen, „der dem rasanten Anpassungsdruck an den freien Markt [...] in einem natürlichen Reflex den Wunsch nach Identitätsbewahrung“ entgegenhalte. Er sah deshalb „keinen Anlaß zu resignativen Einsichten beim allmählichen Zusammenwachsen im kulturellen Feld“,[43] sprach vielmehr davon, die DDR-Literatur sei „wohl in den späten 90er Jahren“ in ihrer spezifischen ideologischen Prägung endgültig versiegt, „um ins gemeinsame literarische Feld, allerdings mit deutlich ausgeprägter regionaler OstRelevanz und Erinnerungsdimension zu münden“.[44] Sie werde ihre „fortschreibenden Autor(inn)en als Hinterbliebene eines gescheiterten Systems samt seinem Nachhall an Spannungen und Ungleichzeitigkeiten“ aber noch lange beschäftigen, war er sich sicher.[45]
Während Wehdeking seine Theorie demnach nur geringfügig relativierte, verfestigte sich in der Literaturwissenschaft das Verständnis von (wenigstens) zwei einander unverändert gegenüberstehenden Literaturen. Der Bremer Philologe Wolfgang Emmerich hob bereits 1994 hervor, dass Literatur die politisch-gesellschaftlichen Prozesse in dreifacher Hinsicht begleite: als „Zeuge des historischen Prozesses“, als „Bewußtstein (der und) gegen die Geschichte“ und letztlich auch als „wirkender Faktor“.[46] Entsprechend glaubte er, ähnlich wie Wehdeking, 1997 zu erkennen, dass sich die beiden deutschen Literaturen vor 1989/1990 angesichts der politischen Entspannung einander annäherten. In Mauerfall und Vereinigung sah er allerdings eine klare Zäsur: Nach 1990 sei es, so Emmerich, zu einem „regelrechten Zusammenstoß der beiden Literaturen“ gekommen, der gezeigt habe, „was man von der Literatur des je anderen Landesteils hielt: nämlich wenig“. Das Ergebnis dieses „Zusammenstoßes“ erkannte er in einer Vielzahl „zueinander offener Szenen“.[47]
An eben jener Offenheit zweifelte Iris Radisch 2000. Ihr Aufsatz Zwei getrennte Literaturgebiete kam in weiten Teilen einer Generalabrechnung mit westdeutschen (Pop)-Autoren wie Benjamin von Stuckrad-Barre, Moritz von Uslar oder Christian Kracht gleich, denen Radisch einen „minimierten Kunstanspruch“ und „Lifesytle- Realismus“ vorhielt. Ihrer „illusionslos alltäglichen und sich in der Inszenierung des Banalen gefallenden Literatur“[48] stellte sie eine ostdeutsche Schreibart gegenüber, in der sich trotz der „Revolution [...] wundersamer Weise nichts verändert“ habe.[49] Als neues Moment entdeckte sie in den Romanen Christoph Heins, Kerstin Hensels, Thomas Rosenlöchers, Johannes Jansens einzig die Figur des „West-Menschen“, der „von dem alten Abziehbild des Fettsacks mit Zigarre und Dollarscheinen nicht übermäßig weit entfernt war, lediglich um ein Weniges modernisiert durch neue Negativ-Attribute wie Simulation und Spiel oder - erstaunlich in diesem Reservoir der Schimpfworte - auch durch das Negativ-Attribut Demokratie“.[50]
Ihr Fazit fiel entsprechend deutlich aus: Iris Radisch war davon überzeugt, „es in Deutschland mit zwei deutschen Literaturen zu tun zu haben, die nichts sonst, nur das eine gemein haben: Sie existieren völlig getrennt voneinander“.[51]
Anknüpfend an Radisch forcierte Elke Brüns die Kritik an Volker Wehdekings Theorie einer bevorstehenden literarischen Einheit in ihrer 2004 in Greifswald eingereichten Habilitationsschrift Nach dem Mauerfall - Eine Literaturgeschichte der Entgrenzung:[52] Hatte Wehdeking dem nationalen Moment des 03. Oktobers 1990 noch Vereinigungsqualitäten zugeschrieben, so erteilte Brüns dem „Wunschbild einer Literatur schon im Hinblick auf die vielfältigen Schreibweisen der Gegenwart“ eine klare Absage,[53] wenngleich sie einräumte, die Popliteratur sei „die erste gesamtdeutsche Literatur“[54] und Thomas Brussig könne als erster gesamtdeutscher Autor bezeichnet werden.[55] Mauerfall und Vereinigung verstand Brüns aber keines-falls als bloße Etappe auf dem Weg zu einer deutschen Literatur: Im „geopolitische[n] Fall der deutsch-deutschen Grenze“ sah sie stattdessen vielmehr den „Modelfall ei-ner sich vollziehenden kulturellen Entgrenzung [...], die in den Texten angezeigt und bearbeitet wird“.[56]
Während Brüns dabei vorrangig auf die narratologischen Facetten fokussierte, liegt meiner Arbeit ein Literaturverständnis zugrunde, das Romane als Produkte ihrer Entstehungszeit, als - geschichtswissenschaftlich gesprochen - Quellen begreift, von deren Aussagen über die Spezifika des jeweils zeitaktuellen gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und/oder sozioökonomischen Systems aus Rückschlüsse auf die Haltung der Autoren zu den Phänomenen und Ereignissen ihrer Zeit gezogen werden können.[57]
In den Mittelpunkt treten dabei die Fragen, wie Christa Wolf, Thomas Brussig, Günter Grass und Thomas Hettche Wende, Mauerfall und Vereinigung einschätzten und wie sie sich zum weiter oben bereits problematisierten Nebeneinander der beiden deutschen Teilnationen positionierten. Ihre Romane[58] sollen dabei als politische Stellungnahmen begriffen werden, da sie mit dem „Wissen um das ,Ende der Geschichte’ - die Vereinigung“ geschrieben wurden, ihre Autoren den „historischen Prozeß von 1989“ deshalb „beinahe zwangsläufig in einen Kontext nachträglicher Bedeutungszuweisung und rückwärtsgewandter Projektion“ stellten.[59] Während mit Thomas Hettches Nox (1995),[60] Günter Grass’ Ein weites Feld (1995)[61] und Christa
Wolfs Medea. Stimmen (1996),[62] gleich drei der vier Romane Mitte der 1990er Jahre erschienen, publizierte Thomas Brussig seinen Zeitroman[63] Wie es leuchtet sogar erst 2004,[64] 14 Jahre nach dem 03. Oktober 1990[65] und damit zu einem Zeitpunkt, als die DDR im kollektiven Bewusstsein als abgeschlossene Vergangenheit galt.[66]
Faktisch handelt es sich bei den vier Romanen um Versuche einer alternativen, einer literarischen Geschichtsschreibung,[67] um nicht zuletzt auch psychologisch notwendige Reaktionen auf die Prozesse, die 1989/1990 schließlich zum Mauerfall und zur staatsrechtlichen Einheit geführt haben,[68] und um ästhetisierte Reflexionen des Gegen-, Neben- und seltener auch des Miteinanders der beiden deutschen Teilnationen. Ihre Autoren bedienten sich - mit unterschiedlicher Intensität - dem stilistischen Mittel der Fiktionalisierung.[69] Sie stellten den Literaturwissenschaftler vor die Herausforderung, zwischen den Zeilen nach einer tieferen Wahrheit, im Text nach Anhaltspunkten für die persönliche Haltung der Schriftsteller zur Wende, zum Mauerfall, zur Vereinigung und zur Koexistenz der beiden deutschen Teilnationen zu suchen.
Nichtfiktionale Äußerungen der Autoren, die sie in Autobiografien, Interviews, Reden, Briefen getroffen haben, können die Suche erleichtern und werden auch von mir gelegentlich herangezogen. Im Mittelpunkt meiner Arbeit, die sich in Anlehnung an Michel Focault und Klaus-Michael Bogdal und damit in logischer Abgrenzung zu Jürgen Link als diskursanalytische,[70] doch textnahe Interpretation versteht, sollen aber vorrangig die Romane als Medium politischer Artikulation stehen. Weil sie nicht losgelöst von ihrem diskursiven Kontext verstanden werden können, waren mir die wesentlichen Facetten der Diskussion um Wende, Mauerfall und Vereinigung bei der Gliederung meiner Studie die ausschlaggebende Orientierungshilfe.
Diesem streng methodologischen Vorgehen ist letztlich auch das - bedauerliche - Faktum geschuldet, dass nicht immer alle vier Romane gleich stark zur ver-gleichenden Interpretation herangezogen werden können, da es sich bei ihnen um stilistisch wie inhaltlich jeweils eigenständige Diskursbeiträge handelt: Während Günter Grass und Thomas Brussig - im wortwörtlichen Sinne - Zeitromane geschrieben haben, die in ihrer Differenziertheit einem Panoptikum ähneln, fokussierten Christa Wolf und Thomas Hettche in ihren Werken auf bestimmte Themenkomplexe, auf das mythische Schicksal Medeas beziehungsweise auf die Nacht des Mauerfalls in Berlin.
Trotz ihrer stilistischen wie inhaltlichen Eigenständigkeit transportieren Medea, Wie es leuchtet, Ein weites Feld und Nox allerdings eine insgesamt einstimmige und in ihrer Unmissverständlichkeit drastische Botschaft: Christa Wolf, Thomas Brussig, Günter Grass und Thomas Hettche lehnten die politische Vereinigung der beiden deutschen Staaten retrospektiv ab und blickten mit Skepsis in die gesamtdeutsche Zukunft. Dies mag in Einzelfällen, denkt man vor allem an Christa Wolf[71] oder Günter Grass,[72] auch biographisch motiviert sein. An der Omnipräsenz der Skepsis und Ablehnung ändert dieser hintergründige Befund aber wenig.
Wichtiger scheinen mir deshalb die Mechanismen zu sein, die den Romanen inhärent sind und aus denen das negative Gesamturteil über die Ereignisse von 1989/1990 resultiert. Zuvorderst wird deshalb nach der literarischen Verarbeitung der politischen Wende[73] in der DDR zu fragen sein.
2. „Wir sind das Volk“ - Literarische Verarbeitungen der politischen Wende
2.1 „Eine sanfte Revolution ist keine“ - Bilder der DDR-Opposition
Die größte Schwierigkeit bei der Beurteilung des Zusammenbruchs der DDR, die - teils mehr, teils weniger deutlich - in allen vier Romanen thematisiert wird und auch zahlreiche Wissenschaftler, namentlich Politologen und Historiker, beschäftigt, besteht darin, dass sich die als „friedliche Revolution“74 ins öffentliche Bewusstsein eingegangene politische Wende in ihrer weitgehenden Gewaltlosigkeit allen zuvor bekannten Klassifizierungsmodellen entzieht: sie eignet sich schlechterdings nicht als Revolution im eigentlichen Sinne, also als gewaltsamer Umsturz, und stellt Wissenschaftler wie Literaten deshalb vor die Herausforderung, etablierte Erklärungsmodelle zu modifizieren oder neue zu definieren und zu konsensualisieren.
So schickten Dieter Herberg, Doris Steffens und Elke Tellenbach ihrem Forschungsüberblick die grundlegende Frage nach der Beurteilung der Ereignisse von 1989 vorweg: „Waren sie revolutionär oder waren sie nicht-revolutionär?“75 Eine Antwort dürften sie sich auch von den führenden Gegenwartshistorikern unserer Zeit erhofft haben. Doch diese konnten sich nicht einigen. Der Bielefelder Geschichtswissenschaftler Hans-Ulrich Wehler gestand als einer der ersten offen seine Ratlosigkeit ein und vertröstete die Ratsuchenden auf unbestimmte Zeit:
„Die Debatten sind durch ein Dilemma geprägt, weil wir hier soziale und politische Prozesse erleben, für die wir keine genauen Begrifflichkeiten haben. [...] Wir stochern also noch im Nebel, und wie die Begrifflichkeiten für die dramatischen Umwälzungen eines Tages aussehen, ist unklar.“76[74] [75] [76]
„Im Nebel stocherten“ unter anderem Joachim Fest, Jürgen Коска, Erhärt Neubert, Charles Maier und Ludger Kühnhardt. Sie rangen um eine möglichst einheitliche Formulierung. Ihre Debatte war von Relativierungen geprägt: Während Kühnhardt 1994 zu bedenken gab, dass diejenigen Revolutionen am schwersten als solche anerkannt würden, „die im Rahmen verfassungspolitischer Institutionen aufgefangen werden“,[77] erkannte Neubert, ein Experte für die Geschichte der Opposition in der DDR, angesichts von „Pflastersteinen, brennenden Autos und brutalen Polizeieinsätzen“ lediglich „Revolutionsszenarien“.[78] Und auch Maier sprach 1999 zwar von einer „überraschenden und mitreißenden Revolution von unten“,[79] um sich aber nur wenige Seiten später für den relativierenden Terminus eines „revolutionären Aufstands“ einzusetzen, dessen Vorteil es sei, dass sich seine „Authentizität“ an der „Mobilisierung des Volkes“ und nicht am Kriterium des „Blutvergießens“ messen lasse.[80] Offensichtlich schreckt die Historiographie unverändert vor eindeutigen Klassifizierungen zurück.
Dabei ging Maiers Urteil bereits Kockas Deutung voraus. 1995 wies der Bielefelder Historiker auf den „bemerkenswert friedlichen Charakter des Umsturzes von 1989“ hin und plädierte, „es mag trotzdem erlaubt sein, von Revolution zu sprechen: Volksbewegungen stellten den zentralen Motor der Veränderungen dar“.[81] Doch auch, dass sich Wehler „unter Rückgriff auf den allgemeinen Revolutionsbegriff der Frühen Neuzeit“ im gleichen Jahr für den Terminus einer „Revolution im Staatensystem“ aussprach,[82] konnte die Suche nach einer konsensfähigen Bezeichnung für den Wandel in der DDR nicht befördern. Der Revolutionsbegriff lässt sich, so scheint es, vielleicht gerade wegen seines frühen inflationären und wahlstrategisch motivierten
Gebrauchs,[83] nicht oder nicht mehr (ohne Einschränkungen) für wissenschaftliche Analysen des politischen Umbruchs in der DDR operationalisieren.[84]
Die Ratlosigkeit der Geschichtswissenschaftler spiegelt sich dabei deutlich in den Schulbüchern wider.[85] Pädagogisch geschult, aber in diesem Punkt fachlich nicht selten überfordert, sind Lehrer weitgehend auf sich allein und ihre subjektiven Erfahrungen als Zeitzeugen gestellt, stehen sie vor der Aufgabe, ihren Schülern ein Bild der friedlichen Revolution und ihrer Errungenschaften zu vermitteln.[86]
Die Deutschen sind sich, so lässt sich abschließend resümieren, weitestgehend uneinig, welchen Vorgängen sie ihre nationale Einheit denn eigentlich zu verdanken haben. Eine konsensfähige Erklärung ist auch zwei Jahrzehnte nach dem Mauerfall nicht in Sicht. Und so hat Werner Heiduczeks Bemerkung: „Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, was sich da Woche für Woche bei zunehmender Gereiztheit in Leipzigs Innenstadt vollzog“, paradigmatischen Charakter.[87]
Das Bild, das die von mir exemplarisch ausgewählten Romane von der politischen Wende in der DDR zeichnen, fällt entsprechend ambivalent aus: Um Sinngebung scheint, ganz gleich ob ost- oder westdeutscher Provenienz, keiner der vier Autoren bemüht gewesen zu sein. Vielmehr schöpften sie die von Dietrich Harth erkannte Freiheit der literarischen gegenüber der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung voll aus, indem sie die historische Wahrheit fiktionalisierten, verfremdeten.[88] Fragwürdig erscheint mir deshalb Iris Radischs einseitiger Befund, im Osten gebe es eine „poetische, tragische, im besten Sinne politische Literatur, die nicht Stellung bezieht, aber durch ihre machtvolle Bergwerkarbeit [...] deutsche Wirklichkeit decouviert, dekonstruiert, destabilisiert“, während im Westen lediglich ein „nüchterner Beschreibungsfetischismus, der Kult des Hier und Jetzt, das Dogma des Reflexionsverbots“ dominiere.[89] Tatsächlich war nämlich nicht nur Christa Wolf und Thomas Brussig, sondern auch Thomas Hettche und Günter Grass am Spiel mit den zahlreichen möglichen Realitäten, am Decouvieren, Dekonstruieren und Destabilsie- ren gelegen. Ihr politischer Anspruch manifestierte sich in der Negation etablierter Deutungsmuster. Allzu verschlüsselt schrieb allerdings selbst Christa Wolf nicht.[90]
Sie, Grass und Brussig teilten eine weit verbreitete Auffassung, nach der es sich bei einer Revolution um eine besondere Form des politischen Wandels handelt, die sich durch die grundlegende, nachhaltige - und zumeist auch gewaltsam bewirkte - Umgestaltung der kulturellen Wertvorstellungen, der gesellschaftlichen Struktur und/oder der politischen Organisation auszeichnet.[91] Folgerichtig ist die Frage nach dem historischen Vorhandenensein einer Opposition, die sich als Träger der Revolution geeignet haben könnte, in drei der vier Romane ein zentrales Thema:
Günter Grass und Thomas Brussig sprachen den ostdeutschen Oppositionellen dabei rückblickend die Fähigkeit ab, tief greifende Veränderungen bewirkt zu haben. Und auch Christa Wolf verhalf der Opposition in ihrer Mythenadaption Medea zu keinem uneingeschränkt positiven Profil.
2.1.1 „Es war mir unerträglich erschienen, vor die Wahl zwischen zwei Übeln gestellt zu sein“ - Das Bild der Opposition in Christa Wolfs Medea
Christa Wolf verortete die politische Wende in der DDR im Motiv des Exodus, das im kulturellen Gedächtnis als ein Paradigma revolutionärer Politik fungiert[92] und das angesichts der Massenflucht aus der DDR ins Bewusstsein der intellektuellen Elite rückte. Helga Schürz, Gerti Tetzner, Sigrid Damm, Daniela Dahn, Helga Königsdorf und Rosemarie Zeppelin, Mitglieder des Berliner Schriftstellerverbands, verwendeten es gemeinsam mit Wolf beispielsweise im September 1989 für einen Resolutionsentwurf, der die Probleme der DDR mit dem Ziel ansprach, systemstabilisierende Veränderungen einzuleiten, den Staat vor dem Zusammenbruch zu bewahren.[93]
Entsprechend ihres eigenen politischen Engagements modifizierte Wolf die Konfiguration ihrer Protagonistin und die Geschichte ihres Exodus’, ihrer Flucht dabei an entscheidenden Stellen: In Medeas Erinnerungen an ihre vormals offensichtlich sozialistische Heimat Kolchis klingt zwar starke Kritik an König Aietes an,[94] der die „uralten Legenden, in denen unser Land von gerechten Königinnen und Königen regiert wurde, bewohnt von Menschen, die in Eintracht miteinander lebten und unter denen Besitz so gleichmäßig verteilt war, daß keiner den anderen beneidete oder nach seinem Gut oder gar nach dem Leben trachtete“, durch seine Herrschsucht pervertiert hat.[95] Die reformwilligen Oppositionellen, deren Zentrum - auch dies eine deutliche Parallele zur politischen Wende in der DDR - der Tempel der Hekate ist,[96] scheitern jedoch an seinem „Starrsinn“.[97] Schließlich bleibt ihnen lediglich noch die Emigration nach Korinth übrig, die von Medea rückblickend als vergebliche „Flucht“ verstanden wird.[98] Anders als im Falle von Euripides’ Medea, die das Exil als „der Übel größtes nicht“ begreift,[99] zeitigt der Verlust ihrer Heimat auf Wolfs Medea traumatische Folgen: „Für die Argonauten waren wir Flüchtlinge, es gab mir einen Stich“, beklagt sich Medea beispielsweise über ihre Fremdwahrnehmung in Korinth.[100] Die Tatsachen über ihre Emigration sieht sie durch zahlreiche Verklärungen „ausgehöhlt [...] zu einer dünnen brüchigen Schale [...], die von jedem, der es wirklich will, zerstört werden kann“.[101] Und weil die übrigen Kolcher „anfingen, mir die Schuld am Verlust der Heimat zu geben, die ihnen nachträglich in ungetrübtem Glanz erstrahlt“, wirft sich Medea vor, ihre Mitexilanten seien ihr zwar auch, weil sie „die politischen Verhältnisse ebenso unerträglich fanden wie ich“,[102] letztlich ausschlaggebend aber „geblendet durch den Ruf, den ich unter ihnen genoß“ gefolgt.[103] Sie ist sich ihrer misslichen Situation, des Fehlers, Kolchis verlassen zu haben, wohl bewusst: „Warum war ich aus Kolchis geflohen“, klagt sie gegen Ende des Romans. „Es war mir unerträglich erschienen, vor die Wahl zwischen zwei Übeln gestellt zu sein. Ich Törin. Jetzt hatte ich nur noch zwischen zwei Verbrechen wählen können.“[104]
Unverkennbar ähnelt die opponierende Königstochter Christa Wolf, die zur Aufbaugeneration der DDR gehörend „Repräsentantin des Staates“, zugleich aber auch „Seismograph oppositioneller Strömungen“ und seit etwa 1970 das auch im Westen akzeptierte „Sprachrohr der Kritik am Staat“ war.[105] Der Ausreisewelle stand sie ablehnend gegenüber.[106] Überträgt man Medeas schmerzliches Bewusstsein um ihren historischen Fehler zurück in die Autorenrealität, wird deutlich, wie sehr Christa Wolf der Zusammenbruch der DDR reute, wie wenig sie sich mit einem Leben in der Bundesrepublik arrangieren konnte, als wie beklagenswert sie den Verlauf der politischen Wende, der friedlichen Revolution erlebte und wie sehr sie sich in ihrem konsequenten Engagement gegen die Vereinigung rückblickend bestätigt fühlte.
2.1.2 „Sie hatte den Moment verpaßt, an dem die fröhliche Revolution zu Ende war“ - Das Bild der DDR-Opposition in Thomas Brussigs Helden wie wir und Wie es leuchtet
Auch Thomas Brussig stand der friedlichen Revolution in der DDR ambivalent gegenüber. Bereits mit seinem mehrfach adaptierten und überaus erfolgreichen[107] Roman Helden wie wir kritisierte er das Verhalten einiger Oppositioneller, namentlich das der Ostberliner Literatin Christa Wolf, deren vermeintliches „Schweigen“ zu DDR- Zeiten er „unanständig“ nannte,[108] und der er öffentlich vorwarf, ihre Literatur habe „nichts Aufstachelndes“ gehabt, Konflikte stattdessen beschwichtigt oder gedeckelt.[109] Die harsche Kritik, die er in seinem zweiten Roman an ihrer Rolle in der DDR und zur Wendezeit übte, ließ Wolf Biermann von „des unbekannten Autors Mord an der weltbekannten DDR-Schriftstellerin“ sprechen.[110]
Travestierte Brussig bereits Wolfs wohl bekanntesten Roman Dergeteilte Himmel mit dem Verweis auf den „geheilten Pimmel“ des Protagonisten Klaus Uhltzscht,[111] so entlarvte er sie als linientreue Autorin, indem er den Vorwurf versinnbildlichte, sie habe „eine Stillhalteliteratur, die jede kollektive Erektion, eben jene Volkserhebung verhindert habe“,[112] zu verantworten: Christa Wolfs literarischer Erstling Nachdenken über Christa T. wird dem am Genital operierten Uhltzscht im Krankenhaus als „Erektionsverhinderer“[113] anvertraut: „Ist zwar ein Liebesroman, aber [...] unbedenklich“, teilt ihm die Krankenschwester unter ironisierendem Gebrauch der
Amtssprache zwinkernd mit.[114] „Christa Wolf hat einen Roman geschrieben. Er ist irgendwem gewidmet. Sie hätte eindeutig schreiben können, wem sie ihr Buch widmet. Aber sie tut’s nicht, und ich weiß nicht, was gemeint ist. [...] Erhoffen Sie sich keine Klarheit - sie bleibt ihnen selbst in den simpelsten Dingen verwehrt“, erbost sich Uhltzscht später in seinem Krankenbett über die dem Roman Der geteilte Himmel vorangestellte Widmung Für G.[115]
Den Vorwurf der unnötigen Verrätselung, der Harmlosigkeit[116] bekräftigte Brussig, der Wolfs „subjektiver Authentizität“ eine „weitgehend faktenkonforme und subversiv-realistische DDR-Satire“ entgegenhielt,[117] schließlich auch mit seiner Kritik an der Rede Sprache der Wende, die die Autorin am 04. November 1989 auf dem Alexanderplatz hielt und die Bestandteil seines „Schelmenromans“[118] ist:
„,Jede revolutionäre Bewegung befreit auch die Sprache.’ Das war nicht etwa meine Mutter, die mit Linguisten diskutierte - dieser Satz kam aus den Lautsprechern. Allein diese Stimme zu hören, diesen mahnendgefaßten Tonfall, reichte mir, um bedient zu sein. Und überhaupt: Wie konnte man an so einem Tag über Sprache reden! Warum dann nicht gleich übers Wetter? Das wäre noch konsequent inkonsequent gewesen! Es sollte ums Ganze gehen, und nicht um Sprache! - Die Frau am Mikrophon war so weit entfernt, daß ich sie nicht erkennen konnte.
Wer ist sie? Wer ist diese Frau?“[119]
Die angesprochene Entfernung lässt sich einerseits insofern wörtlich verstehen, als Klaus Uhltzscht Christa Wolf zuerst „in pikaresker Unschuld“[120] mit der Eiskunstlauftrainerin Jutta Müller verwechselt und erst nach dem Mauerfall bei einer Zeitungslektüre zufällig seinen Irrtum erkennt: „Aber die schönste Rede hat wieder unsere Christa gehalten“,[121] spottet er - ein Verweis auf die eigentliche, die tiefere Bedeutung des hier verwandten Motivs: die ideologische Distanz zwischen Brussig und Wolf, die generationsspezifischen Ursprungs ist.[122] „Das war nicht etwa meine Mutter, die mit Linguisten diskutierte“, merkt Uhltzscht gleich zu Beginn seiner Schilderung an und ordnet Christa Wolf (Jahrgang 1929) damit der Ankunftsgeneration der DDR zu, der er vorwirft, „daß unsere Mütter so gnadenlos un-ta-de-lig waren!“, dass „sie doch die Exklusivrechte an befreiter Sprache gepachtet haben, auch wenn ihnen als erstes frei von den Lippen geht, daß aus Forderungen Rechte, also Pflichten werden. Und als gelte es, den letzten Hügel der Tugend zu erstürmen, beschenken sie uns mit einer Präambel zum Verfassungsentwurf, damit wir es schwarz auf weiß haben, wem oder was in Sachen 89 hinterherzutrauern ist. Die Verneigung kommender Historikergeneration ist ihnen sicher! Ein glänzender Abgang![123]
Klaus Uhltzschts von sarkastischen Momenten geprägter Gedenkenstrom liest sich nicht nur wie, es handelt sich bei ihm um Thomas Brussigs Abrechnung mit der Gründungsgeneration der DDR,[124] [125] deren herausragende Vertreterin sich - Brussig zufolge - ihrer „Unbedenklichkeit“ wegen als indirekte Stabilisatorin des SED-Regi- mes eignete.125 „Christa Wolf ist die too-good-mother, die nun zur bad mother und aus dem Olymp der Dichter gestoßen wird“,[126] urteilte Elke Brüns nicht völlig zutreffend. Denn natürlich und offensichtlich gerät Wolf in dieser Passage zur Zielscheibe der Kritik, diese ist aber nicht ausschließlich an sie gerichtet, macht doch bereits die Verwechslung mit Jutta Müller und Uhltzschts Klarstellung, es handele sich bei der Rednerin nicht um seine Mutter, deutlich, wie substituierbar die Figur Christa Wolf trotz der von ihr verfassten „Sozialismusfiktion“[127] und ihrer einstigen Rollen als „Paradigma [...] des Intellektuellen in der DDR bzw. in totalitären Systemen und Strukturen“,[128] „DDR-Staatsdichterin“,[129] „literarisch-politische Ikone der DDR“,[130] als „Mächtige unter den Macht-losen“[131] und schließlich als „versagende Intellektuelle im Angesicht totalitärer Herrschaft“[132] tatsächlich ist.[133] Brussig wies in einem Interview darauf hin, ihm ginge es in seinem Buch weniger um die Person Christa Wolf, eher um die Frage, worin ihre Popularität begründet sei.[134] Was Wolf Biermann für den deutschen-deutschen Literaturstreit feststellte, gilt folglich auch für Brussigs Kritik: In beiden Fällen ging es „nicht um Christa Wolf“.[135]
Zwar kritisierte Thomas Brussig auch an die von Klaus Uhltzscht zur „Mutter aller Mütter“[136] apostrophierte Christa Wolf gewandt,[137] die DDR sei „auch durch Feigheit zusammengehalten worden“.[138] Er grenzte sich aber nicht alleine von der Ostberliner Autorin ab, sondern vollzog die spätestens nach dem Mauerfall scheinbar notwendig und möglich gewordene literarische Abrechnung der mehrheitlich nicht in die DDR-Gesellschaft integrierten[139] „Zonenkinder“[140] mit ihrer Elterngeneration.[141] Ihr sprach er ab, maßgeblich an der Revolution beteiligt gewesen zu sein.
Und mehr noch: Besonders scharfsinnig erkannte Julia Kormann in dem literarischen Fakt, dass gerade Klaus Uhltzscht, der von Neurosen gezeichnete und naive „Simplizissimus des Ostens“,[142] den Mauerfall bewirkt,[143] eine deutliche Absage an überhaupt jede Existenz einer Opposition.[144] „Weil alle anderen von der Stasi wußten und sich in der Gesellschaft der DDR zu Recht fanden“, führte sie aus, „muß der, der das Außergewöhnliche leistete, eine Ausnahme sein und seine Tat eine Einzeltat.“[145] Tatsächlich erklärte Thomas Brussig die deutsche Einheit für derartig missraten, dass „sie durchaus einen Urheber wie Klaus Uhltzscht haben könne.“.[146] Er verdeckte mit dieser Aussage aber den unter anderem von Oliver Igel benannten Fakt, dass es sich beim Protagonisten um eine kollektive Identität, um die Personifikation der DDR handelt.[147] „Es war der SED-Staat selbst, der schlicht zusammenbrach und sich zu einem großen Teil einfach selbst zerstörte“, umriss Igel die Kernaussage von Brussigs Satire.[148] [151]
Die Kritik am „Mythos“ einer Revolution verstärkte der Ostberliner Romancier mit seinem Roman Wie es leuchtet. Das Gedicht Das Eigentum, das der kleine Dichter auf Hiddensee schreibt[149] und das Brussig, wie der Quellenhinweis auf der letzten Seite des Buches verrät,[150] von Volker Braun übernahm, kann als Indiz für seine Einstellung zur Wende gelten. Elke Brüns analysierte die Haltung des lyrischen Ichs, die sich Brussig mit der Übernahme des Gedichts aneignete, wie folgt:
„Das lyrische Ich vertritt [...] einen bewegungslosen Standpunkt: ,Da bin ich noch’. Die Starre [...] signalisiert [...] gleichermaßen Ratlosigkeit, sozialistische Prinzipientreue, Präsenz und eine wirklich revolutionäre und dichterische Gesinnung. Da sich aus der Sicht des Dichters der Aufbruch der DDR-Bür-ger mit dem (antizipierten) Beitritt der DDR zur BRD in eine Konterrevolution verwandelte, kann der wirkliche Revolutionär und Poet keiner politischen Bewegung mehr folgen, sondern muß im Stillstand verharren.“151
Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangte Volker Wehdeking: er erkannte in dem Gedicht eine „Position des Reformgläubigen“ und kam mit Hinblick auf Volker Brauns sozialen Rang als „ein unermüdlicher Kritiker an den DDR-Zuständen“ zu dem Schluss, nach dem Mauerfall gefalle sich der Dichter zwischen den Stühlen.[152] Bedenkt man, dass Braun seine Einschätzung zur Wende in der DDR mit dem Wissen um die bevorstehende Vereinigung vermittelte,[153] liest sich der Vers: „Es wirft sich weg und seine magere Zierde“ als Hinweis auf die kurz zuvor vollzogene Währungsunion, als Vorwurf an die Revolution, sich verkauft zu haben.[154] Brauns Gedicht erscheint somit als wichtiges „Dokument der Bewußtseinslage von Intellektuellen in der DDR“.[155]
Eine Parallele findet Brauns Haltung in Thomas Brussigs Position zu Mauerfall und Vereinigung. Gestand Brussig dem Wendejahr 1989/1990 zu, „voller Höhepunkte“ gewesen zu sein, so erklärte er die Geschehnisse der Zeit nach 1989 noch „so wenig wie vorher“ verarbeitet zu haben.[156] Entsprechend ambivalent fällt das Bild aus, das er in Wie es leuchtet abseits des Gedichts Das Eigentum mit dem Wissen um ihr Ergebnis von der friedlichen Revolution in der DDR zeichnete:
„Es brach eine Zeit an, in der tatsächlich vieles anders wurde, weil viele etwas machten, das sie bis dahin nicht gemacht hatten. Eine Mutter schreibtan den Innenminister. Eine Schriftstellerin tritt aus der Partei aus. [...] Eine Tierärztin wird Vegetarierin. [...] Alle machten etwas, das schon lange fällig war. Das Netz aus alten Gewohnheiten und Abhängigkeiten, aus Untätigkeit,Gleichgültigkeit und Ohnmacht war löchrig. Bald würde es ganz reißen“[157],
blickte Brussig mit der Stimme des Erzählers zurück auf die sich formierende Opposition, deren anfängliche Spontaneität und energetische Originalität er positiv hervorhob: Lena, die Rollschuh fahrende Krankenschwester, deren Lied „Warum können wir keine Freunde sein“ „dem Bürgermeister von Karl-Marx-Stadt viertausendstimmenfach vorgesungen [...] und schließlich während der größten Montagsdemonstration in Karl-Marx-Stadt [von] einhundertfünfzigtausend Menschen am Karl-MarxDenkmal zehn Minuten lang“ gesungen wird, stilisiert der Erzähler beispielsweise zur „Volksheldin“ und „Jeanne d’Arc von Karl-Marx-Stadt“, da sie „das Einmalige [...] und das Niewiederkommende verkörperte, einer ganzen Stadt Lust auf Veränderung, auf Revolution und auf Freiheit machte.“[158] Sie hilft der Opposition, die sich zuvor „ohne Lied und ohne Ziel [...] wie ein Antragssteller der immer aufs falsche Amt geschickt wird“ geriert,[159] sich zu formieren.
Doch richtet sich an Lena als führende Oppositionelle schließlich auch der Vorwurf, den Moment verpasst zu haben, „an dem die fröhliche Revolution zu Ende war [...], als es eine Regierung gab, die ihre Macht zur Disposition stellte“.[160]
Wie es leuchtet ist eine Hommage an die Anfangszeiten des politischen Protests. Der Roman dokumentiert zugleich aber auch die Ohnmacht der Oppositionellen, das von ihnen erzeugte Machtvakuum zu füllen. Gleich doppelt versinnbildlichte Brussig, woran es ihnen fehlte, an Ideen und Idealen: Die vom Erzähler wortgewaltig zur „Abrechnung“[161] erklärte Belegschaftsversammlung des Krankenhauses, in dem Lena arbeitet, erschöpft sich erstens „schon nach zehn Minuten“ und obwohl dringlichere Themen wie der Test nicht zugelassener Medikamente an unwissenden Patienten zu debattieren wären, in Gesprächen über Belanglosigkeiten wie „Friseur und Fleckensalz“.[162] Sie wird vom karrierebewussten Dr. Matthies schließlich genutzt, sich anstelle des untragbar gewordenen Professors Hense als „Chef der Inneren“ zu installieren.[163]
Zum zweiten Mal verpassen die Oppositionellen ihre Chance, Veränderungen herbeizuführen, revolutionäres Format anzunehmen, als die Musiker Crosby, Stills and Nash am Brandenburger Tor auftreten:
„Daniels Gedanken [...] begaben sich auf Wanderschaft. Er glaubte zu verstehen, daß es ein Traum war, der die drei Weltstars [...] hierher führte [...]: Es war der Traum vom Frieden. [...] Daniel dachte an eine Erzählung von Leonhard Frank [...]. In dieser Erzählung wird eine ganze Stadt nur dadurch lahmgelegt, weil alle Menschen umherlaufen und Frieden rufen [...] Daniel Detjen blieb, bis die Musiker einpackten [...], die Traube der Zuhörer wuchs nie zu einer Menge an, die groß genug war, daß sie, wenn sie sich zerstreut, eine Stadt [...] mit dem Wort Frieden infizieren kann. Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Utopien nie wahr werden, dachte Daniel Detjen.“[164]
Was in der Romanwelt schließlich von der Oppositionsbewegung bleibt, ist eine für sich sprechende Situation: „Zwei bürgerrechtlich anmutende Gestalten“, die „sich in der Richtungsfrage engagierten, umringt von Hunderten, und wie ein Fotovon Lenas Bruder belegt, zeigten sie in genau entgegengesetzte Richtungen“.[165] In diesem Bild konzentriert sich Brussigs Haltung zur Wende, sein Bedauern darüber, dass sich der spontane Protest nicht in effektive Oppositionsarbeit verwandelte.
2.1.3 „Am Ende stehen wir alle mit leeren Händen da“ - Das Bild der DDR-Opposition in Günter Grass’ Ein weites Feld
Ähnlich urteilte auch Günter Grass. Erzählstrategisch dekonstruierte er das Theorem der friedlichen Revolution, indem er die Übermacht der Eliten darstellte. So ist es beispielsweise der Stasispitzel Hoftaller, der - unwidersprochen, aber vom Erzähler mit dem Vorwurf der Larmoryanz leicht ironisiert[166] - die Gründe für den Zusammenbruch der DDR benennt:
„Die drüben haben uns fix und fertig gemacht. Kein Wunder! Die gaben das Tempo an, wir mußten Schritt halten. Mußten wir gar nicht, dachten nur, daß wir unbedingt mußten, na, Wettlaufen, Wettrüsten, bis wir außer Puste, ausgelaugt, leergeschrappt waren. Nun ist das ganze schöne Volkseigentum für die Katz...“167
Die Wende erscheint so als ökonomisch und nicht als politisch bedingter Zusammenbruch. Grass führte mit seinem Roman vor Augen, wie sehr es den Oppositionellen an revolutionärem Format und an Geschlossenheit mangelte, mehrheitlich am Beispiel der sich im Umkreis der Lychener Straße bewegenden systemkritischen Literaten, aber wenigstens im Redundanzbereich der Handlung auch am Exempel des Kreises um Christa Wolf.
Während Thomas Brussig, wie oben gezeigt, harsche Kritik an der Ostberlinerin übte und einzig ihren Parteiaustritt guthieß, zeigte Grass Verständnis für ihre und allgemein die Situation der ostdeutschen Literaten. Er warb für einen respektvollen Umgang mit dem Erbe der von ihnen produzierten Literatur. Ähnlich wie über Armin Müller, der „seinen Whisky zelebriert und sich via Zigarre über seinen Meister Brecht mokiert“, urteilt der Protagonist Theo Wuttke zwar auch über Christa Wolf negativ, da sie sich „tapfer ihr Damenkränzlein“ halte, in dem man in „Hosen und mit Krawatte grad noch geduldeter Gast“ sei, und „Hunderte solcher Blaustrümpfe wie Ludovica Hesekiel mit Sechser-Moral und Dreier-Patriotismus unsere Literatur[167] besorgen“.[168] Doch kritisiert der Erzähler auch, dass die von ihm zur „Heiligen“ stilisierte Wolf „zur Staatshure erklärt“ worden ist, dass „in jenen Tagen der Wendezeit [...] in West wie Ost Schriftsteller andere Schriftsteller an den Pranger stellten“, dass sich „Kleingeister [...] richterlich“ gebärdet haben und „ein jeglicher [solange] unter Verdacht stand“, bis die „östliche Literatur“ schließlich sogar „nur noch nach westlichem Schrottwert gehandelt“ worden sei.[169]
So vehement Günter Grass den opportunistischen Umgang mit den ostdeutschen Literaten kritisierte, so wenig gestand er ihnen und den übrigen Oppositionellen aber revolutionäre Qualitäten zu: Am Beispiel des Prenzlauer Bergs, der „als traditioneller Arbeiterbezirk [...] der Gegenpol aller Orte offizieller Politik“ und „in DDR-Zeiten [...] Heimstatt von Unangepasstheit“ war,[170] veranschaulichte er die „Harmlosigkeit“[171] der Oppositionellen. Die zentrale Figur der „unruhigen und manchmal vorlauten Prenzlberger Szene“ ist - wegen seiner Funktion, als „Schutzpatron“ und seiner Aufgabe „zwischen den sich [lediglich, M.H.] anarchistisch gebenden Dichtern und der immer besorgten Staatssicherheit zu vermitteln“[172] - mit Theo Wutt- ke ausgerechnet jemand, der sich selbst als politisch „wankelmütig seit jeher“ beschreibt und den Kulturbund für sich als, wie sich Professor Freundlich treffend ausdrückt, „eine Spielwiese mit wenig Auslauf, aberviel Betrieb“ entdeckt.[173]
Der Allmacht der Geheimdienste, die, wie Wuttke sich schmerzlich eingestehen muss, „bis hin zum jüngsten Spitzelsystem einen Überwachungsstaat errichten, netzförmig erweitern, verdichten, perfektionieren“,[174] können sich weder er, noch die übrigen Oppositionellen erwehren. „Niemand war sich auf dem Prenzlberg seiner selbst sicher“,[175] teilt Theo Wuttke seiner Enkelin mit.[176] Und der Erzähler beschreibt die Gegend rund um den Kollwitzplatz als ein „Quartier“, in dem „der Mief besonders dicht und von Heimlichkeiten gesättigt war“, in dem sich die „Szene mehr selbstbezogen als konspirativ versammelt habe“, in dem „jeder des anderen Informant und keiner unbeschattet gewesen“, in dem „Verrat [...] ein und aus“ gegangen sei.[177] In einer dermaßen von Repressionen geprägten Romanwelt verfügen die Systemkritiker, wie es der Stasispitzel Hoftaller nennt, einzig über „Narrenfreiheit“.[178] Hoffnungen auf einen politischen Wandel verwirft er unwidersprochen als „lauter Illusionen“.[179]
„Wer hat unser sozialistisches Vaterland wie eine geschlossene Anstalt gesichert und den Schriftstellern obendrein, sobald sie aufmuckten, den Kantschen Zynismus als kategorischen Imperativ getrichtert? Sie waren das, vielgestalt Sie! In immer größerer Erfolgsauflage: Sie, Sie und Sie. Dabei allzeit lesefreudig, denn eure von mir unbestrittene Liebe zur Literatur erschöpfte sich in der von euch wortklaubend besorgten Zensur. So nah standen wir eurem Herzen, daß dessen Pochen uns den Schlaf nahm. Eure Fürsorge hieß Beschattung. Rund um die Uhr habt ihr Schatten geworfen. Tagundnachtschatten seid ihr. In Armeestärke fiel Schat-ten auf uns ,[180] fällt Wuttkes Resümee über die Möglichkeiten der Opposition entsprechend wehmütig aus. Und selbst der Erzähler grämt sich über den ausgebliebenen politischen Umsturz, die verpasste Umkehrung des Machtverhältnisses:
„Zuletzt waren sie sich am 4. November auf dem Alexanderplatz begegnet, als Fonty seine große Rede hielt und [...] vor einer Wiederholung der Achtundvierziger Revolution und dem nachfolgenden Katzenjammer warnte. ,Eine sanfte Revolution ist keine!’ rief er. Aber die viel-tausendköpfige Menge klatschte nur Beifall; niemand hörte auf ihn.[181] “
Schließlich bleibt es im Roman dem Jenaer Professor Freundlich vorbehalten, über das Resultat der politischen Wende zu befinden: „Doch was ging nicht verloren? Hand aufs Herz, Wuttke! Was zählt noch? Wie ich Ihnen kürzlich schrieb: Nichts bleibt. Am Ende stehen wir alle mit leeren Händen da“.[182]
Grass stand mit dieser Auffassung von der ausgebliebenen Revolution, die sich unverkennbar als Antwort auf Christa Wolfs mit der Erzählung Was bleibt aufgeworfene Frage liest und die - wie gezeigt - von Thomas Brussig geteilt wird, allerdings keinesfalls isoliert dar: Jürgen Habermas klagte über den „fast vollständigen Mangel an innovativen zukunftsweisenden Ideen“, der zum Scheitern der Revolution geführt habe.[183] Der Münchener Althistoriker Christian Meier warnte bereits im Februar 1990: „Die Gewaltlosigkeit hat natürlich ihren Preis. Denn manches an einem Umsturz ist revolutionär leichter zu erledigen als rechtsstaatlich. Wird die Versöhnlichkeit in den revolutionären Akt mit hineingenommen, verliert er an Schärfe.“[184]
Noch deutlicher formulierten Kurt Drawert und Karl Heinz Bohrer ihre Kritik an der Opposition in der DDR. Warf Drawert den Regimekritikern 1993 wegen ihrer „Aggressionsgehemmtheit [...] ein stilles Einverständnis mit den Zuständen der Macht“ vor,[185] zitierte Bohrer den französischen Journalisten, Publizisten und Historiker Joseph Rovan, der den Deutschen zu einer kurzen Phase blutiger Säuberungen geraten hatte, und beklagte: „Es fehlen Tote“.[186] Und Günter Kunert beantwortete die Frage, ob 1989 eine Revolution gewesen sei, 1997 schließlich mit den Worten: „Nein, denn es ist ja niemand an die Laterne gehängt worden.“[187]
2.2 „Sie wissenja, wir können auch anders“- die Haltung der ostdeutschen Eliten zur Wende
Das effektive Krisenmanagement der ostdeutschen Eliten, denen es gelang, der sich zur revolutionären Bewegung formierenden Opposition vor Anbeginn der von Rovan geforderten „Phase blutiger Säuberungen“ die Dynamik zu nehmen, den politischen Umbruch in eine „Wende“ (Egon Krenz) zu transformieren, führte zum bis dato einmaligen Szenario einer friedlichen Revolution und evozierte bei den an den historischen Prozessen beteiligten Irritation und Hilflosigkeit. „Das ,letzte Gefecht’“, so beklagte es der Historiker Stefan Wolle, „ging um Devisenkonten bei ausländischen Banken, um Immobilienschiebungen und die Altersrente der SED-Funktionäre. [...] Selbst die Drachentöter überraschte soviel Hilflosigkeit. Es beleidigte sie fast, in welchem Maße sich die Herrschenden dem Endkampf entzogen, denn Lanzelot ohne Drachen gerät ebenfalls leicht zur lächerlichen Figur.“[188]
Bald nach dem 09. November 1989 stellte sich bei den Regimegegnern Ernüchterung und Erstaunen über das letztlich banale Ende der SED-Diktatur ein: „Das berühmte Rätsel der Sphinx war so banal wie das innere Geheimnis der Diktatur.
[...]
[1] Peter Schneider 1982, S. 117.
[2] Analog zu Elke Brüns (2006: S. 10) und rekurrierend auf den Bielefelder Historiker Hans-Ulrich Wehler verwende ich in dieser Arbeit explizit nicht die Begriffe der „Wiedervereinigung“ und „Reunion“, sondern den wesentlich trennschärferen Terminus der „Vereinigung“. Wehler (1997: S. 376) hielt fest, dass sich 1990 keine Wiedervereinigung vollzogen habe, sondern „ein neuer Staatsbildungsprozess [...]- eine neue Nationsbildung“.
[3] Reed 1993, S. 234.
[4] Jürgen Schröder 1994, S. 4.
[5] Mayer-Iswandy 1994, S. 17.
[6] Schmitz 1995, S.13.
[7] Kocka 1995, S. 180.
[8] Roters 1997, S. 18.
[9] Ebd., S. 19.
[10] Michael Braun 2000, S. 107. Vgl. Tate 1997.
[11] Zitiert nach: Wehdeking 2000d, S. 7. Günter de Bruyn (1991) bekräftige mit dieser Aussage seine bereits 1990 bekundete Auffassung, die „Deutschen seien nicht willens, eine Nation zu werden“.
[12] Brüns 2006, S. 10.
[13] Dieckmann 1998b.
[14] Thumfahrt 2002, S. 40.
[15] Zitiert nach: Brüns 2006, S.11.
[16] Ebd.
[17] Reißig 2000, S.91f.
[18] Zitiert nach Leistner 1999, S. 18.
[19] Brüns 2006, S.11.
[20] Einer im Oktober 2008 veröffentlichten, repräsentativen Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach zufolge, bewerten lediglich 19 Prozent der ostdeutschen und 39 Prozent der westdeutschen Bevölkerung das deutsche Wirtschaftssystem positiv. Ähnlich fällt das Urteil über die bundesdeutsche Demokratie aus. Sie wird zwar von immerhin 62 Prozent der Westdeutschen als politisches System befürwortet, von ganzen 71 Prozent der Ostdeutschen aber abgelehnt. Vgl. Köcher 2008 online. Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangte die forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analyse im Dezember 2008 in ihrer von der Berliner Zeitung (2009 online) in Auftrag gegebenen Studie. Nur 46 Prozent der befragten Ost- und 40 Prozent der Westdeutschen gaben an, dass sich ihre persönlichen Lebensbedingungen seit 1989/1990 verbessert hätten. Jeder vierte befragte Ostdeutsche war gar der Meinung, den Menschen in den fünf neuen Bundesländern gehe es heute schlechter als vor der Wende. Forsa-Geschäftsführer Manfred Güllner schlussfolgerte, die Euphorie, die nach dem Mauerfall geherrscht habe, sei weitgehend verflogen. Zitiert nach: Nomen Nescendi 2009 online.
[21] Während die (kulturelle) Rückbesinnung auf die DDR, denkt man nur an die zahlreichen Souvenirartikel und an Kinofilme wie Wolfgang Beckers Good Bye, Lenin!, Dominik Grafs Der Rote Kakadu oder Leander Haußmanns Adaption von Thomas Brussigs Roman (Am kürzeren Ende der) Sonnenallee, unter dem Begriff der „Ostalgie“ längst popularisiert, kommerzialisiert und letztlich auch kodifiziert wurde, wird man den Begriff der „Westalgie“ vergeblich im Duden und im öffentlichen Bewusstsein suchen. Elke Brüns (2006: S. 11) wies als eine der ersten daraufhin, dass es auch im Westen eine Sehnsucht nach der Vergangenheit, der alten Bundesrepublik gebe - „auch wenn es viel weniger wahrgenommen, geschweige denn zum Thema wurde“. Als Belege können Romane wie Michael Kumpfmüllers Hampels Fluchten (2000), Florian Illies’ Generation Golf (2000), Frank Goosens liegen lernen (2000) sowie beispielsweise auch Sven Regeners Trilogie Herr Lehmann (2001), Neue Vahr Süd (2004) und Der kleine Bruder (2008) gelten, mit denen die alte Bundesrepublik erinnerbar wird.
[22] Wolle 1998.
[23] Brüns 2006, S.11.
[24] Wilke (2000: S. 84f) zufolge lässt sich der Prozess der sozialen Vereinigung in vier Phasen gliedern: in eine euphorische, in der der 09. November und der 03. Oktober als Ergebnisse einer gelungenen Revolution gefeiert würden, eine Entfremdungsphase, in der das Gefühl des Fremdseins im eigenen Land einsetze und Nostalgie zunehme, eine Eskalationsphase, in der sich die Konflikte zwischen Ost und West verschärften und schließlich eine Verständigungsphase. Berechtigte Hoffnung auf ein deutsch-deutsches Zusammenwachsen besteht demnach.
[25] Bogdal 1998, S. 10. Ein Befürworter von Bogdals These war beispielsweise Hans-Christoph Graf von Nay- hauss (2002: S. 67). Er führte aus, „im Vergleich zu der Zäsur von 1968“ sei „die Wende 1989 politisch zwar unglaublich gewesen, mental in thematischer Hinsicht jedoch nur in kleinerer Potenz vor allem für die DDR- Autoren als ein Nachholen des Umbruchs von 1968 mit zwanzig Jahren Verspätung anzusehen“. Er (Ebd., S. 71) behauptete, von „einer Zäsur oder einer neuen Epoche der deutschen Literatur“ könne also nicht gesprochen werden, und schlussfolgerte schließlich, Wendeliteratur sei „höchstens Ende-Literatur in dem Sinne, daß der Abschied vom Buch-Zeitalter spürbarer“ werde. Hannes Krauss (1999: S. 44) teilte diese Auffassung bedingt. „Die Wendeliteratur gibt es nicht“, führte er aus. „Es gibt Themen und psychologische Dispositionen, die im Umfeld dessen, was wir Wende nennen, an Virulenz gewannen. Und es gibt natürlich die für viele ehemalige DDR-Autorinnen [sic!] existenzielle Frage nach ihrer künftigen Rolle.“ Auch Koopmann (1997: S. 29) stimmte Bogdal indirekt zu, als er beklagte, die Literatur der 1990er Jahre sei „gesellschaftsfern“; politische oder soziale Themen fehlten. Sein kritisches Urteil war allerdings in ein beinahe schon paradoxes kulturelles Klima eingebettet: Während zahlreiche Literaturkritiker noch die Sehnsucht nach dem „großen, gültigen Epochenroman der Wendezeit“ (Schirner 1993: S. 11) verspürten, erschien zeitgleich eine „kaum überschaubare Flut von ,Wende- texten’“ (Brüns 2006: S. 31). Entsprechend irritiert reagierten Literaten wie Jurek Becker, der in einem Interview mit dem Spiegel 1994 über den „gewaltigen Erwartungsdruck“ klagte, der „seit drei Jahren [...] in vielen Schriftstellerzimmern [...] wie eine fürchterliche giftige Wolke“ schwebe. Zitiert nach: Wehdeking 1995a, S. 147.
[26] Klaus Welzels (1998: S. 11) Feststellung, Literaturwissenschaft orientierte sich „von jeher an der historischen Entwicklung“, sie sei „nicht frei von Geschichte, von Geschichtsschreibung, - und in der Gegenwart: von Politik“ bewahrheitete sich auch angesichts der Erforschung der Literatur zu Wende und Vereinigung: Bereits 1997 regten Walter Erhart und Dirk Niefanger (1997: S. 1) an, nicht nur nach den Reaktionen der Literatur auf die jeweilige historische Entwicklung, sondern auch nach den spezifischen Wechselbeziehungen“ zu fragen, die „Gesellschaft und Literatur an solch entscheidenden, im Wortsinn ,kritischen’ Wendepunkten miteinander eingehen“. 2001 kamen Carol-Anne Costable-Heming, Rachel Halverson und Kristie Foell (2001: S. 4) schließlich zu der unstrittigen Einsicht, dass „writers and filmmakers“ am „process of change“ beteiligt (gewesen) seien. Sie regten an, in Romanen und Filmen nach den Antworten auf die Fragen zu suchen, die Wende, Mauerfall und Vereinigung aufgeworfen haben.
[27] Bogdal 1998 , S. 10.
[28] Zitiert nach: Brüns 2006, S. 12.
[29] Laut der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Studie Lesen in Deutschland 2008 der Stiftung Lesen (2008 online: S. 64) bleibt die „Zahl der Nicht-Leser [...] konstant“, sinkt die „Zahl der Bücher pro Haushalt“ (Ebd., S. 65), ist die Akzeptanz des gedruckten und gebundenen Wortes aber unverändert hoch: „Die Deutschen benennen - zumindest derzeit - explizit drei Print-Vorteile: Vertrauenswürdigkeit, Vermitteln von Orientierung beim Lesen, Mobilität“, urteilten die Herausgeber (Ebd., S. 66) über den Stellenwert des Buches. Aller technischen Neuerungen zum Trotz, scheint mir die Zukunft des gedruckten Romans als Charakteristikum unserer abendländischen Kultur und Untersuchungsgegenstand der Philologie deshalb gesichert.
[30] Bereits 1996 bezifferten Jörg Fröhlich, Reinhild Meinel und Karl Riha (1996) die Zahl der Arbeiten, die die ideologisch wie theoretisch heterogene Transformations- beziehungsweise Transitionsforschung hervorbrachte, auf über 3000 Titel.
[31] Brüns 2006, S. 12.
[32] Das Internetportal wiedervereinigung.de, die selbst ernannte Bibliographie zur Deutschen Einheit, listet aktuell 53 000 Literaturtitel auf, die sich mit der politischen Wende in der DDR und der Vereinigung der beiden deutschen Staaten befassen. (Stand: 07. Oktober 2008)
[33] Einen unterschiedlich akzentuierten, aber zumeist detaillierten und in seinen Urteilen differenzierten Überblick über die Literatur der Gegenwart bieten folgende Arbeiten: Böttiger 2004, Carduff; Vedder (Hg.) 2005, Döring (Hg.) 1995, Erb (Hg.) 1998, Freund; Freund (Hg.) 2001, Harder (Hg.) 2001, Kammler; Pflugmacher (Hg.) 2004, Knobloch; Koopmann (Hg.) 1997 und 2003, Preußer 2003. Ergänzt werden sie durch breiter angelegte Arbeiten wie die folgenden, welche die Literatur der Gegenwart in einen zeitlich weiter gefassten Kontext einordnen: Bahr (Hg.) 1998, Barner (Hg) 1994, Briegleb; Weigel (Hg.) 1992, Detering; Krämer (Hg.) 1998, Glaser (Hg.) 1997, Schnell 1993, Weidermann 2006.
[34] Zu einem ähnlichen Urteil gelangte Gerhard Sauder (2000: S. 291). Er verstand unter „Wendeliteratur“ alle Texte, „die - in welcher Form auch immer - die Übergangszeit von 1989/1990 als Motiv, Allegorie, zentrale Metapher oder Plot gewählt haben“. Und auch Oliver Igel (2005: S. 21) plädierte für einen „gattungsübergreifenden Begriff, weil auch die so genannte Wende alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens umfasst“.
[35] Grub 2005 Band 1, S. 68.
[36] Ebd., S. 71.
[37] Ebd., S. 8.
[38] Wehdeking 1995a. Seine Theorie vom Zusammenwachsen der deutschen Literaturen entwickelte Wehdeking zuvor in folgenden beiden Aufsätzen: Wehdeking 1994 sowie 1995b Seine Auffassung von einer baldigen Symbiose ost- und westdeutscher Literaten bekräftigte er 1996 (ders. 1996), auch wenn er einräumte, die jüngere Vergangenheit werde verschieden reflektiert.
[39] Wehdeking 1995a, S. 16f.
[40] Wehdeking (Hg.) 2000d, S. 8. Voraus gingen folgende Aufsätze: Wehdeking 1999b sowie in Details leicht abgeändert: ders. 1999a.
[41] Wehdeking 2000a, S. 14f.
[42] Wehdeking 2000b, S. 38f.
[43] Wehdeking 2000d, S. 7.
[44] Ebd., S. 11.
[45] Wehdeking 2000b, S.41.
[46] Emmerich 1994b, S. 193.
[47] Emmerich 1997, S. 523. Emmerich griff hiermit eine Feststellung Uwe Wittstocks (1990) auf, der bereits 1990 ausgeführt hatte, die Mauer habe „keinen Keil zwischen die Schriftsteller treiben“ können. Die Wiedervereinigung habe es indessen „spielend geschafft“.
[48] Radisch 2000, S. 23.
[49] Ebd., S. 19. Als Ausnahme führte Radisch (Ebd., S. 22) Reinhard Jirgls Roman Abschied von Feinden an, den sie zum „ersten wahrhaftigen Wenderoman“ kürte, in dem die Grenze oberflächlich gesehen zwar gefallen sei, der aber auch verdeutliche, dass „der Untergang des Abendlandes [...] durch so eine winzige Grenzöffnung nicht aufzuhalten“ sei, da Jirgl „die ganze Welt“ als „eine einzige riesige DDR“ und „selbst Westdeutschland [...] als die Feiertagsausgabe des alten Elends“ zeichne.
[50] Ebd., S. 18.
[51] Ebd., S. 23.
[52] Brüns 2006. Den der Habilitationsschrift zugrunde liegenden wissenschaftlichen Ansatz stellte Brüns (2003) in ihrem Aufsatz Körper, Familie, Paar. Literarische Bilder der Wiedervereinigung vor.
[53] Brüns, Mauerfall., S. 17.
[54] Ebd., S. 243.
[55] Ebd., S. 261.
[56] Ebd.
[57] Ich verwende den Begriff „Quelle“ in dieser Arbeit in Anlehnung an die bis heute unumstrittene Auffassung des Historikers Paul Kirn. Kirn (1968: S. 29) führte erstmals 1947 aus: „Quellen nennen wir alle Texte, Gegenstände oder Tatsachen, aus denen Kenntnis der Vergangenheit gewonnen werden kann“. Er griff damit auf eine ältere Erkenntnis Ernst Bernheims (1908: S. 252) zurück, der Quellen 1908 als „Resultate menschlicher Betätigungen [definiert hatte, M.H.], welche zur Erkenntnis und zum Nachweis geschichtlicher Tatsachen entweder ursprünglich bestimmt oder doch vermöge ihrer Existenz, Entstehung und sonstiger Verhältnisse vorzugsweise geeignet sind“. Zustimmung erhielt Kirn in neuerer Zeit unter anderem von Winfried Schulze (1987: S. 32), der seine Definition noch allgemeiner hielt: „Quelle ist alles, worauf unsere Kenntnis der Vergangenheit ursprünglich zurückgeht“, erklärte er.
[58] Die Auswahl der Romane erfolgte in dem Bewusstsein, in einer Arbeit mit solch geringem Umfang wie diesem keinen erschöpfenden Überblick über die Literatur der 1990er und 2000er Jahre geben zu können, die sich mit Wende, Mauerfall und Reunion beschäftigt. An die Stelle von Vollständigkeit trat in meinem theoretischen Konzept deshalb das Bemühen um Repräsentativität und Exemplarität, indem ich mit Christa Wolf und Günter Grass zwei schon vor 1989/1990 namhafte ost- beziehungsweise westdeutsche Literaten und mit Thomas Brussig und Thomas Hettche zwei Vertreter der jüngeren ost- beziehungsweise westdeutschen Schriftstellergeneration ausgewählt habe.
[59] Brüns 2006, S. 22. Zustimmung erhielt Brüns beispielsweise von Oliver Igel (2005: S. 15), der herausstellte, dass sich „eine politische Dimension“ ergebe, wenn Geschichte in Literatur behandelt werde, die zeitlich noch nicht weit zurückliege, „also die betreffende Generation über sich selbst schreibt“. Weil die Wende „auch das Private politisiert“ habe, plädierte er (Ebd., S. 23) dafür, in den Romanen „die Vielfältigkeit des politischen Charakters“ herauszuarbeiten.
[60] Hettche 2002 (1995).
[61] Grass 1995b.
[62] Wolf 1996b.
[63] Susanne Kunckel (2004) brachte diese Genrebezeichnung bald nach Veröffentlichung des Romans Wie es leuchtet am 19. September 2004 in den Diskurs ein. Zwischenzeitlich nutzen sowohl der Autor als auch der S. Fischer Verlag dieses Prädikat zur Vermarktung des Romans Wie es leuchtet, so etwa auf dem Backcover der von mir verwendeten Taschenbuchausgabe.
[64] Brussig 2006.
[65] Bereits zuvor verfasste Thomas Brussig die beiden Werke Helden wie wir (1995) und Am kürzeren Ende der Sonnenallee (1999), die von der Kritik als „Wenderomane“ erkannt wurden. So erklärte beispielsweise Roberto Simanowski (1996: S. 158) Helden wie wir zum „lang ersehnten Wenderoman“, während Andreas Nentwich (1999) Am kürzeren Ende der Sonnenallee - motiviert durch die auf den 10. Jahrestag des Mauerfalls datierende Kinopremiere von Leander Haußmanns Adaption Sonnenallee - „post festum in den Rang des offiziellen Wenderomans“ erhoben sah. Beide Bücher werden an einigen, wenigen Stellen dieser Arbeit zu Vergleichen herangezogen, deren Ziel es ist, das Urteil über Brussigs Zeitroman Wie es leuchtet und über seine Haltung zur Vereinigung abzurunden. Ich habe mich deshalb dafür entschieden, letztgenannten Roman zu analysieren, weil er einerseits noch weitestgehend seiner wissenschaftlichen Bearbeitung harrt, eine positive Ausnahme bildet die Masterarbeit Licht und Chaos - Thomas Brussigs Wendepanorama, die Hävard Egeland (online) im Mai 2008 am Germanistischen Institut der Universität Bergen einreichte, und weil er andererseits als erstes Werk in Brussigs Oeuvre die Zeit nach dem 09. November 1989 thematisiert und sich insofern besser zum Vergleich eignet. Vgl. Magenau 2000, S.41 sowie Reimann (2008: S. 253).
[66] Elke Brüns (2006: S. 233) sprach davon, „daß die DDR zehn Jahre nach Mauerfall und Wiedervereinigung im kollektiven Bewußtsein historisch geworden“ sei. Als Indize wertete sie Romane wie Michael Kumpfmüllers Hampels Fluchten oder aber auch Thomas Brussigs Am kürzeren Ende der Sonnenalle, mit sowie in denen und durch die „die DDR erinnerbar wurde“.
[67] Die vier Literaten waren sich ihrer Möglichkeit als alternative Geschichtsschreiber wohl bewusst. Thomas Brussig (2002: S. 99) schrieb bereits seinen ersten Roman Wasserfarben aus Ärger über die sich ihm nicht erschließende Art der literarischen DDR-Bewältigung: „Irgendwann habe ich aufgehört, DDR-Literatur zu lesen. Deren Probleme waren nicht meine Probleme, und deren Sprache war nicht meine Sprache. Es machte wenig Vergnügen das zu lesen. Es blieb mir nichts übrig, als mir meine Bücher selbst zu schreiben“, bekundete er. Christa Wolf forderte im Januar 1990 in ihrer Rede zur Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Hildesheim, die Literaten müssten „die blinden Flecken in unserer Vergangenheit erkunden [...] und die Menschen in den neuen Verhältnissen begleiten“. Zitiert nach Langner 2000, S. 49. Günter Grass versteht Literatur als „medizinische Dienstleistung primärer Art“. Zitiert nach: Haase 2001, S. 129. Er (1995a) bezeichnete seinen Roman als „notwendige, literarische Korrektur und Gegenstimme zu dem, was jetzt schon regierungsamtlich als Geschichte festgeschrieben wird“. Und Thomas Hettches (2002: S. 134) Wissen um die geschichtsbildende Funktion der Literatur verdeutlicht nicht zuletzt eine Aussage des am Ende von Nox mit dem Erzähler in den Dialog tretenden Hundes: „Nichts von dem, was du kennst, wird nach dieser Nacht bleiben, wie es ist. Und nur die Geschichten, die man sich davon erzählt, bestimmen, was wird.“
[68] Elke Brüns (2006: S. 23) merkte - zu Recht - an, dass Wende und Vereinigung „einen weitreichenden politischen und kulturellen Umbruch“ dargestellt hätten und diese Zäsur in der Literatur nicht als einmalige Erschütterung, als vergangene Erfahrung beschrieben oder auch ignoriert, sondern fortgesetzt werde. Vgl. hierzu auch: Igel 2005, S. 25f und Grub (2003 S. 674), der von „Bewältigungsliteratur“ sprach.
[69] Wolf, Grass, Brussig und Hettche bilden damit keine Ausnahme. Für Hans-Joachim Schädlich (1992: S. 46) ist „die Fiktion“ beispielsweise sehr oft gar nichts anderes als eine Form des Authentischen.“ Hält man sich vor Augen, dass selbst Historiker ihre Darstellung auf Basis von zuvor nach speziellem Erkenntnisinteresse ausgewähltem Quellenmaterial anfertigen, ist der Begriff der (historischen) Realität ohnehin ein bedenklicher. Mit einiger Berechtigung definierten Peter Berger und Thomas Luckmann (1977: S. 1) „Wirklichkeit“ als „Qualität von Phänomenen“, die „ungeachtet unseres Wollens vorhanden sind und gesellschaftlich konstruiert’“, wobei es sich bei einer „Gesellschaft“ um eine „ständige menschliche Produktion“ handle (Ebd., S. 55), die vom Einzelnen aber als „objektive Wirklichkeit“ erlebt werde (Ebd., S. 64). Oliver Igel (2005: S. 11) konstatierte schließlich, die Historiographie sei „keine exakte Wissenschaft“, „die Wahrheit und die Wirklichkeit“ gebe es nicht. Die Schriftsteller sah er in der für die Geschichtsschreibung wichtigen Rolle des „Erinnerungsarbeiters“. Ihren Verdienst erkannte Beatrice Sandberg (2000: S. 148, 160) darin, Interpretationen „von überprüfbaren Quellen oder von persönlichen Erfahrungen“ zu liefern, die eine „vergleichende Sicht aus anderen Blickwinkeln“ ermöglichten. Auch wenn Sandberg den eigenen Quellengehalt von Romanen ignorierte, wird deutlich, welchen enormen (literatur)geschichtlichen Erkenntnisgewinn fiktionale Literatur liefern kann.
[70] Michel Foucault (1973: S. 156) legte den Grundstein für die Analyse des Diskurses, den er relativ vage als „Menge von Aussagen, die einem gleichen Formationssystem angehören“ umschrieb. Aktuell unterscheidet die Germanistik die unter anderem vom Dortmunder Literaturwissenschaftler Jürgen Link vertretene (semiotisch fundierte) Interdiskurs- bzw. semiotisch arbeitende historische Diskursanalyse von der beispielsweise von KlausMichael Bogdal protegierten historischen Diskursanalyse. Link (2005: S. 108) definierte „Literarizität“ als „Wechselspiel (immanent) semiotischer Strukturen [...] mit (extern) diskursiven Faktoren“ und forderte, „eine semiotisch fundierte Interdiskursanalyse“ müsse „die Frage nach der Spezifik literarischer Zeichen mit der nach ihrer Einbettung in umfassendere Produktions- und Reproduktionszyklen von ineinander greifenden Teilsystemen einer Kultur“ verbinden. Vgl. auch: Link; Hörisch; Pott 1983. Klaus-Michael Bogdal (1999: S. 8) ist indessen überzeugt, „die sukzessive Beschreibung komplexer historischer Diskursformationen, der Referenten der Aussage, der Aussagen selbst, der in ihnen eingenommenen Subjektpositionen und der ihnen eigenen Materialität und Medialität“ erlaube es, „eine Epoche (und ihre Transformation) in ihrer Besonderheit zu erfassen.“ Sie gebe, führte er fort, zugleich den Blick frei „für die Möglichkeiten, die in einer konkreten historischen Konstellation präsent waren“. Bogdal (Ebd., S. 7) forderte deshalb, eine „textnahe Untersuchung literarischer Werke mit historischer Darstellung zu verbinden“, und dabei „auf das Wissen und die Methoden der Historiker“ ebenso wenig zu verzichten „wie auf die eigene Bestimmung der spezifischen Temporalität literarischer Diskurse, ihres Stillstands, ihrer Beschleunigungen, ihrer Wiederholungen, ihrer Ereignisse“. Vgl. auch Bogdal 2005.
[71] Zu Recht wies Elke Brüns (2006: S. 29) auf die besonders exemplarische Rolle hin, die Christa Wolf als ,„Sündenbock’ in den Umbruchzeiten spielte“. Im Verlaufe des deutsch-deutschen Literaturstreits, der sich 1990 an ihrer Schubladenerzählung Was bleibt und ihrer exponierten Stellung in der DDR entzündete, wurde Wolf öffentlich solange mit persönlicher Kritik konfrontiert, bis sie sich für viele Monate aus den Medien und schließlich im September 1992 mithilfe eines neunmonatigen Stipendiums auch aus Deutschland zurückzog. Vgl. zum Literaturstreit: Anz 1995, Deiritz; Krauss 1991, Koch 2001. Papenfuß 1998, Wittek 1997. 1993 geriet Christa Wolf erneut in die öffentliche Kritik, als sie (auch sich selbst) eingestehen musste, zwischen dem 24. März 1959 und dem 29. November 1962 als IM „Margarete“ für die Staatssicherheit (Stasi) tätig gewesen zu sein. Wolf (1993b: S. 166) erschrak einerseits über ihre verdrängte Vergangenheit als „ideologiegläubige, [...] brave Genossin“. Andererseits fühlte sie sich „als Sündenbock, mit dem stellvertretend, exemplarisch eine Abrechnung vollzogen wurde“. Brüns 2006, S. 49.
[72] Grass stand während der Arbeit an seinem Roman Ein weites Feld unter dem Eindruck der Ereignisse in der Zeit um 1990, als er mit seiner Forderung nach einem „deutsch-deutschen Lastenausgleich“ zwar massive Medienpräsenz hatte, aber auch weitgehend isoliert dastand. „Es waren nur Enttäuschungen, die Ihnen die deutsche Politik [...] bereitet hat - zumal in der Zeit um 1990. [...] Allerdings vertraten sie Anschauungen, für die die Mehrheit kein Verständnis hatte. [...] Aber das hat ihnen Schmerz zugefügt, mit dem Sie nicht zu Rande kommen konnten. Und haben Sie nicht gerade damals mit der Arbeit an ihrem Roman ,Ein weites Feld’ begonnen“, hielt ihm Marcel Reich-Ranicki (1995: S. 88) anlässlich des Erscheinens von Ein weites Feld in einem offenen Brief vor, den das Nachrichtenmagazin Der Spiegel abdruckte.
[73] Ich setze mich in meiner Arbeit bewusst über die von Weidenfeld und Korte (1993: S. 136) sowie Grub (2003: S. 8) angestrengten Definitionen hinweg, die als Wende den gesamten Zeitraum zwischen dem mit dem Abbau der ungarischen Grenzen beginnenden Massenexodus aus der DDR und den Volkskammerwahlen im März 1990 verstanden, indem ich dem Themenkomplex „Mauerfall“ ein eigenes Kapitel widme. Weitaus schlüssiger erscheint mir, mit Hinblick auf den Mauerfall als historische Zäsur, nämlich die Beobachtung von Herberg, Steffens und Tellenbach (1997: S. 3) zu sein. Sie untersuchten „Schlüsselwörter“ der Jahre 1989/1990 unter ausschließlicher Berücksichtigung der„Eigenschaften ihres Gebrauchs“ und kamen zu dem Schluss, dass „die Wende“ ausschließlich als Bezeichnung für die politischen Ereignisse des Herbstes 1989 in der DDR“ gebraucht worden sei (Ebd., S. 13). Der Mauerfall lässt sich demnach als Scharnier zwischen Wende und Vereinigung verstehen. Nach der Öffnung der Grenze setzten Prozesse der inoffiziellen, der wirtschaftlichen Vereinigung ein.
[74] Helmut Kohl prägte diesen Begriff am 19. November 1989 in seiner Ansprache vor der Dresdner Frauenkirche. Vgl. Lindner 1998, S. 148. Zuletzt sprach sich Rainer Eppelmann (2004), evangelischer Geistlicher und als führender DDR-Oppositioneller Gründungsmitglied und zeitweilig Vorsitzender des Demokratischen Aufbruchs, sehr entschieden für diesen Terminus aus, den er in Abgrenzung zum von Egon Krenz in seiner Antrittsrede als Generalsekretär des ZK der SED geprägten, ideologisch aufgeladenen Begriff der „Wende“ deshalb befürwortete, weil er auf die zentrale Bedeutung des aktiven Volks verweise, ohne einen bloßen Kurswechsel an der Staatsspitze zu suggerieren. Auf Martin Walter geht eine ähnlich lautende Bezeichnung für den politischen Umbruch in der DDR zurück: Er sprach am 10. November 1989 in einer Umfrage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von einer „sanften Revolution“. Zitiert nach: Schirrmacher 1990d, S. 60. Aus stilistischen Gründen verwende ich die Begriffe der „friedlichen / sanften Revolution“ und der „Wende“ in dieser Arbeit synonym.
[75] Herberg; Steffens; Tellenbach 1997, S. 12.
[76] Wehler 1997 , S. 378.
[77] Kühnhardt 1994, S. 300.
[78] Neubert 1998, S. 851.
[79] Maier 1999, S. 188.
[80] Ebd., S. 206.
[81] Kocka 1995, S. 11.
[82] Wehler 1997, S. 378.
[83] Elke Brüns (2006: S. 69) wies daraufhin, dass „der Begriff ,Revolution’ nicht während der Herbstereignisse selbst, sondern erst im Jahr 1990 und hier am stärksten in der Wahlkampfphase zu den ersten freien Volkskammerwahlen am 18. März 1990“, danach aber immer seltener verwendet worden sei. Als überzeugendes Beispiel führte sie an, dass im Vertrag über die Schafjung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion vom 18. März 1990 noch die Rede von „einer friedlichen und demokratischen Revolution“ gewesen sei, während sich die Politik im Vertrag über die Einheit Deutschlands vom 03. August 1990 nur noch zu „dankbarem Respekt vor denen“ verpflichtet gefühlt habe, „die auf friedliche Weise der Freiheit zum Durchbruch verholfen haben“.
[84] Entsprechend erkannte Christian Jansen, Professor für Neuere Geschichte an der Technischen Universität Berlin, im Wintersemester 2008/2009 in einer Vorlesung zur Geschichte der Weimarer Republik Parallelen zwischen den Umstürzen von 1918 und 1989 lediglich im „Zusammenbruch eines Regimes“.
[85] Vgl. Carsten Schröder 1994.
[86] Die Auswirkungen auf die Schüler waren verheerend: Jürgen Böhm, Joachim Brune, Heribert Flörchinger sowie Antje Helbing und Annegret Pinther (1993: S. 177), Pädagogen aus Speyer und Weida, strengten 1991 eine Untersuchung auf der Grundlage von 1000 Aufsätzen 15- bis 19jähriger Schüler an, die sie nach ihrer persönlichen Einstellung zu Wende und Vereinigung befragten. Ihre Untersuchung konnte „die traurige Realität nur bestätigen, daß die Wahrnehmung in Ost und West gespalten ist und daß die ,Mauern [sic!] in den Köpfen’ vieler Jugendlicher nicht verschwinden“.
[87] Heiduczek 1990, S. 84.
[88] Harth (1990: S. 14f) erkannte die Gemeinsamkeit zwischen Historikern und Literaten darin, dass beide in den „Überbleibseln vergangenen Lebens [...] herumstochern“, dass sie Erinnerungen sammeln, um sie vor dem Vergessen zu bewahren. Anders als die Literaten dürften die Geschichtswissenschaftler dabei aber, so Harth (Ebd., S. 21) weiter, nicht mit Fiktionen arbeiten. Dieses theoretische Wissen spiegelt sich in Brussigs (2002: S. 101) Aussage: „Ich weiß, dass ich mich gerne erinnere, weiß aber auch, dass meine Erinnerung nicht die Wahrheit ist. Die Wahrheit, die ist bei den Historikern.“ Zweifel daran, wem er persönlich einen höheren Stellenwert zugestand, der Erinnerung oder der „Wahrheit“, ließ er (1997: S. 7) aber nicht: „Mal angenommen, es hätte ein Land oder so eine Art Zone gegeben [...]. Dann wäre es natürlich interessant zu wissen, wie hoch die Mauer war oder wie oft portionsweise Suppe verteilt wurde. Aber weit interessanter wäre natürlich noch die Vorstellung, was für Menschen in dieser Zone lebten. Daß die Homo mures was Besonderes waren, wäre klar“, teilte er mit.
[89] Radisch 2000, S. 25f.
[90] Zweifelsfrei entzieht sich Christa Wolfs Werk Medea wegen seines mythologischen Stoffs einer vorschnellen Zuordnung zum Genre des „Wenderomans“. Nicht zu unrecht wies Elke Brüns (2006: S. 27, vgl. auch S. 211f) aber darauf hin, dass die verwendeten Mythologeme und damit die ästhetische Wirkungsstruktur so organisiert seien, dass die meisten Leser das Buch als Widerspiegelung der gesellschaftlichen Realität nach der Vereinigung verstanden hätten. Susanne Ledanff (1997 online) bemerkte, dass kaum einer Literaturkritik die zu dechiffrierende Ost-West-Konfrontation in Christa Wolfs Roman entgangen sei. Das Gleiche trifft auf die literaturwissenschaftliche Rezeption des Romans zu: „In recht platten Bildern läßt sich die Gleichsetzung von Kolchis mit der DDR, und der Korinths mit der Bundesrepublik herauslesen“, urteilte Klaus Welzel (1998: S. 64), während Frauke Meyer-Gosau (2000b: S. 9) von „einer heftig aufgeladenen Allegorie“ sprach, in der „ein traditions- und naturverbundener ,Osten’ einem aalglatt verlogenen, so menschenverachtenden wie mörderischen ,Westen’ zum Opfer fällt“. Ähnlich, wenn auch dezenter, äußerten sich Monika Shafi (1997), die sich sicher war, Christa Wolf habe die Ost-West-Problematik in ihrer Adaption der Medea deutlich angesprochen, und Christoph Steskal (2001: S. 339), der die zeitgeschichtlichen und persönlichen Bezüge in Wolfs Text „evident“ nannte, auch wenn er davor warnte, sie „fälschlicher Weise zum Mittelpunkt der Interpretation zu machen“, da dies die „viel allgemeinere Tendenz des Romans“ schmälere. Angesichts der Übermacht dieser zahlreichen ernstzunehmenden Stimmen verhallten Urteile wie das von Marianne Hochgeschurz (1998: S. 5) beinahe ungehört. Sie beklagte, die „männlich-dominierte Kritik“ habe „die andere Medea“, die den „Frauen-Diskurs“ zu diesem Buch bestimme, nicht wahrgenommen oder voller Schrecken zurückgewiesen. Faktisch darf es heute deshalb wohl als gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis gelten, dass sich Christa Wolf mit ihrem Roman Medea - wenn auch mythologisch chiffriert - zur Wende und zur deutsch-deutschen Vereinigung äußerte. Vermutlich übte sie deshalb nur chiffrierte Kritik am Ausgang der Ereignisse 1989/1990, um einer neuerlichen Demontage ihrer Person vorzubeugen. Ihre Aussage, dem Roman, wenn überhaupt, dann lediglich einen auf sekundärer Ebene angesiedelten Bezug zur Zeitgeschichte eingeschrieben zu haben, lässt sich als (nach-vollziehbare) Schutzbehauptung verstehen. Vgl. zu Wolfs Dementi: Brüns 2006, S. 43-45. Vgl. zu ihrer Verteidigungsstrategie: Most 2002, v. a. S. 364.
[91] Vgl. Kimmel 1990, S. 4-6, Nohlen (Hg.) 1991, S. 593, Schubert; Klein 2006, S. 254, Tilly 1993, S. 29.
[92] Vgl. Walzer 1988, S. 17.
[93] Vgl. Brüns 2006, S. 144. Vgl. auch Jäger; Villinger (Hg.) 1997, S. 41, 70ff, 103, 112, 179 sowie Herberg; Steffens; Tellenbach 1997, S. 117f.
[94] Vgl. zur auffälligen Parallele zwischen Aietes und Erich Honecker: Fuhrmann 1997.
[95] Christa Wolf setzte mit Medea folglich die Kritik an Erich Honecker fort, auf die Kerstin Reimann (2008: S. 140f) als wesentlicher Bestandteil der Erzählung Was bleibt hinwies. Darin, dass Wolfs Protagonistin Schmerz beim Sehen eines Fernsehbeitrags über ein utopisches Gesellschaftsmodell und beim Hören des Arbeiterkampflieds Auf, auf zum Kampf! empfindet, erkannte sie Hinweise auf die „Diskrepanz zwischen realem Zustand und dem Ideal eines Gesellschaftskonzepts“, das „durch die DDR letztlich verraten wurde“.
[96] Vgl. zur Rolle der Oppositionellen und der Kirche in der DDR sowie zu ihrer temporären Symbiose: Jesse (Hg.) 2000, Meckel; Gutzeit (Hg.) 1994. Neubert 1998, Pollack 2000.
[97] Wolf 1996b, S. 99f
[98] Ebd., S. 31.
[99] Euripides 1972, S. 27.
[100] Wolf 1996b, S. 36.
[101] Ebd., S. 33.
[102] Ebd., S. 32. Elke Brüns (2006: S. 147) hielt fest, dass die konstitutiv zum Exodus gehörende Verheißung des gelobten Landes in Christa Wolfs Mythenadaption zwar unausgesprochen bleibe, als politisches Movens der Gefolgsleute Medeas aber vermutet werden könne. Ich gehe, ähnlich wie sie, von einer doppelten Motivation der übrigen Kolcher für den Exodus nach Korinth aus. Im Unterschied zu Brüns denke ich aber nicht, dass diese Beweggründe gleichwertig nebeneinander, sondern viel eher in einer bestimmten Hierarchie stehen: Medea hat als Königstochter wesentlichen Einfluss auf die Kolcher. In ihr glauben sie eine Garantie auf eine Besserung ihrer politischen, wirtschaftlichen, sozialen Stellung zu erkennen. Sie sind vom Leben in Korinth entsprechend enttäuscht. Agameda beklagt sich beispielsweise über die „lange Irrfahrt“, die die Kolcher überstehen mussten, um schließlich in Korinth anzugelangen. Wolf 1996b, S. 78f.
[103] Ebd., S. 31.
[104] Ebd., S. 204.
[105] Welzel 1998, S. 36.
[106] Die Kluft zwischen den meist jungen Emigranten und den meist älteren Demonstranten ließ ihr Selbstverständnis als führende ostdeutsche Autorin erodieren. Vgl. Kormann 1999, S. 218.
[107] Helden 'wie 'wir wurde erstmals von Peter Dreher (Kammerspiele des Deutschen Theater Berlin, Premiere: 27. April 1996) und anschließend über dreißig Mal für das Theater adaptiert, von Wolfgang Rindfleisch als Hörspiel inszeniert (gesendet am 17. September in MDR Kultur) und unter der Regie von Sebastian Peters verfilmt (Premiere: 09. November 1999). Die Verkaufszahlen des Romans liegen bei weit über 200 000 verkauften Exemplaren Vgl. Kormann2000, S. 173, FN 29, Reimann 1998, S. 244 sowie Bremer2002, S. 33.
[108] Lahann 1995, S. 144.
[109] Brussig 1998a, S. 58.
[110] Zitiert nach: Zachau 1997, S. 388. Ähnlich kritisch äußerte sich Frank Thomas Grub (2003: 666ff), der Brussig vorwarf, er wolle als junger Autor gegen die Dominanz Christa Wolfs im Literaturbetrieb anschreiben, lese ihre Text deshalb „bewusst falsch“, lasse seinen Erzähler „die gesamte Wolf-Rede demontieren“ und entblöde sich auch nicht, „dabei beleidigend zu werden“. Heide Hollmer (2000: S. 117) zeigte hingegen Verständnis für Brussigs Kritik an Christa Wolf, namentlich an ihrem Roman Der geteilte Himmel, den sie zum „Paradebeispiel für die poetische Affirmation der deutschen Teilung und des Mauerbaus“ erklärte.
[111] Das siebte Kapitel des Romans trägt die Überschrift „Das 7. Band: Der geheilte Pimmel“. Brussig 1999b, S. 277.
[112] Brüns 2006, S. 246.
[113] Brussig 1999b, S.310.
[114] Ebd., S. 295.
[115] Ebd., S. 296.
[116] Christa Wolf (1990c: S. 52) wusste um dieses auch von ihr als Manko empfundene Moment ihres Schreibens, um den „Tanz in Ketten“ (Schädlich 1990), den sie und andere Literaten aufzuführen gezwungen waren: „Schönen guten Tag, lieber Selbstzensor“, wendet sie sich beispielsweise in ihrer autobiografischen Erzählung Was bleibt an die innere Stimme, die sie umsichtiger, vorsichtiger urteilen lässt. „Ich selbst. Über die zwei Worte kam ich lange nicht hinweg. Ich selbst. Wer war das. Welches der multiplen Wesen, aus denen ,ich selbst’ mich zusammensetzte. Das, das sich kennen wollte? Das, das sich schonen wollte? Oder jenes, das immer versucht war, nach derselben Pfeife zu tanzen wie die jungen Herren da draußen vor meiner Tür“, fährt sie, ihre innere Zerrissenheit im Rahmen eines literarischen Selbsterfahrungsprozesses dokumentierend, fort. (Ebd., S. 55.) Was bleibt liest sich als Kampf gegen jene alte „Sprache, in der [sie] noch immer denken musste“ (Ebd., S. 10) und als Suche nach einer „neuen Sprache“, nach der „Sprache der Wende“, die Christa Wolf erstmals am 04. November 1989 gebrauchte. Zitiertnach: Wehdeking 2000c, S. 44.
[117] Igel 2005, S. 50. Vgl. auch Hollmer; Meier 2000, S. 122. Charakteristisch für Wolfs Prosa ist ihre tagebuchnotizartige inhaltliche wie stilistische Beschaffenheit, auf die Karin McPherson (2002: S. 423f) hinwies und die Brussig persiflierte, indem er seinen Roman, in Anlehnung an Heiner Müllers Krieg ohne Schlacht und Manfred Krugs Werk Abgehauen, als einen auf Tonbänder aufgezeichneten Lebensbericht gestaltete. Vgl. Nause 2000a, S. 163. Reimann (2008: S. 250f) erkannte in dieser stilistischen Besonderheit eine Kritik an den „zahlreichen Publikationen des Wendejahres 1989/90, die [...] unter dem Terminus biographisches Schreiben’ zusammengefasst wurden“.
[118] Wehdeking 2000b, S. 35. Kerstin Reimann (2008: S. 247, FN 205) wies daraufhin, dass diese Genrezuschreibung keineswegs unumstritten ist: Tanja Nause (2002: S. 20f) war beispielsweise der Meinung, dass es sich bei Helden wie wir nicht um einen „Schelmenroman“ handele. Sie stellte fest, die drei von ihr zur Klassifizierung bemühten Eigenschaften dieser Gattung „Humor“, „autobiographische Form der Schilderung“ sowie „Kontext eines sozialen und gesellschaftlichen Wandels“ seien im Roman unterrepräsentiert. Zu Recht bemerkte Reimann (Ebd.) allerdings unter Rekurs auf Jürgen Jacobs (1983: S. 29f), dieses Urteil sei „wenig überzeugend“, da Nause „wesentliche Eigenschaften dieser Gattung wie z. B. die Gestaltung eines Schelms, der als Außenseiter der Gesellschaft auftritt“ ignoriere. Oliver Schwarz (2000: S. 4) gelange so auch zur Feststellung, Klaus Uhltzscht sei der „erste sozialistische Schelm“, führte Reimann aus, nicht aber ohne zu kritisieren, Schwarz lasse Schelmenromane beziehungsweise Romane mit pikarischen Zügen wie beispielsweise Irmtraud Morgners Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura außer Acht. Eine Kompromisslosung boten Heide Hollmer und Albert Meier (2000: S. 116) an, als sie ausführten, „das bejahrte Genre des Schelmenromans“ diene in Helden wie wir „vielfältigen Erzählstrategien von der Inter- textualität und Medialisierung bis hin zur literarischen Karnevalisierung ά la Bachtin“ als „strukturelles Gerüst“.
[119] Brussig 1999b, S. 282.
[120] Reimann 2008, S.261.
[121] Brussig 1999b, S. 304.
[122] Mit dem Habitus der Erfahrenen verurteilte Wolf 1989 dann auch die Kritik an ihrer Rede vom 04. November in der Wochenpost. „Ich sehe die Politik der Trennung von „Intelligenz’ und ,Volk’, die über Jahrzehnte mehr oder weniger zielstrebig betrieben wurde, wirkt weiter. [...] Genau dieser Ton, und was er an konkreten und diffusen Maßnahmen zur Folge hatte, hat so viele Künstler [...] aus dem Land getrieben. Ohne diese Probleme aufbauschen zu wollen, möchte ich doch warnen vor einer Fortsetzung der unheilvollen Tradition der deutschen Geschichte, die so oft die Produzenten der materiellen und der geistigen Güter an verschiedene Ufer trieb. Den revolutionären Errungenschaften ist das nie bekommen.“ Zitiert nach Welzel 1998, S. 48.
[123] Brussig 1999b, S.311.
[124] Bemerkenswert ist, dass Brussig zu diesem Zweck Kritik an den Müttern seiner Generation übte, während sich die 1968er-Proteste in erster Linie gegen das mangelhafte Schuldbewusstsein der Väter richteten und sich auch Monika Maron in Stille Zeile sechs und Kurt Drawert in Spiegelland kritisch mit den Vätern auseinandersetzten. Vgl. Reimann 2008, S. 261ff.
[125] Therse Hörnigk stellte diese Auffassung von Christa Wolfs Rolle in der DDR bereits 1996 infrage. Sie verwies darauf, Christa Wolf sei als „moralische Instanz“ vor allem nach 1968 durchaus unbequem für die DDR gewesen, Wolfs Texte hätten einen „moralischen Gestus [...] gegen Pragmatismus und autoritäre Machtanmaßung“ aufgewiesen, „der Werte einklagte, die auf dem langen Wege einer fehllaufenden Geschichte verloren gegangen oder nie in Angriff genommen waren.“ Zitiert nach: Wehdeking 2000b, S. 36. Kerstin Reimann (2008: S. 132) wies schließlich daraufhin, das von Hans-Dietrich Sander (1985: S. 836) festgestellte „Partnerschaftsverhältnis“ zwischen den Mächtigen und den Intellektuellen der DDR sei, trotz anders lautender Propaganda, bereits „Ende der 1970er Jahre“ zerbrochen.
[126] Brüns 2006, S. 246.
[127] Klussmann 2000, S. 208.
[128] Karl-Wilhelm Schmidt 1994, S.291.
[129] Marcel Reich-Ranicki prägte diese pejorative Bezeichnung, die später im deutsch-deutschen Literaturstreit wieder aufgegriffen werden sollte, 1986 in seinem Artikel Macht Verfolgung kreativ, in dem er harsche Kritik an Wolfs Laudatio auf den Dissidenten Thomas Brasch übte. Seine auch im Herbst 1989 in der Fensehsendung Das literarische Quartett mit der Frage, ob eigentlich in der DDR die Schriftsteller gesiegt oder versagt hätten, forcierte Kritik und Hans Nolls (1987) Beitrag Die Dimension der Heuchelei bildeten den Beginn der persönlichen Angriffe auf Christa Wolf. Vgl. Kormann 1999, S. 62 sowie Reimann 2008, S. 151f.
[130] Meyer-Gosau 2000a, S. 159.
[131] Hage 1987.
[132] Schirrmacher 1990b.
[133] Wie wenig sich Christa Wolf als Zielscheibe der Kritik eignet, verdeutlichte Klaus Welzel (1998: S. 17), indem er auf den von Wolf reflektierten Generationskonflikt als konstitutives Merkmal ihrer Erzählung Was bleibt hinwies: „Während bei der Erzählerin die Unfähigkeit zur Kommunikation - einmal mit dem Gegner Stasi, dann mit der Familie oder Freunden - zu einer Krise in Wahrnehmung und vor allem Sprache führt, wehren sich die jugendlichen Protagonisten [...] in einem sicheren Reflex gegen die staatliche Übermacht“, erklärte er. Wolf wusste folglich um ihre Defizite, die sie vor allem in der fiktiven Begegnung mit der ungenannt bleibenden Autorin Gabriele Kachold, einer „Kontrastfigur zur Ich-Erzählerin“ (Reimann 2008, S. 142), versinnbildlichte. Sie war bemüht, ihre Sprachlosigkeit zu überwinden. Ihre Ich-Erzählerin verknüpfte „mit dem subversiven Schreiben des jungen Mädchens“ sogar „die Hoffnung auf die nächste Autor(inn)engeneration“. Ebd., S. 143. Ferner plädierte Wolf (1989a) als eine der ersten öffentlich dafür, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen, das ostdeutsche „Dogma von den ,Siegern der Geschichte’“ aufzugeben, da dieses dazu beigetragen habe, „das Verstehen zwischen den Generationen in unserem Land zu erschweren“. Mangelndes Verständnis oder gar fehlende Toleranz für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der DDR können ihr also nicht vorgeworfen werden.
[134] Brussig 1995a.
[135] Biermann 1991, S. 139.
[136] Brussig 1999b, S. 320.
[137] Brussig (Ebd., S. 316) ließ seinen Protagonisten Uhltzscht den Vorwurf artikulieren, Christa Wolf sei „die Autorin für ein Publikum, das es nicht fertigbringt, ein Dutzend Grenzsoldaten wegzuschieben“ gewesen, und gab Christa Wolf auch in zwei anderen Punkten der Lächerlichkeit preis: Einerseits verhöhnte er ihre Furcht vor der Staatssicherheit: sein Antiheld ist einer der drei jungen Herren, die in Wolfs Erzählung Was bleibt in dem Auto vor ihrer Haustüre sitzen. Andererseits gibt Klaus Uhltzscht die „Mixtur von Abkürzungen und Bürokratendeutsch“ (Reimann 2008, S. 259), in der er sich bei Stasi übt, als „neue [...] Sprache“ (Brussig 1999b, S. 180) aus, auf die, wie Reimann (2008: S. 259) bemerkt, „bereits die Ich-Erzählerin aus Wolfs Was bleibt hofft“. „Und wenn schon befreite Sprache, dann richtig: Hoppla! Ist doch eine starke Verfassungspräambel, oder A- Wop-Bop A-Loo-Bop, oder And now for something completely different oder Mittwoch ist Kinotag oder Tüdelüdüdü, tüde-lüdüdü“, lässt Brussig (1999b, S. 308f) seinen Antihelden schließlich räsonieren. Vgl. hierzu auch Hollmer; Meier 2000, S. 121.
[138] Zitiert nach Koelbl 1998, S. 100.
[139] Vgl. Wehdeking 2000b, S. 38 sowie Bremer 2002, S. 60.
[140] Unter dem Label „Zonenkinder“, das auf einen gleichnamigen Roman Jana Hensels rekurriert, verbirgt sich das Pendant zur von Floran Illies’ ausgerufenen Generation Golf: jene Gruppe junger ostdeutscher Literaten wie Kurt Drawert, Jakob Hein, Falko Henning, Jana Hensel, Wolfgang Hilbig, Reinhard Jirgl, André Kubiczek und eben auch Thomas Brussig, der es auf Grund ihres Alters erlaubt scheint, „jenseits aller ideologischen Vorwürfe und Rechtfertigungsversuche vor allem die ,banal existierende DDR“ zu rekonstruieren beziehungsweise mit den Mitteln der Verdrängung und Schönfärberei sowie des Weichzeichnens zum „genuin literarischen Erinnerungsraum“ umzugestalten. Brüns 2006, S. 237f.
[141] Oliver Igel (2005: S. 49) erkannte in Brussigs Roman einen „Befreiungsschlag“, der „die Meinung der identitätslosen jüngeren Generation wider“ spiegele. „Die Christa-Wolf-Generation hat nach Auffassung des Erzählers keine vorzeigbare Vergangenheit, nur eine freudlose Gegenwart und flüchtet sich deshalb in eine utopische Zukunft“, führte er weiter aus. Einen Beleg für seine These erkannte er (Ebd., S. 50ff) - zu Recht - darin, dass nicht nur Wolf, sondern auch die Eislauftrainerin Jutta Müller, Uhltzschts Mutter, sein für die Stasi tätiger Vater und Erich Honecker als „Stellvertreter der Eltern-Generation“ angegriffen und die ,„alten’ Vorbilder: Gagarin, Pieck und Thälmann [...] als Idole weitgehend ignoriert und sexuell ironisiert“ werden. Vgl. hierzu auch Bremer (2002: S. 43, FN 103). Sie merkte an, auch die Fernsehansagerin Dagmar Frederic sei „eine Vertreterin der Müttergeneration“, gegen die sich Brussigs Kritik richte. Gründe für Brussigs Angriff auf die Elterngeneration erkannte Bremer (Ebd., S. 57) in der „generationspezifischen Begrenztheit im Denken und Fühlen“, in der „Konfliktvermeidung, und Übervorsichtigkeit, [in] der Prüderie und Sexualfeindlichkeit, der mangelnden Liebesfähigkeit, aber auch [in] der politischen Einstellung“ der Eltern, die dazu führe, dass sie „Zweifel an der sozialistischen Ideologie, der Gesellschaft der DDR oder ihrer Position darin“ nicht zu lassen. Entsprechend kritisierte das „Zonenkind“ Kurt Drawert (1993c, S. 78) jene älteren „Dichter und Denker mit einstigem Behördenvertrag“, weil sie „auf dem Hintergrund zahlloser Existenzen, denen das Rückgrat gebrochen ist, [...] den eigenen verstauchten kleinen Finger als Beweis dafür heben, auch widersprochen zu haben“.
[142] Reimann 2008, S. 246.
[143] „Die Geschichte des Mauerfalls ist die Geschichte meines Pinsels“, erklärt Brussigs (1999b, S. 7) Protagonist, der die Grenzposten am 09. November 1989 durch das Vorzeigen seines durch eine misslungene Operation auf monströse Größe angeschwollenen Glieds zum Zurückweichen nötigt.
[144] Uhltzscht Protagonist fordert seinen Interviewer auf: „Sehen Sie sich die Ostdeutschen an, vor und nach dem Fall der Mauer. Vorher passiv, nachher passiv - wie sollen die je die Mauer umgeschmissen haben?“ Ebd., S. 319f.
[145] Kormann 2000, S. 174. Vgl. hierzu auch Reimann 2008, S. 264ff sowie Bremer 2002, S. 54. Brüns (2006: S. 117) hob hervor, dass Brussig den Mythos der Revolution bereits mit der Konfiguration seines Protagonisten und Ich-Erzählers unterhöhle: Mit Klaus Uhltzscht erschaffe der Literat, so Brüns, eine „Kunstfigur“, die nicht nur den von Hans-Joachim Maaz (1990: S. 137) diagnostizierten „gehemmt zwanghaften“ Charakter verkörpere, sondern auch die provozierende Kernaussage des Gefühlsstaus transportiere: „Es hat keine Revolution stattgefunden“. Diese Erkenntnis, dieses Werk habe in ihm eine „Lawine losgetreten“, sagte Brussig später. Zitiert nach Igel 2005, S. 36.
[146] Zitiert nach: Bremer 2002, S. 54.
[147] Igel 2005, S. 55 und 109. Vgl. auch Huberth 2003, S. 310.
[148] Igel 2005, S. 55.
[149] Brussig 2006, S. 584.
[150] Ebd., S. 608.
[151] Brüns 2006, S. 145.
[152] Wehdeking 2000a, S. 18. Ähnlich urteilte Julia Kormann (1999: S. 256). Sie stellte fest, das Subjekt, sie meinte damit das lyrische Ich, sei körperlos, lediglich seines Seins noch gewiss.
[153] Volker Braun publizierte Das Eigentum erstmals am 4./5. und 10. August 1990, also nach der Währungsunion und vor dem Beschluss der Volkskammer der DDR vom 23./24. August 1990, der Bundesrepublik beizutreten. Vgl. Brüns 2006, S. 144f. Brussigs (2006: S. 582ff) kleiner Dichter schreibt das Gedicht ebenfalls im Sommer 1990 während seines Urlaubs auf Hiddensee.
[154] Vgl. Brüns 2006, S. 145. Peter Rühmkorf (1993: S. 15) veränderte den Vorwurf vom Ausverkauf der Revolution 1993 in seiner Rede anlässlich der Verleihung des Büchnerpreises in einem entscheidenden Punkt: „Und tatsächlich [...] glaubten wir für ein paar bewegende Weltsekunden einen Sinn in der geschichtlichen Fatalität zu erkennen - [...] bis die Revolutionsspekulanten an die Stelle des Mirakels eilten und den von niemandem vorausgesehenen Sternschnuppenregen in ihre eigenen, weit ausgespannten Schürzen lenkten“, beklagte er, die Schuld von den Revolutionären auf die westdeutschen Spekulanten lenkend. Vgl. zum hier anklingenden Vorwurf der Kolonisierung Kapitel 4.2.
[155] Domdey 1990, S. 1774.
[156] Brüns 2006, S. 145.
[157] Brussig 2006, S. 58f
[158] Ebd., S. 88ff.
[159] Ebd., S. 77f.
[160] Ebd., S. 177.
[161] Ebd., S. 152.
[162] Ebd., S. 155f.
[163] Ebd., S. 157.
[164] Ebd., S. 334.
[165] Ebd., S. 76.
[166] „Wir ließen ihn jammern. Das kannte man schon. Viel unterhaltsamer war es, ihn mit Objekt zum Multipel zu verzaubern, ohne und unterm Schirm. Doch selbst als Serienproduktion wollte er nicht vom Jammer ablassen; einen eingeübten Chor hörten wir.“ Grass 1995b, S. 517.
[167] Ebd.
[168] Ebd., S. 258f.
[169] Ebd., S. 600.
[170] Reinhold 2000, S. 60.
[171] Grass 1995b, S. 27.
[172] Ebd.
[173] Ebd., S. 349.
[174] Ebd., S. 498.
[175] Ebd., S. 443.
[176] Selbstredend lässt sich Fontys Aussage als Anspielung auf die Spitzeltätigkeit des Lyrikers Sascha Anderson lesen, der auf dem Prenzlauer Berg lebend seit 1975 beispielsweise Elke Erb, Jan Faktor, Wolfgang Hilbig, Uwe Kolbe, Bert Papenfuß-Gorek sowie Lutz Rathenow bespitzelte. Wolf Biermann (1994) beschuldigte ihn im Oktober 1991 in seiner Rede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises indirekt, um ihn kurze Zeit später anlässlich der Verleihung des Eduard-Mörike-Preises endgültig als Stasimitarbeiter zu enttarnen. Vgl. zur Debatte um Sascha Anderson sowie zur Überwachung und zu den Produktionsbedingungen ostdeutscher Literaten: Böthig; Michael (Hg.) 1993, Fricke 1991, Lewis 2003, Loest 1991, Schädlich (Hg.) 1992 sowie Walther 1996.
[177] Grass 1995b, S. 275.
[178] Ebd., S. 170.
[179] Ebd., S. 271.
[180] Ebd., S. 598f.
[181] Ebd., S. 351.
[182] Ebd., S. 350.
[183] Habermas 1990b, S. 181.
[184] Meier 1990, S. 134.
[185] Drawert 1993b, S. 31f.
[186] Bohrer 1992, S. 958.
[187] Kunert 1997, S. 279. Ihr nonfiktionales Pendant findet die von Grass und Brussig vertretene Position im Vorwurf Henryk M. Broders (1992), der zu der - fragwürdigen - Einschätzung gelangte, dass „die friedliche Revolution’ eine Stasi-Inszenierung war“. Ähnlich äußerte sich Wolf Biermann. Er polemisierte in seiner Büch- ner-Preis-Rede, die Revolution sei wohl doch keine gewesen, „sondern mehr ein günstiger Notverkauf der Russen.“ Zitiert nach: Jäger; Villinger (Hg.) 1997, S. 65. Die Boulevardjournalisten Ralf Reuth und Andreas Bönte (1993) verdächtigten Moskau sogar als Initiator eines misslungenen Komplotts. Auseinandersetzungen mit oben genannten Theorien finden sich bei: Wolle 1998, S. 338 und Misselwitz 1996, S. 12.
[188] Wolle 1998, S. 344.
- Arbeit zitieren
- Michael Hensch (Autor:in), 2009, Deutschland, einig Vaterland?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137214
Kostenlos Autor werden




















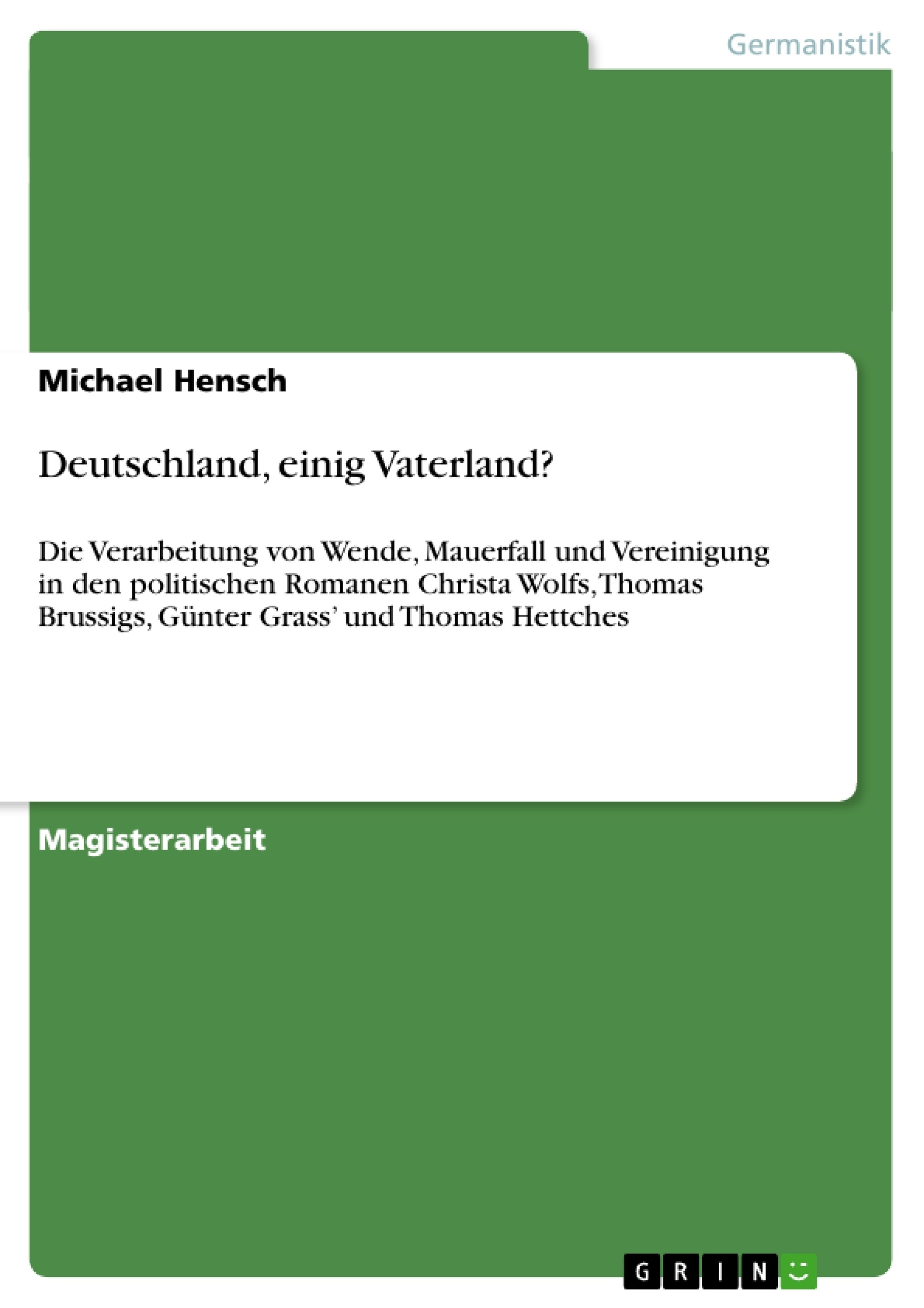

Kommentare