Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Taylors Politik der Anerkennung und Habermas` Kritik daran
2.1.Inhaltliche Zusammenfassung und Voraussetzungen
2.2.Der Zusammenhang von Anerkennung und Identität
2.2.1.Von Ehre zu Würde
2.2.2.Authentizität
2.2.3.Kosequenzen
2.3.Politik des Universalismus und Politik der Differenz
2.3.1.Menschenbild
2.3.2. Ziele
2.3.3. Problematik
2.3.4.Die Politik der allgemeinen Menschenwürde
2.3.5Der überflüssige Liberalismus 2
2.3.5.1. Habermas` Ausgangspunkt
2.3.5.2.Analyse der Taylorschen Theorie
2.3.5.3.Lösungsvorschlag
2.3.5.Modelle liberaler Gesellschaften
2.3.5.1.Charles Taylors Vorschläge
2.3.5.2.Jürgen Habermas kritische Analyse
2.4.Gleichwertigkeit von Kulturen
2.4.1.Grundthese
2.4.2.Praktische Umsetzung
2.4.3.Fazit
2.4.4.Habermas zu Wertschätzung und Überleben von Kulturen
2.5.Die falsche Neutralität des Rechtsstaats
2.5.1.Argumentation
2.5.2.Die Bedeutung der Sozialstruktur
2.5.3.Schlussfolgerungen
3. Schluss
1. Einleitung
Begriffe aus dem Bereich des Multikulturalismus sind heute alltäglich: Ob es um Gastronomie geht, um Musik, Kunst oder um das Bildungswesen – „multikulturelle Gesellschaft“ ist Bestandteil des aktiven Wortschatzes geworden. Was steckt aber hinter diesem Begriff?
Eine Antwort darauf versucht nicht nur die politische Theorie zu finden, auch Philosophie, Soziologie, Kommunikationswissenschaften, Kulturwissenschaften und viele andere Fachbereiche beschäftigen sich mit der Analyse des Multikulturalismus. Im Gebiet der Politologie ist Charles Taylor einer der etabliertesten und aktivsten Autoren. Sein Vorgehen und seine Lösungsvorschläge sind sowohl philosophisch fundiert als auch umfassend anwendbar, d.h. nicht nur für einen speziellen Problembereich geschaffen. Sein ausführliches Essay „Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung“[1] stellt einen wertvollen Beitrag zur Debatte über den Umgang mit nationalen Minderheiten, Migration und Diskriminierung dar. Der in der deutschen Ausgabe veröffentlichte Kommentar von Jürgen Habermas mit der Überschrift „Anerkennungskämpfe im demokratischen Rechtsstaat“ bietet außer einer ausführlichen Analyse und Kritik der Taylorschen Positionen auch interessante Ansätze zur politisch-philosophischen Betrachtung der Situation in Deutschland.
In dieser Arbeit möchte ich auf den zentralen Punkt des Taylorschen Essays eingehen: Seine Konzeption eines Rechtsstaates, der die Forderungen seiner Bürger nach Anerkennung auch erfüllen kann. Von allen Kommentaren zu diesen Essays erscheint mir das von Habermas als dasjenige mit dem kritischsten und zugleich analytischsten Ansatz. Deshalb habe ich seinen Beitrag ausgewählt, um zu zeigen, auf welchen Grundlagen eine Kritik an Taylor möglich ist. Auf die äußerst interessanten Analysen und Bewertungen der deutschen Asylpolitik möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen, da dies auch eine Beschreibung der Stellungnahmen Taylors zu diesem Themenbereich erfordern würde und ein solcher umfassender Vergleich den rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Abschließend möchte ich meine Erkenntnisse zusammenfassen und einen Ausblick auf die mögliche Fortsetzung der Multikulturalismus-Debatte wagen.
2. Taylors Politik der Anerkennung und Habermas` Kritik daran
2.1.Inhaltliche Zusammenfassung und Voraussetzungen
Charles Taylor leistet mit seinem ausführlichen Essay zum Multikulturalismus eine wertvollen Beitrag zur Debatte über den Umgang mit nationalen Minderheiten, Migration und Diskriminierung. Seine Positionen sind sowohl philosophisch fundiert und durchdacht als auch umfassend anwendbar, d.h. nicht nur für einen speziellen Problembereich geschaffen. Grundlegend ist dabei Taylors soziale Konzeption des Menschen, wie er sie auch in anderen Schriften vertreten hat: Der Mensch ist nur als gesellschaftliches Wesen denkbar, erst die Gemeinschaft mit anderen macht ihn zum Menschen.[2] Mit dieser Auffassung stellt er sich klar gegen die klassische liberale Auffassung, die seit Hobbes vom Menschen als autonomem Individuum ausging.
Der Kommentar, den Jürgen Habermas zu Charles Taylors ausführlichem Essay „Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung“ verfasst hat, enthält zum einen eine ausführliche Analyse und Kritik von Taylors Thesen, zum anderen aber auch eine Situationsanalyse der Anerkennungsproblematik in der Bundesrepublik. Seine Grundthese lautet dabei, der sog. Liberalismus 2 der Taylorschen Politik der Anerkennung sei überflüssig, sofern die Theorie der Rechte nur konsequent durchgesetzt würde.
2.2.Der Zusammenhang von Anerkennung und Identität
Zu Beginn seiner Überlegungen stellt Taylor die These auf, „unsere Identität werde teilweise von der Anerkennung oder Nicht-Anerkennung, oft auch von der Verkennung durch die anderen geprägt, so dass ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen wirklichen Schaden nehmen, eine wirkliche Deformation erleiden kann, wenn die Umgebung oder die Gesellschaft ihm ein einschränkendes, herabwürdigendes oder verächtliches Bild ihrer selbst zurückspiegelt“ (Taylor, 1996: S. 13/14). Für diese These führt er verschiedene Beispiele an: Feministische Theorien, Erfahrungen der schwarzen Bürgerrechtsbewegung sowie Folgen des Kolonialismus. Des Weiteren definiert er das Verlangen nach Anerkennung als ein menschliches Grundbedürfnis.
Um diese Definition zu untermauern, geht er zunächst auf die Frage ein, wie der „Diskurs von Anerkennung und Identität“ (ebd. S. 15) sich überhaupt zum Ausgangspunkt unserer Fragestellungen entwickeln konnte. Als Antwort darauf erläutert er die historisch-philosophische Entwicklung heute selbstverständlicher Begriffe wie Identität und Authentizität. Als ausschlaggebend für das moderne Interesse an Anerkennung und Identität führt er erstens den Übergang von der Ehre zur Würde und zweitens die seit Ende des achtzehnten Jahrhunderts entstandene Auffassung einer individualisierten Identität an.
2.2.1.Von Ehre zu Würde
Den Begriff der Ehre verknüpft Taylor mit dem Ancien Regime und den Theorien Montesquieus: „Ehre beruht auf Bevorzugung und Besserstellen“ (ebd. S. 15), ist also ein hierarchisch geprägter Begriff, der mit gesellschaftlichem Aufstieg innerhalb der engen vorgegebenen Grenzen verknüpft ist. Den modernen Begriff der Würde sieht Taylor als Gegensatz dazu: Würde wird in einem „universalistischen und egalitären“ (ebd. S. 16) Sinne gebraucht und ist wesentlicher Bestandteil der demokratischen Kultur.
2.2.2.Authentizität
Anschließend an L. Trilling[3] verwendet Taylor für diese Auffassung einer individuellen Identität den Begriff „Authentizität“. Er entwickelte sich aus dem Moralitätsempfinden des 18. Jahrhunderts und ist Teil der Subjektivierung der neuzeitlichen Kultur. Die entscheidende Formulierung für diese Entwicklung findet Taylor bei Herder: „Jeder Mensch hat ein eigenes Maß“ (ebd. S. 19).
2.2.3.Kosequenzen
Der gemeinsame Nenner beider Faktoren ist ihr Zusammenhang mit dem Niedergang der hierarchischen Gesellschaft. Obwohl sich mit dem Entstehen demokratischer Gesellschaften nicht automatisch die soziale Identitätsbestimmung änderte, führte die Idee der Authentizität zu einem größeren Selbstbewusstsein im wörtlichen Sinne, das letztlich auch die gesellschaftlichen Rollenmuster in Frage stellte.
Im Zusammenhang mit der Authentizität betont Taylor den „dialogischen Charakter der menschlichen Existenz“ (ebd. S. 21). Als zentral für diesen Dialog hält er Sprachen im weitesten Sinne, die man erlernen müsse. Erst durch ihren Gebrauch könne man in Interaktion mit der Umwelt – oder mit den Worten G.H. Meads[4] ausgedrückt: den „signifikanten Anderen“ (ebd. S. 22) – treten. Die Ausführung dieses Arguments führt Taylor zu der Frage, was Identität sei: Er definiert sie als „Rahmen, in dem unsere Vorlieben, Wünsche, Meinungen und Strebungen einen Sinn bekommen“ (ebd. S. 23). Identität muss zwangsläufig dialogisch sein, wie Kommunikation kann Identität nicht für sich entstehen und fortbestehen. Das Problem der Anerkennung gewinnt im Rahmen dieser Erkenntnisse an weiterer Bedeutung: Anerkennung ist durch die Individualisierung der Identität wesentlich weniger selbstverständlich geworden, da die festen sozialen Kategorien, die früher allgemeine Anerkennung garantierten, durch Austausch und Dialog ersetzt wurden. Neu daran ist laut Taylor, dass das „Streben nach Anerkennung scheitern könne“ (ebd. S. 24). Als Vorläufer dieser Theorie nennt er Rousseau und Hegel.
2.3.Politik des Universalismus und Politik der Differenz
Aus den in 2.2.1. und 2.2.2. beschriebenen Entwicklungen leitet Taylor zwei politische Möglichkeiten des Umgangs mit Anerkennung ab; er nennt sie Politik des Universalismus und Politik der Differenz. Beide beruhen auf der Idee der Gleichachtung und weisen daher diverse Gemeinsamkeiten und Überschneidungen auf. Sie können allerdings anhand der unterschiedlichen Definition des Begriffs „Gleichrangigkeit“ gegeneinander abgegrenzt werden: Dessen Neudefinition macht die Politik der Differenz zu einer logischen Weiterentwicklung der Politik des Universalismus.
2.3.1.Menschenbild
Ebenfalls unterschiedlich sind die Grundideen über den Wert des Menschen, die den beiden Politiken zugrunde liegen: Während die Politik des Universalismus in der Tradition Kants von dem Begriff der menschlichen Würde im Sinne eines allgemeinen menschlichen Potentials zum vernünftigen Handeln ausgeht, ist die Politik der Differenz der Ansicht, das Achtunggebietende am Menschen sei sein Potential, “eine eigene individuelle oder auch kulturelle Identität hervorzubringen und zu definieren“ (ebd. S. 32). Zwei unterschiedliche Forderungen können aus diesen Grundsätzen abgeleitet werden: Erstens die Forderung nach gleicher Achtung für alle und zweitens die nach gleich viel Respekt für verschiedene Kulturen ohne die Möglichkeit einer Wertung. Hier sieht man den gravierenden Unterschied zwischen den beiden Politiken, der sich ja auch schon im Namen entdecken lässt: Universalismus vs. Differenz, Gemeinsamkeiten vs. Unterschiede. Im weiteren Verlauf werden wir diesen Unterschied noch deutlicher herausarbeiten.
2.3.2. Ziele
Beide Politiken zielen auf eine Gesellschaft ohne Bürger erster und zweiter Klasse. Während allerdings die Politik des Universalismus diejenigen Eigenschaften zur Grundlage ihrer Überlegungen macht, die allen Menschen gemeinsam sind oder allen Menschen gleichermaßen zustehen, geht die Politik der Differenz davon aus, dass Anerkennung erst durch Anerkennung der Unterschiede zwischen den Menschen erlangt werden kann. „Wir können das, was universell vorhanden ist –jeder Mensch hat eine Identität- nur anerkennen, indem wir auch dem, was jedem Einzelnen eigentümlich ist, anerkennen. Die aufs Allgemeine gerichtete Forderung wird zur Triebkraft der Anerkennung des Besonderen.“ (ebd. S. 29).
2.3.3. Problematik
Die Konfliktlinie zwischen den beiden Politiken verläuft entlang des Umgangs mit Diskriminierung: Die aktive Nicht-Diskriminierung der universalistischen Politik muss sich den Vorwurf gefallen lasse, „sie negiere die Identität, indem sie den Menschen eine homogene, ihnen nicht gemäße Form aufzwinge“ (ebd. S. 34), die Politik der Differenz dagegen muss sich gegen den Vorwurf der Diskriminierung verteidigen.
Die Politik des Universalismus setzt sich für differenzblinde Formen der aktiven Nicht-Diskriminierung ein; ihr Ziel ist „die Angleichung und der Ausgleich von Rechten und Ansprüchen“ (ebd. S. 27). Dabei macht sie auch Praktiken wie die umstrittene „affirmative action“/“reversed discrimination“[5] möglich: Um einen differenzblinden Raum wiederherzustellen, werden übergangsweise bestimmte, bis dato benachteiligte Gruppen bevorzugt[6]. Das Problem mancher dieser Maßnahmen liegt laut Taylor darin, dass sie zu einer Konservierung der Differenzen führt, die ja so nicht beabsichtigt war. Im Gegensatz dazu nimmt die Politik der Differenz eine Neudefinition des Begriffs Nicht-Diskriminierung vor und fordert ausgehend davon, „die Unterschiede zur Grundlage einer differenzierenden Praktik [zu] machen“ (ebd. S. 30).
Besonders drastisch ist laut Taylor der Einwand, die differenzblinden Prinzipien der Politik des Universalismus seien selbst von der jeweiligen Hegemonialkultur geprägt und daher an sich schon diskriminierend. „Besorgniserregend“ (ebd. S. 34) findet er den Gedanken, dass dieser Einwand ein Beweis dafür sein könnte, dass „die Idee des Liberalismus selbst bereits ein Widerspruch in sich ist, ein Partikularismus unter der Maske des Universalismus“ (ebd. S. 34/35).
2.3.4.Die Politik der allgemeinen Menschenwürde
Um näher auf die Problematik dieser beiden Konzepte einzugehen, umreißt Taylor kurz die Positionen Rousseaus, der einer der Vorläufer und einer „der Urheber des Diskurses der Anerkennung“ (ebd. S. 35) ist, und betont dabei den Zusammenhang, den Rousseau zwischen der Abhängigkeit von anderen und einem hierarchischen System herstellt. Dazu erläutert er Rousseaus Grundgedanken, dass Abhängigkeit nicht nur politischer, finanzieller usw. Natur sein kann, sondern auch aus dem „Bedürfnis nach der wohlwollenden Meinung anderer“ (ebd. S. 36) entstehen kann. Dies ist allerdings nur möglich, solange die traditionelle Auffassung von Ehre herrscht, d.h. solange es ein System der Bevorzugung gibt. Daraus folgt nun die paradoxe Situation, dass „die Einzelnen über ungleich viel Macht [verfügen], aber alle […] gleichermaßen voneinander abhängig“ (ebd. S. 36) sind. Die Lösung findet Taylor schließlich in Rousseaus Vorstellungen einer idealen Republik: Gleichheit, Gegenseitigkeit und Einmütigkeit im Wollen führen zu einer Gleichheit in der gegenseitigen Wertschätzung, die ihrerseits die Einmütigkeit im Wollen bedingt. Diese vollkommen ausgewogene Gegenseitigkeit der Anerkennung könnte man also „gute Abhängigkeit“ nennen, da sie mit der Freiheit und der gesellschaftlichen Einmütigkeit vereinbar ist und sogar eine Art „kollektives Ich“ (ebd. S. 40) entstehen lässt, während die „schlechte Abhängigkeit“ (ebd. S. 40) lediglich Entfremdung, Trennung und Isolation hervorbringt. Auch Hegel[7] lehnt sich mit seiner Forderung nach einem „Gemeinwesen mit einer gemeinsamen Zielsetzung, in der das Ich das Wir und das Wir das Ich ist“ (ebd. S. 42) an Rousseau an. Die Hauptproblematik der Rousseauschen Politik der allgemeinen Menschenwürde sieht Taylor darin, dass die von ihm für nötig befundene Einmütigkeit des Wollens eine „rigorose Ausschließung jeder Rollendifferenzierung“ (ebd. S. 42) fordert und die Abhängigkeit vom allgemeinen Willen zum wichtigsten Instrument, um zweiseitige Abhängigkeitsbeziehungen zu vermeiden, macht. Dies lässt an Tyrannei in all ihren Formen denken.
[...]
[1] Taylor: 1997.
[2] Z.B. Taylor: 1988.
[3] Vgl. Trilling 1980.
[4] Vgl. Mead: 1968.
[5] Vgl. das Urteil des US- Supreme- Courts 1978 im sog. Bakke – Fall zur umgekehrten Diskriminierung weißer Männer an amerikanischen Universitäten.
[6] Vgl. dazu auch die durchaus kontrovers geführte Debatte um „Frauenquoten“ der politischen Parteien in der BRD.
[7] Vgl. Hegel: 1988. Kapitel 4.
- Arbeit zitieren
- Katharina Bläsing (Autor:in), 2003, Charles Taylors Politik der Anerkennung in der Kritik von Jürgen Habermas, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13542
Kostenlos Autor werden


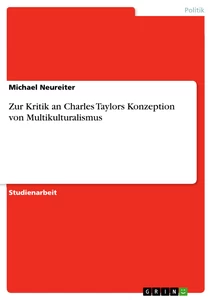







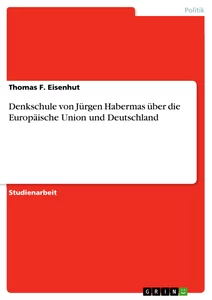







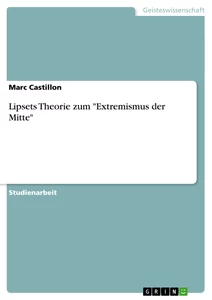
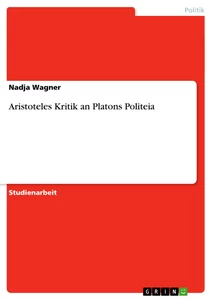



Kommentare