Leseprobe
Inhalt
Einführung
1) Sozialisation
1.1 Begriffsklärung „Sozialisation“
1.2 Begriffsklärung „Mediensozialisation“
1.3 Begriffsklärung „geschlechtsspezifische Sozialisation“
2) Kinderfernsehen
2.1 Öffentlich-rechtliche Programme
2.2 Private Programme
2.3 Sehverhalten von Kindern
3) Sozialisationsangebote im Kinderfernsehen
3.1 Geschlechtsrollen
3.1.1 Männliche Geschlechtsrollen
3.1.2 Weibliche Geschlechtsrollen
3.2 Werte und Normen
3.3 Sonstige
3.3.1 Gesellschaftliche Minderheiten
3.3.2 Alte Menschen
4) Schluss
Literatur
Einführung
Das Massenmedium Fernsehen beeinflusst und verändert aufgrund seiner besonderen Diskursform (siehe dazu ausführlicher Postman 1987) und seiner uneingeschränkten gesellschaftlichen Akzeptanz nicht nur unsere Gesellschaft an sich, sondern in besonderem Maße auch die Kindheit; man spricht von einer „mediatisierten Kindheit“.
Waren früher die wichtigsten Sozialisationsinstanzen für ein Kind die Kirche, die Familie und später die Schule (Hoefer 1995, S. 35), so rückt heute das Fernsehen als „Fenster zur Welt“ auf einen der vordersten Plätze. An die Stelle der Eltern als Vorbild für kindliches Verhalten tritt zunehmend das Fernsehen, das neue, dem Verhalten der Eltern evt. widersprechende Werte und Lebensentwürfe präsentiert und damit die Einstellungen von Kindern schon frühzeitig prägt.
Ein bekanntes Zitat von Gert K. Müntefering „Kinderfernsehen ist, wenn Kinder fernsehen“ verdeutlicht dabei die wichtige Tatsache, dass es Kindern prinzipiell möglich ist, alle ausgestrahlten Sendungen, auch die nur für die Erwachsenen bestimmten, zu sehen und deren Inhalte im Zuge ihrer Sozialisation in ihre Weltbilder einzubauen. Trotz dieser Tatsache will ich mich im folgenden auf speziell für Kinder ausgewiesene Sendungen beschränken.
Diese Sendungen definieren sich meist darüber als Kindersendung, dass sie Zeichentrick und lustige Plüschpuppen beinhalten, seltener über Lerninhalte, Gewaltlosigkeit und Themen, die Kinder und ihre Probleme unmittelbar betreffen.
Für private Anbieter, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Struktur hauptsächlich an Werbeeinnahmen und Einschaltquoten interessiert sind, ist eine mit beliebigen Trickfilmen gefüllte Programmfläche deshalb schon ausreichend, weil Kinder Trickfilme lieben, Eltern Trickfilme für harmlos halten und weil Trickfilme kurz genug sind, um regelmäßig Werbung dazwischen schalten zu können.
Bei den öffentlich-rechtlichen Anbietern gibt man sich bei Kindersendungen mehr Mühe; hier wird auf Bildungsinhalte und Gewaltfreiheit geachtet, es werden Kinder in ihrer sozialen Umwelt gezeigt und man bemüht sich darum, den besonderen Bedürfnissen von Kindern gerecht zu werden.
Dennoch will ich mich in dieser Hausarbeit auf die Untersuchung von Trickfilmen im Kinderprogramm konzentrieren, die auch von ARD und ZDF ausgestrahlt werden und sich bei Kindern großer Beliebtheit erfreuen (vgl. Kapitel 2.3).
Die darin dargestellten stereotypisierten Geschlechtsrollen, Handlungsanleitungen, Gut-und-Böse-Konstellationen etc. sind keineswegs dazu geeignet, aus unseren Kindern die selbstbewussten, emanzipierten Bürger von morgen zu formen, als die wir sie uns erträumen.
Nach einer bewusst kurz gehaltenen Einführung und Begriffsklärung zur Sozialisation im Kindesalter allgemein und zur Mediensozialisation im besonderen möchte ich deshalb prüfen, wie öffentlich-rechtliche und private Sender Kindersendungen gestalten, welche Bemühungen getroffen werden, um gutes Kinderfernsehen anzubieten und welche (mehr oder weniger angemessene) Sozialisationsangebote im Sinne von Rollen- und Familienbildern, Werten, Konfliktlösungsstrategien etc. aus Kindersendungen gezogen werden (können).
1) Sozialisation
1.1 Begriffsklärung „Sozialisation“
Der Begriff der Sozialisation wurde 1896 erstmals von dem amerikanischen Soziologen E.A. Ross benutzt. Er beschrieb „Sozialisation als einen Mechanismus, durch den die Gesellschaft die schwierige Aufgabe bewältigt, die Gefühle und Wünsche der Individuen so zu formen, dass sie den Bedürfnissen der Gruppe entsprechen“ (zit. nach Tillmann 1990, S. 35).
Seit den 80er Jahren verliert diese Vorstellung vom eher passiven Einfügen des Individuums in seine gesellschaftliche Umwelt an Bedeutung. Kindheit wird mit der „Entdeckung“ der Kinder als eigenständige soziale Gruppe nicht mehr nur als Übergangsphase betrachtet, in der der unfertige Erwachsene vollständig sozialisiert wird.
Nach der heute allgemein anerkannten Definition von K. Hurrelmann ist Sozialisation ein „Prozeß der Entstehung und Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit in Abhängigkeit von und in Auseinandersetzung mit den sozialen und den dinglich-materiellen Lebensbedingungen ... , die zu einem bestimmten Zeitpunkt der historischen Entwicklung einer Gesellschaft existieren“ (Hurrelmann 1986, S. 14).
Das Individuum wird also nicht mehr bloß geformt, es formt sich auch selbst zu einer sozial handlungsfähigen Persönlichkeit, die in ein soziales Umfeld eingebettet ist (z.B. Schicht- und Geschlechtszugehörigkeit, die Abhängigkeit von sozialen Institutionen, temporäre Ereignisse in der Gesellschaft wie Kriege, die Frauenbewegung etc.), und dies tut es ein Leben lang.
Dieser Prozess beinhaltet einerseits die Übernahme und Internalisierung von soziokulturellen Werten, Normen und sozialen Rollen, andererseits die „Individualisierung“ i. S. einer individuell bestimmten Auseinandersetzung mit den Einflüssen der Gesellschaft (Hillmann 1994, S. 805). Diese Vermittlung zwischen Mensch und Gesellschaft wird in der soziologischen Sozialisationstheorie hauptsächlich mit dem Konzept der Rollentheorie untersucht, die Sozialisation als eine Integration des Individuums in ein bestehendes gesellschaftliches Rollensystem versteht.
Welche Werte und Rollen im Sozialisationsprozess vermittelt wurden, ist also entscheidend für die Entwicklung der soziokulturellen Persönlichkeit und ihr späteres Verhältnis zur und Verhalten in der Gesellschaft.
1.2 Begriffsklärung „Mediensozialisation“
Der Prozess der Sozialisation wird allgemein in drei Phasen unterteilt. In der primären Sozialisationsphase wird dem neugeborenen Menschen in einer Primärgruppe, meist der Familie, die subjektive Handlungsfähigkeit im Rahmen seiner sozialen Umwelt vermittelt (Hillmann 1994, S. 805). Die sekundäre Phase beinhaltet das Lernen sozialer Rollen, Werte und Normen in der Schule, während die tertiäre Phase die weitergehende Sozialisation des erwachsenen Menschen während seines gesamten Lebens beschreibt.
Massenmedien leisten bei der Sozialisation einen entscheidenden Beitrag, indem sie dem Rezipienten vielfältige Werte, Normen und Verhaltenserwartungen präsentieren, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Waren sozialisationsbegleitende Medien früher hauptsächlich Bücher und Geschichten, die Kindern erzählt und vorgelesen wurden, tritt heute an deren Stelle schon frühzeitig das Fernsehen.
Es kann angenommen werden, dass in mehr Haushalten ein Fernseher steht als ein Bücherregal (AG.MA 1994: Fernseher in Haushalten mit einem Jugendlichen 99% (Westdeutschland) bzw. 100% (Ostdeutschland), zit. nach Hoppe-Graff/ Oerter 2000, S. 108). Über eine Satellitenantenne oder Kabelanschluss verfügen ca. 75% der Haushalte, und in ca. 25% der Haushalte mit Kindern ist ein Zweitgerät vorhanden, das meistens im Kinderzimmer steht (ebd., S. 108).
Der Umgang mit dem Fernseher ist schon für zwei- bis dreijährige Kinder eine Selbstverständlichkeit, es können feste Sehzeiten und erste Spartenkenntnisse festgestellt werden (ebd., S. 109). Stellt man die durchschnittliche Sehdauer in diesem Alter von 75 Minuten pro Tag der Zeit gegenüber, die ein „modernes“ Kind mit seinen berufstätigen Eltern verbringt, gewinnt das Fernsehen als Sozialisationsinstanz an Bedeutung.
Besonders für die Sozialisation von Kindern ist dieses Medium sehr gut geeignet: es ist in jedem Haushalt vorhanden, es verlangt außer einer biologischen Grundausstattung keine speziellen Fähigkeiten oder Vorkenntnisse für seine Nutzung, seine visuelle Natur macht es für Kinder besonders attraktiv. Um es mit R. Damerall zu sagen: „Kein Kind und kein Erwachsener wird durch mehr Fernsehen zu einem besseren Fernsehzuschauer. Die erforderlichen Fähigkeiten sind so elementar, dass uns von einem Fall von Fernsehschwäche noch nichts zu Ohren gekommen ist“ (zit. nach Postman 1987, S. 93).
Dazu kommt, dass das Fernsehen als Kommunikationsstoff schon in den peer groups im Kindergarten eine bedeutende Rolle spielt. Eine weitere Stärke des Fernsehens bzw. der meisten Fernsehsendungen ist ihre Serialität und lange Dauer. Es gibt Serien, die in den 50er Jahren produziert wurden und noch heute von Kanal zu Kanal durchgereicht werden; vieles, was im Fernsehen vermittelt wird, unterliegt also zusätzlich einer ständigen, der Einprägsamkeit sehr zuträglichen, Wiederholung (Berry/ Asamen 1993, S. 230 f.).
Das Fernsehen arbeitet also quasi mit unfairen Mitteln: es bietet sich als unkompliziertes Freizeitvergnügen an, stellt keine Anforderungen, es erzählt spannende Geschichten und ist durch eine begrenzte Anzahl von Genres und Plots sowohl vorhersagbar als auch einprägsam.
Die Jugendmedienstudie kommt zu dem Schluss, dass Fernsehen überwiegend in der Familie stattfindet, die kommunikative Aufarbeitung des Gesehenen aber in den peer groups (Lukesch et al. 1990, S. 68). Die Auseinandersetzung mit den im Fernsehen angesprochenen Thematiken (bzw. die Fixierung auf im Fernsehen gezeigte Thematiken) wird Kindern zusätzlich erleichtert durch die Mehrfachvermarktung wichtiger Figuren und Sendungen (Spielzeug, Computerspiele, Bücher, Kleidung etc.).
Es wurde schon angesprochen, dass Sozialisation nicht nur fremdbestimmt ist, und so ist auch Mediensozialisation als aktives soziales Handeln zu begreifen: ausgehend von den Bedeutungsangeboten des Fernsehens werden deren subjektive Bedeutungsmöglichkeiten im Kontext sozialer Beziehungen kommunikativ verhandelt, d.h. die endgültige Bedeutungszuweisung ist immer geprägt von der sozialen und biographischen Situation des Rezipienten (Fromme et al. 1999, S. 132 f.).
Es besteht jedoch m.E. ein großer Unterschied zwischen einem fernsehenden Erwachsenen, der seine tertiäre Sozialisationsphase durchlebt, und einem Kind, das noch in der primären bzw. sekundären Sozialisation steckt: ersterer hat schließlich erheblich größere soziale und biographische Erfahrungen vorrätig, um Medienangebote angemessen kritisch zu verarbeiten, während ein Kind noch nicht einmal kognitiv vollständig in der Lage ist, die Besonderheiten dieses visuellen Mediums zu begreifen: „Preschoolers and young children attend more to television than older children, comprehend less of truly central and more of incident content, and have difficulty making inferences about content. ... They are more likely to believe in the reality or realism of television content on television“ (Berry/ Asamen 1993, S. 35).
Ihre kognitive “Unreife” hindert Kinder aber nicht daran, wenigstens tagsüber prinzipiell alle angebotenen Sendungen zu rezipieren, also zu verarbeiten. Dabei stoßen Kinder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf Themen, die nicht kinderspezifisch sind, mit denen sie keine Erfahrungen haben (können oder wollen): Moral, Liebe, Macht, Gewalt, Geld, Leidenschaft. Diese Themen werden durch ein ständig wiederholtes Schema vermittelt, das sich durch nahezu alle fiktionalen Programme zieht: die Infragestellung und anschließende Wiederherstellung sozialer Ordnung.
Durch diese ständige Wiederholung problematischer (bzw. nicht verarbeitbarer) Medieninhalte können sich stereotypisierte Weltbilder entwickeln, wie z.B. das des Gesetzesbrechers, des Ordnungshüters, der Gewalt als Erfolgsrezept, der Überlegenheit des Mannes oder die Förderung der Konsumorientierung durch Werbesendungen (Barthelmes 1987, S. 31).
Besonderes Gewicht liegt also auf der Dynamik zwischen Medienangebotsebene und Rezeptionsebene: wie viel Spielraum lassen die in den Medieninhalten eingelagerten Bedeutungsangebote zur Interpretation, und wie selbständig können Kinder diese Bedeutungsangebote verhandeln – mit wem können sie kommunizieren, welche alternativen Deutungen sind ihnen zugänglich?
1.3 Geschlechtsspezifische Sozialisation
Sobald ein Kind das Licht der Welt erblickt hat, wird es anhand seiner biologischen Geschlechtsmerkmale sofort und eindeutig einem von zwei Geschlechtern zugeordnet, ähnlich wie dies beim Erwerb eines Haustiers geschieht (Goffman 1994, S. 107).
Das Geschlecht ist in unserer Gesellschaft eine soziale Strukturkategorie, die schwerer wiegt als Klassen- oder Schichtzugehörigkeit, Rasse oder Konfession; es ist in seiner Zuordnung eindeutig, unveränderbar (jedenfalls im Idealfall) und wird mit „natürlichen“ bzw. biologischen Fakten begründet.
Als Strukturierungsprinzip wirkt „Geschlecht“ wirkt auf dreierlei Art: als Klassifikationssystem zur Zuweisung eines gesellschaftlichen Status´, als Strukturkategorie zur Beschreibung von Alltagsphänomenen und als Ideologie zur möglichen Strukturierung von Denkprozessen (Klaus 1996, S. 40).
Die Summe aller Erwartungen, die die Gesellschaft mit den Konzepten „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ verbindet, bezeichnet man als „gender“: es ist der „zentrale Code, der die Vorstellung der Einzelnen von ihrer grundlegenden menschlichen Natur entscheidend prägt“ (Goffman 1994, S. 105). Das soziale Geschlecht ist somit eine gesellschaftliche Konstruktion, die über eine symbolische Ordnung hergestellt wird; dies können geschlechtsbezogene Stereotype, Kleidung oder Spielzeug sein.
Solche Symbolisierungen erleichtern dem Kind die Selbstsozialisation hin zu einem widerspruchsfreien, gesellschaftlich anerkannten Geschlechtsrollenbild. Es sind Deutungsmuster, Zuschreibungen und Erwartungen, die für den einzelnen die Darstellung der Geschlechtszugehörigkeit ermöglichen. „Jedes Kind hängt wie mit unsichtbaren Fäden an dem erreichbaren Angebot der symbolischen Deutungsmuster vom gesellschaftlich definierten Jungen- und Mädchenverhalten“ (Zimmermann 1998, S. 18).
Bei einer gelingenden Sozialisation werden die geschlechtsspezifischen Erwartungen der Gesellschaft im individuellen Selbst verankert, die Geschlechtsidentität wird zur „Quelle der Selbstidentifikation“ (Wenger 2000, S. 16). Eine große Rolle im Prozess der geschlechtsspezifischen Sozialisation kommt den Interaktionspartnern zu, die geschlechtsspezifische Selbstkonzepte und entsprechendes Handeln bestätigen und/ oder korrigieren können. „Zweigeschlechtlichkeit als kulturelles Kernelement und die alltägliche Konstruktion von Geschlecht in Interaktionen bedingen sich wechselseitig“ (ebd., S. 49).
Ein tragender Bestandteil unserer Gesellschaft ist die Dominanz der männlichen Rolle und die Unterlegenheit der weiblichen, die sich auf die traditionelle geschlechtsspezifische Arbeitsteilung als ökonomische Basis stützen. Alltagswissenschaftlich „begründet“ wird dieses Machtgefälle (meist von beiden Geschlechtern) mit einer Höherbewertung „typisch männlicher“ und einer Geringschätzung „typisch weiblicher“ Eigenschaften:
typisch männlich: Aktivität, Rationalität, Durchsetzungsvermögen, Befähigung zur
Machtausübung, Nervenstärke, psychische Stabilität,
Selbstbewusstsein, Uneitelkeit etc.
typisch weiblich: Passivität, Emotionalität, Fürsorglichkeit, Beziehungsarbeit, Hingabe- und Opferbereitschaft, leichte Erregbarkeit, Sanftheit, Eitelkeit, ohne Führungsqualitäten etc.
(vgl. Scarbath et al. 1994, S. 29, Wenger 2000, S. 17).
Die Frau wird demzufolge als schwaches, zerbrechliches, schützenswertes Wesen stilisiert, der Mann komplementär dazu als starker, überlegener Beschützer der Frau.
Da sowohl Männer als auch Frauen ihr kulturelles Geschlecht i. S. von gender als natürlich empfinden (es sei denn, sie haben Soziologie studiert), wird diese Machtungleichheit als natürliche Folge der biologischen Geschlechtszugehörigkeit betrachtet und nicht oder selten in Frage gestellt; Goffman spricht folgerichtig von „Geschlechtsklassen“ (Goffman 1994).
Dieses System der Zweigeschlechtlichkeit wird sowohl subjektiv als auch strukturell reproduziert: kurz gefasst bedeutet dies, dass Frauen exklusiv die biologische und soziale Elternschaft zugewiesen bekommen und diese auch annehmen, damit oder weil Männer von der Reproduktionsarbeit freigestellt werden und somit auf dem Arbeitsmarkt agieren können (was auch sie annehmen).
Diese typische Organisation der Geschlechter prägt sich einem Kind schon früh ein: die Mutter ist immer (oder jedenfalls öfter als der Vater) anwesend, der Vater oft abwesend. Diese subjektive Erfahrung bildet die Basis für eine unterschiedliche Wahrnehmung von Frauen und Männern. Von Frauen wird Fürsorge erwartet, sie werden aber auch ambivalent hinsichtlich einer gewissen „Überfürsorge“ und Machtlosigkeit des Kindes wahrgenommen. Über Männer existieren eher idealisierende Vorstellungen aus Erzählungen der Mutter über den Vater, da das konkrete Identifikationsobjekt in der Kindheit abwesend ist (vgl. Kühne-Vieser 1993, S. 41 f.).
Mädchen haben es in dieser Hinsicht in den ersten Jahren ihrer Kindheit leichter als Jungen: sie können in allen Aspekten geschlechtsbestimmten Verhaltens dem Beispiel der Mutter folgen und sich mit ihr identifizieren; sie brauchen sich nicht von der Mutter abzugrenzen. Nach der Kleinkindphase sind sich Mädchen daher ihrer eigenen Geschlechtsidentität sicherer. Spätestens mit dem Eintritt in die Schule, oft aber schon früher, erleben Mädchen aber die Dominanz des anderen Geschlechts und ihre eigene Unterlegenheit, in der Pubertät dann ihre Neudefinition als Sexualobjekt für andere (vgl. Hagemann-White 1984, S. 94 f.).
Jungen werden in ihren ersten Lebensjahren genau wie Mädchen unter die alleinige Obhut der Mutter und anderer Frauen gestellt. In dieser Zeit identifizieren sich auch Jungen mit der Mutter, übernehmen weibliche Normen und Vorstellungen (darunter auch weibliche Bewertungen von männlichen Eigenschaften!) (Zimmermann 1998, S. 56).
Schon mit zwei Jahren sind sich Jungen aber ihrer anderen Geschlechtszugehörigkeit bewusst und auch der Tatsache, dass ihr Geschlecht das höher bewertete ist (vgl. Wahl 1990); sie sehen sich also zur Ausbildung ihrer eigenen Geschlechtsidentität gezwungen, die niedrig bewerteten weiblichen Eigenschaften abzulehnen und aus ihrer Persönlichkeit zu verdrängen. Nach wie vor sind Jungen aber von der Mutter abhängig; dies müssen sie ständig verleugnen und werden von der Mutter selbst dazu angehalten, sich zu lösen und allein in der Welt zu bestehen. Jungen erleben ihre Primärsozialisation also als sehr belastend, sind unsicher und tendieren daher dazu, sich und ihre Geschlechtszugehörigkeit zu beweisen oder sich mit ausgewiesen männlichen Helden zu identifizieren (Zimmermann 1998, S. 59 f.).
Die Integrierung der Machtungleichheit zwischen den Geschlechtern in das eigene Selbstbild lässt sich schon früh bei Kindern beobachten. In einer Befragung an Tageseinrichtungen für Grundschulkinder in München (Permien/ Frank 1995) schätzten Mädchen ihr eigenes Geschlecht durchweg negativer ein als Jungen und erkannten häufiger Kompetenzen von Jungen an als umgekehrt. Mädchen begründen positive Aspekte ihres Geschlechts mit ihrem Aussehen, dem sozialen Verhalten, der Beherrschung von Haushaltstätigkeiten. Fester Bestandteil ihres Selbstbildes ist die körperliche Unterlegenheit unter Jungen.
Jungen betrachten sich selbst als stärker, tapfer und lehnen weibliche Eigenschaften und teilweise Mädchen generell ab. Auch wissen Jungen schon früh Bescheid über ihre besseren gesellschaftlichen Chancen bei Einkommen und Berufswahl und bei der familiären Rollenverteilung („Als Junge kann man mehr Geld verdienen“, „Männer bestimmen in der Familie“). Auffällig ist die starke Prägung der Kinder durch geschlechtsbezogene Stereotype, wobei die negativen Klischees fast ausschließlich auf Weiblichkeit bezogen sind. „Nur ganz wenige Jungen sehen keine Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen“ (Permien/ Frank 1995, S. 69).
Einen wichtigen Anteil bei der Konstruktion sozialer Wirklichkeit und damit auch dem System der Zweigeschlechtlichkeit mit all seinen Konsequenzen haben die Massenmedien, mithin auch das Fernsehen. In zahlreichen Studien wurde die gesellschaftliche Diskriminierung der Frau und die Dominanz des Mannes in den Produktionsbedingungen und Inhalten der Massenmedien eindeutig nachgewiesen. „Gender durchdringt – in hyperritualisierter Form – die Massenmedien“ (Wenger 2000, S. 50).
2) Kinderfernsehen
Innerhalb des großen Spektrums an Sendern und der großen Masse an täglicher Sendezeit nehmen Kindersendungen nur einen vergleichsweise geringen Platz ein. Generell lässt sich sagen, dass Sendungen für Kinder während der Woche nur von einzelnen Programmen über den Tag verteilt angeboten werden; dies vor allem zu Zeiten, in denen Erwachsene nicht fernsehen, nämlich früh, vormittags und nachmittags (vor der Schule, während einer Freistunde bzw. statt des Kindergartenbesuchs und nach der Schule).
Großflächige Angebote an Kindersendungen (meist von 6:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr) findet man vor allem bei privaten Anbietern wie RTL2, SuperRTL, KIKA (ARTE) und TM3, während auf den öffentlich-rechtlichen und Dritten Programmen Kindersendungen häppchenweise über den Tag verteilt sind.
[...]
- Arbeit zitieren
- Jenny Haroske (Autor:in), 2000, Sozialisation durch Kinderfernsehen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13430
Kostenlos Autor werden









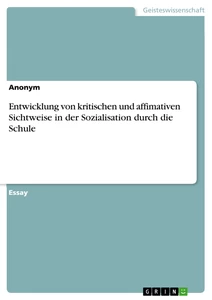

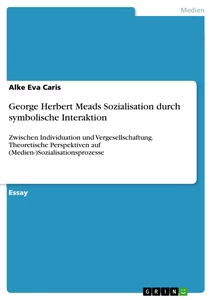










Kommentare