Inhaltsangabe oder Einleitung
In folgender Ausarbeitung möchte ich mich mit engen Beziehungen genauer mit Zufriedenheit, Verpflichtung und Auflösung in bzw. von engen Beziehungen beschäftigen.
Zuerst befasse ich mich mit Zufriedenheit in engen Beziehungen. Dabei geht es um die Frage, warum sich manche Beziehungen zu einer harmonischen und glücklichen andere wiederum zu konflikthaften und eher unglücklichen Beziehungen entwickeln.
Darüber hinaus beschäftige ich mich mit der Frage, unter welchen Umständen und in welchem Umfang sich die Partner in Beziehungen einander verpflichtet fühlen und welche Bedingungen die Stabilität von Beziehungen beeinflussen können.
Im letzten Teil befasse ich mit der Beendigung bzw. der Auflösung von engen Beziehungen. Insbesondere geht es dabei um die eventuellen Folgen, die sich im Falle einer Scheidung, für die Betreffenden ergeben können.
- Arbeit zitieren
- Sandra Richter (Autor:in), 2000, Enge Beziehungen: Zufriedenheit, Verpflichtungen und Auflösung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13399
Kostenlos Autor werden
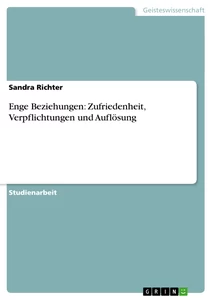
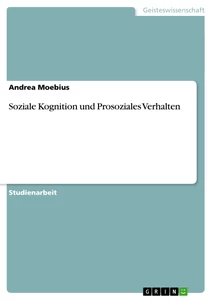
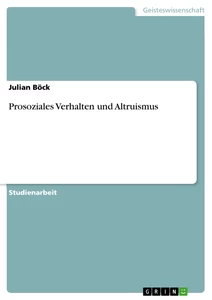
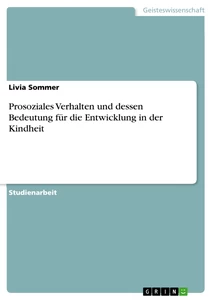

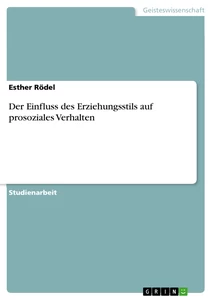
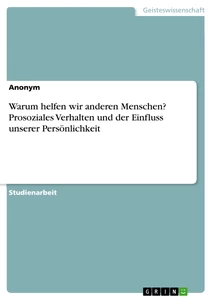


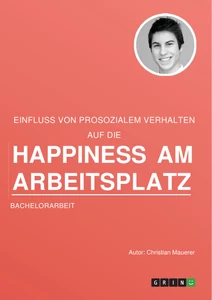
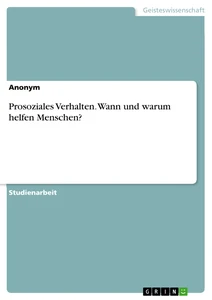

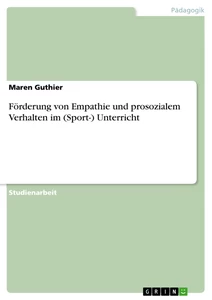

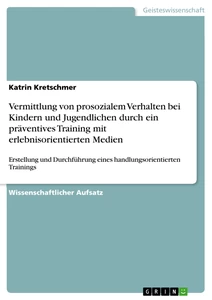
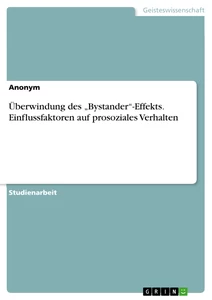

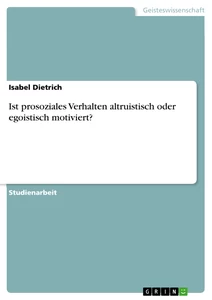
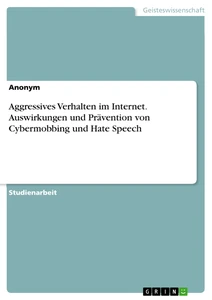

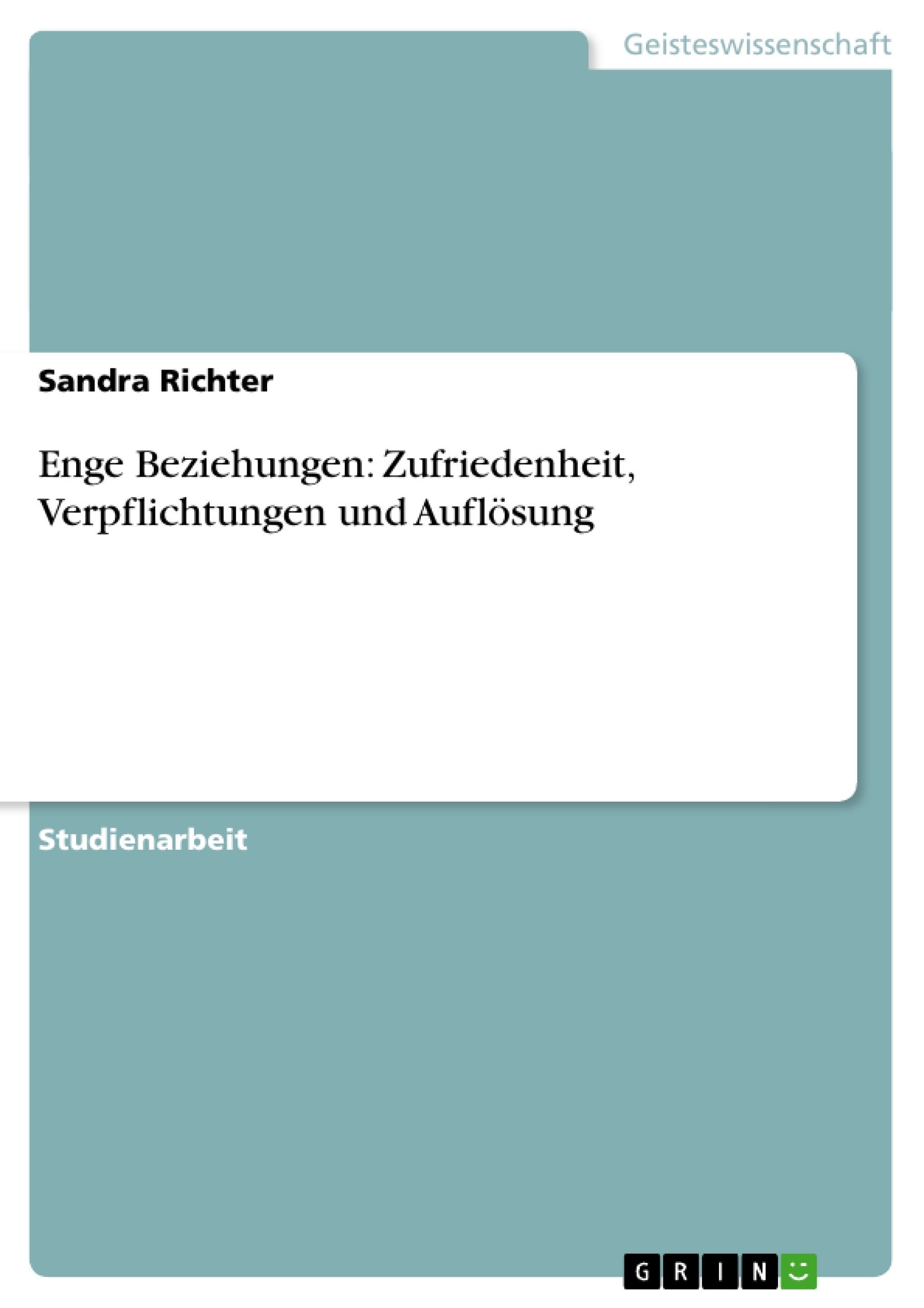

Kommentare