Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einführung in die Thematik
1.1 Gegenstand der Arbeit
1.2 Vorgehensweise
2 Was ist digitales Fernsehen?
2.1 Vorteile des Digitalfernsehens
2.1.1 Effektivere Ausnutzung der Bandbreite
2.1.2 Digitale Produktionskette und breitere Nutzung
2.1.3 Zeitversetztes Fernsehen
2.1.4 Pay-TV
2.1.5 Interaktivität
2.2 Aktueller Stand der Digitalisierung
2.3 Hürden der Digitalisierung
2.4 Ausblick für das Digitalfernsehen
2.5 Ist der Markteintritt im Digital-TV derzeit sinnvoll?
3 Vertriebswege und Empfangbarkeit
3.1 DVB-T
3.2 DVB-C
3.3 DVB-S
3.4 Internetfernsehen
3.4.1 Web-TV
3.4.2 IPTV
3.5 Handy-TV
3.6 Welcher Übertragungsweg wird sich durchsetzen?
4 Erlösmöglichkeiten
4.1 Entgelte und Gebühren
4.2 Werbung
4.2.1 Gesetzliche Regeln für Werbung
4.2.2 Werbeformen
4.3 Weitere Erlösformen
4.4 Erlöspotenzial für digitale TV-Sender
5 Fernsehforschung
5.1 Methode
5.2 Datenmaterial
5.3 Lizenzen
5.4 Kritik
6 Der Konsument
6.1 Mediennutzung und Nutzerprofile
6.2 Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen
6.3 Rückläufiger Fernsehkonsum?
6.4 Jugendliche flüchten ins WWW?
6.5 Medienverschiebung pro Online
6.6 Kinder – die Zuschauer von morgen
6.7 Die Zukunft gehört On Demand?
6.8 Die Offliner
7 Musikfernsehen
7.1 Ursprung des Musikfernsehens
7.2 Faszination Musikvideo
7.3 Medienpolitische Rahmenbedingungen
7.4 Sparten- oder Vollprogramm?
7.5 Hat Musikfernsehen heute noch eine Daseinsberechtigung?
7.6 Musikpräferenzen der Jugend
8 Zulieferer
8.1 Verwertungsgesellschaften
8.2 Lizenzproblematiken
9 Musikfernsehen in Deutschland
9.1 MTV & VIVA
9.2 iMusic 1
9.3 Yavido Clips
9.4 Deluxe Music
9.5 Potenzielle Mitbewerber
9.6 Web TV
9.7 Sonstige Alternativen
10 Zusammenfassung und Ausblick
Anhang A: Interview mit Dr. Bernhard Engel
Anhang B: Interview mit Prof. Dr. Ing. Rolf Hedtke
Anhang C: Interview mit Uwe Lerch
Anhang D: Interview mit Andreas Grotholt
Anhang E: Interview mit Alexander Gorny
Anhang F: Interview mit Bernd Wohlleben
Literaturverzeichnis
Vorwort
„Man muss ein bisschen unique sein – in dieser Welt.“
Andreas Grotholt, Global Business Leader von Millward Brown
(im Anhang auf S. 188)
Diese Diplomarbeit ist das Ergebnis langer Recherchen und vieler schlafloser Nächte. Ich möchte mich bei meinem Arbeitgeber und der gesamten Belegschaft der iMusic TV GmbH, bedanken, die mir während meines Praktikums tiefe Einblicke in das TV-Geschäft gewährt haben.
Darüber hinaus möchte ich mich bei meinen Interviewpartnern Dr. Bernhard Engel, Alexander Gorny, Andreas Grotholt, Prof. Dr. Ing. Rolf Hedtke und Bernd Wohlleben für ihre Zeit und die
interessanten Antworten bedanken, die mir bei der Spurensuche sehr geholfen haben.
Außerdem danke ich Herrn Uwe Lerch, der sich als Koreferent bereit erklärt hat, mich während dieser Zeit zu betreuen und darüber hinaus sich mir im Interview gestellt hat.
Frau Prof. Dr. Ziegler danke ich, dass sie an mich geglaubt und mir stets zur Seite gestanden hat.
Und zu guter letzt danke ich meiner Frau Bonny, ohne die ich diese Arbeit wohl nie rechtzeitig vollendet hätte.
Im Folgenden wird ausschließlich zugunsten der besseren Lesbarkeit des Textes jeweils nur die männliche Form verwendet.
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 - Entwicklung der Brutto- und Netto-TV-Werbeumsätze
Abb. 2 - Wettbewerbskräfte im Musikfernsehen
Abb. 3 - Anzahl der in Deutschland flächendeckend gut
empfangbaren TV-Kanäle
Abb. 4 - Entwicklung des Digitalisierungsgrades in Deutschland
Abb. 5 - Empfangsebenen in Deutschland
Abb. 6 - Empfang auf den drei meistgenutzten Geräten
Abb. 7 - Prognose zur Digitalisierung im Primärempfang
Abb. 8 - Absatz HDTV Geräte in Deutschland
Abb. 9 - Bundesweite private Fernsehprogramme
Abb. 10 - Empfangsebenen pro Region in Deutschland
Abb. 11 - DVB-T Empfangsbereich deutschlandweit
Abb. 12 - Einzugsgebiete der drei großen Kabelnetzbetreiber
Abb. 13 - Verteilung der Haushalte auf die Netzebenen Drei und Vier
Abb. 14 - Analoger und digitaler ASTRA-Empfang
Abb. 15 - Entwicklung der Internetnutzung
Abb. 16 - Entwicklung von schnellen Breitbandanschlüssen
Abb. 17 - Häufigkeit der Nutzung von Internetfernsehen
Abb. 18 - Rezeption und Partizipation bei Videoportalen
Abb. 19 - Prognose zur Entwicklung der IPTV-Haushalte
Abb. 20 - Übertragungsarten von Inhalten auf Mobiltelefone
Abb. 21 - Entwicklung von UMTS
Abb. 22 - Struktur der Gesamterträge im privaten Fernsehen
Abb. 23 – Werbung stört?
Abb. 24 - Entwicklung der durchschnittlichen Sehdauer
Abb. 25 - Entwicklung des Tausend-Kontakt-Preises 30 Sec in Euro
Abb. 26 - Sehbeteiligung in % im Tagesverlauf 2007
Abb. 27 - Beispiel für Skyscraper
Abb. 28 - Beispiel für Singlesplit
Abb. 29 - Wachstum der Online-Käufer
Abb. 30 - Marktanteile der AGF- und Lizenzsender
Abb. 31 - Abwanderung von Zuschaueranteilen zu den Restlichen
Abb. 32 - Modellansicht TC score
Abb. 33 - Anzahl der in Deutschland lebenden Ausländer
Abb. 34 - Lean-Back, Lean-Forward, Jump-In
Abb. 35 - Alterungsprozess in Deutschland
Abb. 36 - Sinus-Milieus im AGF-Fernsehpanel
Abb. 37 - Ausweitung der Mediennutzung im Laufe der Jahre
Abb. 38 - Verschiebung der Internetnutzung im Tagesverlauf
Abb. 39 - Parallelnutzung der Medien
Abb. 40 - Stellenwert des Internets bei tagesaktuellen Informationen
Abb. 41 - Jugendliche als Vorreiter der Internetnutzung
Abb. 42 - Informationsverhalten für tiefergehende Informationssuche
Abb. 43 - Einschätzung zur globalen Entwicklung des Werbemarktes
Abb. 44 - Multimediale Kinderzimmer
Abb. 45 - Medienbindung bei Kindern
Abb. 46 - Aussagen von Eltern zu Computer und Internet
Abb. 47 - Genrepräferenzen junger Fernsehzuschauer
Abb. 48 - Attraktivität von Musikfernsehen nach Altersklassen
Abb. 49 - Bildungsstand in Deutschland
Abb. 50 - Interesse an klassischer Musik
Abb. 51 - Musikpräferenzen in Deutschland
Abb. 52 - Jugendszenen in Deutschland
Abb. 53 - Störfaktoren im Fernsehen
Abb. 54 - Dr. Bernhard Engel
Abb. 55 - Rolf Hedtke
Abb. 56 - Uwe Lerch mit seinem Sohn David
Abb. 57 - Andreas Grotholt
Abb. 58 - Alexander Gorny bei der Grimme-Preisverleihung
Abb. 59 - Bernd Wohlleben
Tabellenverzeichnis
Tab. 1 - Entwicklung des Werbeträgers Fernsehen
Tab. 2 - Was Zuschauer am Fernsehen nicht mögen
Tab. 3 - Reichweiten der großen Kabelnetzbetreiber
Tab. 4 - Eigenschaften der Mobil-TV Standards
Tab. 5 - Soziodemografische Struktur der Offliner in Deutschland
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einführung in die Thematik
Über 70 Jahre nach Gründung des ersten öffentlichen Fernseh-programmdienstes der Welt[1] spielt das Fernsehen noch immer eine zentrale Rolle im Leben der Menschen (vgl. AGF 2008, S. 4). Von der Gründung der sechs Landesrundfunkanstalten[2] durch die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands (ARD) am 09. und 10.06.1950 über die Einführung des Farbfernsehens am 25.08.1967 bis hin zur Geburtsstunde des Privatfernsehens mit Sat.1 durch den Start des Kabelfernsehens am 01.01.1984[3] (vgl. gfu 2006, S. 4ff.) konnte sich das TV-Gerät als oberstes Massenmedium etablieren und ist selbst heutzutage als solches kaum aus dem Alltag wegzudenken.
Derzeit erfährt das Fernsehen mit der Digitalisierung die nächste Revolution. Der Startschuss für den ersten digitalen Fernsehsender namens DF1[4] am 28. Juli 1996 (vgl. Premiere 2008, S. 1) wird allgemein als Eintritt in ein neues Fernsehzeitalter bezeichnet (vgl. Lenz/Reich 1999, S. 6). Die analoge Übertragungstechnik erlaubte bis dahin nur eine sehr begrenzte Anzahl an Programmen[5]. Die Frequenzen waren Anfang bis Mitte der Neunziger recht schnell ausgelastet, weshalb ein Einstieg für neue Marktteilnehmer erst durch den Ausstieg anderer möglich war.
Ab dem 11.10.1988 eröffnete sich mit dem ersten auf Deutschland direkt strahlenden Satelliten ASTRA 1A eine weitere Alternative zum Markteintritt. Aber diese war aufgrund der anfangs geringen Verbreitung von Satellitenempfängern noch relativ unattraktiv. Wie mir Dr. Engel berichtete, startete Pro7 im Jahr 1989 seinen Sendebetrieb trotz der geringen Reichweite von nur 500.000 Haushalten über Satellit und bewies, dass sich dieser mutige Schritt letztendlich gelohnt hat (vgl. Anhang, S. 107).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im Schutze dieser technischen Barriere konnten die teilnehmenden Sender ihre Werbeeinnahmen problemlos in die Höhe treiben (siehe Tab. 1).
Erst mit der Digitalisierung der Übertragungswege und der damit verbundenen Potenzierung der Programmzahl, auf die ich später näher eingehen werde, öffnet sich der Markt für neue Mitbewerber, die ebenfalls am reichlich gedeckten Tisch Platz nehmen wollen. Wie man in Abb. 1 erkennen kann, erwirtschaftet das Fernsehen im Schnitt vier Milliarden Euro an Werbeeinnahmen p.a. – das entspricht ca. 20% des gesamten Werbemarktes (vgl. Breunig 2007a, S. 89). Grund genug sich die Königsklasse der Medien mal näher anzusehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 - Entwicklung der Brutto- und Netto-TV-Werbeumsätze
Daten: ZAW, Nielsen Media Research, Goldmedia-Analyse (Quelle: ALM 2008, S. 92)
1.1 Gegenstand der Arbeit
Die Grundfragestellung meiner Abhandlung zielt darauf ab, ob für neue TV-Sender ein Markteintritt zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoll ist und inwieweit die Digitalisierung Möglichkeiten für neue TV-Konzepte bietet.
Mittlerweile gibt es in Deutschland rund 500 digitale Fernsehkanäle und darüber hinaus 700 Web-TV-Angebote (vgl. van Eimeren/Frees 2008a, S. 350). Die Vielzahl an Akteuren und die Heterogenität ihrer Angebote würden den Rahmen einer Diplomarbeit bei weitem sprengen. Daher begrenze ich die Betrachtung auf ein spezielles TV-Genre, das die Fernsehlandschaft in diesem Sinne vertreten soll.
Als Untersuchungsobjekt dient mir das Musikfernsehen, welches ich im Hinblick auf seine Tauglichkeit im derzeitigen Medienumfeld analysieren werde. Es hat einen ganz eigenen Charakter, der seit über einem Vierteljahrhundert sowohl jung wie alt in seinen Bann zieht. Im Internetzeitalter steht es vor der Herausforderung, sich selbst neu zu erfinden, denn die Menschen haben andere Mittel und Wege gefunden, den Musikvideoclip zu konsumieren. Nun stehen alte wie neue Wettbewerber vor dem Scheideweg zwischen Sparte und Vollprogramm.
Der hier untersuchte Markt unterliegt einem ständigen technischen und gesellschaftlichen Wandel, in dem Schlag auf Schlag neue Entwicklungen die Ausgangssituation verändern können. Ich habe mich durch ausgiebige Internetrecherchen um eine hohe Aktualität bemüht, um eine möglichst langlebige Aussagefähigkeit zu erreichen.
Als Stichtag gilt der 31. August 2008, auf den sich der Quellenstand und somit auch das Ergebnis dieser Arbeit festlegen lassen. Alle Informationen, die nach diesem Datum erschienen sind, wurden nicht berücksichtigt. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass die hier geschlossene Bilanz im Laufe der Zeit als überholt gelten kann.
1.2 Vorgehensweise
Im Sinne der strategischen Marktanalyse wende ich das Konzept der fünf Wettbewerbskräfte nach Michael Porter an. Anhand dieses Modells ist es möglich, die Attraktivität und Rentabilität eines Marktes zu bewerten, um auf dem Wettbewerbsumfeld beruhend eine wirksame Strategie zu entwickeln. Dazu werde ich den potentiellen Markteintritt neuer Anbieter (Markteintrittsbarrieren und Distributoren), die Verhandlungsstärke der Abnehmer (Zuschauer und Werbewirtschaft), die Verhandlungsstärke der Lieferanten (Content-Produzenten und Rechteinhaber), den Wettbewerb innerhalb der Branche (andere Musik-TV-Sender) und die Substitutionsgefahr (durch andere Medien) untersuchen (siehe Abb. 2).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2 - Wettbewerbskräfte im Musikfernsehen
(eigene Darstellung in Anlehnung an Porter 1999, S. 23)
In den ersten drei Kapiteln werde ich die Voraussetzungen und Vorzüge des Digitalfernsehens erörtern und die verschiedenen Distributionswege untersuchen.
Im Gegensatz zu vielen anderen Branchen besteht beim Fernsehen zwischen Anbieter und Konsument, mit Ausnahme von Pay-TV, kein direktes Geschäftsverhältnis (vgl. Friedrichsen/Lindner 2004, S. 290ff.). Das Privatfernsehen ist in erster Linie werbefinanziert. D.h., die Werbekunden honorieren den Zuschauererfolg des Senders mit lukrativen Werbebuchungen. Dieser Dreiecksbeziehung, die letztendlich über Aufstieg oder Fall eines Senders entscheidet, widme ich den Schwerpunkt meiner Abhandlung.
Im Rahmen meiner Nachforschungen stellte ich fest, dass das Fernsehen ein sehr lebendiger Markt ist, der aufgrund des immensen Drucks, 24/7[6] ein durchgehendes Programm zu bieten, sehr stark von dem Bauchgefühl seiner Macher abhängt. Daher entschloss ich mich, einige Interviews mit Führungskräften der Branche zu führen, um der herrschenden Meinung auf den Zahn zu fühlen. Bei der Auswahl meiner Interviewpartner achtete ich darauf, möglichst viele verschiedene Blickwinkel abzudecken.
Dr. Bernhard Engel vertritt hierbei als Chefmarktforscher des ZDF die Öffentlich-Rechtlichen, Prof. Dr. Ing. Rolf Hedtke als Forscher und Lehrender der FH Wiesbaden die technische Seite der Industrie, Uwe Lerch als Senior Vice President der iMusic TV GmbH einen privaten Digital-TV Sender namens iMusic 1, Andreas Grotholt als Global Business Leader von Millward Brown ein unabhängiges Marketingunternehmen, Alexander Gorny als Vice President der Hobnox AG ein zukunftsweisendes Internetfernsehprojekt und schließlich Bernd Wohlleben, der als Geschäftsführer von Streetclip.tv das Sendekonzept des klassischen Musikfernsehens auf das Internet adaptiert.
Die von mir persönlich geführten Interviews wurden aufgezeichnet, transkribiert, zur besseren Lesbarkeit redaktionell aufbereitet und schließlich zur Freigabe den jeweiligen Interviewpartnern vorgelegt. Somit entsprechen die Mitschriften sinngemäß dem tatsächlichen Verlauf der Interviews. Während meiner Analysen werde ich auf die Interviews Bezug nehmen und auf die entsprechenden Stellen verweisen.
Die Interviews befinden sich im Anhang ab S. 99.
Doch zunächst gilt es, das Digitalfernsehen mit seinen Vorteilen und das Musikfernsehen mit seinen Eigenheiten näher zu erläutern.
2 Was ist digitales Fernsehen?
„Nicht das Fernsehen der Zukunft ist digital, sondern das Fernsehen, was wir heute haben, ist digital.“
Prof. Dr. Ing. Rolf Hedtke, FH Wiesbaden (im Anhang, S. 141)
Der Begriff „digital“ stammt von dem lateinischen Wort „digitus“ ab, was übersetzt „Finger“ heißt. In der Physik versteht man darunter nicht stetig veränderliche, also in diskrete Einzelschritte aufgelöste Werte, während analoge Größen völlig stufenlos sind (vgl. Meyer 2007, Suchbegriff „digital“). Die Wandlung von analog in digital bedeutet nichts anderes, als dass man die Ausschläge analoger Schwingungen durch binäre[7] Zahlenfolgen darstellt. Somit erhält man einen Datenstrom, der mit modernen Datenreduktionsverfahren den Frequenzbereich des analogen Signals wesentlich effizienter ausnutzt (vgl. Breunig 1997, S. 17, 24).
1993 wurde der europäische Standard DVB (Digital Video Broadcasting) zur Übertragung von digitalen Fernseh- und Radioprogrammen sowie weiteren digitalen Diensten aufgestellt (vgl. Messmer 2002, S. 19).
Dementsprechend wird das digitale terrestrische Fernsehen mit DVB-T, das digitale Kabelfernsehen mit DVB-C und das digitale Satellitenfernsehen mit DVB-S bezeichnet. Zur Datenreduktion werden gemäß des DVB-Standards MPEG-Codecs[8] eingesetzt. Diese verwenden Algorithmen, um die Bitrate noch weiter zu reduzieren. Im Wesentlichen sind das die Irrelevanz- und die Redundanz-Reduktion (vgl. Breunig 1997, S. 43).
Das TV-Bild besteht aus einer Folge von vielen Einzelbildern, die in hoher Frequenz die menschliche Wahrnehmung aufgrund ihrer Trägheit überlisten und fließende Bewegungen suggerieren.[9] Die Redundanz-Reduktion basiert auf der Idee, nur jene Bildanteile zu übertragen, die in der Bildfolge ihre Position ändern. Die unveränderten Bildanteile müssen demnach nur einmal übertragen werden (vgl. Lenz/Reich 1999, S. 34). Dazu werden vor dem Aussenden des Fernsehsignals die aufeinanderfolgenden Bilder analysiert und die konstanten Anteile herausgefiltert, um beim Empfänger wieder zu einem kompletten Bild zusammengefügt zu werden (vgl. Breunig 1997, S. 25). Im Durchschnitt bleiben bei zwei aufeinanderfolgenden Bildern ca. 96% der Inhalte unverändert (vgl. Karstens/Schütte 2005, S. 315).
Die Irrelevanz-Reduktion entfernt Informationen, die aufgrund psychooptischer und psychoakustischer Phänomene für die menschliche Wahrnehmung, wie der Name schon sagt, irrelevant sind. So werden sehr fein aufgelöste Strukturen, die vom Menschen nur als homogene Flächen wahrgenommen werden, geglättet übertragen. Ebenso werden aus Audiodaten jene Frequenzen gelöscht, die das menschliche Ohr ohnehin nicht hören kann (vgl. Lenz/Reich 1999, S. 34f.).
Ein analoges Fernsehsignal kann mit diesen beiden Methoden problemlos um den Faktor zehn reduziert werden, ohne einen deutlich erkennbaren Qualitätsverlust zu offenbaren (vgl. Lenz/Reich 1999, S. 36). Dank einer wirksamen Fehlerkorrektur in den Empfangsgeräten sind digitale Signale selbst bei widrigen Umständen stabiler als analoge (vgl. Lenz/Reich 1999, S. 43ff.). Somit sind Bildstörungen durch schlechte Witterung sozusagen Schnee von gestern.
Durch das Multiplexing werden mehrere Datenströme aus verschiedenen Video-, Audio- und Datensignalen zu einem Transportstrom zusammengeführt (vgl. Ziemer 2003, S. 299). So ist es möglich, gleich mehrere digitale Programme auf dem Frequenzkanal eines analogen Programms zu übertragen. Man spricht dann von einem Programmbouquet (vgl. §2 II Nr. 9 10. RÄndStV). Nimmt man z.B. einen ASTRA-Satellitentransponder mit 38,015 Mbit/Sekunde und eine Kabelfrequenz mit 33,791 Mbit/Sekunde, ergeben das sieben bis acht digitale Programme in guter Qualität bei jeweils 4,5 Mbit/Sekunde (vgl. Lenz/Reich 1999, S. 36f.).
Zum Empfang von digitalen Sendern ist ein separater Receiver notwendig, welcher aus den übertragenen Daten das TV-Bild wieder zusammensetzt und ggf. für analoge Fernsehgeräte umwandelt. Da der technische Fortschritt auch bei den Endgeräten eine komplette Digitalisierung vorantreibt, gibt es bereits TV-Geräte, die einen Digital-Receiver bspw. für den terrestrischen Empfang fest eingebaut haben.
2.1 Vorteile des Digitalfernsehens
Wie im vorherigen Kapitel erläutert, ermöglicht die Digitalisierung mehr Inhalte zu übertragen. Dies ist die Basis der allseits angepriesenen Vorteile und Möglichkeiten des Digitalfernsehens (vgl. Lenz/Reich 1999, S. 27). Welche Chancen, aber auch welche Risiken die mit sich bringen, erkläre ich im Folgenden.
2.1.1 Effektivere Ausnutzung der Bandbreite
Die zusätzlichen Kapazitäten der digitalen Distribution können genutzt werden, um entweder mehr Programme zu übertragen, als Abwandlung davon mittels Multi-Channeling mehrere Kameraperspektiven für bspw. Sport-Events anzubieten, oder die Programme in höherer Qualität auszustrahlen. Für letzteres können eine geringere Kompression, höherwertige Tonformate wie Dolby Digital[10] oder hochauflösende Bilder im HDTV-Standard[11] eingesetzt werden.
Dazu wird mehr Bandbreite benötigt, was die Programmzahl pro Frequenzkanal wieder einschränkt.
In meinen Interviews waren sich alle Teilnehmer einig, dass gerade die bessere Bild- und Tonqualität sowie die wachsende Programmauswahl von großer Bedeutung sind. Die stetig wachsenden Bildschirmdiagonalen erfordern hochwertigere Bildquellen. In Japan wird bereits an neuen Standards wie Ultra-HDTV gearbeitet, um selbst wandgroße Flachbildfernseher adäquat zu bespielen (vgl. Anhang, S. 143).
Der Programmzuwachs hingegen bedeutet aber auch eine stärkere Fragmentierung. Dies erhöht den Wettbewerb insbesondere zwischen den kleineren Rundfunkanstalten, denn wie Dr. Engel mir erklärte, nutzen die Fernsehzuschauer trotz dem großen Angebot nur eine kleine Auswahl an Sendern regelmäßig (vgl. Anhang, S. 124). In seiner Abhandlung über das Relevant Set[12] stellt er fest, dass selbst ein Konsument mit Digitalfernsehen, der im Schnitt 123 Programme empfängt, 90% seiner Gesamtnutzung allein mit zehn Programmen abdeckt (vgl. Beisch/Engel 2006, S. 374-375).
2.1.2 Digitale Produktionskette und breitere Nutzung
Die Digitalisierung der Übertragungswege ist die konsequente Fortführung der Computerisierung in der Video- und Audioproduktion und schließt somit die Lücke zwischen den weitgehend digitalisierten Studios und den Endgeräten beim Konsumenten (vgl. Lenz/Reich 1999, S. 27). Der Einsatz von Computern ermöglicht eine höhere Flexibilität und Qualität bei der Erstellung von Inhalten und eröffnet neue Dimensionen in der verlustfreien Gestaltung und Nachbearbeitung von Videos, die zudem durch die stetig steigende Verarbeitungsgeschwindigkeit der Computer immer kostengünstiger realisiert werden können (vgl. Neumann-Bechstein 1997, S. 183).
Prof. Dr. Ing. Hedtke gab zu bedenken, dass sich den Produzenten erst bei konsequenter Umstellung des gesamten Work-Flows (engl. Arbeitsablauf) das volle Potential der Digitaltechnik eröffnet. Das setzt natürlich voraus, dass sie in diese Technik investieren müssen (vgl. Anhang, S. 144).
Der soeben erwähnte technische Fortschritt in der Computertechnik liefert laut Prof. Dr. Ing. Hedtke zudem immer kleinere Komponenten, mit denen sich mehr Multimediafunktionen in Endgeräte integrieren lassen. Nur dadurch konnte sich z.B. das Mobiltelefon zu dem Allroundtalent entwickeln, wie wir es heute kennen (vgl. Anhang, S. 142).
Digitale Inhalte können also für eine breite Basis an Endgeräten weiterverarbeitet werden. Dadurch wird eine Auswertung auf alternative Mediengeräte, wie Radio oder Handys, sowie nachgelagerten Verwertungsstufen, wie Print- und Online-Diensten, vereinfacht (vgl. Schössler 2001, S. 10).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dementsprechend ist auch die Ausstrahlung eines Fernsehprogramms nicht mehr auf den klassischen Broadcast[13] über Terrestrik, Kabel oder Satellit beschränkt. Die Ausstrahlung über das Internet oder andere Telekommunikationsnetze ist ebenso machbar. Der Markteintritt über das Internet ist bereits mit kleinen Budgets realisierbar und eignet sich bspw. zum Testlauf von neuen Programmkonzepten.
Dem Konsumenten bietet sich eine größere Auswahl an Empfangswegen, die gemeinsam eine bessere Versorgungsabdeckung erlauben. DVB-T wirbt nicht umsonst mit dem Kunstwort „Überallfernsehen“ (vgl. NDR 2008, S. 1). Wie Abb. 3 zeigt, hat sich während der Digitalisierung nach 1995 die Zahl flächendeckender Programme mehr als verdoppelt.
2.1.3 Zeitversetztes Fernsehen
Da die Fernsehprogramme in digitaler Form beim Konsumenten ankommen und bandlos gespeichert werden können, genießt er die gleichen Vorzüge wie die Produktionsstudios. Sofern er über eine entsprechende Ausstattung verfügt, kann er die Sendungen verlustlos aufzeichnen, auf den Computer exportieren und weiterbearbeiten.
Sogenannte Personal Video Recorder (PVR) verfügen über Festplatten oder optische Speichermedien wie DVD-Recorder (Digital Versatile Disc). Mit ihnen wird der zeitverzögerte Fernsehkonsum, der zwar mit analogen Videorecordern bereits möglich war, noch bequemer. Neben dem direkten Zugriff auf jede Stelle einer Aufnahme ist insbesondere das Timeshifting zu nennen, mit dem der Nutzer jederzeit ein laufendes Programm pausieren und später fortsetzen kann. Timeslip nennt man hingegen das Abspielen einer bereits gestarteten Aufnahme, die noch nicht abgeschlossen ist und im Hintergrund weiteraufzeichnet. Dem Verwender bietet sich damit die einmalige Chance, sich von dem traditionell linearen[14] TV-Programm zu emanzipieren (vgl. van Eimeren/Frees 2008a, S. 350).
Das Electronic Programme Guide (EPG) ist eine Art digitale Programmzeitschrift, mit der sich der Nutzer über die aktuelle und die darauffolgenden Sendungen informieren kann. Im Gegensatz zum althergebrachten Videotext greift das EPG auf die Informationen aller gespeicherten Sender zu und bietet eine sinnvolle Orientierung in der Flut an Digitalprogrammen, die über den geneigten Zuschauer hereinbrechen. Mittels Filter sind auch Abfragen nach Genre oder anderen Suchschlüsseln möglich (vgl. Schenk/Döbler/Stark. 2002, S. 40f.). Als besonders komfortabel zeichnet sich die Programmierung von Aufzeichnungen mittels EPG aus, bei der Anfangs- und Endzeiten sowie Titel und weitere Informationen mit wenigen Knopfdrücken direkt übernommen werden. Die EPGs werden über die Programmkanäle gesendet und können neben Texten auch Bilder enthalten. Je nachdem wie der Anbieter das EPG gestaltet, in den Kabelnetzen sind das in der Regel die Kabelnetzbetreiber selbst, kann er Einfluss darauf nehmen, wie die Sender darin vom Nutzer wahrgenommen werden. Bei einem Markteintritt sollte ein Sender sich deshalb um eine prominente Zuordnung bemühen.
Noch einen Schritt weiter gehen intelligente Festplattenrekorder, wie vom amerikanischen Marktführer TiVo, die aus dem Seh- und Aufnahmeverhalten des Benutzers ein Profil erstellen und davon ausgehend selbständig Sendungen aufzeichnen, die dem Besitzer eventuell gefallen könnten. Das Verpassen einer Serie gehört damit der Vergangenheit an (vgl. Turecek/Grajzyk/Roters 2001, S. 265).
Prof. Dr. Ing. Hedtke sieht gerade im EPG die Chance für kleinere Sender auf unattraktiven Programmplätzen in den hinteren Rängen, über die Suchfilter dieser Navigationshilfen überhaupt in den Wahrnehmungsbereich der Zuschauer zu gelangen (vgl. Anhang, S. 161).
Während das EPG hier Chancen für Neueinsteiger bietet, beschworen viele bereits mit der Ankündigung des ersten TiVo-Festplattenrekorders im Jahre 1999 das Ende des werbefinanzierten Fernsehens, da mit Geräten dieser Art das Überspringen von Werbung sehr leicht gemacht wird (vgl. Stipp 2008, S. 299). Auch die überwiegende Mehrheit meiner Interviewpartner sah darin eine Gefahr für den klassischen Werbeblock – dem grundlegenden Geschäftsmodell der Privaten.
Dr. Engel hingegen relativierte diese Angst mit dem Hinweis auf hinreichende Untersuchungen aus den USA (vgl. Anhang auf S. 118). Diese belegen, dass trotz des Vorhandenseins eines PVRs im Haushalt 70 Prozent des TV-Konsums live erfolgt und lediglich ein Reichweitenverlust von sechs Prozent auf das Überspringen von Werbung zurückzuführen ist (vgl. Stipp 2008, S. 299). Dr. Engel fügte hinzu, dass der Fernsehkonsum durch einen PVR sogar zunimmt und diesen Verlust weitgehend ausgleicht (vgl. Anhang auf S. 118). Darüber hinaus sind meines Erachtens live übertragene Ereignisse wie ein Fußballspiel extrem resistent gegenüber zeitversetzter Nutzung, denn schließlich will kaum jemand mit fünf Minuten Verzögerung über ein Tor jubeln, während die Nachbarn bereits den Konter erleben.
Trotzdem sollten sich die Werbetreibenden auf die steigende Verbreitung von PVRs einstellen und entsprechende Gegenmaßnahmen in Betracht ziehen. Wie eine von NBC und TiVo beauftragte Studie von Millward Brown feststellte, wird Werbung in erster Linie per Schnelldurchlauf übersprungen. Dabei muss sich der Nutzer besonders stark auf die rasche Abfolge der Spots konzentrieren, um das Ende des Werbeblocks nicht zu verpassen und gezielt den Einstieg in die Sendung zu finden. Das Erinnerungsvermögen an die Spots war überraschend hoch. Die Untersuchungen belegten, dass die Probanden vor allem auf die Mitte des Bildschirms achten, was für eine zentrierte Einblendung von Marken und Produkten spricht. Darüber hinaus neigen die Zuschauer dazu, auf TV-Spots, die sie persönlich interessieren, zurückzuspulen, um sie dann in aller Ruhe zu genießen (vgl. Stipp 2008, S. 300-305). Hier sehe ich besonders gute Chancen für unterhaltsame und variierende Werbespots.
2.1.4 Pay-TV
„Auf lange Sicht werden wir mehr Pay-TV Sender bekommen. Der Deutsche wird sich damit abfinden müssen.“
Bernd Wohlleben, Geschäftsführer von Streetclip.tv
(im Anhang S. 216)
Da ist es natürlich naheliegend, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die werbefrei funktionieren. Da bietet sich die Verschlüsselung von Programmen an, die dann für ein Entgelt bspw. als Abonnement vom Konsumenten freigeschaltet werden können – Pay-per-Channel (vgl. Woldt 2002, S. 534). Sender wie Premiere boten kostenpflichtige Programme bereits in analogen Zeiten an, aber im digitalen Zeitalter lassen sich solche Geschäftsmodelle wesentlich einfacher realisieren. Zur Entschlüsselung, auch Descrambling genannt, werden Smartcards[15] mit Informationen über den Nutzer, z.B. die Kundennummer, benötigt, die über ein Conditional Access Modul[16] (CA-Modul) in den Receiver gesteckt werden und den Nutzer somit adressierbar machen (vgl. Ziemer 1997, S. 318).
Die temporäre Freischaltung eines kostenpflichtigen Kanals über festgelegte Zeiteinheiten nennt sich Pay-per-View und wird verwendet, um einzelne Leistungen wie einen bestimmten Film oder ein Fußballspiel abzurechnen (vgl. Neumann 1997, S. 106).
Near-Video-on-Demand bezeichnet die Bereitstellung von ein und demselben Programm auf mehreren Kanälen mit zeitversetzten Startterminen, damit der Konsument auch zu einem späteren Zeitpunkt seinen Wunschfilm ansehen kann (vgl. Woldt 2002, S. 535).
Pay-TV und Near-Video-on-Demand bieten allerdings nur etwas mehr Freiheit in der Unfreiheit (vgl. Schneider 2007, S. 22).
Echte Souveränität bietet nur Video-on-Demand. Dies setzt voraus, dass audiovisuelle Medieninhalte zu jeder Zeit individuell abrufbar sind. Am besten lässt sich das über einen ständig aktiven Rückkanal realisieren, wie ihn das Internet bietet (vgl. Kaumanns/Siegenheim 2006, S. 622). In einer Umfrage hat sich gezeigt, dass das Interesse, eine Sendung zu einem individuell gewählten Zeitpunkt ansehen zu können, zwar groß, aber die Motivation, dafür extra zu bezahlen, eher gering ist (vgl. Kaumanns/Siegenheim 2006, S. 624ff.).
Mein Interviewpartner Andreas Grotholt von Millward Brown bestätigte ebenfalls, dass das Pay-TV-Geschäft im Allgemeinen eher schleppend verläuft (vgl. Anhang, S. 179).
Das liegt meines Erachtens an der, wie Prof. Dr. Ing. Hedtke so treffend feststellte, einmaligen Situation, dass es in Deutschland ein großes Angebot an frei empfangbaren Programmen gibt (vgl. Anhang, S. 145). Dadurch herrscht eine gewisse Kostenlosmentalität, die dem Bezahlfernsehen hohe Wachstumsraten verwehrt (vgl. Kaumanns/Siegenheim 2006, S. 627).
2.1.5 Interaktivität
Mit der Multimedia Home Platform (MHP) sollte die Interaktivität in die Wohnzimmer der Zuschauer einkehren. Mit diesem auf der Programmiersprache Java basierenden Standard (vgl. Zervos 2003, S. 145) sollte es den TV-Sendern ermöglicht werden, ganz nach dem Internetprinzip weiterführende Informationen zum laufenden Programm anzubieten. Mittels eines Rückkanals über die Telefonleitung wären z.B. die Teilnahme an Gewinnspielen oder Home Shopping realisierbar (vgl. Schönenborn 2004, S. 517-518). Allerdings konnte sich MHP bislang nicht am Markt durchsetzen, da nur wenige Sender wie ARD und ZDF umfangreiche Inhalte für MHP-fähige Receiver anbieten und sich aus diesem Grund viele Gerätehersteller die Mehrkosten mangels Anwendungsmöglichkeiten einfach sparen. Während die öffentlich-rechtlichen Sender noch an MHP glauben, ist es bei den Privaten in diesem Bezug recht still geworden (vgl. Digital Fernsehen 2007, S. 1).
Für echte Interaktivität eignet sich insbesondere das Internet. Das werde ich im Kapitel 3 – Vertriebswege und Empfangbarkeit eingehender beleuchten.
2.2 Aktueller Stand der Digitalisierung
Wie wir festgestellt haben, bietet das Digitalfernsehen viele Vorteile, die das Fernsehen bequemer, die Auswahl größer und die Nutzung flexibler machen. Trotzdem verläuft die Umstellung in den Haushalten viel langsamer als erhofft.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4 - Entwicklung des Digitalisierungsgrades in Deutschland
(eigene Darstellung, Quelle der Daten: AGF 2008, S. 16)
Im Jahre 2003 setzte sich die Europäische Kommission das Ziel, 2005 die Abschaltung der analogen Frequenzen, Analogue Switch-Off, herbeizuführen. 2005 korrigierte die Kommission ihr Ziel auf 2012. Auf der Radio Conference im Jahr 2006 in Genf einigte man sich darauf, analoge Signale nur noch bis 2015 zu tolerieren. Während in Finnland, Luxemburg, Schweden und in den Niederlanden der Switch-Off bereits erfolgt ist (vgl. Woldt 2007, S. 635), zeigt sich Europas größter TV-Markt[17] Deutschland besonders zögerlich. Im Bezug auf die Digitalisierung liegt Deutschland weit unter dem westeuropäischen Durchschnitt (vgl. Schmied 2007, S. 61).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5 - Empfangsebenen in Deutschland (Quelle: ASTRA 2008a, S. 7)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6 - Empfang auf den drei meistgenutzten Geräten (Quelle: GSDZ 2007, S. 55)
Betrachtet man die Reichweiten der Empfangswege in Abb. 5 auf S. 16, stellt man fest, dass das Kabelfernsehen noch der bedeutendste Übertragungsweg ist. Zieht man die Digitalisierungsrate der jeweiligen Empfangswege in Abb. 6 auf S. 16 hinzu, fällt auf, dass gerade der wichtigste Distributionsweg in Deutschland kaum digital genutzt wird.
Da stellt sich natürlich die Frage, weshalb das so ist.
2.3 Hürden der Digitalisierung
„Der Deutsche ist grundsätzlich ein skeptischer Mensch, der Neuheiten zwar offen gegenübersteht, aber für den Eigengebrauch dann doch etwas länger braucht.“
Uwe Lerch, Senior Vice President der iMusic Media GmbH
(im Anhang, S. 169)
Die bislang schwache Digitalisierungsquote in Deutschland hat vielfältige Gründe, die teilweise ineinander spielen. Welche Rolle die verschiedenen Interessensgruppen dabei einnehmen, werde ich jetzt näher erläutern.
„Eine Zwangsdigitalisierung ist mit uns nicht zu machen.“
Michael Bobrowski, Referent für Telekommunikation
beim Bundesvorstand der Verbraucherzentrale
(Digital Fernsehen 2008a, S. 13)
Ausgangspunkt der digitalen Zurückhaltung sind die öffentlich-rechtlichen Sender. Obwohl sie selbst ein großes Interesse am Digitalfernsehen hegen – schon allein aufgrund des positiven Kosteneffekts – sind sie von Gesetzes wegen gezwungen, die Digitalisierung zu bremsen. Gemäß § 51 III Nr. 4 b) 10. RÄndStV sind sie zur Grundversorgung der Bevölkerung verpflichtet. Zu diesem Zweck laufen die Programme im Simulcast[18] bis eine vertretbare Digitalisierungsquote erreicht ist, um die analogen Frequenzen abzuschalten.
„Fernsehen gehört zur Grundversorgung!.“
Dr. Engel, Chef der ZDF-Medienforschung
(im Anhang, S. 109)
Zwar wäre ein analoger Switch-Off denkbar, aber dann müsste aufgrund dieses Gesetzes auch sichergestellt sein, dass die einkommensschwachen Haushalte dadurch nicht benachteiligt werden. Dr. Engel gab mir dazu ein Beispiel und erzählte von der Digitalisierung des terrestrischen Fernsehens in Berlin-Brandenburg. Als dort der analoge Switch-Off für die Terrestrik im Jahr 2003 vollzogen wurde, mussten von der eigens dafür eingerichteten Rundfunkhilfe e.V. insgesamt 6.000 DVB-T Set-Top-Boxen für diejenigen Haushalte gestellt werden, bei denen die Sozialhilfeträger die Kosten nicht übernehmen wollten. Die Industrie erklärte sich zu einem Sonderpreis von 200 Euro pro Stück bereit (vgl. Anhang S. 109 und vgl. mabb 2003, S. 8). Auf bundesweiter Ebene wäre das kaum finanzierbar – geschweige denn die Kabel- und Satellitenhaushalte.
Dieser Umstand macht den Simulcast notwendig. Es liegt also in erster Linie am Willen und den Möglichkeiten der Konsumenten, den digitalen Umstieg durchzuführen. Für die gibt es allerdings wenig Anreize dafür. Prof. Dr. Ing. Hedtke erklärte mir, dass es in Deutschland ein geradezu einmaliges Free-TV-Angebot gibt und dass der Unterhaltungs- und Informationsbedarf mit dem analogen Angebot weitgehend abgedeckt ist (vgl. Anhang, S. 145). Darüber hinaus wäre ein Umstieg mit Kosten und Mühen verbunden, da sich der Nutzer für jeden Fernseher einen eigenen Receiver anschaffen müsste, der zudem auch neu eingestellt und dessen Bedienung erst erlernt werden müsste (vgl. Lauff 2007b, S. 32).
Wenn man noch die Grundverschlüsselung der digitalen Programme im Kabelfernsehen dazu nimmt, sinkt die Motivation noch weiter. Die Kabelnetzbetreiber setzen auf eine Verschlüsselung ihres digitalen Angebots, das erst durch eine Smartcard freigeschaltet werden kann. Dadurch möchten sie zum einen mehr Kontrolle über die angeschlossene Endgerätezahl und die bislang anonymen Konsumenten, um mehr Einnahmen aus der Grundgebühr zu generieren (vgl. Hege 2007, S. 14). Im Vergleich dazu kann man an einem analogen Anschluss so viele TVs verwenden wie man will.
Zum anderen erhoffen sie sich, dass die Konsumenten eher Pay-TV-Angebote nutzen, sobald ein Endgerät mit eingebautem Verschlüsselungssystem bei ihnen zu Hause steht (vgl. Lauff 2007b, S. 30). Auch wenn die digitalen Anschlüsse mittlerweile von einigen Kabelnetzbetreibern[19] etwas günstiger angeboten werden, wird der Konsument in der Summe seiner Geräte mit einem deutlich höheren Kostenfaktor konfrontiert.
Die Wohnungswirtschaft hegt wenig Interesse an einer Digitalisierung, da sie eine Entwertung ihrer Kabelanschlüsse befürchtet (vgl. Hege 2007, S. 14). Im Falle eines analogen Hausanschlusses werden erhebliche Mengenrabatte je nach Anzahl der angeschlossenen Wohnungen vergeben, damit die Vermieter den Kabelanschluss günstig über die Umlage abrechnen können.
Selbst die konsequente Vergabe von Digitalanschlüssen bei Neuanmeldungen stagniert, da der Kabelnetzmarkt weitgehend gesättigt ist (vgl. Lauff 2007b, S. 31).
Wer aber ohnehin an Pay-TV interessiert ist, nimmt diese Hürde gerne in Kauf (vgl. Lauff 2007b, S. 32). Deshalb und wegen der zusätzlich erhobenen Digitalgebühren entspricht die herrschende Meinung einer Gleichsetzung vom Digital-TV mit Pay-TV.
Eine weitere Partei, die von der schleppenden Digitalisierung profitiert, sind die etablierten Analogsender. Da über einen Digitalanschluss wesentlich mehr Programme übertragen werden, steigt selbstverständlich der Wettbewerb. Warum also sich selbst mehr Konkurrenz machen, wenn man mit Aufrechterhaltung des Analogsignals ein gut abgestecktes Oligopol aufrechterhalten kann (vgl. Lauff 2007b, S. 30).
Zuletzt fehlt es den Leuten an Erfahrungen mit Digital-TV. Herr Grotholt gab zu verstehen, dass zu wenig Aufklärung über die Vorteile und Qualitäten des Digitalfernsehens betrieben wird (vgl. Anhang, S. 178). Für die meisten ist es einfach nur ein anderer Weg fernzusehen und wenn die Konsumenten vom Digital-TV lediglich „the same“ oder „more of the same“ erwarten, dann ist eine Zurückhaltung nicht verwunderlich (vgl. Lauff 2007a, S. 5).
2.4 Ausblick für das Digitalfernsehen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 7 - Prognose zur Digitalisierung im Primärempfang in Deutschland bis 2010
(Quelle: Goldhammer/Schmid/Stockbrügger, S. 26)
Es gibt zwar noch einige Hürden zu nehmen, aber die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran. Mit einem kompletten analogen Switch-Off ist für 2010 nicht zu rechnen. Dr. Engel gab mir zu verstehen, dass die Initiative Digitaler Rundfunk dieses Datum als eine Art Industrie-Commitment propagiert hat, um für das Digitalfernsehen die Werbetrommel zu rühren (vgl. Anhang, S. 107). Zumindest wird die Digitalisierung des terrestrischen Fernsehens bis 2010 abgeschlossen sein, da waren sich meine Interviewpartner alle einig.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 8 - Absatz HDTV Geräte in Deutschland (Quelle: Goldhammer/Schmid/
Stockbrügger, S. 7)
Betrachtet man Prognosen wie die von Goldmedia, Abb. 7, dann dürfte die Digitalisierungsquote in wenigen Jahren kaum noch ein Thema sein. Vergleicht man aber die Entwicklung von 2006 – 2007 mit den Ergebnissen der AGF in Abb. 4 auf S. 15 mit lediglich 8,91 Mio digitalen Haushalten in 2007 dann kann man die recht euphorische Kurve von Goldmedia etwas nach unten korrigieren.
Trotzdem befindet sich das Digitalfernsehen auf dem richtigen Weg. Laut Dr. Engel dürfte vor allem das Satellitenfernsehen als Vorreiter fungieren, da es einen leichten Umstieg erlaubt. Es ist lediglich ein Receiveraustausch nötig, die bestehende Satellitenanlage kann komplett samt Verkabelung weiterverwendet werden (vgl. Anhang, S. 108). Der Knackpunkt bleibt aber das Kabelfernsehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 2 - Was Zuschauer am Fernsehen nicht mögen (Quelle: Sonnabend 2008, S. 13)
Hier dürfte vor allem der technische Fortschritt greifen. Überdimensionale und hochauflösende Flachbildschirme erfreuen sich steigender Beliebtheit, siehe Abb. 8 auf S. 20. Diese haben aber Schwierigkeiten, analoge Signale sauber darzustellen. Die Schwachpunkte der Sendequalität werden insbesondere bei großen Bildschirmdiagonalen augenfällig. Beim digitalen Fernsehen entfällt die zusätzliche Wandlung des Signals und die Rauscharmut sorgt für ein homogeneres Bild.
Diese werden auch die Nachfrage nach hochauflösenden Inhalten fördern, welche die Möglichkeiten der aktuellen TVs besser ausnutzen. Prof. Dr. Ing. Hedtke sieht in diesem Mehrnutzen auch ein Potenzial für etwaige Pay-TV-Angebote, da er dem Konsumenten tatsächlich auch Geld Wert ist (vgl. Anhang, S. 154).
Ebenso dürfte der Wunsch nach mehr Zeitsouveränität die digitale Verbreitung weiter antreiben. Denn alle Punkte, siehe Tab. 2, welche die meisten Leute am Fernsehen stören, wie z.B. unüberwindbare Werbeunterbrechungen, fehlende Vor- und Rückspulfunktion, Zeitsouveränität durch immer verfügbare Inhalte oder die Interaktion mit dem Programm sind durch die Digitalisierung lösbar.
2.5 Ist der Markteintritt im Digital-TV derzeit sinnvoll?
Bei der strategischen Planung ist der Zeitpunkt des Markteintritts von großer Wichtigkeit. Da das Fernsehen vornehmlich ein werbefinanziertes Medium ist, hängt es von der Reichweite ab, ob ein Sender kurzfristig rentabel arbeiten kann.
Für Funkmedien gilt die Faustregel, dass ein Sender erst ab einer technischen Reichweite von mindestens zehn Millionen Haushalten als Werbeträger interessant wird (vgl. Breunig 1997, S. 77). Bei 34,99 Millionen Empfangshaushalten in Deutschland insgesamt läge demnach die Untergrenze der Digitalisierungsquote bei 28,57% (vgl. Bornemann 2004, S. 48). Auf Abb. 4 auf S. 15 wird deutlich, dass erst mit Beginn 2008 diese Marke überschritten wurde. Natürlich setzt das voraus, dass man alle digitalen Empfangswege bundesweit bedient, was nicht ganz im Kosten-/Nutzenverhältnis liegt. Auf die Kostenfaktoren eines TV-Senders komme ich später noch zu sprechen.
Aber es gibt noch einen weiteren Faktor, der meines Erachtens unbedingt in Betracht gezogen werden sollte. Aufgrund der steigenden Programmzahl in den digitalen Netzen überwiegen attraktive Programmplätze langfristig den Kosten-/Nutzenfaktor. Wer sich rechtzeitig einen Platz in den vorderen Programmrängen sichert, für den steigen die Chancen, auch langfristig im Wahrnehmungsraum der Zuschauer zu bleiben, erheblich. Dieser vermarktungstechnische Vorteil muss evtl. durch eine Durststrecke in der Anfangsphase teuer erkauft werden. Bei einem späteren Markteintritt kann dies hingegen kaum nachgeholt werden.
Die digitale Dividende wird in der Terrestrik in naher Zukunft eher ernüchternd ausfallen. Zwar wären statt der sieben bis acht analogen Kanäle bis zu 32 digitale Programme möglich (vgl. Woldt 2007, S. 634), aber die aktuell noch von analogen Sendern belegten Frequenzen sind bereits für DVB-H, digitales Radio (DAB) und andere digitale Dienste verplant (vgl. Libertus 2008, S. 233).
Auch in den digitalen Kabelnetzen sind bereits erste Kapazitätsgrenzen erreicht, weshalb man in Betracht gezogen hat, den „freiwilligen“ Rückzug von analogen Kleinanbietern zu forcieren. Ebenso fordern die Landesmedienanstalten von der ARD, die analoge Verbreitung von landesfremden Dritten Programmen in den jeweiligen Bundesländern einzustellen (vgl. Lauff 2007b, S. 29-30).
Die ARD nimmt dieses Abschmelzszenario ernst und wird laut neuesten Berichten dem auch Folge leisten, damit wieder neue Kapazitäten frei werden. (vgl. Digital Fernsehen 2008b, S. 11)
Wie in Abb. 9 auf S. 23 zu sehen ist, werden in Deutschland bereits 239 private Digitalprogramme ausgestrahlt. Bereits jetzt dürfte es schwer sein, sich weiter nach vorne zu argumentieren. Da aber die Rentabilität in greifbare Nähe gerückt ist – die magische 10-Millionen-Haushaltsgrenze ist ja überschritten – wäre jetzt der letztmögliche Zeitpunkt, bevor eine wahre Flut von Kleinstsendern über die Kabelnetze hereinbricht, wie es bereits auf den Satelliten geschehen ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 9 - Bundesweite private Fernsehprogramme in deutscher Sprache
(Quelle: KEK 2008, S. 70)
3 Vertriebswege und Empfangbarkeit
Wie ich im vorigen Kapitel festgestellt habe, ist die Distribution des Programms ein wesentlicher Schlüssel für den Erfolg eines TV-Senders. Die Reichweite bestimmt den Umsatz durch Werbung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 10 - Empfangsebenen pro Region in Deutschland (Quelle: ASTRA 2008a, S. 8)
Die einzelnen digitalen Übertragungswege und ihre Betreiber werde ich jetzt näher vorstellen.
3.1 DVB-T
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 11 - DVB-T Empfangsbereich deutschlandweit, Stand 26.08.2008
(Quelle: NDR 2008, S. 1)
Die analoge Terrestrik ist weitgehend abgeschafft. Wie man in Abb. 11 erkennen kann, gibt es nur noch wenige weiße Flecken wie bei Freiburg auf der Karte. Allerdings beschränkt sich das Programmangebot der privaten TV-Sender lediglich auf Ballungsgebiete. Aufgrund der Monopolstellung des einzigen bundesweiten DVB-T Anbieters Media&Broadcast[20] ist es den meisten werbefinanzierten TV-Sendern einfach zu teuer. Trotz der Digitalisierung gilt die terrestrische Übertragung als die Kostspieligste.
Im Jahr 2002 wurde die flächendeckende Ausstrahlung eines analogen Programms auf 90 Millionen Euro beziffert. Da pro analogem Kanal drei bis vier digitale Programme übertragen werden können, wäre dieser Betrag zu teilen. Aufgrund der geringen Nutzerzahl, siehe Abb. 10 auf S. 24, ist das in finanzieller Hinsicht kaum tragbar. Im besten Falle entspräche das ungefähr acht Euro pro angeschlossener Wohneinheit – im Vergleich dazu belaufen sich die Kosten je Wohneinheit per analogem Satellit auf 49 Cent bzw. per analogem Kabel auf 14 Cent (vgl. Sürtenich 2002, S. 3-4).
In Ballungsräumen sieht die Situation anders aus. Dort befinden sich viele Haushalte in der Reichweite der Sendemasten. Aber auch hier mussten die Privaten mit Fördermitteln gelockt werden. Schließlich gewinnt DVB-T erst mit den privaten Sendern an Attraktivität. Z. B. wurde für den DVB-T Start in Nordrhein-Westfalen eine staatliche Beihilfe ausgehandelt. Die Sender VIVA, Eurosport, CNN und Terra Nova[21] teilen sich ein Programmbouquet. Sie werden seit dem 08.11.2004 über eines der sechs Multiplexe ausgestrahlt, für das jährlich 675.000 Euro pro Programmplatz veranschlagt werden. Der fünfjährige Zuschuss übernimmt im ersten Jahr 40% und wird jedes weitere Jahr um 5% gesenkt. Insgesamt beläuft sich die staatliche Beihilfe auf 1.012.500 Euro je Programmplatz, was knapp 30% der anfallenden Übertragungskosten abdeckt (vgl. EU 2008, S. 14f.) Die vier Sender erhalten insgesamt 4.050.000 Euro an Förderung (vgl. EU 2008, S. 9).
Die Sächsische Landesmedienanstalt (SLM) schlug als Alternative sogenannte Lowpower-Sendernetze vor, die im Gegensatz zu den von T-Systems installierten High-Power-Antennen wesentlich kostengünstiger sind. Die Lowpower-Variante hat eine geringere Reichweite, die aber durch eine geschickte Verteilung von Sendeantennen im Empfangsgebiet ausgeglichen werden kann (vgl. Dehn 2008, S. 1).
In Leipzig hat die Mugler AG am 17.03.2008 den Sendebetrieb eines solchen Netzes aufgenommen. Dieses Stadtnetz versorgt 200.000 Haushalte mit vier Programmen zu einem wesentlich günstigeren Preis für die Programmbetreiber. Die Nutzung der gesamten Sendeanlage beläuft sich auf 220.000 Euro, die durch die Programmanbieter entsprechend ihrer Datenrate geteilt werden. Die Übertragung über Media&Broadcast würde das Vierfache kosten. Neben RTL gibt es bereits weitere Lokalsender, die Interesse für das Lowpower-Sendekonzept in anderen Städten bekunden (vgl. Dehn 2008, S. 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Eine Einführung des terrestrischen HDTV mittels DVB-T2 ist in den nächsten Jahren noch nicht zu erwarten. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben hierfür noch keine konkreten Pläne (vgl. Digital Fernsehen 2008f, S. 8). DVB-T2 setzt mit MPEG-4 auf einen anderen Codec, der durch seine höhere Kompression der Daten bei gleichbleibender Bildqualität eine terrestrische Verbreitung erst möglich macht. Hierzu wären auf Konsumentenseite neue Empfangsgeräte notwendig. Dr. Engel sieht allerdings langfristig schon den Umstieg auf DVB-T2, da die höhere Kompression mehr Programmplätze und eine günstigere Kostenverteilung mit sich bringt (vgl. Anhang, S. 115).
3.2 DVB-C
Das Kabelfernsehen ist der meistverbreitete Empfangsweg in Deutschland. Mit Telefonie und Internet erweitern die Kabelnetz-betreiber ihr Angebot in Richtung Triple-Play[22] und nagen an den Geschäftsmodellen der Telekom-munikationsunternehmen. Doch sind diese Bestrebungen nur ein Aufguss zum eigentlich Kerngeschäft.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 12 - Einzugsgebiete der drei großen Kabelnetzbetreiber
(Quelle: Wolter/Schurig 2008, S. 1)
Die bundesweite Verbreitung eines digitalen Programmbouquets mit 38 Mbit/s wird auf 4,35 Millionen Euro pro Jahr geschätzt. Herunter-gebrochen auf ein digitales Programm in SDTV-Qualität wären ca. 500.000 Euro fällig (vgl. Bornemann, S. 46). Allerdings haben wir in Kapitel 2.2 schon festgestellt, dass die Digitalisierungsquote im Kabel noch zu Wünschen übrig lässt.
Ein weiteres Problem ist die starke Fragmentierung des deutschen Kabelmarktes. Man spricht im allgemeinen von vier Netzebenen (vgl. Digital Fernsehen 2008g, S. 1). Der Endkunde kommt vor allem mit der Netzebene drei, der Straßenverteilung, und der Netzebene vier, der Hausverteilung[23], in Berührung. Die drei größten Anbieter Kabel Deutschland (KDG), Unitymedia und Kabel Baden-Württemberg (Kabel BW) vereinen die letzten beiden Netzebenen miteinander, während kleinere Lokalanbieter der Netzebene Vier entsprechen und Programme von den großen Distributoren angeliefert bekommen. Der Finanzinvestor Orion Cable vereint die beiden Netzebene-4-Anbieter PrimaCom und Telecolumbus zum viertgrößten Anbieter in Deutschland (siehe Tab. 3). Die restlichen Haushalte verteilen sich auf über 3000 Lokalanbieter, die in den Verbänden ANGA und FRK organisiert sind (siehe Abb. 13 auf S. 28). Dr. Engel bestätigte mir, dass die starke Fragmentierung der Netzebene Vier ein großes Hindernis für die Digitalisierung darstellt (vgl. Anhang, S. 106).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 3 - Reichweiten der großen Kabelnetzbetreiber in Millionen Haushalten
(eigene Darstellung anhand von Unternehmensangaben)
Ein wesentlich größeres Hemmnis für die fortschreitende Digitalisierung im Kabel ist die Grundverschlüsselung. Wie wir bereits festgestellt haben, hegen die großen Kabelnetzbetreiber selbst ein starkes Interesse daran, ihre anonymen Abonnenten adressierbar zu machen. Zum anderen wollen die privaten Senderverbünde von RTL und ProSiebenSat.1 nicht auf ihre großen analogen Marktanteile verzichten.
Gerade den kleineren Kabelnetzbetreibern ist dies ein Dorn im Auge, haben sie doch erkannt, wie sehr die Grundverschlüsselung dem Voranschreiten der Digitalisierung im Wege steht. Außerdem wollen sie sich von den Digitalangeboten der drei großen Netzebene-3-Anbieter befreien, um vor allem selbst an den Abogebühren zu verdienen. In diesem Zuge gibt es Bestrebungen, den digitalen Anschluss mit alternativen Pay- und Free-TV-Angeboten attraktiver zu machen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 13 - Verteilung der Haushalte auf die Netzebenen Drei und Vier
(Stand: Frühjahr 2008, Quelle: KDL 2008, S. 8)
So liefert Eutelsat mit dem Kabelkiosk eine unabhängige Pay-TV-Plattform für die lokalen Kabelnetzbetreiber. Sie selbst können entscheiden, welche Programmteile sie verschlüsselt oder unverschlüsselt an den Konsumenten weitergeben möchten (vgl. KabelKiosk 2008, S. 1).
Außerdem hat im Juli die KabelDienstLeistungs GmbH (KDL) eine Kooperation mit dem Satellitenbetreiber ASTRA geschlossen, um ein
Free-TV-Paket aufzubauen, das aus über 20 digitalen Programmen besteht. Das sind in der Regel reine Digital-TV Sender, deren Marktanteile unter der Grundverschlüsselung leiden. Ihr TOPP-Angebot (Transponder Optimierte Programm Pakete) sieht vor, dass die Endkunden nicht an ein Abonnement mit Smartcard gebunden werden. Die Programme der einbezogenen Sender werden unverschlüsselt ausgestrahlt. Der Kunde kann sich also jede kabelfähige Set-Top-Box im Geschäft kaufen und zum Empfang einsetzen. Die großen Senderfamilien werden ohnehin unverschlüsselt auf analogem Wege verbreitet, so dass die KDL mit ihnen nicht in Verhandlung treten muss. Ein Ausbau auf bis zu 52 Programme ist in Planung (vgl. KDL 2008, S. 10-11 und Gajowski 2008, S. 1).
Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die alternativen Angebote durchsetzen. Gerade die Free-TV Variante der KDL klingt mit einem Potenzial von 2,5 Millionen Haushalten sehr verlockend (siehe Abb. 13 auf S. 28). Gelingt ihnen dieser Coup, würde das eine Revolution im Kabelmarkt zur Folge haben.
3.3 DVB-S
Das Satellitenfernsehen ist laut Dr. Engel der Treiber der Digitalisierung (vgl. Anhang, S. 103). Wie wir in Kapitel 2.4 festmachen konnten, wird einem der Umstieg auf keinem anderen Übertragungsweg so einfach gemacht wie hier.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 14 - Analoger und digitaler ASTRA-Empfang im deutschsprachigen Markt
(Quelle: ASTRA 2008a, S. 4)
Die ASTRA-Position 19,2° Ost ist das für den deutschsprachigen Raum bedeutendste Satellitensystem. Der Satellitenbetreiber deckt 98,5% der Nutzung in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab (siehe Abb. 14).
Die Satellitenübertragung kostet via analogem Transponder sechs Millionen Euro im Jahr und für einen digitalen Transponder kassiert ASTRA ca.
750.000 Euro im Jahr (vgl. ARD 2002, S. 6). Auf einem digitalen Satellitentransponder lassen sich sechs bis sieben TV-Programme übertragen (vgl. Schächter 1998, S. 167). Somit ist ein digitales Programm in SDTV-Qualität bei 4 MBit/s bereits für 125.000 Euro realisierbar.
Aufgrund der weit fortgeschrittenen Digitalisierungsquote von über 60% (siehe Abb. 14) und der positiven Prognose, siehe Abb. 7 auf S. 20, ist DVB-S geradezu als Einstiegsplattform prädestiniert. Die im Vergleich zu DVB-T und DVB-C schier unbegrenzten Kapazitäten bieten genügend Raum für die unterschiedlichsten Angebote. 11,7 Millionen digitale Haushalte mit einem Schlag erreichen zu können, klingt zumindest sehr verlockend (vgl. ASTRA 2008a, S. 6). Aber mit der reinen Übertragung allein ist es nicht getan, denn es tummeln sich knapp 350 digitale TV-Sender und knapp 100 digitale Radio-Sender auf den Frequenzen dieses Satelliten. Nimmt man noch die beliebte Doppelfeed-Kombination[24] ASTRA 19,2° Ost und Hotbird 13° Ost, ist das Chaos mit insgesamt ca. 2.750 Programmen komplett.
Zwar erscheint die Übertragung über Satellit dank der europaweiten Reichweite und der günstigen Kosten am vorteilhaftesten, aber es ist zwingend notwendig, die Existenz eines neuen Senders zu kommunizieren, damit die Leute diesen zwischen all den anderen Satellitenprogrammen auch finden. Darüber hinaus werden die Sendeplätze in den Endgeräten der Konsumenten meist nicht automatisch aktualisiert. Die potentiellen Zuschauer müssen also dazu motiviert werden, einen neuen Suchlauf zu starten und dem propagierten TV-Sender einen attraktiven Platz auf der Fernbedienung zu gönnen.
3.4 Internetfernsehen
„Ich persönlich brauche den Fernseher schon lange nicht mehr.“
Andreas Grotholt, Global Business Leader von Millward Brown,
(im Anhang, S. 191)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 15 - Entwicklung der Internetnutzung (Quelle: Schneller 2008, S. 3)
Seit 1970 können über 90% aller Haushalte das Fernsehprogramm am heimischen TV empfangen (vgl. Schneller 2008, S. 4). Knapp 40 Jahre später schickt sich ein neues Medium an, den klassischen Broadcast als Fenster in die Welt abzulösen.
Das Internet erfreut sich seit Jahren steigender Beliebtheit (siehe
Abb. 15 auf S. 30), und wächst mit dem technischen Fortschritt vom reinen Informations- zum ultimativen Unterhaltungsmedium. Bereits 72% der Bevölkerung nutzen das Internet – Tendenz steigend.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Darstellung von Videos stellt für heutige Computer keine große Herausforderung mehr dar. Aber erst mit der Verbreitung von schnellen Breitbandanschlüssen ist die Übertragung von Videoinhalten erst richtig interessant geworden (siehe Abb. 16).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 16 - Entwicklung von schnellen Breitbandanschlüssen
(Quelle: Köcher/Schneller 2007, S. 31)
Internetfernsehen unterscheidet man in zwei Darreichungs-formen, nämlich Web-TV und IPTV. Bei beiden Formen erfolgt die Übertragung mittels dem Internet Protocol über Datennetze an die Internetanschlüsse der Haushalte. Der Vorteil liegt in der direkten Addressierbarkeit des Nutzers, da er über einen individuellen Rückkanal verfügt (vgl. Breunig 2007b, S. 478).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 17 - Häufigkeit der Nutzung von Internetfernsehen
(Quelle: Köcher/Schneller 2007, S. 32)
Die Nutzung von TV-Signalen über die klassischen Verteilwege am PC mittels DVB-T, DVB-C oder DVB-S Empfängern wie USB-Sticks oder TV-Karten werden nicht zum Internetfernsehen gezählt (vgl. van Eimeren/Frees 2008a, S. 351).
Derzeit hält sich die Nutzung von Internetfernsehen noch in Grenzen, siehe Abb. 17 auf S. 31, was sich aber mit der steigenden Qualität der Angebote in Zukunft sicher noch ändern wird.
3.4.1 Web-TV
Als Web-TV bezeichnet man den Livestream[25] oder den Download von Videomaterial aus dem World Wide Web auf einen Computer. Sie sind für die Nutzung am Computer optimiert und bieten noch nicht die Qualität, um auf großen Bilddiagonalen optimal dargestellt zu werden (vgl. van Eimeren/Frees 2008a, S. 350f.).
Im Gegensatz zum linearen Broadcast über die klassischen Übertragungswege kann dem Nutzer dank des Rückkanals echtes Video-on-Demand geboten werden. Der Internetuser ist diese Nutzungsform seit jeher gewohnt, weshalb vor allem Videostreamingportale wie YouTube.com im Internet zu finden sind.
Es wird dadurch eine Zeitsouveränität erreicht, die Ihresgleichen sucht. Die ARD bietet in ihrer Mediathek Sendungen an, die bereits im regulären Fernsehbetrieb gelaufen sind (vgl. sat+kabel 2008a, S. 16f.). Es lässt sich dadurch eine Art kollektives Bild- und Videogedächtnis aufbauen, in dem TV-Inhalte nachträglich angesehen werden können (vgl. van Eimeren/Frees 2008a, S. 352). Mein Interviewpartner Andreas Grotholt zeigte sich von der zeitsouveränen Nutzungsmöglichkeit durch das Internet besonders begeistert und sieht darin die Zukunft des Fernsehens (vgl. Anhang, S. 191).
Mit dem Ausbau der Datenleitungen und der Steigerung der Übertragungsraten werden die Livestream-Sender, die in ihrer Ausstrahlungsform eher dem Broadcast gleichen, weiter zunehmen.
Problematisch hingegen ist laut Bernd Wohlleben die Lizensierung von Fremdinhalten. Denn das Internet ist ein weltoffenes Portal, dessen Nutzung sich kaum auf bestimmte Gruppen einschränken lässt (vgl. Anhang, S. 214).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 18 - Rezeption und Partizipation bei Videoportalen (Quelle: Köcher/Schneller 2007, S. 24)
Auf Videoportalen wird vor allem konsumiert (siehe Abb. 18). Der aktive Kreis derer, die eigene Videos einstellen, ist im Vergleich zu den Nutzern sehr klein. Die Motivation der Konsumenten das Programm inhaltlich mitzugestalten ist also eher gering. Neben den bekannten Videoportalen wie YouTube.com haben sich auch TV-Sender mit eigenen Angeboten wie MyVideo.de von ProSieben oder Clipfish.de von RTL niedergelassen, um hier starke Marken für die Zukunft aufzubauen. Schließlich konkurriert man im Internet mit der ganzen Welt, und gefunden wird nur, was auch aktiv gesucht wird.
3.4.2 IPTV
IPTV wurde von den Telekommunikationsunternehmen als Alternative zum regulären Broadcast entwickelt und ist eine abgewandelte Form des Web-TV. Es basiert auf demselben Übertragungsprinzip mit dem Unterschied, dass eine Set-Top-Box benötigt wird, die unabhängig vom PC direkt an die Internetleitung angeschlossen wird. Dazu werden besonders schnelle Internetanbindungen benötigt wie ADSL2+ mit 16-25 MBit/s oder VDSL mit bis zu 52 Mbit/s, die noch nicht flächendeckend verfügbar sind (vgl. Deloitte 2008, S. 8).
Aufgrund dieser technischen Voraussetzungen gehören vor allem Technik-Freaks mit fundierten Computerkenntnissen zu den Hauptnutzern von IPTV (vgl. Köcher/Schneller 2007, S. 34)
Im Gegensatz zum regulären Broadcast werden nur diejenigen Inhalte übertragen, die vom Konsumenten über den Rückkanal angefordert werden. Dies ermöglicht ebenfalls echtes Video-on-Demand und Interaktivität (vgl. Deloitte 2007, S. 9).
Neben einer eingebauten Festplatte bieten solche Set-Top-Boxen auch an PVR-Funktionen. Eine ausgelagerte Variante ist der Netz-PVR, bei dem die gewünschten Sendungen auf einem Server beim Provider aufzuzeichnen, um sie dann von dort jederzeit abrufen zu können (vgl. Heiles 2007, S. 31). Des Weiteren sind am Fernseher auch Ausflüge ins Internet mittels der Set-Top-Boxen möglich, um bspw. E-Mails oder Onlinespiele zu nutzen (vgl. Breunig 2007b, S. 479). Beim IPTV verschmelzen Internet und TV zu einer Einheit.
IPTV ist Provider-Fernsehen. D.h., die Inhalte werden direkt von dem Netzbetreiber geliefert (vgl. Breunig 2007b, S. 478f.). In diesen geschlossenen Netzen stellen Lizenzrechte kein Problem mehr dar, weshalb viele TV-Sender ihr Live-Programm lediglich über diesen Weg durch die Datenleitung schicken. Daher liegt der Fokus auf linearem TV und Video-on-Demand (vgl. Deloitte 2007, S. 22).
Somit tritt IPTV in direkte Konkurrenz zu den traditionellen Empfangswegen über Sat, Kabel und Terrestrik und liefert eine vergleichbare Bild- und Tonqualität (vgl. Heiles 2007, S. 30). So sieht es auch die Rechtsprechung, die IPTV zum Rundfunk zählt (vgl. Breunig 2007b, S. 478), obwohl dies rein technisch gesehen eigentlich nicht der Fall ist.
Derzeit gibt es drei IPTV-Anbieter. T-Home mit seinen Entertainpaketen vom Branchenriesen Deutsche Telekom, Arcors Digital-TV und das Alice Home TV der HanseNet. Alle sind Telekommunikationsunternehmen und bieten ihre TV-Angebote als Zusatzpaket zu ihren Telefon- und Internetdienstleistungen an. Trotz des bislang eher bescheidenen Erfolgs führt T-Home mit insgesamt 180.000 Abonnenten das Dreiergespann an. Alice HomeTV konnte bisher 20.000 Abonnenten verzeichnen, während Arcor Digital-TV im unteren vierstelligen Bereich vor sich hin vegetiert (Stand März 2008, vgl. KEK 2008, S. 314-316).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 19 - Prognose zur Entwicklung der IPTV-Haushalte in Deutschland
(Quelle: Goldmedia 2006, S. 1)
Goldmedia rechnet mit einer erheblichen Steigerung der Nutzerzahlen, siehe Abb. 19 auf S. 34. Aufgrund umfangreicher Triple-Play- und zukünftiger Quadruple-Play[26] Pakete klingt das auch schlüssig (vgl. Deloitte 2007, S. 7). Im Vergleich zu den Triple-Play-Erfolgen der Kabelnetzbetreiber müssen sie sich momentan aber noch geschlagen geben[27].
Dies mag unter anderem an der Tatsache liegen, dass viele Haushalte bereits über einen im Mietvertrag fest verankerten Kabelanschluss verfügen und deshalb nicht auf IPTV wechseln, da sie sonst den Fernsehanschluss doppelt bezahlen (vgl. Lauff 2007a, S. 5).
Abgesehen davon kostet es der Telekom viel Mühe die Verbreitung ihres IPTV-Angebotes voranzutreiben, denn jeder aktive Zuschauer bedeutet einen Einzelabruf von Videoinhalten, auch wenn das gleiche Programm geschaut wird. Dies bedeutet eine enorme Belastung für die Datennetze, die derzeit an ihre Grenzen stoßen und für jeden zusätzlichen Haushalt ausgebaut werden müssen.
Der Empfang ist allerdings über jedes internetprotokollfähige Endgerät denkbar, so dass IPTV nicht allein über das Festnetz angeboten werden muss, sondern seine Reichweite auch um das Kabelnetz, Mobilfunknetze (HSPA, MBMS, WLAN und WiMax an Hotspots) und rückkanalfähige Rundfunknetze (DXB) erweitern könnte. Eventuell könnte dies der Weg aus der aktuellen Misere sein.
3.5 Handy-TV
„2015 wird mobiles Fernsehen genauso wichtig wie stationäres TV sein.“
TV-Veranstalter (zitiert nach Deloitte 2008, S. 18)
Neben dem Internetfernsehen positioniert sich derzeit ein weiterer Vertreter der modernen Übertragungswege, der Mobilfunk. Dort unterscheidet man im Wesentlichen zwischen „TV on the mobile“, also dem Betrachten von regulären TV-Sendungen per Broadcast, und „TV for the mobile“, den speziell auf die Bedürfnisse mobiler Anwendung zugeschnittenen Videoinhalten (vgl. Trefzger 2005, S. 11-13).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 20 - Übertragungsarten von Inhalten auf Mobiltelefone
(Quelle: Deloitte 2008, S. 10)
Auf Abb. 20 sind die unterschiedlichen Übertragungsformen zu sehen, mit denen TV-Inhalte an Handys gesendet werden können. Der Unicast bezeichnet die individuelle Ausstrahlung an einzelne Nutzer und entspricht dem Video-on-Demand Prinzip. Beim Multicast werden fortlaufende Inhalte nur an diejenigen Konsumenten gesendet, die eine Schaltung explizit per Rückkanal anfragen – was in etwa IPTV gleich kommt. Den Broadcast an die breite Masse, die einfach nur auf den ständig ausgestrahlten Kanal schalten muss, kennen wir von den traditionellen Übertragungsformen.
Aufgrund der begrenzten Übertragungskapazitäten in den Mobilfunknetzen muss ein bandbreitenverschlingendes Medium, wie Fernsehen, geplant eingesetzt werden.
Derzeit gibt es vier verschiedene Standards. Das Universal Mobile Telecommunications System, kurz UMTS, ist vergleichbar mit DSL im Festnetz. Entsprechend der Vorgehensweise von IPTV werden Videoinhalte über die drahtlose Datenleitung abgerufen. Dies können sowohl Videodownloads wie auch Livestreams sein. Erfolgen zu viele Abrufe gleichzeitig, stößt das Netz allerdings schnell an seine Kapazitätsgrenzen (vgl. Mobiles Fernsehen 2007, S. 11). Als Massenmedium ist es demnach nur bedingt geeignet. Dafür spricht hingegen die weite Verbreitung von UMTS-fähigen Handys.
Tab. 4 - Eigenschaften der Mobil-TV Standards (Quelle: Deloitte, S. 13)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im Mai 2006 kam das erste kommerzielle DMB-fähige Mobiltelefon des Plattformbetreibers MFD (Mobiles Fernsehen Deutschland) in die Geschäfte. Der Digital Multimedia Broadcasting Standard (DMB) basiert auf dem digitalen Radio (DAB) und wurde 2007 noch in zwölf Städten mit insgesamt vier Programmen ausgestrahlt (vgl. Mobiles Fernsehen 2007, S. 11).
Wie Dr. Engel mir im Interview berichtete, hat sich DMB nicht durchgesetzt. Lediglich 12.000 Geräte wurde verkauft (vgl. Anhang, S. 113). Prof. Dr. Ing. Hedtke sieht dieses Projekt eher als Testlauf, um die Möglichkeiten des Handyfernsehens auszuloten, als DVB-H noch nicht verfügbar war (vgl. Anhang, S. 155). Zwar ist aufgrund der DAB-Herkunft das DMB-Signal leicht bundesweit zu verbreiten, aber dafür ist der Empfang in geschlossenen Räumen schwierig (vgl. Breunig 2006, S. 552).
Mittlerweile wurde der von der MFD ausgestrahlte Dienst „Watcha“ aufgrund des mangelnden Erfolges und dem Engagement für DMB eingestellt.
Die EU hat das auf DVB-T basierende DVB-H zum neuen Mobilfunk-TV- Standard erkoren (vgl. ALM 2008, S. 19). DVB-H greift dabei auf das Sendernetz von DVB-T zurück. Im Vergleich zu DVB-T liefert es für die kleinen Handydisplays angepasste Bilder, die entsprechend wenig Bandbreite nutzen. Dies hat auch Einfluss auf den Stromverbrauch, da weniger Daten von dem Mobiltelefon verarbeitet werden müssen. Außerdem ist eine Verschlüsselung vorgesehen, um Pay-TV zu ermöglichen. Mit UMTS als Rückkanal sollen interaktive Dienste realisiert werden (vgl. Deloitte 2008, S. 5).
Ein erster Testlauf wurde im Februar 2005 in Berlin für zwölf Monate unternommen. Neben 16 Fernsehprogrammen wurden auch interaktive Fernsehdienste, Nachrichtenticker und 18 Radiosender übertragen (vgl. Mobiles Fernsehen 2007, S. 11).
DVB-H ist im Juni 2008 in vier Großstädten gestartet, allerdings erneut nur im Testbetrieb ohne Serviceangebote, ohne am Markt erhältlich empfangsfähige Mobiltelefone und natürlich fast ohne Zuschauer (vgl. Stiftung Warentest 2008, S. 42).
Während man also weiterhin auf DVB-H warten muss – der Starttermin wurde erneut verschoben und verpasst nach der in Deutschland abgehaltenen Fußballweltmeisterschaft nun auch die Europameisterschaft in Österreich/ Schweiz (vgl. Digital Fernsehen 2008d, S. 10) – greifen einige Gerätehersteller zu einer Übergangslösung und integrieren DVB-T
Empfänger in die Handys (vgl. Digital Tested, 2008 S. 10). Marc Hankmann, Chefredakteur der Digital Fernsehen, sieht darin die Antwort der Mobilfunkbetreiber auf die Vergabe der DVB-H Sendelizenz an den unabhängigen Plattformbetreiber Mobile 3.0, hätten doch die Mobilfunkkonzerne am liebsten die Lizenz für sich selbst erstanden (vgl. Hankmann 2008, S. 3). Trotzdem zeigen sich T-Mobile, Vodafone und O2 für weitere Verhandlungen mit Mobile 3.0 offen (vgl. Digital Fernsehen 2007, S. 11). Schließlich lassen sich über DVB-T keine zusätzlichen Erlöse generieren.
Die Studie „Mobiles Entertainment“ des Wirtschaftsunternehmen Deloitte hat die Vorteile von DVB-H gegenüber den anderen Standards bestätigt. So ist im Gegensatz zu UMTS ein Broadcast an eine maximale Nutzerzahl möglich, während die Bilder von DVB-T nicht für die kleinen Displays der Handys optimiert sind und die dort ausgestrahlten Programme sich an der Nutzungssituation der Konsumenten zu Hause orientieren. Die Möglichkeiten der Verschlüsselung und eines Rückkanals komplettieren die Liste (vgl. Deloitte 2008, S. 5,14).
So schön das alles klingt, DVB-H muss sich definitiv beeilen, denn mit DXB (Digital eXtended Multimedia Broadcasting) steht bereits ein weiterer Konkurrent in der Pipeline, der sich mittels mehrerer Standards auf hybride Endgeräte konzentriert (vgl. Mobiles Fernsehen 2007, S. 11).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 21 - Entwicklung von UMTS (Quelle: Deloitte 2008, S. 11)
Außerdem holt UMTS dank verbesserter Kompressionstechniken und erhöhter Übertragungsraten auf, siehe Abb. 21. In wenigen Jahren können die Mobilfunkbetreiber aufgrund ihrer eigenen UMTS-Lizenzen völlig autark über Programmangebot und Erlösmodelle bestimmen (vgl. Deloitte 2008, S. 12).
Prof. Dr. Ing. Hedtke und Andreas Grotholt sehen aufgrund der völlig anderen Nutzungssituation unterwegs vor allem Bedarf an Spartenkanälen mit kurzen Beiträgen (vgl. Anhang, S. 156,182).
3.6 Welcher Übertragungsweg wird sich durchsetzen?
„Fernsehen ist kein technologiegetriebenes Medium. Ich glaube nicht, dass sich ein Konsument aktiv technologiegetrieben etwas anderes anschafft.“
Dr. Engel, ZDF Medienforschung (im Anhang, S. 104)
Für den Markteinstieg ist die Wahl des Verteilweges auf langfristige Sicht von großer Bedeutung. Legt man sich zu früh auf einen der modernen Übertragungswege fest, gehen beim Scheitern des gewählten Distributionswegs wertvolle Investitionen verloren. Lässt man sich zu viel Zeit, blockieren die Mitbewerber attraktive Programmplätze oder gar ganze Übertragungsformen. Einen großen Schub wird es bei einem analogen Switch-Off geben, der den Markt stark beeinflussen wird.
Auf meine Frage hin, auf welchen Übertragungsweg die bisherigen Analog-Seher bei einem analogen Switch-Off wohl ausweichen werden, erhielt ich eine ganze Reihe interessanter Antworten.
„Linear TV is not dead – indeed it will be a very long time before this happens“
Ross Sonnabend, Accenture (Sonnabend 2008, S. 18)
Andreas Grotholt erklärte mir, dass die meisten Konsumenten in ihrem Haushalt bei dem Anschluss bleiben, der bereits vorhanden ist, und einfach in die digitale Variante wechseln. Denn irgendwann ist eine Entscheidung zwischen Kabel und Satellit gefällt worden – sei es bspw. wegen der technischen Voraussetzungen oder der Vorgaben der Vermieter. Da ist es am bequemsten, einfach nur den digitalen Schalter umzulegen (vgl. Anhang, S. 181).
Aus finanzieller Sicht ist DVB-T für den Seher am attraktivsten, denn die Programmauswahl deckt sich weitgehend mit dem des analogen Kabels. Wenn für die digitalen Kabelprogramme zusätzliche Gebühren erhoben werden, erwartet Dr. Engel in den einkommensschwachen Schichten eine Abwanderung zu DVB-T (vgl. Anhang, S. 111). Diejenigen, die ohnehin terrestrisch empfangen haben, werden zu DVB-T übergehen.
Wie wir bereits festgestellt haben, wird das mobile Fernsehen wegen der völlig anderen Anwendungssituation das reguläre Fernsehen eher ergänzen als ersetzen. Der zwölfmonatige Testlauf mit DMB hat gezeigt, dass die Nutzer vor allem bekannte Fernsehinhalte erwarten, die sie dann zeitunabhängig nutzen können (vgl. Mobiles Fernsehen 2007, S. 13). Hierbei sind Nachrichten besonders gefragt, gefolgt von Verkehrsmeldungen, Musikclips und Livesport. Beiträge zu Freizeit, Veranstaltungen, Gesundheit, Wissenschaft, Wirtschaft und Sozialem runden den Informationsbedarf ab (vgl. Mobiles Fernsehen 2007, S. 13). Man hat festgestellt, dass mobiles Fernsehen gerne auf Reisen und bei längeren Wartezeiten genutzt wird (vgl. Mobiles Fernsehen 2007, S. 15). Gerade Musikfernsehen war sehr beliebt, da ein Einstieg inhaltlich jederzeit möglich ist und es sich als Radioersatz mit Video als Zusatznutzen bewährt hat (vgl. Hanekop/Schrader 2007, S. 12ff.).
Das Handy ist zwar ein gelerntes Bezahlmedium, aber es wird trotzdem schwer werden, die Leute über die Rundfunkgebühr hinaus dafür zur Kasse zu bitten (vgl. Breunig 2006, S. 560). Dies spiegelt sich auch in den Verkaufszahlen der DVB-T-fähigen Handys wieder. Für DVB-H sind hingegen Paketpreise, wie sie bereits für die mobile Internetnutzung üblich sind, am sinnvollsten.
Das Interesse an mobilem Fernsehen per Handy ist aber derzeit ohnehin noch gering, da die Konsumenten kaum Erfahrungen damit haben (vgl. Mobiles Fernsehen 2007, S. 17). Es bleibt abzuwarten, mit welchen Geschäftsmodellen die Telekommunikationsfirmen am mobilen TV-Markt an den Start gehen und ob sie damit tatsächlich auch Erfolg haben werden.
Laut Bernd Malzani werden Telekommunikationsfirmen und Satelliten- und Kabelplattformbetreiber mittels ihrer Verschlüsselungssysteme und EPGs ihre Position als Gatekeeper verstärken (vgl. Malzani 2007, S. 2). Im Kampf um die Gunst des Kunden werden sie versuchen, möglichst viele exklusive Inhalte, in diesem Falle TV-Sender, in ihrem Portfolio zu halten.
Aber in einer Sache waren sich alle meine Interviewpartner einig. Das Internet wird sich zu einem ernsthaften Konkurrenten entwickeln. Mit seinem Suchcharakter wird das Internet laut Prof. Dr. Ing. Hedtke vor allem von Spartenkanälen bevölkert werden (vgl. Anhang, S. 152), aber mit den steigenden Übertragungsraten wird der Weg auch für Vollprogramme geebnet. Wohl dem, der entsprechende Maßnahmen getroffen hat, auch dort umfassend präsent zu sein.
4 Erlösmöglichkeiten
Nachdem wir in den vergangenen Kapiteln festgestellt haben, dass Fernsehen ein kostspieliges Medium ist, widme ich diese Kapitel den möglichen Erlösquellen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 22 - Struktur der Gesamterträge im privaten Fernsehen nach Erlösquellen
(Quelle: ALM 2008, S. 91)
4.1 Entgelte und Gebühren
TV-Sender haben zweierlei Möglichkeiten, direkt vom Konsumenten für ihr ausgestrahltes Programm bezahlt zu werden.
Im Gegensatz zu den Privaten verfügen die öffentlich-rechtlichen Sender über eine äußerst zuverlässige Einnahmequelle, die Rundfunkgebühren. Per Gesetz sind für den Betrieb eines Fernseh- oder Radiogerätes automatisch Gebühren fällig, sofern es zum Empfang von Programmen ausgerüstet ist. Der Einzug der Gebühren erfolgt durch die Gebühreneinzugszentrale (GEZ) und betrifft im Prinzip jeden TV-Haushalt. Somit ist das jährliche Gebührenaufkommen stabil und gut verplanbar. Privatsender dürfen mit diesem Geld nicht unterstützt werden (vgl. §43 10. RÄndStV).
Private TV-Sender können hingegen Entgelte für ihr Programm verlangen. Wie Pay-TV funktioniert und welche Pay-Modelle es gibt, habe ich bereits in Kapitel 2.1.4 ab S. 13 erläutert. Auch wenn diese Lösung im Bezug auf die Planbarkeit hin attraktiv erscheint, hat sie in Deutschland nur mäßigen Erfolg. Größter Pay-TV-Betreiber ist Premiere mit insgesamt 4.242.467 Abonnenten[28] (davon 621.908 über Arena), über dessen Infrastruktur einige andere Anbieter weitere Pay-TV-Lösungen anbieten. Gerade die Infrastruktur – Haushalte mit den passenden Receivern – ist die größte Hürde, um eine neue Pay-Plattform aufzustellen. Der Versuch vom Satellitenbetreiber ASTRA, ein alternatives Pay-TV-System zu etablieren, ist bislang gescheitert. Mittlerweile steht die Pay-Plattform Entavio kurz vor dem Aus (vgl. sat+kabel 2008b, S. 13). Dort hatte man versucht, Millionen von bereits digitalen Zuschauern davon zu überzeugen, von digital unverschlüsseltem Free-TV zum kostenpflichtigen grundverschlüsselten Digitalfernsehen zu wechseln. Dies ist nicht zuletzt am notwendigen Wechsel der bereits bei den Zuschauern vorhandenen Receiver gescheitert (vgl. Lauff 2007b, S. 32).
[...]
[1] Am 22.03.1935 startete die Reichs-Rundfunkanstalt zum 40. Jahrestag des Films den ersten öffentlichen Fernseh-Programmdienst der Welt (vgl. gfu 2006, S. 4).
[2] Bayerischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk, Nordwestdeutscher Rundfunk, Süd-deutscher Rundfunk, Radio Bremen und Südwestfunk
[3] RTLplus folgte einen Tag darauf.
[4] Der Pay-TV Sender DF1 verschmolz 1999 mit dem ehemaligen Hauptkonkurrenten unter der Führung der Kirch Gruppe zu Premiere World (vgl. Premiere 2008, S. 1).
[5] Über die analoge Terrestrik konnten lediglich vier bis sechs Programme empfangen werden. Im Kabel lag die Grenze mit ca. 30 analogen Programmen etwas höher.
[6] 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche
[7] Binäre Zahlen bestehen lediglich aus „Nullen“ und „Einsen“, in der Informatik auch Bits genannt. Sie sind die Basis für Computer, da man die Symbole 0 und 1 in elektrische Signale für den Zustand „an“ oder „aus“ umsetzen kann.
[8] Bei einem MPEG-Codec handelt es sich um einen Daten komprimierenden Standard zur Datenumwandlung (Codec = Kodieren und Dekodieren) der Motion Picture Expert Group (MPEG), die als Arbeitsgruppe von der Internationalen Standardisierungs-Organisation (ISO) und der International Electronical Commission (IEC) gegründet wurde. (vgl. MPEG 2008, S. 1)
[9] Im Kino sind das 24 Bilder/Sekunde, die europäische TV-Norm PAL (Phase Alternating Line) verwendet 25 Bilder/Sekunde, während im amerikanischen TV-Standard NTSC (National Television Systems Commitee) 30 Bilder/Sekunde ablaufen.
[10] Dolby Digital ist ein Raumklangsystem, das mittels im Raum verteilter Lautsprecher die auf dem Bildschirm dargestellte Situation akustisch nachbildet. Somit können Geräusche, die aus einer bestimmten Richtung kommen, vom Zuschauer so geortet werden, als wäre er Teil der Szenerie. Der am meisten verbreitete Standard ist DD-5.1 und setzt fünf Lautsprecher für die Richtungsortung (links, mittig, rechts, hinten links, hinten rechts) und einem Subwoofer für den Tieftonkanal ein (vgl. ITwissen 2008, Suchwort „Dolby Digital“).
[11] HDTV (High Definition Television) liefert in seiner hochwertigsten Form, Full-HD, eine Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten. Im Vergleich zum sogenannten SD-Fernsehen (Standard Definition) entspricht das einer Vervierfachung und liefert mehr Details, eine höhere Bildtiefe und tiefere Plastizität (vgl. ITwissen 2008, Suchwort: „HDTV“)
[12] Das Relevant Set beschreibt die persönlich bevorzugte Auswahl von Programmen
[13] Unter dem englischen Begriff Broadcast versteht man die Ausstrahlung eines Programms von einem Sender an viele Nutzer gleichzeitig.
[14] Die EU-Kommission hat die Linearität, also die Ausstrahlung eines festgelegten Programmablaufs, bei dem der Zuschauer nicht eingreifen kann, als Merkmal für den Rundfunk festgelegt (vgl. Schneider 2007, S. 21).
[15] Smartcards sind Chipkarten im Kreditkartenformat, auf denen Daten auf einem eingelassenen Schaltkreis gespeichert werden – daher heißen sie auch Integrated Circuit Cards (ICC). Die Komplexität dieser Schaltkreise kann vom reinen Speicher als ROM (Read Only Memory) oder RAM (Random Access Memory) bis hin zu einem eigenen Prozessor reichen (vgl. ITwissen 2008, Suchwort: “Smartcard“. Im EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), der für eine Neuprogrammierung eines Stromstoßes bedarf, sind die Entschlüsselungsalgorithmen hinterlegt.
[16] Conditional Access bedeutet bedingter Zugang und ist ein Smartcard-System, mit dem übertragene Datensignale nur einer bestimmten Kundengruppe zugänglich gemacht werden (vgl. Inside-Digital 2008, Suchwort: „CA“).
[17] Deutschland war Ende 2007 mit 36,98 Mio. TV-Haushalten der mit Abstand größte Fernsehmarkt in Europa, gefolgt von England mit 25,05 Mio., Frankreich mit 24,21 Mio. und Italien mit 22,98 Mio. (vgl. ASTRA 2008b, S11).
[18] Simulcast ist die gleichzeitige Ausstrahlung eines Senders auf digitalem und analogem Wege.
[19] Kabel BW bietet den digitalen Basisanschluss für 12,90 Euro an, der analoge Basisanschluss kostet 14,90 Euro (vgl. Kabel BW 2008a, S. 1). Unitymedia verlangt für den analogen Basisanschluss 17,90 Euro, während für den digitalen Anschluss inkl. Digitalreceiver 16,90 Euro fällig werden (vgl. Unitymedia 2008, S. 1)
[20] Media&Broadcast wurde im Januar 2008 von T-Systems für 850 Millionen an den französischen Senderbetreiber TDF (Télédiffusion de France) verkauft (vgl. Forbes 2008,
S. 1).
[21] Der Sendebetrieb von Terranova wurde am 10.07.2007 eingestellt.
[22] Als Triple-Play werden Komplettangebote für Telefon, Internet und Fernsehen bezeichnet.
[23] Die Netzebene eins bilden die Programmanbieter. Netzebene zwei bezeichnen die Kopfstationen, welche die Programme der TV-Sender empfangen und für die Weiterversendung verarbeiten (vgl. Digital Fernsehen 2008g, S. 1).
[24] Der Doppelfeed-Empfang bezeichnet den Empfang von zwei Satellitenpositionen über eine Satellitenschüssel.
[25] Im Gegensatz zum Download, bei dem Videos in voller Länger heruntergeladen und auf dem Computer vor dem Abspielen gespeichert werden, werden beim Livestream die Videodaten kontinuierlich an den Computer geliefert, um ohne große Verzögerung direkt auf dem Bildschirm angezeigt zu werden.
[26] Quadruple-Play erweitert das Triple-Play um den Mobilfunk. Zwar kann HanseNet in Ermangelung eines eigenen Mobilfunknetzes kein Quadruple-Play anbieten, aber der Mobilfunknetzbetreiber O2 hat bereits Interesse an Alice HomeTV bekundet (vgl. Digital Fernsehen 2008c, S. 11).
[27] Triple-Play Nutzer der Kabelnetzbetreiber:
Kabel BW = 240.000 (vgl. Kabel BW 2008b, S. 8)
Unitymedia = 220.000 (vgl. Unitymedia 2008, S. 4)
KDG = 453.000 (vgl. KDG 2008, S. 3)
[28] Stand Q1 2007
- Arbeit zitieren
- Gerhard Fischer (Autor:in), 2008, Digital TV - Die Markteintrittschance für neue Sender?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131436
Kostenlos Autor werden



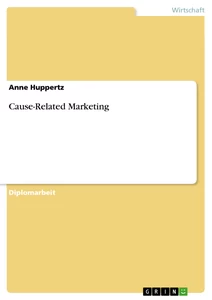

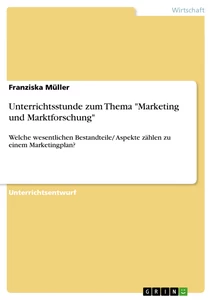


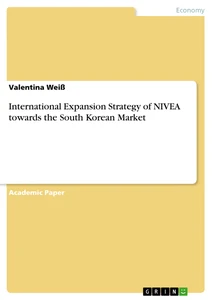













Kommentare