Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung
1.1 Problemaufriss
1.2 Fragestellung, Thesen, Vorgehensweise, Zielsetzung
2 Das Empowerment-Konzept
2.1 Theoretische Verortung
2.1.1 Erste Annäherung
2.1.2 Empowerment im Sinne von Selbstbemächtigung
2.1.3 Empowerment als professionelles Unterstützungskonzept
2.1.4 Empowerment: Grundüberzeugungen/Menschenbild
2.2 Ebenen und Elemente von Empowerment-Prozessen
2.2.1 Subjektzentrierte Ebene
2.2.2 Gruppenbezogene Ebene
2.2.3 Institutionelle Ebene
2.2.4 Politische/Gesellschaftliche Ebene
2.3 Empowerment und Bildung
2.3.1 Zur Bedeutung des Bildungsbegriffs
2.3.2 Bildung von Menschen mit Behinderung
2.3.3 Empowerment-Konzept und Bildungstheorie
2.3.4 Perspektiven für die Erwachsenenbildung
2.4 Kritische Anmerkungen
2.4.1 Konzeptionelle und begri iche Unschärfen
2.4.2 Überforderung des Subjekts
2.4.3 Fehleinschätzung von Fähigkeiten und Bedürfnissen
2.4.4 Praktische Umsetzung unpräzisiert
2.4.5 Unzureichende Re exion gesellschaftlicher Bedingungen
2.4.6 Gesellschaftliche und politische Instrumentalisierung
2.5 Zusammenfassung: Einschätzung und Bewertung
3 Die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)
3.1 Historische Entwicklungslinien
3.1.1 Das System der Behindertenhilfe in Deutschland
3.1.2 Zur Entwicklung der WfbM
3.2 Zur Bedeutung der WfbM
3.3 WfbM und Bildung
3.3.1 Überblick
3.3.2 Beru iche Bildung und Weiterentwicklung der Persönlichkeit ...
3.3.3 Organisation von Bildung in WfbM
3.4 Die WfbM als Ort von Empowerment
3.4.1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
3.4.2 Wunsch- und Wahlrecht
3.4.3 Persönliches Budget
3.4.4 Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO)/Werkstattrat ...
3.5 Zusammenfassung
4 Das Projekt WerkstattZeitung
4.1 Grundlagen
4.1.1 Lebensweltbezug
4.1.2 Projektorientierung
4.2 Konzeption
4.2.1 Beteiligte Institutionen
4.2.2 Situationsbeschreibung
4.2.3 Zielgruppe
4.2.4 Ziele
4.3 Die WerkstattZeitung: Empowerment-Prozesse
4.3.1 Subjektzentrierte Ebene
4.3.2 Gruppenbezogene Ebene
4.3.3 Institutionelle Ebene und politische/gesellschaftliche Ebene
4.4 Fazit
4.4.1 Zur praktischen Umsetzung
4.4.2 Perspektiven
5 Schlussbetrachtungen
6 Literaturverzeichnis
7 Anhang WerkstattZeitung Nr
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anmerkungen
Bei Beschreibungen und Aussagen, die für beide Geschlechter Gültigkeit haben, wird überwiegend das generische Maskulinum verwendet, das männliche und weibliche Personen einschließt.
Um einen gleichmäßigen Lese uss zu unterstützen, werden die Bezeichnungen Menschen mit geistiger Behinderung und geistig behinderte Menschen verwendet. Dies erfolgt jedoch in dem Wissen, dass es keine eindeutige Definition von geistiger Behinderung gibt, vielmehr handelt es sich bei diesen Bezeichnungen um eine Zuschreibung bzw. Stigmatisierung von Personen, die in mehr oder weniger starkem Maße als intellektuell, kognitiv oder lernbeeinträchtigt wahrgenommen und eingeschätzt werden.1
Mit der Einführung des SGB IX am 1. Juni 2001 wurde die Bezeichnung Werkstatt für Behinderte (WfB) abgelöst. Zur verbesserten Lesbarkeit wird durchweg die aktuell gebräuchliche Bezeichnung Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) verwendet, auch für Sachverhalte, die sich auf die Zeit vor Einführung des SGB IX beziehen. Die Abkürzung WfbM wird dabei sowohl im Singular als auch im Plural verwendet.
1 Einführung
1.1 Problemaufriss
Ist die Etablierung von beschützenden Werkstätten in der BRD ab den 1960er Jahren zunächst im Zusammenhang mit dem bis dahin unzureichenden Angebot an gemeindenahen Beschäftigungsmöglichkeiten für erwachsene behinderte Menschen zu betrachten (vgl. Kapitel 3.1.2), sieht sich diese „Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben ( 136 Abs. 1 SGB IX) vor dem Hintergrund der Paradigmendiskussion in der Behindertenhilfe (Thimm 2001) inzwischen einer starken Kritik ausgesetzt, sowohl aus fachlicher Perspektive (u. a. Jähnert 1995; Doose 2003 und BAGÜS/BIH 2007) als auch aus der Betroffenen- und Angehörigenperspektive (u. a. Rauchberger 2004; Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e. V. 2006).
Insbesondere ab den 1970er Jahren haben fachliche Umbrüche in Wechselwirkung mit tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Verständnis von Behinderung, mit der Rolle von Menschen mit Behinderungen in helfenden Beziehungen, mit dem Ort der Hilfe, mit dem Verständnis von Hilfe selbst und mit dem Status behinderter Menschen in der Gesellschaft geführt (vgl. auch Schädler 2002, 71ff). Angestoßen von neuen sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen wurde der traditionelle, psychiatrisch-medizinisch orientierte Behinderungsbegriff substanziell hinterfragt und das monokausale, individuumszentrierte und statische Verständnis von Behinderung in Rezeption systemisch-ökologischer Ansätze und interaktionistischer
Theorien zugunsten eines sozialwissenschaftlichen und ökosozialen Verständnisses revi- diert.2 Gesellschaftliche Demokratisierungsprozesse haben zu einem normativen Wandel in der heilpädagogischen Theorie und Praxis geführt, der in Ablehnung vorherrschender fürsorglicher und segregierender Strukturen der Behindertenhilfe in Forderungen nach Normalisierung, Integration und Selbstbestimmung seinen Ausdruck fand. Große Beachtung fand in diesem Zusammenhang auch das Empowerment-Konzept, das im Sinne eines „Anstiftens zur (Wieder-)Aneignung von Selbstbestimmung (Herriger 2006, 1) darauf zielt, „die vorhandenen (wenn auch vielfach verschütteten) Fähigkeiten der Menschen zu kräftigen und Ressourcen freizusetzen, mit deren Hilfe sie die eigenen Lebenswege und Lebensräume selbstbestimmt gestalten können (ebd.).
Unter dem Eindruck dieser Paradigmendiskussion sowie angesichts der zunehmenden Relevanz betriebswirtschaftlicher Denkmuster in heil- und sozialpädagogischen Handlungsfeldern (vgl. Galuske 2007, 152ff) und fundamentaler gesamtgesellschaftlicher Umbrüche (Stichwort Risikogesellschaft, vgl. Beck 1986) steht das System der Behindertenhilfe vor der Herausforderung nach Wegen zu suchen, die normativen Ansprüche, die in Begriffen wie Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Emanzipation, Autonomie und Teilhabe kodifiziert sind, umfassend zu verwirklichen. Die WfbM befindet sich dabei in einem kon iktträchtigen Spannungsfeld: Sie hat den gesetzlichen Auftrag, behinderte Menschen in das Arbeitsleben einzugliedern (vgl. 136 SGB IX) und im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Wettbewerb mit erwerbswirtschaftlichen Unternehmen zu treten (vgl. 12 WVO), mit der Konsequenz, dass Ziele, Strukturen, Normen und Mechanismen erwerbswirtschaftlicher Unternehmen mit pädagogischen, therapeutischen und persönlichkeitsbildenden Schwerpunkten konkurrieren und sich gegen diese vielfach durchsetzen (vgl. Scheibner 2000, 15ff).3 Es ist daher nicht überraschend, dass sich „Werkstattleitungen eher als Manager von Wirtschaftsunternehmen und weniger als Leiter von beru ichen Eingliederungseinrichtungen (Scheibner 2000, 17) begreifen, „der Markt ist im Werkstattalltag und in der Werkstattleitung die bestimmende Triebkraft (ebd.). In diesem Sinne sind auch die Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse der behinderten Menschen in der WfbM einzuschätzen: Es sind marktwirtschaftlich geprägte Arbeitsund Beschäftigungsverhältnisse auf dem Fundament von Fremdbestimmtheit, Unterordnung und Abhängigkeit. Die behinderten Beschäftigten werden dabei einem Leistungsund Anpassungsdruck ausgesetzt, zum einen, um ihnen in rehabilitativer Absicht „zu ermöglichen, ihre Leistungs- und Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen ( 136 Abs. 1 SGB IX) und zum anderen, um ihre Arbeitskraft im Rahmen der wirtschaftlichen Tätigkeit der WfbM zu verwerten.
Von substantieller wirtschaftlicher Bedeutung für die WfbM sind die Großserien-Lohn- auftragsfertigung und -Auftragsfertigung: Trotz der zunehmenden Relevanz von Eigenproduktion einfacher Gebrauchsgüter wie z. B. Spielwaren und Dekoartikel und Dienstleistungen im Niedriglohnbereich wie z. B. Landschafts- und Gartenbau/p ege, Gastronomie und Catering, Reinigungsservice, Hausmeisterservice sind industrielle Lohnauftragsfertigung und Auftragsfertigung die zentralen Produktionsbereiche der WfbM. So ergab eine repräsentative Untersuchung der Deutschen Vereinigung für die Rehabilitation Behinderter e. V. zur Zukunft der WfbM,4 dass durchschnittlich knapp 60% des Umsatzes der WfbM auf die Industrie als Auftraggeber und Abnehmer von Leistungen der WfbM entfallen, alle anderen Abnehmergruppen (u. a. Handwerk, Handel, Öffentliche Hand, Endverbraucher) haben einen durchschnittlichen Umsatzanteil von unter 10 % (vgl. Deutsche Vereinigung für die Rehabilitation Behinderter e.V. 2001, 62f). Über 80% der WfbM stufen die Akquisition von Lohnauftragsfertigung sowohl derzeit als auch in Zukunft als sehr wichtig ein (vgl. ebd., 57). Die zentrale Stellung der Lohnauftragsfertigung und Auftragsfertigung führt dazu, dass die WfbM „mit dem allgemein rasanten technischen Fortschritt mithalten müssen, um ihre überwiegend aus der Industrie stammenden Kunden zufrieden zu stellen. Das heißt, die Werkstätten sind einem ähnlichen Preis- oder Rationalisierungsdruck ausgesetzt, wie Unternehmen aus der freien Wirtschaft (ebd., 54). Die Arbeit der behinderten Beschäftigten im Rahmen von Lohnauftragsfertigung ist dabei weitgehend gekennzeichnet von taylorisierten Arbeitsabläufen einer Großserien- und Massenfertigung u. a. in den Bereichen Montage, Konfektionierung, Verpackung, Metall- und Holzbearbeitung. In dieser Hinsicht erleben die behinderten Beschäftigten den Arbeits- und Lebensort WfbM nur eingeschränkt als Erfahrungsraum für Selbstwirksamkeit und Gestaltungskraft. Vor dem Hintergrund der heilpädagogischen Paradigmendiskussion um Selbstbestimmung Mitbestimmung, Emanzipation, Autonomie und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung stellt sich die Frage, inwieweit die behinderten Beschäftigten in den WfbM angesichts dieser entfremdeten Tätigkeiten Werkstattarbeit und damit die WfbM als sinnstiftend erleben, ihr „Selbsttrauen über subjektives Kompetenzerleben (Kar- dorff/Ohlbrecht 2006, 28) stärken und „Selbstverwirklichung [...] durch Übernahme von Verantwortung, durch Spielräume für Kreativität und Selbstentfaltung (Zwierlein 1997, 20) erfahren können.
1.2 Fragestellung, Thesen, Vorgehensweise,Zielsetzung
Vor dem Hintergrund der heilpädagogischen Paradigmendiskussion werden in dieser Arbeit Fragen nach theoretischen und praxisrelevanten Erträgen des Empowerment-Konzepts für die WfbM untersucht: In welchem Zusammenhang stehen Empowerment-Konzept und Paradigmendiskussion in der Heilpädagogik? Welche Bezüge können im Empowerment- Konzept zum bildungstheoretischen Diskurs ausgemacht werden? Inwieweit können Bildungsangebote im Rahmen einer Empowerment-Praxis Empowermentprozesse initiieren und damit zur Verwirklichung von Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Emanzipation, Autonomie und Teilhabe behinderter Menschen beitragen? Welche Bedeutung hat die WfbM als Teil des institutionalisierten Systems der Behindertenhilfe und welche gesellschaftlichen und historischen Bezüge lassen sich in diesem Zusammenhang ausmachen? Wie stellt sich die WfbM unter dem Blickwinkel der heilpädagogischen Paradigmendiskussion dar, d. h. inwieweit bilden Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Emanzipation, Autonomie und Teilhabe behinderter Menschen Bezugspunkte für Strukturen, Arbeitsweise und institutionelles Handeln der WfbM? Welche Anknüpfungpunkte können für die institutionelle Implementation und Umsetzung des Empowerment-Konzepts in der WfbM bestimmt werden? Ausgangspunkt der Betrachtungen sind folgende Thesen:
1. Im Empowerment-Konzept wird Selbstbestimmung als soziale Kategorie bestimmt und mit einer gesellschaftskritischen Perspektive verknüpft - damit stellt es einen richtungsweisenden Beitrag zur Paradigmendiskussion in der heilpädagogischen Theorie und Praxis dar.
2. Das Empowerment-Konzept hat bisher nur geringe Auswirkungen auf Strukturen, Arbeitsweise und institutionelles Handeln der WfbM.
3. Für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung ist die Institution WfbM ein zentraler Arbeits- und Lebensort, d. h. die überwiegende Mehrheit dieser Personen ist in die WfbM eingebunden.
4. Bildungsangebote für behinderte Menschen mit dem Ziel der Initiierung von Empowerment- Prozessen sind dann nachhaltig wirksam, wenn sie didaktisch und methodisch in einem unmittelbaren Bezug zur Lebenswelt stehen.
5. Projektorientiertes Lernen ermöglicht in einem hohen Maße handlungs- und lebensweltbezogenes Lernen - Projektorientierung ist damit adäquate methodische Grundlage für Bildungsangebote mit dem Ziel der Initiierung von Empowerment- Prozessen.
Im Folgenden wird der Versuch unternommen, diese Thesen zu entfalten und zu begründen:
Das Empowerment-Konzept wird im Kontext einer kritischer Bildungstheorie erörtert, die den emanzipativen Gehalt von Bildung hervorhebt und eine gesellschaftskritische sowie sozialpolitische Perspektive einnimmt. In diesem Zusammenhang wird die Frage nach dem Potential von Bildungsangeboten für die Initiierung von Empowerment-Prozessen im Umfeld der WfbM diskutiert: Die WfbM hat die Aufgabe, Menschen mit Behinderungen „angemessene beru iche Bildung ( 136 Abs. 1 SGB IX; vgl. auch 4 WVO) anzubieten und ihnen zu ermöglichen, „ihre Persönlichkeit weiter zu entwickeln ( 136 Abs. 1 SGB IX; vgl. auch 5 WVO), es wird daher untersucht, in welcher Form Bildungsangebote in der WfbM Kristallisationskeime für Empowerment-Prozesse sein können.
In einem ersten Schritt wird zunächst das Empowerment-Konzept näher bestimmt und Bezüge zum bildungstheoretischen Diskurs beleuchtet, insbesondere zu Klafkis kritischkonstruktiver Erziehungswissenschaft, Bildungstheorie und Didaktik (Kapitel 2), bevor im zweiten Abschnitt der Fokus auf die Praxis gerichtet wird. Hier wird die Entwicklung der WfbM unter dem Blickwinkel der heilpädagogischen Paradigmendiskussion nachgezeichnet, die Bedeutung der WfbM in quantitativer Hinsicht untersucht und in Hinblick auf das Empowerment-Konzept analysiert (Kapitel 3). Im Kontext dieser Arbeit wurde in der Göttinger Werkstätten gGmbH von August 2007 bis März 2008 das Projekt WerkstattZeitung durchgeführt, in dessen Rahmen behinderte Beschäftigte der Göttinger Werkstätten gGmbH redaktionell und journalistisch tätig waren. Dieses Projekt wird beispielhaft für eine Erwachsenenbildung als Element einer heilpädagogischen Empowerment-Praxis vorgestellt und in Hinblick auf seine konzeptionellen, didaktischen und methodischen Grundlagen untersucht, Bezug nehmend auf die vorangegangen Erörterungen zum Empowerment-Konzept werden potentielle Empowerment-Prozesse analysiert (Kapitel 4). Abschließend werden die theoretischen Erörterungen im ersten Abschnitt dieser Arbeit in Beziehung zu den praktischen Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Projekt WerkstattZeitung gesetzt und im Kontext der heilpädagogischen Paradigmendiskussion im Umfeld der WfbM diskutiert (Kapitel 5).
Diese Arbeit versteht sich als ein praxisbezogener Beitrag zur heilpädagogischen Paradigmendiskussion im Umfeld der WfbM: Indem das grundlegende Bildungsverständnis der WfbM, das berufsqualifikations- und arbeitsmarktbezogene Aspekte betont und auf die Ausbildung funktionaler beru icher Qualifikationen zielt (vgl. BA/BAG:WfbM 2002, 10ff), in Anschluss an die Bildungstheorie der kritisch-konstruktiven Erziehungswissenschaft um den emanzipativen Gehalt von Bildung erweitert wird, eröffnen sich in Hinblick auf die Paradigmendiskussion Ansätze zur Weiterentwicklung der WfbM. Im Rahmen einer Empowerment-Praxis können Bildungsangebote als „lebensweltkritische Kategorie (Theunissen/Plaute 1995, 168) den behinderten Beschäftigten Erfahrungsräume für Selbstwirksamkeit und Gestaltungskraft i. S. v. Emanzipation, Selbstbestimmung und Mitbestimmung eröffnen und damit Kristallisationskeime für Empowerment-Prozesse sein, auch in einem weitgehend fremdbestimmten Umfeld wie der WfbM.5
2 Das Empowerment-Konzept
Den Begriff Empowerment umgibt eine gewisse „Aura der Fortschrittlichkeit und Zukunftsoffenheit (Herriger 1997, 11), in aktuellen sozialwissenschaftlichen und -politschen Diskursen ist er allgegenwärtig, lassen sich mit dieser „offenen normativen Form (ebd.) doch unterschiedlichste Grundüberzeugungen, Werthaltungen und moralische Prämissen chiffrieren. Mit dem Empowerment-Begriff werden sozialrevolutionäre Zukunftsträume von einer radikalen Umverteilung der Macht wie auch rückwärtsgewandte Heilserwartungen, die auf die Rückkehr zu den Glücksversprechungen traditioneller Werte (Familie, Gemeinschaft, Religion, Nationalismus usw.) bauen , zuweilen neue Experimente in par- tizipatorischer Demokratie oder ein Bild vom schlanken Sozialstaat, der Lebensrisiken reprivatisiert und sie in die Verantwortlichkeit subsidiärer kleiner Netze zurückverlagert assoziiert (vgl. ebd.).
Inzwischen werden der Empowerment-Begriff und das Empowerment-Konzept auch im wissenschaftlichen Diskurs der deutschsprachigen Heilpädagogik er- und bearbeitet: Ausgehend von der amerikanischen Independent-Living-Bewegung und im Zusammenhang mit der Selbstbestimmungsdebatte ist mit der Diskussion um das Empowerment-Konzept seit den 1990er Jahren „ein Prozess in Gang gesetzt [worden; M. F.], der eine tiefgreifende (substantielle) Veränderung für die herkömmliche Behindertenhilfe bedeutet (Theunis- sen/Plaute 1995, 19). Ausgehend von der These, dass das Empowerment-Konzept einen richtungsweisenden Beitrag zur Paradigmendiskussion in der heilpädagogischen Theorie und Praxis darstellt (vgl. Kapitel 1.2), wird das Empowerment-Konzept in diesem Kapitel näher bestimmt. Dazu werden zunächst die Konturen der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Empowerment-Konzepts nachgezeichnet, bevor die theoretischen und konzeptionellen Grundlagen in den Mittelpunkt der Betrachtungen rücken. Anschließend werden Bezüge zum bildungstheoretischen Diskurs erhellt, insbesondere zu Klafkis kritisch-konstruktiver Erziehungswissenschaft, Bildungstheorie und Didaktik, abschließend folgt eine Darstellung zentraler Beiträge zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Empowerment-Konzept.
2.1 Theoretische Verortung
2.1.1 Erste Annäherung
Empowerment kann mit Selbstbemächtigung , Selbstbefähigung oder Stärkung der Eigenkräfte wörtlich übersetzt werden (vgl. Herriger 2006, 1). Es scheint also nicht abwegig, dass Galuske in seiner Einführung in die Methoden der Sozialen Arbeit mit dem Empowerment-Konzept zunächst eine „neue Runde der Selbsthilfedebatte eingeläutet (Galuske 2007, 265) sieht. Das erweist sich jedoch als zu kurz gegriffen, wenn er auf die historischen Wurzeln im Umfeld der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA, in der Debatte um Kommunitarismus, den Erfahrungen der Selbsthilfebewegung und der neuen sozialen Bewegungen (Ökologie-, Frauen-, Friedensbewegung usw.) sowie den Forschungen zu Bedingungen, Strukturen, Chancen und Grenzen sozialer Netzwerke und sozialer Unterstützungssysteme verweist (vgl. ebd., 260).6
In einem Ordnungsversuch dieses Wurzelge echts stellt Herriger „vier Zugänge zu einer Definition von Empowerment (Herriger 1997, 5) heraus, die vielfältige Schnittstellen und ießende Übergänge aufweisen (vgl. ebd., 12ff):
1. Empowerment ist „ein kon ikthafter Prozess der Umverteilung von Macht, in dessen Verlauf Menschen oder Gruppen von Menschen aus einer Position relativer Machtunterlegenheit austreten und sich ein Mehr an Macht, Verfügungkraft und Entscheidungsvermögen aneignen (ebd., 12; Hervorhebung entfernt), und fokussiert die strukturell ungleiche Verteilung von politischer Macht und Ein ussnahme. In dieser Tradition sieht Herriger die radikal-politischen Bewusstwerdungskampagnen durch Erziehungs- und Alphabetisierungsprogramme (Freire), politische Gemeinwesenarbeit und radical community organization (Alinsky), die Frauenbewegung und feminist-empowerment-praxis (Bookman/Morgen; Brown), lokalpolitische Bürgerinitiativen und öffentlichkeitswirksame Kampagnen für die Beachtung von Interessen ethnischer Minderheiten und die Independent-Living-Bewegung von Menschen mit Behinderung (DeJong/Batavia; Theu- nissen/Plaute).
2. Empowerment zielt auf eine „gelingende Mikropolitik des Alltags und betont „das Vermögen von Menschen, die Unüberschaubarkeiten, Komplikationen und Belastungen ihres Alltags in eigener Kraft zu bewältigen, eine eigenbestimmte Lebensregie zu führen und ein nach eigenen Maßstäben gelingendes Lebensmanagement zu realisieren (ebd., 13; Hervorhebung entfernt). Diese Definition ist vor allem in der Rezeption des Empowerment-Konzepts durch die Soziale Arbeit und Gemeindepsychologie (Herriger; Keupp) bedeutsam.
3. Empowerment ist „die aktive Aneignung von Macht, Kraft, Gestaltungsvermögen durch die von Machtlosigkeit und Ohnmacht Betroffenen selbst (ebd., 14) i. S. v. SelbstBemächtigung und Selbst-Aneignung von Lebenskräften und hebt die Aspekte der Selbstinitiierung und Eigensteuerung „auf der Ebene der Alltagsbeziehungen wie auch auf der Ebene der politischen Teilhabe und Gestaltungskraft (ebd., 14; Hervorhebung entfernt) hervor. Dieser Zugang zu Empowerment findet sich vor allem „im Kontext von Projekten und Initiativen, die auf die produktive Kraft selbstaktiver Felder und sozialer Unterstützungsnetzwerke vertrauen (ebd.) wie z. B. Bürgerechtsbewegungen, Selbsthilfeorganisationen und kommunitaristische Projekte.
4. Empowerment ist ein „programmatisches Kürzel für eine psychosoziale Praxis, deren Handlungsziel es ist, Menschen vielfältige Vorräte von Ressourcen für ein gelingendes Lebensmanagement zur Verfügung zu stellen (ebd., 15; Hervorhebung entfernt). Im Vordergrund dieser Definition steht der Aspekt des Ermöglichens, der Unterstützung und der Förderung von Selbstbestimmung durch andere. Diese Auffassung von Empowerment liegt einer professionellen Sozialen Arbeit und Heilpädagogik zu Grunde, die Methoden wie Ressourcendiagnostik, Unterstützungsmanagement (case management), Biographiearbeit und Netzwerkberatung/Netzwerkförderung anwendet.
Dieses letztgenannte Verständnis von Empowerment steht im Bezug zur professionellen Sozial- und Heilpädagogik: „Der Begriff Empowerment steht heute für alle solchen Arbeitsansätze in der psychosozialen Praxis, welche die Menschen zur Entdeckung der eigenen Stärken ermutigen und ihnen Hilfestellungen bei der Aneignung von Selbstbestimmung und Lebensautonomie vermitteln wollen (Herriger 2006, 1). Aber auch wenn Galuske (2007) das Empowerment-Konzept in sein „Ordnungsschemata (ebd., 162) der Methoden in der Sozialen Arbeit aufgenommen hat, versteht sich Empowerment „ausdrücklich nicht als Methode (ebd., 262) oder professionelles Handwerkszeug, „sondern repräsentiert eher eine professionelle Haltung, die den Fokus auf die Förderung von Potentialen der Selbstorganisation und gemeinschaftlichen Handelns legt (Stark zit. n. Galuske 2007, 262). Empowerment stellt damit „im Idealfall den Hintergrund sozial-professioneller Berufsidentität dar (Galuske 2007, 262). An dieser Stelle wird ein zentrales Spannungsfeld sichtbar: Empowerment versteht sich als eine professionelle Haltung auf der Grundlage eines konkreten und konsensfähigen Menschenbildes (vgl. Kapitel 2.1.4), die Deutung und Konsequenzen dieser Haltung in Hinblick auf die praktische Tätigkeit gleicht jedoch einem „Steinbruch von konzeptionellen Orientierungen, methodischen Angeboten, berufspraktischen Perspektiven (Herriger 1997, 9). Und Galuske ergänzt: „Die Schwierigkeit, einen Empowermentblickwinkel in die professionelle Arbeit zu integrieren, besteht vor allem darin, dass Empowerment-Prozesse angestoßen werden können, der eigentliche Prozess jedoch weitgehend ohne Zutun der beru ichen Helferinnen abläuft. Eine Haltung des Empowerment lässt sich daher nicht mit direkten Interventionen vergleichen (Galuske 2007, 264). Somit stellen die Gedanken des Empowerment-Konzepts auch in heilpädagogischen Kontexten kein fertiges Theoriegebäude dar, „ebensowenig dürfen die Aussagen als endgültige Handlungsstrategien angesehen werden. Es handelt sich vielmehr um grundlegende Überlegungen zur Persönlichkeitsentfaltung, Selbstbestimmung und Rechte-Perspektive geistig behinderter Menschen, um Überlegungen zur pädagogischen Begegnung sowie um Prämissen zur Gestaltung von autonomiefördernden und -sichernden Lebensräumen (Theunissen/Plaute 1995, 8).
Ausgangspunkt dieser „neuen Fachlichkeit der Heilpädagogik (ebd., 24) und der „NeuVermessung des Arbeitskontraktes zwischen Sozialarbeiter und Klient (Herriger 2006, 16) ist eine deutliche Kritik „an den Blind ecken des tradierten Klientenbildes, das das berufsbezogene Alltagswissen in den Köpfen der sozialen Professionals prägt (ebd., 3). Dieser „Defizit-Blickwinkel auf den Menschen (ebd.) ist auch angesichts der Paradigmendiskussion (vgl. Kapitel 1.1) in vielen Praxisfeldern der Heilpädagogik und Sozialen Arbeit handlungsleitendes Deutungs- und Orientierungsmuster (vgl. Rock 2001, 163ff). Herriger bilanziert: „Die Identitätsentwürfe der Klienten Sozialer Arbeit, ihre biographischen Erfahrungshorizonte und Bindungsnetzwerke werden nur allzu oft allein in Kategorien von Mangel und Unfertigkeit, Beschädigung und Schwäche wahrgenommen (Herriger 2006, 3). Die Folge ist eine Fürsorgepädagogik , die „die Betroffenen in beratende und therapeutische Vollversorgungspakete einpackt, sie zugleich aber auf Dauer von Fremdhilfe abhängig macht und verbleibende Ressourcen von Eigenmächtigkeit entwertet (ebd.). Eine „Neue Professionalität in der psychosozialen Praxis (Herriger 2006, 16) geht demzufolge einher mit der „Abkehr vom Defizit-Blick auf Menschen mit Lebensschwierigkeiten (ebd.) und verzichtet zugleich auch „auf pädagogische Zuschreibungen von Hilfebedürftigkeit (ebd.).
In einem heilpädagogischen Blickwinkel ergänzen Theunissen/Plaute: „Bei Menschen mit geistiger Behinderung spielt die Förderung der Selbstbestimmung sowie des Selbsthilfepotentials zweifelsohne eine große Rolle wurde ihr Streben nach Autonomie doch häufig erst gar nicht zugelassen, oder es wurde verkannt, nur unzureichend unterstützt oder gefördert (Theunissen/Plaute 1995, 61f). Sie verweisen auf einen in der Gesellschaft vorliegenden „Minimalkonsens über die anthropologischen Möglichkeiten des Menschseins (ebd., 41), wonach der Mensch als „ein nach Freiheit (Autonomie, Emanzipation, Selbstbestimmung) strebendes soziales Wesen begriffen wird (ebd.), und konkretisieren darauf aufbauend ein Empowerment-Konzept für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen in vier Grundzügen (vgl. Theunissen/Plaute 1995, 21ff):
1. Die Fähigkeit zur Selbstbestimmung gehört wesenhaft zum Menschsein: „Menschliche Entwicklung ist auf Zuwachs an Autonomie angelegt, auch die Entwicklung von Menschen mit geistiger Behinderung (Hahn zit. n. Theunissen/Plaute 1995, 21), was nicht ausschließt, „dass im Einzelfall Menschen zu mehr Autonomie angeregt, ja befähigt werden müssen (ebd.). Durch Aufbereitung der Lebensgeschichte kann an verschüttete Potentiale angeknüpft und schrittweise Entscheidungs- und Handlungsautonomie aufgebaut werden.
2. „Empowerment als Selbst-Bemächtigung kann bei geistig behinderten Menschen nicht vorbehaltlos erwartet werden. Derlei Bedürfnisse entstehen ebenso wie das Interesse, sich in Selbsthilfegruppen zu organisieren, in der Regel nicht von alleine (ebd.). Notwendig sind Aktivitäten, durch die Menschen mit geistiger Behinderung Kompetenzen und Fähigkeiten entwickeln, die sie in die Lage versetzen, Wünsche zu äußern, eigene und kollektive Interessen zu artikulieren und sich in (Interessen-)Gruppen sozial kompetent einzubringen.
3. Angesichts der zum Teil sehr massiven Lernbeeinträchtigungen bei vielen Menschen mit geistiger Behinderung „kann auf eine lebensbegleitende pädagogische Assistenz7 kaum verzichtet werden (ebd., 22). Die damit verbundene Gratwanderung zwischen der Förderung von Selbstbestimmung und die durch eine Assistenz erzeugte bzw. aufrechterhaltene Abhängigkeit und weitere spezifische Probleme wie z. B. kognitive Überforderung müssen dabei von den professionell Tätigen selbstkritisch re ektiert werden.
4. Die Rolle professioneller Helfer von geistig behinderten Menschen unterscheidet sich von jener, die Helfer in der Rehabilitation körperbehinderter oder sinnesgeschädigter Personen einnehmen. Besonders im Bereich der tertiären Sozialisation von Arbeit und Wohnen kann in der Arbeit mit geistig behinderten Menschen auf eine geleitete Unterstützung nicht völlig verzichtet werden, eine Vertrauensperson, die dem behinderten Menschen zur Verfügung steht, wenn dies gewünscht wird oder wenn es sich als sinnvoll bzw. notwendig erweist. „Geistig behinderte Menschen können nicht einfach unter der Parole der Selbstbestimmung in die Normalität entlassen werden und sich damit selbst überlassen bleiben. Empowerment zielt vielmehr darauf ab, assistierende Hilfe in einer Qualität und Quantität zu organisieren, dass sowohl Möglichkeiten der Selbstbestimmung in sozialer Bezogenheit als auch mehr individuelle Autonomie realisiert werden können (ebd., 23).
In einem ersten Fazit können die dargelegten Gedanken zum Empowerment-Konzept mit Keupp folgendermaßen gebündelt werden: „Empowerment meint den Prozess, innerhalb dessen Menschen sich ermutigt fühlen, ihre eigenen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, ihre eigenen Kräfte und Kompetenzen zu entdecken und ernst zu nehmen und den Wert selbsterarbeiteter Lösungen schätzen zu lernen. [... ] Aus der Sicht professioneller und institutioneller Hilfen bedeutet die Empowerment-Perspektive die aktive Förderung solcher solidarischer Formen der Selbstorganisation (Keupp zit. n. Galuske 2007, 262). In einer älteren Traditionslinie steht Empowerment für einen „kollektiven Prozess der Selbst-Aneignung von [politischer; M. F.] Macht und Gestaltungskraft (Herriger 2006, 16) und in einer jüngeren Traditionslinie für ein „professionelles Konzept der Unterstützung von Selbstbestimmung (ebd., 17).
2.1.2 Empowerment im Sinne von Selbstbemächtigung
Diese Traditionslinien lassen sich auch in Hinblick auf Menschen mit Behinderung nachweisen: Selbstbestimmungsprozesse i. S.v. Selbst-Bemächtigung werden erstmals deutlich sichtbar in der Independent-Living-Bewegung (Selbstbestimmt-Leben) in den USA, die auf Initiative behinderter Studierender8 in den 1970er Jahren entstand (vgl. Theunissen 2007, 93ff). Die Idependent-Living-Bewegung hat die Rolle des behinderten Menschen neu bestimmt: „Diejenigen, die die Bedürfnisse behinderter Menschen am besten kennen und wissen, wie diesen Bedürfnissen am besten begegnet werden kann, sind die Behinderten selbst (Miles-Paul zit. n. Rock 2001, 17). Aus diesem Grundsatz entwickelte sich dann auch die Forderung nach größtmöglicher Kontrolle über die Organisationen und Dienstleistungen durch behinderte Menschen selbst sowie Beratung und Unterstützung von Behinderten durch Behinderte (vgl. Rock 2001, 12ff). Einen Schwerpunkt der Aktivitäten der Independent-Linving-Bewegung bildete die „Durchführung weitreichender Protestaktionen gegen diskriminierende Verhältnisse und dem Engagement für entsprechende gesetzliche Veränderungen (Wetzel zit. n. Bartuschat 2002, 17). „In einem selbstinitiierten und eigengesteuerten Prozess der (Wieder-)Herstellung von Selbstbestimmung (Herriger 2006, 2) hinsichtlich der Gestaltung des eigenen Lebens haben die Angehörigen der Independent-Living-Bewegung „sich in eigener Kraft aus einer Position der Ohnmacht (Herriger 2006, 1) befreit und wurden „zu aktiv handelnden Akteuren, die ein Mehr an Selbstbestimmung, Autonomie und Lebensregie erstreiten (ebd.).
Parallel zur Entwicklung der Independent-Living-Bewegung entstanden in den USA und in Kanada eigenständige Interessenvertretungen von Menschen mit geistiger Behinderung, die sich später unter dem Namen People First9 zu einer Bewegung zusammengeschlossen haben und die sich seit einem 1994 durchgeführten Kongress der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V. mit dem Titel Ich weiß doch selbst, was ich will! Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung auch in Deutschland etabliert haben (vgl. Rock 2001, 22ff und Theunissen 2007, 103ff). Während die Independent-Living-Bewegung vornehmlich von Menschen mit Körperbehinderungen und zu einem kleineren Anteil von Menschen mit Sinnesschädigungen getragen wird und professionelle Unterstützung in Form heilpädagogischer Intervention, Therapie oder Anleitung teilweise rigoros ablehnt10 (vgl. Theunissen/Plaute
1995, 23), werden die meisten Self Advocacy- und People First-Gruppen von unterstützenden Personen (Advisors) begleitet (vgl. Rock 2001, 33ff). Rock weist in diesem Zusammenhang jedoch darauf hin, dass sich die Mitglieder von Self Advocacy- und People First-Gruppen „im Auftreten, im Verhalten und hinsichtlich ihrer Fähigkeiten positiv von Menschen mit vergleichbaren Beeinträchtigungen unterscheiden und häufig nicht mehr dem gesellschaftlichen Stereotyp von geistig behindert sein entsprechen (Rock 2001, 29), zudem sind in einigen amerikanischen Selbstvertretungsgruppen für Menschen mit developmental disabilities11 auch Personen involviert, „die ausschließlich über eine Körperbehinderung verfügen, deren Lebensumstände aber denen von Menschen mit einer geistigen Behinderung gleichen (ebd.). Von Bedeutung ist der Umstand, dass die Bezeichnung geistig behindert (engl. mentally handicapped oder mentally retarded ) im anglo-amerikanischen und skandinavischen Raum Personen einschließt, die im deutschen Sprachraum der Gruppe der lernbehinderten Menschen zugeordnet werden. „Eine solche Begriffsausweitung, wie sie auch in Frankreich und Holland üblich ist, führt leicht in die Irre, zumindest aber befördert sie Missverständnisse (Theunissen/Plaute 1995, 20). Es besteht die Gefahr, dass geistig behinderten Menschen, die „als geistig schwer oder schwerstbehindert bezeichnet werden (ebd.) nicht von diesen Entwicklungen profitieren können und „weiterhin oder erneut ausgegrenzt und womöglich als P egefälle etikettiert in Großeinrichtungen oder Wohnheimen untergebracht und versorgt werden (ebd., 21).
2.1.3 Empowerment als professionelles Unterstützungskonzept
Empowerment im Sinne eines professionellen Konzepts der Unterstützung von Selbstbestimmung stellt die zweite, historisch jüngere Traditionslinie von Empowerment dar (vgl. Herriger 1997, 17). Der Empowerment-Gedanke wird als ein Handlungskonzept für die „verberu ichte Soziale Arbeit (ebd.) und Heilpädagogik reklamiert, die die „Prozesse der (Wieder-)Aneignung von Selbstgestaltungskräften anregend, unterstützend und fördernd begleitet und Ressourcen für Empowerment-Prozesse bereitstellt (ebd.). Handlungsziel dieser „sozialberu ichen Empowerment-Praxis (ebd.) ist zum einen die Förderung von Ressourcen der betroffenen Menschen, d.h. jene positiven Potentiale, „die von der Person zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse, zur Realisierung von langfristigen Identitätszielen, zur Bewältigung altersspezifischer Entwicklungsaufgaben oder zur gelingenden Bearbeitung von belastenden Alltagsanforderungen genutzt werden können und damit zur Sicherung ihrer psychischen Integrität, zur Kontrolle von Selbst und Umwelt sowie zu einem umfassenden biopsychosozialen Wohlbefinden beitragen (Herriger 2006, 5).
Eine professionelle Empowerment-Praxis zielt darauf „Möglichkeitsräume aufzuschließen, in denen sie sich die Erfahrung der eigenen Stärke aneignen und Muster solidarischer Vernetzung erproben können (Herriger 1997, 17). Eine solche Empowerment-Praxis geht damit über eine Hilfe zur Selbsthilfe hinaus, die in der Praxis oft verkürzt wird „auf die (Wieder-)Herstellung von Arbeitsfähigkeit als Grundlage einer eigenfinanzierten Lebensführung und dabei wesentliche Momente politischer Ein ussnahme auf die Gestaltung von lebensweltlichen Zusammenhängen außer acht lässt (Galuske 2007, 262).
Empowerment als professionelles Handlungskonzept ist vor allem auch ein Auftrag zur Neugestaltung der Rolle von professionell Tätigen, in das Blickfeld einer Empowerment- Praxis rückt daher explizit die Person des professionell Tätigen (vgl. Herriger 1997, 209ff; Theunissen 2003, 55ff). „Empowerment zielt auf eine Veränderung des Selbstverständnisses von Helfern und Hilfsinstitutionen (Herriger 1997, 261), die durch drei Perspektivwechsel gekennzeichnet ist (ebd., 261ff):
Von der Defizitorientierung zur Förderung von Stärken: „Der Blickwinkel richtet sich [... ] gezielt auf die Ressourcen und Stärken der Menschen, auf ihre Potentiale zur Lebensbewältigung und -gestaltung (Stark zit. n. Galuske 2007, 262) auch in Situationen des Mangels. Im Rahmen von Casemanagement arrangieren professionell Tätige gezielt vorhandene bzw. erreichbare Ressourcen und Hilfsquellen (z. B. soziale Beziehungen, soziale Netzwerke und Stützsysteme).
Von der Einzelförderung zur Stärkung von Individuen in Gruppen und (politischen) Kontexten: Vor allem dort, „wo Individuen sich in Gruppenzusammenhänge von Gleichbetroffenen eingliedern (Galuske 2007, 263f) werden sie in dem Bewusstsein gestärkt, ihre Situation prinzipiell beein ussen zu können. In den Mittelpunkt der professionellen Arbeit rückt die Unterstützung kollektiver Selbstorganisation z. B. in Form von „Informationsund Kontaktstellen für Selbsthilfe und ehrenamtliche Arbeit (vgl. hierzu Herriger 1997, 142ff).
Von der Beziehungsarbeit zur Netzwerkförderung: Die Verlagerung von einer direkten Intervention zur indirekten Förderung von Zusammenhängen bedeutet, Betroffenen „Aufbauhilfe bei der Gestaltung von unterstützenden Netzwerken zu vermitteln (Herriger 2006, 10). Dieses Stiften neuer sozialer Zusammenhänge wird durch Netzwerkberatung ergänzt, die u. a. darauf zielt, gewachsene familiäre verwandtschaftliche oder freundschaftliche Beziehungen, „die sich in der Zeit gelockert haben, enger zu knüpfen, bestehende Risse in der Textur der Beziehungen zu kitten, emotionale Belastungen und Beziehungshypotheken zu mindern und die Unterstützungsbeiträge des privaten Netzwerkes zu einem gemeinsamen Ganzen zu verknüpfen (ebd.).
Für die professionelle Empowerment-Arbeit in Praxisfeldern der Heilpädagogik hat Theu- nissen diese Perspektivwechsel modifiziert und zu fünf Leitlinien erweitert (Theunissen 2003, 57ff; vgl. auch Theunissen 2007, 62ff):
Zusammenarbeit: Zwar „lässt sich ein Machtgefälle zwischen Adressaten und professionellen Dienstleister nicht in jedem Falle zu einem gleichberechtigten Beziehungsverhältnis au ösen (ebd., 57f), die Grundlage der Empowerment-Praxis bildet jedoch ein auf Gleichberechtigung hin angelegtes Verhältnis zwischen Adressaten und Professionellen.
Stärken-Perspektive: Basis einer Empowerment-Praxis ist die „Erschließung individueller und sozialer Stärken (ebd., 58) sowohl in Hinblick auf einzelne Individuen (z. B. verschüttete und vorhandenen Fähigkeiten, Talente, Interessen, kulturelle Bräuche usw.), als auch in Hinblick auf Familien, Gruppen oder das soziale Umfeld (Ressourcenorientierung/aktivierung).
Subjekthaftigkeit: Anerkennen und ernst nehmen von individuellen Wirklichkeitsdeutungen, subjektiven Erfahrungen, Befindlichkeiten, Wünschen, unkonventionellen Lebensentwürfen, eigenen Zeitplänen usw. der Adressaten.
Kontextorientierung: „Menschen in gesellschaftlich marginaler Position [werden; M. F.] nicht als alleinige Adressaten (psycho)sozialer Dienstleistungen betrachtet (ebd., 59f): Interaktionen und ökosoziale Lebenswelten werden in Hinblick auf entwicklungsfördernde und einschränkende Bezüge und Bedingungen analysiert, Veränderungsbedarf ermittelt und Veränderungen angestoßen.
Solidarische Professionalität und Parteinahme: Menschen in gesellschaftlich marginaler Position werden als Bürger mit Ansprüchen, Rechten, aber auch Verantwortlichkeiten wahrgenommen und unterstützt, was „auch Kritik gegen herrschende Mächte, Verbände oder Institutionen (ebd., 60) einschließt. Gesellschaftliche Prozesse und das subjektive Empfinden einer Diskriminierung, Stigmatisierung und Ausgrenzung oder Benachteiligung werden für eine auf individuelle und kollektive Selbsthilfe und Selbstvertretung hin ausgerichtete Empowerment-Praxis aufgegriffen und aufbereitet (vgl. Theunissen 2007, 65).
2.1.4 Empowerment: Grundüberzeugungen/Menschenbild
Zentrales Moment einer veränderten Rolle des professionell Tätigen ist ein verändertes Menschenbild, das Herriger als „Philosophie der Menschenstärken (Herriger 2006, 3) bezeichnet. In diesem Abschnitt werden Grundüberzeugungen und Menschenbild des Empowerment-Konzepts zunächst entfaltet, an anderer Stelle (Kapitel 2.4.2) werden sie einer kritischen Betrachtung unterzogen.
Folgende normativ-ethische Grundüberzeugungen fundieren das Menschenbild des Em- powerment-Konzepts (Herriger 2006, 3ff):
Selbstbestimmung und Lebensautonomie: Ein „feste[r] Glaube an die Fähigkeit eines jeden Individuums, aus dem Schneckenhaus von Abhängigkeit, Resignation und erlernter
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Grundüberzeugungen und Menschenbild des Empowerment-Konzepts (nach Herriger 1997, 73ff und Herriger 2006, 3ff; Darstellung M. F.)
Hil osigkeit auszuziehen und in eigener Kraft Autonomie, Selbstverwirklichung und Lebenssouveränität zu erstreiten (Herriger 2006, 4; vgl. auch Theunissen 2007, 36ff).
Soziale Gerechtigkeit: Das Empowerment-Konzept ist einem „sozialaufklärerischen Programm (Herriger 2006, 4) verp ichtet. Angesichts gesellschaftlicher Strukturen sozialer Ungleichheit, d.h. die sozial ungleiche Verteilung von materiellen Lebensgütern (Niveau und Sicherheit des verfügbaren Einkommens und Vermögens) und immateriellen Lebensgütern (Bildung, Gesundheit, soziale Sicherung, Inklusion in tragende soziale Netzwerke) ist es Ziel einer Empowerment-Praxis, „Menschen ein kritisches Bewusstsein für die Webmuster der sozial ungleichen Verteilung von Lebengütern und gesellschaftlichen Chancen zu vermitteln und in ihren Köpfen ein analytisches Wissen um die Veränderbarkeit dieser übermächtig erscheinenden Strukturmuster zu festigen (ebd.; vgl. auch Theunissen 2007, 48ff).
Demokratische Partizipation: „Empowerment-Prozesse zielen auf die Stärkung der Teilhabe der Bürger an Entscheidungsprozessen, die ihre personale Lebensgestaltung und ihre unmittelbare soziale Lebenswelt betreffen. Sie zielen auf die Implementation von Partizipationsverfahren, die ihren Wünschen und Bedürfnissen nach Mitmachen, Mitgestalten, Sich-Einmischen in Dienstleistungproduktion und lokaler Politik Rechnung tragen und eine eigenverantwortliche Gestaltung von lokalen Umwelten zulassen (Herriger 2006, 4; vgl. auch Theunissen 2007, 40ff).
Auf diesen Grundüberzeugungen baut das Menschenbild des Empowerment-Konzepts auf: „Die Adressaten sozialer Dienstleistungen werden auch in Lebensetappen der Belastung in der Rolle von kompetenten Akteuren wahrgenommen, die über das Vermögen verfügen, ihre Lebenssettings in eigener Regie zu gestalten und Lebenssouveränität zu gewinnen (Herriger 2006, 3). Dieses Menschenbild lässt sich in verschiedenen Komponenten präzisieren (Herriger 1997, 73ff):
Vertrauen in die Fähigkeit eines jeden Menschen zu Selbstaktualisierung und personalem Wachstum: Auch wenn ihre Biographie „mit der Hypothek vielfältiger Ohnmachts- und Entfremdungserfahrungen belastet ist (ebd., 76), tragen Menschen das Potential zu ihrer Selbstaktualisierung in sich, wie z. B. in Form lebensgeschichtlich zurückliegender Settings und Zeiten des Gelingens, verschütteter positiver Erfahrungen von Selbstwert.
Achtung vor der Autonomie und Selbstverantwortung des Adressaten und Respekt auch vor unkonventionellen Lebensentwürfen: Eine voraussetzungslose, allen pädagogischen Bemühungen um Normalisierung vorangehende Akzeptanz der Person des Adressaten wie auch seiner kon ikthaften Lebensentwürfe. Dies bedeutet jedoch nicht Rückzug aus Verantwortung, die Toleranz gegenüber eigensinnigen Lebensweisen „endet dort, wo Grundwerte von Interaktion und sozialem Austausch, wie z. B. die Achtung vor der physischen und psychischen Integrität des anderen und der Verzicht auf schädigende Angriffe in Gefahr geraten (ebd., 77).
Respekt vor der eigenen Zeit und den eigenen Wegen des Adressaten: „Empowerment- Prozesse verlaufen in aller Regel in Umwegen, Rückschritten, Warteschleifen, sie landen in Sackgassen der Entmutigung und des Stillstands und steuern damit Kurse, die [... ] hohe Ressourcen von Zeit und Lebensenergie verbrauchen (ebd., 78). Zwar setzt das institutionelle „Zeit- und Arbeitsinvestment (ebd., 79) Grenzen, jedoch dürfen expertenseitig definierte Hilfe- und Zeitpläne die „Kursbestimmungen und Zeitrhythmen (ebd., 78) der Adressaten nicht „verschütten (ebd.).
Verzicht auf entmündigende Expertenurteile bei der Definition von Problemen, Problemlösungen, wünschenswerte Lösungen: „An die Stelle des sicheren Expertenurteils (d.h. der Unterstellung sicher zu wissen, wessen der andere bedarf ) tritt mehr und mehr das offene und machtgleiche Aushandeln von Lebensperspektiven (ebd., 80). Andererseits sind Kritik, Problematisierung, Grenzziehung gegenüber subjektiv nicht (mehr) tolerierbaren riskanten Lebensentwürfen unverzichtbar, notwendig ist eine „Gratwanderung zwischen dem Respekt gegenüber dem Eigensinn [... ] und den Zumutungen von Kritik, Distanz und Nicht-Übereinstimmung (ebd.).
Orientierung an einer ,Rechte-Perspektive‘: „Menschen mit Lebensschwierigkeiten verfügen unabhängig von der Schwere ihrer Beeinträchtigung über ein unveräußerliches Partizipations- und Wahlrecht im Hinblick auf die Gestaltung ihres Lebensalltags (Herriger 2006, 4).
2.2 Ebenen und Elemente von Empowerment-Prozessen
In Anlehnung an Vertreter des Empowerment-Konzepts lassen sich zu analytischen Zwecken vier Ebenen12 unterscheiden, auf denen Empowerment-Prozesse wirksam werden, die jedoch in praktischen Bezügen vielfältig miteinander verknüpft sind und in Wechselwirkungen stehen (vgl. Herriger 1997, 85ff und 2006, 8ff; Galuske 2007, 263f; Theunissen 2003, 60f; Theunissen/Plaute 2002, 57ff). Im Folgenden werden diese Ebenen vor dem Hintergrund praxisbezogener Fragestellungen in heilpädagogischer Perspektive konkretisiert, korrespondierende methodische Elemente umrissen sowie Beispiele für Empowerment-Prozesse vorgestellt.-Praxis in Hinblick auf den Adressaten umfasst zum einen die Erschließung individueller Stärken und Ressourcen und zum anderen die Stärkung und Erweiterung von Fähigkeiten, die Empowerment-Prozesse ermöglichen. Mit dem Begriff Ressourcen werden dabei jene positiven Potentiale beschrieben, „die von der Person zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse, zur Realisierung von langfristigen Identitätszielen, zur Bewältigung altersspezifischer Entwicklungsaufgaben oder zur gelingenden
Bearbeitung von belastenden Alltagsanforderungen genutzt werden können und damit zur Sicherung ihrer psychischen Integrität, zur Kontrolle von Selbst und Umwelt sowie zu einem umfassenden biopsychosozialen Wohlbefinden beitragen (Herriger 2006, 5). In Hinblick auf die subjektzentrierte Ebene stehen personale Ressourcen13 im Mittelpunkt, „lebensgeschichtlich gewachsene, persönlichkeitsgebundene Selbstwahrnehmungen, werthafte Überzeugungen, emotionale Bewältigungsstile und Handlungskompetenzen, die der Einzelne in der Auseinandersetzung mit kritischen Lebensereignissen zu nutzen vermag und die ihm ein Schutzschild gegen drohende Verletzungen sind (Herriger 2006, 6). Im Weiteren beschreibt Herriger einzelne Komponenten personaler Ressourcen: Beziehungsfähigkeiten, Selbstakzeptanz und Selbstwertüberzeugung, internale Kontrollüberzeugung, aktiver Umgang mit Problemen, exible Anpassung an Lebensumbrüche, Veröffentlichungsbereitschaft (vgl. ebd., 6f). Im Rahmen des Empowerment-Konzept gilt es nun Anlässe und Settings zu arrangieren, durch die der Betroffene „Vertrauen in das eigene Vermögen zur Lebens- und Umweltgestaltung gewinnt, verschüttete Kraftquellen von Kompetenz und Vermögen entdeckt und zur Gestaltung relevanter Lebensausschnitte einsetzt (Herriger 2006, 8).
In Hinblick auf die Stärkung und Erweiterung von Empowerment-Fähigkeiten betont Stark die Relevanz der Politikfähigkeit: „Um ein Mehr an Selbstbestimmung und Kontrolle über die eigenen Lebenszusammenhänge zu erlangen, bedarf es vorrangig der Förderung der Politikfähigkeit von Individuen zur Erweiterung ihrer (politischen) Partizipationsspielräume (Stark zit. n. Galuske 2007, 62). Politikfähigkeit umfasst dabei die Komponenten Organisations- und Kon iktfähigkeit: „Organisationsfähigkeit meint [... ] die Kompetenz der Gruppe, ein begründetes Eigeninteresse kollektiv zu artikulieren und zur Durchsetzung dieses Interesses Bündnispartner zu mobilisieren, bürokratische Kompetenz im Umgang mit den Verfahren, Regelungen und Begründungsnotwendigkeiten des politisch-administrativen Systems zu dokumentieren und sich des Zugangs zu Kanälen der politischen Ein ussnahme zu versichern. Kon iktfähigkeit bedeutet zugleich die Fähigkeit, die Legitimation kommunalpolitischer (Nicht-)Entscheidungen öffentlich zu problematisieren, die Verweigerung von Entgegenkommen und Konsensbereitschaft zu skandalisieren und so Widerstandsmacht geltend zu machen (Herriger zit. n. Galuske 2007, 262; vgl. auch Herriger 1997, 132f). Die der Politikfähigkeit zugrundeliegenden Bildungs- und Lernprozesse müssen entsprechend der individuellen persönlichen und lebensweltlichen Voraussetzungen, der Sozialisationsgeschichte, der konkreten Lebenssituation und den gegebenen gesellschaftlichen und institutionellen Bedingungen der Adressaten differenziert werden. In der heilpädagogischen Empowerment-Praxis wird Politikfähigkeit akzentuiert, im Zentrum stehen „Angebote und Lernhilfen zur konkreten Aneignung individueller und sozialer Empowerment-Fähigkeiten [. . . ] zum Beispiel Wünsche äußern, Auswahl und Entscheidungen treffen, Probleme eigenständig-verantwortlich lösen, sich in einer Gruppe behaupten, andere um Hilfe bitten, sich politisch äußern und einmischen etc. sowie „Angebote in Unterstützter Kommunikation (Theunissen 2007, 77f; vgl. Kapitel 2.3.4).
An folgenden Beispielen lässt sich Empowerment-Praxis auf der subjektorientierten Ebene illustrieren: Assistenz bei Menschen mit geistiger Behinderung als „einfühlende und unterstützende Lebenswegbegleitung (Herriger 2006, 16; vgl. auch Theunissen 2003, 64ff)14 in den Bereichen Wohnen ( Supported Living ) und Arbeit ( Supported Employement ); Mobilitätstrainings, „die es Menschen mit Behinderung und bisher begrenztem Aktivitätsradius ermöglichen sollen, Orte ihrer Wahl im Gemeinwesen zu erreichen, um Freunde zu besuchen, ins Schwimmbad zu gehen oder an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen (Lindmeier/Lindmeier 2002, 2); Bildungs- und Lernangebote, die nach Prinzipien der allgemeinen Erwachsenenbildung (Freiwilligkeit, Mitbestimmung, Wahlfreiheit und eine durchgehende Teilnehmerorientierung) durchgeführt werden: u. a. VHS-Kurse (vgl. Treipl 2006, 104) und Weiterbildungsangebote für Selbstvertretungsgruppen wie Werkstatträte oder People First-Gruppen; Unterstützung und Sicherung von Entscheidungsautonomie auch bei Menschen mit einer komplexen Beeinträchtigung z. B. in Form verschiedener Wahlmöglichkeiten sowohl in Alltagsangelegenheiten, als auch bei essentiellen Themen wie Wohnen.
2. Hinsichtlich des beru ich Tätigen intendieren Empowerment-Prozesse eine umfassende Professionalisierung, eine „neue Fachlichkeit (Theunissen/Plaute 1995, 24): Die Neubestimmung des Selbstverständnisses und des Menschenbildes (vgl. Kapitel 2.1.4), die qualifizierte Anwendung entsprechender Methoden (z.B. Casemanagement, Ressourcendiagnostik, Kompetenzdialog, Biographiearbeit, Netzwerkberatung und -förderung, Assistenzkonzept bei Menschen mit geistiger Behinderung) und die Bereitschaft zur re exiven Auseinandersetzung mit „grundlegenden Strukturproblemen und Handlungsdilemmata (Rock 2001, 170) sowie Handlungsperspektiven z.B. im Rahmen von Supervision, Praxisberatung und -begleitung, Soldidargemeinschaften, Fortbildung (hierzu auch Theunissen 2003, 76).
2.2.2 Gruppenbezogene Ebene
In Anbetracht einer gesellschaftlich ungleichen Verteilung von Selbstorganisationskräften Herriger spricht von einer stillen Selektivität entlang den Demarkationslinien sozialer Ungleichheit Bildung, Einkommen und Macht (vgl. Herriger 1997, 141) verfügt „vor allem die klassische Klientel sozialstaatlicher Dienstleistungsagenturen [... ] kaum über das (ökonomische, kulturelle und soziale) Kapital, das nötig ist, um sich selbstbewusst und schöpferisch in Assoziationen bürgerschaftlichen Engagements einzumischen (ebd.).15 In das Zentrum einer Empowerment-Praxis auf der gruppenbezogenen Ebene treten daher das Stiften von Zusammenhängen, die Inszenierung, der Aufbau und die Weiterentwicklung von fördernden Netzwerkstrukturen, die die Selbstorganisation von Menschen unterstützen (vgl. Herriger 2006, 10). „In vielen (vielleicht sogar den meisten) Fällen ist Empowerment das Produkt einer konzentrierten Aktion das gemeinschaftliche Produkt von Menschen also, die sich zusammenfinden, ihre Kräfte bündeln und gemeinsam aus einer Situation der Machtlosigkeit, Resignation und Demoralisierung heraus beginnen, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen (ebd.). Auf der gruppenbezogenen Ebene ergibt sich für eine Empowerment-Praxis „die Aufgabe, Menschen miteinander zu verknüpfen und ihnen Aufbauhilfen bei der Gestaltung von unterstützenden Netzwerken zu vermitteln [...], die Inszenierung, der Aufbau und die Weiterentwicklung von fördernden Netzwerkstrukturen, die die Selbstorganisation von Menschen unterstützen und kollektive Ressourcen für eine selbstbestimmte Lebensgestaltung freisetzen (Herriger zit. n. Haider 2006, 22).
In der wissenschaftlichen Diskussion wird auf positive Wirkungen und Leistungen sozialer Netzwerke hingewiesen, so werden einerseits „Austauschgüter sozialer Unterstützung [...] auf den Beziehungsbahnen sozialer Netzwerke gehandelt und getauscht (Herriger 1997, 136), zum anderen hat soziale Unterstützung direkte Ein üsse auf das biopsychosoziale Wohlbefinden und auf Stressbewältigungsprozesse (vgl. ebd., 134ff). In Anschluss an Diewald unterscheidet Herriger folgende Unterstützungsleistungen solidarischer Gemeinschaftsbezüge (vgl. Herriger 1997, 136f): Emotionale Unterstützung (Verminderung von Ohnmachts-, Abhängigkeits- und Isolationserfahrungen; Regulation der Emotionalität durch das Ausleben-Können von Gefühlen wie Wut, Angst, Verzwei ung, Niedergeschlagenheit usw.; Stärkung der Selbstwerterfahrung durch Wertschätzung und die Ich-stützende Anerkennung der anderen); Instrumentelle Unterstützung (Bereitstellung von materiellen Hilfen, konkreten Handlungstechniken und handfesten praktischen Alltagshilfen im Umgang mit einem kritischen Lebensereignis; Vermittlung von entlastenden Hilfen; Unterstützung des Betroffenen bei der schwierigen Suche nach einer neuen Lebensroutine , einem veränderten Lebensstil und einem neuen Lebensrhythmus); Kognitive (informationelle) Unterstützung (Aufklärung und Information über garantierte Rechte und verfügbare Hilfen im System sozialer Sicherung; Hinweise auf weitere hilfreiche Ressource-Personen in privater Lebenswelt und administrativem Kontext; Orientierungshilfe durch Zulieferung von neuen Informationen und durch das Öffnen von Türen zu neuen Informationsquellen); Aufrechterhaltung der sozialen Identität (Stärkung des Selbstwertes und der sozialen Identität durch die Kommunikation von Wertschätzung, Anerkennung und Zuwendung auch und gerade in Zeiten subjektiver Belastung); Vermittlung von neuen sozialen Kontakten (In-Kontakt-Bringen mit anderen Menschen in vergleichbarer Lebenslage; Vermittlung eines Zugehörigkeitsempfindens und Stärkung des Gefühls des sozialen Eingebundenseins).
Keupp verweist auf die Bedeutung solidarischer Vernetzung und Selbstorganisation angesichts der Ambivalenz gesellschaftlicher Individualsierungsprozesse: „Statt einer Förderung und Beschleunigung von Individualisierungsprozessen (z. B. als psychotherapeutische Modernisierung) gilt es, Projekte zur Gewinnung kollektiver Handlungsfähigkeit zu unterstützen, und dies speziell dort, wo die vorhandenen Ressourcen für einen autonomen Prozess von gesellschaftlicher Selbstorganisation nicht ausreichen (Keupp zit.n. Herriger 1997, 142; vgl. auch Herriger 1997, 36ff). Als Aufgabe einer Empowerment- Praxis auf der gruppenbezogenen Ebene sieht Herriger daher auch die Förderung von „Szenarien des freiwilligen sozialen Engagements von Menschen (Herriger 1997, 120; Hervorhebung entfernt), die in gemeinschaftlicher Form und in eigener Verantwortung ausgeführt werden, „um Lebensprobleme zu bewältigen, Umweltstrukturen zu verändern oder anderen zu helfen (ebd.). Diese Szenarien umfassen soziale Selbsthilfe in freien Assoziationen und Initiativgruppen, ehrenamtliche soziale Mitarbeit in Wohlfahrtsverbänden und anderen sozialen Organisationen und strittigen bürgerschaftlichen Initiativen, die in kritischer sozialer Einmischung gemeinschaftliche Interessen verfolgen (z. B. Umweltveränderung, Dienstleistungsgestaltung, Partizipation an politischer Willensbildung und Entscheidungsfindung).
Ein Beispiel für professionelle Empowerment-Prozesse auf der gruppenbezogenen Ebene sind die Informations- und Kontaktstellen für Selbsthilfe und Ehrenamt (vgl. Herriger 1997, 142ff), die „im Zwischenraum zwischen der einzelnen Person und der Sphäre der Öffentlichkeit (ebd., 142) angesiedelt sind und „vielfältige vermittelnde, vernetzende, überbrückende Funkionen (ebd.) erfüllen. Die verschiedenen Arbeitsschwerpunkte der Wegweisung, der Vermittlung von Starthilfen, der Vernetzung der Netzwerke, des Angebotes von Weiterbildungsprogrammen und des Aufbaus von Beteiligungsnetzwerken zielen auf eine Senkung der Schwellen bürgerschaftlichen Engagements, auf eine Vernetzung von Menschen mit gleichgelagerten Anliegen, Interessen und Bedürfnissen und auf das Anstoßen von Prozessen der Selbstorganisation durch das Arrangement förderlicher Rahmenbedingungen. Auch in Praxisfeldern der Heilpädagogik zielt gruppenbezogene Empowerment-Arbeit auf das Anstiften von Gruppenzusammenschlüssen sowie die Unterstützung von Gruppen und deren Arbeit wie z. B. Selbstbestimmt-Leben-, Self Advocacy- und People First-Gruppen in Form von Beratung und Assistenz (vgl. Theunissen 2007, 78f; Rock 2001, 23ff und Theunissen 2003, 64ff). „Als vorbildlich kann hierzu das Engagement renommierter US-amerikanischer Fachwissenschaftler in Hinblick auf Unterstützung und Netzwerkförderung der People First-Gruppen zu einem weltweiten Zusammenschluss betrachtet werden (Theunissen 2007, 79).
2.2.3 Institutionelle Ebene
Eine Empowerment-Praxis auf der institutionellen Ebene intendiert Veränderungsprozesse in Organisationen, Institutionen und Einrichtungen der Sozialen Arbeit und Heilpädagogik sowie auch der Sozialverwaltung und der politischen Willensbildung, d. h. einen Auf- und Ausbau von partizipativen und demokratischen Strukturen. Empowerment „zielt auf die Öffnung von Verbänden und Dienstleistungsunternehmen für Bürgerbeteiligung und ziviles Engagement [...], die Stärkung der Responsivität administrativer Strukturen für Bürgerbelange und die Etablierung von Verfahren formaler Beteiligung, die sachverständigen Bürgern ein Mandat im Prozess der Planung, Gestaltung und Implementation von sozialen Dienstleistung geben (Herriger 2006, 11). Das umfasst eine „Stärkung und Verbreiterung von Bürgerbeteiligung und zivilem Engagement (Herriger 1997, 149) im Zusammenhang mit der Diskussion über Kundenorientierung , neue Steuerungsmodelle und Adressatenbeteiligung (vgl. ebd.). Eine systematische Organisationsentwicklung ist i.d.S. darauf gerichtet, verbesserte Verfahren der Bürgerbeteiligung (Partizipation) zu implementieren, die Leistungsfähigkeit der Organisation (Effektivität und Dienstleistungsqualität) zu verbessern sowie Arbeitsstrukturen (betriebsinterne Entscheidungsstrukturen, Kooperationsmuster und Handlungsabläufe; Teamkultur; individuelle Arbeitsplatzqualität) zu schaffen, die „die Gestaltungsfreiräume der beru ichen Helfer in der Bewältigung ihrer berufsalltäglichen Aufgaben vergrößern und Arbeitsqualitäten herstellen, in denen sich eine bemächtigende Soziale Arbeit einrichten kann (ebd.). Die Implementation einer institutionellen Empowerment-Praxis „produziert signifikante organisatorische Ungleichgewichte und erfordert deutliche Kurswechsel in der Gestaltung der organisatorischen Verläufe, Kooperationen, Entscheidungsprozesse und Arbeitsplatzgestaltungen (Herriger 1997, 160), notwendig sind daher entsprechende methodische Instrumente der Organisationsentwicklung, wie z.B. Empowerment-Zirkel, die „den Kurswechseln der Institution in Richtung Empowerment eine verbindliche Richtschnur (Herriger 2006, 16) sein können (vgl. ebd., 13ff).16 Denn „je rigider und kontrollierender die institutionellen Systeme oder Strukturen sind, desto größer ist die Gefahr, dass den betroffenen Dienstleistern ein notwendiges Maß an Autonomie und Gestaltungsmöglichkeiten fehlt, um eine Unterstützung im Sinne von Empowerment zu geben (Theunissen 2003, 73).
Hinsichtlich der Menschen mit geistiger Behinderung betonen Theunissen/Plaute dabei die Zusammenarbeit aller Beteiligten, d. h. „gemeinsam mit den Betroffenen (bzw. im Interesse derer, die nicht für sich selber sprechen können) und ihren Bezugspersonen (Mitarbeitern) einen institutionellen Veränderungsbedarf zu erschließen (Theunissen/Plaute 2002, 41f) und auch Möglichkeiten einer De-Institutionalisierung durch bedürfnisorientier- te, bedarfsgerechte, gemeindeintegrierte Wohn- und Dienstleistungsangebote auszuloten und umzusetzen.
Folgende Beispiele veranschaulichen professionelle Empowerment-Prozesse auf der institutionellen Ebene: Demokratisierung der Schule durch interne und externe SchulmitwirkungsOrgane und -Verfahren auch in Förderschulen (vgl. Schlummer/Schlütte 2006, 21ff); Mitwirkung in Wohneinrichtung der Behindertenhilfe (vgl. ebd., 106ff; vgl. auch Schädler 2002, 184ff); Mitwirkung in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) durch Werkstatträte (vgl. ebd., 61ff und Kapitel 3.4.4); Beteiligung und Mitwirkung von betroffenen Menschen in Organisationen und Institutionen der Behindertenhilfe (z. B. die Beteiligung behinderter Menschen in Ausschüssen der Lebenshilfe; vgl. Gießelmann 1999).
2.2.4 Politische/Gesellschaftliche Ebene
Professionelle Empowerment-Praxis nimmt auch die Bedingungen für politische Einmischung und gesellschaftliche Ein ussnahme in den Blick. Sie zielt auf den Aufbau demokratischer Strukturen, die Menschen in marginalen Position, Selbsthilfe-Initiativen oder selbstorganisierten Netzwerken formelle Mitgestaltungsmöglichkeiten in lokalen Machtstrukturen eröffnen (vgl. Theunissen/Plaute 2002, 42ff). Aufgabe professionell Tätiger ist es dann, „in Kollaboration mit den Betroffenen [... ] die Interessen zu bündeln und gegenüber mächtigen, ein ussreichen Verbänden, Verwaltungsbürokratie, Politik und ihren Instanzen sozialer Kontrolle offensiv und konstruktiv zur Geltung bringen (ebd., 42f). Eine Empowerment-Praxis auf der politischen/gesellschaftlichen Ebene bedeutet, „die Responsivität der von Verwaltung und Politik für Bürgerbelange zu stärken, institutionelle und politische Settings zu arrangieren, die die Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen nach Mitmachen, Mitgestalten und Sich-Einmischen aufgreifen und verp ichtende partizipative Verfahrensregelungen und Entscheidungsstrukturen für Adressatenbeteiligung zu installieren (Herriger 1997, 150).
Herriger gibt zu bedenken, dass Beteiligung an (kommunal)politischen und administrativen Verfahren und Entscheidungsstrukturen „nicht (allein) durch radikale ( außerparlamentarische ) Opposition erstritten werden [kann; M. F.]. Es bedarf vielmehr formell abgesicherter Verfahren der Bürgerbeteiligung, die in Form von vertraglichen Vereinbarungen strukturelle Garantien für die Teilhabe, das Mitwirken und das Mitbestimmen der Bürger sichern (ebd., 157). Diese „Brückeninstanzen (ebd.) i. S.v. vermittelnden Strukturen sind geeignet, „die sich immer weiter öffnende Kluft zwischen der Lebenswelt der Bürger einerseits und den Entscheidungsträgern in Politik, Verwaltung und Verbänden andererseits zu überbrücken (ebd.). Die Mitwirkung in Beiräten und örtlichen Arbeitsgemeinschaften ermöglicht engagierten Bürgern, „ihre Interessen in konzentrierter Weise zu artikulieren und in die formellen Machtstrukturen einzubringen (ebd.). Professionelle Empowerment-Praxis solidarisiert sich mit Betroffenen, um „durch ein kritisches Beharren auf Mitwirkungsrechten, durch einen kalkulierten Einsatz von Skandalisie- rungstechniken sowie durch die Mobilisierung einer unterstützenden Öffentlichkeit [... ] diese[n] Beteiligungsgremien jene Freiräume für Selbstgestaltung und Selbstvertretung zu eröffnen, ohne die eine bedürfnisnahe und bürgerorientierte lokale Politik nicht zu verwirklichen ist (ebd., 159). Beispielhaft sind in diesem Zusammenhang kommunale Gremien wie Beiräte für Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund und ältere Menschen sowie entsprechende Beauftragte auf Kommunal-, Landesund Bundesebene.
Eine Empowerment-Praxis auf der politschen/gesellschaftlichen Ebene nimmt zudem gesetzliche Regelungen auf kommunaler Ebene, Länder- und Bundesebene sowie europäischer Ebene in den Blick, die den Rahmen für Empowerment-Prozesse bilden und damit ein förderliches Klima für Partizipations- und Mitwirkungsprozesse verankern und absichern. Eine professionelle Empowerment-Praxis umfasst damit auch eine solidarische Parteinahme für Menschen in gesellschaftlich marginaler Position, die auf Schutz und Stärkung ihrer Rechte abzielt. So erfuhren die Rechte behinderter Menschen i. d. S. seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine Stärkung: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948, Benachteiligungsverbot im Grundgesetz (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG) 1994, Fokussierung des Selbstbestimmungs- und Partizipationsgedanken im SGB IX 2001 (vgl. Kapitel 3.4.1), Behindertengleichstellungsgesetz 2002 und entsprechende Landesgleichstellungsgesetze, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 2006, ächendeckende Einführung des Persönlichen Budgets als P ichtleistung 2008 (vgl. Kapitel 3.4.3; Theunissen 2007, 101ff).
2.3 Empowerment und Bildung
Der Wandel gesellschaftlicher Wahrnehmung von Behinderung und die Paradigmendiskussion in der Heilpädagogik werden auch in den sich verändernden Auffassungen und Auslegungen des Bildungbegriffs sichtbar, insbesondere in Hinblick auf die institutionalisierte Schulbildung: Lange Zeit wurden Kinder mit geistiger Behinderung als bildungsunfähig17 vom Schulbesuch ausgeschlossen. Erst nachdem die Ständige Konferenz der Kultusminister 1960 „die Erziehungs- und Bildungsfähigkeit den geistig behinderten Kindern eingeräumt und die Verp ichtung ihnen gegenüber ausgesprochen hatte (Bach 1968, 3), wurde das Sonderschulwesen auf- und ausgebaut, das auch Kindern und Jugendlichen mit komplexen Entwicklungsbeeinträchtigungen Zugang zu pädagogisch strukturierter Förderung ermöglicht (vgl. auch Antor/Bleidick 2001, 11ff).
In den folgenden Abschnitten werden der Bildungsbegriff untersucht, seine Auslegung in Hinblick auf behinderte Menschen und damit verbundene Auswirkungen betrachtet und Bezüge des Empowerment-Konzepts zum bildungstheoretischen Diskurs beleuchtet, insbesondere zu Klafkis kritisch-konstruktiver Erziehungswissenschaft, Bildungstheorie und Didaktik. Im Zentrum des Interesses steht dabei das Verhältnis von Bildungsprozessen und Empowerment-Prozessen auf der subjektzentrierten Ebene und die Frage nach dem Potential von Bildungsangeboten für die Initiierung von Empowerment-Prozessen.
2.3.1 Zur Bedeutung des Bildungsbegri s
Eine gründliche Untersuchung des Bildungsbegriffs kann angesichts der Fülle an vorliegenden Betrachtungen, Erörterungen und Re exionen nicht erfolgen, im Folgenden werden daher nur einige grundlegende Aspekte des Bildungsdiskurses konturiert, die im Zusammenhang mit dem Empowerment-Konzept bedeutsam erscheinen.
Der Ausdruck Bildung kann, zunächst in Ausblendung eines normativen Gehalts, „sowohl für den Prozess als auch für das Resultat gebraucht werden, dem der Prozess seine Bestimmtheit verdankt. Bildung als Resultat ist die durch die Erfahrung und vielfältige Anstrengung erworbene individuelle Prägung im Denken, Fühlen und Handeln, die das Welt- und Selbstverhältnis des Menschen bestimmt (Koch 1999, 78). Die normative Ausgestaltung von Bildungszielen und -wegen ist dann wesentlich bestimmt „durch den jeweiligen Entwicklungsstand des Wissens darüber, worin das Wesen des Menschen gesehen werden kann. Bildung umfasst demzufolge Beschreibungen, welche grundlegende Haltung der Mensch zu sich und zu der ihn umgebenden materiellen, sozialen und geistigen Umwelt einnimmt (Marotzki/Tiefel 2007, 134). In diesem Sinne kann Bildung „erstens einen Stoff bezeichnen, eine kanonisierte Sorte von Kenntnissen; die dazugehörigen Verben lauten haben und wissen. Bildung kann zweitens ein Vermögen bezeichnen, die Fertigkeit oder Fähigkeit zu etwas; die dazugehörigen Verben lauten können und tun. Bildung kann drittens einen Prozess bezeichnen, eine Formung der Person; die kennzeichnenden Verben lauten sein , werden , sich bewusstwerden . Die letzte Bedeutung ist nur denkbar als Sich-bilden , jene Humboldtsche Figur von der Wechselwirkung zwischen Individuum und Welt (v. Hentig 1999, 180).
Eine re exive Auseinandersetzung des Menschen mit seinem Wesen und seinem Verhältnis zur Welt fand zu allen Zeiten statt und „das, was unter Bildung verstanden wird, ist also abhängig vom zeitdiagnostischen Gehalt einer kulturellen Epoche, stellt sich also in der Wissensgesellschaft anders dar als in einer Industrie- oder Agrargesellschaft (Marotzki/Tiefel 2007, 134.). Und während die transitive Bedeutung von bilden bis zum 18. Jahrhundert auf Gott, die Natur und den Menschen bezogen werden konnte,18 setzt ein pädagogischer Begriff von Bildung „die Einschränkung des Gebrauchs von Bildung auf Formierung und Gestaltung des Menschen durch den Menschen voraus (Koch 1999, 78). Koch spricht in diesem Zusammenhang von zwei konkurrierenden Modellen des Gebrauchs von Bildung , „erstens die artifizielle Verwendung (das Handwerkermodell) im Sinne der Gestaltung eines vorliegenden Stoffes nach einem vorweg gefassten Bild (imago) und zweitens der nicht mehr transitive, sondern re exive und dann auch organologische Gebrauch im Sinne des Sich-Bildens, von dem wir bei den lebenden Naturprodukten sprechen, die sich aus einem inneren Prinzip (Same, Keim, Anlage) zu ihrer vollendeten Gestalt ausbilden (das entelechiale Modell des Wachsenlassens). Während der artifizielle Gebrauch die bildende Tätigkeit im Bildner findet, unterlegt das entelechiale Modell die bildende Tätigkeit dem sich bildenden Leben selbst (ebd.). So beschreibt Bildung bei Kant noch einen tatsächlichen Vorgang, d. h. die „vielfältige[n] pädagogische[n] Bemühungen, die geistige und praktische Geschicklichkeit und einen sittlichen Charakter hervorbringen sollen (v. Hentig 1999, 38), während Humboldts Theorie der Bildung einem entelechialen Modell folgt: Bildung ist „die Anregung aller Kräfte eines Menschen, damit diese sich über die Aneignung der Welt in wechselseitiger Ver- und Beschränkung harmonisch-proportionierlich entfalten und zu einer sich selbst bestimmenden Individualität oder Persönlichkeit führen, die in seiner Idealität und Einzigartigkeit die Menschheit bereichere (v. Hentig 1999, 38).19
Humboldts Bildungsvorstellung ist dabei von einer emanzipatorischen Intention durchdrungen, wenn er in der „Absolutsetzung der Bildung zum höchsten Daseinszweck (Koch 1999, 80) den Staat in den Dienst der Bildung stellen und ihm die Aufgabe zuweisen möchte, „für Freiheit und mannigfaltige Situationen zu sorgen, ohne welche die Bildung der Individuen nicht gedeihen kann (ebd., 81). Gleichwohl diese Vorstellung von Bildung auch schon zu Humboldts Zeiten nicht von allen Zeitgenossen geteilt wird (vgl. v. Hentig 1999, 39), bleibt diese „Arbeit an der geschichtlichen Durchsetzung der Vernunft und des Geistes und an der Verknüpfung von Humanismus und Humanität (Gamm zit. n. Bernhard 1997, 64) nicht folgenlos. In der Perspektive einer kritischen Bildungstheorie stellt Bernhard fest: „Während in anderen westeuropäischen Industrieländern die politische Überwindung feudaler Produktionsverhältnisse zum Teil über die Freisetzung von Aufständen und Revolutionen vollzogen wird, wird sie in Deutschland [... ] aufgrund spezifischer Machtkonstellationen auf lange Zeit verschoben. An ihre Stelle tritt die intensive Aufbereitung einer Theorie der Bildung (Bernhard 1997, 64).
Dieses „Bildungsideal der deutschen Klassik (Litt zit. n. Antor/Bleidick 2001, 8) wird jedoch im Zuge einer fortschreitenden Industrialisierung und im Übergang zur bürgerlichen Gesellschaft zunehmend mit der „Notwendigkeit einer Vorbereitung auf das ökonomischtechnische System der Berufs-, Arbeits- und Wirtschaftsgesellschaft (Antor/Bleidick 2001, 7) konfrontiert, mit der Folge, dass Bildung immer stärker „auf ihre Funktion als Qualifizierung für das von der Gesellschaft benötigte Arbeitsvermögen reduziert (Bernhard 1997, 64) wird. Damit einher geht eine „Verdinglichung und Entwertung (Koch 1999, 82) des Bildungsbegriffs und in dem Maße wie „ höhere Bildung zum Sozialetikett der Gebildeten (ebd.) wird, gerinnt Bildung zur „Attitüde eines konservativen bürgerlichen Klassenbewusstseins (ebd.). Bernhard resümiert: „In dem Maße, in dem sich das Bürgertum etablierte und seine Hegemonie ausbaute, verfiel [... ] auch der emanzipative Anspruch seiner Bildungsphilosophie (Bernhard 1997, 64). Unter diesen Eindrücken steht dann auch ein Alltagsverständnis von Bildung: Außerhalb der akademischen Sphäre von Pädagogik und Erziehungswissenschaft wird Bildung überwiegend vor einem bildungsökonomischen Hintergrund mit Qualifikation und Lernen in Hinblick auf Schule, beru iche Ausbildung und den Ansprüchen des Arbeitsmarktes assoziiert (vgl. Marotzki/Tiefel 2007, 135). Bezugnehmend auf die Kritische Theorie und Adornos Kategorie der Halbbildung betont Bernhard die „vergesellschaftete Verfallsform von Bildung (Bernhard 1997, 70f), die sich durch „eine marktorientierte Vermittlung von Bildungsinhalten und eine „kulturindustrielle Berieselung und Durchdringung gesellschaftlichen Alltags als „ober ächliche und üchtige Informiertheit artikuliert . Dieses verkürztes Bildungsverständnis tendiert schließlich dazu, „soziale Ungleichheit und Missstände zu verschleiern und zu stabilisieren (Theunissen/Plaute 1995, 164).
Auch wenn es Versuche gibt, die Bildungsidee zeitgemäß weiter zu entwickeln (u. a. Klafkis kritisch-konstruktive Erziehungswissenschaft und Heydorns Bildungstheorie), wird in postmodernen erziehungswissenschaftlichen Positionen in grundsätzlicher Kritik an aufklärerischen Bildungsideen und humanistischen Bildungskonzepten die Möglichkeit einer politischen und pädagogischen Selbstbestimmung angezweifelt, nämlich dass „eine vernünftige Selbstbestimmung als Grundlage gesellschaftlichen Zusammenlebens möglich sei (Bernhard 1997, 72). In diesem Sinne kann auch die zunehmende Präsenz und von sozialwissenschaftlich und empirisch geprägten Begriffen wie Lernen, Kommunikation, Förderung gedeutet werden, die den Bildungsbegriff verdrängen (vgl. Stinkes 1999, 6).20
Die kritische Bildungstheorie weist jedoch auf den Doppelcharakter von Bildung hin, der im Rahmen einer emanzipativen Erziehung zum Ausgangspunkt für eine gesellschaftskri- tische Persönlichkeitsbildung werden kann: „Einerseits ist Bildung Vorbereitung auf das beru iche Leben in einer neuen von Verwertungs- und Konkurrenzzwängen durchdrungenen Gesellschaft, andererseits wird sie zur Voraussetzung, sich dem gesellschaftlichen Verfügungsdruck zu entziehen, indem sie auf Selbstbewusstwerdung , eigenständige Handlungsfähigkeit und Selbstermächtigung orientiert (Bernhard 1997, 64). Diese emanzipative Bildung ist aber auf soziopolitische Bewegungen verwiesen, „die sich, ebenso wie sie selbst, an widerspruchsreichen Vorgängen gesellschaftlicher Entwicklungstendenzen entzünden (ebd., 72).
2.3.2 Bildung von Menschen mit Behinderung
In einer Untersuchung zur Bildungswirklichkeit geistig behinderter Menschen hat Kast die historische Entwicklung der Bildungsidee untersucht und mit gesellschaftlichen und anthropologischen Fragestellungen verknüpft (vgl. Kast 1999). Er stellt zusammenfassend fest, dass zwar „gesellschaftliche Veränderungen zu epochalen Veränderungen der Bildungsidee geführt haben (ebd., 109), die verschiedenen Bildungsvorstellungen jedoch einem „Lebenszweck , einer „von der Vernunft geforderten Staatsidee und deshalb mehr oder weniger der Frage des Nutzens für das Allgemeingut (ebd.) unterworfen waren. Diese Nützlichkeit wurde Menschen mit geistiger Behinderung abgesprochen und „auch wenn der Selbstbestimmung der Einzelnen [Menschen; M. F.] in der Spätaufklärung und [im; M. F.] frühen Neuhumanismus ein immer größer werdender Stellenwert zuerkannt wurde, so blieb sie doch an die Selbstbestimmung, im Sinne dieses Lebenszwecks , gebunden. Sie wurde keineswegs für Menschen mit (schwerster) geistiger Behinderung gefordert, weil deren Lebenszweck und deren Bildbarkeit stets fragwürdig blieb (ebd.). Diese Fragwürdigkeit geistig behinderter Menschen ist eng mit anthropologischen und teleologischen Vorstellungen der conditio humana verknüpft: „Gerade die für den geisteswissenschaftlichen Bildungsbegriff, für die Entstehung des Bildbarkeitsgedankens und für die Allgemeinbidungsidee herausragenden Epochen der klassischen Antike, der (Spät)Aufklärung und des Neuhumanismus, stellten den Menschen in den Vordergrund ihrer Betrachtungen. [... ] Im Gegensatz zum Tier, welches nur auf seine körperlichmaterielle Existenz beschränkt sei, besitze der Mensch geistiges Vermögen sei der Mensch vernunftbegabt (ebd., 109f). Durch diese Trennung des Körpers vom Geist i. S. v. Verstand kann die Sonderstellung des Menschen im Universum begründet werden, jedoch mit existentiellen Folgen für Menschen mit geistiger Behinderung: „Die Ableitung des Bildungsrechts für Menschen mit (schwerster) geistiger Behinderung auf der Basis einer Beschreibung der Kombination der biologischen Determinanten mit den Kriterien, die für den Vernunftgebrauch gefordert werden, hat sich [... ] als schwierig, wenn nicht gar als unmöglich erwiesen (ebd., 110).
Schon in der Antike wurden „sowohl in Sparta als auch in Athen missgebildete Neugeborene , die nicht in der Lage waren, zum Erhalt und zur Fortentwicklung des Staates beizutragen, selektiert und ausgemerzt (ebd., 48), und die Übernahme antiker Traditionen in die abendländische Bildungskultur schloss auch diese Formen des Umgangs mit behinderten Menschen ein: So fielen behinderte Menschen in der Zeit des Mittelalters trotz einzelner Initiativen einer „christlich motivierten Fürsorglichkeit für Geistesschwache und Geisteskranke (Speck zit. n. Kast 1999, 46) einer Glaubenswelt zum Opfer, die verunstaltete Kinder als das Werk des Teufels betrachtete (vgl. ebd., 47f). Ein aufkommendes medizinisches Interesse an der Heilung von Blödsinnigkeit und sozial- caritative Bemühungen führten im 19. Jahrhundert zwar dazu, dass zumindest „die totale Verneinung des Menschseins von Menschen mit (geistiger) Behinderung aufgehoben (ebd., 49) wurde, „impliziert[en] allerdings schon die Gefahr des Scheiterns (ebd., 50), wenn die Intention des Heilens nicht „feststellbar erfüllt werden kann (ebd.). Angesichts des mit der Industrialisierung einsetzenden gesellschaftlichen Wandels und der zunehmenden Durchsetzung utilitaristischer Vorstellungen einer kapitalistischen Verwertbarkeit des Menschen stellte sich auch in Bezug auf geistig behinderte Menschen die Soziale Frage , auf die ab Ende des 19. Jahrhunderts zunächst mit einer eugenischen Praxis der Sterilisation von Unbrauchbaren und Minderwertigen reagiert wurde, die weitere Radikalisierung sozialdarwinistischen und rassenhygienischen Denkens führte schließlich zum systematischen Mord an Menschen mit geistiger Behinderung im nationalsozialistischen Deutschland (vgl. ebd., 51ff und Kapitel 3.1.1).21
Vor dem Hintergrund dieser gesellschaftlichen Tendenzen im Umgang mit behinderten Menschen kann auch die Entwicklung des (Sonder-)Schulwesens nachvollzogen werden. So waren die ab Ende des 19. Jahrhunderts entstehenden Hilfsschulen nur den Kindern vorbehalten, denen eine geringe kognitive Begabung attestiert wurde, nicht jedoch den Blödsinnigen , die als nicht schulbildungsfähig eingeschätzt wurden. Der anfängliche pädagogische Optimismus, „den Kretinismus zu heilen (Kast 1999, 50) war bald einem „nicht zu unterschätzenden wirtschaftlichen Motiv (ebd.) gewichen, die Erfolge der Erziehungsbemühungen um geistig behinderte Menschen in Form einer sozialen Brauchbarkeit und Erwerbsfähigkeit nachzuweisen.22 So forderte die 1865 gegründete Gesellschaft zur Förderung der Schwach- und Blödsinnigenbildung in einer Grundsatzerklärung 1866: „In allen größeren Städten gründe man Schulen für schwachsinnige Kinder, damit diese, die später zum größten Teil der Gemeinde zur Last fallen, durch geeignete Persönlichkeiten und entsprechenden Unterricht zu brauchbaren Menschen herangebildet werden (Schäd- ler 2001, 44). Diese Hilfsschulen wurden jedoch von den bestehenden Idiotenanstalten , die das „Konzept einer religiös orientierten P ege und Verwahrung der Schutzbefohlenen (ebd., 50) verfolgten, als Bedrohung ihres Monopols empfunden.23 Die mehr als 20-jährigen Auseinandersetzungen zwischen Anstalts- und Hilfsschulvertretern führte zum Kompromiss einer „Grenzregulierung (Bradl zit. n. Schädler 2001, 45) in Form einer strikten Trennung von Hilfsschulen und Idioten-Heilanstalten : Schwachbegabte , als noch bildungsfähig angesehene Kinder wurden pädagogisch gefördert, schwachsinnige , als bildungsunfähig angesehene Kinder wurden gep egt und verwahrt, schließlich wurde mit 11 Reichsschulp ichtgesetz 1938 die Grenze zwischen schulischer Bildungsfähigkeit und Bildungsunfähigkeit in der Fähigkeit zur Erlernung der Kulturtechniken rechtlich festgeschrieben (vgl. Bach 2000, 3).
Dieser 11 des Reichsschulp ichtgesetzes diente auch als Vorlage für die neuen Schulgesetze nach dem Zweiten Weltkrieg, sodass bildungsunfähige Kinder und Jugendliche weiterhin von der Schulp icht befreit wurden. Es entstanden private, außerschulische Bildungseinrichtungen und Tagesstätten, aber erst in Reaktion auf Forderungen und Appelle betroffener Eltern räumte die Ständige Konferenz der Kultusminister 1960 in einem Gutachten zur Ordnung des Sonderschulwesens geistig behinderten Kindern ein Bildungsrecht ein (vgl. Bach 2000, 2f und Eggers 2004, 21ff). In der Folge kam es zu einer weiteren Differenzierung des Sonderschulwesens, die schließlich auch zum Aufbau von Schulen für geistig behinderte Kinder führte. Mit Etablierung der Sonderschulen für geistig behinderte Kinder ging eine Auseinandersetzung um den Bildungsbegriff in der Heilpädagogik einher, um „die praktisch bereits erwiesene, jedoch theoretisch nicht bewiesene Bildungsfähigkeit von geistig behinderten Menschen auszuzeigen (Stinkes 1999, 4). Stinkes hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass die Heilpädagogik „in Theorie und Praxis [... ] durch das historisch verbürgte und über geistig behinderte Menschen ausgesprochene Verdikt ihrer Bildungsunfähigkeit und ihrem Lebensunwert (Stinkes 1999, 1), belastet ist, und fordert daher eine normativ-anthropologische Begründung des Bildungsrechts im Zusammenhang mit der Neuformulierung des Bildungsbegriffs.
In Hinblick auf die Frage nach der Bildungsfähigkeit geistig behinderter Menschen und die Begründung ihres Bildungsrechts verweisen Antor/Bleidick auf eine gattungsspezifische Lernfähigkeit: „Das anthropologische Bestimmungsstück der Lernfähigkeit gilt da es gattungsspezifisch ist für alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Anlagen, aber auch ungeachtet ihrer durch günstige oder ungünstige Faktoren beein ussten Entwicklungsmöglichkeiten (Antor/Bleidick 2001, 10; Hervorhebung entfernt). Demnach sind auch „Menschen mit geringen kognitiven Fähigkeiten, fehlender Lautsprache, gestörter
Motorik oder unkontrolliertem Verhalten [... ] lernfähig gemäß der ihnen zur Verfügung stehenden Lernmöglichkeiten (ebd.). Die Bildungsfähigkeit eines Menschen ist dann jeweils individuell bestimmt „durch das je einmalige Verhältnis von Lernmöglichkeiten, Lernangeboten und Lernanforderungen (ebd., 11). Diese Lernmöglichkeiten sind jedoch nicht zuverlässig prognostizierbar, notwendig sind sowohl ein „Vorschuss an Bildsamkeit (ebd.) als auch entsprechende rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen wie z. B. eine angemessene sachliche und personale Ausstattung von Schulen. „Nur wenn Menschen Gelegenheit zum Lernen erhalten, wenn förderliche Bedingungen [. . . ] bereit gestellt werden, kann das Ziel menschlicher Entwicklung überhaupt ins Auge gefasst werden (ebd.). In diesem Sinne leitet sich das Bildungsrecht aus dem Lebensrecht ab: „Bildungsrecht ist im tieferen Sinne Lebensrecht. Denn der Mensch kann nur existieren, wenn er den Schritt zur proportionierlichen Weiterentwicklung seiner Naturanlagen tut (Kant), und wenn er die Bedingungen dafür zugestanden bekommt.24 Lebensrecht und Bildungsrecht sind zwei Aspekte ein und derselben normativen Anerkennung des Menschen als eines Wesens, dessen Leben auf Weiterentwicklung angelegt ist (ebd., 12f; Hervorhebung entfernt). Im Begriff der Menschenwürde werden Lebens- und Bildungsrecht zusammengeführt: „Zwischen dem Recht auf Leben und dem Recht auf Bildung besteht ein wechselseitiger Zusammenhang. Wer ein ungeteiltes Recht auf Leben für alle Menschen einfordert, bejaht ein Bildungsrecht für alle, das Erziehung und Bildung nicht von irgendwelchen Voraussetzungen wie Sprachfähigkeit, intellektuelle Mindestkompetenz oder dergleichen abhängig macht. [...] Werden Bildungsrecht und Bildungsmöglichkeiten für alle Menschen anerkannt, so ist das nur vor einem logischen Hintergrund denkbar, der das Recht auf Leben nicht in Frage stellt (ebd., 13).25
In den gesellschaftlichen Diskursen um ethisch-moralische Grundsatzfragen im Zusammenhang mit Lebensrecht, Euthanasie, pränataler Diagnostik und Abtreibung behinderten Lebens zeigt sich, dass dieser Auslegung der menschlichen Würde und damit des Lebensrechts und des Bildungsrechts nicht unwidersprochen zugestimmt wird. Insbesondere ein empirisch-rationales Verständnis von Menschsein, das empirisch beschreibbare Kriterien26 für die Zugehörigkeit zur Gattung Mensch beschreibt, birgt „die Gefahr, aufgrund der Unmöglichkeit des empirischen Nachweises, das Absprechen des Lebensrechts beinahe unbegrenzt ausdehnen zu können (Kast, 1999, 97). „Die Interpretationen, die der Begriff der Würde zugelassen hat, machen [...] die Notwendigkeit deutlich, dieses Recht nicht als zeitlich unbegrenzt gültig zu betrachten, sondern Gefährdungen zu erkennen, dagegen anzusteuern und für dieses Recht einzustehen (ebd., 109).
2.3.3 Empowerment-Konzept und Bildungstheorie
Im Folgenden werden einige Berührungspunkte und Überschneidungen von bildungstheoretischen Vorstellungen mit dem Empowerment-Konzept aufgezeigt. Die damit heraus gestellten Parallelen zwischen pädagogischen Bildungsprozessen und Empowermentprozes- sen sind insbesondere in Hinblick auf die subjektzentrierte Empowerment-Praxis relevant (vgl. Kapitel 2.2.1).
Es ist vor allem Theunissen, der in seinen Betrachtungen und Ausführungen die bildungstheoretischen Bezüge des Empowerment-Konzept betont, wenn er daraufhinweist, dass der „Empowerment-Gedanke schon in den klassischen Theorien der Allgemeinbildung angelegt ist (Theunissen/Plaute 1995, 170). Er knüpft dabei an die Bildungstheorie der kritisch-konstruktiven Erziehungswissenschaft an und entfaltet das Empowerment- Konzept als Wegweiser einer „kritisch-konstruktive[n] Heilpädagogik (Theunissen 2007, 149; vgl. Theunissen/Plaute 1995, 25ff und 162ff; Theunissen/Plaute 2002, 67ff , 134ff und 191ff; Theunissen 2007, 52ff, 121ff, 239ff und 323ff).27 Theunissen bezieht sich namentlich auf Klafki, daher werden zunächst ausgewählte Grundzüge von Klafkis Entwurf einer Theorie der Erziehung skizziert (vgl. Klafki 1971; 1995; 1996; 1998a; 1998b; 1998c).
Als Bestimmungselemente seiner Theorie der Erziehungswissenschaft und Erziehungsforschung benennt Klafki (1998b, 2ff) zum einen inhaltliche Grundprinzipien und Grundkategorien und zum anderen konstitutive methodische Ansätze.
Inhaltliche Grundprinzipien und Grundkategorien: 1. Erziehungswissenschaft versteht sich als Theorie von der pädagogischen Praxis und für die pädagogische Praxis, wobei pädagogische Praxis als „eine bestimmte Form gesellschaftlicher Praxis zu verstehen (ebd., 2) ist, die sich mit den jeweiligen geschichtlich-gesellschaftlichen Zusammenhängen wandelt. 2. Grundlage der Pädagogik in Theorie und Praxis ist eine „relative Autonomie (ebd.) gegenüber Theologie, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in einer „spezifische[n] Form der selbstverantwortlichen Bezogenheit (ebd., 3). 3. Der Bildungsbegriff wird in „Wiederbesinnung auf die großen klassischen Traditionen der Bildungstheorie (ebd., 4) unter dem Eindruck der Kritischen Theorie neugefasst. Bildung muss demnach als Zusammenhang dreier Grundfähigkeiten verstanden werden: „Erstens als Fähigkeit zur Selbstbestimmung jedes einzelnen über seine individuellen Lebensbeziehungen und
[...]
1 Einen Überblick über aktuelle Tendenzen in der Diskussion um den Ausdruck Menschen mit geistiger Behinderung gibt Theunissen 2007, 9ff.
2 So entwickelte z. B. die WHO ihre erste Klassi kation von Behinderung ICIDH (1980) zur ICF (2001) weiter und vollzog damit den Wandel von einem störungs- und de zitorientierten hin zu einem kontext- und ressourcenorientierten Ansatz (vgl. DIMDI 2005, 175ff).
3 Gesetzliche Instrumentarien zur Erleichterung der Auftragsakquise in Form nanzieller Anreize für Erwerbsbetriebe (Anrechnung von Werkstattleistungen auf die Ausgleichsabgabe, 140 SGB IX) und der Verp ichtung der öffentlichen Hand zur Vergabe von Aufträgen an WfbM ( 141 SGB IX) sind weitgehend wirkungslos geblieben (vgl. Scheibner 2000, 15f).
4 Im Rahmen einer schriftlichen Befragung wurden 1999 rund 650 WfbM angeschrieben, die Rücklaufquote lag bei 54% (Deutsche Vereinigung für die Rehabilitation Behinderter e. V. 2001, 42).
5 Die grundlegenden Widersprüche und Kon ikte, die sich aus der wirtschaftlichen Tätigkeit der WfbM ergeben, d. h. Verwertungsdruck auf die behinderten Beschäftigten und weitgehend fremdbestimmte, entfremdete Arbeit, bleiben zunächst ungelöst.
6 Zu den Ursprüngen von Empowerment: Herriger 1997, 18ff und Theunissen/Plaute 2002, 27ff.
7 Derzeit wird das Assistenzmodell im Zusammenhang mit den gesetzlichen Regelungen zum Persönlichen Budget ( 17 SGB IX) diskutiert (vgl. z.B. Paus 2007a). Einen allgemeinen Überblick geben Rock 2001, 53ff und Bartuschat 2002, 56ff.
8 In ihrer Arbeit konzentrierten sie sich darauf einen Helferpool aufzubauen und eine Liste von behindertengerechten Wohnungen zu erstellen, um so jedem behinderten Studenten die Entscheidungsfreiheit zu geben, zu wählen, wie und wo er in der Gemeinde leben wollte (Laurie zit.n. Treipl 2006, 102).
9 Die Bezeichnung People First ( Wir sind zuerst Menschen ) geht auf eine Tagung für Menschen mit geistiger Behinderung zurück, die 1974 in Oregon stattfand (vgl. Rock 2001, 26). Der Begriff Self-Advocacy, der oft als Synonym für People First gebraucht wird, bezeichnet den Aufbau und die Vernetzung von eigenständigen Interessenvertretungen geistig behinderter Menschen [...] sowie den damit verbundenen Anspruch dieser Menschen auf Selbstbestimmung und Selbstvertretung (ebd., 23).
10 So sprachen sich insbesondere die Krüppelgruppen gegen eine gleichberechtigte Zusammenarbeit mit Nicht-Behinderten aus, in den Vordergrund wurde zunächst die Bildung eines eigenen Selbstverständnisses und politischen Bewusstseins in Abgrenzung zur Nichtbehinderten-Normalität gestellt (vgl. Bartuschat 2002, 19).
11 Dieser Begriffskategorie werden Autismus, Epilepsie, Cerebralparese und geistige Behinderung zugeordnet (vgl. Rock 1995, 26).
12 Herriger unterscheidet zunächst drei Ebenen (vgl. Herriger 1997, 85ff), später differenziert er vier Ebenen (vgl. Herriger 2006, 8ff).
13 Herriger unterscheidet strukturelle, personale und soziale Ressourcen (vgl. Herriger 2006, 5ff).
14 Theunissen unterscheidet acht zentrale Assistenzformen: Dialogische Assistenz (Herstellung und Fundierung einer vertrauensvollen Beziehungsgestaltung und kommunikativen Situation), Lebenspraktische Assistenz (pragmatische Hilfen zur Alltagsbewältigung), Konsultative Assistenz (gemeinsame Beratung in Bezug auf psychosoziale Probleme, Lebenspläne und -ziele, Zukunft), Advokatorische Assistenz (Anwaltschaft, Fürsprecherfunktion, Stellvertreter, Dolmetscher), Facilitatorische Assistenz (wegbereitende, i. S.e. subjektzentrierten Förderung auf Basis offener Curricula ), Lernzielorientierte Assistenz (Hilfe zur Selbsthilfe durch strukturierte Lernangebote), Sozialintegrierende Assistenz (soziale und gesellschaftliche Integrationshilfe, Netzwerkförderung)und Intervenierende Assistenz (z. B. haltgebende, stützende Hilfe im Falle von Verhaltensauffälligkeiten) (vgl. Theunissen 2003, 72ff).
15 Herriger ergänzt: Die Lobeshymnen auf die Kraft der Selbstorganisation, die in vielen Räumen der Sozialpolitik in Zeiten skalischer Krise und schwindender politischer Legitimation angestimmt wird, bekommen vor dem Hintergrund dieser sozialstrukturellen Ungleichheit zynische Obertöne (Herriger 1997, 141).
16 Ein weiterer Ansatz in der institutionellen Empowerment-Praxis ist die Empowerment-Evaluation , die im Gegensatz zu Topdown Modellen eines Qualitätsmanagements, welches Qualitätsentwicklung als Aufgabe von Pro s betrachtet (Theunissen 2007, 80), den Betroffenen eine Stimme verleiht und alle an einem Reform- oder Entwicklungsprozess beteiligten Personen (ebd.) beteiligt (vgl. Theunissen 2007, 80ff).
17 Das Urteil bildungsunfähig [ist] tatsächlich von tragischem Gewicht [...]; denn es rechtfertigt nicht nur pädagogische Resignation, sondern es fordert sie gerade heraus. Sofern aber der Mensch zum Menschen erst wird durch Erziehung, kommt die Abweisung durch den Begriff der Bildungsunfähigkeit praktisch einem Todesurteil über den Menschen hinsichtlich seiner Menschlichkeit gleich und ist als leise Euthanasie zu bezeichnen (Bach 1968, 7; Hervorhebung im Original).
18 Gott bildet den Menschen zu seinem Ebenbild (imago Dei); die Natur schafft Bildungen etwa die Bildung von Kristallen, die Bildung eines Antlitzes (Gesichtsbildung) oder einer menschlichen
Gestalt; ebenso konnten Hervorbringungen aus Menschenhand als Gebilde bezeichnet werden, vor allem diejenigen des bildenden Künstlers . Hier wird überall Bildung im Sinne von Formierung und vor allem Gestaltung verwendet (Koch 1999, 78).
19 In dieser De nition ist jedes Wort bedeutsam: Es geht um Anregung (nicht um Eingriff, mechanische Übertragung, gar Zwang); alle (nicht nur die geistigen) Kräfte sollen sich entfalten (sie sind also schon da, werden nicht gemacht oder eingep anzt), was durch die Aneignung von Welt (also durch Anverwandlung in einem aktiven Vorgang) geschieht in wechselhafter Ver- und Beschränkung (das hei t erstens: auch die Welt bleibt nicht unverändert dabei, zweitens: die Entfaltung ist kein blo es Vorsichhin-Wuchern, sie fordert Disziplin); die Merkmale sind Harmonie und Proportionierlicheit (Bildung mildert die Kon ikte zwischen unseren sinnlichen und unseren sittlichen, zwischen unseren intellektuellen und unseren spirituellen Ansprüchen, sie fördert keine einseitige Genialität); das Ziel ist die sich selbst bestimmende Individualität aber nicht um ihrer selbst willen, weil sie als solche die Menschheit bereichert (v. Hentig 1999, 39; Hervorhebung im Original).
20 Diese Begriffsverschiebung steht auch im Zusammenhang mit einer allgemeinen Krise der geisteswissenschaftlichen Pädagogik seit dem Ende der 1950er Jahre (vgl. Klafki 1998a) und der realistischen Wende in der pädagogischen Forschung (Roth).
21 Dörner stellt folgende These auf: Es ist die entscheidende Absicht der Nazis gewesen, der Welt am Beispiel Deutschlands ein einziges Mal zu beweisen, dass eine Gesellschaft, die sich systematisch und absolut jedes sozialen Ballastes entledigt, wirtschaftlich, militärisch und wissenschaftlich unschlagbar sei, eine Absicht, die sich auch nur schwer widerlegen lässt, wenn man die Logik [... ] der Industrialisierung konsequent zu Ende denkt (Dörner 1988, 10).
22 Ein anschauliche Beispiel gibt Gröschke in der Beschreibung der Erziehungsversuche des Medico- Pädagoge[n] Itard (Gröschke 1997, 77) mit Victor, dem Wilden Kind von Aveyron : Itard war überzeugt, dass es sich bei Victor um ein verwildertes, unzivilisiertes Kind handele, an dem man den unbearbeiteten Rohzustand der Menschennatur beobachten könne. Er wollte den praktischen Beweis liefern für die Maxime der Anthropologie der Aufklärung, dass der Mensch nur das ist, was die Erziehung aus ihm mache (ebd., 77ff).
23 Bilanziert man das kirchliche Engagement unter macht- und gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten, so ist festzustellen, dass über die Institutionalisierung ihrer Sozialarbeit, insbesondere durch den Aufbau von Idiotenanstalten , die protestantischen Kirchen Unabhängigkeit zurückgewinnen und die katholische Kirche ihren gesellschaftspolitischen Ein uss wiederum ausbauen konnten (Schädler 2001, 50).
24 Heydorns Warnung, dass Bildung in Herrschaft und Unterdrückung jener umschlägt, die nicht an ihr teilhaben können, enthält die Feststellung der Bildungsbehinderung. Behinderte Menschen sind pädagogisch durch Behinderung ihrer Erziehung, ihres Lernens und ihrer Sozialisation gekennzeichnet (Antor/Bleidick 2001, 9).
25 Kast weist darauf hin, dass ein für die Heilpädagogik konstitutives Verständnis von Menschenwürde, das Lebensrecht und Bildungsrecht vereinigt, sich mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und dem Grundgesetz der BRD begründen lässt, daraus jedoch nicht zwingend abgeleitet werden kann und somit von appellativem Charakter ist (vgl. Kast 1999, 65ff).
26 z.B. Minimalintelligenz, Selbstbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit (vgl. Kast 1999, 91ff)
27 An anderer Stelle führt Theunissen aus, dass die kritisch-konstruktive Erziehungswissenschaft als eine passende Bezugswissenschaft für eine an der Empowerment-Philosophie orientierte Heilpädagogik und Behindertenhilfe gelten (Theunissen 2007, 145) kann und plädiert für eine Leitdisziplin der lebensweltbezogenen Behindertenarbeit (ebd., 16) als eine kritischre exiv beobachtende Wissenschaft des Erziehungs- und Sozialwesens (ebd., 15; zur Frage des Selbstverständnisses der Heilpädagogik vgl. auch Knauer 2000).
- Arbeit zitieren
- Marco Ferchland (Autor:in), 2008, Projektorientierte Bildungsangebote in der WfbM als Ausgangspunkt für Empowerment-Prozesse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131065
Kostenlos Autor werden



















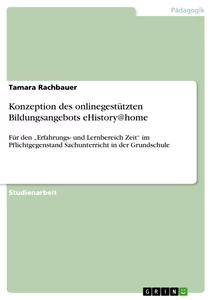
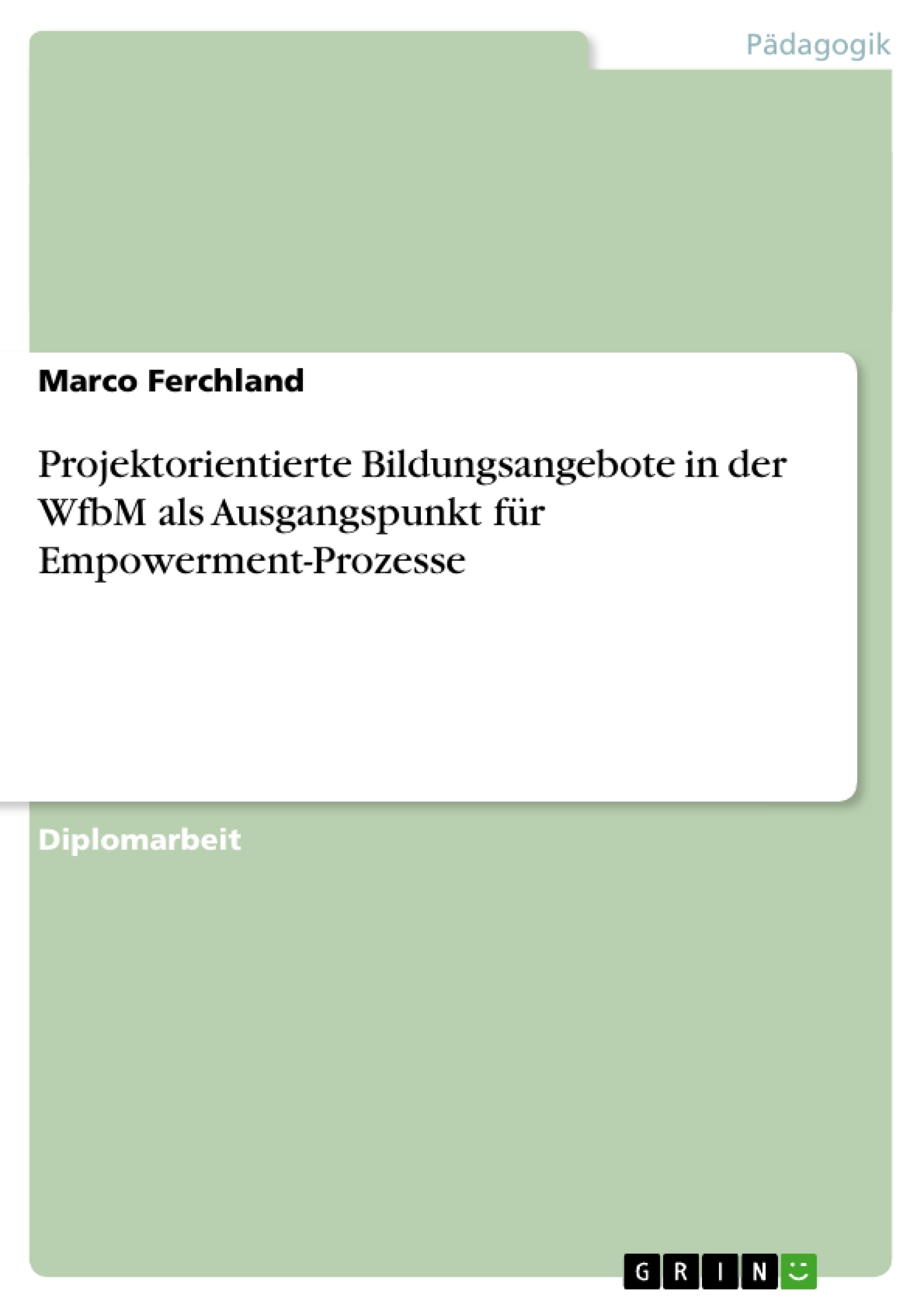

Kommentare