Extracto
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Bindung
2.1.1 Die Bindungstheorie nach John Bowlby
2.1.2 Entwicklung der Bindung
2.1.3 Die inneren Arbeitsmodelle
2.1.4 Bindung und Entwicklung
2.1.5 Bindung und Psychobiologie
2.1.6 Bindung und Psychoneuroimmunologie
2.2 Handlungsorientierung
2.2.1 Theorie der Handlungsorientierung von Julius Kuhl
2.2.2 Konzept der Handlungskontrolle
2.2.3 Handlungs- und Lageorientierung
2.2.4 Neuere Ansätze
2.2.5 Handlungs- und Lageorientierung im Kindesalter
2.3 Lebensqualität
2.4 Psychosomatische Erkrankungen
2.4.1 Definition Psychosomatik
2.4.2 Atopie, Immunsystem und Stress
2.4.3 Asthma Bronchiale
2.4.4 Neurodermitis
2.4.5 Adipositas
3 Methodik
3.1 Fragestellung und Hypothesen
3.2 Verwendete Erhebungsinstrumente
3.2.1 Der Separation-Anxiety-Test (SAT)
3.2.2 Der HAKEMP für Grundschüler
3.2.3 Der KINDL-Fragebogen zur Lebensqualität
3.3 Kritische Betrachtung der verwendeten Verfahren
3.4 Statistische Methoden der Auswertung
3.4.1 Verwendete Methoden
3.4.2 Problem der kleinen Stichproben
3.4.3 Konsequenzen für die Stichprobenplanung
3.5 Stichprobe
3.6 Ablauf der Datenhebung
3.7 Probleme bei der Umsetzung der Untersuchung
4 Ergebnissteil
4.1 Darstellung der Teilstichproben
4.1.1 Teilstichproben zu Bindungsverhalten
4.1.2 Teilstichproben zu Handlungsorientierung
4.1.3 Teilstichproben zu Lebensqualität
4.2 Auswertung und Darstellung der Ergebnisse
5 Diskussion und Zusammenfassung
5.1 Datendiskussion
5.2 Teststärke- und Problemdiskussion
5.3 Abschließende Betrachtung und Diskussion
5.4 Konsequenzen für spätere Studien
5.4.1 Erhöhung des Stichprobenumfangs
5.4.2 Erhöhung der Effektstärke
Literaturverzeichnis
Anhang
1 Einleitung
Die Erkrankungen Neurodermitis, Adipositas und Asthma Bronchiale werden von vielen Menschen als typische Zivilisationskrankheiten bezeichnet. Diese Meinungen sind häufig von Argumenten, wie: „Früher gab es diese Krankheiten nicht!“ oder der Behauptung: „Die Kinder wachsen viel zu behütet auf!“, begleitet. Aber zeitgleich wird von unserer Gesellschaft und den Eltern sehr viel Aufwand betrieben, Kinder vor Krankheiten aller Art zu schützen. Extreme Sauberkeit in der Umgebung der Kinder, streng reglementierte Essenszeiten oder das Verbot, mit dem kranken Nachbarskind zu spielen, sind nur einige Beispiele für solche Schutzmaßnahmen. Die derart besorgten Eltern können damit aber auch genau das Gegenteil erreichen, denn viele Krankheitsbilder werden nicht nur durch unsere genetische Veranlagung oder eine Ansteckung, sondern auch durch verschiedene soziale Komponenten gefördert. „Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen daraus ist, daß, welchen Einfluß auch immer genetische Unterschiede auf die Persönlichkeitsentwicklung und Psychopathologie haben mögen, doch Umweltfaktoren…zweifelsfrei einen bedeutsamen Einfluß ausüben.“ (Bowlby,1997, S.19)
Kinder lernen durch Erfahrungen, verschiedene Situationen und die von ihnen ausgehende Gefahr einzuschätzen. Dadurch wird die Fähigkeit zur Bewältigung externer und interner Anforderungen mitgeprägt. Nach Bowlbys Theorie stellt das Verhalten der Eltern einen solchen Umweltfaktor dar. Die fehlende oder falsche Reaktion der Bezugsperson bewirkt Stress, der manchmal bis zu traumatischen Erfahrungen führen kann (Bowlby, 1997). Die mit diesem Stress verbundenen physio- und psychologischen Prozesse können dann als Auslöser für eine überzogene Immunreaktion dienen, die auch passive Bewältigung (Birbaumer, Schmidt, 2003) genannt wird. Andererseits kann es zu unangepasstem Bewältigungsverhalten, wie unkontrolliertem Essen, kommen. Die sichtbaren Ergebnisse dieser Reaktionen bezeichnet man auch als psychosomatische Erkrankungen.
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Bindung
2.1.1 Die Bindungstheorie nach John Bowlby
Die Theorie über das Bindungsverhaltenssystem (Attachment System) beruht auf dem bindungstheoretischen Konstrukt des Psychoanalytikers John Bowlby (1975). Es entwickelt sich parallel zum motorischen Erkundungssystem und sorgt dafür, dass ein Kind nicht in Gefahr gerät oder verloren gehen kann (Rauh, 2002). Haben Kinder in den ersten Lebensjahren ein Minimum an Interaktion mit anderen Personen, bildet sich eine personenspezifische Bindung aus. Nach Bowlby ist Bindungsverhalten nicht immer aktiv und sichtbar. Das „Attachment System“ bestehend aus Verhalten, Emotion und Motivation zeigt sich nur in subjektiv unsicheren Situationen, in denen das Kind die Sicherheit der Bezugsperson benötigt. Diesen Schutz erlangt es durch das Suchen der Bindungsperson, durch Hinkrabbeln, Anschmiegen, Festklammern, Schreien, Weinen oder Anlächeln (Oerter & Montada, 2002). Ziel des Kindes ist es, Kontakt mit der Bindungsperson herzustellen und deren Trost und Unterstützung zu erhalten. Die Stärke dieses im Alter von zwei Jahren am besten beobachtbaren Bindungsverhaltens ist von Erreichbarkeit bzw. Reichweite der Fürsorgeperson, sowie der empfundenen Belastung abhängig. Bindungsverhalten besteht demzufolge aus einer physischen (tatsächlich vorhandene Situation) und einer psychischen (subjektive Wahrnehmung der Situation) Komponente. Bowlby beschreibt das typische Muster von Interaktion zwischen Eltern und Kind als die Erkundung der Umgebung von einer sicheren Basis aus: „Eine weitere wesentliche Komponente der menschlichen Natur ist der Drang, die Umwelt zu erkunden, zu spielen, und an verschiedenen Aktivitäten der Gleichaltrigen teilzunehmen. Dieses Verhalten ist antithetisch zum Bindungsverhalten. Wenn eine Person gleich welchen Alters sich sicher fühlt, wird sie sich sehr wahrscheinlich erkundend von ihrer Bindungsfigur wegbewegen. Wird sie erschreckt, ängstlich, müde oder fühlt sie sich unwohl, fühlt sie ein starkes Bedürfnis nach Nähe“ (1997, S. 21). Sind die Kinder zu jung, um die zurückgelegten Distanzen selbständig schnell zu reduzieren, oder sich der Sicherheit durch die Bindungsperson zu vergewissern, kann auch eine Fürsorgeperson diese Aufgabe übernehmen. Durch die richtige Reaktion auf die Signale des Kindes bleibt das Bindungssystem stabil und das Erkunden der Umwelt kann fortgesetzt werden. Bowlby bezeichnet deshalb das Bindungsverhaltenssystem als Steuersystem zur Herstellung einer „äußeren Homöostase“, da dieses Verhalten die Bindungsperson beeinflusst, eine Handlung zu vollziehen, die dem Kind Trost und Sicherheit gewährleistet.
Evolutionär betrachtet ist das Bindungsverhalten von unschätzbarem Wert, um den Nachkommen Sicherheit und ein erfolgreiches Aufwachsen zu ermöglichen. Da der Mensch in seiner Entwicklung den Gefahren der Umwelt schutzlos ausgesetzt ist, benötigt er eine Bezugsperson, die in Notfallsituationen schnell reagiert. Dies wird umso deutlicher, wenn wir nicht nur die Gefahren einer Industrienation betrachten, sondern die eines Landes der dritten Welt, die den Anforderungen unserer evolutionären Entwicklung wesentlich ähnlicher sind.
Kinder entwickeln bis zum fünften Lebensjahr verschiedene interne Modelle (inner working models) über sich selbst und ihre Umgebung. Diese Modelle beruhen auf den gesammelten Erfahrungen und Informationen ihrer Umwelt. Je zutreffender das Arbeitsmodell in der entsprechenden Situation ist, desto angepasster und effektiver ist dann auch das Verhalten. Auch die Bezugspersonen entwickeln solche Modelle im Umgang mit dem Kind. Sie sind Grundlage für ein soziales Miteinander und die erfolgreiche Entwicklung der Handlungs- und Bewältigungsstrategien. Diese Modelle entstehen in Abhängigkeit der verschiedenen Beziehungen und Bindungen zu anderen Personen. So kann das Kind eine unsichere Bindung zur Mutter aufbauen und eine sichere Bindung zum Vater. Haben sich diese Modelle dann verfestigt, bestimmen sie das Verhalten der Person auch im späteren Leben (Spangler & Zimmermann, 1997).
2.1.2 Entwicklung der Bindung
Die Entwicklung der personenbezogenen Bindung unterliegt nach Bowlby (1975) mehreren Phasen. Er gründet seine Einteilung auf das Erlangen der erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten mit fortschreitendem Alter. Kinder sind unmittelbar nach der Geburt in ihren Kommunikationsfähigkeiten stark eingeschränkt. Das Aussenden von Signalen beschränkt sich auf Verhalten, wie Schreien, Saugen und Festhalten. Mit zunehmendem Alter erweitern sich täglich die Möglichkeiten des Kindes. So kann es wenige Zeit nach der Geburt bereits gezielt lächeln, dann kriechen und später auch sprechen. Mit diesen Fähigkeiten geht die Entwicklung des Bindungsverhaltens einher, das Bowlby in vier Phasen ohne klare Abgrenzung einteilt:
1. Phase: Orientierung und Signale ohne Unterscheidung der Figur
Diese Phase dauert bis etwa zwölf Monate nach der Geburt. Das Baby orientiert sich auf beliebige Personen seiner Umgebung und verlängert durch sein Verhalten die Zeit, die es mit einer Person verbringt.
2. Phase: Orientierung und Signale, die sich auf unterschiedene Personen der Umgebung orientieren
In dieser bis etwa zum sechsten Monat dauernden Phase nutzt das Kind sein Verhaltensrepertoire in Abhängigkeit von der mit ihm interagierenden Person. Es beginnt sich besonders stark an der Mutter zu orientieren.
3. Phase: Aufrechterhalten der Nähe zu einer unterschiedenen Figur durch Signale und Fortbewegung
Bis zum Alter von zwei bis drei Jahren zeigt das Kind in dieser Phase eine deutliche Bindung an die Mutterfigur. Es folgt ihr soweit wie möglich und zeigt an die Person der Mutter gebundene Reaktionen bei Trennung und Rückkehr. Andere Personen nehmen eine weniger zentrale Rolle ein. Fremde werden mit Vorsicht betrachtet und lösen teilweise auch Alarm- und Rückzugsreaktionen aus.
4. Phase: Bildung einer zielkorrigierten Partnerschaft
Der Beginn der 4. Phase ist nicht sehr genau zu bestimmen. Inhaltlich interpretiert sie Bowlby jedoch so, dass das Kind die Motive des Handelns der Mutter erkennt. Damit ist es in der Lage, eine wesentlich komplexere Kommunikation mit ihr aufzubauen, denn es erkennt die verschiedenen Gesetzmäßigkeiten des Handelns, um eigene und fremde Ziele zu erreichen.
Eine ähnliche Unterteilung findet sich auch bei Ainsworth et al. (1978) und Ainsworth (1985).
Nachdem sich das Kind im ersten Lebensjahr eine hauptsächliche Bindungsfigur gewählt hat, meistens die Mutter, empfindet es eine subjektive Trennung von ihr als Belastung. In dieser Situation wird das Bindungssystem aktiviert und sorgt mit dem Bindungsverhalten für die Aufmerksamkeit und Fürsorge durch die Bezugsperson. Bindungsverhalten ist also das Werkzeug, um sich der Unterstützung und Sicherheit der Fürsorgeperson zu vergewissern. Unterstützung und Sicherheit sind die Grundlagen für das Erkunden der Umwelt.
2.1.3 Die inneren Arbeitsmodelle
Wie bereits erwähnt, entwickelt das Kind eine innere Repräsentation („inner working model“) über die Bezugsperson, sich selbst und die Situation. Dieses Modell ermöglicht es ihm, eine Situation vorauszuplanen und Ereignisse gedanklich vorwegzunehmen. Man könnte auch sagen, es simuliert mit seinen Mitteln die reale Welt. Je besser die Simulation der Realität entspricht, desto angepasster ist das eigene Verhalten und umso geringer die wahrgenommene Belastung. Diese „inner working models“ oder auch Arbeitsmodelle sind relativ stabil und begleiten uns bis zum Tod (Spangler & Zimmermann, 1997). Basierend auf dem erlangten Wissen über zwischenmenschliche Beziehungen bestimmen sie unser Handeln und unsere Gefühle. Dabei beinhalten sie selber affektive und kognitive Elemente (Bretherton, 1985) und sind maßgeblich an der Entwicklung von persönlichen Regeln beteiligt.
Zur Ermittlung des Arbeitsmodells führten Ainsworth und Wittig (1969) den Fremde-Situations-Test (FST) in die Bindungsforschung ein. Mit diesem wurde bei ein- bis zweijährigen Kindern das Bindungsverhalten in belastenden Trennungssituationen beobachtet und anschließend einem Bindungsstil zugeordnet. Abgeleitet aus diesem Test wurden weitere Untersuchungen (z. B. Fremmer-Bombik, 1987, Wartner, Grossmann, Fremmer-Bombik & Suess, 1994, Mehldau, 1989) durchgeführt und vier Bindungsmodelle/ -stile bestimmt:
a.) sicherer Bindungsstil
Ein sicher gebundenes Kind zeigt in einer subjektiven Trennungssituation wenig Belastung. Die Verfügbarkeit der Mutter gilt als gesichert, selbst wenn diese über einen längeren Zeitraum nicht anwesend ist. Das Arbeitsmodell dieser Kinder beinhaltet das Wissen, um den positiven Ausgang der Trennung, wenn die Mutter wieder kommt. Man könnte sagen, die negativen und beängstigenden Gefühle werden durch die von der Mutter gegebene Sicherheit ausgeglichen. Im Fremde-Situations-Test nehmen diese Kinder nach Rückkehr der Mutter schnell Kontakt mit ihr auf, finden Trost und beruhigende Worte. Die positiven Erwartungen des Kindes werden durch das Verhalten der Mutter bestätigt.
b.) unsicher-ambivalenter Bindungsstil
Für ein unsicher-ambivalent gebundenes Kind ist die Bindungsfigur unberechenbar. Es kann das Verhalten der Mutter nicht eindeutig zuordnen und hat dadurch Schwierigkeiten ein passendes Arbeitsmodell zu entwickeln. Während das sicher gebundene Kind darauf vertraut, dass die Mutter ständig Sicherheit gibt, kann das unsicher-ambivalent gebundene Kind dieses Wissen nicht in sein Arbeitsmodell integrieren. Deshalb versucht es, sich der Anwesenheit der Mutter ständig zu versichern und sucht deren Nähe. Nach einer Trennung verlangen diese Kinder die Nähe der Mutter, sind aber auch zornig über deren Verhalten. Das Bindungssystem ist ständig aktiviert und kurze Trennungen bedeuten eine starke Belastung. Die negativen Gefühle der Trennung können nicht durch eine positive Erwartung über den Ausgang der Situation kompensiert werden.
c.) unsicher-vermeidender Bindungsstil
Mary Ainsworth hielt das Verhalten dieser Kinder anfänglich für besonders reif. Nach der Betrachtung der Entwicklung der Kinder und dem Verhalten ihrer Mütter änderte sie allerdings diese Meinung, obwohl unsicher-vermeidende Kinder in einer Trennungssituation keine Anzeichen von Beunruhigung zeigen. Ihr Verhalten ist Teil einer Strategie zur Vermeidung von Zurückweisung. Die Erfahrung der Kinder beinhaltet das Wissen, dass die Mutter weder Sicherheit noch Trost spendet. Im Unterschied zu den unsicher-ambivalent gebundenen Kindern sind die unsicher-vermeidenden Kinder von diesem zurückweisenden Verhalten überzeugt. Kinder mit diesem Bindungsstil zeigen sich sehr distanziert. Mit möglichst kurzen Antworten und zurückhaltendem Verhalten vermeiden sie eine mögliche Zurückweisung und damit auch die Enttäuschung.
d.) unsicher-desorganisierter Bindungsstil
Zu den bereits genannten Bindungsstilen bildet dieser später entwickelte Typ eine stilübergreifende Komponente. Eine Desorganisation kann also zusätzlich zu einem bereits vorhandenen Modell auftreten. Sichtbar wird dieser Stil durch auffälliges und schwer zuzuordnendes Verhalten wie Grimassen schneiden oder plötzliches Erstarren. Scheinbar haben die Kinder keine adäquate Verhaltensmöglichkeit in der auftretenden Situation. Das Verhalten weist auf andauernde Schwierigkeiten in der Verhaltensregulation und der Entwicklung neuer Strategien. Ainsworth und Eichberg (1991) vermuteten eine ständig bestehende Aktivierung des Bindungssystems der Mutter, möglicherweise bedingt durch ein Trauma o. ä. Der Umgang mit diesem nicht zu verarbeitendem Trauma führt zu einer desorganisierten Bindung mit dem eigenen Kind.
Das Bindungsmodell wird je nach Alter unterschiedlich sichtbar. Während ein etwa einjähriges Kind sein Arbeitsmodell direkt umsetzt und der Beobachter direkt aus der Handlung schließen kann, verschlüsselt ein sechsjähriges Kind sein Arbeitsmodell im verbalen und nonverbalen Dialog mit der Mutter oder Bezugsperson. Ein Erwachsener zeigt sein Arbeitsmodell unter anderem dadurch, wie er über bindungsrelevante Themen redet.
2.1.4 Bindung und Entwicklung
Da die Bindungsforschung seit über 40 Jahren konsequent vorangetrieben wird, konnten verschiedenen Längsschnittstudien die Stabilität der Bindungsmuster überprüfen. Diese ist umso interessanter da Bowlby, Ainsworth und Main (Rauh, 2002) das Bindungsverhalten als einen Prädiktor für spätere Beziehungen zu Vertrauenspersonen betrachten.
Bindungsqualität gilt als relativ stabiles Merkmal. Zeigten Kinder als Einjährige ein sicheres Bindungsverhalten, waren sie auch im Kindergarten und der Grundschule kompetenter. Dies zeigte sich im Konfliktmanagement und geringeren Verhaltensproblemen (Rauh nach Bohlin, G., Hagekuhl, B. und Rydell, A., 2000). Nach Grossmann und Grossmann (2001) ist die Bindungsklassifikation auch im Jugendalter konstant. Bewertungen des Verhaltens der Bindungspartner im Abstand von zehn Jahren (sechstes und sechzehntes Lebensalter des Kindes) zeigten hohe Stabilität.
Ein Wechsel von sicherem zu unsicherem Bindungsmuster erfolgte oft nur bei schwerwiegenden Lebensereignissen (Zimmermann et al., 2000). Der umgekehrte Fall, eine Veränderung von unsicher zu sicher gebunden, war weniger oft mit äußeren Lebensumständen korreliert (Rauh, 2002). Es wird vermutet, dass die Identitätserarbeitung den Jugendlichen die Möglichkeit gibt, unabhängig von bedeutenden Lebenseinschnitten, ein stabileres inneres Arbeitsmodell aufzubauen.
2.1.5 Bindung und Psychobiologie
Für die Erklärung des Zusammenhangs von Verhaltensebene und physiologischer Ebene gibt es zwei wesentliche Theorien. Das Aktivierungsmodell von Lindsley (1970) postuliert eine Korrelation zwischen den beiden Ebenen. Demnach erfolgt bei einer Aktivierung des Verhaltenssystems automatisch auch eine physiologische Aktivierung. Für eine bindungstheoretische Betrachtung eignet sich ein Copingmodell (Box 1) aber besser. In diesem Modell werden die kompensierenden physiologischen Reaktionen erst ausgelöst, wenn es auf der Handlungsebene keine weiteren Bewältigungsstrategien mehr gibt. Bowlby erklärt dies folgendermaßen: „In diesem Licht betrachtet, lassen sich die regulativen Systeme zur Aufrechterhaltung einer ständigen Beziehung zwischen dem Individuum und der ihm vertrauten Umwelt gewissermaßen als ´äußerer Ring´ lebenserhaltender Systeme sehen; sie ergänzen den ´inneren Ring´ von Systemen, welche die physiologische Homöostase aufrechterhalten“ (1973, S. 188).
Damit umschreibt Bowlby bereits Teile des Komplementaritätsprinzips von Fahrenberg (1983). Demzufolge kann der Organismus bei mangelnden Bewältigungsstrategien in der Verhaltensebene in seiner physiologischen Ebene eine Veränderung vornehmen. Dadurch wird ein physiologisch benötigtes Gleichgewicht wieder hergestellt. Dieses Prinzip konnte durch mehrere Untersuchungen bestätigt werden. Spangler und Scheubeck (1993) überprüften die Cortisolwerte zwei und vier Tage alter Säuglinge. Sie zeigten, dass bei geringer Orientierungsfähigkeit ein signifikant höherer Cortisolwert zu messen war als bei hoher Orientierungsfähigkeit. Gunnar, Larson, Hertsgaard, Harris und Brodersen führten 1992 Studien mit neun Monate alten Kindern durch. Dazu wurden diese für 30 Minuten von ihrer Mutter getrennt und durch eine Betreuerin versorgt. Wenn die Betreuerin sich nur um die nötigsten Maßnahmen der Versorgung kümmerte, stieg der Cortisolwert der Kinder an. Eine signifikante Reduzierung erfolgte erst bei einer warmherzigen und aufmerksamen Zuwendung. Auch in anderen Situationen sind die physiologischen Reaktionen nachweisbar. Spangler, Schieche, Ilg, Maier und Ackermann (1994) fanden bei drei, sechs und neun Monate alten Kindern häufiger einen Cortisolanstieg in freien Spielsituationen, wenn die Mutter „unfeinfühlig“ war. Kinder von Müttern mit einfühlendem Verhalten zeigten diesen Cortisolanstieg seltener. Interessanterweise fanden sie keinen signifikanten Zusammenhang zwischen äußerer Erregung, wie Schreien oder anderen Erregungssignalen, und dem Cortisolwert. Damit hat sich Lindsleys Aktivierungsmodell für diesen Fall als nicht haltbar erwiesen. Entscheidend für diese physiologischen Stressreaktionen sind den Untersuchungen zufolge nicht die Stressoren selber, sondern die vorhandenen Ressourcen der Person.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Box 1: Exkurs „Coping“
Für die vorliegende Untersuchung ist besonders der Zusammenhang zwischen Bindungsverhalten und einer physiologischen Reaktion interessant. Spangler und Grossmann konnten 1993 bereits verschiedene Nebennierenaktivitäten in Abhängigkeit von der Bindungsqualität nachweisen. Unsicher gebundene und desorganisierte Kinder wiesen in einer Trennungssituation einen höheren Cortisolspiegel als ihre sicher gebundenen Altersgenossen auf. Bei diesen zeigte sich in einer zweiten Trennungssituation sogar ein leichter Rückgang des Cortisols. Wie in den späteren Untersuchungen von Spangler et al. (1994) war der gemessenen Cortisolwert nicht durch äußere Erregung vorhersagbar. Entgegen dem biologisch bestimmten Stressniveau erschienen die unsicher gebundenen Kinder relativ ruhig und ausgeglichen. Die sicher gebundenen Kinder zeigten ihr Unwohlsein durch Schreien und anderes Verhalten. Weitere Untersuchungen können diesen Zusammenhang allerdings nicht bestätigen. So fanden Gunnar, Mangelsdorf, Larson, Hertsgaard, (1989) keinen Unterschied in der gemessenen Cortisolmenge in Abhängigkeit von den klassischen Bindungstypen nach Ainsworth (1969). Allerdings beachteten sie nicht, dass mindestens 15 Minuten benötigt werden, bevor die cortisolproduzierenden Nebennierenrinden reagieren können.
2.1.6 Bindung und Psychoneuroimmunologie
Die Psychoneuroimmunologie beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Belastungen oder Stressoren auf das Individuum. Dabei betont sie die Bedeutung früher Kindheitserfahrungen. Coe, Lubach und Ershler (1994) vermuten, dass massive Belastungen während der kindlichen Entwicklungsphase lang anhaltende Konsequenzen auf die Immunfunktionen des Körpers haben. Die Vulnerabilität für Krankheiten wie Asthma oder Magen-Darm-Infektionen erhöht sich, da die Ausdifferenzierung und Reorganisation des Immunsystems gestört ist. Unterstützt wird diese These durch Untersuchungen mit Totenkopf- und Rhesusäffchen. Nach der Trennung der Jungtiere von ihrer Mutter wiesen die Tiere eine drastische Veränderung im Immunsystem auf. Einige der Veränderungen waren bis zu zwei Wochen nach der Trennung immer noch nachweisbar (Laudenslager, Reite & Harbeck, 1982). Diese Reaktion fiel umso stärker aus, je weiter die Affenkinder von ihrer bekannten Situation (Artgenossen, Sichtkontakt mit Mutter, Hören der Mutter) entfernt wurden. Rhesusaffen, die von Menschenhand aufgezogen wurden, also kein affentypisches Pflegeverhalten der Artgenossen erhielten, zeigten abweichende Immunparameter bis zum dritten Lebensjahr. Einige litten vermehrt unter Darminfektionen (Coe, 1993).
Schieche (1996) benutzte für seine Untersuchung von Kindern neben dem Cortisolwert auch das Immunglobulin A (IgA) im Speichel. IgA ist ein zentrales Element in der Körperabwehr von Antigenen (Tomasi, 1976). Es bildet durch sein Vorkommen in den Schleimhäuten eine Art erste Abwehrfront des Immunsystems. Langfristige Belastungen führen zu einer Verminderung des IgA (Henning, 1994), kurzfristige Belastungen und Entspannung zu einer Erhöhung (Kugler, 1994). Kugler konnte in seiner Metaanalyse nicht eindeutig klären, in welchem Zusammenhang das IgA auf kurze und milde psychische Stressoren reagiert. Schieche beobachtete diesen Zusammenhang in seiner Studie. Etwa zwei Stunden nach der Morgenmessung fand die erste Trennungssituation mit einer zu lösenden Aufgabe statt. In diesem Zeitraum reduzierte sich das IgA bei allen Kindern. Die folgende kurze Anstrengung führte bei den Kindern zu einem IgA-Anstieg. Einen Unterschied bezüglich des Bindungsverhaltens konnte er aber nicht eindeutig genug feststellen. Dies könnte aber auch an den von Schieche beschriebenen mangelnden Erfahrungen mit sekretorischem IgA als Indikator liegen, denn die IgA-Werte der Kinder feinfühliger Mütter waren immer niedriger als die Werte der restlichen Gruppe. Der gefundene Unterschied war nicht signifikant und bedarf einer zusätzlichen Studie. Des Weiteren zeigten sicher gebundene Kinder einen normalen tageszyklischen Abfall der Cortisolwerte. Bei den als unsicher eingestuften Kindern konnte dagegen eine Aktivierung des Nebennierenrindensystems (Cortisolproduktion) während der Aufgabenlösung festgestellt werden. Interessanterweise hatten die Kinder unfeinfühliger Mütter generell einen niedrigeren Cortisol- und höheren IgA-Wert, auch außerhalb der Testsituation.
2.2 Handlungsorientierung
2.2.1 Theorie der Handlungsorientierung von Julius Kuhl
Nach Kuhls Auffassung spielt der Wille ein zentrales Element in unserem Handeln. Diese Volition ist nicht unwesentlich von einer besonderen psychischen Kompetenz abhängig (Kuhl, 1996). Der Wille ist neben der Intelligenz oder der Motivation für eine Aufgabe, eine Eigenschaft die nur schwer dem Bewusstsein zugänglich ist. Er ist eine Art Koordinationszentrale, die nach eigenen Bedürfnissen die elementaren Systeme Temperament, Affekte, Verhaltensroutinen und Objekterkennung steuert. Dabei wird das Erreichen selbstgewollter Ziele optimiert.
2.2.2 Konzept der Handlungskontrolle
Kuhl (1983, 1984, 1987) unterscheidet in seiner Theorie der Handlungskontrolle zwischen volitionalen und motivationalen Prozessen. Durch die Motivation entscheidet sich die Person für eine Handlungsmöglichkeit. Mit dieser Entscheidung ist die gewählte Handlung aber noch nicht realisiert. Zur erfolgreichen Umsetzung finden verschiedene volitionale Prozesse statt, die die gewählte Handlungstendenz gegen andere Handlungstendenzen abschirmen und dadurch das optimale Erreichen des Zieles ermöglichen (Heckhausen, 1989). Kuhl nennt sieben Prozesse, die das Erreichen des Zieles „verteidigen“:
Selektive Aufmerksamkeit: Die Aufmerksamkeit wird auf alle Informationen gerichtet, die das augenblickliche Handlungsziel (Intention) unterstützen. Andere Informationen und Randbeobachtungen werden weniger oder gar nicht beachtet. Ein Beispiel ist das konzentrierte Lesen von Fachliteratur in der Bibliothek. Die benachbarten Studenten werden dabei nicht wahrgenommen.
Enkodierkontrolle: Ankommende Informationen werden tiefer verarbeitet, wenn sie für die Intention relevant sind. Enkodierkategorien, die mit der Intention in Zusammenhang stehen, befinden sich in erhöhter Bereitschaft.
Emotionskontrolle: Wenn der Person Emotionen bekannt sind, die ihre Intention unterstützen, wird sie versuchten diese zu erzeugen. Behindernde Emotionen werden unterdrückt.
Motivationskontrolle: Weil konkurrierende Intentionen das Erreichen des Zieles bedrohen, wird auf das vorgeschaltete Motivationssystem zurückgegriffen und eine neue, stärkere Motivation wie eine Belohnung für die beabsichtigte Intention erzeugt.
Umweltkontrolle: Es wird versucht, möglichst alle Ablenkungen, die dem Ziel entgegenstehen, zu vermeiden. Zusätzlich kann ein sozialer Druck erzeugt werden, um die Intention zu unterstützen. Während einer Diät können alle stark kalorienhaltigen Lebensmittel vermieden und zusätzlich eine Diätgruppe aufgesucht werden.
Sparsame
Informationsverarbeitung: Um schnell vom Planen und Bewerten der Intention zum Handeln zu gelangen, werden Informationen sparsamer verarbeitet. Damit werden ständiges Grübeln und das Zurückfallen in den Motivationszustand vermieden.
Misserfolgsbewältigung: Misserfolge werden nicht lange bewertet, sondern die Person orientiert sich auf neue Ziele.
Die Kontrollstrategien sind aber nicht ständig voll aktiv. Sie treten in Erscheinung, wenn die intentionsrealisierende Handlung behindert oder abgeschwächt wird. Eine solche Behinderung kann nicht nur durch innere konkurrierende Intentionen geschehen, sondern auch durch äußere Gegebenheiten.
Um eine Handlung zu vollenden, beschreibt Kuhl ein Ablaufschema der vermittelnden Prozesse. Zuerst werden nach einem Vergleich mit der aktuellen Situation im Langzeitgedächtnis handlungsbezogene Strukturen (Wünsche, Normen, Werte, Intentionen und Erwartungen) aktiviert. Wenn diese Intentionsformat aufweisen, werden sie ins Arbeitsgedächtnis übermittelt, und es kommen Kontrollstrategien bei deren Umsetzung zum Einsatz. Glaubt die Person, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein oder mangelnde Fähigkeiten zu besitzen, nutzt sie passendere Strategien oder ändert die Intentionen und das Handlungsprogramm (Heckhausen, 1989). Diese Kontrollstrategien können nach Heckhausen bewusst oder unbewusst ablaufen.
2.2.3 Handlungs- und Lageorientierung
Neben den Widersprüchen zwischen Intention und Handlungsrealisierung nennt Kuhl (1984, 1985) zwei übergeordnete Kontrollmodi. Die „Handlungsorientierung“ und die „Lageorientierung“. Sie stellen Zustände des Kontrollsystems dar, die einen erfolgreichen Abschluss der Handlung behindern oder fördern. Handlungsorientierung bedeutet die gerichtete Aufmerksamkeit auf den angestrebten Soll-Zustand, den gegenwärtigen Ist-Zustand, die Diskrepanz zwischen beiden und die Handlungsmöglichkeiten, um den Soll-Zustand zu erreichen. Sie ist eine optimale Form der Selbststeuerung gerade bei widrigen situativen Gegebenheiten (Fischer & Wiswede, 2002). Lageorientierung liegt vor, wenn die Aufmerksamkeit auf zwei der folgenden Sachverhalte gerichtet ist: Zielzentrierung, Misserfolgszentrierung, Planungszentrierung, Erfolgszentrierung oder –fixierung. Bei der Lageorientierung ist der Handelnde mit perseverierenden Kognitionen beschäftigt, die seine Handlungsmöglichkeiten hemmen. Um Probleme erfolgreich zu bewältigen und das gewünschte Ziel zu erreichen, ist die Handlungsorientierung geeigneter. Für die Entstehung eines lageorientierten Modus sind zwei Bedingungen entscheidend. Kurzfristige Lageorientierung entsteht wenn Inkongruenzen in der erhaltenen Information erst geklärt werden müssen. Langfristiger wirkt sich ein fehlendes Element in der Intention aus. Kuhl stellt sich dabei eine Intention aus mehreren Elementen vor. Fehlt eines dieser Elemente, z. B. die präzise Tätigkeitsgestaltung, kommt es zu einer misserfolgszentrierten Lageorientierung und perseverierenden Kognition. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich auf den Misserfolg und es entsteht eine Form der gelernten Hilflosigkeit. Handlungs- und Lageorientierung sind aber nicht nur situationsgebunden. Kuhl nennt auch die Möglichkeit persönlicher Unterschiede in der Neigung zu Handlungs- oder Lageorientierung.
2.2.4 Neuere Ansätze
2.2.4.1 Theorie der willentlichen Handlungssteuerung
Diese Theorie beschreibt die affektive Minimalarchitektur, um willentliches Handeln zu erklären. Sie stellt den Kern der für diese Untersuchung wichtigen Persönlichkeits-Interaktions-Theorie (PSI) dar (Kuhl, 2001). Ausgangspunkt sind die drei Funktionskomponenten der Selbststeuerung. Die (1) Aufrechterhaltung der Absicht ist notwendig, um zukünftige Handlungen zu realisieren. Kuhl verweist dabei auf neurobiologische Untersuchungen (Baddeley, 1986), die zeigen, dass bei der Vorbereitung und Aufrechterhaltung einer Handlungsplanung die selben Hirnregionen aktiv sind, wie bei Aufgaben, die das klassische Kurzzeitgedächtnis beanspruchen. Fuster (1995) geht sogar weiter und nennt zwei separate Arten von Arbeitsgedächtnissen. Eines ist mit den Kurzzeiterinnerungen des Geschehenen kombiniert und das andere ist eine Art zukunftsorientiertes System. Darin sind alle in Kürze durchzuführenden Handlungen gespeichert. Kuhl bezeichnet dieses zukunftsorientierte Gedächtnis auch als Komponente eines Absichts- oder Intentionsgedächtnisses. Dieses Intentionsgedächtnis stellt neben dem Arbeitsgedächtnis in Kuhls Theorie ein weiteres Gedächtnissystem mit den drei beschriebenen Funktionskomponenten der Selbststeuerung dar. Die (2) Ausführungshemmung und ihre (3) Aufhebung dienen der Kontrolle und Koordination der motorischen Ausführung einer bevorstehenden Handlung. Nach Kuhls Theorie ist das Arbeitsgedächtnis mit einer partiellen Voraktivierung anstehender motorischer Programme assoziiert. Er beruft sich dabei auf Untersuchungen von Schwartz et. al. (1991), die eine Aktivierung motorischer und prämotorischer Areale des Frontalhirns bei einer unmittelbar bevorstehenden Reaktion zeigen. Diese Aktivierung der Motorik muss aber bis zu einer passenden Gelegenheit gehemmt werden, um nicht unkontrolliert eine Reaktion auszulösen. Für diese Funktion wählt Kuhl den Begriff Ausführungshemmung. Um diese Hemmung aufzuheben, muss die dritte Funktion, die Aufhebung (Initiative), des Arbeitsgedächtnisses aktiviert werden.
In der Erklärung des Intentionsgedächtnisses findet sich kein Hinweis auf die Entstehung von Zielen, also wie die Absicht aussieht, ein Ziel zu erreichen. Ebenso wird auch nicht erläutert, woran das System erkennt, ob das Erreichte eine verwirklichte Absicht ist und was geschieht, wenn die Zielerreichung nicht festgestellt wird. Deshalb führt Kuhl weitere Gedächtnistypen ein. Das Extensionsgedächtnis bezieht sich auf das Kontext- und Selbstwissen und besteht aus den Funktionskomponenten Selbstrepräsentation, Selbsthemmung und Objekterkennung. Die (4) Selbstrepräsentation ist die Integration von Einzelempfindungen über die eigenen Bedürfnisse, Gefühle, Körperwahrnehmungen, Präferenzen, Werte und den Erfahrungskontext, in dem diese gemacht wurden. Um diese Aufgabe zu erfüllen, wird das Extensionsgedächtnis von einem ausgedehnten assoziativem Netzwerk unterstützt, das auch entfernte Bedeutungen oder Handlungsmöglichkeiten und ihr Bedürfnisbefriedigungspotential vermittelt. Den Nachweis dieser „Rückmeldungstheorie“ lieferten Damasio et al. 1991. Sie zeigten, dass Patienten mit einer Unterbrechung der Verbindung zwischen dem präfrontalem Kortex als Steuerzentrale und verschiedenen somatosensorischen Zentren Schwierigkeiten hatten, einfachste Entscheidungen zu treffen. Die fehlenden Signale der Muskelbewegungen reichten bereits aus, um durch mangelnde Körperwahrnehmung das Selbstsystem zu stören. Für das Extensionsgedächtnis scheint es nötig zu sein, dass die neu erlangten Gefühle, Erfahrungen und Emotionen ständig mit dem ausgedehnten Netzwerk an bestehenden Erfahrungen in Kontakt treten, um dieses zu aktualisieren und Handlungen effektiver zu gestalten. Ist dieses Netzwerk gestört, oder nicht ausreichend entwickelt, kann es zu einer Rigidisierung des Verhaltens kommen. Schuld daran ist die Tatsache, dass in diesem Fall ein erreichtes Handlungsergebnis nicht mit dem Selbstsystem verglichen werden kann. Es ist dann auch nicht möglich, ein potenziell erreichtes Ergebnis zu akzeptieren, dass hinreichend viele Randbedingungen der impliziten Selbstrepräsentation erfüllt. Um eine zu starke Konzentration auf das Selbst zu vermeiden und ein soziales Miteinander zu ermöglichen, benötigt das oben beschriebene System Funktionskomponenten zur Reaktion auf übergeordnete Direktiven. Hier nennt Julius Kuhl die (5) Selbsthemmung und die (6) Objekterkennung. Die Selbsthemmung ist eine erweiterte Form der Ausführungshemmung. Sie schiebt die Ausführung einer Absicht auf und ermöglicht so die Verfolgung eines Zieles, das nicht primär den eigenen Interessen und Bedürfnissen gilt. So ist die Bildung von Gruppen mit einem gemeinsamen Ziel, unabhängig von den persönlichen Interessen möglich. Bei der Objekterkennung wird die Verfolgung eigener Interessen zu Gunsten einer unmittelbar nötigen Handlung außer Kraft gesetzt. Dieses erfolgt beispielsweise beim Erkennen eines gefährlichen Tieres. Die einsetzende Fluchtreaktion ist nicht vom Vergleich eines Handlungsergebnisses mit den aktivierten Inhalten des Selbstsystems gesteuert.
Die Theorie der willentlichen Handlungssteuerung unterscheidet zwischen zwei Formen der „Bahnung“ und zwei Formen der „Hemmung“ von Willensfunktionen. Neurobiologen beziehen diese Hemmung und Bahnung auf die Hemmung oder Aktivierung einer im präfrontalen Kortex lokalisierten Steuerzentrale. Um das Zusammenwirken der sechs Funktionskomponenten und das Prinzip von Hemmung und Bahnung besser zu verstehen, ist es nötig, den Einfluss der Komponenten auf vier kognitive Makrosysteme (Tab. 2.1) zu beschreiben. Diese Makrosysteme sind das Intentionsgedächtnis: IG, das intuitive Ausführungssystem: IVS, das die Intentionscodes in konkrete Verhaltensroutinen übersetzt, das Extensionsgedächtnis: EG und ein Wahrnehmungssystem: OES, das die Empfindungen aus den Sinnesmodalitäten vermittelt. Die selbstrepräsentativen Anteile des Extensionsgedächtnisses und die Inhalte des Intentionsgedächtnisses repräsentieren den „Willen“ und sind hochinferente Strukturen. Ausführungs- und Wahrnehmungssystem gehören zu den sensu-motorischen Operationen. Das OES stellt Wiedererkennbares durch eine Kontrasterhöhung zum Kontext aus diesem heraus. Es verwertet die mit dem Ziel zusammenhängenden Rückmeldungen und orientiert sich eng an den durch das EG definierten Erwartungen und Wünschen. Das IVS fügt Informationen der Sinnesmodalitäten zusammen und steuert damit intuitiv einsetzbare Verhaltensprogramme. Das EG sammelt alle nötigen Informationen von Einzelobjekten, Emotionen und erlebten Episoden. Diese fügt es zu einer Erlebnislandschaft zusammen, die dann als Basis für Emotionsbewältigung, Selbstmotivierung und -steuerung weiterer Emotionen dienen kann. Zusätzlich ist das EG mit einer umfangreichen Aufmerksamkeitsform vernetzt, die eine zum aktuellen Ziel passende Wahrnehmung verstärkt. Im Gegensatz zum EG ist das IG mehr mit dem analytischen Denken vernetzt, also von Erleben und Steuerung der Emotionen abgekoppelt. Es beinhaltet neben Handlungsplänen auch Absichten und erhält aus den Aufmerksamkeitssystemen verstärkte Informationen, die zu den Zielen und Handlungsplänen passen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2.1: Funktionsprofile der vier persönlichkeitsrelevanten Makrosysteme nach Kuhl (1991)
2.2.4.2 Persönlichkeits-System-Interaktions-Theorie
Nachdem die Theorie der willentlichen Handlungssteuerung die vier Makrosysteme, ihre Funktionen und ihren Informationsaustausch beinhaltet, wird in der PSI-Theorie nach den systeminternen wechselseitigen Aktivierungsstärken gefragt. Kuhl geht hier von einer dynamischen Beziehung aus, deren Aktivierungsdynamik sich nicht nur auf die anderen Systeme, sondern auch auf deren Informationsaustausch auswirkt. Das gesamte System, bestehend aus den vier Makroebenen der willentlichen Handlungssteuerung sowie je einer positiven und negativen Affektkomponente, ist durch ein Fließgleichgewicht gekennzeichnet. Dabei haben die Affekte modulatorische Funktionen.
Wie in Abbildung 2.1 zu erkennen ist, bestehen zwischen dem Intentionsgedächtnis und dem Intuitiven Verhaltenssystem sowie zwischen dem Extensionsgedächtnis und der Objekterkennung hemmende Verbindungen. Über einen Eingriff in die bahnenden Formen des Willens (Selbstbestimmung und Zielumsetzung) sowie die Willenshemmung (Ausführungshemmung und Selbsthemmung) können die Affekte (A) die dynamische Beziehung der Makrosysteme manipulieren. Eine Herabregulierung des positiven Affekts A(+), wie z. B. Kummer oder Unlust, lässt eine stärkere Wirkung der Ausführungshemmung vom Intentionsgedächtnis auf das intuitive Verhaltenssteuerungssystem zu (1. Modulationsannahme). Verstärkt sich der positive Affekt, z. B. bei einem Erfolgserleben, wird die Ausführungshemmung schwächer, und es kommt zur Handlung. Eine Reduzierung des negativen Affekts A(-) bahnt einen hemmenden Einfluss der Selbstrepräsentation auf die Objekterkennung (2. Modulationsannahme). Damit wird unter anderem eine übermäßige Sensibilisierung für die selbst- oder erwartungsdiskrepante Objektwahrnehmungen erreicht. Die Selbsthemmung unterbindet den Zugang zur integrierten Selbstpräsentation. Eine Überfunktion dieses Mechanismus kann zu einer dauerhaften Blockade dieses Zugangs führen. In Abbildung 2.1 ist diese Selbsthemmung durch A - dargestellt. Der Affekt reduziert die schon vorhandene hemmende Wirkung des Selbstsystems auf die Objekterkennung. Dadurch wird die Wahrnehmung unerwünschter Objekte reduziert und so der Einfluss der auf Erfahrung beruhenden Erwartungen abgeschwächt. Wird die Hemmung durch A - stärker, kann das Selbstsystem ungewollte Wahrnehmungen und Gedanken immer schlechter unterbinden. Mit dem Fragebogen zur Handlungsorientierung HAKEMP-90 (Kuhl, 1994) kann neben der „Handlungsorientierung nach Misserfolg“ diese „Misserfolgsorientierte Lageorientierung“ (LOM) erhoben werden. Die LOM stellt sich durch handlungslähmendes, nicht kontrollierbares Grübeln dar, denn das System kann durch eine Störung des Zugangs zur Selbstrepräsentation die Gedanken und Gefühle, die nicht zum Selbst passen und ungewollt sind, nicht erkennen und unterbinden. Eine weitere Form der Ausführungshemmung ist das ständige Nachdenken, was man gerne tun möchte, ohne die Kraft aufzubringen, die notwendigen Handlungsschritte einzuleiten. Diese Disposition zur Ausführungshemmung nennt Kuhl „Prospektive Lageorientierung“ (LOP) oder auch „Lageorientierung in der Entscheidungsphase“. Dabei kann durch den gehemmten Zugang zur Selbstrepräsentation die mit schwierigen Absichten verbundene Ausführungshemmung nicht wieder aufgelöst werden, und es kommt zur Handlungslähmung. Die Aktivierung einer Systemkomponente, z. B. des Intentionsgedächtnisses, muss aber nicht zwangsläufig zur Hemmung einer anderen Komponente, wie z. B. des positiven Affekts, führen. Der Verlust der willensbahnenden Energie kann durch eine dritte Komponente, z. B. der Selbstmotivation, kompensiert werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2.1: Formale Darstellung des Kerns der PSI-Theorie (gestrichelte Pfeile = Hemmung; durchgezogene Pfeile = Bahnung; A (+)= Hemmung positiver Affekt; A + = positiver Affekt; A (-) = Hemmung negativer Affekt; A - = negativer Affekt)
Intentions- und Extensionsgedächtnis sind hochinferente Volitionskomponenten. Sie haben die Kompetenzen zur Selbstbestimmung und Zielumsetzung. Wie gut diese Kompetenzen jedoch eingesetzt werden können, hängt von der Qualität der Ausführungshemmung und ihrer rechtzeitigen Lösung ab. Werden diese Selbststeuerungskompetenzen unter Stress genutzt, kommt es zu einer verminderten Selbststeuerungseffizienz und Selbstmotivierungskompetenz. Das Gleichgewicht der Systemkomponenten ist demzufolge eine elementare Bedingung für den Erhalt der Gesamteffizienz des Systems.
Abbildung 2.1 zeigt aus Platzgründen nicht alle Hemmungsrelationen. Deshalb werden vollständiger weise die sieben von Kuhl postulierten Modulationsannahmen (Relationen) erläutert:
1. Modulationsannahme: (Willensbahnungs-Annahme) Die Herabregulierung eines positiven Affekts A (+) hemmt die Verbindung zwischen IG und IVS. Dadurch werden die weitere Bearbeitung und Aufrechterhaltung von Handlungsabsichten gebahnt.
2. Modulationsannahme: (Selbstbahnungs-Annahme) Wird ein negativer Affekt A(-) herabgeregelt, wirkt der hemmende Einfluss der integrierten Selbstrepräsentation auf das Erleben inkongruenter Objektwahrnehmungen und Empfindungen.
3. Modulationsannahme: (Ausführungshemmungs-Annahme) Je stärker das „Intuitive Gedächtnis“ aktiviert ist, desto stärker entwickelt sich die Verbindung zwischen diesem und der „Intuitiven Verhaltenssteuerung“. Dadurch werden voreilige oder schlecht durchdachte Handlungsoptionen unterbunden.
4. Modulationsannahme: (Selbstberuhigungs-Annahme) In bedrohlichen Situationen führt die Aktivierung des Extensionsgedächtnisses mit den darin enthaltenen Selbstrepräsentationen zu einem erweiterten Überblick über Erfahrungen in vergleichbaren Situationen. Dies geschieht durch eine Dämpfung der negativen Affekte. Es kommt unter Umständen zur Integration neuer Erfahrungen in das Selbstsystem.
5. Modulationsannahme: (Selbstmotivierungs-Annahme) Die Aktivierung der Selbstpräsentation steigert auch die Aktivierung des positiven Affekts. Nach Kuhl könnte deshalb in Abbildung 2.1 auch eine durchgezogene Bahn zwischen EG und A + verlaufen. Dieser Kontakt zwischen dem Selbstsystem und dem subkognitiven Mechanismus der Affektsteigerung ist in Abhängigkeit von der Persönlichkeit unterschiedlich stark ausgeprägt. Ziel dieser Steigerung des positiven Affekts ist die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass eine Handlung umgesetzt wird, die mit einer relativ großen Zahl von Selbstaspekten im Einklang steht.
6. Modulationsannahme: (Selbstverwirklichungsannahme) Selbstentwicklung, Willenseffizienz und die kontinuierliche Elaboration von Planungswissen benötigen ein ausgewogenes Affektsystem. Die Regulation der positiven und negativen Affekte spielen in dieser Annahme eine entscheidende Rolle. Einseitige affektive Prägung verursacht eine Fixierung auf einen der beiden Affekte. Dadurch wird die Selbstverwirklichung gehemmt.
7. Modulationsannahme: (Intra- und intersystemische Penetrationsannahme) Je intensiver einer der Affekte aktiviert ist, desto komplexere Teilsysteme werden aktiviert. Diese Aktivierung ist mit einem assoziativen Netzwerk der Kognitionspsychologie vergleichbar (Kuhl, 2001).
2.2.4.3 Die PSI-Theorie und das Bindungskonzept von Bowlby
Für die Beantwortung der Frage, wie die Entwicklung der selbstgesteuerten Regulation der positiven und negativen Affekte verläuft, entwickelte Kuhl die Systemkonditionierungs-Hypothese. Basis bilden die Modulationsannahmen 4 und 5 sowie die Mechanismen der klassischen Konditionierung. Sie sagt aus, dass sich analoge Verbindungen auch zwischen psychischen Systemen bilden, wenn vor der Aktivierung des einen Systems ein anderes System ebenfalls hinreichend oft aktiviert wurde. Wenn also ein kleines Kind durch Schreien (Unwohlsein) oder Blickkontakt (Interesse) eine Aktivierung der subkognitiven Affektregulierung wie Beruhigung oder Ermutigung, das Objekt des Interesses zu erkunden, benötigt, sollte diese auch gewährt werden. Dadurch wird die Verbindung zwischen Selbstsystem und entsprechender Affektregulierung gestärkt. Wird das Kind älter, ist durch die Konditionierung keine affekterzeugende Person mehr nötig. Die Aktivierung des affektgenerierenden Systems erfolgt dann automatisch.
Vergleichbar mit anderen Ansätzen (Kohut, 1979, Neumann, 1980) postuliert die PSI-Theorie eine Persönlichkeitsentwicklung durch die Anpassung an das soziale Umfeld. Biologische, geistige und emotionale Entwicklung lassen sich als Prozess von der Fremdregulation durch Bezugspersonen hin zu einer Selbstregulation durch das Individuum beschreiben. Selbstregulation meint in der PSI-Theorie das Fühlen, das durch die Selbstrepräsentation auch auf die verschiedenen Subsysteme einwirkt. Fremdregulation bezeichnet die Durchführung wesentlicher Aufgaben durch Bezugspersonen, weil die betroffenen Kinder psychisch und physisch dazu noch nicht in der Lage sind. Ihre Bedürfnisse können nur durch verschiedenes Ausdrucksverhalten wie Schreien oder Blickkontakt gezeigt werden. Damit soll im Idealfall die gewünschte Verhaltensreaktion provoziert werden. Die Entwicklung von der Fremd- zur Selbstregulation erfolgt in abgrenzbaren Phasen mit dem plötzlichen Auftreten qualitativ neuer Verhaltensweisen. Ein Beispiel dafür ist der Übergang der Existenzsicherung von der Mutter zum Kind. Diese Situation ist mit der Trennungssituation Bowlbys identisch. Durch Schreien und Weinen versucht das Kind die Nähe der Sicherheit gewährleistenden Bezugsperson zu regulieren, denn die willkürliche Verhaltensorganisation des Kindes ist noch nicht ausgeprägt genug, um diese Aufgabe zu bewältigt. Damit die auftretende Belastung kontrollieren werden können, wenden die Kinder Strategien der Selbstberuhigung an. Ein Beispiel dafür sind Gedanken wie: „Mutter kommt gleich wieder, sie hat mich noch nie alleine gelassen“. Da die Erfahrungen des Kindes über die Fremdregulation der Bezugsperson individuell sind, entwickeln Kinder auch unterschiedliches Bindungsverhalten und Formen der Selbstregulation.
2.2.5 Handlungs- und Lageorientierung im Kindesalter
Kuhls Konzept scheint aber nur eingeschränkt auf Kinder übertragbar zu sein. Kraska (1993) beschreibt eine Untersuchung aus der Münchener Logic-Studie mit vier- bis sechsjährigen Kindern. Nach einer Einteilung der Kinder in „Handlungs-“ und „Lageorientiert“ wurde ihre Selbstregulierungseffizienz überprüft. Dazu ermittelten die Durchführenden die Differenz zwischen den Arbeitsleistungen ohne und den Leistungen mit dargebotener Zerstreuung. Die Lageorientierten waren dabei signifikant überlegen. Bezugnehmend auf einen mündlichen Bericht von Kuhl beschreibt Kraska die Kinder mit höherer Selbstregulierungseffizienz als ängstlicher und mit höheren Ansprüchen an sich selbst. Sie geben weniger leicht auf und erzeugen mehr Zuneigung bei Erwachsenen. Diese Kinder werden auch als tüchtiger und geschickter beschrieben. Kinder, die sich weniger am Ziel orientierten, drücken nach Kraska mehr negative Gefühle offen aus, vergleichen sich häufiger mit Anderen, drängen öfter nach Unabhängigkeit und kommen über belastende Ereignisse schneller hinweg. Sie wollen Anderen mehr gefallen, sind dabei selbstsicherer und bringen sich zur Geltung. Bei diesen Ergebnissen zeigt sich die Problematik des Kuhlschen Konzeptes bei Kindern. Vermutlich verstärken sich spezifische Erziehungsstile (Anpassung an Normen) und komplementäres Anpassungsverhalten der Kinder gegenseitig.
[...]
- Citar trabajo
- Daniel Pagels (Autor), 2003, Bindungsverhalten und Handlungsorientierung psychosomatisch erkrankter Kindern (Pilotstudie), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13092
Así es como funciona




















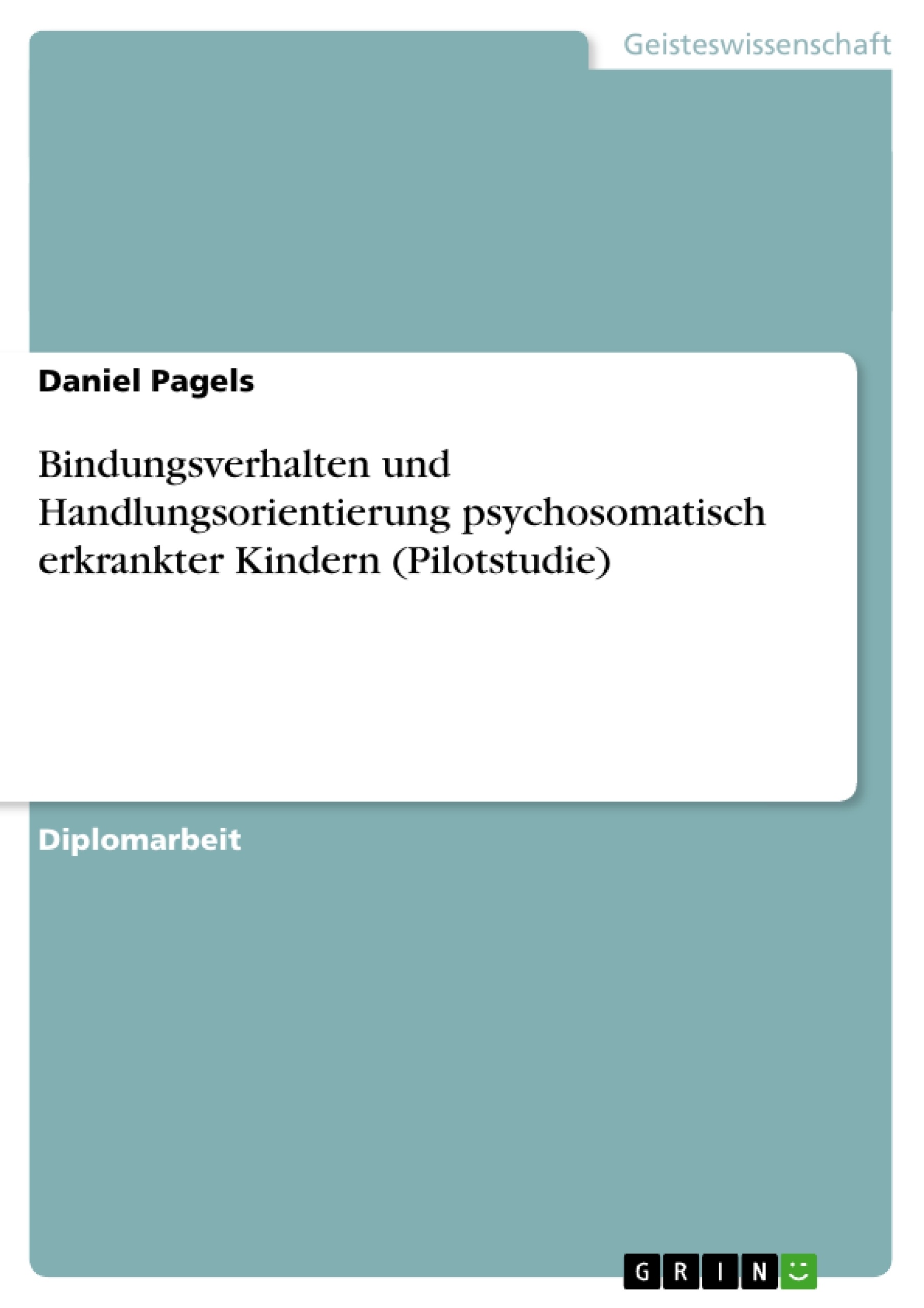

Comentarios