Leseprobe
Inhalt
Einführung
1. Short Message Service
1.1 Was ist Short Message Service?
1.1.1 Definition
1.1.2 Sozialdemographie
1.1.3 Forschungsstand in Deutschland
1.2 Alltägliche Nutzung von SMS und Nutzungsmotive
1.3 Soziale Bedeutung des SMS für Jugendliche
1.4 Einordnung des SMS zwischen mündliche und schriftliche Kommunikationsformen
1.4.1 Telefon
1.4.2 Mobiltelefon
1.4.3 Brief
1.4.4 E-Mail
1.4.5 Chat
2. Kommunikationsregeln
2.1 Kommunikation als regelgeleitetes soziales Handeln
2.1.1 Merkmale von Regeln
2.1.2 Funktion von Regeln
2.2 Regelgeleitete mediatisierte interpersonale Kommunikation
3. Methodik
3.1 Rekonstruktion von Regeln
3.2 Formulierung von Regeln
3.3 Erhebungsmethoden für die Rekonstruktion von Regeln
3.3.1 Experteninterview
3.3.2 Begründung für qualitatives Experteninterview
3.4 Methodische Gütekriterien und Auswertungsvorgehen
4. Rekonstruktion von Medienregeln
4.1 Medienregeln für „alte“ Medien
4.1.1 Medienregeln für die Telefonkommunikation
4.1.2 Medienregeln für die telefonische Kommunikation über Mobiltelefon
4.1.3 Medienregeln für die Briefkommunikation
4.1.4 Medienregeln für die E-Mail-Kommunikation
4.1.5 Medienregeln für die Chat-Kommunikation
4.2 Prognose von Medienregeln für die SMS-Kommunikation
4.3 Rekonstruktion von Medienregeln für die SMS-Kommunikation
5. Medienregeln für die SMS-Kommunikation
5.1 Auswertung der Interviews
5.1.1 Rekrutierung von Experten
5.1.2 Zusammenfassung der Interviews
5.2 Konstruktion von Typen der SMS-Kommunikation
5.3 Medienbezogene Regeln für die SMS-Kommunikation
5.3.1 Wahrnehmung von SMS
5.3.2 Gelegenheiten für die SMS-Kommunikation
5.4 Prozedurale Regeln für die SMS-Kommunikation
5.4.1 Höflichkeitsregeln
5.4.2 Inhaltsregeln
6. Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang 1: SMS-Texte
Anhang 2: Leitfaden
Anhang 3: Transkriptions – Legende
Anhang 4: Selbstständigkeitserklärung
Anhang 5: Interviews
Einführung
Der SMS (Short Message Service) ist eine Form der elektronisch vermittelten schriftlichen interpersonalen Kommunikation zwischen zwei Mobiltelefonen. Niemand hatte vorausgesehen, dass sich diese Art der schriftlichen Kommunikation, die von den Betreibern der Mobilfunknetze anfangs als kostenloser Zusatzdienst angeboten wurde, einmal einer derartigen Beliebtheit erfreuen könnte, wie sie es heute tut. Besonders in der Bevölkerungsgruppe der Jugendlichen ist sowohl der Handy-Besitz als auch die Verwendung von SMS in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen.
Für die meisten Menschen gehört die Kommunikation via SMS heute zum Alltag, der Besitz eines Handys ist nichts besonderes mehr, sondern eine Selbstverständlichkeit, ohne die eine effektive Organisation des Alltags kaum mehr möglich scheint.
Der Forschungsstand in den Sozialwissenschaften trägt diesem Phänomen besonders in Deutschland in keiner Weise Rechnung. Bei einer Sichtung der Literatur zu (technisch) vermittelter interpersonaler Kommunikation fällt auf, dass Medien wie das Telefon, der Brief oder neuerdings die E-Mail und das Mobiltelefon von der Soziologie und den Kommunikationswissenschaften grob vernachlässigt wurden und werden, während sie für die Alltagskommunikation z. T. schon seit Jahrhunderten selbstverständlich sind.
Wie und warum man telefoniert oder einen Brief schreibt, wissen die meisten Mitglieder unserer Gesellschaft; sie erlernen den korrekten Umgang mit diesen Medien während ihrer Sozialisation und wenden die Regeln, die deren Gebrauch bestimmen, meist unbewusst an.
Wie und zu welchen Anlässen man korrekt eine E-Mail schreibt oder mit dem Handy telefoniert, darüber wird zur Zeit noch heftig gestritten - Stichworte wie „Netiquette“ oder „Handy-Terror“ beleuchten die Diskussionen um einen angemessenen Umgang mit diesen Medien. Dies ist einerseits ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich für die „neuen“ Medien in der kurzen Zeit ihrer Existenz noch keine sozialen Normen oder Regeln herausbilden konnten, wie sie etwa für den Brief oder das (stationäre) Telefon existieren. Andererseits könnte man dies auch als Indiz dafür nehmen, dass sich durchaus Regeln herauszubilden beginnen, die aber von einem Großteil der Benutzer noch nicht übernommen worden sind - deren Regelübertretungen werden nun von den sie bereits Anwendenden heftig sanktioniert.
Eine erste Hypothese ist daher, dass solche Regeln für „neue“ Medien nicht eigentlich neu sind, sondern dass vielerorts die Regeln für den Umgang mit den „alten“ Medien einfach auf die „neuen“ Medien überschrieben worden sind. Der öffentliche Unmut über den Umgang mit neuen Medien könnte nun daher rühren, dass diese überschriebenen Regeln nicht ganz auf ihre neuen Anwendungsobjekte „passen“.
Da die „neuen“ Medien wie das Funktelefon, die E-Mail oder der SMS aber Gebrauchsmöglichkeiten aufweisen, die die „alten“ wie das stationäre Telefon oder der Brief nicht abdecken, ist die Herausbildung gänzlich neuer oder wenigstens aktualisierter Regeln unerlässlich.
Mein Hauptaugenmerk liegt in dieser Arbeit auf dem beliebtesten, öffentlich am wenigsten problematisierten, und von der Forschung am meisten vernachlässigten Kommunikationsmedium: dem SMS. Während sich für das Funktelefon und die E-Mail anhand von „Handy-Knigges“ und „Netiquette“-Benimmlisten die wichtigsten Regeln für den Umgang mit diesen Medien ansatzweise ausmachen lassen, fehlen solche Regeln für den SMS zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Trotzdem befleißigt sich ein wachsender Teil der Bevölkerung erfolgreich dieser Art der Kommunikation.
Meine Hypothese lautet daher, dass sich Medienregeln für den Umgang mit SMS schon herausgebildet haben müssen, die einen reibungslosen Ablauf solcher Interaktionen ermöglichen.
Um solchen Regeln auf die Spur zu kommen, ist es nötig, die Personen um Rat zu fragen, die am ehesten etwaige neue Regeln bereits anwenden: die Pioniere unter den SMS-Nutzern bzw. die „SMS-Junkies“. Diese Experten sind am wahrscheinlichsten unter den Jugendlichen anzutreffen.
Ziel dieser Arbeit ist es, durch Interviews mit einzelnen Jugendlichen, die sich selbst als SMS-Vielschreiber definieren, einen Einblick in die sozialen Gebrauchsweisen und Nutzungsmuster des SMS zu gewinnen und daraus folgernd Regeln für den Gebrauch dieses Mediums zu extrahieren.
Um dieser Erhebung eine sichere Basis zu schaffen, ist es zunächst nötig, den aktuellen Forschungsstand zur SMS-Kommunikation zusammenzutragen. SMS muss als eigenständige Kommunikationsform, die eng mit dem mobilen Telefonieren verbunden ist, zwischen mündliche (Telefon und Funktelefon) und schriftliche Medien (Brief und E-Mail) eingeordnet werden. Dabei soll zunächst geklärt werden, ob die kommunikativen Spezifika des SMS sowie seine Funktionen und Nutzungsmotive für die Alltagskommunikation im Vergleich mit anderen Medien einzigartig sind und ihm eine eigene „Nische“ zuweisen (vgl. Dimmick et al. 2000), oder ob die SMS-Nutzung ein Trend ist, der ebenso schnell wieder verschwinden kann.
Im nächsten Schritt soll versucht werden, aus den schon angesprochenen Ratgebern und der Fachliteratur heute geltende Medienregeln für (Funk-)Telefon, Brief und E-Mail abzuleiten. Aufgrund etwaiger Gemeinsamkeiten dieser Medien mit dem SMS könnten dann erste Prognosen über SMS-Regeln gestellt werden, da nach der o. g. Hypothese zunächst die „alten“ Regeln auf die „neuen“ Medien überschrieben werden. Diese Analyse soll hauptsächlich eine methodische Hilfe sein, um einen Leitfaden für die fokussierten Interviews erstellen zu können, da Etikette-Ratgeber eher „Soll-Regeln“ sammeln, an die sich halten muss, wer zu einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht gehören will. Diese Regeln können sich radikal von den „Ist-Regeln“ unterscheiden, die im kommunikativen Alltag gelten und den Akteuren oft nicht bewusst sind.
Die Experten-Interviews sollen im dritten Schritt klären, ob und welche der „alten“ Regeln für die SMS-Kommunikation gelten, und ob es schon zur Herausbildung von „neuen“, nur für diese Kommunikationsform gültigen Regeln gekommen ist. Hier wird die Betonung auf den „Ist-Regeln“ liegen, die (z. T. unbewusst) das Handeln bestimmen.
Die hier angerissene Methode kann natürlich keine repräsentativen Ergebnisse erzeugen. Diese Arbeit versteht sich vielmehr als eine explorative Studie, die erste Einblicke in ein von den Sozialwissenschaften noch völlig unerforschtes Gebiet gewähren möchte. Mit den hier geschaffenen Grundlagen sollten weitere Arbeiten zur Soziologie der interpersonalen Kommunikation und besonders der SMS-Kommunikation ermöglicht werden.
1. Short Message Service
1.1 Was ist Short Message Service?
1.1.1 Definition
Short Message Service (im folgenden immer SMS) bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch das Generieren und Versenden von Kurzmitteilungen von einem Mobiltelefon[1] zu einem anderen. Das Akronym SMS steht dabei auch für die Textnachricht an sich.
Ursprünglich wurde der SMS von den Mobilfunkanbietern verwendet, um ihre Kunden darüber zu benachrichtigen, dass sich in ihrer Mailbox (vergleichbar einem Anrufbeantworter) eine Mitteilung befindet. Als „Nebenprodukt des Mobiltelefonierens“ (Androutsopoulos/ Schmidt 2001, S. 1) wurde dieser Dienst anfangs sogar kostenlos angeboten, in Norwegen bis Ende 1998 (Ling 1999c).
Auf den ersten Blick scheint der SMS paradox: er stellt eine Möglichkeit der schriftlichen Kommunikation dar, deren Erzeugung und Empfang an den Gebrauch eines Mediums der mündlichen Kommunikation gebunden ist. Das Mobiltelefon wird so „vom Hörfon zum Sehfon“ (Drösser 1999).
Zunächst muss aber zwischen dem Mobiltelefon als Medium und dem SMS als Kommunikationsform unterschieden werden. Werner Holly definiert Medien als „konkrete, materielle Hilfsmittel, mit denen Zeichen verstärkt, hergestellt, gespeichert und/ oder übertragen werden können“ (Holly 1997, S. 65), wohingegen Kommunikationsformen „virtuelle Konstellationen“ (ebd.) von strukturellen bzw. semiotischen Merkmalen medial vermittelter Kommunikation sind. Kriterien zur Bestimmung einer Kommunikationsform sind nach Holly a) Zeichentyp, b) Kommunikationsrichtung und c) Kapazität zur Speicherung bzw. Übertragung. Weitere Kriterien, die von Runkehl et al. (1998) zur Abgrenzung der Kommunikationsmöglichkeiten E-Mail, Chat und Newsgroup eingeführt werden, sind d) Zeitlichkeit und e) Anzahl der Interaktionspartner. Anhand dieser Kriterien kann man den SMS nun näher beleuchten.
a) Die SMS-Kommunikation ist im wesentlichen schriftlich, auch wenn bei einigen Geräten das Versenden von Piktogrammen oder fertigen Logos möglich ist. Die Eingabe einer Textnachricht erfolgt über das Tastaturfeld eines Mobiltelefons. Die 26 Buchstaben des Alphabets sind dabei auf acht Tasten verteilt. Deshalb und da die Geräte im Zuge der technischen Entwicklung der letzten Jahre immer kleiner werden, erfordert das Eingeben von Text einiges Fingerspitzengefühl.
Eine Nachricht ist im allgemeinen auf 160 Zeichen inklusive Leerzeichen begrenzt (einige Geräte erlauben Kurznachrichten mit bis zu 460 Zeichen Umfang)[2]. Das lästige und zeitraubende Zusammenbasteln der Nachrichten, wobei für jedes Zeichen eine der Zifferntasten bis zu fünf mal gedrückt werden muss, wird seit der Einführung von Texteingabehilfen (T9, Z1) wesentlich vereinfacht.
Die technisch bedingte Kompaktheit der Nachrichten sowie die etwas gewöhnungsbedürftige Art der Texteingabe kann durchaus zum Problem werden. In der nicht repräsentativen Studie von Schlobinski et al. gaben je nach Altersgruppe zwischen 20% und 50% der befragten Besitzer eines Mobiltelefons an, sie würden nicht gerne per SMS kommunizieren, da die Texteingabe zu umständlich sei. Vereinzelt wird berichtet, dass Texteingabehilfen wie T9 durch abweichende Wortvorschläge den Schreiber dazu bringen, seine Nachricht umzuformulieren – ein Sieg der Technik über den Anwender (Höflich 2001, S. 14).
Über den Gebrauch von sogenannten „Emotikons“ in der SMS-Kommunikation wie [ :-) ] oder [ :-( ] wird in der öffentlichen Berichterstattung viel, in empirischen Studien dagegen wenig berichtet. Auch die berühmten kryptischen Abkürzungen ganzer Sätze, die eine Werbekampagne der BILD-Zeitung thematisierte („haduluaueibi?“[3] ), finden sich in keiner der Studien, die sich mit sprachlichen Inhalten von Kurznachrichten befassen.
Hauptsächlich für Besitzer von Nokia-Mobiltelefonen ist es aber möglich, mittels Sonderzeichen wie [ ( ], [ - ], [ _ ] etc. Piktogramme zu erstellen bzw. solche käuflich zu erwerben (Beispiele bei Schlobinski et al. 2001, S. 14). Anhand der Umsätze, die allein der Logo- und Klingeltonanbieter www.handy.de erwirtschaftet, lässt sich erkennen, dass diese Art der Kommunikation zumindest unter Jugendlichen sehr beliebt ist (Dörrzapf 2001).
Eine Umfrage des Xerox Research Centre Europe (XRCE) und des Xerox Palo Alto Research Centre (PARC) unter Jugendlichen zeigte, dass viele Kurzmitteilungen nicht verstanden werden, sei es, weil der Sender Abkürzungen und Ausdrücke gebraucht hat, mit denen der Empfänger nicht vertraut ist, oder weil Botschaften, wenn sie zu kurz gefasst wurden, zweideutig oder unverständlich werden können. Von Zeit zu Zeit scheint es für den Empfänger schwierig zu sein zu entscheiden, ob eine Nachricht ernst oder als Scherz gemeint ist (Grinter/ Eldridge 2001). Dies trifft zumindest bei den von Kasesniemi befragten finnischen Jugendlichen besonders auf Jungen zu: „Girls [...] criticize boys’ competency to interpret SMS messages. [They] say they must write their messages to boys in ,plain language’ without too many compressed expressions, references and suggestions“ (Kasesniemi/ Routiainen, unveröffentlicht).
b) Die Kommunikation via SMS ist im allgemeinen dialogisch, d.h. ein Verfasser sendet seine Nachricht an einen Empfänger, der daraufhin dem Verfasser antworten kann. In der nicht repräsentativen ethnographischen Erhebung von Androutsopoulos und Schmidt (2001) stehen 67% der erfassten SMS-Nachrichten in einem dialogischen Zusammenhang. Höflich/ Rössler (2001b) fanden in ihrer Befragung Jugendlicher eine Reziprozitätsnorm, die den Empfänger einer Nachricht in recht starkem Maß zu einer Antwort verpflichtete. Eine Antwort habe „nach Maßgabe der empfundenen Bedeutsamkeit einer Nachricht [...] in der Regel umgehend zu erfolgen“ (Höflich 2001, S. 14), 97% der befragten Jugendlichen stimmten dem zu (Höflich/ Rössler 2001b, S. 52).
c) Ist eine Nachricht erstellt, wird sie vom Mobiltelefon an das Service-Zentrum gesendet. Von dort aus wird innerhalb einer festgelegten Zeitspanne versucht, die Nachricht zuzustellen; dies dauert meist einige Minuten. Über die tatsächliche Zustellung der Textnachricht bekommt der Absender in den meisten Fällen (geräteabhängig) keine Information. Es kann z. B. passieren, dass der Empfänger sich in einem „Funkloch“ befindet, dass sein Mobiltelefon über die festgelegte Zeitspanne hinaus abgeschaltet war, dass er den Signalton seines Mobiltelefons nicht gehört hat. Der Absender hat keine Möglichkeit zu erfahren, ob seine Nachricht angekommen ist, bzw. warum vom Empfänger keine Reaktion erfolgt. Auch wenn man eine Nachricht erhalten hat, ist es immer möglich, sich durch Verweis auf technische Probleme vor einer Antwort zu drücken. Der SMS zeichnet sich in dieser Hinsicht durch eine hohe „Unverbindlichkeit“ (Androutsopoulos/ Schmidt 2001, S. 5) seitens des Empfängers aus. Mobiltelefone sind in der Regel nicht in der Lage, mehr als 15 Textnachrichten zu speichern. Eine neue Nachricht kann dann nur empfangen werden, wenn vorher ältere Nachrichten aus dem Speicher gelöscht wurden.[4]
d) Die Kommunikation mittels Textnachrichten ist im Gegensatz zum mobilen Telefonieren asynchron. Auf die Vor- und Nachteile, die sich daraus ergeben können, werde ich später zurückkommen.
e) Mittels SMS kommunizieren Individuen miteinander. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, eine Textnachricht einer Gruppe von Empfängern zukommen zu lassen oder an einem sogenannten SMS-Chat teilzunehmen, bei dem mehrere meist unbekannte Partner gleichzeitig als Sender und Empfänger aktiv sind.
Auch wenn der SMS als Kommunikationsform an ein Medium gebunden ist, hat er sich in den letzten Jahren vom Mobiltelefon als „Conditio sine qua non“ gelöst. Textmitteilungen können aus dem Internet an ein Mobiltelefon, vom Mobiltelefon an eine E-Mail-Adresse, an ein Faxgerät oder gar auf den Fernsehbildschirm gesendet werden[5].
Ein wichtiges Kriterium sind noch die Kosten. Jede versandte Textmitteilung wird vom Netzbetreiber einzeln in Rechnung gestellt und kostet je nach Tarif zwischen 0,08 und 0,20 Euro. Geht man davon aus, dass sich aus einer Nachricht oft ein Dialog entwickelt, kann diese Art der Kommunikation schnell teuer werden. Im allgemeinen wird das Versenden von Textnachrichten aber als relativ preiswert empfunden (Ling/ Yttri 1999). Als der Mobilfunknetzbetreiber T-D1 zu Anfang des Jahres 2001 die Preise für Kurznachrichten erhöhen wollte, brach ein öffentlicher Sturm der Entrüstung los, der das Unternehmen letztlich dazu veranlasste, seine Pläne wieder zurückzunehmen.
1.1.2 Sozialdemographie
Knapp zwei Drittel aller Deutschen (62%) telefonieren laut einer Forsa-Umfrage gegenwärtig mobil. Die Nutzung von Mobiltelefonen nimmt dabei mit wachsendem Einkommen zu und mit dem Alter ab. Sind es in der Gruppe der 18-29jährigen über 80%, telefonieren von den über 60jährigen immerhin noch ein Drittel mobil (O.N. 2002c).
Dabei ersetzt die mobile Kommunikation zunehmend die über das Festnetz geführte: Die Zahl der Mobilfunk-Anschlüsse stieg von 274 000 im Jahr 1990 auf knapp 57 Millionen im Jahr 2001 (O.N. 2002g).
Dieses starke Wachstum (allein im letzten Quartal 2000 gewannen die deutschen Operatoren 7,12 Millionen neue Kunden) liegt vor allem in der Einführung und aggressiven Vermarktung der Prepaid-Karten begründet, die inzwischen fast die Hälfte des Gesamtmarktes GSM besetzen und zum Großteil von Jugendlichen benutzt werden. Nach Angaben des Netzbetreibers Vodafone verschicken Inhaber von Prepaid-Karten mit monatlich etwa 16 Nachrichten acht mal mehr Kurzmitteilungen als Vertragskunden (ebd.).
Kurznachrichten können in Deutschland seit 1994 mittels SMS verschickt werden. Die Zahl der Textmitteilungen stieg von 1998 bis 2000 um 2500%; zur Zeit senden die Deutschen etwa zwei Milliarden Nachrichten im Monat. Damit waren sie die unbestrittenen „SMS-Weltmeister“ (O.N. 2002b) des Jahres 2000, was besonders interessant wird, wenn man bedenkt, dass die Märkte in den skandinavischen Ländern ungleich stärker mit Mobiltelefonen gesättigt sind (Schiller 2000, S. 37).
Obwohl die Bevölkerungsgruppe der Jüngeren ohne Zweifel mehr Textnachrichten verschickt (laut einer repräsentativen Emnid- Studie verschicken Menschen zwischen 14 und 29 Jahren pro Woche 15,4 Kurzmitteilungen), sind auch die älteren Handy-Besitzer auf den Zug aufgesprungen: Über 60% nutzen die SMS-Funktion ihres Mobiltelefons und verschicken bis zu fünf Textnachrichten pro Woche (O.N. 2002c).
Unterschiede in der Nutzung des SMS zeigen sich also in den Altersgruppen, aber auch zwischen den Geschlechtern. Die Umfrage von Emnid (O.N. 2002c) ergab, dass über 80% aller Mobiltelefon-Besitzerinnen Kurznachrichten verschicken, und zwar durchschnittlich 12,6 Nachrichten pro Woche, während Männer zu 75% die SMS-Funktion nutzen und dabei pro Woche etwa 10,2 Nachrichten verschicken. Das schriftliche Mitteilungsbedürfnis bei Frauen scheint also höher zu sein; 77% der Frauen schicken bis zu 15 Kurzmitteilungen pro Woche ab, während der Großteil der Männer (60%) wöchentlich zwischen einer und fünf dieser Nachrichten versendet.
Konzentriert man die Betrachtung auf die jugendliche Bevölkerungsgruppe, sind schließlich noch Unterschiede hinsichtlich des Bildungsniveaus sowohl der Besitzer von Mobiltelefonen als auch deren Eltern festzustellen. Die 13. Shell-Jugendstudie kommt zu dem Schluss, dass „ein Handy für Jungen und Mädchen unterschiedliches bedeutet“ (Fritzsche 2000, S. 200), da Mädchen aus Elternhäusern mit niedrigem Bildungsniveau wesentlich seltener im Besitz eines Mobiltelefons sind[6], wohingegen das Verhältnis bei Jungen bis zum Alter von 19 Jahren genau umgekehrt liegt und sich später nivelliert[7]. Auch andere Erhebungen können diesen Trend bestätigen: Auf Realschulen und Gymnasien ist der Anteil der Mobiltelefon-Besitzer mit 40% fast doppelt so hoch wie auf Hauptschulen (INRA 2001a).
1.1.3 Forschungsstand in Deutschland
Obgleich die Kommunikation mittels SMS sich in den letzten Jahren so überwältigend durchgesetzt hat wie noch keine andere Art der Kommunikation zuvor, ist die Beschäftigung der Sozialwissenschaften mit diesem Thema bisher bestenfalls episodisch gewesen.
Gilt schon das Mobiltelefon als ein „vernachlässigtes Medium“ (Münker/ Roesler 2000, zit. nach Logemann/ Feldhaus 2002, S. 3), ist die Forschungslage zu SMS und damit erzeugten Textmitteilungen beschönigt ausgedrückt „noch unterrepräsentiert“ (Androutsopoulos/ Schmidt 2001, S. 1). Abgesehen von neckischen Ratgebern (z. B. Jochmann 2000) und Pressemeldungen, die sich meist darauf beschränken, den Verfall der Sprache heraufzubeschwören, existieren hauptsächlich Studienergebnisse diverser Marktforschungsinstitute, die im Auftrag von Netzbetreibern und Mobiltelefonherstellern entstanden (Grinter/ Eldridge 2001, INRA 2001b, O.N. 2002c).
Logemann und Feldhaus erklären dieses eklatante Forschungsdefizit mit der schnellen und umfassenden „Veralltäglichung“, der Medien wie das Mobiltelefon und der SMS unterliegen (2002, S. 2); aus ähnlichen Gründen wird bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt das Telefon als Medium der interpersonalen Kommunikation sozialwissenschaftlich vernachlässigt (vgl. dazu Dimmick et al. 1994, Skelton 1989).
Ein weiterer Grund, der eher in der sozialwissenschaftlichen Ethik begründet liegt, ist die noch immer weit verbreitete Restriktionshypothese. Diese besagt, dass Medien wie das Mobiltelefon, der SMS u. a. aufgrund ihrer spezifischen Kommunikationsform, die Höflich als „technisch vermittelte interpersonale Kommunikation“ bezeichnet (Höflich 1996), als restriktiv und damit bedeutungsärmer empfunden werden, da eine face-to-face-Kommunikation die Bedeutungsübertragung auf ungleich mehr Kanälen erlaubt (vgl. Schultz 2001).
Empirische Forschung zur sozialen Nutzung des Mobiltelefons und in Ansätzen auch zum SMS wird zur Zeit fast ausschließlich in Skandinavien getrieben, wo das Mobiltelefon schon einige Jahre eher als im übrigen Europa in den Alltag integriert wurde (vgl. sämtliche Arbeiten von Ling sowie Haddon 1997, 2000, Katz 1999, 2002).
Für Deutschland liegen bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwei vorwiegend linguistisch orientierte explorative Untersuchungen vor, die sich auf sprachliche Aspekte von SMS-Nachrichten beziehen (Androutsopoulos/ Schmidt 2001, Schlobinski et al. 2001) sowie die ebenfalls explorativen Arbeiten von Höflich (2001) und Höflich/ Rössler (2001a,b) zum Forschungsprojekt „Jugendliche und SMS. Gebrauchsweisen und Motive“, die sich aus der Perspektive des Uses-and-Gratifications-Ansatzes kommunikationssoziologischen und -psychologischen Gesichtspunkten widmen. Höflich und Rössler sind bis jetzt die Einzigen, die eine theoretische Verortung des SMS „in einer ,Dialektik’ mobiler Kommunikation“ (ebd.) versuchen.
1.2 Alltägliche Nutzung von SMS und Nutzungsmotive
„Immer mehr Handy-User verschicken SMS [sic!]. Der entscheidende Vorteil gegenüber dem normalen Telefonieren (abgesehen von Preisvorteilen): die Nachrichten werden geräuschlos übermittelt. So kann man sich, ohne jemanden zu stören, über langweilige Konferenzen oder Schulstunden hinwegretten und weiterhin mit der geliebten Welt in Verbindung bleiben. Auch aus öffentlichen Verkehrsmitteln kann man nun mit seinen Liebsten in Kontakt treten, ohne dass der ganze Großraumwagen mithört (und mithören muss)“ (Jochmann 2000, S. 4f.).
Einer der wichtigsten Vorteile des SMS, der auch in der Untersuchung von Höflich und Rössler (Höflich 2001, Höflich/ Rössler 2001a,b) deutlich wurde, ist das Vermeiden der „Aufdringlichkeit unmittelbarer medialer Kontaktaufnahme“ (Höflich/ Rössler 2001a). Der SMS wird nicht umsonst oft in Analogie zur E-Mail gestellt, die ebenfalls einen Siegeszug durch die westliche Gesellschaft gehalten hat.
Während die Gegner des Mobiltelefons sich hauptsächlich daran stören, dass durch ständiges Klingeln im öffentlichen Raum die Abgrenzung zwischen öffentlicher und privater Kommunikation verschwimmt und dadurch das Mobiltelefon von der „Möglichkeit“ ubiquitärer Erreichbarkeit zur „Belästigung“ und Störung der Interaktion mit körperlich Anwesenden wird (Höflich 2001, S. 3), bieten E-Mail und SMS einen Ausweg aus dem „Zwang, immer erreichbar sein zu müssen“ (ebd., S. 4).
Die Kommunikation mittels Textnachrichten ist, wie schon ausgeführt wurde, asynchron. Daraus ergeben sich für Sender und Empfänger zahlreiche Vorteile.
Derjenige, der eine Textnachricht produziert, hat vor dem und beim Schreiben die Möglichkeit, Inhalt und Stil der Mitteilung zu planen, also „überlegen, was man genau schreibt“ (Schlobinski et al. 2001, S. 26). Dazu hat er den Vorteil, seinem Gegenüber unangenehme Dinge mitteilen zu können, ohne auf dessen Reaktionen sofort reagieren zu müssen – man braucht sich „keine nervigen Widerworte“ anhören und hat „keine Rechenschaft abzulegen“ (ebd., S. 29).
Besonders von Jungen wird berichtet, dass sie lieber per SMS flirten, da ihnen das leichter falle als von Angesicht zu Angesicht oder am Telefon[8]. Ein Brief wird als zu große Herausforderung empfunden (man weiß nicht, wie man das Blatt füllen soll), und schließlich wird eine Textnachricht auf dem Display als weniger verbindlich angesehen – mit einem Tastendruck ist sie verschwunden.
Der oben schon angesprochene Vorteil, dass die Textnachricht diskret beim Empfänger eintrifft, kann sich allerdings auch nachteilig auswirken, nämlich dann, wenn dieser nicht bemerkt hat, dass ihn eine Mitteilung erreicht hat.
Die Asynchronität der SMS-Kommunikation bietet auch für den Empfänger Vorteile. Er wird zwar von seinem Mobiltelefon benachrichtigt, wenn eine Mitteilung eingetroffen ist, doch er kann frei entscheiden, wann und ob er sich dem Interaktionsangebot zuwendet. Auch muss er nicht sofort auf das Angebot reagieren; auch er kann seine Reaktionen „planen“.
Schlobinski et al. fanden, dass besonders Männer zwischen 22 und 30 Jahren es als Vorteil empfinden, dass „eine SMS nicht zwangsläufig zu einem Dialog führe“ (ebd., S. 26)[9]. Die synchrone Kommunikation über das Telefon ist dagegen eine „herrschaftsförmige Aktivität, bei der eine Partei der anderen ihre Zeit aufzwingt“ (Freyermuth 1999).
Wird lediglich ein kurzer Informationsaustausch angestrebt, ist die Kommunikation mittels SMS außerdem ungleich preiswerter als ein Telefongespräch, bei dem Eröffnungs- und Verabschiedungszeremonien, der Austausch von Höflichkeiten und natürlich das Abschweifen des Gesprächs auf andere Themen die Gesprächsdauer in die Länge ziehen können[10]. Anders als beim Schreiben eines Briefs ist es aber möglich, ohne Zeitverlust zu kommunizieren – eine Kurznachricht kommt in der Regel binnen weniger Minuten beim Adressaten an.
Das neben der Asynchronität wichtigste Alleinstellungsmerkmal der Kurznachrichten ist ihre mediale Schriftlichkeit, die allerdings besonders bei der Kommunikation zwischen Freunden konzeptionell eher mündlich ist (vgl. Androutsopoulos/ Schmidt 2001).
Neben den Gelegenheiten, bei denen eine Textmitteilung als Substitut zum Telefonat genutzt wird (sei es wegen der Einsparung von Telefongebühren oder der Diskretheit des Kontakts), finden sich in den Studien daher auch zahlreiche Gelegenheiten, in denen nur SMS für die Kommunikation genutzt wird. Androutsopoulos/ Schmidt berichten von „Momentaufnahmen“ der aktuellen Situation des Absenders in Phasen der Langeweile – im Stau, im Zug etc. Interessant ist, dass in solchen Situationen ohne SMS keine Kommunikation zustande kommen würde (ebd., S. 13). Nachrichten, die aus solchen Kontexten gesendet werden, haben im allgemeinen keinen erkennbaren Zweck als eben den, Kontakt zu einem Freund aufzunehmen.
Die schriftliche Abfassung einer Nachricht verlangt dem Absender nicht nur ein größeres Maß an Planung ab, sie versetzt ihn auch in die Lage, ein hohes Ausmaß an Kreativität in seine Mitteilung zu legen. Nicht umsonst sind in den letzten Jahren zahllose Bücher erschienen, die es sich zur Aufgabe machen, denen, die weniger kreativ sind, beim Verfassen origineller Textmitteilungen unter die Arme zu greifen (für z. T. haarsträubende Sprüche siehe Jochmann 2000).
Besonders bei der Kommunikation im Freundeskreis wird die Sprache eher informell und gruppenspezifisch gestaltet, z. B. mit dem „Gebrauch von Variationsmustern“ und „Sprachexperimenten“ (Androutsopoulos/ Schmidt 2001, S. 20), die nur bei der Kommunikation mittels SMS verschriftlicht werden. Dies können der Gebrauch von Kinder- oder Umgangssprache, Dialekten, Medienreferenzen, aber auch eigene Wortkreationen sein[11], die eine stark „kontextualisierende Funktion“ (ebd., S. 27) haben. Die über Kurznachrichten Interagierenden vermitteln sich so durch den Stil ihrer Nachrichten ihre enge Beziehung: „...den Interaktanten ist bewusst, dass dieser Nachrichtenstil nur innerhalb der Gruppe möglich ist, und dieses Bewusstsein trägt wiederum zum intellektuellen und ästhetischen Genuss ihrer SMS-Kommunikation bei“ (ebd.).
Valide Aussagen über die Nutzung von Kurznachrichten sind bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt schwer oder gar nicht zu treffen, da sämtliche Erhebungen, auf die ich mich beziehe, nicht repräsentativen Charakters sind.
Ein durchgängiges Ergebnis aller Studien, die nach der SMS-Nutzung fragen, ist die Beschränkung der Kommunikation auf den sozialen Nahraum. Obwohl das Mobiltelefon fähig ist, Verbindungen in und mit aller Welt zu schaffen, bleibt die Nutzung des SMS in bestehende Kontakte eingebunden. Im Gegensatz zur Kommunikation mittels (Mobil-)Telefon, bei der die häufigsten Kommunikationspartner regelmäßig Verwandte sind, ist die Textnachricht eine Kommunikationsform, die fast ausschließlich auf den Freundeskreis sowie den Partner beschränkt ist (Schlobinski et al. 2002). Regelmäßiger Austausch von Textnachrichten besteht dabei bei der Mehrheit der Nutzer mit einer bis sechs Personen, wobei sich Frauen auf weniger Kontaktpersonen beschränken (ebd., S. 27).
Wie das Telefon und sein mobiler Nachfolger dient also auch die Kommunikation mittels SMS dazu, bereits bestehende soziale Beziehungen aufrecht zu erhalten. Dies ergibt sich aus den Angaben zu den Hauptnutzungsmotiven: Das Treffen von Verabredungen, sich nach dem Befinden erkundigen oder „sich mal melden“ (ebd., S. 27 und Höflich/ Rössler 2001b) sind die wichtigsten Gründe, eine Textnachricht zu verschicken.
Von Ling hervorgehoben wird die Funktion von Textmitteilungen für die Organisation des Alltags, hier allerdings verstärkt im familialen Kontext (Ling/ Yttri 1999). Dies könnte daher rühren, dass in Norwegen, wo Ling seine Arbeiten durchführt, die Bevölkerung zu einem viel höheren Grad mit Mobiltelefonen ausgestattet ist, es demzufolge wahrscheinlicher als in Deutschland ist, dass mehrere Familienmitglieder über ein Mobiltelefon verfügen und die SMS-Funktion nutzen können.
Eine Faktorenanalyse von Höflich/ Rössler (2001b), in der 204 Jugendliche zu 15 Nutzungsmotiven für Textnachrichten befragt wurden, ergab fünf Nutzungsdimensionen:
An erster Stelle steht demnach die gegenseitige Rückversicherung („psychological need for reassurance“, Dimmick et al. 1994), für die der SMS exzellent geeignet ist: Eine kurze Textnachricht genügt, um den Freunden oder dem Partner das eigene Befinden mitzuteilen und etwas über das ihrige zu erfahren. An zweiter Stelle steht die allgemeine Kontaktpflege, also das Verabreden sowie das Kommunizieren mit Freunden, die nicht anwesend sind bzw. nicht telefonisch erreicht werden können. Hierhin gehört auch das Verschicken von Mitteilungen einfach „um ihrer selbst willen“ (Höflich/ Rössler 2001b, S. 54).
Als dritte Dimension folgt dichtauf die generelle Verfügbarkeit des Mediums Mobiltelefon, an das der SMS gekoppelt ist. Dies beinhaltet sowohl die Möglichkeit, ständig für andere erreichbar zu sein (besonders in Umgebungen, in denen die Annahme eines Anrufs unpassend, störend oder untersagt sein könnte), als auch die empfundene größere Sicherheit in eventuell auftretenden Notsituationen (etwa ein Unfall in spärlich besiedelten Gegenden)[12].
Deutlich weniger häufig wurde der Aspekt der „Lebenshilfe“ thematisiert, der im einzelnen aus dem Besprechen von Problemen und dem Erteilen von Ratschlägen besteht. Die fünfte Dimension, und die einzige, die von Jungen häufiger als von Mädchen genannt wurde, ist der „Nutz-Spaß“ an SMS, also die Beschäftigung mit dem Service aus technischem Interesse, das Abrufen von Informationsdiensten sowie das Vertreiben von Langeweile.
Obwohl die Befragung unter Jugendlichen durchgeführt wurde, ist zu vermuten, dass besonders die ersten drei Gratifikationsdimensionen bezüglich des SMS auch für erwachsene Nutzer zutreffen (vgl. Schlobinski et al. 2001).
Es sollte allerdings noch hinzugefügt werden, dass Höflich/ Rössler mit den von ihnen aufgestellten Gratifikationsdimensionen nicht in der Lage waren, die Häufigkeit der SMS-Nutzung zu erklären. Lediglich die Aspekte Eins und Drei hatten einen signifikanten Einfluss; besser erklärt wurde die SMS-Nutzung durch Geschlecht und Bildungsgrad. Als häufigste SMS-Nutzer wurden Mädchen und Real- bzw. Berufsschüler identifiziert, und zwar umso stärker, je mehr Geld ihnen zur Verfügung stand (ebd., S. 56).
Ein weiterer starker Zusammenhang besteht offensichtlich zwischen der Häufigkeit der SMS-Nutzung und dem Telefonieren mit dem Mobiltelefon, was Höflich/ Rössler als „generelle Handy-Affinität“ bezeichnen (ebd.).
Zuletzt ist noch ein weiterer Aspekt zu nennen, der die Kommunikation mittels SMS betrifft, und der eng mit der fünften Dimension aus der Untersuchung von Höflich/ Rössler (2001b), dem „Nutz-Spaß“, verbunden ist: Das Versenden von Textmitteilungen kann nicht nur pragmatische Gründe haben, sondern es kann auch für eine eigensinnige, „distinkte“ (Höflich 2001, S. 8) Verwendung von Technik und Kommunikationsformen stehen. Die Bevölkerungsgruppe, auf die dieser Aspekt im besonderen zutrifft, sind die Jugendlichen.
1.3 Soziale Bedeutung des SMS für Jugendliche
Die Jugendlichen von heute werden gern als „Generation @“ (Opaschowski 1999), „Mediengeneration“ (Weiler 1999) oder „Net Kids“ (Tapscott 1998) bezeichnet. Es ist nicht zu bestreiten, dass die Lebenswelten von Jugendlichen ungleich mehr als die früherer Generationen durch Medien, besonders durch „neue“ Medien, geprägt sind.
Der Umgang mit dem Fernseher ist schon für zwei- bis dreijährige Kinder eine Selbstverständlichkeit (Hoppe-Graff/ Oerter 2000, S. 109) und über 40% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland besitzen einen Computer, den sie autonom nutzen können (Krüger 1996, S. 115). Postman (1987) vertritt davon ausgehend die These, dass Kindheit bzw. Jugend als Lebensphase verschwinden würden, während Lenzen (1996) annimmt, dass sich durch den Wissensvorsprung der jüngeren Generation bzgl. neuer Medien das Generationenverhältnis auflösen oder umkehren könnte. Sicher scheint jedoch, dass im Zeitalter von Multimedia die verschiedenen Generationen in unterschiedlichen Medienwelten leben, die kaum noch gemeinsame Bezugspunkte haben (Bolz 1997, S. 60).
Zumindest hinsichtlich der Nutzung von Mobiltelefonen ist die „Avantgarde-Position“ (Richard/ Krüger 2001) der Jugendlichen, was die Adaption neuer Technologien betrifft, kaum zu bestreiten.
Eine Untersuchung des Marktforschungsinstituts INRA zeigte, dass sich 75% aller Kinder ein Mobiltelefon wünschen (wenn sie nicht schon eines haben: 3% der 6-7jährigen besitzen schon eines, von den 12-13jährigen telefonieren schon 42% mobil). In Finnland liegt die Durchdringungsrate mit Mobiltelefonen in der Altersgruppe der 16- bis 18jährigen bei fast 100% (O.N. 2002a).
Dazu kommt, dass die Jugendphase, wenn man sie überhaupt so verallgemeinern kann, eine recht „mobile“ Zeit ist, „both mentally and physically“ (O.N. 2002a). Besonders nach dem Wechsel von der Grund- in die weiterführende Schule entstehen neue Interessen und Ansichten, Freunde kommen aus einem größeren geographischen Einzugsgebiet, es eröffnen sich neue Handlungsräume, bestehende werden ausgeweitet (Brown 1990, S. 181). Das Mobiltelefon scheint geradezu das Medium zu sein, auf das alle Jugendlichen gewartet haben; es besetzt eine „Kommunikationsnische“, die von keinem anderen Medium gefüllt werden kann.
Eltern geben dem Wunsch ihrer Kinder nach einem Mobiltelefon oft nach, um über die ständige Erreichbarkeit für mehr Sicherheit sorgen zu können („keep track of their children“, O.N. 2002a), für ihre Kinder verheißt das Mobiltelefon das Gegenteil: Freiheit von der elterlichen Überwachung. Da das (Mobil-)„Telefon [...] im Begriff [ ist, J.H.], zum persönlichen Kommunikator zu werden“ (Freyermuth 1999), stellt es für das Kind bzw. den Jugendlichen ein Medium dar, das es mit niemandem und schon gar nicht mit den Eltern teilen muss. Es existiert eine eigene Rufnummer einschließlich Anrufbeantworter und, wichtiger als das, es existiert keine Bindung mehr an das (meist elterlicher Kontrolle unterworfene) Festnetztelefon, um soziale Kontakte zu pflegen[13].
Ling geht sogar so weit, den Erwerb eines Mobiltelefons für den Jugendlichen als eine latente Funktion „of marking the transition“, also als Statuspassage, zu betrachten (1999c, S. 2). Diese Funktion übernimmt das Mobiltelefon ganz neu, da es zuvor kein anderes Medium gab, das für Jugendliche derartige Möglichkeiten eröffnet hätte.
Da Kinder und Jugendliche in anderen Alltagswelten leben, andere Erfahrungen machen und daher auch andere Bedürfnisse haben als Erwachsene, dürften auch die Funktionen, die das Mobiltelefon sowie die Kommunikation mittels SMS für sie haben, sich von denen für Erwachsene unterscheiden.
Die Kommunikation mittels SMS ist unter Kindern und Jugendlichen ungeheuer beliebt: Fast die Hälfte der Kinder, die schon im Besitz eines Mobiltelefons sind, nutzen dieses hauptsächlich, um Textnachrichten zu verschicken und zu empfangen (INRA 2001a).
Die Erhebung des XRCE und des PARC unter Jugendlichen ergab, dass die Kommunikation via SMS hauptsächlich auf den Freundeskreis („peers“) beschränkt ist – 90% aller Nachrichten zirkulieren in diesem Umfeld (Grinter/ Eldridge 2001). Weniger noch als bei Erwachsenen, für die die Verteilung ungefähr gleich liegt (vgl. Schlobinski et al. 2001)[14], ist das verwunderlich, schließlich spielt die peer-group in der Sozialisation heutiger Jugendlicher eine gewichtige Rolle: „in fact, it is in this period that friendships and the peer group is at its apex [...] this is perhaps the only time in our lifes when friends come fully to center stage“ (Ling 2000c, S. 4)[15].
Die peer group ermöglicht dem Jugendlichen das Üben sozialer Interaktion mit Gleichgestellten, sie hat eine Schutzfunktion und verschafft den Mitgliedern eine Gruppenidentität, vor allem aber markiert sie die wachsende Unabhängigkeit von der Familie (ebd.). Für den Jugendlichen ist sie der erste Schritt zur Schaffung seines eigenen sozialen Netzwerks und eine wichtige Hilfe bei seiner Selbstsozialisation.
Innerhalb des Jugendlichen-Netzwerks erfüllt das Mobiltelefon zwei verschiedene Funktionen. Einerseits dient es sowohl über Telefonate als auch über die SMS-Kommunikation der direkten Koordinierung von (außerschulischen) Aktivitäten. Anders als die Mitglieder einer Familie können Mitglieder eines Freundeskreises ihre Tagesaktivitäten nicht am Frühstückstisch miteinander besprechen. Ohne Kommunikation kann die Gruppe nicht funktionieren. Mit dem Mobiltelefon sind alle Mitglieder immer füreinander erreichbar, und wenn doch nicht, kann eine Textmitteilung auch noch später gelesen werden, ohne dass die Familie des Abwesenden in die Nachrichtenübermittlung einbezogen werden musste. Auf diese Weise kann der Jugendliche eine individuelle Identität entwickeln, die nicht mehr (geographisch) an die Familie bzw. das Elternhaus gekoppelt ist (vgl. Ling 2000a, S. 5).
Die andere Funktion ist weniger pragmatisch bzw. quantitativ erfassbar; es handelt sich um den distinktiven Gebrauch des Mobiltelefons als Symbol der Gruppenzugehörigkeit[16]. Am einsichtigsten wird dies, betrachtet man Aussagen Jugendlicher zu ihren Gründen, ein Mobiltelefon haben zu wollen. Der Hauptgrund scheint jedes Mal zu sein, dass alle Freunde schon im Besitz eines solchen Geräts sind. Will man nicht von der gruppeninternen Kommunikation ausgeschlossen werden, braucht man ebenfalls ein Mobiltelefon – „the very ownership of a mobile phone indicates that one is socially connected“ (Ling/ Helmersen 2000, S. 13). Weiterhin symbolisiert ein Mobiltelefon einen gewissen Grad an Selbstständigkeit und Reife: „When you are in primary school it is surely extra cool [to have a mobile telephone] because then you are so big“ (ebd., S. 15). Mit zunehmendem Alter wächst diese Selbstständigkeit, bis die Jugendlichen auch selbst für das Bezahlen ihrer Telefonrechnung verantwortlich werden – dann sind sie wirklich „erwachsen“. Mehr zum distinktiven Gebrauch von Mobiltelefonen findet sich in den Arbeiten von Ling; im weiteren werde ich mich auf die Kurzmitteilungen und ihre Funktionen konzentrieren.
Wenn das Mobiltelefon allein schon einen ungeheuren Zuwachs an Selbstständigkeit und Privatsphäre ermöglicht, bietet die Kommunikation mittels Kurznachrichten noch weitere Freiheit. Da Interaktion über die schriftlichen Mitteilungen asynchron verläuft und sehr diskret ablaufen kann, ist der SMS die ideale Kommunikationsform für die Schule; hier fungiert er äquivalent zu den Zetteln, die man unter der Schulbank durchreicht (Höflich 2001, S.13, vgl. für Norwegen auch Ling 2000d). Ling fand, dass die stille Kommunikation mittels Textnachrichten von den Schülern weniger benutzt wird, um bei Prüfungen zu betrügen, als für die „pattern maintenance of the group“ (Ling 2000d, S. 9).
Ein weiterer Vorteil, der sich aus der asynchronen Kommunikation ergibt, wurde schon besprochen: Gerade für Jugendliche, die im Moderieren „kritischer“ Interaktionen noch wenig Erfahrungen haben, kann die zeitliche Verzögerung, die zwischen den Dialogzügen liegt, wertvolle Zeit zum Planen der nächsten „Redezüge“ bedeuten: „Then one does not have to use their voice that can shout or break up. You have to have time to think… You always use it in situations like this […]” (Ling 2000c, S. 12). Auch bei der Anbahnung romantischer Beziehungen sind die Asynchronität und die Schriftlichkeit von großer Bedeutung. Wenn jedes Wort „auf die Goldwaage“ gelegt wird, ist die Möglichkeit der genauen Planung von Äußerungen von unschätzbarem Vorteil. Über Textnachrichten kann eine Beziehung auch unkompliziert wieder beendet werden: „ [...] if you regret then you just don’t take the phone[17] or send a message“ (ebd., S. 13).
Über die Gratifikationen, die Jugendliche mit dem SMS als Kommunikationsform verbinden, habe ich im vorigen Kapitel berichtet; ich habe dabei angenommen, dass diese Gratifikationen auch für Erwachsene zutreffen[18]. Vor allem im Kontext der besonderen Rolle der peer group gehe ich aber davon aus, dass der SMS als Kommunikationsform für Jugendliche noch weitere, für diese Altersgruppe spezifische Dimensionen beinhaltet.
63% aller Textnachrichten werden von zu Hause aus geschickt (Grinter/ Eldridge 2001). Das ist bemerkenswert, da die meisten Teenager die Möglichkeit haben, kostenlos das Festnetztelefon ihrer Eltern zu benutzen. Ein Drittel der Befragten gab als Begründung an, das Versenden einer Kurzmitteilung ginge schneller. Angesichts der eingeengten finanziellen Lage der meisten Teenager kann dies nicht die einzige Erklärung sein.
Das Verschicken und Empfangen von Textnachrichten hat neben den pragmatischen Aspekten der „micro-coordination“ (Ling/ Yttri 1999) des Alltags auch expressive Funktionen innerhalb der peer group. Wie Schlobinski et al. schon bemerkten, versichern sich Angehörige eines Freundeskreises über den Stil und den Inhalt der Kurznachrichten ihrer engen und exklusiven Beziehung. Dies geschieht auf drei Ebenen.
Der erste Aspekt ist die mit der Textmitteilung verbundene Meta-Kommunikation: Das Verschicken und Empfangen versichert Sender und Empfänger ihrer Mitgliedschaft in der peer group. Außerdem ist die Zahl der empfangenen Nachrichten ein Indikator für sozialen Status innerhalb der Gruppe (vgl. Ling 2000c, S. 13). Eine weitere Aktivität, mit der sich die Gruppenmitglieder ihrer Gemeinschaft versichern, ist das Weiterschicken von „Ketten-Nachrichten“ (vergleichbar den „Chain-Mails“ in der E-Mail- Kommunikation) oder witziger Piktogramme.
Auf einer zweiten Ebene sollte man die Inhalte der Nachrichten betrachten. Obwohl der Großteil der SMS-Kommunikation der Organisation des Alltags dient, also konkrete Informationen vermittelt werden, besteht doch ein nicht unerheblicher Teil der Inhalte von Textmitteilungen aus „chatting“: „[With] friends it is chatting, parents ... call for something“ (Ling 2000c, S. 12). Auch dieser entspannte Umgang mit der neuen Kommunikationsform SMS dient der Aufrechterhaltung der Bindungen unter den Jugendlichen.
Nachrichten überwinden die Grenze der Eins-zu-Eins-Kommunikation, indem sie innerhalb der Gruppe weitergeschickt oder vorgelesen werden; Mitglieder, die Nachrichten kreativ und treffend formulieren können, übernehmen diese Aufgabe als „jugendlicher Cyrano de Bergerac“ (O.N. 2001b) für ihre weniger begnadeten Freunde und genießen dafür in der Gruppe hohes Ansehen. Durch den Aufbau einer gemeinsamen Kommunikationsgeschichte wird wiederum der Zusammenhalt der Gruppe gestärkt.
Schließlich existiert noch die dritte Ebene der sprachlichen Mittel. Ähnlich wie die von Schlobinski et al. (2002) als Datenquelle benutzten Freunde gehen auch Jugendliche kreativ mit Sprache und Stil im engen Rahmen der technischen Möglichkeiten des SMS um, erfinden Abkürzungen und neue Wörter und verwenden Slang. Die implizite Absicht ist das Ziehen und Verteidigen von Gruppengrenzen: „Those outside the group will either not understand the content of the slang, or will appear inept when trying to use it“ (Ling 2000c, S. 12).
Das Element des Spiels verorten Höflich und Rössler (2001b) als für Jugendliche typische Gratifikationsdimension hinsichtlich der Nutzung des SMS. Im Spiel lernen Jugendliche nicht nur, das Medium Mobiltelefon in ihren Alltag einzubauen, sondern auch, unter den vom Mobiltelefon vorgegebenen Bedingungen mit anderen zu kommunizieren. Das Mobiltelefon wird dabei von Jugendlichen mehr als von Erwachsenen als „pleasure phone“ (Leung/ Wei 2000, S. 313) wahrgenommen und benutzt. Spielerische Formen wie das Versenden von „chain messages“, das Kreieren (bzw. Kaufen) von Piktogrammen oder das Flirten mit Unbekannten finden sich fast nur in der Altersgruppe der Jugendlichen.
1.4 Einordnung des SMS zwischen mündliche und schriftliche Kommunikations-formen
Der SMS ist eine Möglichkeit der „technisch vermittelten interpersonalen Kommunikation“ (Höflich 1996). Die bisherige Betrachtung hat verdeutlicht, dass die Kommunikation mittels Textnachrichten sowohl Funktionen übernimmt, „die man durchaus als ,brieflich’ bezeichnen könnte, ebenso wie sie allerdings auch Funktionen [...] [übernimmt, J.H.], die ,telefonisch’ sind“ (Höflich 2001, S. 12). Deshalb soll die SMS-Kommunikation im folgenden in die Reihe anderer Formen medial vermittelter interpersonaler Kommunikation eingeordnet werden.
Wie schon besprochen wurde, ist der SMS kein Medium im strengen Sinne der Definition von Holly (1997) und bleibt aus diesem Blickwinkel immer an das Mobiltelefon gebunden. Betrachtet man andere Möglichkeiten der interpersonalen Kommunikation, zwischen die der SMS eingeordnet werden soll, dann finden sich mit E-Mail und Chat weitere Kommunikationsformen, die nicht eigentlich ein Medium, sondern ebenfalls an eines gebunden sind, nämlich an den PC.
Andere Kommunikationsformen wie das Telefon, das Mobiltelefon und der Brief können legitim als Medien betrachtet werden. Zwar kann man den Brief nicht gerade als „technisch“ vermittelndes Medium bezeichnen, jedoch soll er trotzdem in die Analyse mit aufgenommen werden, da die SMS-Kommunikation Analogieschlüsse zur Brief-Kommunikation geradezu provoziert (vgl. Höflich 2001)[19].
Neben den genannten existieren noch andere Kommunikationsformen, auf die die Bezeichnung „interpersonal“ bzw. „technisch vermittelt“ zutrifft: Newsgroups, MUDs und MOOs im Internet, das Fax und zuguterletzt die Postkarte. Dass diese Kommunikationspraxen im folgenden nicht betrachtet werden, hat lediglich ökonomische Gründe.
Selbstverständliche Vergleichsgröße für alle Arten der Kommunikation scheint das direkte, mündliche face-to-face-Gespräch zu sein. Der Vergleich mit dieser unvermittelten Art der Kommunikation ergibt dabei stets eine defizitäre Betrachtung jeder anderen Kommunikationsform (vgl. z. B. Walther/ Burgoon 1992, Wetzstein et al. 1995). Was dabei übersehen wird, ist die prinzipielle Unvergleichbarkeit der beiden Sphären, die im Alltagsgebrauch selbstverständlich zu sein scheint.
Flanagin und Metzger (2001) fanden in einer Uses-and-Gratifications-Untersuchung über den alltäglichen Gebrauch von „alten“ und „neuen“ Medien, dass diese nicht im Bewusstsein ihrer Unterlegenheit zum face-to-face-Gespräch gebraucht werden, sondern dass jedes Medium seine eigenen Vorteile hat, wegen denen es benutzt wird. Die Verdichtung der Gratifikationsitems für neun verschiedene Kommunikationsmodi ergab drei deutlich getrennte Cluster: einmal den der „mediated interpersonal communication“, dann den der Massenkommunikationsmedien und schließlich den der face-to-face-Interaktion (ebd.). Genauso wie man nicht einen Spielfilm im Fernsehen mit der face-to-face-Kommunikation vergleicht, sondern eher den Spielfilm mit einem Roman, sollte man auch bei der Beurteilung mediatisierter interpersonaler Kommunikationsformen innerhalb dieses Spektrums bleiben.
In dieser Richtung liegt eine interessante Studie des Marktforschungsinstituts INRA vor, die die „Stärken und Schwächen“ der Kommunikationsformen E-Mail, SMS, Telefon, Fax, Brief, Postkarte und (natürlich) des persönlichen Gesprächs auf einer „Kommunikations-Landkarte“ darstellt (INRA 2001b)[20].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 (INRA 2001b)
Gefragt wurde danach, für welche Zwecke bzw. in welcher Situation welches Kommunikationsmedium gewählt würde, wenn die Befragten freie Wahl hätten. Es ergaben sich vier Dimensionen, auf denen die Kommunikationsformen angeordnet sind.
Geforderte Reaktionszeit: Ausgehend von einer mehr oder weniger starken Reziprozitätserwartung in Form einer Reaktion auf das Interaktionsangebot ist es nicht verwunderlich, dass die Postkarte, die meist nicht mehr als die Meta-Botschaft, dass der Sender an den Empfänger gedacht hat, enthält, den letzten Platz belegt; genauso wenig verwundert der erste Platz des persönlichen Gesprächs. An der Anordnung der schriftlichen Medien Brief, Fax und E-Mail und dem Abstand des SMS zu ihnen zeigt sich schon eine Sonderrolle des letzteren.
Emotionalität: Bei der mehr oder weniger starken Besetzung der Kommunikationsformen mit Gefühlen assoziierten die Befragten besonders die E-Mail und den SMS als erfreulich, wohingegen Faxe und Briefe weitgehend mit geschäftlicher Kommunikation verbunden werden und deshalb als unerfreulich eingestuft werden.
Formalität: Hier wird bestätigt, dass die Kommunikation mittels SMS durchgehend als privat empfunden wird; sie ist ungleich privater als alle anderen Medien, die zwar auch zur privaten, aber eben auch zu formeller Kommunikation genutzt werden können. Die Sonderrolle des SMS ist auch hier wieder klar ersichtlich.
Vertrautheit: Die Anordnung der Medien auf der Vertrautheits- Dimension weist dem SMS einen Rang nach dem Telefon zu; das ist ein interessanter Widerspruch zur Spitzenstellung des SMS bei der Privatheit. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die Kommunikation mit Partner und Familie doch eher über das Telefon abgewickelt wird, so dass die SMS-Kommunikation für die in dieser Hinsicht weniger vertrauten Freunde reserviert bleibt.
Anstatt Kommunikationsformen hinsichtlich ihrer jeweiligen Defizite zur direkten mündlichen Interaktion zu betrachten, sollte es mehr Gewinn versprechen, sie anhand des Kriteriums „Mündlichkeit – Schriftlichkeit“ einzuordnen. Dies dürfte besonders für die SMS-Kommunikation, die eine schriftliche Kommunikation mittels eines originär mündlichen Mediums erlaubt, interessant werden.
Die Doppeldeutigkeit der Begriffe „mündlich“ und „schriftlich“ (Koch/ Oesterreicher 1994) führt zunächst zu einer notwendigen Trennung von medialer und konzeptioneller Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit (vgl. Haase et al. 1997). Ersteres bezieht sich auf das Medium, mit dem die sprachlichen Äußerungen jeweils realisiert werden, letzteres auf die den Äußerungen zugrunde liegende Konzeption. Die Einordnung der jeweiligen Medien fällt nicht schwer: Auf der einen Seite finden sich Telefon und Mobiltelefon, auf der anderen Brief und E-Mail sowie der SMS.
Während hier eine Dichotomie erzeugt werden kann, stellt die konzeptionelle Dimension eher ein „Kontinuum“ dar, dessen „Endpunkte“ Mündlichkeit und Schriftlichkeit sind (Koch/ Oesterreicher 1994). Man kann dies auch mit dem Gegensatzpaar „kommunikative Nähe“ und „kommunikative Distanz“ ausdrücken (Haase et al. 1997, S. 60). Wie die „Kommunikations-Landkarte“ gezeigt hat, können Brief und E-Mail konzeptionell mündlich sein, wenn mit Freunden und Verwandten kommuniziert wird, aber auch konzeptionell schriftlich, wenn die Kommunikation mit Behörden, Vorgesetzten etc. geführt wird. Bei Telefon und Mobiltelefon ist die Einordnung wohl meist am mündlichen „Endpunkt“ zu treffen. Wiederum zeigt sich die Sonderrolle des SMS – da mittels Textmitteilungen mit Freunden kommuniziert wird, ist diese Kommunikationsform der konzeptionellen Mündlichkeit zuzuordnen, während sie medial schriftlich ist.
Die folgende Betrachtung der einzelnen Kommunikationsformen soll sich aus ökonomischen Gründen auf den „Endpunkt“ der kommunikativen Nähe konzentrieren. Auch hier finden sich noch genügend Unterschiede, z. B. in der Rahmung der Interaktion, typischen Interaktionsabläufen und verschiedener textsortenspezifischer Charakteristika, die sich aus den jeweiligen medialen Besonderheiten ergeben, sowie der nahe liegendste Unterschied - die Wahl des jeweiligen Mediums für das Erreichen bestimmter kommunikativer Zwecke.
1.4.1 Telefon
Medienwahl-Untersuchungen ergeben, dass das Telefon trotz seines Potentials ein „Medium der Nahraumkommunikation“ (Höflich 2000, S. 86) ist, mit dem hauptsächlich bereits bekannte Personen kontaktiert werden[21]. Die große kommunikative Nähe und emotionale Intensität, die das Telefon übermitteln kann, machen es attraktiv für Paare und enge Freunde. Auf einer anderen Ebene, aber prinzipiell ähnlich, wird offenbar die Kommunikation über Textnachrichten von diesen Personen verwendet (Schlobinski et al. 2002). Dass die familiale Kommunikation noch wenig über SMS stattfindet, ist hypothetisch damit zu begründen, dass Familien mehrere Generationen verbinden, von denen die älteren meist wenig Interesse an neuen Medien zeigen und diese eher weniger in ihren Kommunikationsalltag integrieren.
Die Untersuchung von Claisse (1989) zeigt, dass „die häusliche Nutzung des Telefons vor allem sachorientiert (45,5%) oder überwiegend sachbezogen ist (56,5%)“ (ebd., S. 263). Daraus, dass sich die Gesprächspartner in den meisten Fällen persönlich nahe stehen, kann also nicht geschlossen werden, dass das Telefon eine vorrangig beziehungsstiftende Funktion hätte. Es ergeben sich zwei Hauptnutzungsweisen des Telefons, die eng mit der Zeitwahrnehmung und dem Zeitgebrauch stehen: Um Zeit zu sparen oder zu gewinnen, werden sachorientierte Gespräche geführt (z. B. „Ich komme in fünf Minuten, mach dich bereit“). Für personenorientierte Gespräche, die als weniger dringlich empfunden werden, wird Zeit als solche explizit „gebraucht“. Die Gespräche dauern dann länger und werden in der Freizeit geführt. Ziel einer solchen Interaktion ist es ja auch, „Zeit mit jemandem zu verbringen“. Die personenorientierten Gespräche verbinden außerdem Personen über größere Entfernungen hinweg, als das bei eher organisatorischen Gesprächen der Fall ist, bei denen kürzere Entfernungen gezielt eingesetzt werden (ebd.). Aus den Gratifikationen und Nutzungsweisen des SMS ist zu erkennen, dass die sachorientierte Nutzung des Telefons in Konkurrenz zu diesem steht. Ob SMS die Telefonkommunikation auf dieser Ebene ersetzen könnte, bleibt zu untersuchen.
Eine Uses-and-Gratifications-Studie von Dimmick et al. (1994) fand zusätzlich zu den erwähnten eine dritte Dimension: „reassurance“ (ebd., S. 659). Die Aufgaben der sozialen Integration von Individuen und der Organisation des Alltags können auch von anderen Medien wahrgenommen werden, wohingegen die Aufgabe der Rückversicherung, die eher eine psychologische Variable ist, allein dem Telefon zufällt. Da die neuen interpersonalen Medien hauptsächlich der Schriftlichkeit zuzuordnen sind (E-Mail, Chat, etc.), wird diese dritte Dimension der Mündlichkeit des Mediums Telefon zugeschrieben. Neueste Untersuchungen legen allerdings nahe, dass auch auf dieser Ebene das Telefon auf verlorenem Posten steht: Höflich und Rössler (2001b) identifizieren die Rückversicherung als stärksten Faktor der SMS-Kommunikation unter Jugendlichen.
Die Nichtverfügbarkeit besonders des visuellen Kanals ist der für die Telefonkommunikation bestimmendste Faktor. Hinzu kommt eine charakteristische, gesellschaftlich akzeptierte Flüchtigkeit des Mediums (Telefonate werden selten aufgezeichnet). Eine ähnliche kommunikative Distanz schafft die schriftliche SMS-Kommunikation: Hier fehlt auch noch der akustische Kanal; dafür können die einzelnen „Redebeiträge“ gespeichert werden.
Fast alle Funktionen des Telefons können von anderen Medien übernommen werden. Ein besonders aussichtsreicher Konkurrent im Gefüge der interpersonalen Kommunikationsformen ist der SMS, da er wegen seiner konzeptionellen Mündlichkeit auf der gleichen emotionalen Ebene benutzt wird. In allen Situationen, in denen die Synchronität des Telefongesprächs von Nachteil ist, kann die SMS-Kommunikation einspringen. Natürlich gibt es darüber hinaus kommunikative Absichten, die sich genau dieser Synchronität bedienen; dazu kommt der weitere Vorteil mündlicher Kommunikation, dass sie keine Vorkenntnisse und Fertigkeiten erfordert. Trotz einer umfassenden Neubewertung und Verortung im Gefüge der interpersonalen Kommunikationsformen wird das Telefon auch weiterhin ein eigenständiges Medium bleiben.
1.4.2 Mobiltelefon
Um das mobile Telefonieren als Kommunikationsform betrachten zu können, sollte man sich nicht nur auf „plain old telephone service on the move“ (Leung/ Wei 2000) beschränken; die enge Verflechtung des Mobiltelefons mit der SMS-Kommunikation darf nicht vergessen werden.
Sieht man sich die Motive an, aus denen heraus Mobiltelefone gekauft werden, stößt man an erster Stelle auf die „umfassende Erreichbarkeit“ und die Beweglichkeit, die aus der „Loslösung des Telefonierens von einem festen Ort“ (Höflich/ Rössler 2001b, S. 439) resultiert. Das Mobiltelefon bündelt „drei Grundelemente hochmoderner Gesellschaften: Kommunikation, Mobilität und Individualität“ (Burkart 2000, S. 209). Kommunikation und damit die Organisation des Alltags und die Pflege sozialer Beziehungen wird einfacher oder wenigstens effektiver, gleichzeitig wird Telefonieren individueller. Im Gegensatz zum Festnetztelefon, das in den meisten Fällen ein „Familientelefon“ ist, koppelt sich ein Mobiltelefon viel enger an die Identität seines Besitzers: „a mobile telephone is actually an expression of your personality“ (Ling/ Yttri 1999, S. 1).
Ling und Yttri (1999) gehen sogar so weit, von neuen Interaktionsformen zu sprechen, die durch die Einführung des Mobiltelefons entstehen. Es handelt sich hier um „micro coordination“ und „hyper coordination“. Während sich die eine Form der Interaktion auf instrumenteller Ebene abspielt und die Organisation des Alltags betrifft, liegt die zweite Form eher auf der expressiven Ebene und bezieht sich auf den Gebrauch des Geräts als Distinktionsmittel besonders durch Jugendliche. Diese Dimensionen gelten natürlich auch für die mittels Mobiltelefon stattfindende SMS-Kommunikation.
Eines der interessantesten Ergebnisse einer Uses-and-Gratifications-Untersuchung von Leung/ Wei (2000) war, dass das Mobiltelefon weniger als Statussymbol wahrgenommen wurde, sondern vielmehr als „the new pleasure phone“ (ebd., S. 313). Statements in dieser Dimension lauteten etwa „to help pass the time“, „because it’s entertaining“ oder „because using the telephone is fun“ (ebd., Tabelle S. 312). Die Bedeutung des Spiels bei der Aneignung und Nutzung von Medien wurde schon für die SMS-Nutzung unterstrichen (Höflich / Rössler 2001b).
Anders als das stationäre Telefon übernimmt das Mobiltelefon auch nicht funktionelle Aufgaben. Dabei kann das Gerät als Objekt Aussagen über den Träger machen, aber auch die Art, wie es gebraucht wird (schon die Tatsache, dass ein Anruf von einem Mobiltelefon aus getätigt wird, kann viel aussagen).
Es wäre untertrieben zu sagen, dass mit dem Mobiltelefon einfach nur telefoniert würde. Mit diesem Medium verbinden sich gänzlich neue Gratifikationen, so dass man berechtigt von einer neuen „Nische“ sprechen kann, die das Mobiltelefon besetzt hat (vgl. Dimmick et al. 2000), und die der SMS-Kommunikation als Ausgangsbasis dient.
Das heißt nicht, dass das mobile Telefon seinen unbeweglichen Vorgänger verdrängen und dessen Funktionen substituieren würde, jedenfalls nicht, solange sich im Tarifverhältnis der Telefonsysteme nichts Grundlegendes ändert. Solange nämlich das Festnetztelefon und das Mobiltelefon preislich derartig divergieren wie heute noch der Fall, werden längere personenorientierte Gespräche mit dem Mobiltelefon vermieden werden. Diese Nutzungsweise bleibt bis heute allein dem Festnetztelefon vorbehalten.
1.4.3 Brief
Als „archetypisches Modell“ der Briefkommunikation bezeichnet Nickisch (1991, S. 20) eine private schriftliche Kommunikation zwischen zwei Partnern. Verfasser und Empfänger sind in der Erzeugungs- und Rezeptionssituation allein; sämtliche Möglichkeiten der Verständnisklärung müssen also imaginiert oder zeitverschoben realisiert werden.
Es fehlt bei der schriftlichen Kommunikation der Beziehungsaspekt (vgl. Watzlawick et al. 1982): die Kontrolle inhaltlicher Verlässlichkeit durch Beobachtung der als nicht manipulierbar angesehenen Aspekte von Verhalten (vgl. Goffman 2000, S. 10) ist im Brief schwer oder gar nicht möglich. Durch diesen „Mangel“ kann der Inhalt deutlicher werden, er kann aber auch zu gesteigerter Unsicherheit führen.
Durch die Linearität und die „Objektivität“ des Schriftlichen ist zudem ein größeres Maß an Planung nötig; Themensprünge müssen z. B. in angemessener stilistischer Form erfolgen, Aussagen müssen so getroffen werden, dass ein Missverständnis seitens des Lesers ausgeschlossen werden kann. Diese Planbarkeit der Äußerungen ist auf der anderen Seite einer der Vorteile der schriftlichen Kommunikation. Nicht zuletzt müssen pragmatische Aspekte kontrolliert werden, indem man etwa eine lesbare Handschrift übt oder den maschinell geschriebenen Text auf Fehler überprüft, die die Lesbarkeit behindern könnten.
Durch die Verbreitung des Telefons ist der Brief heute kaum noch „Medium des Gedanken- und Meinungsaustausches“, sondern vielfach eine „Höflichkeitspflicht“ geworden (vgl. Ettl 1983); verbreitete Anlässe, einen Brief zu schreiben, sind formelle Einladungen, Kondolenzen und Konfliktbearbeitung[22]. Hierfür scheint der Brief als geeignet wahrgenommen zu werden, da er den Charakter des Offiziellen trägt, dadurch nachdrücklicher wirkt und durch die Ablösung der Nachricht vom Sender beiden Partnern hilft, „das Gesicht zu wahren“.
Im Gegensatz zur mündlichen Interaktion bemüht man sich im Brief meist des Hochdeutschen und versucht, keine Formfehler zu machen – diese werden nämlich vom Empfänger einer genauen sozialen Kontrolle unterzogen und gelten als „Repräsentanten ihrer Schreiber“ (Steger 1972, S. 209). Aus diesem Bewusstsein heraus und da die Fertigkeiten des Briefschreibens heute nicht mehr selbstverständlich sind, wird die Produktion eines Briefes von vielen als „Mühe“ empfunden (die man sich möglichst spart).
Die meisten Briefe werden zu einem bestimmten Zweck geschrieben und beschränken sich inhaltlich auf die Bearbeitung dieses einen Zwecks. In Briefwechseln finden aber in der Regel Bezüge auf vorher Geschriebenes statt, um eine gemeinsame Kommunikationssituation herzustellen; es werden Fragen an den Partner gestellt und vorangegangene beantwortet.
Eine weitere Besonderheit des Briefes liegt in seiner Materialität begründet: So lange er nicht mit Geheimtinte geschrieben wurde, besteht immer die Chance, dass er den Einflussbereich des Empfängers, für den er bestimmt war, verlässt und damit die (evt. sehr intimen) Äußerungen des Absenders für Außenstehende offengelegt werden. An den unzähligen veröffentlichten Briefwechseln zwischen prominenten Personen sehen wir, dass so etwas schnell geschehen kann.
Es ist anzunehmen, dass der Brief durch seine Seltenheit im kommunikativen Alltag einen sehr hohen Stellenwert einnimmt, wenn es doch einmal zu einem Briefwechsel kommt. Darauf deuten die Äußerungen der Jugendlichen hin, die von Höflich (2001) interviewt wurden: „...also wenn ein Brief im Briefkasten ist, dann ist das nicht einfach nur mal so, also da freut man sich ja auch richtig drüber...“ (ebd., S. 13). Die „Mühe“, die sich der Schreiber gemacht hat, wird bewundert und als Kompliment genommen. Dazu kommt, dass das Versenden eines Briefes im Vergleich zu einer E-Mail oder einer Textnachricht ungleich mehr Geld und Zeit kostet: Man muss nicht nur eine Briefmarke kaufen, sondern auch zum Briefkasten laufen. Besonders durch neue schriftliche Kommunikationsformen wie SMS, aber auch E-Mail und Chat, unterliegt der Brief einer Neudefinition und -einordnung im Kontinuum der interpersonalen Medien. Da er aber, wie gezeigt wurde, gänzlich andere Aufgaben wahrnimmt als SMS & Co. und daher auch anders wahrgenommen wird, kann hier nicht von einer Substitution ausgegangen werden.
1.4.4 E-Mail
Genau bezeichnet ist E-Mail die Möglichkeit der digitalen Datenübertragung von einem Computer auf einen anderen mittels spezieller E-Mail-Programme[23]. Bedingung sind neben dem Computer noch eine Telefonleitung und ein Modem, mit denen der Computer an das Internet angeschlossen werden kann.
Günther und Wyss (1996) sind überzeugt, die Kommunikationsform E-Mail sei durch eine „verschriftete Mündlichkeit“ bzw. „mündliche Schriftlichkeit“ gekennzeichnet, die die E-Mail von der Briefkommunikation unterscheide (ebd., S. 70) und sie damit in die Nähe der SMS-Kommunikation rückt: „Ohne Begrüßungs- und Schlussformeln der EMs [ E-Mails, J.H.] wäre ein Vergleich mit Gesprächsschritten (turns), wie sie in mündlichen Dialogen zu finden sind, naheliegend“ (ebd., S. 73, Hervorhebung im Original; zur Hervorhebung der Dialogizität vgl. auch Pansegrau 1997). Eine weitere Gemeinsamkeit mit mündlicher Interaktion (und SMS-Kommunikation) sind direkte, unkommentierte Bezugnahmen auf vorangegangene E-Mails ohne Redundanz[24].
Über Faktoren, die diese Mündlichkeit hervorrufen, wird z. Zt. noch spekuliert. Es könnte sein, dass „...beim Schreiber ein Gefühl [...] mitspielt, Post über Computer sei weniger endgültig, weniger formal festgelegt, weil irgendwie ja nicht richtig schriftlich, sei also etwas Spontaneres und ohnehin anderes...“ (Janich 1994, S. 254).
Die E-Mail scheint eine Kommunikationsform der Nähe und Freundschaft zu sein und dieser Funktion durch ihre Tendenz zur Mündlichkeit besser gerecht zu werden als der Brief. E-Mails werden zum überwiegenden Teil (fast 90%) für die Kommunikation mit Freunden und Bekannten genutzt (O.N. 2002d). Darauf deuten auch Ergebnisse einer Untersuchung von Dimmick et al. (2000) hin. Obwohl das Telefongespräch durchweg als geeigneter für die Pflege sozialer Beziehungen erachtet wurde, nutzen viele Menschen stattdessen die E-Mail- Kommunikation.
Während der Vorteil des Telefons die „social-context clues“ sind (ebd., S. 241), kann die E-Mail mit der asynchronen Übermittlung punkten. Besonders bei unterschiedlichen und unflexiblen Tagesabläufen, evt. in verschiedenen Zeitzonen, ist diese Form der Kommunikation die effektivere und für beide Partner bequemere. Das Spannungsverhältnis von medialer Schriftlichkeit und konzeptioneller Mündlichkeit und allen daraus resultierenden Eigenschaften verbindet E-Mail und SMS. Während E-Mails jedoch immer (noch) an einen PC und ein E-Mail-Programm gebunden sind, hat die SMS-Kommunikation den Vorteil der Mobilität, weshalb sie auch andere Zwecke erfüllen kann. Beide Kommunikationsformen stehen in Konkurrenz zu den Nutzungsweisen des Telefons, wobei E-Mail die eher personenorientierte Ebene abdeckt, während SMS-Kommunikation die sachorientierte Dimension ersetzen kann.
1.4.5 Chat
Chatten, zu deutsch ungefähr „plaudern, schwatzen“, ist die „wohl populärste Form der Online-Kommunikation“ (Filinski 1998, S. 23), und sicherlich die ungewöhnlichste. Chats können prinzipiell jedem Thema gewidmet sein, werden jedoch meist zur Unterhaltung genutzt, wobei sich meist unbekannte Personen miteinander unterhalten.
Die Kommunikationsform des Chats nimmt einen besonderen Platz zwischen den schon besprochenen mündlichen und schriftlichen Kommunikationsformen ein. Eine Sonderstellung bekommt sie erstens wegen der Zahl der teilnehmenden Kommunikationspartner: Im Chat kann man sich zwar „unter vier Augen“ unterhalten, die Regel sind jedoch Interaktionen zwischen mehreren Personen.
Der wichtigste Punkt ist die schriftlich vermittelte Synchronität der Chat- Kommunikation: „It is a written - or rather, typed - form of communication that is transmitted, received and responded to within a time frame that has formerly been only thought relevant to spoken communication” (Reid 1991). Dies ist geschichtlich bisher einzigartig; nur die SMS-Kommunikation kommt in ihrer Übertragungsgeschwindigkeit und mündlichen Konzeption in die Nähe des Chats.
Auch wenn bis jetzt eher vorsichtig von einer „Zwitterstellung“ (Lenke/ Schmitz 1995, S. 21) die Rede ist, tendiert man doch zu einer Einordnung, die gegenüber der E-Mail und der Newsgroup-Kommunikation deutlich weiter zum mündlichen Pol hin deutet (vgl. Jakobs 1998).
Der Text, den der Sender eingibt, erscheint fast in Echtzeit auf dem Bildschirm: „Was auf den ersten Blick zwanglos formuliert erscheint, ist in Wirklichkeit das Ergebnis konzentrierter Arbeit. Teilnehmer [...] stehen vor dem Problem, unter Zeitdruck eine Vielzahl parallel verlaufender Gesprächsstränge gleichzeitig zu verfolgen und dabei die „Gesprächssituation“ in ihren Teilen wie auch als Ganzes zu überblicken, um sich im geeigneten Moment [...] an der „Gesprächsrunde“ beteiligen zu können“ (Jakobs 1998, S. 196). Hierher rühren auch die vielen Fehler, die bei einer Sichtung von Chat- Kommunikationen ins Auge stechen.
Ebenfalls ein Element der mündlichen Kommunikation ist die charakteristische Flüchtigkeit der Äußerungen; ähnlich wie im face-to-face-Gespräch wird nichts gespeichert. Die Beiträge werden bewusst ähnlich den „turns“ im mündlichen Dialog gestaltet.
Es existieren z. Zt. noch kaum Untersuchungen darüber, warum Menschen chatten und welche sozialen Charakteristika Chatter haben. Während bei themenspezifischen Chats noch das Bedürfnis nach Austausch mit Gleichgesinnten über bestimmte Themen, Wissenserweiterung und Suche nach Informationen angeführt werden könnte, lässt sich über die Gründe für das „zweckfreie“ Chatten nur spekulieren. Instrumentelle Gratifikationen sind hier kaum zu erwarten, eher dürfte der Chat das Bedürfnis nach sozialer Interaktion und nach spielerischer Betätigung befriedigen.
Es zeigt sich, dass die Chat-Kommunikation mit keiner anderen bisher besprochenen Kommunikationsform verglichen werden kann, da es sich beim Chatten um eine gänzlich andere Kommunikationsart mit anderen Inhalten und Zielen handelt. Eine Ähnlichkeit mit der SMS-Kommunikation rührt vor allem aus dem gemeinsamen Spannungsverhältnis zwischen medialer Schriftlichkeit und konzeptioneller Mündlichkeit; diese beschränkt sich aber hauptsächlich auf linguistische Merkmale. Nutzungsweisen und Gratifikationen unterscheiden sich diametral.
2. Kommunikationsregeln
2.1 Kommunikation als regelgeleitetes soziales Handeln
Grundlage jeder Theorie sozialen Handelns ist die Annahme, dass der Mensch nicht durch Einflüsse seiner Umwelt determiniert ist, sondern zielgerichtet, aktiv und kreativ handelt. Handeln ist dabei subjektiv sinnhaft, von soziokulturellen Werten, Normen und sozialen Rollen beeinflusst (Weber 1980, Parsons 1961, Schütz 1960, Luckmann 1992). Der Mensch wird hier nicht primär als Systemelement oder sich reflexartig verhaltender Organismus gesehen, sondern als ein Individuum, das mit anderen Individuen interagiert bzw. kommuniziert.
Mittels der Kommunikation können sich Individuen miteinander verständigen, ihre Handlungen koordinieren und sich Normen und Werte vermitteln, um das einzelne Individuum an die Gesellschaft zu binden. Kommunikation ist somit Voraussetzung für jedes soziale Handeln (Schwalm 1998, S. 44), durch Kommunikation wird die soziale Realität der Akteure von diesen geschaffen und aufrecht erhalten.
Menschen handeln aufgrund der Bedeutung von Dingen und Beziehungen, d.h. sie handeln nicht beliebig, sondern bewerten ihre Handlungen und wählen sie aus den ihnen verfügbaren Alternativen aus. Diese Auswahl kann auf der Basis sozialer Regeln oder Normen erfolgen, an denen sich das Individuum orientiert[25].
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der subjektiven Sinnhaftigkeit des Handelns: „Following a rule is not simply going on in a certain way, it is going on in a certain way for a particular kind of reason“ (Cheal 1980, S. 45). Mit dem subjektiven Sinn, den Individuen bei ihren Handlungen verfolgen, grenzt sich regelgeleitetes Handeln von deterministischem/ mechanistischem Verhalten ab, bei dem es ja ebenfalls zu Regelmäßigkeiten kommen kann.
Durch ihre eingrenzende Wirkung haben Normen eine handlungsökonomisch entlastende Funktion: Sie erleichtern die Orientierung und ermöglichen koordiniertes Handeln (Höflich 1996, S. 34), in letzter Konsequenz ermöglichen sie soziale Ordnung.
Eine zentrale Erkenntnis des Symbolischen Interaktionismus ist, dass soziales Handeln durch Symbole vermittelt erfolgt, die von den Mitgliedern einer Gruppe, Gesellschaft oder eines Kulturkreises geteilt werden müssen. Ohne solche Symbole und geteilte Bedeutungen wäre keine Verständigung möglich (Mead 1968). Kommunikation kann also nur gelingen[26], wenn „nicht alles möglich ist“, d. h. wenn für die am Kommunikationsprozess teilnehmenden Individuen Restriktionen existieren (Höflich 1988, S. 61).
Höflich bezeichnet solche Restriktionen als Kommunikationsregeln: „Die Bezugnahme auf gemeinsame Regeln [...] führt dergestalt zu einer Reduktion kommunikativer Unsicherheiten. Indem sich die Handelnden an gemeinsamen Regeln orientieren, werden kommunikative Folgehandlungen ermöglicht, die die Chance einer Verständigung erhöhen...“ (Höflich 1996, S. 31). Das Regelkonzept ermöglicht eine Verbindung zwischen Handeln und Bedeutung.
Die „Begründer“ der regelgeleiteten Kommunikationstheorie definieren Kommunikationsregeln in einem handlungstheoretischen Kontext als „sets of common expectations about the appropriate responses to particular symbols in particular contexts“ (Cushman/ Whiting 1972, S. 225). Inhaltsregeln betreffen den Gebrauch von Symbolen und strukturieren dadurch die Inhalte der Kommunikation, prozedurale Regeln betreffen den Gebrauch von Kanälen, die Art und Umstände der Kommunikation, sie strukturieren damit die kommunikativen Beziehungen.
Im Zentrum ihrer Betrachtungen stehen „standardisierte Situationen“, die durch relativ klar vorgegebene Regeln stark strukturiert und daher methodisch einfacher zu bearbeiten sind (Cushman et al. 1982, S. 94). Kommunikationsregeln legen für solche Situationen Erwartungen fest und ermöglichen die Selektion von Kommunikationsakten. In vielen Fällen sind mehrere Regeln an eine Situation gebunden. So entstehen Schemata (vgl. dazu Cheal 1980, S. 40) und soziale Rollen (vgl. dazu Dreitzel 1972, S. 128).
Der Ansatz basiert auf der Grundannahme, dass Regeln von den Akteuren benutzt werden, um ihre Handlungen innerhalb einer „heterogeneous social order“ zu koordinieren, mit dem Ziel, bei der Lösung von Problemen Konsens zu erreichen (Donohue et al. 1980, S. 6). Die Akteure wissen also, dass sie verschiedene „conceptions of their mutual problems“ (ebd., S. 14) haben und verwenden Regeln, um zu einer Einigung zu kommen. Dies wird möglich, da bestimmte Regeln fest mit bestimmten Situationen verknüpft sind (die angesprochenen Schemata). So können Regeln bewusst verwendet werden und sind stabil genug, um das Handeln voraussehbar und manipulierbar zu machen.
Das Ziel von Untersuchungen dieser Forschungstradition besteht darin, herauszufinden, „how people use talk“ (ebd., S. 6) bei der Durchsetzung ihrer Ziele.
Ein interpretativer Ansatz, der eher in der Tradition der Konversationsanalyse und der Ethnomethodologie steht[27], nimmt als Grundvoraussetzung das Gegenteil an, nämlich eine „homogeneous social order“ (ebd.), in der Akteure geteilte Regeln annehmen und sich auf diese Annahme verlassen, um Äußerungen des Gegenübers verstehen zu können. „Conversational rules“ sind in diesem Verständnis „the devices that structure the procedures actors use to ,know how’ to interpret and sequence their talk” (ebd.).
Regeln sind hier soziale Einschränkungen, die Akteure benutzen, um zu kommunizieren und Verständnis zu erreichen. Nur so ist es den Menschen möglich, die um sie geschehenden sozialen Ereignisse zu verstehen. Dadurch, dass die Regeln im Gedächtnis der sozialen Gruppe verankert sind und in sozialer Interaktion immer wieder bestätigt werden, können sich die Individuen darauf verlassen, dass auch ihr Gegenüber sich an die Regeln halten wird.
Regeln sind nicht so sehr Handlungsanweisungen für bestimmte Situationen, sondern eher konstante Interpretationsanweisungen für soziale Ereignisse. Regeln sind also nach diesem Verständnis den Akteuren nicht bewusst, solange nicht die soziale Ordnung gestört wird[28], sie können daher von den sie Verwendenden meist auch nicht artikuliert werden. Das Forschungsinteresse gilt in dieser Richtung dem Problem, herauszufinden, „how people make talk“ (ebd.).
Beide Traditionen unterscheiden sich nicht so sehr in ihrem Verständnis, was Regeln sind, sondern vielmehr in ihrer Betrachtung der soziologischen Ebenen, auf denen Regeln wirken. Während der interpretative Ansatz eher auf einer mikrosoziologischen Ebene einzelne Teile von Interaktionen analysiert und dabei wirkende Regeln beschreibt, versucht der handlungstheoretische Ansatz auf einem makrosoziologischen Niveau, zu erklären, wie mit bestimmten Regeln Koordination und Problemlösungen möglich sind[29].
2.1.1 Merkmale von Regeln
Regeln sind zentrale Konzepte in mannigfaltigen wissenschaftlichen Disziplinen, in denen dieser Begriff jeweils anders definiert wird (zu einem theoretischen Überblick vgl. Shimanoff 1980), dazu kommen die verschiedenen Definitionen des Wortes im Alltagssprachgebrauch[30].
Folgende Punkte lassen sich als allgemeine Merkmale von Regeln festlegen:
- Regeln muss man befolgen können
- Regeln sind präskriptiv oder normativ
- Regeln sind handlungsanweisend
- Regeln sind kontextgebunden
- Regeln gelten für eine Klasse menschlichen Handelns, nicht für einzelne Situationen (u.a. Black 1974, Gumb 1972, Cheal 1980).
Ausgehend von diesen Merkmalen definiert Shimanoff eine Regel als „a followable prescription that indicates what behavior is obligated, preferred or prohibited in certain contexts“ (Shimanoff 1980, S. 57).
Die Möglichkeit der Befolgung oder Nichtbefolgung einer Regel unterscheidet sie zunächst vom Gesetz („law”). Ein Gesetz wird erfüllt, nicht befolgt; es fehlt die Möglichkeit der Wahl: „Laws describe noncontrollable phenomena, including human behavior, whereas rules relate only to human behavior, and only to human behavior that is prescribed and can be controlled“ (Shimanoff 1980, S. 39, Hervorhebung im Original). Diese Bedingung rührt aus dem handlungstheoretischen Ansatz her, der Handeln von determiniertem bzw. mechanistischem Verhalten abgrenzt.
Collett (1977) beschreibt für die Regel eine „condition of alteration“ und eine „condition of breach“, d. h. von einer Regel kann abgewichen werden, und man kann sie verletzen (ebd., S. 4). Deshalb sind für regelgeleitetes Handeln zwar Grenzen vorgegeben, aber es ist nicht determiniert. Cheal (1980) bezeichnet regelgeleitetes Handeln deshalb als „patterned indeterminacy“ (ebd., S. 40). Es muss auch möglich sein, eine Regel zu ändern, wenn sie von den Handelnden nicht länger als praktikabel angesehen wird.
Ganz (1971) schränkt weiterhin ein, dass eine Regel empirisch befolgbar sein muss; sie kann kein physikalisch unmögliches oder widersprüchliches Handeln verlangen (ebd., S. 31). Dies schließt aber nicht ein, dass eine Regel praktisch befolgbar sein muss.
Regeln sind präskriptiv oder normativ in dem Sinne, dass sie angemessene Verhaltensweisen in bestimmten Situationen vorschreiben und damit die Bewertung der so vollzogenen Handlungen ermöglichen. Dies stellte schon Max Weber fest, indem er Regeln als Normen charakterisierte, an welchen gegenwärtige, vergangene oder zukünftige Vorgänge im Sinne eines „Werturteils“ gemessen werden (Weber 1968, S. 323). Diese Präskriptivität kann man auch als normative Kraft bezeichnen, die sich als Verbot, Verpflichtung oder Präferenz einer bestimmten Handlungsweise manifestiert. Kann eine Regel, aus welchen Gründen auch immer, nicht befolgt werden, kommt wenigstens Unbehagen auf, und Individuen versuchen entweder, die Situation zu „reparieren“ oder sie begründen ihr fehlerhaftes Handeln mit akzeptablen Gründen (Goffman 1971).
Indem man den Begriff der Sanktion mit einbezieht, werden Handlungen, die erlaubt oder indifferent (neutral) sind, aus der Regel-Definition von Shimanoff ausgeschlossen. Ebenfalls wird klar, dass eine Regel nicht wahr oder falsch sein kann, sie schreibt lediglich angemessenes Handeln vor (vgl. Keller 1974, S. 16).
Das Kriterium, das Regeln von Gesetzen und Befehlen unterscheidet, ist die Kontextualität. Regeln sind im Gegensatz zu Befehlen für ganze Klassen von Situationen gültig. Das bedeutet, dass die normative Kraft einer Regel sich erst in der „passenden“ Situation entfaltet (Ganz 1971, S. 65). Außerdem muss eine Regel die Beschreibung von Bedingungen enthalten, in denen sie zur Anwendung kommen soll. Shimanoff stellt dies in einer Wenn-Dann-Formel dar: „If X, then Y is obligated (preferred or prohibited)“ (ebd., S. 76), wobei dies keine Kausalität bedeuten soll. Eine Regel gilt also für verschiedene Situationen, aber nur für bestimmte Bedingungen.
Für wie viele Situationen eine Regel zutreffen muss, um eine Regel zu sein, ist unklar: Snyder argumentiert für mindestens zwei (ebd., S. 163), während Pearce (1976) verlangt, dass Regeln so häufig angewendet werden müssen, dass statistische Regelmäßigkeiten zu beobachten sind (ebd., S. 26)[31].
Die Zahl von Situationen, in denen eine Regel gilt, ist unterschiedlich. Regeln wie „Wenn ein anderer spricht, sollst du ihn nicht unterbrechen“ gelten für viele Situationen (alle, in denen jemand anders spricht), während „Beim Spielen darfst du keine Miene verziehen“ nur für Pokerspiele gilt. Darüber hinaus gibt es noch Meta-Regeln, die spezifizieren, wann bestimmte Regeln gelten (Höflich 1988, S. 65).
Hieraus ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen der Generalisierbarkeit (der Zahl von Situationen) und der Spezifität, d. h. wie genau das entsprechende Verhalten von einer Regel vorgeschrieben wird (vgl. Cushman/ Whiting 1972, S. 232). Es ergibt sich ein Kontinuum, wobei auf der einen Seite Regeln mit hohem Geltungsbereich und hoher Spezifität stehen (woraus „habitual communication behavior“ entstehen kann) und auf der anderen Seite Regeln mit beschränktem Geltungsbereich und geringer Spezifität (hier wird individuelles kreatives Handeln anzutreffen sein). Ein bestimmter Gehalt an Spezifität und Geltungsbereich muss gegeben sein, damit die Regel nicht zu ungenau wird, d. h. Verständigung nicht mehr möglich ist (ebd., S. 234).
Das handlungsanweisende Element einer Regel bezieht sich wiederum auf die normative Kraft, die sie enthält, und die das Individuum dazu bringt, nach der Regel zu handeln, „statt etwa gar nichts zu tun“ (Höflich 1988, S. 66). Diese Kraft wird dem Individuum während seiner Sozialisation vermittelt, mit der Androhung von Sanktionen verbunden. Zu dem so entstandenen inneren Zwang kommt der äußere durch Personen, die qua Autorität einer Regel Gültigkeit verleihen können. Nicht für jede Regel lässt sich ein „Begründer“ i. S. einer konkreten Person oder Gruppe finden, aber hinter jeder Regel steht die Drohung der Sanktion im Falle einer Abweichung, es existieren also immer „Instanzen mit entsprechendem Sanktionspotential“ (ebd.). Ohne die Angst vor Sanktionen bzw. das Streben nach positiver Bewertung wäre eine Regel nach der vorliegenden Definition nicht gegeben.
Collett (1977) unterscheidet zwischen positiv (durch Belohnung) und negativ (durch Bestrafung) sanktionierten Regeln: Die erzwungene Einhaltung durch negative Sanktionen betrifft solche Regeln, die zentral für die soziale Ordnung und leicht zu befolgen sind und/ oder deren Einhaltung erwartet wird, während Belohnungen in Aussicht gestellt werden für die Einhaltung von Regeln, die eher unwichtig für die Aufrechterhaltung sozialer Ordnung oder deren Einhaltung nicht unbedingt erwartet wird (vgl. ebd., S. 21).
Cushman et al. (1986) sprechen in diesem Zusammenhang von der „praktischen Kraft“ einer Regel, die sich aus der Intensität (die wahrgenommene Wichtigkeit, die sich aus der Stärke der potentiellen Sanktionen ergibt) und der Kristallisierung (die Übereinstimmung über potentielle Sanktionen) ergibt (ebd., S. 47).
Sanktionen können aber auch ausbleiben, ohne dass dies auf die Nichtexistenz einer Regel schließen lassen würde. Shimanoff (1980) hebt dabei den Statusaspekt hervor: Es gelten nicht nur unterschiedliche Regeln für Interaktionsteilnehmer mit unterschiedlichem Status, sondern ein höherer Status kann ein „rule-allowance behavior“ mit sich bringen, i. S. einer erlaubten Regelübertretung (ebd., S. 114). Ebenfalls können Sanktionen ausbleiben, wenn der Regelbruch unbemerkt bleibt, zur Belustigung beiträgt oder als neue Regel anerkannt wird oder wenn andere Regeln wie Takt und Höflichkeit gegenüber dem Regelverletzer wirksamer sind als die Ausübung von Sanktionen (ebd., S. 98).
Der Zwang bzw. die praktische Kraft sind es schließlich, die regelgeleitetes Handeln vorhersehbar machen und den Interaktionsteilnehmern Prognosen über das Handeln des Gegenüber ermöglichen. Mit der Inaussichtstellung von Sanktionen werden solche Erwartungen durchsetzbar.
Während Ganz (1971) betont, dass Regeln Handlungen in bestimmten Situationen verlangen (ebd., S. 71), argumentiert Shimanoff (1980), dass es auch Regeln gibt, die sich auf Personen beziehen („Fremde und Vorgesetzte spricht man mit Nachnamen an, Freunde und Untergebene mit Vornamen“, ebd., S. 51). Sie verallgemeinert diese Feststellung allerdings wieder, da auch personenbezogene Regeln das Verhalten diesen gegenüber festlegen.
Hieraus ergibt sich, dass Regeln befolgt werden müssen (Handeln), aber dass dies nicht bewusst im Sinne einer Regelbefolgung geschehen muss (Kognition). Analog zu einem „Sprach- oder Rechtsgefühl“ (Hayek 1963, S. 45) haben Menschen ein Gefühl dafür, welches Verhalten je nach Situation angemessen oder unangemessen ist, ohne dafür konkrete Regeln nennen zu können. Shimanoff bezeichnet solche Regeln als „implicit“ (ebd., S. 55)[32]. Solche Regeln zeigen sich immer wieder sehr anschaulich in den Arbeiten von Goffman und Garfinkel, wobei letzterer Regeln in Gewohnheiten und Routinen dadurch kenntlich macht, dass er sie bricht (Garfinkel 1973). Hier wird auch verdeutlicht, dass Individuen meist nicht nach konkret bekannten Regeln handeln, sondern eher ein taktisches Regelbewusstsein haben (vgl. die Argumentation von Höflich 1988, S. 67).
2.1.2 Funktion von Regeln
Geht man davon aus, dass Regeln zwischen Kommunikationspartnern konsensuell festgelegt werden müssen, um die Situation zu bestimmen, in der sich die Handelnden befinden, ergeben sich folgende Funktionen für Regeln (die aber nicht mit den Regeln gleichgesetzt werden dürfen, wie Shimanoff (1980) betont [ebd., S. 83ff.]):
- Regulation des Verhaltens
- Interpretation des Verhaltens
- Bewertung des Verhaltens
- Rechtfertigung des Verhaltens
- Korrektur des Verhaltens
- Verhaltensvoraussage und
- Erklärung des Verhaltens
(Shimanoff 1980, S. 83f., zit. nach Höflich 1996, S. 41f.). Während die meisten dieser Funktionen sich auf die sozialen Akteure beziehen, sind die Interpretation und Voraussage von Verhalten von besonderem Interesse für die wissenschaftliche Untersuchung von Regeln.
Regeln spezifizieren situationsadäquates Verhalten, ohne es allerdings festzuschreiben; sie fungieren als Selektionskriterien für mögliche Handlungsalternativen, machen Handeln so in gewissen Grenzen voraussehbar und erleichtern die Orientierung der Handelnden. Die den Regeln immanente normative Kraft zeigt sich an den Sanktionen, die über nicht regelkonformes Verhalten verhängt werden. Regeln stehen also für kollektive Vorstellungen davon, welches Handeln angemessen ist und welches nicht. Bewertungen werden dabei nicht nur dem Handeln eines Akteurs zugeschrieben, sondern auch seiner Person. Vor diesem Hintergrund ermöglicht der Bezug auf Regeln den Akteuren die Rechtfertigung ihres Handelns.
Überdies schreiben Regeln den mit ihnen verbundenen Handlungen Sinn zu bzw. konstituieren diesen, indem sie den Situationen, in denen sie gelten, soziale Bedeutung verleihen und zwischen den Akteuren, von denen sie geteilt werden, Verständigung erzeugen. Hierauf weist insbesondere Giddens ( 1988, S. 70) hin, der die Funktion von Regeln im Prozess der Herstellung von Intersubjektivität betont.
2.2 Regelgeleitete mediatisierte interpersonale Kommunikation
Strenggenommen ist jede Kommunikation zugleich medial vermittelte Kommunikation (Burkart 1983, S. 35), da auch Sprache, Mimik und Gestik als Medien zu begreifen sind.
Im folgenden sollen mit dem Begriff „Medium“ manifeste Transportmittel für menschliche Kommunikation bezeichnet werden, die Pross (1972) als sekundäre und tertiäre Medien einordnet: Zum einen sind dies Kommunikationsformen, die nur auf der Produktionsseite ein „Gerät“ erfordern (Brief, Zeitung, Fernseher etc.), und zum anderen technische Medien, bei denen sowohl Sender als auch Empfänger Geräte zur En- und Dekodierung der Mitteilungen benötigen.
Was geschieht nun, wenn ein solches Medium in die interpersonale Kommunikation zwischengeschaltet wird? In einem handlungstheoretischen Kontext kann es nicht nur darum gehen, Medien als neutrale Übermittler von Informationen zu betrachten.
Jedes Medium[33] erlaubt nur eine ganz bestimmte Form, in der eine Mitteilung übermittelt werden kann, es stellt m. a. W. einen medienspezifischen Rahmen zur Verfügung, innerhalb dessen bestimmte Ausdrucksformen als Zeichen fungieren (Burkart 1983, S. 37). Medien gewinnen außerdem als Symbole wie auch als kulturelle Artefakte Bedeutung und Sinn. Dadurch wird ihnen selbst eine soziale Bedeutung zuteil, und ihr Gebrauch wird zu einer sozialen Praxis (vgl. Höflich 1991).
Unabhängig von dem Inhalt, den sie transportieren, erlangen Medien damit selbst eine sozial normierte Bedeutung, oder wie Marshall McLuhan es formulierte: „Das Medium ist die Botschaft“ (McLuhan 1970).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 medienbezogene Bedeutungszuschreibung (Höflich 1996, S. 105)
Höflich (1997) nennt drei kommunikative Besonderheiten für Medien der interpersonalen Kommunikation: Medien sind (1) kulturelle Artefakte und somit Träger von Bedeutung, deren Funktion es (2) ist, Inhalte zu übermitteln, die ebenfalls durch den bedeutungsvollen Charakter des Mediums beeinflusst werden. Dies geschieht (3) unter medienspezifischen Kodierbedingungen (ebd., S. 204).
Die Praxis der Medienverwendung erlangt zugleich Auswirkungen auf die Bedeutung der medial vermittelten Inhalte, was man analog zu Watzlawick et al. (1985) als den Beziehungsaspekt von Kommunikation beschreiben kann, der sich auf den Inhaltsaspekt bezieht und diesen durch zusätzliche Informationen verständlich macht, „daher Metakommunikation“ ist (ebd., S. 56). Da medial vermittelten Kommunikationssituationen in aller Regel der nonverbale Kanal, teilweise auch der akustische Kanal fehlt, ersetzt das Medium als Zeichen in gewisser Weise diesen Kanal (vgl. Höflich 1991, S. 84).
Ein handgeschriebener Brief steht für Nähe, das Telefon für Dringlichkeit, eine E-Mail für Professionalität und Eile. So werden auch die mit diesen Medien verbundenen kommunikativen Situationen mit Nähe, Direktheit oder Eile assoziiert bzw. eine Nachricht wird je nach dem Medium mit dem sie übermittelt wird, anders verstanden.
Mit der Festlegung von Gebrauchs- und Nutzungsweisen ergibt sich so eine kommunikative Alltagspraxis. Hier wird definiert, ob, wie und zu welchen Zwecken ein Medium benutzt werden kann und soll, um auf sozial akzeptierte Art zu kommunizieren.
Die Kommunikation über Medien wird gegenüber der „klassischen“ Gesprächssituation, der face-to-face-Interaktion, stets potentiell defizitär wahrgenommen. Dies liegt vor allem darin begründet, dass eine mediatisierte Gesprächssituation immer mehr oder weniger entkontextualisiert ist (vgl. Höflich 1991, 1997) - beim Telefon ist die Interaktion auf den akustischen Kanal beschränkt, beim Brief gar auf phasenverzogene Schriftlichkeit etc. Zudem fehlt den Interaktionspartnern die gemeinsame Orientierung im Raum, teilweise sogar in der Zeit, sie sind (meist) unsichtbar füreinander den Einflüssen der sie jeweils umgebenden Umwelt ausgesetzt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Mediale Kommunikationsrestriktionen (vgl. Höflich 1997, S. 208)
Aus der Tatsache, dass bei mediatisierter Kommunikation dennoch nicht mehr Störungen in der Interaktion auftreten als bei direkter face-to-face-Kommunikation[34], lässt sich jedoch eindrucksvoll herleiten, dass es Akteuren auch in diesen Situationen gelingen muss, eine gemeinsame Definition der Situation vorzunehmen und nach damit verbundenen Regeln zu handeln: Sie sind in der Lage, „medienadäquat“ zu kommunizieren (Höflich 1991, S. 77). In diesem Sinne sollte man auch nicht von einer Dekontextualisierung, sondern eher von einer „Rekontextualisierung“ (Meyrowitz 1990, S. 72) sprechen, da es „eine kontextfreie Kommunikation überhaupt nicht gibt“ (Höflich 2000, S. 89).
In Anlehnung an Goffman (1977) kann man hier den Begriff der Medienrahmen einführen, die als „[...] metakommunikative handlungsleitende interpretative Hinweise [fungieren]“, und „die ein Erschließen dessen, ‚was vor sich geht’ ermöglichen“ (Höflich 2000, S. 90)[35].
Um den Kontextverlust bzw. -wechsel auszugleichen, den jedes Medium für die Kommunikation mit sich bringt, müssen die Akteure die (technischen) Regeln beherrschen, die zum Gebrauch des Mediums notwendig sind, aber auch die sozialen Regeln, die festlegen, wann, wie und zu welchem Zweck ein Medium angemessen verwendet wird, wie man die medial vermittelten Kommunikationssituationen mit ihren je eigenen Kodiergrenzen bewältigt und welche symbolische Bedeutung mit der Wahl eines Mediums übermittelt wird. Hierbei kommen sowohl Kommunikationsregeln zur Anwendung, die auch für direkte Interaktion gelten können[36], als auch spezifische Regeln, die nur bei medial vermittelter Interaktion zur Geltung kommen.
Hinsichtlich kulturabhängig unterschiedlicher Nutzungsweisen und Wahrnehmungen verschiedener Medien führt Wiest (1997) eine Unterscheidung zwischen dem „primären Kode“, also den unerlässlichen Handgriffen zur Inbetriebnahme und Nutzung eines Mediums, und dem „sekundären Kode“ ein, der nicht nur kultur-, sondern auch kontextabhängig variabel ist und medienspezifische Gebrauchsformen im Rahmen einer standardisierten kommunikativen Praxis festlegt.
Höflich (1997) unterscheidet innerhalb dieses sekundären Kodes zwischen prozeduralen Regeln, die „als sozial konsentierte Standards eine mediale Konversation überhaupt erst ermöglichen“ (ebd., S. 210), und medienbezogenen Regeln, die festlegen, welches Medium situations- und zielabhängig zu verwenden ist, „um Kommunikationsabsichten sozial adäquat realisieren zu können“ (ebd., S. 214). Clyne (1985) bezeichnet diese als Kanalregeln, „indicating whether communication for a particular purpose in a specific situation will take place in face- to- face interaction, over the telephone, in freely constructed or formalistic letters, or through the completion of written forms” (ebd., S. 13).
Diese Regeln stellen somit eine intersubjektiv geteilte Grundlage der Medienverwendung sicher[37]. Sie sind damit auch die Grundlage für eine gemeinsame Definition der entsprechenden Kommunikationssituation bzw. des Medienrahmens, in dem dann prozedurale Regeln zur Anwendung kommen können.
Werden diese Regeln bezüglich eines Mediums von einem Großteil der Gesellschaftsmitglieder geteilt und eingehalten, spricht man von einem standardisierten Gebrauch (vgl. Cushman/ Florence 1974, S. 12).
In der folgenden Untersuchung sollen jedoch weniger die medienbezogenen bzw. Medien-/ Kanalregeln betrachtet werden, da dies eine tiefergehende Beschäftigung mit Medienwahltheorien sowie Uses-and-Gratifications-Untersuchungen erfordern würde. Der Begriff „Medienregeln“ wird wegen seiner Kürze auch weiterhin als Oberbegriff für medienbezogene und prozedurale Regeln im Umgang mit Medien verwendet.
Ein Medium kann aber auch unterschiedliche Bedeutungszuweisungen erhalten, die von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Subgruppen ausgehen können. Dies kann sich nicht nur in unterschiedlichen Besitz- oder Verfügungsverhältnissen zeigen, sondern auch in differenzierten Nutzungsweisen. Man kann also mit Claisse (1989) feststellen, dass „ab einem gewissen Grad allgemeiner Zugänglichkeit einer Technik soziale Differenzierungen sich nicht mehr an ihrem Erwerb, sondern an der Art ihrer Handhabung festmachen“ (ebd., S. 278). So kann ein Medium nicht nur funktional unterschiedlich wahrgenommen und genutzt, sondern auch distinkt verwendet werden, z. B. als Statussymbol oder zur Demonstration von Gruppenzugehörigkeit[38]. Hinzugefügt werden sollte noch, dass dies nicht erst nach einer erfolgten Diffusion geschehen kann, sondern auch am Beginn der Einführung eines neuen Mediums (z. B. des Mobiltelefons).
Weiterhin muss hinzugefügt werden, dass Kommunikations- und medienbezogene Regeln nicht ein für allemal feststehen. Gerade bei der Einführung neuer Medien, die die Aufgaben alter Medien übernehmen, aber auch gänzlich neue Kommunikationsmöglichkeiten eröffnen können, werden Medienregeln neu interpretiert, lösen sich auf oder verändern sich. Höflich (1997) spricht in diesem Zusammenhang von einem „umfassenden kulturellen Kontext“ (ebd., S. 220), in dem Kommunikation und besonders mediatisierte Kommunikation jederzeit steht und durch den sie geprägt wird.
Das „Lernen“ von medienspezifischen und prozeduralen Regeln erfolgt in einem „process of learning the context“ (Myers 1987, S. 264). Sind Regelsysteme für neue Medien noch nicht in das soziale Alltagswissen vorgedrungen, kann man Unsicherheiten der Akteure in Bezug auf Mediensituationen beobachten. So soll in den Anfangsjahren des Telefons die entsprechende Situation geprägt von affektiver Hemmungslosigkeit gewesen sein, ebenso wie die gegenwärtige Chat- und E-Mail-Kommunikation durch flaming-Attacken einzelner Nutzer gestört wird. Dies lässt sich eindeutig auf eine defizitäre normative Grundlage zurückführen, da einfach noch keine Regeln für den jeweiligen medialen Rahmen existieren.
Kiesler et al. (1984) führen jedoch weiter aus, dass die beobachtete Enthemmung generell für technisch vermittelte Kommunikation gelten könnte. Durch die Entkontextualisierung sind die Interaktionspartner weniger durch Attribute ihres physisch anwesenden Gegenübers beeinflusst und verhalten sich so „freier“: „Without reminder of an audience, people became less constrained by conventional norms and rules for behavior“ (Sproull/ Kiesler 1991, S. 40). Während der Computer personalisiert und beschimpft oder gehätschelt wird, scheinen Personen am anderen Ende der Leitung durch den Wegfall des Beziehungsaspekts bei vermittelter Kommunikation weniger als solche wahrgenommen zu werden.
Hier kann nur die Ausbildung und Einforderung einer Medienetikette helfen, wie sie für das Telefon erstellt wurde („telephone courtesy“, O.N. 1904) oder wie sie sich momentan für die Kommunikation im Internet durchsetzt („Netiquette“).
3. Methodik
3.1 Rekonstruktion von Regeln
Das Auffinden von expliziten Regeln als Handlungsgründe scheint zunächst relativ einfach; man muss „nur“ die Akteure fragen, nach welcher Regel sie gerade handeln. Weniger einfach ist das Auffinden von impliziten Regeln, denn entweder die Akteure sind sich gar nicht bewusst, dass sie nach einer Regel handeln (vgl. die Beispiele von Garfinkel 1973), oder sie können sie nicht sprachlich korrekt darstellen: „[...] they often deny that there are any rules, and they are made anxious by suggestions that such is the case“ (Hall 1969, S. 159).
Aber auch das Auffinden expliziter Regeln kann zum Problem werden. Cheal (1980, S. 46) nennt mehrere Probleme, die sich aus dem Befragen von Akteuren ergeben können: die Handelnden können sich weigern, eine Regel zu nennen oder eine vom Forscher angebotene Formulierung ablehnen oder aber eine Regel falsch benennen, aus manipulativen Gründen (weil die Regel z. B. eine gruppeninterne ist und nicht verraten werden darf) oder aber weil sie sich selbst und ihr Handeln besser oder auf eine sozial vorteilhaftere Weise darstellen wollen (vgl. auch Douglas 1976, S. 126, Garfinkel 1967, S. 114).
Winch (1958) stellt denn auch fest, dass „the test of whether a man’s actions are the application of a rule is not whether he can formulate it but whether it makes sense to distinguish between a right and a wrong way of doing things in connection with what he does” (ebd., S. 58, Hervorhebung im Original). Ein Regelbewusstsein lässt sich bei einem Akteur dann verlässlich erkennen, wenn er in der Lage ist, Situationen zu erkennen und zu definieren, in denen er auf eine bestimmte, ihm ebenfalls bekannte Weise handeln sollte (nicht: muss). Nach den Gründen für sein Handeln gefragt, muss er ein Motiv nennen können, da sein Handeln ja subjektiv sinnhaft ist. Cheal (1980) nennt die idealtypische Antwort: „because that is the correct way to act“ (ebd., S. 45).
[...]
[1] Obwohl im deutschen Sprachraum vorrangig die Bezeichnung „Handy“ verwendet wird, werde ich den Begriff „Mobiltelefon“ beibehalten, da in der englischsprachigen Literatur meist von „mobile phone“ oder „cellular phone“ die Rede ist. Zu weiteren fremdsprachlichen Alternativen siehe Höflich (2001a).
[2] Diese technische Einschränkung, die oft als Nachteil der SMS-Kommunikation empfunden wird, weckt aber mancherorts ungeahnte kreative Potentiale: der Uzzi-Verlag schrieb im Jahr 2001 auf seiner Website den Wettbewerb „160 Zeichen“ aus. Die originellsten eingesandten SMS-Nachrichten wurden veröffentlicht und mit – natürlich – 160 DM prämiert (O.N. 2001a)
[3] Übersetzt: „Hast du Lust auf ein Bier?“
[4] Diese technische Einschränkung scheinen finnische Mädchen zu kompensieren, indem sie besonders aufhebenswerte Nachrichten in Poesiealben übertragen (O.N. 2001b).
[5] Exemplarisch dafür ist der neue Musiksender Viva Plus, bei dem eingesendete Textnachrichten der jugendlichen Zuschauer rund um die Uhr über den Bildschirm laufen. Dieses Prinzip unterscheidet sich vom SMS-Chat, der z. B. im Videotext von Sat1 angeboten wird, denn die eingespielten SMS beschränken sich auf schriftliche Grüße an zuschauende Freunde oder „an alle Welt“. Dies kann m.E. nicht mehr als dialogische Kommunikation betrachtet werden.
[6] In der Altersgruppe der 15-19jährigen liegen die Besitzverhältnisse bei 15% im niedrigen Bildungsniveau gegenüber 17% in hoch gebildeten Elternhäusern; dieses Verhältnis verstärkt sich in der Altersgruppe der 20-24jährigen zu 24% bei niedrigem gegenüber 43% bei hohem Bildungsniveau der Eltern.
[7] Zu den Folgerungen, die Fritzsche daraus zieht und einer Beurteilung dieser Ausführungen siehe Höflich/ Rössler (2001b).
[8] In ihrem Forschungsprojekt „Jugendliche und SMS. Gebrauchsweisen und Motive“ finden Höflich und Rössler, dass mehr als drei Viertel der von ihnen befragten Jugendlichen schon einmal via SMS geflirtet haben (Höflich/ Rössler 2001a, S. 12).
[9] So verwundert es, dass die Hälfte dieser Altersgruppe auf jede ihrer Textnachrichten eine Antwort erwartet (Schlobinski et al. 2002, S. 29).
[10] Wird vom Absender dennoch ein Telefongespräch gewünscht, kann er sich mittels einer Kurznachricht für dieses „anmelden“, der Empfänger entscheidet dann, ob er das Angebot annehmen möchte (vgl. Androutsopoulos/ Schmidt 2001, S. 11).
[11] Für ein amüsantes Beispiel über den Gebrauch von Wortkreationen, die aus der Benutzung von Texteingabehilfen entstanden, siehe Androutsopoulos/ Schmidt (2001), S. 20.
[12] Dieses letztere Motiv muss übrigens bei der Mehrzahl der Mobiltelefon – Käufe als vorrangige Anschaffungsmotivation herhalten (O.N. 2002c, Haddon 2000, Logemann/ Feldhaus 2002) und ist in den letzten Jahren zu einer „urban legend“ (Ling 2000a, S. 6) geworden.
[13] 15% der Nachrichten von Jugendlichen sind dazu da, das nächste (Festnetz-) Telefongespräch zu verabreden; damit wird das Risiko, dass ein anderes Familienmitglied den Anruf entgegennimmt, minimiert (Grinter/ Eldridge 2001).
[14] Obwohl gerade für erwachsene SMS-Nutzer überhaupt keine repräsentativen Daten vorliegen, nehme ich vorläufig die Ergebnisse der wenigen nicht-repräsentativen Untersuchungen als Basis für meine Darlegungen.
[15] Da die Lebensphase Jugend in den letzten Jahren weit über das 18. Lebensjahr hinaus verlängert worden ist, wäre eine dahingehende Hypothese, dass auch die bisher zu ihrem SMS-Verhalten befragten Erwachsenen noch nicht so „erwachsen“ waren, dass sie keinen Freundeskreis mehr gehabt hätten.
[16] Schon seit längerer Zeit ist das Mobiltelefon kein Elitemedium mehr und fungiert deshalb immer weniger als gesellschaftliches Statussymbol, wie es Schneider (1996) eher ironisch charakterisiert hat.
[17] Fast jedes Mobiltelefon hat heute die Funktion der „Caller-ID“; d.h. die Nummer des Anrufenden wird im Display angezeigt, wenn dies nicht extra unterdrückt wird.
[18] Dies legen Studien zum Gebrauch von Telefon und Mobiltelefon nahe, die sehr ähnliche Gratifikationen ergaben; vgl. dazu Dimmick et al. (1994) und (2000).
[19] Während Androutsopoulos und Schmidt (2001) den Anrufbeantworter in die Reihe der interpersonellen Medien aufnehmen, werde ich das nicht tun, da dieses Gerät m. E. aus der Reihe fällt: es erlaubt zwar dem Sender, eine Nachricht zu übermitteln, der Empfänger muss aber für eine Antwort auf ein anderes Medium ausweichen.
[20] Bedauerlich ist, dass diese Studie zwar repräsentativ ist, aber leider nur für die Grundgesamtheit der Internet-Nutzer.
[21] In einer Untersuchung von Claisse (1989) ergab sich ein Anteil von 40% für Gespräche mit Familienangehörigen sowie 36% im Bekanntenkreis (ebd., S. 259).
[22] Empirische Untersuchungen zu diesem Thema lassen sich nicht finden; ich bin hier auf eigene Erfahrungen und Vermutungen angewiesen.
[23] Im Zuge der fortschreitenden „intermedialen Konvergenz“ (Höflich/ Rössler 2001b, S. 440) ist die E-Mail nicht mehr auf den PC beschränkt, sondern kann auch an ein Mobiltelefon gesendet bzw. von einem solchen aus geschickt werden.
[24] Auch hier sind pragmatische Gründe anzuführen: während ein Brief den Wirkungsbereich des Senders materiell verlässt, ist eine gesendete E-Mail im Postausgang des Mail- Programms gespeichert und kann vom Sender eingesehen werden. Dazu kommt, dass eine Antwort per E-Mail im allgemeinen schneller erfolgt als eine postalische, der Sender also den Inhalt seiner Anfrage noch gut in Erinnerung haben müsste.
[25] Die Begriffe „Regel“ und „Norm“ bezeichnen dasselbe, wenn man Norm soziologisch und nicht alltagswissenschaftlich als „normal“ definiert. Sie werden im Folgenden auch synonym verwendet.
[26] Ich gehe hier von der Kommunikationsdefinition von Reimann aus, die besagt, dass Kommunikation die vollzogene Bedeutungsvermittlung ist, die sich aus wechselseitigen Handlungen der Kommunizierenden ergibt. Es kommt also auf das Ergebnis an, nicht auf den Versuch (Reimann 1974, S. 74).
[27] Als Vertreter dieses Ansatzes gelten u.a. Robert E. Nofsinger (1974, 1976), Leonard C. Hawes (1976), Harvey Sacks et al. (1974) und natürlich Harold D. Garfinkel (1967).
[28] Hier setzt Garfinkel (1967) seine Krisenexperimente an.
[29] Zu einem ausführlichen Überblick über Inhalte, Vertreter und Kritiken an den genannten Ansätzen siehe Donohue et al. (1980).
[30] Ganz (1971) identifizierte über 70 Synonyme für das Wort „rule“ im Englischen.
[31] Hier sollte man vorsichtig sein, denn offensichtlich muss regelmäßiges Verhalten nicht einer Regel folgen, sondern es kann von ganz anderen Faktoren beeinflusst sein.
[32] Ganz (1971) ist hingegen nicht zuzustimmen, wenn sie die Existenz impliziter Regeln verneint („one cannot follow that which one is unaware of“ [ebd., S. 28ff.]), aber dafür von regelgeleitetem Handeln spricht, wenn „zufällig“ in Übereinstimmung mit einer Regel gehandelt wird. In einem solchen Fall wäre die Sinnhaftigkeit des Handelns m.E. nicht mehr gegeben.
[33] Hier kann der Begriff „Medium“ wieder in seiner gesamten Bedeutungsspanne verstanden werden.
[34] Zu entsprechenden Untersuchungen bzgl. des Telefons vgl. Beatti/ Barnard (1979).
[35] Diese Beschreibung ähnelt der des Regelbegriffs bzgl. der Sinnkonstruktion, der Handlungsanweisung und der Kontextspezifität, jedoch mit der wichtigen Einschränkung, dass hier nicht von einer Präskriptivität i. S. einer normativen Kraft mit Sanktionspotential die Rede ist. Ein Rahmen ist denn auch dem Regelkonzept übergeordnet, er „enthält“ jeweils einen bestimmten Regelbestand (vgl. Goffman 1977, S. 34).
[36] In diesem Zusammenhang weisen Cathcart/ Gumpert (1986) darauf hin, dass jede vermittelte Kommunikation nur dann als interpersonale Kommunikation funktionieren kann, wenn die Partner so tun, als ob sie in einer Face-to-face-Situation wären und die Tatsache der Mediatisierung nicht thematisieren (ebd., S. 325).
[37] Zur empirischen Untersuchung solcher Regeln vgl. Noble (1987b), Lange et al. (1990).
[38] Auch die prozeduralen Regeln eines Mediums lassen sich distinktiv verwenden, wie man am Sprachgebrauch in Chat-Kanälen oder MUDs erkennen kann. Hier werden Nicht-Gruppenmitglieder sprachlich ausgegrenzt.
- Arbeit zitieren
- Jenny Haroske (Autor:in), 2002, Medienregeln für die Kommunikation über Short Message Service (SMS), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13091
Kostenlos Autor werden








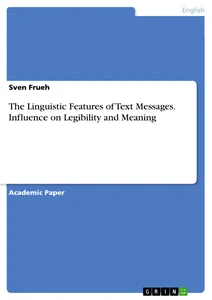









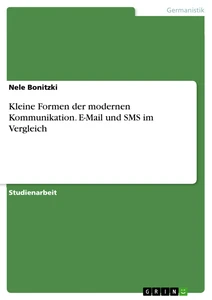

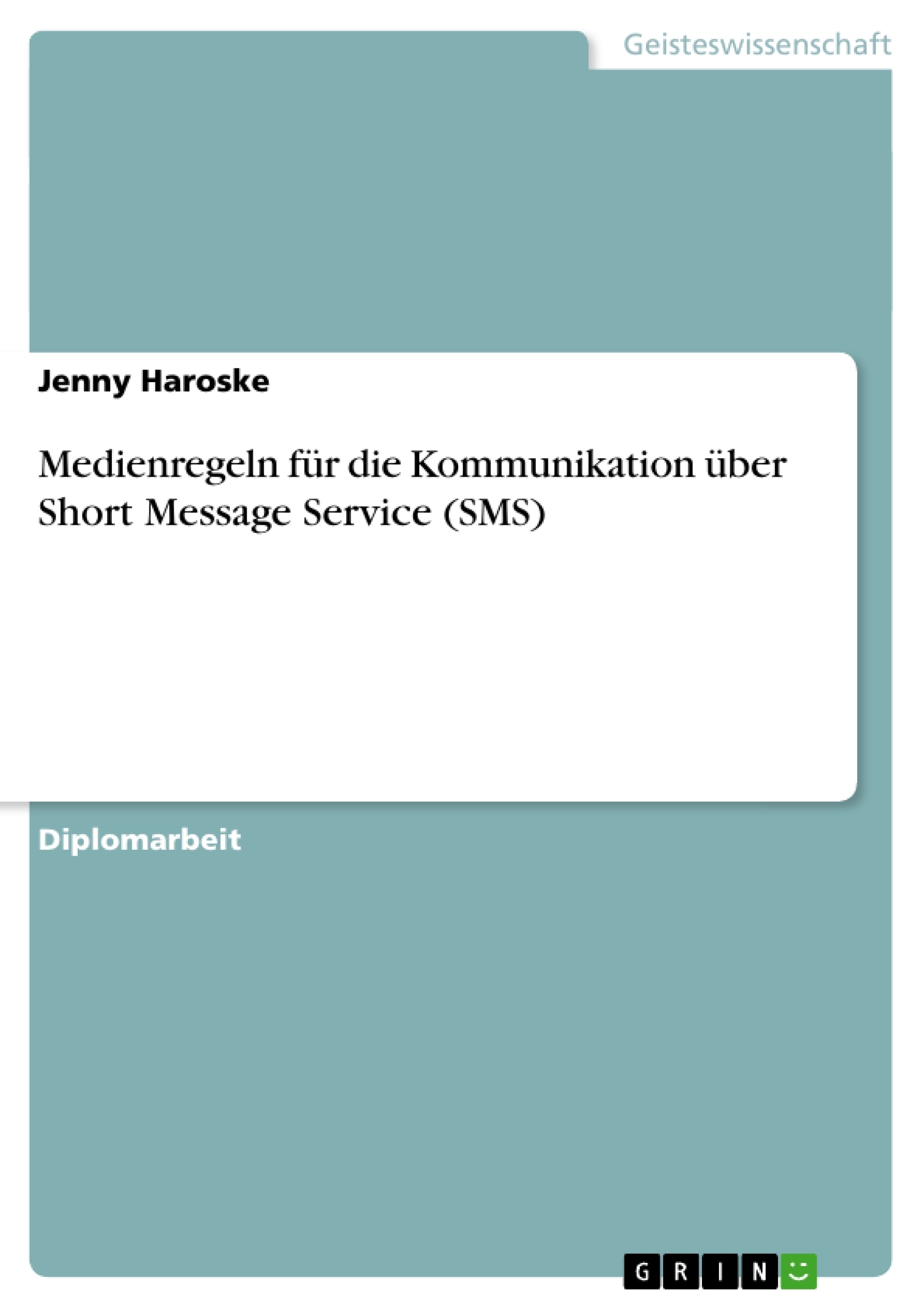

Kommentare