Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Problemstellung und Zielsetzung
1.2. Aufbau der Arbeit
1.3. Abgrenzung
2. Das Strategische Management als Rahmenkonzept
2.1. Grundlagen des Strategischen Managements
2.2. Das 7S-Modell von Peters / Waterman
2.3. Der Strategische Fit als Kerngedanke
2.4. Folgerungen für die Arbeit
3. Grundlagen zur Unternehmenskultur
3.1. Einführung
3.2. Das Phänomen der Unternehmenskultur
3.2.1. Der Begriff »Kultur«
3.2.2. Perspektiven der Unternehmenskulturforschung
3.2.3. Der Begriff »Unternehmenskultur«
3.2.4. Eigenschaften der Unternehmenskultur
3.2.5. Ebenen der Unternehmenskultur
3.3. Einflüsse auf die Unternehmenskultur
3.3.1. Individuum und Unternehmensführung
3.3.2. Gesellschaft und Branche
3.3.3. Subkulturen
3.3.4. Strategie und Struktur
3.4. Wirkung der Unternehmenskultur
3.4.1. Positive Wirkungen
3.4.2. Negative Wirkungen
3.4.3. Wirkungen auf die Subsysteme des Strategischen Managements
4. Grundlagen des Innovationsmanagements
4.1. Einführung
4.2. Die Begriffe »Invention« und »Innovation«
4.3. Innovationsarten
4.4. Der Innovationsprozess
4.5. Der Begriff »Innovationsmanagement«
5. Die Einordnung der Innovationsfähigkeit
5.1. Der Begriff »Innovationsfähigkeit«
5.2. Die Bestimmungsgrößen der Innovationsfähigkeit
5.3. Die Dimensionen der Innovationsfähigkeit
5.4. Innovationsfähigkeit und Innovationserfolg
5.4.1. Einflussgrößen des Innovationserfolgs
5.4.2. Messung des Innovationserfolgs
6. Unternehmenskultur-Typologien mit Innovationsbezug
6.1. Wesen und Schwächen von Kulturtypologien
6.2. Branchenkultur-Typologie nach Deal / Kennedy
6.3. M-O-Typologie nach Burns /Stalker
6.4. Zweidimensionale Typologie nach Cameron /Freeman
6.5. Kulturdimensionen nach Bleicher
7. Merkmale einer Innovationskultur
7.1. Der Begriff «Innovationskultur»
7.2. Grundannahmen einer Innovationskultur nach Schein
7.3. Die Ausrichtung der Offenheit in einer Innovationskultur
7.4. Die Ausrichtung der Differenziertheit in einer Innovationskultur
7.5. Die Rolle der Führung in einer Innovationskultur
7.6. Die Rolle der Mitarbeiter in einer Innovationskultur
8. Indikatoren einer Innovationskultur
8.1. Indikatoren im Unternehmens-/Umweltkontext
8.1.1. Alter des Unternehmens
8.1.2. Unternehmensgröße
8.1.3. Anzahl der Subkulturen
8.1.4. Positives Betriebsklima
8.2. Indikatoren im Symbolsystem
8.2.1. Innovationsförderliche Raumgestaltung
8.2.2. Innovationsbezogene Umgangsformen, Rituale und Legenden
8.3. Indikatoren im Anwendungssystem
8.3.1. Offenes Kommunikationsverhalten
8.3.2. Die Fähigkeiten der „Lernenden Organisation“
8.3.3. Systemdenken
8.3.4. Balance zwischen Markt- und Technologieorientierung
8.3.5. Unternehmertum im Unternehmen
8.3.6. Innovationsorientiertes Führungsverhalten
8.4. Indikatoren im Managementsystem
8.4.1.Innovationsorientiertes Unternehmensleitbild
8.4.2. Innovationsorientierte Ziel- und Strategiegestaltung
8.4.3. Innovationsorientierte Organisationsgestaltung
8.4.4. Institutionalisiertes Innovationsmanagement
8.4.5. Innovationsorientiertes Kommunikationssystem und Wissensmanagement
8.4.6. Innovationsorientiertes Anreizsystem
8.4.7. Innovationsorientiertes Personalmanagement
8.4.8. Innovationsorientiertes Kontrollsystem
9. Schlussbetrachtung
9.1. Zusammenfassung der Ergebnisse
9.2. Kritische Würdigung
9.3. Ausblick
9.3.1. Empirische Forschung
9.3.2. Instrument zur Diagnose einer Innovationskultur
9.3.3. Verankerung einer Innovationskultur
Literaturverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1 - Modell der Untersuchung
Abbildung 2 - Das Strategische Dreieck
Abbildung 3 - Das 7S-Modell im Kontext des Fit-Gedankens
Abbildung 4 - Einordnung der Fragestellung im Strategischen Management
Abbildung 5 - Das Schichtenmodell der Kultur
Abbildung 6 - Die Phasen des Innovationsprozesses
Abbildung 7 - Das Innovationssystem im Gesamtkontext
Abbildung 8 - Die Elemente des Innovationssystems als Bezugsrahmen
Abbildung 9 - Die Dimensionen der Innovationsfähigkeit
Abbildung 10 - Die Einflussgrößen des Innovations- und Unternehmenserfolgs
Abbildung 11 - Die Branchenkultur-Typologie von Deal / Kennedy
Abbildung 12 - Die Kulturtypologie nach Cameron/Freeman
Abbildung 13 - Die Dimensionen der Unternehmenskultur nach Bleicher
Abbildung 14 - Die Grundannahmen einer Innovationskultur nach Schein
Abbildung 15 - Die Systematik der Kultur-Indikatoren
Coverbild: pixabay.com
1.EINLEITUNG
Es folgt die Darstellung der Problemlandschaft, die Formulierung der Fragestellung sowie eine Skizzierung des Aufbaus der vorliegenden Arbeit. Der letzte Abschnitt definiert die inhaltlichen und metftüdiscten-erenzEtfdrBnrbetnng.
1.1.Problemstellung und Zielsetzung
Die Frage nach der Bedeutung der Unternehmenskultur für die Erreichung von Unternehmenszielen nimmt seit Beginn der 1980er Jahre breiten Raum in der organisationstheoretischen und praxisbezogenen Literatur ein. Anlass für eine Beschäftigung mit Faktoren, die sich in der sozialen Dimension eines Unternehmens entwickeln, waren empirische Arbeiten, die Leistungsdifferenzen zwischen Unternehmen feststellten, obwohl deren strukturelle Eigenschaften und Systeme weitgehend identisch waren.1 Modelle zur Abbildung von Unternehmen - verstanden als soziale Systeme - gelten seitdem als unvollständig, sofern der Aspekt der Unternehmenskultur fehlt.
Diese primär unternehmensinterne Problematik erfährt eine zusätzliche Brisanz durch Veränderungen in der Unternehmensumwelt. Hier kann allgemein festgestellt werden, dass sich die exogenen Rahmenbedingungen durch eine zunehmende Dynamik, Diskontinuität und Komplexität kennzeichnen lassen. In diesem Kontext wird die Innovationsfähigkeit zu einer herausragenden Eigenschaft für die Bestandssicherung von Unternehmen. Bei einem Zustand der ständigen Veränderung in konjunktureller, struktureller und technologischer Natur kann in vielen Branchen von einem regelrechten Zwang zur Innovation gesprochen werden. Der Bedarf an einer kontinuierlichen Erneuerung durch neue Produkte und Verfahren stellt hohe Anforderungen an Unternehmen sowie deren Mitarbeiter.2 Vor diesem Hintergrund gewinnt die Analyse der Einflussgrößen auf die Innovationsfähigkeit an Bedeutung.
In Anbetracht der Relevanz beider Themenkomplexe erscheint daher eine Untersuchung der Zusammenhänge sinnvoll. Dabei sollte überprüft werden, inwiefern kulturelle Aspekte zur Erklärung der Innovationsfähigkeit von Unternehmen beitragen können. Die Hypothese lautet, dass innovatives Handeln eine Vielzahl personaler und organisatorischer Bedingungen erfordert, deren innovationsförderliche oder -hemmende Ausrichtung maßgeblich durch kulturelle Faktoren bestimmt wird. Aus dieser Überlegung entstand die Fragestellung der vorliegenden Arbeit: „Welche Wechselbeziehungen bestehen zwischen der Unternehmenskultur und der Innovationsfähigkeit von Unternehmen? “
Daraus ergeben sich wiederum Teilfragen, die im Fokus der folgenden Ausführungen stehen:
1. Was sind die Merkmale der Unternehmenskultur innovationsfähiger Unternehmen?
2. Welche Indikatoren machen eine solche Unternehmenskultur sichtbar?
Aus der Beantwortung dieser Fragen werden wichtige Hinweise für den wünschenswerten Aufbau einer „Unternehmenskultur der Innovation“ erwartet. Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, Entscheidungsprobleme in Innovationsprozessen durch die neue Perspektive der Unternehmenskultur besser zu verstehen und schließlich steuern zu können.
1.2. Aufbau der Arbeit
Kapitel 2 enthält zunächst eine Einführung in das Führungskonzept des Strategischen Managements, das als Rahmenkonzept der Arbeit dienen soll. Eine hervorgehobene Behandlung erfährt dabei das 7S- Modell von Peters / Watermann als Bezugsrahmen sowie der Fit-Gedanke als Kern des Führungskonzepts. Im Anschluss daran wird die oben genannte Fragestellung der Arbeit in das skizzierte Rahmenkonzept eingeordnet.
Kapitel 3 erörtert und definiert die grundlegenden Begrifflichkeiten und Zusammenhänge der Unternehmenskultur-Thematik. Zunächst stellt sich die Frage nach der Relevanz des Unternehmenskultur-Themas für die Unternehmensführung. Es folgt die Definition der zentralen Termini sowie eine Systematisierung nach Eigenschaften und Ebenen. Dann soll geklärt werden, welche Einflussgrößen die Unternehmenskultur bestimmen, bevor schließlich auf die direkten und indirekten Wirkungen der Unternehmenskultur eingegangen wird.
Kapitel 4 wendet sich der Innovationsthematik zu. Zunächst stellt sich wieder die Frage nach der Relevanz des Themas für die Unternehmensführung. Es folgt die Definition der zentralen Begriffe „Invention“ und „Innovation“ sowie eine Systematisierung nach Innovationsarten. Schließlich wird darauf eingegangen, welche Phasen ein idealtypischer Innovationsprozess durchläuft und welche Aufgaben dabei dem Innovationsmanagement zufallen.
Kapitel 5 schildert, was unter dem Begriff der Innovationsfähigkeit zu verstehen ist, welche Elemente diese Eigenschaft konstituieren und welche Dimensionen sie beschreiben. Schließlich soll erörtert werden, inwiefern Innovationserfolg und Innovationsfähigkeit miteinander zusammenhängen.
Bei der Ermittlung von Merkmalen der Unternehmenskultur innovationsfähiger Unternehmen sollen Kulturtypologien Ansatzpunkte liefern. Kapitel 6 stellt dazu anerkannte Kulturtypologien mit Innovationsbezug vor. Innerhalb dieses Rahmens werden die Kategorien der Typologien nach ihrer angenommenen Innovationsfähigkeit verglichen und bewertet.
In Kapitel 7 werden zunächst die beiden Größen „Unternehmenskultur“ und „Innovationsfähigkeit“ zum Konstrukt der Innovationskultur verdichtet. Vom Vergleich der Kulturtypologien ausgehend, werden anschließend idealtypische Merkmale einer Innovationskultur abgeleitet und beschrieben. Dabei werden zwei Merkmalsebenen unterschieden: Die Ebene der übergeordneten Grundannahmen und die Ebene der bekundeten Werte. Diese beiden Merkmalsebenen bilden den Kern der Innovationskultur.
In Kapitel 8 werden schließlich die Wirkungszusammenhänge zwischen diesen verborgenen Merkmalen des Kulturkerns und den aus ihnen entstehenden, sichtbaren Indikatoren einer Innovationskultur diskutiert. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich eine Innovationskultur beobachtbar, messbar und damit gestaltbar im Unternehmenskontext äußert.
Dazu wird die Gesamtheit der Indikatoren in die vier Kategorien „Unternehmens-/Umweltkontext, „Symbolsystem“, „Anwendungssystem“, und „Managementsystem“ systematisiert.
In der Schlussbetrachtung werden die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und kritisch beurteilt. Im Abschnitt „Ausblick“ wird zunächst der Bedarf an empirischen Forschungen erklärt. Weiter wird vorgeschlagen, an die vorliegende Analyse die Entwicklung eines DiagnoseInstruments zur Entschlüsselung einer Innovationskultur sowie die Implementierung eines Kulturmanagements zur Umsetzung der Erkenntnisse anzuschließen. In Abbildung 1 wird die vorgestellte Vorgehensweise mit den dazugehörigen Kapitelzahlen visualisiert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 - Modell der Untersuchung3
1.3. Abgrenzung
Es sei darauf hingewiesen, dass bei der Bearbeitung der Fragestellung inhaltliche und methodische Grenzen gesetzt wurden:
1. In der aktuellen Managementdiskussion wird der Terminus „Unternehmenskultur“ zunehmend im Zusammenhang mit normativ-wirtschaftsethischen Fragen verwendet. Dieser Aspekt soll im Folgenden nicht weiter verfolgt werden.4
2. Die Grenzen zum Funktionsbereich der Personalführung verlaufen im Zusammenhang mit der behandelten Fragestellung fließend. Es soll jedoch herausgestellt werden, dass der Fokus der Arbeit nicht auf dem einzelnen Mitarbeiter, sondern auf der Kultur, der Innovationsfähigkeit und der Angehörigen eines Unternehmens als Ganzes liegt.
3. Als Forschungsmethode wurde die Analyse vorhandener Literatur gewählt. Auf Basis des bestehenden Wissens soll versucht werden, themenspezifische Aussagen zu generieren und in neuer Form zu strukturieren.5
4. Es wird angenommen, dass die untersuchten Größen positiv mit dem Innovationserfolg korrelieren. Die Einbeziehung des Innovationserfolgs als dritte Größe ist jedoch nicht Bestandsteil der Fragestellung.6 Vielmehr soll mit der Bestimmung von Merkmalen und Indikatoren einer innovationsorientierten Unternehmenskultur eine Grundlage gelegt werden, die im Rahmen einer Anschlussarbeit mit dem Innovationserfolg in Beziehung gesetzt werden kann.
5. Die Beziehungen zwischen Unternehmenskultur und Innovationsfähigkeit werden auf korrelativen Niveau analysiert. Lineare Ursache-Wirkungsbeziehungen stehen in der Kulturforschung (noch) nicht zu Verfügung.7
6. Gegenstand der Arbeit ist nicht die Frage nach dem Aufbau bzw. der methodischen Vorgehensweise einer Kulturdiagnose im einzelnen Unternehmen. Ebenso ausgeblendet wird der Aspekt des Kulturmanagements. Die Implementierung der gewonnenen Erkenntnisse in eine neue oder vorhandene Unternehmenskultur stellt vielmehr einen logischen nächsten Schritt dar.8
2. DAS STRATEGISCHE MANAGEMENT ALS RAHMENKONZEPT
Als Rahmenkonzept der vorliegenden Arbeit wird das Führungskonzept des Strategischen Managements gewählt.9 Zunächst werden die theoretischen Grundlagen erörtert. Dann wird der 7S- Modell von Peters / Waterman als Bezugsrahmen für die Einordnung der Fragestellung vorgestellt.Anschließend wird die Thematik des „Strategischen Fits“ diskutiert. Abschließend wird die Fragstellung der Arbeit in das skizzierte Rahmenkonzept eingeordnet.10
2.1. Grundlagen des Strategischen Managements
Der Aktionsraum der Unternehmensführung ist von einer zunehmenden Umweltdynamik und Komplexität der Unternehmens-Umwelt-Beziehungen geprägt.11 Daraus erwachsen an Unternehmen neue Anforderungen, die sich in zwei Kategorien unterteilen lassen:12
1. Eine verstärkte Außenorientierung und Umweltsensibilität zur Wahrnehmung der Umweltveränderungen sowie
2. eine entsprechende Innenorientierung, die auf die Entwicklung leistungsstarker Potentiale abzielt, um auf diese Umweltveränderungen antizipativ und adäquat reagieren zu können.
Die neuen Anforderungen führten seit den 1950er Jahren zu einem Wandel der Managementforschung und mündeten in den 1980er Jahren in der Etablierung des Strategischen Managements als dominierende Führungskonzeption13. Einigkeit im Schrifttum besteht über das Ziel des Strategischen Managements, das Wolfrum als „die Sicherung der Überlebensfähigkeit des Unternehmens durch seine zielgerichtete Steuerung seiner langfristigen Evolution“ zusammenfasst.14
Schwarz analysiert aus der großen Bandbreite vorhandener Begriffsfassungen Gemeinsamkeiten und beschreibt das Aufgabengebiet des Strategischen Managements als die „Erschließung, integrative Gestaltung, Erhaltung und Entwicklung der zentralen Erfolgspotentiale einer Unternehmung“.15 Bei der Erschließung von Erfolgspotentialen sollen sowohl interne als auch externe Elemente des Aktionsfeldes eines Unternehmens berücksichtigt werden. Die integrative Gestaltung der Erfolgspotentiale mündet schließlich in der Formulierung und Implementierung von Strategien.16
In der vorliegenden Arbeit wird aus der Perspektive des ressourcenorientierten Ansatzes (Ressource- based View, RBV) argumentiert.17 Dieser Ansatz der Chicago-Schule, geprägt insbesondere durch Penrose, rückte Mitte der 1990er Jahre in das Zentrum des Interesses und ergänzt den marktorientierten Ansatz (Market-based View) durch einen Perspektivenwechsel.18 Dabei wird die Suche nach Wettbewerbsvorteilen auf die unternehmensinternen Ressourcen ausgeweitet. Nach diesem Konzept wird der betriebswirtschaftliche Erfolg oder Nichterfolg von Unternehmen vorrangig durch die Qualität interner Ressourcen bestimmt.19
Grant klassifiziert Ressourcen dazu in 1. tangible (materielle) Ressourcen, 2. intangible (immaterielle) Ressourcen und 3. Human Ressourcen (Wissen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Motivation der Mitarbeiter).20 Burr wiederum subsumiert aus dem vorhanden Schrifttum acht Ressourcenkategorien: 1. Physisches Kapital, 2. Humankapital, 3. Organisationales Kapital, 4. Technologie, 5. Reputation, 6. Finanzmittel, 7. Unternehmenskultur sowie 8. Managementteam.21
Die Aufgabe des Strategischen Managements ist es, Ressourcen, die auch als Erfolgspotentiale bezeichnet werden, aufzubauen und weiterzuentwickeln. Ausgangspunkt ist die unternehmensspezifische Ressourcenausstattung, die sich je nach relativer Ausprägung im Vergleich zum Wettbewerb als Stärke oder Schwäche herausstellt.22
Macharzina definiert Erfolgpotentiale als die „von einem Unternehmen kontrollierten Vermögenswerte, Fähigkeiten, Organisationsprozesse, Firmenattribute, Informationen und Wissensinhalte“.23 Für Bea / Haas stellen Ressourcen „Speicher spezifischer Stärken dar, die es ermöglichen, die Unternehmung in einer veränderlichen Umwelt erfolgreich zu positionieren und somit den langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern“.24
Um die Erfolgspotentiale beeinflussbar zu machen, müssen sie operationalisiert werden. Erfolgsrelevante Stärken und Schwächen, die aus den Erfolgspotentialen ableitbar sind und den Unternehmenserfolg wesentlich, nachhaltig und direkt beeinflussen, werden als Erfolgsfaktoren bezeichnet.25 Bezüglich des Maßstabes für den Erfolg besteht in der Erfolgsfaktorenforschung weitgehende Einigkeit, die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen RoI und Cash Flow zu verwenden.26 Demgegenüber steht eine unüberschaubare Anzahl an unterschiedlichen Ansätzen bezüglich der Definition, welche Faktoren letztlich die erfolgsrelevanten Stärken sind.27 Ein systematischer Vergleich wird dadurch erschwert.
Wird im Leistungsangebot auf der Basis von Erfolgsfaktoren ein günstigeres Preis/Leistungsverhältnis gegenüber dem Wettbewerb erzielt und richtet sich das Angebot konsequent an den Bedürfnissen der Kunden aus, generiert ein Unternehmen am Markt einen Komparativen Konkurrenzvorteil.28 Diese Systematik wird im so genannten „Strategischen Dreieck“ in Abbildung 2 dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2 - Das Strategische Dreieck29
2.2. Das 7S-Modell von Peters / Waterman
In der Literatur existiert bislang kein einheitliches Konzept zur Darstellung der Subsysteme des Strategischen Managements. Jedoch besteht weitgehender Konsens bezüglich der Relevanz „weicher Faktoren“ für das Führungskonzept.30
Peters / Waterman gehen in ihrem viel beachteten McKinsey-7S-Modell davon aus, dass jede Behandlung eines Organisationsproblems wenigstens sieben Subsysteme berücksichtigen muss, die den oben diskutierten Erfolgspotentialen des ressourcenorientieren Ansatzes entsprechen.31
Die Subsysteme sind voneinander abhängig und machen in ihrer Gesamtheit das Strategische Management aus. Dabei wird explizit herausgestellt, dass neben der rational-quantitativen Hardware („hard facts“) die emotional-qualitative Software („soft facts“) eine gleichberechtigte Berücksichtigung finden muss.
Als Ergebnis ihrer Untersuchungen subsumieren Peters / Waterman, dass die bislang als irrational, informell und nicht beeinflussbar vernachlässigten „weichen Faktoren“ durch Führungsmaßnahmen gesteuert werden können und dass Unternehmen, die diesen Faktoren Bedeutung beimessen, langfristig erfolgreicher sind.32 Insbesondere die Untemehmenskultur nimmt im 7S-Modell als Subsystem eine eigenständige und herausragende Rolle ein.33
Die Stärken des 7S-Modells des Strategischen Managements liegen insbesondere in dessen ganzheitlicher Sichtweise und dem zur Verfügungsstellen grundsätzlicher Beziehungen. Durch den Verzicht auf rezeptartige Gestaltungsrichtlinien ermöglicht es als Bezugsrahmen eine situationsspezifische Ausgestaltung im jeweiligen Unternehmens-/Umweltkontext und liefert generelle Anhaltspunkte, welche Subsysteme von der Unternehmensführung berücksichtigt werden müssen.34
2.3. Der Strategische Fit als Kerngedanke
Im Kern des Strategischen Managements steht der Fit-Gedanke, der eine ganzheitliche Koordination von Umwelt und Unternehmen verlangt. Um erfolgswirksam zu sein, ist eine unternehmensspezifische Ausgestaltung und Abstimmung der einzelnen Subsysteme des Strategischen Managements (die durch ein interdependentes Wirkungsgefüge miteinander verknüpft sind) mit den Anforderungen der Umwelt erforderlich. Ansoff prägte 1979 für den Zielzustand der Unternehmens-/Umweltkoordination die Bezeichnung „Strategic Fit“.35
In Abbildung 3 wird zur grafischen Darstellung des Fit-Gedankens das oben erörterte 7S-Modell verwendet. Unterschieden werden drei Dimensionen des Strategischen Fits, die nicht isoliert voneinander betrachtet werden können:36
1. Der Intra-Subsystem-Fit fordert eine Abstimmung innerhalb der einzelnen Subsysteme (im Falle der Grafik des Subsystems „Kultur“). Die Subsystem-Qualität wird einerseits durch die Qualität der Subsystem-Komponenten und darüber hinaus durch das Zusammenpassen der Komponenten untereinander bestimmt.37
2. Zur Herstellung des Inter-System-Fits ist eine Abstimmung zwischen den Subsystemen des Systems „Unternehmen“ erforderlich. Anzustreben ist eine möglichst hohe gegenseitige Entsprechung, da die isolierte Ausgestaltung einzelner Subsysteme ohne die Beachtung von Wechselwirkungen dem Integrationsgedanken widerspricht. So kann mit Blick auf die Fragestellung der Arbeit das Potential einer innovationsorientierten Unternehmenskultur nur bei einer stimmigen Ausgestaltung der anderen Subsysteme ausgeschöpft werden, etwa zwischen Unternehmenskultur, Strategie und Struktur.38
3. Der System-Umwelt-Fit verlangt schließlich eine konsequente Abstimmung des Gesamtsystems „Unternehmen“ mit den Anforderungen seiner Umwelt. Intra- und Inter-Segment-Fit als Ausdruck der internen Konfiguration (Innenorientierung) müssen in ihrer Ausrichtung den externen Konstellationen (Außenorientierung) entsprechen.
Mit Blick auf die Fragestellung dieser Arbeit muss demnach berücksichtigt werden, welche Umweltsituationen innovationsförderliche Unternehmenskulturen hervorbringen bzw. welcher Unternehmenskulturtyp in welchen Umweltsituationen Erfolg versprechend ist.39
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3 - Das 7S-Modell im Kontext des Fit-Gedankens40
2.4. Folgerungen für die Arbeit
Im vorliegenden Kapitel wurde das Strategische Management als Rahmenkonzept für die folgende Untersuchung vorgestellt. Wir verfolgen den ressourcenorientierten Ansatz, der die unternehmensinternen Erfolgspotentiale als Quelle für Wettbewerbsvorteile bezeichnet.
Für eine erste Einordnung der beiden zu untersuchenden Größen verwenden wir das anerkannte 7S- Modell von Peters / Waterman. Sowohl die Unternehmenskultur als eigenständiges Subsystem, als auch die „Innovationsfähigkeit“, die wir als organisational Fähigkeit im Subsystem „Spezialkenntnisse“ verstehen, lassen sich in dem Modell als „Intangibles“ verorten.
Abbildung 4 zeigt, dass die Wechselbeziehungen zwischen Unternehmenskultur und Innovationsfähigkeit auf Ebene der Erfolgspotentiale analysiert werden. Wie beschrieben, müssen die Potentiale operationalisiert werden, um sie sicht- und beeinflussbar zu machen. Dieser Schritt erfolgt in Kapitel 8. Die Gewinnung von Erkenntnissen, inwiefern die gewonnenen Indikatoren einer innovationsförderlichen Unternehmenskultur gleichzeitig empirisch bestätigte Erfolgsfaktoren mit direktem Einfluss auf den Erfolg darstellen, ist dagegen nicht der Kerngegenstand der vorliegenden Arbeit.41
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4 - Einordnung der Fragestellung im Strategischen Management42
Aufbauend auf diesem Rahmenkonzept soll die Fragestellung der Arbeit gelöst werden. Dazu wird in den folgenden drei Kapiteln zunächst ein einheitliches Verständnis für die zentralen Begriffe »Unternehmenskultur«, »Innovation« und »Innovationsfähigkeit« hergestellt.
3. GRUNDLAGEN ZUR UNTERNEHMENSKULTUR
Im folgenden Kapitel sollen die grundlegenden Begrifflichkeiten und Zusammenhänge der Unternehmenskultur-Thematik erörtert und definiert werden. Zunächst stellt sich die Frage nach der grundsätzlichen Relevanz des Themas für die Unternehmensführung. Es folgt die Definition der zentralen Termini sowie eine Systematisierung nach Eigenschaften und Ebenen. Dann soll geklärt werden, welche Einflussgrößen die Unternehmenskultur bestimmen, bevor schließlich auf deren Wirkungen eingegangen wird.
3.1. Einführung
In ökonomischer Hinsicht ist das Forschungsgebiet der Unternehmenskultur seit Ende der 1970er Jahre von Interesse. US-amerikanische Vergleichsstudien mit den damals zum Vorbild avancierten japanischen Industrieunternehmen offenbarten Unterschiede in den Managementstilen. Das japanische Erfolgskonzept wurde darin insbesondere durch die starke Solidarität der Unternehmensangehörigen untereinander erklärt, die auf eine gemeinsame Verinnerlichung unternehmensbezogener Werte zurückgeführt wurde. Forscher wie Praktiker erkannten, dass Unternehmen eine bestimmte Kultur verkörpern, die sie unverwechselbar macht, so wie auch jeder Mensch und jede Gesellschaft über eine eigene Kultur verfügt - unabhängig davon, ob sie reflektiert wird oder nicht.43
Daneben wird die Schutzfähigkeit hardwarebezogener Potentiale vor der Imitation immer geringer.44 Softwarebezogene Potentiale beziehen dagegen Wettbewerbsvorteile auf Grundlage kultureller, durch die Mitglieder des Unternehmens geschaffener Voraussetzungen auf Basis von verankerten Werten und Normen.45 Die Unternehmenskultur stellt aufgrund ihres langjährigen Entwicklungsprozesses und ihrer verhaltensprägenden Wirkung, die sich kurzfristig weder durch finanzielle Mittel noch durch Systeme oder Methoden erzwingen lässt, „[...] das abschirmbare unternehmerische Fundament dar, auf dem sich die angestrebte Profilierung realisieren lässt.“46
Der Betriebswirtschaftslehre fällt die nun Aufgabe zu, das versteckte Potential der Unternehmenskultur zu analysieren und auf dieser Grundlage gewinnbringend einzusetzen.47
Wie das 7S-Modell von Peters / Waterman in Kapitel 2.2. zeigt, wird das Instrumentarium des Strategischen Managements mit der Kultur um ein wesentliches Element erweitert, das bei der Planung und Durchsetzung von Strategien und operativen Maßnahmen zur Zielerreichung berücksichtigt werden muss. Bea / Haas führen in diesem Zusammenhang die Rückbesinnung auf qualitativ-integrative Größen auch auf eine Ernüchterung in der Wissenschaft bezüglich der Effektivität und Effizienz quantitativ-reduktionistischer Methoden zurück.48 Auch durch die Internationalisierungsbestrebungen von Unternehmen im Zuge der Globalisierung gewinnen kulturelle Faktoren weiter an Relevanz. Das Zusammentreffen von Individuen, Unternehmen und Nationen unterschiedlicher kultureller Prägung erfordert eine besondere Sensibilität und Qualifikation der Unternehmensführung im Umgang mit Kulturfragen.49
3.2. Das Phänomen der Unternehmenskultur
3.2.1. Der Begriff »Kultur«
Zunächst müssen die Grundlagen des Phänomens »Kultur« behandelt werden, bevor diese Erkenntnisse auf den Kulturträger »Unternehmen« übertragen werden können.
Soziale Gruppen grenzen sich durch ihre Kulturen ab, wobei die gemeinsamen Werte und Normen sowie die daraus abgeleiteten Denk- und Handlungsweisen die Unterscheidungskriterien sind.50
Werte stellen Maßstäbe des Richtigen oder Falschen dar, anhand derer Objekte, Ereignisse oder Handlungen beurteilt werden.51 Werte werden auch als die „Determinanten der Einstellungen“ bezeichnet.52 Aus Werten entstehen soziale Normen, die als konkrete und sichtbare Vorschriften für soziales Handeln definiert werden.53 Die Quelle des Antriebs zum Schaffen einer Kultur liegt in dem menschlichen Bedürfnis nach „Stabilität, Folgerichtigkeit und Sinn“ begründet.54 Die wesentliche Voraussetzung für die Herausbildung einer Kultur ist eine „[...] Geschichte gemeinsamer Erfahrungen, die wiederum auf einer stabilen Mitgliedschaft beruhen muss.“55
Dieses Kulturverständnis verlangt 1. eine strukturelle Stabilität und Tiefe der Gemeinsamkeiten sowie 2. die Integration dieser Gemeinsamkeiten in ein größeres Paradigma auf einer höheren Metaebene.56 Kultur geht demnach weit über gemeinsam geteilten Dinge und äußerlichen Phänomene hinaus.
Den folgenden Ausführungen sollen die Aspekte der Kultur-Beschreibung nach Bleicher zugrunde gelegt werden:57 1. Die Kultur ist vom Menschen geschaffen als das Ergebnis gemeinsamen Denkens und Handelns einzelner Individuen; 2. die Kultur drückt sich in Werten und Normen aus, wird in Sozialisierungsprozessen gelernt und wirkt verhaltenssteuernd sowie 3. die Kultur stellt aus der Vergangenheit bewährte Methoden zur Lösung von Problemen zur Verfügung und projiziert diese Zukunft.
Sozialen Gruppen können Volksgruppen bzw. eine Gesellschaft darstellen, der Kulturbegriff lässt sich aber ebenso auf andere Kulturbereiche wie Branchen (Branchenkulturen), Institutionen (Organisations- bzw. Unternehmenskulturen), Gruppen (Subkulturen) sowie auf Individuen (Individualkulturen im Sinne von kulturellen Standards eines Individuums) übertragen.58
Neben der Dimension des Kulturbereiches stellt die Art einer Kultur eine weitere Unterscheidungsdimension dar. Demnach können Kulturen 1. hinsichtlich ihrer Stärke und 2. hinsichtlich ihrer inhaltlichen Ausrichtung unterschieden werden.
Macharzina misst die Stärke einer Kultur 1. an der Prägnanz bzw. Klarheit, d.h. an der eindeutigen Erkennbarkeit der Werte und Normen für die Kulturmitglieder, 2. am Verbreitungsgrad, d.h. am quantitativen Ausmaß, in welchem die Werte und Normen von den Kulturmitgliedern geteilt werden sowie 3. an der Verankerungstiefe, d.h. am Ausmaß, ob die Werte und Normen nur oberflächlich übernommen werden oder ob sie tief im Bewusstsein der Kulturmitglieder wurzeln.59
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Darstellung der inhaltlichen Ausrichtung einer Kultur. Speziell soll untersucht werden, inwieweit die inhaltliche Kulturausrichtung mit der Innovationsfähigkeit eines Unternehmens interagiert.60 In diesem Sinne impliziert die Fragestellung, dass eine handlungsleitende Kultur vorhanden sein muss, was wiederum das Vorhandensein einer kritischen Kulturstärke voraussetzt.
3.2.2. Perspektiven der Unternehmenskulturforschung
Die im Schrifttum hervorgebrachten Definitionsversuche für den Begriff der Unternehmenskultur können in zwei Perspektiven eingeteilt werden, die sich in ihrer Zielsetzung und Vorgehensweise elementar unterscheiden: 1. Die Perspektive der Kulturanthropologie (subjektivistische, institutionale Sichtweise61 ) sowie 2. die Perspektive der Soziologie (objektivistische, instrumentelle Sichtweise62 ). Die Zuordnung der Unternehmenskultur als Subsystem des Strategischen Managements (vgl. Kapitel 2.2. ) folgt der objektivistischen Sichtweise. Smircich bezeichnet die Handhabung der Kultur im Sinne eines Instruments bzw. einer Variable des Systems als “[...] a bridge between organizational behaviour and strategic management interests.”63 Diese Sichtweise wirft insofern Schwierigkeiten auf, als dass eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Wesen der Unternehmenskultur nur an deren Oberflächenstruktur im Sinne von objektiven respektive beobachtbaren Indikatoren stattfindet.64
Die subjektivistische Sichtweise gibt demgegenüber tiefergehende Einblicke in die Unternehmenskultur über die materiellen Oberflächenstrukturen hinaus. Smircich beschreibt die Kultur aus dieser Perspektive als “root metaphor” zur Erklärung sozialer Systeme: „[...] by using culture as a root metaphor, they are all influenced to consider organization as a particular form of human expression.“65 Es geht nicht um „die bloße Existenz [...] beobachtbarer Kulturelemente [...], sondern die subjektive [...] Bedeutungszumessung dieser Elemente durch die Unternehmensmitglieder [...], um die internen Mechanismen einer Unternehmung aufzudecken.“66 Dieses Begriffsverständnis impliziert, dass die Unternehmenskultur nicht als eines der Subsysteme des Strategischen Managements verstanden wird, sondern dass diese Subsysteme erst als Resultat der spezifischen Ausprägungen einer Unternehmenskultur entstehen und in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung vom kulturellen Kontext abhängen.67
Die beiden Perspektiven bedingen sich gegenseitig und sollten nicht isoliert voneinander betrachtet werden.68 Die im Strategischen Management geforderte ganzheitliche Herangehensweise an Entscheidungsprobleme macht eine integrative Zusammenführung beider Perspektiven unumgänglich.69 Ein integrierter Ansatz definiert die Unternehmenskultur 1. als gestaltbares Subsystem des Strategischen Managements (welches mit den anderen Subsystemen des Unternehmens im Sinne des Fit-Gedankens abzustimmen ist) und liefert 2. gleichzeitig grundlegende Erklärungen über deren Bestandteile und interne Funktionsmechanismen.70
Auf Basis dieser grundsätzlichen Überlegungen können im nächsten Abschnitt Definitionen selektiert und bewertet werden.
3.2.3. Der Begriff »Unternehmenskultur«
Trotz der anerkannten Relevanz der Unternehmenskultur besteht im Schrifttum kein einheitliches Begriffsverständnis.71
Als Ergebnis einer Metastudie definiert Schnyder die Unternehmenskultur als „ein soziokulturelles, immaterielles unternehmensspezifisches Phänomen, welches die Werthaltungen, Normen und Orientierungsmuster, das Wissen und die Fähigkeiten sowie die Sinnvermittlungspotentiale umfasst, die von einer Mehrzahl der Organisationsmitglieder geteilt und akzeptiert werden“.72
Poech subsumiert aus vorhandenen ökonomischen und organisationspsychologischen Definitionsversuchen Unternehmenskulturen als kognitive Ideensysteme, die sich aus mehreren Elementen zusammensetzen: „Dies sind zum einen die im Wege von Sozialisationsprozessen erlernten Grundmuster, aufgrund deren die Wirklichkeit wahrgenommen und interpretiert wird; zum anderen sind es die geteilten Glaubenssätze und Handlungsvorschriften [...] eines Unternehmen.“73
Noch klarer argumentieren Bea / Haas, die Unternehmenskultur als „die Gesamtheit von im Laufe der Zeit in einer Unternehmung entstandenen und akzeptierten Werten und Normen, die über bestimmt Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensmuster das Entscheiden und Handeln der Mitglieder der Unternehmung prägen [.. .]“74 definieren.
Eine verbreitete Definition ist die von Schein, die auf einer tieferen Ebene ansetzt.75 Demnach ist der Grund dafür, dass sich Kulturen als verbindendes Element zwischen den Mitgliedern einer Gruppe bilden, das menschliche Streben nach Sinn und Integration. Für Schein ist Unternehmenskultur „ein Muster gemeinsamer Grundprämissen, dass die Gruppe bei der Bewältigung ihrer Probleme externer Anpassung und interner Integration erlernt hat, das sich bewährt hat und somit als bindend gilt; und das daher an neue Mitglieder als rational und emotional korrekter Ansatz für den Umgang mit diesen Problemen weitergegeben wird.“76 Diese Grundprämissen bzw. Grundannahmen beziehen sich auf genau die Probleme, die im Führungskonzept des Strategischen Managements zu lösen sind: „Der Umgang mit dem externen Umfeld [.] und das Management der internen Integration“.77
Ernst schließt daraus, dass die Unternehmenskultur den Status eines nicht-strukturellen Koordinationsinstrumentes einnimmt.78
Die Definition von Schein impliziert, dass Unternehmenskultur nicht ausschließlich auf Grundlage direkt beobachtbarer Handlungen beurteilt werden darf, sondern vielmehr anhand der „dahinter liegenden Annahmen und Wertvorstellungen der Mitglieder“ eines Unternehmens.79
Wir bauen im Folgenden auf diese Definition auf, da sie der Strukturierung der Arbeit zuträglich ist und mit Blick auf die Fragestellung Schnittstellen zur Innovationsthematik anbietet, die noch im weiteren Verlauf der Arbeit diskutiert werden.80
3.2.4. Eigenschaften der Unternehmenskultur
Zur inhaltlichen Präzisierung der Begriffsdefinitionen hat das Schrifttum prägende Eigenschaften einer Unternehmenskultur abgeleitet:
1. Die Unternehmenskultur wird maßgeblich durch die Unternehmensgeschichte und seine Umwelt geprägt. Dabei spielen starke Führungspersönlichkeiten der Vergangenheit eine große Rolle. Die Werthaltungen dieser Persönlichkeiten wurden schließlich zu akzeptierten und handlungsleitenden Wertvorstellungen der Mehrzahl der Unternehmensangehörigen.81
2. Die meisten Unternehmen besitzen eine Unternehmenskultur. Diese Kultur ist einzigartig und differenziert sich nach ihrer Art und Stärke.82 Schein stellt heraus, dass sich eine Kultur nur bei einem ausreichenden Maß an gemeinsamer Geschichte herausbildet. Ohne „gemeinsam erfolgreich bewältigte schwierige Situationen“83 fehlen gemeinsame Grundannahmen und es kann höchstens von einer Menschenansammlung die Rede sein.
3. Die Unternehmenskultur ist implizierter und inoffizieller Natur und darf nicht mit den verbreiteten Führungsgrundsätzen oder Leitbildern gleichgesetzt werden.84 Schein erläutert dazu, dass eine derartige Formulierung der bekundeten Werte die Unternehmensmitglieder enger zusammenbringen kann, „wenn die bekundeten Werte einen angemessen Grad an Übereinstimmung mit den Grundprämissen“ aufweisen.85 Rationale Erklärungen, die nicht der Wirklichkeit der Grundannahmen entsprechen, bleiben demnach wirkungslos.
4. Die Unternehmenskultur wird von den Unternehmensangehörigen in mehr oder weniger starkem Ausmaß im Laufe ihrer Unternehmenszugehörigkeit mehrheitlich unbewusst gelernt und übernommen Dieser Prozess wird als Sozialisation bezeichnet.86
3.2.5. Ebenen der Unternehmenskultur
Bei der Darstellung der Perspektiven der Kulturforschung konnte eine Herangehensweise an die Unternehmenskultur auf verschiedenen Ebenen festgestellt werden, die sich nach dem Grad ihrer Sichtbarkeit unterscheiden und wechselseitig aufeinander einwirken. Aus der soziologischobjektivistischen Perspektive war von „materiellen Oberflächenstrukturen“ bzw. sichtbaren Ausprägungen einer Kultur die Rede. In den Kulturdefinitionen von Schnyder, Poech und Bea /Haas wird das Werte- und Normensystem eines Unternehmens als Kern der Unternehmenskultur gekennzeichnet. Schein spricht schließlich von „gemeinsamen Grundprämissen“ respektive Grundannahmen. Von ihm wurde das Mehrebenenpostulat der Unternehmenskultur aufgegriffen und ausformuliert.
An der Oberfläche befinden sich die Artefakte der Kultur. Diese Kulturmanifestationen sind die sichtbaren Strukturen und Prozesse im Unternehmen, die alles das einschließen, was man sehen, hören und fühlen kann.87 Diese Symbole bieten zwar einen ersten praktischen Anknüpfungspunkt, um das Phänomen »Kultur« kennenzulernen und zu gestalten, jedoch sind sie mehrdeutig und in ihrer tatsächlichen Bedeutung nicht direkt zu entschlüsseln.88 Darüber hinaus besteht die Gefahr, ihnen mehr Bedeutung zuzumessen, als ihnen tatsächlich zukommt.89
Auf der mittleren Kulturebene manifestieren sich die gemeinsam bekundeten und vertretenen Werte. Dazu stellt die Unternehmenskultur den Unternehmensangehörigen einen Wissensvorrat aus dominanten Anschauungen zur Verfügung, wie bei Entscheidungsproblemen mit mehreren Alternativen zu reagieren ist.90 Bleicher definiert die angenommenen Werte der Unternehmenskultur als „Präferenzen für bestimmte Ziele und Zustände und [...] die Verfolgung organisatorischer Gestaltungsprinzipien [...].“91
Auf der tiefsten Kulturebene liegen die Wurzeln der Unternehmenskultur in einem System von Grundannahmen verborgen, das von der Mehrzahl der Unternehmensmitglieder getragen wird und von dem der größte Einfluss auf das Verhalten der Mitarbeiter ausgeht.92 Die Grundannahmen sind unsichtbar, werden nur selten bewusst wahrgenommen und bestimmen von daher unhinterfragt das Denken und Handeln des Unternehmens. Sie entstehen, wenn eine bestimmte Handlungsweise immer wieder funktioniert. Während Werte nur einen Hinweis auf eine bevorzugte Lösung aus mehreren Grundalternativen geben, gelten Grundannahmen als Tatsache.93
Die Interdependenzen zwischen den drei Ebenen können folgendermaßen dargestellt werden: Die Artefakte basieren auf Werten; erfolgreiche Werte werden zu Grundannahmen; Grundannahmen überprüfen neue Werte, welche wiederum Artefakte hervorrufen.94 Die drei Ebenen lassen sich nicht nur auf die Unternehmenskultur, sondern auf alle der genannten Kulturbereiche anwenden. Durch ihre inhaltliche Ausrichtung sowie die variierende Stärke werden die Kulturebenen schließlich einzigartig. Abbildung 5 stellt diesen Zusammenhang grafisch dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5 - Das Schichtenmodell der Kultur 95
Das Konzept der Unternehmenskulturebenen wurde von Schwarz gedanklich weiter durchdrungen und konkretisiert.96 Er spezifiziert die drei anerkannten Ebenen durch eine weitere Unterteilung in fünf aufeinander aufbauende Teilkomponenten, die nach zunehmender Beeinflussbar- und Beobachtbarkeit angeordnet werden können:97 1. Das Kultur-Leitsystem stellt die langfristig gültigen, grundlegenden Prinzipien und damit einen überdauernden Maßstab für alle Handlungen dar. Dabei enthält die «UK- Basis» mit den langfristig gültigen Grundannahmen die affektiven Elemente der Unternehmenskultur. Die «UK-Leitlinie» enthält mit den geteilten Werten die kognitiven Elemente. 2. Das KulturVerstärkungssystem nimmt eine bündelnde Mittlerrolle ein. Die «UK-Stabilisatoren» wandeln die Inhalte des Kultur-Leitsystems in normative Vorgaben um. «UK-Symbole» verkörpern schließlich die vorgenannten Bestandteile in erfahrbarer Art und Weise.98 3. Das Kultur-Anwendungssystem enthält die «UK-Verhaltensmuster». Sie beschreiben die charakteristischen Denk- und Verhaltenweisen im Unternehmen.99 Die Arbeit von Schwarz wird bei der Systematisierung von Indikatoren einer innovationsorientierten Unternehmenskultur in Kapitel 8 wieder aufgegriffen.
3.3. Einflüsse auf die Unternehmenskultur
Es folgt eine Diskussion der im Schrifttum genannten Einflussgrößen auf die Unternehmenskultur.
3.3.1. Individuum und Unternehmensführung
Bleicher weist darauf hin, dass die beeindruckende Palette an Instrumenten, die dem Strategischen Management zur Verfügung stehen, nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass es letztlich „Menschen mit ihren [...] Präferenzen sind, die derartige Konzepte erarbeiten und deren Verwirklichung fördern oder ihnen mit Widerständen begegnen.“100 Die Mitglieder eines Unternehmens bringen ihre Präferenzen in die Kultur ein und beeinflussen diese damit.101 Die Denkrichtung der konstruktivistischen Philosophie hat dazu das Konstrukt des konzeptionellen Rasters entwickelt. Demnach verfolgt jedes Individuum über eine „private Theorie“, nach der es die Vielzahl der Umwelteinflüsse selektiert und interpretiert. Jeder Mensch führt mit Hilfe dieses Instruments die Komplexität von Entscheidungssituationen auf ein für ihn verarbeitbares Niveau zurück.102
Einen besonderen Einfluss auf die Unternehmenskultur übt die Unternehmensführung aus. Ist den Führungskräften dieser Einfluss bewusst, haben sie eine - wenn auch begrenzte - Möglichkeit, die Unternehmenskultur aktiv zu steuern und zu verändern.103 Führung und die Unternehmenskultur eines Unternehmens sind nach Schein zwei Seiten derselben Medaille.104 In den frühen Jahren eines Unternehmens konstituiert sich die Unternehmenskultur über Grundannahmen der Führungspersönlichkeiten. Wenn diese zum Erfolg führen, werden sie von den Gruppenmitgliedern zunehmend als selbstverständlich angenommen und manifestieren sich in eine Kultur, die an Neulinge als die korrekte Form des Denkens und Handelns weitergegeben wird.105 Der Einfluss des Managements manifestiert sich auf der Ebene der kulturellen Artefakte z.B. über die Wahl des Führungsstils, über die Bevorzugung bestimmter Koordinationsmechanismen oder über die Gestaltung des betrieblichen Anreizsystems.106
3.3.2. Gesellschaft und Branche
Wie in Kapitel 2.3. diskutiert, steht jedes Unternehmen als soziales System in Interaktion mit seiner Umwelt. Die Erfolgswirksamkeit einzelner Aktionen, mit denen das Unternehmen an die Umwelt herantritt, ist von der Qualität des angestrebten System-Umwelt-Fits abhängig.107 Dabei ist die Unternehmenskultur sowohl in eine Branchen- als auch eine Gesellschaftskultur integriert. Diese unter dem Begriff »Umkultur« zusammengefassten Kulturbereiche weisen zahlreiche Interaktionen zur Unternehmenskultur auf.108 In dem Zusammenhang weist Macharzina auf die Culture-Bound-These hin, deren Vertreter die Abhängigkeit der Untemehmenskultur von der Landeskultur postulieren.109 Die „verhaltensprägenden Einflüsse der Gesellschaftsordnung, die [...] auf die Untemehmenskultur [...] abstrahlen, beeinflussen qualitativ und intensitätsmäßig das institutionelle Verhalten der Unternehmung [..,].110
3.3.3. Subkulturen
Die von Schein postulierte Kulturdefinition macht keine Angaben über die maximale Gruppengröße einer Kultur. Allerdings hat die Erfahrung gezeigt, dass sich ab einer bestimmten Unternehmensgröße Untergruppen bilden.111 Es ist ein normaler Entwicklungsverlauf, dass „eine soziale Großgruppe im Lauf der Zeit Untergruppen hervorbringt, die ihrerseits Subkulturen erzeugen.“112 Dabei bilden sich Subkulturen häufig identisch mit abgegrenzten Teilsystemen des Unternehmens.113 So wird auch die im weiteren Verlauf dieser Arbeit diskutierte Innovationskultur als Subkultur der Unternehmenskultur definiert.114 Von einer Untemehmenskultur im Sinne einer Einheitskultur kann nur dann gesprochen werden, wenn bestimmte Prämissen von allen Untergruppen eines Unternehmens gemeinsam geteilt werden.115 Nach Bleicher können die Beziehungen zwischen einzelnen Subkulturen „komplementär, indifferent oder substitutiv sein.“116 Es ist die Aufgabe des in Kapitel 2.3. diskutierten Intra-Kultur- Fits, die einzelnen Subkulturen eines Unternehmens untereinander zu koordinieren. Die Art und Weise des Beziehungsgefüges der Subkulturen beeinflusst dabei die inhaltliche Ausrichtung der Gesamtkultur in hohem Maße.117
3.3.4. Strategie und Struktur
Die Strategien, welche ein Unternehmen in der Vergangenheit verfolgt hat oder aktuell verfolgt, verbunden mit dem mit ihnen verknüpften Erfolg oder Misserfolg, formen die Unternehmenskultur ebenso, wie eine spezifische Aufbau- und Ablauforganisation und der damit verbundenen „Existenz bzw. Dominanz spezifischer Informations-, Kommunikations- und Koordinationsbeziehungen [,..].“118 Hier wird die Bedeutung der Interdependenzen zwischen den Subsystemen ersichtlich: Die Untemehmenskultur übt nämlich ihrerseits einen ebenso maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung der Strategien und Strukturen aus. Diese Problematik greift der folgende Abschnitt im Allgemeinen und Kapitel 3.4.3. im Besonderen wieder auf.
3.4. Wirkung der Unternehmenskultur
Es folgt die Erörterung der positiven, negativen und indirekten Wirkungen der Unternehmenskultur.
3.4.1. Positive Wirkungen
Liegt eine starke Unternehmenskultur gemäß den oben vorgestellten Bedingungen vor, lassen sich mit den Wirkungen der Untemehmenskultur Unternehmensziele erreichen. Schwarz nimmt dazu eine Zusammenführung der im Schrifttum genannten Wirkungen der Untemehmenskultur vor119: 1. Die Untemehmenskultur kann sich positiv auf die Anpassung an neue externe Anforderungen auswirken. 2. Intern wirkt die Untemehmenskultur auf die Integration der Subsysteme des Strategischen Managements, hervorgerufen durch die gemeinsame Orientierung.
Konkret lassen sich die Wirkungen in folgende interdependente Teilfunktionen dividieren:
- Koordinationsfunktion: Gerade in einem dynamischen Unternehmensumfeld arbeitet die Unternehmenskultur als informales Koordinationsinstrument weitaus effizienter als strukturelle und technokratische Koordinationsmechanismen.120 Eine starke Unternehmenskultur generiert ein einheitliches, unternehmensweit getragenes Orientierungsmuster.121 Die Steuerung komplexer Unternehmen über gemeinsame Werte bietet den Vorteil, dass nicht jeder einzelne, bald wieder überholte Vorfall geregelt werden muss, „sondern dass ein Konsens bezüglich übergeordneter, zeitlich überdauernder Ziele herbeigeführt wird.“122
- Komplexitätsreduktionsfunktion: Kulturelle Prämissen dienen als Wahrnehmungsfilter bei der Selektion und Interpretation der vorhandenen Informationskomplexität.123 Die Handlungsfähigkeit von Unternehmen verbessert sich dadurch insofern, als dass durch die stark einheitliche Kulturprägung „ein eindeutiges Raster zur Deutung von Informationen“124 zur Verfügung gestellt wird, welches die Handlungsrichtung grundlegend festlegt, die Abstimmung zwischen Unternehmensmitgliedern vereinfacht und ressourcenintensive Grundsatzdiskussionen gar nicht erst entstehen lässt. Auf der Basis solcher kollektiver Orientierungsmuster werden sinnvolle gemeinsame Kommunikationsprozesse erst möglich.125
- Sinnfunktion: Sinnstiftend wirkt die Unternehmenskultur insofern, als dass sie den Unternehmensangehörigen „übergeordnete Bezüge liefern und die Notwendigkeit bestimmter Handlungsmuster verdeutlicht.“126 Diese Sinnbezüge bestimmen das Ausmaß der Identifikation der Kulturmitglieder mit dem Unternehmen bzw. ihrer konkreten Arbeitsumgebung .127
- Identitätsfunktion: Wenn die Unternehmenskultur zusammen mit den anderen Subsystemen des Strategischen Managements im Sinne des Fit-Gedankens ein konsistentes Gesamtbild ergibt, bewirkt dies nach Innen ein positives Betriebsklima und Zusammengehörigkeitsgefühl sowie nach Außen ein wieder erkennbares Bild in der Öffentlichkeit.128 Daneben vermittelt eine starke Unternehmenskultur dem einzelnen Mitarbeiter Rollensicherheit: „’Das Unternehmen sind wir.’“129
- Motivationsfunktion: Eng mit der Sinn- und Identitätsfunktion verknüpft ist die positive motivationale Wirkung der Unternehmenskultur. Gemeinsam geteilte Prämissen fördern den Teamgeist und das Zusammengehörigkeitsgefühl einer sozialen Gruppe.130
3.4.2. Negative Wirkungen
Den positiven Wirkungen einer starken Unternehmenskultur stehen negative Wirkungen gegenüber, die in Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit von Relevanz sind.
Die Mitglieder einer Unternehmenskultur tendieren dazu, „einmal etablierte Grundannahmen nicht mehr zu überdenken [,..].“131
[...]
1 Für einen Überblick vgl. Ernst 2003: S. 23. Ernst verweist auf die Arbeiten von Pascale /Athos 1981, Ouchi 1981, Deal / Kennedy 1982 und Peters / Waterman 1982. Vgl. dazu Kapitel 3.
2 Zur besseren Lesbarkeit wird nur das männliche Genus verwendet. Wenn von Mitarbeitern gesprochen wird, sind auch Mitarbeiterinnen gemeint und so weiter.
3 Quelle: Eigene Darstellung.
4 Im Fokus des Interesses stehen Forschungsergebnisse, die Beziehungen zwischen dem betriebswirtschaftlichen Erfolg auf der einen Seite und moralisch-verantwortungsvollem Handeln auf der anderen Seite aufzeigen. Die Thematik wird häufig unter der Überschrift „Corporate Social Responsibility“ mit den Teilaspekten „Corporate Citizenship“ und „Sustainability“ geführt und ist verbreitet als Teilbereich der Unternehmenskommunikation im Unternehmenskontext institutionalisiert. Vgl. Porter / Kramer 2003: S. 40-56.
5 Eine empirische Untersuchung des Phänomens »Unternehmenskultur« könnte im Rahmen einer Diplomarbeit nur in einem abgegrenzten Teilbereich erfolgen. Eine Partialanalyse trüge jedoch kaum zur Problemlösung bei, da eine Kultur nur in ihrem komplexen Wirkungsgefüge analysiert und bewertet werden kann. Vgl. dazu insbesondere Kapitel 3.3. und 3.4..
6 Damit die Arbeit anschlussfähig ist, wird das Konstrukt des Innovationserfolgs in Kapitel 5.4. definiert.
7 Vgl. dazu insbesondere Kapitel 2.2..
8 Einzelne Aspekte der Kulturdiagnose und des Kulturmanagements werden in Kapitel 9.3. („Ausblick“) skizziert.
9 Zur Vereinfachung werden die Begriffe „Strategisches Management“ und „Strategische Unternehmensführung“ im Folgenden synonym verwandt. Gleiches gilt für die Termini „Management“ und „Führung“.
10 Eine isolierte Betrachtung der zu untersuchenden Größen ohne ein übergeordnetes Rahmenkonzept kann die Frage nach deren Einflussgrößen und Wirkungen nicht realistisch beantworten. Vgl. Schwarz 1989: S. 7f.
11 Bea / Haas (2001: S. 6-10) nennen als Ursachen für die Veränderungen in der Unternehmensumwelt den technologischen Fortschritt bei den Produktionsverfahren, den stärkeren Differenzierungsgrad bei den Nachfragern, das hohe Niveau der Kaufkraft und der damit verbundenen, verstärkt postmateriellen Werteorientierung, die Auswirkungen der zunehmenden Weltorientierung der Unternehmen und auch der Nachfrager (Globalisierung) sowie den immer größeren Einfluss unternehmensexterner Interessensgruppen.Der Unternehmensbegriff bezieht sich in dieser Arbeit auf erwerbswirtschaftlich orientierte Wirtschaftseinheiten im deutschsprachigen Kulturraum (vgl. Mugler 2005: S. 20ff). Der Begriff „Unternehmen“ wird im Folgenden vereinfacht als Synonym für die Begriffe „Unternehmung“ und „Organisation“ verwendet.
12 Vgl. Bea / Haas 2001: S. 6-10.
13 Für einen Überblick über die Entwicklungsphasen der Managementforschung und deren Forschungsschwerpunkte bis zum Strategischen Management vgl. Bea / Haas 2001: S. 11-14.
14 Wolfrum 1994: S. 16.
15 Schwarz 1989: S. 9.
16 Vgl. Wolfrum 1994: S. 16f. Strategien sollen die Entwicklungsrichtung eines Unternehmens festlegen und die Allokation von Ressourcen zur Erreichung der Unternehmensziele lenken. Strategisches Handeln betont das Wichtige, beschränkt sich auf das Wesentliche und strebt nach proakivem Handeln.
17 Für einen Überblick zu den Kernaussagen weiterer im 20. Jahrhundert diskutierten Führungsansätze und -theorien vgl. Macharzina 2003: S. 45-132.
18 Der Einfluss des marktorientierten Ansatzes geht auf die Vertreter der Harvard Business School zurück, insbesondere Porter, die in den 1980er Jahren die unternehmensexternen Faktoren Branchenattraktivität und relativer Wettbewerbsvorteil als wesentliche Einflussfaktoren des Unternehmenserfolgs herausstellten. Der marktorientierte Ansatz wird wegen seiner reaktiven Grundposition und dem ausschließlich externen Suchen von Wettbewerbsvorteilen kritisiert. Vgl. dazu Bea / Haas 2001: S. 24f; Macharzina 2003: S. 65-69.
19 Dabei sollen marktorientierter und der ressourcenorientierter Ansatz nicht als Gegensätze verstanden werden. Markterfolge lassen sich letztlich „nur dann erzielen, wenn sie den Anforderungen der Nachfrager entsprechen.“ Mit der Ressourcenfokussierung findet vielmehr „eine sachliche und zeitliche Vorverlagerung des Wettbewerbsgedankens statt“ (Bea / Haas 2001: S. 29).
20 Vgl. Grant 1998: S. 111-124. Tangible Ressourcen können über den Markt beschafft werden; sie bilden die Aktiva des Unternehmens. Ein erfolgsstiftendes Profil im intangiblen Bereich kann von Wettbewerbern ungleich schwieriger erzeugt, imitiert oder substituiert werden. Intangible Ressourcen sind tief im Unternehmen verankert und können nur unter großen Wertverlusten extern beschafft werden (vgl. Macharzina 2003: S 67f). Zu diesem Ergebnis kommt auch Wolfrum (1991: S. 32ff), der die überragende Bedeutung immaterieller Erfolgsbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit herausstellt.
21 Vgl. Burr 2004: S. 119ff.
22 Vgl. Bea / Haas 2001: S. 24f; Macharzina 2003: S. 65-69. Die Ressourcen werden als Vorsteuerungsgrößen des Erfolgs betrachtet, indem unternehmensspezifischen Stärken mit den externe Chancen und Risiken abgeglichen und ausgebaut werden.
23 Vgl. Macharzina 2003: S. 66.
24 Vgl. Bea / Haas 2001: S. 27. So kann z.B. die Ressource „Organisation“ Speicher der Stärken „Flexibilität“ oder „Kooperationsfähigkeit“ sein.
25 Vgl. Bea / Haas 2001: S. 106-131. Ob ein Unternehmen mit einem Erfolgsfaktor eine Stärke oder eine Schwäche aufweist, ist stets relativ im Verhältnis zum Wettbewerb zu sehen. Mit einer Stärken-/Schwächenanalyse ist daher untrennbar ein Gegenüberstellen des Stärken-/Schwächenprofils mit den Ergebnissen einer Konkurrentenanalyse verbunden. Als Analyseinstrument zur Ermittlung des unternehmensspezifischen Ressourcenprofils steht u. a. die Wertkette nach Porter zur Verfügung.
26 Vgl. Steinle / Kirschbaum / Kirschbaum 1996: S. 50f. Der Return on Investment (RoI) ist eine eher langfristig ausgerichtete Kennziffer, die das Verhältnis zwischen Gewinn und investiertem Kapital darstellt. Der Cash Flow ist eine eher kurzfristig ausgerichtete Kennziffer zur Darstellung des Einzahlungsüberschusses (respektive Liquidität, Finanzkraft) einer Rechnungsperiode.
27 Für einen Überblick über praktische, theoriegeprägte und empirische Erfolgsfaktorenansätze vgl. Steinle / Kirschbaum / Kirschbaum 1996: S. 19. Die Studien unterscheiden sich durch ihre definitorischen Grundlagen, Methoden und Ergebnisse. Bea / Haas (2001, S. 106-131) stellen als ausgereifte Konzepte der empirischen Erfolgsfaktorenforschung das PIMS- Programm, das Konzept des Produktlebenszyklus sowie das Konzept der Erfahrungskurve heraus. Das Ziel der Konzepte ist die Ermittlung von empirisch bestätigten Zusammenhängen zwischen den Strategischen Erfolgsfaktoren und dem Strategischen Erfolg ist.
28 Vgl. Wolfrum 1994: S. 17f. Ein Komparativer Konkurrenzvorteil bildet die Grundlage für einen Wettbewerbsvorteil. Ein Wettbewerbsvorteil muss die drei Eigenschaften „wichtig für die Abnehmer“, „als Vorteil wahrnehmbar“ und „dauerhaft schwer imitierbar“ erfüllen.
29 Quelle: Modifizierte Darstellung in Anlehnung an Wolfrum 1994: S. 18.
30 Für einen Überblick über die vorhanden Konzepte zur Darstellung und Erklärung der Subsysteme des Strategischen Managements vgl. Bea / Haas 2001: S. 15-18; Schwarz 1989: S. 7f .
31 Vgl. Bea / Haas 2001: S. 15ff.
32 Vgl. Peters / Waterman 1984: S. 30-34. Peters / Waterman stellen sieben Variablen als relevante Ressourcen und damit Subsysteme des Strategischen Managements heraus: Die Strategie (strategy), die Struktur (structure), die Systeme und Verfahren (systems), das Stammpersonal (staff), die vorhandenen oder angestrebten Stärken und Spezialkenntnisse (skills), der Führungsstil (style) sowie die Kultur (subordinate goals).Zur Erklärung der einzelnen Subsysteme vgl. Macharzina (2003: S. 905f): „Strategie“ bezeichnet die Aktionsplanung eines Unternehmens, nach der die Allokation der knappen Ressourcen erfolgt. „Struktur“ bezeichnet die Art und Weise, in der ein Unternehmen organisiert ist. „Systeme“ stellen die vom Management angewandten Systeme und Techniken dar. „Stammpersonal“ beschreibt die Charakteristiken der Mitarbeiter. „Spezialkenntnisse“ bezeichnet die besonderen Fertigkeiten und Fähigkeiten der Mitarbeiter und des Unternehmens. „Führungsstil“ bezeichnet die Verhaltensmuster der Unternehmensführung. Die „Kultur“ steht im Fokus der vorliegenden Arbeit und wird in Kapitel 3 eingehend diskutiert.
33 Vgl. Bea / Haas 2001: S. 16f; Scholz 1988: S. 91. In den späteren Forschungsarbeiten galt es daraufhin als allgemein anerkannt, dass die Unternehmenskultur essentieller Bestandteil des Strategischen Managements ist.
34 Vgl. Macharzina 2003: S. 121; Schwarz 1989: S. 7-12. Zur Kritik am 7S-Modell vgl. Macharzina (2003: S. 909). Genannt werden insbesondere die potentielle Unvollständigkeit des Modells, die Ausblendung exogener Größen und der empirisch nur unzureichend bestätigte Zusammenhang zwischen harten und weichen Faktoren.
35 Vgl. Ansoff 1979: S: 7.
36 Vgl. Schwarz 1989: S. 18-21.
37 Vgl. zu den System-Komponenten der Kultur Kapitel 3.
38 Vgl. dazu allgemein Kapitel 3.3. und 3.4. sowie themenspezifisch Kapitel 8.4.. Bei der aufwändigen Herstellung des Inter-System-Fits müssen allerdings die Opportunitätskosten der Anpassungen berücksichtigt werden. (Vgl. Wolfrum 1994: S. 38).
39 Vgl. dazu insbesondere Kapitel 6.2. und 6.3..
40 Quelle: Erweiterte Darstellung in Anlehnung an Peters / Waterman 1984: S. 32. Bea / Haas (2001: S. 17) bauen darauf auf und präsentieren eine erweiterte Darstellung der Subsysteme des Strategischen Managements. Sie unterscheiden zwischen 1.übergeordneten Führungspotentialen (Strategische Planung, Strategische Kontrolle, Information, Organisation,Unternehmenskultur) sowie 2. Leistungspotentialen, die im Leistungsprozess unmittelbar zur Wertschöpfung beitragen (Beschaffung, Produktion, Absatz, Kapital, Personal, Technologie).
41 Wie bereits in Kapitel 1.3 erörtert, sollte der Zusammenhang zwischen Indikatoren und betriebswirtschaftlichen Erfolgsgrößen im Rahmen einer Anschlussarbeit überprüft werden, um den Argumentationsgang zu vervollständigen. Damit die Arbeit dahingehend anschlussfähig ist, wird das Konstrukt des Innovationserfolgs in Kapitel 5.4. definiert.
42 Quelle: Eigene Darstellung.
43 Vgl. Poech 2003: S. 6f
44 Vgl. Kapitel 2.2.. Pümpin / Kobi / Wüthrich (1985: S. 19f) definieren hardwarebezogene Potentiale als Wettbewerbsvorteile, die Ausdruck physischer Voraussetzungen sind (z.B. produkt- und verfahrensspezifisches Know-how, Sach-/Finanzmittel, Produktqualität sowie Verkaufs- und Distributionssysteme).
45 Vgl. Pümpin / Kobi / Wüthrich 1985: S. 19.
46 Pümpin / Kobi / Wüthrich 1985: S. 19.
47 So subsumiert Poech (2003: S. 47) als Feststellung ihrer Metaanalyse von empirischen Forschungsarbeiten, dass sich die Unternehmenskultur positiv auf die Effizienz betrieblicher Prozesse auswirkt.
48 Vgl. Bea / Haas 2001: S. 452. Auch Bleicher (1991: S. 731) argumentiert, dass der Versuch, hochkomplexe Probleme ausschließlich technokratisch zu lösen, dem spezifischen Charakter von Unternehmen als soziales System nicht mehr gerecht wird.
49 Vgl. Bea / Haas 2001: S. 452. Die Globalisierung wird insbesondere verursacht durch zusammenwachsende Wirtschaftsräume, aufweichende geographischer Grenzen, Prozessverbesserungen im Transportbereich sowie die steigenden Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnik. Güter und Wissen werden zunehmend mobil und die Markttransparenz steigt. Vgl. zu den Veränderungen der Rahmenbedingungen auch Kapitel 2.1..
50 Vgl. Bea / Haas 2001: S. 454. Da diese Umschreibungen häufig mit Attributen wie »unsichtbar«, »ungreifbar« oder »komplex« charakterisiert werden, kann bei der Kultur von einem »Phänomen« oder »Konstrukt« gesprochen werden.
51 Vgl. Daxner et al. 2005: S. 5f. Werte respektive Wertvorstellungen finden ihren Ausdruck in Werturteilen. Werte enthalten eine kognitive Dimension (Wissen über den Wert), eine affektive Dimension (der originäre Vorgang der Beurteilung) und eine konative Dimension (die mittelbaren Verhaltensmuster auf Grundlage der Werte).
52 Die Abgrenzung zwischen Werten und Einstellungen verläuft fließend. Martin (2002: S. 125) beschreibt Einstellungen als „einen Zustand der Bereitschaft, sich in einer spezifischen Situation einem Objekt [...] gegenüber positiv oder negativ zu verhalten [...]“, während Werte auf einer höheren Abstraktionsebene und erweitert um die Dimension der Langfristigkeit „[...] ein konsistentes System von Einstellungen mit normativer Verbindlichkeit [...]“ (Martin 2002: S. 126) bezeichnen.
53 Vgl. Bleicher 1991: S. 732. Bleicher bezeichnet Normen als „die Handlungsmaximen und Verhaltensvorschriften“ einer sozialen Gruppe.
54 Schein 1995: S. 23
55 Wie Schein (1995: S. 23) argumentiert, gelingt die Bildung einer gemeinsamen Kultur aber nicht in jeder Gruppe: Kulturelle Elemente laufen in einer Gruppe einander zuwider, wenn „mangelnde Stabilität der Mitgliedschaft, unzureichender gemeinsamer Erfahrungshintergrund oder die Existenz zu vieler Untergruppen mit verschiedenen eigenen Erfahrungen“ zusammentreffen.
56 Vgl. Schein 1995: S. 22. Diese Integration zu einem einheitlichen Ganzen entspricht dem in Kapitel 2.3. diskutierten IntraKultur-Fit.
57 Vgl. Bleicher 1993: S. 175f
58 Vgl. Bea / Haas 2001: S. 454f; Bleicher 1991: S. 738f
59 Vgl. Macharzina 2003: S. 222. Eine starke Kultur wird nachMacharzina und der dort zitierten Literatur maßgeblich von Dauer und Umfang der gemeinsam gemachten Erfahrungen der Kulturangehörigen bestimmt.
60 In Kapitel 6 werden dazu zunächst innovationshemmende und innovationsfördernde Unternehmenskulturen anhand von Kulturtypologien voneinander abgegrenzt. In Kapitel 7 und 8 werden darauf aufbauend die Merkmale der Unternehmenskultur eines innovationsorientierten Unternehmens sowie deren Indikatoren dargestellt.
61 Kernaussage der subjektivistischen Kulturperspektive ist «Ein Unternehmen ist eine Kultur»: Sie beschreibt die Kultur als System von Ideen und Bedeutungen, welches mit dem sozialen System in enger Verbindung steht. Vgl. Schwarz 1989: S. 34.
62 Kernaussage der objektivistischen Kulturperspektive ist «Ein Unternehmen hat eine Kultur»: Sie beschreibt die Kultur als Bestandteil bzw. Komponente des sozialen Systems. Vgl. Schwarz 1989: S. 34.
63 Smircich 1983: S. 346. Diese instrumentelle Sichtweise trennt Smircich in zwei Paradigmen: Das «comparative management» beschreibt Kultur als exogene Variable, die sich auf interne Gegebenheiten auswirkt. Die «corporate culture» stellt eine interne Variable dar, die von der Unternehmensführung zur Erreichung von Zielen eingesetzt werden kann.
64 Vgl. Schwarz 1989: S. 35.
65 Smircich 1983: S. 353. Diese metaphorische Sichtweise unterstellt im Übrigen, dass sich die Kultur einer Beeinflussung durch das Management weitgehend entzieht.
66 Vgl. Schwarz 1989: S. 36.
67 Erst auf einer solchen Grundlage kann dann der instrumentelle Charakter der Unternehmenskultur zum Gegenstand des Interesses werden.
68 Macharzina (2003: S. 217) verwendet andere Begrifflichkeiten und bezeichnet die anthropologische Perspektive als explikatives Kulturkonzept, das den geistigen und normativen Überbau des Handelns darstellt. Die soziologische Perspektive wird als deskriptives Kulturkonzept bezeichnet, das die wahrnehmbaren Ergebnisse der Zivilisation als Ergebnis des erwähnten geistig-normativen Überbaus beschreibt. Auch Macharzina postuliert, dass die Realität verkürzt würde, wenn nur eine der Perspektiven Berücksichtigung fände.
69 Vgl. Schwarz 1989: S. 32.
70 Vgl. Schwarz 1989: S. 40. Auch Pape (1996: S. 15) definiert Unternehmenskultur 1. als gestaltbare Instrumentalvariable sowie 2. als ständige Kontextvariable. Im Sinne des Fit-Gedankens ist schließlich die Unternehmenskultur mit den anderen Subsystemen des Unternehmens abzustimmen.
71 Vgl. Ernst 2003: S. 25. „Unternehmenskultur“ wird im Folgenden als Synonym für die Begriffe „Unternehmungskultur“, „Organisationskultur“ und „Firmenkultur“ verwendet.
In der Literatur bezieht sich Unternehmenskultur auf eine eher ökonomische Sicht, während Organisationskultur eine eher organisationspsychologische Perspektive einnimmt. Auf eine Diskussion der Unterschiede wird an dieser Stelle verzichtet.
72 Schnyder 1989: S. 61.
73 Poech 2003: S. 11.
74 Bea / Haas 2001: S. 456. Bleicher (1991: S. 732) bezeichnet die verhaltensprägende Dimension der Unternehmenskultur als „kollektive [.] Programmierung des menschlichen Handelns“.
75 Vgl. Ernst 2003: S. 25.
76 Schein 1995, S. 25. Diese Definition weist auf die Voraussetzung für eine Kulturbildung hin: 1. Neue Mitglieder müssen diese Prämissen erkennen und lernen. Da diese nur selten offensichtlich sind, kann eine Entschlüsselung „nur über Belohnungen und Strafen gelingen [...]“ (Schein 1995: S. 26). Weiter geht eindeutig hervor, dass eine Kultur nicht mit offenen Verhaltensmustern gleichzusetzen ist. Regelmäßigkeiten im Verhalten können, müssen aber nicht eine Manifestation von gemeinsamen Prämissen sein, sondern können sich ebenso aus individuellen Erfahrungen oder biologischen Reflexen bilden (vgl. Schein 1995: S. 27).
77 Schein 1995: S. 61. So bilden sich kulturelle Prämissen zum einen aus den Aspekten der Beziehungen einer Gruppe zu ihrer externen Umgebung: „Die Gruppe muss in den Fragen der Kernmission, der Ziele und der geeigneten Mittel [.] zum Konsens gelangen [...]“ (Schein 1995: S. 73). Zudem muss die Gruppe einen gemeinsamen Konsens bezüglich ihrer internen Beziehungen schaffen. Darunter fallen u. a. das Schaffen einer gemeinsamen Sprache, die Festlegung der Gruppengrenzen, die Verteilung von Macht und Status, die Entwicklung von Regeln für Vertrautheit und Freundschaft sowie die Kriterien zur Erteilung von Belohnungen und Strafen (Schein 1995: S. 75-90). Vgl. dazu auch Kapitel 6 und 7.
78 Ernst 2003: S. 25. Demnach übernimmt die Unternehmenskultur eine Steuerungsfunktion, indem sie die Handlungsspielräume ihrer Mitglieder begrenzt, die sich zwischen den formalen und individuellen Auslegungen bilden können. Vgl. zur Steuerungsfunktion der Unternehmenskultur Kapitel 3.4..
79 Ernst 2003: S. 25.
80 Vgl. dazu insbesondere Kapitel 7.2..
81 Vgl. Schein 1995: S. 56. „Kulturelle Prämissen wurzeln in den führen Gruppenerfahrungen und in dem Schema, in dem sich Erfolge und Mißerfolge eingestellt haben“. Nach Bleicher (1991: S. 732) werden diese gemeinsamen Erfahrungen als kognitive Dimension der Unternehmenskultur über Werte und Einstellungen auf die Gegenwart übertragen, wo sie in ungeschriebenen Gesetzen das Verhalten der Mitglieder steuern (affektive Dimension).
82 Vgl. dazu bereits Kapitel 3.2.2.; vgl. Macharzina 2003: S. 219.
83 Schein 1995: S. 28.
84 Vgl. Macharzina 2003: S. 219f. Insofern ist die Unternehmenskultur-Forschung von der Corporate Identity-Forschung abzugrenzen. Birkigt / Stadler (2002: S. 18f) definieren Corporate Identity (CI) als „strategisch geplante und operativ eingesetzte Selbstdarstellung und Verhaltensweisen eines Unternehmens nach innen und außen auf Basis einer festgelegten Unternehmensphilosophie, einer langfristigen Unternehmenszielsetzung und eines definierten Soll-Images mit dem Willen, alle Handlungsinstrumente in einen einheitlichen [...] Rahmen zu bringen“. Zunächst fällt auf, dass die CI ausschließlich durch das Management entsteht und umgesetzt wird, während sich eine Unternehmenskultur auch ohne Managementhandlungen bilden kann. Schnyder (1989, S. 149ff.) unterscheidet die wissenschaftlichen Wurzeln der UK in der Anthropologie mit den Wurzeln der CI in der Psychologie und Soziologie. Dem Ansatz, Völkerkulturen auf die Unternehmensebene zu übertragen, steht der Ansatz gegenüber, Konzepte und Methoden, die ursprünglich einzelne Personen betreffen, zu übertragen. Während sich die CI primär mit Problemen der Identität und Profilierung beschäftigt, ist die UK breiter ausgelegt und fokussiert das gesamte Unternehmensgeschehen. Darüber hinaus wendet sich die CI primär an die externe Unternehmensumwelt, während die UK unternehmensinterne Beziehungszusammenhänge fokussiert (vgl. Scholz 1988: S. 84). Macharzina (2003: S. 221) ordnet die CI auf Grundlage dieser Ausführungen als sichtbaren Teil der UK ein. Gleiches gilt für die vom Management geschaffenen Konstrukte der Unternehmensphilosophie („Soll-Kultur“) sowie der Unternehmensgrundsätze (vgl. Macharzina 2003: S. 221), die zunächst Worthülsen darstellen und nur dann verhaltensbestimmend sind, wenn sie von der Mehrzahl der Unternehmensangehörigen getragen und so Teil der UK werden.
85 Schein 1995: S. 32.
86 Vgl. Macharzina 2003: S. 219. Ob Neulinge die Unternehmenskultur annehmen, liegt deren individualkulturellen Prämissen. Steht seitens der Unternehmensführung die Harmonie im Unternehmen im Vordergrund, ist bei der Personalrekrutierung auf einen entsprechenden Kultur-Fit zu achten. Anderseits kann es gerade beabsichtigt sein, diese Harmonie durch die Rekrutierung völlig gegensätzlicher Persönlichkeiten aufzubrechen.
87 Vgl. Schein 1995: S. 30f. Sackmann (2004: S. 2) vergleicht die sichtbaren Artefakte einer Kultur, in der sich die grundlegenden Überzeugungen eines Unternehmens nach Außen ausdrücken, mit der Spitze eines Eisbergs.
88 Vgl. Bea / Haas 2001: S. 457-459.
89 Vgl. Scholz 1988: S. 82.
90 Vgl. Schein 1995: S. 32f. Meffert (2000: S. 125) argumentiert ähnlich. Für ihn stellen Werte gespeicherte Auffassungen von Wünschenswertem dar, die er als „Über-Einstellungen“ bezeichnet.
91 Bleicher 1991: S. 732.
92 Vgl. Scholz 1988: S. 82.
93 Vgl. Schein 1995: S. 33. Grundannahmen gelten als derart selbstverständlich, dass „man innerhalb eines kulturellen Verbands nur auf geringe Unterschiede trifft. Schein stellt heraus, dass sich nur mit der Kenntnis dieser Grundannahmen die Artefakte interpretieren und die Glaubwürdigkeit der bekundeten Werte beurteilen lassen. Vgl. zu den Grundannahmen einer innovationsförderlichen Unternehmenskultur Kapitel 7.2..
94 Vgl. Schwarz 1989: S. 50.
95 Quelle: Modifizierte Darstellung in Anlehnung an Bea / Haas 2001, S. 459.
96 Die Grundlage seiner Arbeit stellt eine Verdichtung von vorhandenen Unternehmenskulturmodellen dar, in der er feststellt, dass sich die Systematisierungsvorschläge in ihren Grundstrukturen weitgehend decken. Vgl. Schwarz 1989: S. 54.
97 Vgl. Schwarz 1989: S. 54-59. Unschärfen hinsichtlich der Möglichkeit, dass sich einzelne Elemente logisch mehreren Komponenten zuordnen lassen können, werden in Kauf genommen.
98 Zu den Symbolen zählen insbesondere Gebäude, Einrichtungen, Umgangsformen, Rituale und Legenden.
99 Nicht das gesamte individuelle Verhalten fällt unter das Anwendungssystem, sondern nur der Teil davon, der mit der Unternehmenskultur interagiert. Vgl. dazu auch Kapitel 3.3..
100 Bleicher 1991: S. 734.
101 Vgl. Scholz 1988: S. 81. Bea / Haas (2001: S. 467f) erklären diesen Prozess der Sozialisation als „Lernprozess des Hineinwachsens in ein Beziehungsgefüge“. Innerhalb dieses Prozesses kann unterschieden werden in primäre Sozialisation, die endet, wenn ein Mensch eine eigene Identität gefunden hat, sowie sekundäre Sozialisation, die ein ganzes Leben fortdauert.
102 Vgl. Macharzina 2003: S. 109. Diese „geistige Landkarte“ von Entscheidungsträgern in Unternehmen konstituiert sich nach Macharzina (2003: S. 109) aus „deren Wertesystem, deren Attitüden, deren Motive und Bedürfnisse, deren kognitive Strukturen, deren Problemlösungstyp [...]“ sowie aus der strategischen Grundhaltung und der Kultur des Unternehmens, in dem sie arbeiten. Bei der Determinante „Unternehmenskultur“ werden Wechselbeziehungen ersichtlich: Zum wird die „private Theorie“ von der Kultur beeinflusst, die durch ihre koordinierende Funktion eine Einengung des Interpretationsspielraums für Problemlösungen erzeugt, zum anderen üben die Kulturmitglieder und deren „private Theorien“ nämlich ihrerseits einen ebenso maßgeblichen Einfluss auf die Ausrichtung der Unternehmenskultur aus.
103 Der Aspekt der Kulturveränderung wird in dieser Arbeit in Kapitel 9.3. (Abschnitt „Ausblick“) andiskutiert.
104 Schein 1995: S. 17.
105 Vgl. Schein 1995: S. 17. Gerät das Unternehmen im weiteren Verlauf in Schwierigkeiten und verlieren einige Prämissen ihre Gültigkeit, ist es wiederum die Aufgabe des Managements, aus der ursprünglichen Kultur auszubrechen und die notwendigen Veränderungsprozesse einzuleiten.
106 Vgl. Bea / Haas 2001: S. 469. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass umgekehrt auch das Führungsverhalten die Ausprägungen einer Kultur beeinflusst wird. Vgl. zu den Indikatoren einer innovationsorientierten Unternehmenskultur Kapitel 8.
107 Vgl. Bleicher 1991: S. 735; Schwarz 1989: S. 60. Vgl. dazu auch Kapitel 6.2. („Branchenkultur-Typologie“).
108 Vgl. Bea / Haas 2001: S. 465. Nach Bea /Haas (2001: S. 468) manifestieren sich Interaktionen zwischen Umkultur und Unternehmenskultur insbesondere 1. über die Individualkulturen der Mitarbeiter, 2. über die kulturbedingten Erwartungen der Gesellschaft an Unternehmen, 3. in Folge von Internationalisierungsstrategien im Sinne der Herstellung eines Cultural- Fits, 4. über die im Umfeld vorherrschende Religion sowie 5. über branchenspezifische Rahmenbedingungen und Verhaltensweisen.
109 Vgl. Macharzina 2003: S. 224. Von der Wirtschafts- und Sozialordnung als Element der Landeskultur geht dabei der größte Einfluss aus.
110 Bleicher 1991: S. 740.
111 Vgl. Schein 1995: S. 27.
112 Schein 1995: S. 27.
113 Vgl. Bea / Haas 2001: S. 460; Scholz 1988: S. 88. Es können sich vertikale Subkulturen (insbesondere nach Produktsparten, Märkten oder Regionen in Spartenorganisationen sowie Hierarchieebenen) und horizontale Subkulturen (insbesondere nach Funktionen, Berufen oder Interessen) bilden.
114 Vgl. zur Definition des Begriffs der „Innovationskultur“ Kapitel 7.1..
115 Schein 1995: S. 27. Diese kommen insbesondere „im Krisenfall angesichts eines gemeinsamen Gegners zum Tragen.“
116 Vgl. Bleicher 1991: S. 740.
117 Vgl. Bleicher 1991: S. 750.
118 Vgl. Bea / Haas 2001: S. 470; Schwarz 1989: S. 60; Wolfrum 1994: S. 102f.
119 Vgl. Schwarz 1989: S. 61f.
120 Vgl. Macharzina 2003: S. 225.
121 Vgl. Bea / Haas 2001: S. 472. Sackmann (2004: S. 27) beschreibt in diesem Zusammenhang die Unternehmenskultur als „unsichtbare Einflussgröße des Menschensystems eines Unternehmens“, welche, einmal vorhanden, das kollektive Denken und Handeln im Unternehmen lenkt.
122 Macharzina 2003: S. 225.
123 Vgl. Sackmann 2004: S. 28.
124 Macharzina 2003: S. 225. Um die Entstehung dieses Rasters zu verstehen, helfen die Ausführungen von Sackmann (2004: S. 29): Die Kultur als kollektives Gedächtnis eines Unternehmens verstärkt die Verhaltensweisen, die erfolgreich waren und vermeidet solche, die zu Misserfolg führten. Dies führt zu „Verhaltenssicherheit und Kontinuität im positiven Sinne, da nicht jeder Arbeitsvorgang neu überdacht [...] werden muss.
125 Vgl. Sackmann 2004: S. 28.
126 Macharzina 2003: S. 225.
127 Vgl. Sackmann (2004): S. 29.
128 Vgl. Macharzina 2003: S. 225. Bea / Haas (2001: S. 473) nennen die Wirkung der Kultur nach Außen „Repräsentationswirkung“ und erklären, dass sich eine aus der Kultur gebildete Corporate Identity positive Erwartungen am Markt weckt, denen Absatzerfolge und Vorteile bei der Rekrutierung von Personal folgen können.
129 Vgl. Bea / Haas 2001: S. 472.
130 Vgl. Macharzina 2003: S. 226. Zur Motivationsfunktion trägt auch der Wegfall von ungeliebten formellen Koordinationsmechanismen bei.
131 Schein 1995: S. 25
- Arbeit zitieren
- Sven Theobald (Autor:in), 2006, Innovationskultur - Merkmale und Indikatoren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130449
Kostenlos Autor werden





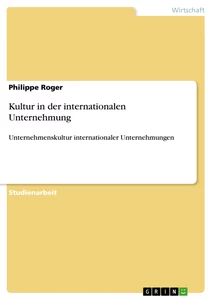




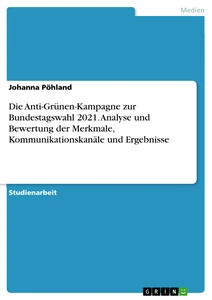






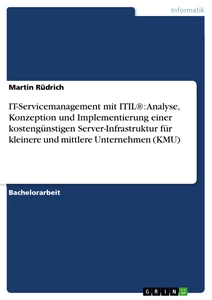




Kommentare