Leseprobe
S C H A T T E N L A N D
Analyse einer Lebenskrise
Wißt Ihr nicht, daß hier auf Erden
eine geheime Gesellschaft existiert,
die man die melancholische
Kompanie nennt ? (J. P. Jacobsen)
Den Nachmittag meines 45ten Geburtstags verbrachte ich beim Psychiater. Nach einem kurzen Gespräch stand die Diagnose fest: Depression. In diesem Zustand war ich schon seit Monaten, hatte aber stets gehofft, dass es mir gelingen würde, mein Problem auf intellektuelle Weise zu lösen, und dass ich eines Tages aufwache und alles, was mich quält, wieder weg ist – wie ein böser Traum. Aber nichts dergleichen geschah ... Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer ...
Nach dem Besuch beim Psychiater wurde mir klar, dass ich ohne pharmakologische und psychotherapeutische Unterstützung aus diesem Zustand wohl kaum herausfinden würde. Alleine schon aus dem Grunde war ich auf diese Unterstützung angewiesen, weil ich unter schlimmen Angstzuständen litt, die mich fast um den Verstand brachten. Was mir Angst machte, schien aus der äußeren Realität zu kommen. Diese äußere Ursache konnte aber nicht als alleiniger Grund für so starke Angstzustände gelten. Meine Vernunft sagte mir, dass es Unsinn ist, was da in mir vorgeht, eine andere „Instanz“ in mir schenkte ihr aber kein Gehör und trieb ihr Unwesen desto intensiver, je eindringlicher meine Vernunft ihr das auszureden versuchte.
Dank der pharmakologischen und psychotherapeutischen Unterstützung trat langsam eine gewisse Besserung ein, zu langsam aber, als dass ich damals hätte glauben können, jemals wieder gesund zu werden, jemals wieder normal leben zu können. Die Medikamente erlaubten mir eigentlich nur irgendwie die schlimmen Stunden des Tages zu überstehen. Und jeder Morgen war stets schlimmer als der vergangene Abend.
Sobald ich meine Augen öffnete, war sie nämlich wieder da – meine treue Begleiterin: die Große Angst. Wenn ich einschlief, schlief sie mit mir ein, wenn ich aufwachte, wachte sie mit mir auf. Nachts ließ sie mich meistens zum Glück in Ruhe, aber morgens war sie wieder da. So schlief ich dann stets mit der Angst ein, meiner Angst am Morgen wieder zu begegnen, und so geriet ich in den Teufelskreis „der Angst vor der Angst“. Heute weiß ich nicht mehr, was schlimmer war, die Angst vor Krankheit und Tod, die mich plagte, oder meine Angst vor der Angst.
Für den sogenannten „gesunden Menschenverstand“ – totaler Unsinn! Die Tatsache, dass ich mir dessen durchaus bewusst war, aber keinen Einfluss darauf hatte, was in mir vorging, machte alles nur noch schlimmer. Mein Verstand schien nämlich durchaus normal zu funktionieren, ich war also nicht verrückt, irgendwie aber ver-rückt und konnte dem nicht entgegenwirken. Musste es geschehen lassen. Versuchte es mir aber immer wieder auszureden. Auch andere – Freunde, Bekannte und vor allem mein Mann versuchten es mir auszureden. Ich wusste, dass sie Recht hatten, hörte ihnen zu, aber konnte die Argumente keineswegs anwenden. So hatten sie dann auch keine Wirkung!
Meine geordnete Welt und mein ganzes Leben, dass ich doch so gut im Griff zu haben glaubte, gerieten total aus den Fugen. Und der Grund war eigentlich lächerlich: eine ärztliche Untersuchung, ein Befund, aus dem sich eigentlich nichts Böses für mich ergab, der mir aber Angst machte, es könnte ja mal böse werden ... Und diese Angst konnte ich zwei Jahre lang nicht loswerden.
Sie war in mir allanwesend, allmächtig, unersättlich und sie verschlang sofort jeden positiven Gedanken, der sich in mir zu regen wagte und jeden Hoffnungsschimmer ... und trotzdem vermochte sie eines nicht, mich dieses unlebbaren Lebens zu entledigen. Sie tat es nicht, obwohl ich es mir damals sehnlichst wünschte ...
Angst scheint also nicht zu töten!? Sonst würde ihre Herrschaft über unsere Seele ja aufhören. Wenn man in ihre Fänge gerät, so macht uns ihr Geflüster wahnsinnig. Sie flüstert so lange, bis wir diesen Wahn für real halten, obwohl wir genau wissen, dass es nur ein Wahn ist.
An dieser Stelle fällt mir ein Gedicht von Erich Fried ein, das den signifikanten Titel Irrtum trägt und nur aus ein paar Zeilen besteht:
Wer seine Angst anstarrt
ohne sich abzuwenden
von dem heißt es:
„Sein Mut
muß besonders
groß sein“
Aber nicht
Sein Mut
Muß so groß sein
Nur die Angst
Die sein Auge
Nicht losläßt
Wo die Angst waltet, gibt es keinen Platz für andere Emotionen, geschweige denn für Gefühle ... ja vielleicht gesellt sich manchmal noch die Wut dazu, mit einem Beigeschmack von Schmerz und Enttäuschung, dass einen niemand versteht und niemand helfen will. Eigentlich war ich mir dessen durchaus bewusst, dass mir eigentlich niemand helfen k a n n , war aber wütend, dass mir niemand helfen w i l l. Wartete aber dennoch auf Hilfe von außen. Erzählte jedem, der bereit war, mir zuzuhören, was mir meine Angst wieder zugeflüstert hatte und tat dieses stets in der Hoffnung, dass jemand, dann vielleicht etwas sagt, was meine Angst vertreibt. So wartete ich also mehr oder weniger auf einen Zauberspruch, aber niemand kannte einen ... So blieben immer nur diese wirkungslosen Argumente der Vernunft übrig, mit denen man mir klar machen wollte, dass durchaus keine Gefahr für mich besteht. Von diesen ließ sich meine treue Begleiterin, die Große Angst jedoch keineswegs verscheuchen. Ihre „irrationale Intelligenz“ war viel mächtiger als die „rationale Intelligenz“ all derer, die mir helfen wollten. Sie verhöhnte sie alle und stellte jedes Argument in Frage!
So konnte keine Rede davon sein, einen Halt zu finden, weder in mir selber, noch an denen, die mir helfen wollten. Und es war kein Mittel zu finden, diese destruktive Wirkung der Angst außer Kraft zu setzen. Ich schien von ihrer Macht besessen zu sein.
Auf dieses destruktive Phänomen hatte schon Freud hingewiesen. In einer seiner Schriften („Jenseits des Lustprinzips“) betont er ausdrücklich, dass ihn nichts in seiner analytischen Praxis stärker beeindruckt hätte, als jene widerspenstige Kraft, die sich mit allen Mitteln gegen die Heilung wehrt und an der Krankheit und dem Leiden festhält (Freud, 1975, S. 180).
Heute weiß ich aber, dass die Mühe, die sich andere mit mir gegeben haben, nicht völlig nutzlos war. Einige Impulse von außen müssen doch auf etwas in mir gestoßen sein, dass vielleicht noch nicht ganz von der Angst zerfressen war, obwohl ich es damals nicht als wirksam empfinden konnte, sonst hätte ich diesem unlebbaren Leben doch wohl früher oder später ein Ende gesetzt.
Ich suchte nicht nur Hilfe bei anderen, ich suchte sie auch in Büchern. Mein Mann hat sich zu jener Zeit ungeheuer viel Mühe gegeben, mich mit passender Lektüre zu versorgen. Trotz meines schlechten Selbstbefindens war ich an manchen Abenden imstande etwas zu lesen. Die Angst, meine ständige Begleiterin, verließ mich zwar nicht, war aber abends manchmal etwas betäubt von den vielen Psychopharmaka, die ich tagsüber schlucken musste. Das Lesen war zwar auch kein sicheres Mittel gegen die Angst, es gab mir aber ein wenig Kraft. Und ich brauchte jedes Krümchen Kraft, um den nächsten Tag zu überstehen
Die moderne Psychologie und Psychiatrie weiß bereits schon sehr viel über das uralte Phänomen Melancholie, das heute Depression genannt wird. Man vermag heute sofort ihre Symptome zu erkennen, auch wenn sie in verkleideter Form auftreten. Es werden zahlreiche Formen dieser Störung unterschieden, mit ihrem typischen und untypischen Verlauf. Man ist auch imstande Depressionen zu heilen. Aber was weiterhin noch ungenügend untersucht zu sein scheint, sind die Ursachen depressiver Zustände. Daher bleibt ein jeder Versuch, diese zu ergründen, mehr oder weniger eine I n t e r p r e t a t i o n.
So ist dann die Psychiatrie (in dieser wie auch in vieler anderer Hinsicht) ein besonderes Gebiet der Medizin, da sie sich die Aufgabe stellt, etwas zu erfassen, was nicht zu erfassen ist. Daher ist jede Diagnose zunächst eine Hypothese, die einer permanenten Verifizierung bedarf. Andererseits gilt es, dieses unfassbare Phänomen zu behandeln, denn dem Kranken muss Hilfe geleistet werden. So muss sich ein Psychiater bei vollem Bewusstsein der Kompliziertheit des gesamten Vorhabens auf einige Vereinfachungen und Vorgehensmuster einlassen, denn dass ermöglicht sowohl eine Kommunikation mit dem Patienten als auch mit anderen Spezialisten, die eventuell noch zu Rate gezogen werden müssen. Es ermöglicht auch eine rasche Hilfeleistung, garantiert aber keine Heilung. Zu viel Individuelles geht nämlich verloren, muss zwangsläufig verloren gehen, da es keine Klassifizierung und Etikettierung verträgt. Mit dem Verlorengegangenen beschäftigt sich dann die Psychotherapie. Und diese vermag heute schon Großes zu leisten, aber auch hier geht immer noch zu viel Wesentliches verloren. So dauert es oft Jahre bis der Heilungsprozess in Gang gebracht werden kann (vgl. Dudek & Zięba, 1997, S. 13 – 14).
Diese tiefe Gemütsstörung, die man einst Melancholie nannte und heute Depression nennt, ist wohl so alt wie die Menschheit selbst. Die ersten Zeugnisse davon sind wohl in der Bibel zu finden. Hiobs Klagen weisen so manches Merkmal auf, das von der modernen Psychiatrie als depressives Symptom eingestuft werden müsste. Sein ganzes Denken und Handeln scheint im Zeichen der Depression zu stehen. In diesem Sinne ist auch seine Todessehnsucht zu deuten (vgl., ebenda, S. 15 ).
Eine der ersten Beschreibungen depressiver Zustände lieferte Hippokrates. Als Ursache dieser psychischen Störung gab er ein Übermaß an schwarzen Galle an, im Verhältnis zu den übrigen Körpersäften: gelber Galle, Schleim und Blut. Daher sprach man von melancolia also Schwarzgalligkeit (melas = schwarz, chole = Galle). Rufus aus Ephesos (1./2. Jh. n. Chr.) dagegen achtete als erster auf eine gewisse psychische Eigenschaft, die keineswegs krankhaft ist, den Betroffenen jedoch oft melancholischen Stimmungen ausliefert, besonders im Herbst und im Frühjahr. So verstand man dann unter dem Begriff Melancholie sowohl einen krankhaften Zustand als auch eine Gemütsveranlagung oder sogar eines der vier Temperamente, was wiederum auf Hippokrates zurückgeht (ebd., S. 16 – 17).
Im Altertum, aber auch später noch, glaubte man also, dass sich die Melancholie nicht nur aus dem Überfluss der schwarzen Galle ergibt, sondern auch, dass sie durch den Einfluss des Saturns verursacht werde. Das trübe Licht dieses Planeten erfülle die menschliche Seele mit tiefer Traurigkeit, was eine zur Erstarrung führende Trägheit des gesamten Gemüts zur Folge haben kann.
Sehr viel Licht brachte 1621 in die Geheimnisse der Melancholie eine umfangreiche Studie von Robert Burton, einem anglikanischen Geistlichen. Alleine schon ihr Titel The Anatomy of Melancholy verspricht eine gründliche Auseinandersetzung mit diesem komplizierten Phänomen. Und die Arbeit hält, was ihr Titel verspricht. Burton liefert nicht nur eine gründliche Übersicht des bisherigen Wissens über die Melancholie, er weist auch auf ihre Ursachen hin, die er sowohl in Erfahrungen aus der Kindheit als auch in der psychischen Veranlagung des gegebenen Menschen zu sehen scheint. Ein wichtiger Faktor scheint auch das soziale Umfeld zu sein. Die soziale Komponente scheint ihn sogar besonders zu interessieren. Er untersuchte auch die Zusammenhänge zwischen Melancholie und Gesellschaft, womit er einiges vorwegnimmt, was Wolf Lepenis – ein moderner, angesehenen Forscher auf diesem Gebiet – aufgreift und weiterverfolgt. Sein 1969 erschienenes Buch Melancholie und Gesellschaft beginnt mit einem Zitat aus Jens Peter Jacobsens Frau Marie Grubbe: „Wißt Ihr nicht, dass hier auf Erden eine geheime Gesellschaft existiert, die man die melancholische Kompanie nennt?“ (zit. nach: Lepenis, 1981, S. 7).
Wie schwierig es wohl sein mag, dieses Phänomen auf gesellschaftlicher Ebene zu erfassen, wird uns schon beim Lesen der ersten Zeilen bewusst, und es wird uns überdies bewusst, dass es auch dem Autor, Wolf Lepenis, durchaus klar ist, dass er einer Erscheinung nachspioniert, die sich so gebärdet, als ob es sie überhaupt nicht gäbe: „Nach den Ursachen von Fremd- und Eigen benennungen wird in diesem Buch gefragt“ – schreibt Lepenis – „nicht, ob einer melancholisch ist, sondern was es bedeutet, wenn einer behauptet, er sei es. Ebenso wenig wird Melancholie als Kennzeichen des ‘sozial character’ oder Volkscharakter analysiert: was die Franzosen ‘la maladie anglaise’ nennen, heißt bei den Engländern ‘french boredom’, und Roepke, der so von den Deutschen spricht, ließe sich Arthur Schopenhauer gegenüberstellen, der die Engländer das melancholischste Volk nannte. Stendhal aber reiste 1821 ausgerechnet nach London, um dort ein Mittel gegen seinen Spleen zu finden“ (ebd.).
Man sieht, dass sich schon so mancher große Mühe gegeben hat, dem Phänomen Melancholie in all seinen unterschiedlichen und sogar, wie es manchmal scheinen mag, widersprüchlichen Aspekten auf die Schliche zu kommen. So kann man dann wohl sagen, dass man dieses Phänomen sowohl als Krankheit wie auch als eine persönliche Veranlagung (bzw. Temperament) zu verstehen pflegt, mit der Tendenz bei manchen Autoren, es sogar bei ganzen Völkern zu erkennen oder auf bestimmte Epochen zu beziehen, z.B. das fin de siècle . Die größte Bedeutung gewann das Motiv der Melancholie im 18. Jahrhundert, als man sie, und dieses nicht nur in Deutschland, als Werther-Krankheit bezeichnete. Sie hatte eine wahre Epidemie stilechter Selbstmorde zur Folge. Auch gegen Ende des 19. Jahrhunderts als man von „mal du siecle“ sprach, der Krankheit des ausgehenden Jahrhunderts (des fin de siècle), hinterließ die Melancholie so manche tragische Spur.
Von der Stimmung des fin de siècle schienen wohl die meisten damals betroffen, ohne wirklich krank zu sein. Es war fast eine Mode. Einerseits war man tief im bürgerlichen Leben verankert, andererseits konnte man keiner Sache mehr sicher sein, weder im Bereich der Materie, noch des Geistes. Und gerade diese Stimmung hat die Literatur der damaligen Zeit wunderbar eingefangen. Die Literatur ist eines dieser besonderen Gebiete, die einen tiefen Einblick in die Geheimnisse des Phänomens „Melancholie“ gewährleisten. Der Literatur verdanken wir auch den wohl bekanntesten Melancholiker aller Zeiten: Hamlet.
Was kann uns aber eigentlich heute noch an diesem passiven Helden, der vor jeder Schwierigkeit zurückweicht und sich durch Selbstzweifel, Entscheidungs- und Handlungsunfähigkeit in Frage stellt, interessieren, wenn da nicht die Tatsache wäre, dass wir dies alles bei uns selbst erkennen oder zumindest ahnen. So dürfte uns dann das Jacobsen-Zitat, das zum Motto dieses Kapitels geworden ist, keineswegs wundern, denn tatsächlich scheint es „hier auf Erden eine geheime Kompanie“ der Melancholiker zu geben.
Und man kommt ins Grübeln, wenn man sich vor Augen führt, wie groß wohl diese Kompanie sein mag. Bekannte Persönlichkeiten und völlig unbekannte Leute gehören dazu. Doch alle verbindet eines, alle kennen diese trügerische Sackgasse im Labyrinth ihrer Psyche. Viele fanden da nicht wieder heraus, manche aber wurden auf wundersame Weise gerettet, indem sie eine Wandlung erfuhren; eine Wandlung, mit der sie nicht mehr gerechnet haben.
Eine Auffassung der Melancholie im Sinne von Depression, wie wir sie heute verstehen, gibt es eigentlich erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als sich die Psychologie zu einem selbstständigen Forschungsgebiet emanzipierte und als die Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Physiologie Klarheit über bestimmte Funktionen des Gehirns und deren Störungen schufen. Das bedeutet aber noch längst nicht, dass alles, was vorher darüber gesagt wurde, irrelevant ist, weil es von der Wissenschaft nicht bewiesen werden konnte. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese veralterten, unwissenschaftlichen Auffassungen mehr zu erzählen haben, als die modernsten, wissenschaftlich bewiesenen Theorien.
So fasziniert mich persönlich besonders die Auffassung der Melancholie von Aristoteles, der sie stets mit Genialität gepaart sieht. In krasser Opposition zu dieser Auffassung steht die mittelalterliche Sicht dieses Phänomens. Da man im Mittelalter jegliche Krankheiten als Strafe Gottes für ein sündiges Leben ansah und überdies auch an Hexerei und Besessenheit glaubte, hatten Menschen, die von psychischen Störungen heimgesucht wurden, einen besonders schwierigen Stand. Melancholie wurde als schwere Sünde angesehen, weil sie nach der damaligen Auffassung von einer Glaubenskrise zeugte, und diese nur das Werk des Teufels sein konnte.
Häufig betraf dieses mittelalterliche Mönche und äußerte sich als Trägheit des Körpers und des Geistes, die sich besonders als Widerwillen gegen jegliche religiöse Handlungen zu erkennen gab. Gleichzeitig wurden die Betroffenen aber von schweren Schuldgefühlen geplagt und der Angst, für ihre Sündhaftigkeit bestraft zu werden. Acedia nannte man diesen Zustand, und er würde heute den schwersten Formen eine Depression entsprechen: Zuständen völliger Apathie und Erstarrung. Die Interpretation dieses Zustandes als einer Todsünde, mag uns vielleicht schockieren, aber ein gewisses Echo davon kann man noch heute vernehmen. Besonders häufig auftretende Symptome einer Depression sind nämlich: unbegründete Schuldgefühle, die den Kranken plagen und ein auf den Nullpunkt gesunkenes Selbstwertgefühl.
Als sich gegen Ende des Mittelalters ganz neue Entwicklungstendenzen des menschlichen Geistes zu Worte meldeten, die dann die Epoche der Renaissance hervorbrachten, änderte sich vor allem das Bild des Menschen. Jetzt wurde alles zulässig, was einfach menschlich war. Dem Menschen sollte nichts Menschliches mehr fremd bleiben. Es nimmt daher nicht wunder, dass sich auch das Verhältnis zu Gemüts- und Geistesstörungen änderte.
Marsilio Ficino schreibt daher in seiner De vita triplice (1494) über die schöpferischen Aspekte der Melancholie, knüpft dabei selbstverständlich an Aristoteles an. Einen melancholisch veranlagten Menschen stellt er folgendermaßen dar: „Selten gewöhnliche Charaktere und Schicksale, sondern Menschen, die von den anderen verschieden sind, göttliche oder tierische, glücksselige oder vom tiefsten Elend niedergebeugte“ (zit. nach: Hocke, 1973, S. 20).
Melancholiker sind nach Ficino dann ganz außergewöhnliche Personen, deren Schicksal auch außergewöhnlich sein muss. Sie unterscheiden sich deutlich von anderen, weisen entweder göttliche oder tierische Züge auf. Er schien sich selber in diesen Kategorien zu betrachten, so schrieb er dann auch: „Ich weiß in diesen Zeiten sozusagen gar nicht, was ich will, vielleicht auch will ich gar nicht, was ich weiß, und will, was ich nicht weiß“ (zit. nach: Hocke, ebd.).
Eine treffende Zustandschilderung stammt auch von dem hl. Augustinus: „Zum Teil wollen und zum Teil nicht wollen, ist kein unbegreiflicher Stand der Dinge, sondern eine Krankheit der Seele ... Es gibt dann einen doppelten Willen, und keiner davon ist ganz, denn einer besitzt das, was dem anderen fehlt. So kann ich nicht ganz Wollen und ganz nicht Wollen. Daher stand ich mit mir selber im Streit und war Zerrissen. Aber auch diese Zerrissenheit war wider meinen Willen, bewies aber nicht die Anwesenheit eines fremden Geistes in mir ... ein und dieselbe Seele ist es, die zur Hälfte das eine will, zur anderen Hälfte aber das andere“ (Hl. Augustinus, Bekenntnisse, Buch 8). Diese Selbstdarstellung weist zwar auf einen neurotischen Zustand hin, aber auch Neurosen haben ihre depressiven Phasen.
Depression oder Melancholie wie man sie einst nannte, ist durchaus keine einheitliche Kategorie, sie beinhaltet vieles, sehr vieles, nimmt unzählige Gestalten und Ausdruckformen an, weist eine enge Verwandtschaft mit vielen anderen Störungen auf, so dass es manchmal wirklich schwer ist, sie von diesen zu unterscheiden.
Die Vielschichtigkeit dieses Phänomens faszinierte nicht nur Ärzte, Psychologen, und Geisteswissenschaftler, sondern auch Künstler. Eine der eindrucksvollsten künstlerischen Darstellungen der Melancholie lieferte 1514 Albrecht Dürer mit seinem Kupferstich Melencolia I. Man kann dieses Werk als ein gewisses geistiges Autoportrait des Künstlers ansehen. Dürer schien sich wohl vor allem der Doppelnatur dieses Phänomens bewusst zu sein, und dieses durchaus im aristotelischen Sinne. So wusste er also, dass Melancholie das schöpferische Genie bestimmt, ohne die sich kein Werk zur vollen Ausdruckskraft entfalten könnte. Und es bedarf ihrer durchaus, um etwas Wahres über das menschliche Dasein aussagen zu können. Dieses edle „Brandmal“, von dem Dürer gezeichnet zu sein schien, bemerkte schon Philip Melanchthon, einer der nächsten Mitarbeiter Luthers, indem er den Ausdruck generissima melancolia Düreri prägte ( zit. nach: Hagen & Hagen, 1984, S. 82).
Man kann natürlich die Dürersche Auffassung der Melancholie, wie er sie allegorisch in seinem Kupferstich darstellt, nicht dem heutigen Begriff der Depression völlig gleichsetzen. Dürers Melancholie ist viel komplexer. Sie scheint eine besondere Veranlagung auszumachen, eine Gabe, die einem schöpferischen Geist die Grenzen seiner Möglichkeiten aufzeigt, aber zugleich eine Herausforderung zur Grenzüberschreitung ist. Wer diesen Kupferstich kennt, der weiß, dass Dürers Melancholie Flügel hat. Diesem Phänomen widme ich ein ganzes Kapitel in meinem Buch, in dem man auch den Abdruck des Kupferstichs findet.
Die Mehrdeutigkeit, wenn nicht Vieldeutigkeit des Begriffs Melancholie ergibt sich natürlich auch daraus, dass man das sich darunter verbergende Phänomen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln zu erfassen versuchte. Es ist wohl durchaus verständlich, dass Melancholie anders von einem Psychologen, anders von einem Soziologen, anders von einem Philosophen und noch ganz anders von einem Künstler betrachtet werden muss. So spricht Sören Kierkegaard wohl nicht über das Gleiche wie Aristoteles, Aristoteles nicht über das Gleiche wie Wolf Lepenis und Lepenis durchaus nicht über das Gleiche wie Freud und dieser schon gar nicht über das Gleiche wie Jung. Und so könnte man mit dieser Auflistung bis ins Unendliche fortfahren.
Die moderne Wissenschaft verlangt aber Klarheit und Eindeutigkeit beim Erfassen des Phänomens Depression, von der die Menschheit heute wie wohl noch in keiner anderen Epoche geplagt zu sein scheint. Und das sie dieses verlangt, ist auch durchaus verständlich und akzeptabel, denn es gilt, schnelle Hilfe zu leisten und nicht mit langwierigen Interpretationen Zeit zu verlieren, was den Kranken das Leben kosten kann.
Es bleibt aber eine Notlösung. Vielleicht nicht einmal eine Not-Lösung, vielleicht vielmehr ein Notbehelf, denn eigentlich wird ja weder mit der Diagnosenstellung noch mit der pharmakologischen Behandlung etwas gelöst. Aber man kann natürlich nicht erwarten, dass man vom Psychiater Folgendes zu hören bekommt: „ ... und ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, lieber Herr Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst liebzuhaben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein“ (Rilke, Brief an Franz Xaver Kappus, 16. Juli, 1903).
Wenn sich ein Psychiater eines ähnlichen Textes wie dieser, bedienen würde, hielten ihn seine Patienten gewiss für verrückt! Und er würde wohl recht bald all seine Patienten verlieren. In einem so jämmerlichen Zustand, wie ich ihn aus eigener Erfahrung kenne, erwartet ein Patient keine Vertröstungen auf ein Irgendwann, sondern wirksame sofortige Hilfe. Und diese ist leider nur pharmakologisch zu leisten.
Daher werde ich nie ein böses Wort über Psychopharmaka sagen, aber sehr viele böse Worte über diejenigen, die in einer medikamentösen Behandlung von Neurosen und Depressionen DIE Lösung sehen. Das ist KEINE Lösung!
Kein Psychologe, kein Psychiater und kein Psychotherapeut kann unser Problem lösen, da keiner von diesen mit Sicherheit sagen kann, was bei jedem individuellen Fall die Ursache ist und welche Vorgehensweise die beste sein wird. Möglich ist nur eine Wieder-In-Gang-Setzung der psychischen „Maschinerie“, die aus ungewissen Gründen zu klemmen begonnen hat, mehr oder weniger also, die Einleitung eines Selbstheilungsprozesses.
Wenn es im psychotherapeutischen Prozess gelingt, aufgestaute Energien in den tieferen Strukturen unserer Psyche wieder freizusetzen, besteht Hoffnung auf Heilung. Psychische Energien müssen nämlich ständig kreisen, wie ein Mühlrad. Irgendwann versteht es der Patient dann von selbst, dass Depressionen auch ihre guten Seiten haben. Sie zwingen einen einfach dazu, stehen zu bleiben und zu begreifen, dass man in eine Sackgasse geraten ist. Wenn sich der Betroffene dessen bewusst wird, kann die Depression zum Anfang äußerst kreativer Veränderungen in seinem Leben werden.
Problematisch ist nur, wie bringt man den Betroffenen zu jenem Durchblick. Wie bringt man ihn dazu, in seinem dunklen, dunklen Tunnel in der Ferne das rettende Licht zu erblicken, wenn er nicht einmal mehr die Willenskraft hat, seinen Kopf zu heben. Das Licht ist da, es ist eigentlich immer da, nur er sieht es nicht. Es ist für einen Therapeuten wahrlich eine äußerst schwierige Aufgebe, einem depressiven Patienten den Glauben zu vermitteln, seine Depression wäre kein Fluch, sondern ein Segen. Wie kann man eine Person, deren Leben unerträglich geworden ist, überzeugen, dass sie jetzt zwar unendlich leiden muss, aber dass dieses Leiden genau der springende Punkt ist, der eine qualitative Verwandlung ihres ganzen Lebens bringen kann, und zwar nicht nur eine Überwindung der Depression, sondern sogar eine Abkehr von dem Irrweg, der zur Depression geführt hat?
Wer depressiv ist, kann sich keinen anderen Zustand mehr vorstellen, als diesen, in dem er sich gerade befindet. Und das ist das Gefährlichste an einer Depression! Diese Erstarrung im eigenen Unglück. Dieses zu Stein gewordene Leid!
Eine Depression ergibt sich aber nicht, wie viele Menschen glauben aus Mangel an etwas, was man messen kann, betont Andrew Solomon in seinem außergewöhnlichen Buch The Nunday Demon. An Anatomy of Depression. Es heißt nämlich immer, ein niedriger Gehalt an dem Neurotransmitter Serotonin im Gehirn wäre die Ursache. Das ist laut dem Autor, der selber durch die Hölle mehrerer Depressionen gegangen ist, eine weitgehende Vereinfachung. Eine Zufuhr von Serotonin setzt zwar einen Prozess in Gang, der verursacht, dass sich das Selbstbefinden des Betroffenen nach einer gewissen Zeit bessert. Aber ein zu niedriger Gehalt an Serotonin ist nicht die Ursache einer Depression. Mehr noch: Auch Serotonin bringt nicht sofortige Besserung. Einer an Depressionen leidenden Person würde es auch dann nicht gleich besser gehen, wenn man ihr einen halben Liter Serotonin direkt ins Gehirn pumpte. Andererseits aber, wenn der Gehalt an Serotonin über längere Zeit entsprechend hoch ist, so kann man erwarten, dass einige Krankheitssymptome verschwinden, was aber keineswegs mit einer Heilung gleichzusetzen ist.
Eine Feststellung: „Ich leide an einer Depression, aber das ist durchaus nur eine chemische Angelegenheit“, wäre laut Solomon genauso unklug, als wenn jemand sagte: „Ich habe zwar mörderische Instinkte, aber das ist reinste Chemie“. Wenn wir einen Menschen aus dieser Perspektive betrachten, dann ist alles an ihm Chemie. Man darf eben nicht vergessen, dass es da noch den Persönlichkeitsfaktor gibt. Daher ist die Reaktion auf die eigene Depression bei verschiedenen Personen ganz unterschiedlich. Manche überwinden schwere Formen von Depressionen, andere erliegen schon ihren leichtesten Berührungen (vgl. Solomon, 2004, S. 21 – 22).
Muss ein Therapeut dann nicht ein Magier oder gar ein Schamane sein, wenn er dem Betroffenen wirklich Hilfe leisten soll !? Und dass würde bedeuten, dass er einen Transformationsprozess in Gang setzt, dank dem sich die im Kranken wütenden destruktiven Kräfte in kreative Kräfte verwandeln.
Carl Gustav Jung betonte in seiner Autobiografie, dass jeder individuelle Fall sich so sehr von allen anderen unterscheidet, dass er für den Therapeuten zu einer derartige Herausforderung wird, die diesen zwingt, sein ganzes bisheriges Wissen an den Nagel zu hängen und zu beginnen, die Psychologie neu zu schreiben.
Leider gibt es immer noch zu viele Ärzte und Therapeuten, denen diese Demut fehlt, eine Demut, die sich aus tiefer Ehrfurcht vor den Geheimnissen der menschlichen Psyche ergibt. Verstrickt in diverse Theorien, überzeugt vom Besitz eines höheren Wissens, schauen sie reserviert auf das Leiden ihrer Patienten herab, und meinen ihre Haltung wäre „wissenschaftlich“( vgl. Dudek, Vorwort zu: Wais, 2001, S. 10).
Die Ärzte vergessen allzu oft, worauf es wirklich ankommt, oder es ist ihnen überhaupt nicht bewusst, worauf es bei der Behandlung ankommt. Jung betonte immer wieder, dass klinische Diagnosen durchaus sehr wichtig sind, da sie dem Arzt eine Orientierung geben, aber dem Patienten helfen sie nichts. Entscheidend ist die Lebensgeschichte des Betroffenen, nur dort kann man nach den Ursachen des Leidens suchen .
Wenn ein Therapeut dies alles nicht genügend berücksichtigt und wenn der Kranke überdies auch noch keine Unterstützung von seinen Nächsten bekommt, sind die Chancen auf Heilung eigentlich gleich Null, es sei denn, es geschieht ein Wunder. Besonders gefährlich für den Kranken ist fehlendes Verständnis der Nächsten und dieses ergibt sich meistens aus ihrem Unwissen. Zu oft werden Depressionen noch mit Verstimmtheit und schlechter Laune verwechselt. So bekommt der Betroffene von seiner Familie, seinen Freunden und Bekannten wohl manches Mal zu hören: „Mensch, reiß Dich doch zusammen! Anderen geht es noch viel, viel schlechter und sie machen kein Drama draus!“. Wenn ein Kranker das immer wieder zu hören bekommt, kann es passieren, dass er keinen Grund mehr findet, seine keimenden Selbstmordgedanken von sich zu weisen.
Einem an Depressionen leidenden Menschen fällt es ungeheuer schwer, zu akzeptieren, dass ihn eigentlich niemand so richtig versteht, obwohl er genau weiß, dass die falschen Reaktionen der Mitmenschen viel eher auf dieses Nicht-Verstehen zurückzuführen sind als auf schlechten Willen. Es ist von den Gesunden durchaus nicht zu erwarten, dass sie begreifen, dass einen gar nichts mehr freut und gar nichts mehr interessiert, oder dass man panische Angstanfälle bekommt, vor etwas, was gar nicht existiert. Das weiß der Betroffene meistens genau. Aber das nützt ihm nichts. Eigentlich nützt alles nichts, was der Verstand sagt. So stellt die Depression auch den Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten sehr, sehr hohe Ansprüche; Ansprüche, die oft zu hoch sind, als dass sie imstande wären, diese zu erfüllen. Dieses betont auch immer wieder Andrew Solomon, in dem bereits erwähnten Buch.
Die leidende Person, schreibt Solomon, braucht von seinen Nächsten mehr Fürsorge, als es üblich ist, diese zu leisten. Daher werden viele mit der Depression ihrer Familienmitglieder oder Freunde einfach nicht fertig und daher auch in Mitleidenschaft gezogen. Wenn man Glück hat, werden manche Außergewöhnliches leisten, um dem Kranken zu helfen. Nicht alle sind aber imstande, der Depression direkt ins Auge zu schauen. Die meisten unserer Mitmenschen mögen nicht mit Leid und Unglück konfrontiert werden. Es ist selten, dass jemand aus dem Umfeld des Kranken fähig ist, zu akzeptieren, dass diese Krankheit nicht durch äußere Umstände verursacht wird, die man einfach ändern kann. Die meisten glauben, wenn jemand leidet, hat das eine konkrete Ursache und man könne etwas dagegen tun. (vgl. Solomon, 2000, S. 72).
Vor allem kann sich ein depressiv gewordener Mensch nicht einfach „zusammennehmen“. Seine Depression ist keine Frage des guten oder schlechten Willens. Der Wille scheint überhaupt ausgeschaltet zu sein. Das nicht Wollen-Können ist ja gerade das Problem. Es ist wie eine Krankheit des Willens. Das heißt aber nicht, dass der Kranke überhaupt nichts mehr will, obwohl es auch so weit kommen kann. Oft ist der Kranke nicht imstande, seine einfachsten Bedürfnisse zu befriedigen. Ich saß manchmal da, rauchte eine Zigarette nach der anderen und weinte fast vor Hunger, war aber nicht fähig in die Küche zu gehen, den Kühlschrank zu öffnen und mir etwas zum Essen zu nehmen. Wartete da lieber, hungrig wie ich war, bis mein Mann aus der Arbeit kam, und mir etwas gab. Da kann man wohl noch einen Restbestand des Willen erkennen. Ich wollte nicht hungrig sein! Aber war nicht fähig, dieses zu ändern. Warum, weiß ich wirklich nicht!
Wenn ich imstande war, aufzustehen (zwar mit Mühe und Not) mich anzukleiden (was auch nicht leicht war), mich dann ins Wohnzimmer zu setzen und Zigaretten zu rauchen, so musste ich auch – rein physisch gesehen – durchaus imstande sein, mir aus der Küche etwas zu essen zu holen. Tat es aber nicht! Wie ist das nun einem gesunden Menschen zu erklären!? Nun stelle man sich meinen Mann vor, der nach einem schweren Arbeitstag nach Hause kommt und dann von mir erfährt, dass ich nichts gegessen habe, weil er nicht da war. Das kann man nicht verstehen, denn ich verstand es ja selber nicht! So kommen wir wieder zur Unnützlichkeit des Verstandes beim Umgang mit einer Depression.
Ein weiteres Problem ist für die Angehörigen und den Betroffenen die Selbstmordgefahr. Hier entsteht aber sofort die Frage, wie kann denn ein Mensch, der völlig apathisch geworden ist, soviel Willenskraft aufbringen, dass diese für einen Selbstmord reicht!?
Kein psychischer Zustand ist konstant. Auch bei Depressionen, gibt es unterschiedliche Phasen. Daher sind pharmakologisch herbeigeführte Phasen der Besserung durchaus auch gefährlich. Einerseits geht es ja gerade darum, den Kranken aus seiner Erstarrung herauszuholen, andererseits kann dieses aber dazu führen, dass er nun die ihm bisher fehlende Kraft aufbringt, es wirklich zu tun. Daher braucht er gerade in dieser Phase besondere Fürsorge seiner Nächsten. Manchmal muss er sogar beaufsichtigt werden, denn meistens bessert sich zunächst nur sein physischer Zustand, was den Trugschluss erlaubt, dass es dem Kranken auch psychisch besser geht. Oft ist dies aber nicht der Fall. Seine Seele ist weiterhin krank, viel zu krank, als dass sie leben wollte. Daher steht die Depression auch an siebter Stelle unter den häufigsten Todesursachen. Laut mancher Statistiken steht sie sogar an zweiter Stelle, gleich nach den Herzkrankheiten (vgl. ebd., S. 24).
Als ich mir dieser Tatsachen bewusst wurde, war ich noch viel mehr erschrocken über meinen Zustand. Und ich muss zugeben, dass es mich mehr beschäftigte als alles andere, was ich, soweit mein Zustand es zuließ, über das Phänomen „Depression“ las. Es war also nicht genug, dass ich Tag für Tag von Todesängsten geplagt wurde, nun konnten diese auch noch einen Selbstmord verursachen. Und wenn man dabei berücksichtigt, dass ich oft an Selbstmord dachte, kann man sich wohl gut vorstellen, dass ich mich nun tatsächlich in die Enge gedrängt fühlte. Der Selbstmordgedanke war eigentlich mein ständiger Begleiter, mein liebster Trost, aber auch mein größter Schrecken, denn ich spürte immer deutlicher, dass mir die Lust schwand, weiterleben zu wollen.
[...]
- Arbeit zitieren
- Doktor Klaudia Winiarska (Autor:in), 2009, Schattenland - Analyse einer Lebenskrise, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128779
Kostenlos Autor werden






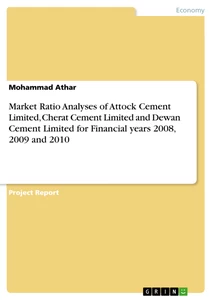

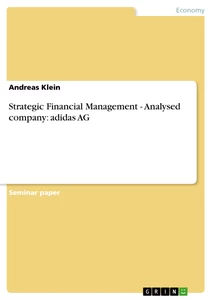
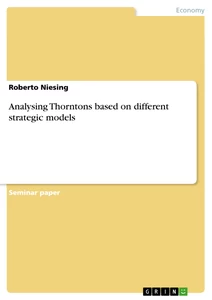

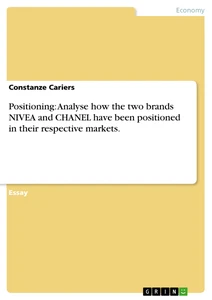
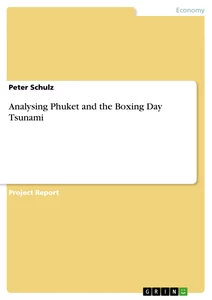
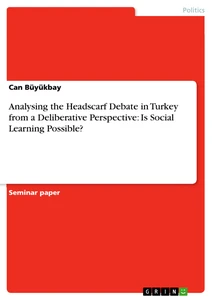


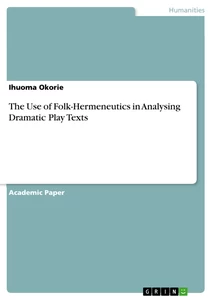

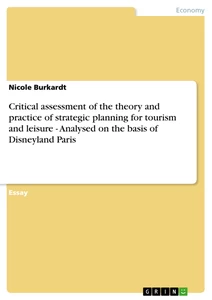



Kommentare