Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Hauptteil
1.Theoretische Grundlegung
1.1 Die Kategorie „Geschlecht“
1.2 Gender Mainstreaming
1.3 Geschlechtsspezifische Jugendarbeit
1.3.1 Mädchenarbeit
1.3.2 Jungenarbeit
1.3.2.1 Definition von Jungenarbeit
1.3.2.2 Enstehungsgeschichte und Entwicklung
2. Grundlegende Begriffe
2.1 Doing Gender
2.2 Männlichkeit
2.3 Mannsein
2.4 Männlicher Habitus
3. Relevanz der Jungenarbeit
3.1 Männliche Sozialisation
3.2 Männliche Identität
3.3 Exkurs: Konzept der hegemonialen Männlichkeit
4. Möglichkeiten der Jungenarbeit
4.1. Grundlagen geschlechtbezogender Jungenarbeit
4.1.1 Ziele, Ansätze und Basistheorien
4.1.2 Männer- und Jungenforschung
4.1.3 Institutionen der Jungenarbeit
4.2 Praxis geschlechtsbezogener Jungenarbeit
4.2.1 „Neue Wege für Jungs“ - Ein Projekt des BMFSFJ
4.2.2 Das Gewaltpräventionsprojekt „Anti-Aggressivitäts-Training“
4.2.3 Kommunikations- und Konflikttraining für Jungen an Schulen
4.2.4 „Die Nacht des Feuers“ - Projekt zur Firmvorbereitung
4.2.5 „Kräfte bündeln - Kräfte rauslassen“ - Projekt Jungentag
4.2.6 MFM-Projekt „Agenten auf dem Weg “
5. Schwierigkeiten der Jungenarbeit
5.1 Grenzen in der Praxis von Jungenarbeit
5.1.1 Geschlechtshomogene vs. geschlechtsheterogene Jungenarbeit
5.1.2 Herausforderungen im pädagogischen Bezug
5.1.3 Institutionelle Grenzen
5.2 Wissenschaft-Praxis-Defizit
III. Schluss
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
I. Einleitung
„Was ist nur mit den Jungen los?“ ist eine häufige Frage, die insbesondere rund um die aktuelle Thematik „Jugendgewalt“ immer wieder gestellt wird. Gerade junge Männer, meistens die Verursacher von Gewalt, werden als aggressive Täter darge- stellt, so z.B. in der Spiegel-Ausgabe vom Januar dieses Jahres unter der Überschrift „Junge Männer: die gefährlichste Spezies der Welt“. Ist dies wirklich Realität oder nur eine Übertreibung der Medien? Offensichtlich ist, dass immer mehr Jungen Gewalt als Mittel zur Durchsetzung ihrer Ziele wählen. Weitere Zeitschriftentitel der vergangenen Jahre waren beispielsweise u.a. „Arme Jungs! Das benachteiligte Ge- schlecht“ (Focus, Nr. 32 vom August 2002) oder „Jungs. Werden sie die Sorgenkin- der unserer Gesellschaft?“ (GEO Magazin, Nr. 3 vom März 2003). Fakt ist, dass Jungen in den letzten Jahren sehr häufig die Aufmerksamkeit der Medien erfahren haben. Klar ist auch, dass in unserer globalisierten Gesellschaft die Geschlech- ter(rollen) einem ständigen Wandel ausgesetzt sind. Diese Entwicklung betrifft in gleichem Maße Mädchen bzw. Frauen wie auch Jungen bzw. Männer und führt bei letztgenannten häufig zu einer Verunsicherung darüber, was männlich ist und was nicht, wie ein Mann sein soll, und wohin sich ein Mann zu entwickeln hat. Die Forde- rungen an das männliche Geschlecht haben dabei kontinuierlich zugenommen. Reichte es früher häufig noch aus, einen guten Beruf zu erlernen und die Familie finanziell zu unterstützen, werden heutzutage insbesondere an Emotionalität und Sensibilität erhöhte Erwartungen gestellt. Deshalb scheinen gerade Jungen und junge Männer einer Hilfe bei der Entwicklung ihrer männlichen Identität sowie einer Orientierung und Unterstützung bei ihrem Mannwerden zu bedürfen. Dabei kommt es sowohl bei den Jungen selbst als auch bei deren pädagogischen Betreuern häufig zur Überforderungen, insbesondere, wenn Jungen und junge Männer Ansprüchen der Gesellschaft nach Verhaltensänderungen nachkommen sollen, die sie kaum erfüllen können.
Eine Option zur Verbesserung der aktuellen Lage stellen die seit Jahren zunehmen- den Veranstaltungen und Projekte für Jungen unter der Überschrift „Jungenarbeit“ dar. Genau mit dieser Jungenarbeit und deren aktueller Situation beschäftigt sich diese Arbeit. Eine Frage, die sich dabei nahezu durchgängig stellt, lautet: Sind die Jungen schon verloren oder noch zu retten? Von der jeweiligen Beantwortung dieser Frage hängt eine Befürwortung oder Ablehnung jungenpädagogischer Angebote ab.
Warum ist jedoch gerade die Zielgruppe Jungen verstärkt in den Blickpunkt geraten? Warum haben ausgerechnet Fachveröffentlichungen und -tagungen zum Themenfeld „Jungen“ in den letzten Jahren zugenommen und nehmen weiter zu? Erklärungsansätze finden sich in der einschlägigen Literatur zur Jungenarbeit. Dort werden Jungen u.a. als „Kleine Helden in Not“1 oder als „Einsame Cowboys“2 be- schrieben. Warum ist das so? Sind Jungen - soweit sich überhaupt von den Jungen sprechen lässt - als angehende Männer nicht eigentlich das so oft propagierte star- ke Geschlecht? Oder haben sie gerade aufgrund ihres Geschlechts in unserer heuti- gen Gesellschaft jede Menge Probleme? Inwieweit dies tatsächlich der Fall ist, wird in dieser Diplomarbeit u.a. aufgezeigt und der Frage nach der Relevanz einer ge- schlechtsspezifischen Jungenarbeit nachgegangen. Diese Relevanzprüfung erfolgt nach einführenden Kapiteln zur theoretischen Grundlegung und einer allgemeinen Begriffsbestimmung der Arbeit. Im Anschluss daran werden einige Grundlagen der Jungenarbeit vorgestellt und anhand von sechs Jungenprojekten verschiedene Um- setzungsmöglichkeiten in der Praxis angeführt. Welche Schwierigkeiten es bei den jungenspezifischen Angeboten gibt und welche Grenzen sich daraus ergeben, wird im letzten Kapitel behandelt.
Bei der theoretischen und/oder praktischen Beschäftigung mit Jungenarbeit, kann eine Auseinandersetzung mit den Themen Homosexualität und Homophobie kaum verhindert werden. Dennoch wird hier aus mehreren Gründen von einer Bearbeitung dieser komplexen Themen abgesehen und auf einschlägige Literatur verwiesen, die sich in Ausschnitten mit der Homosexualität der Jungen und deren Auswirkungen auf das Mannsein beschäftigt.3
Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit durchgängig die männliche Form verwendet. Natürlich sind hier aber grundsätzlich beide Geschlechter gemeint.
II. Hauptteil
1. Theoretische Grundlegung
Zur theoretischen Grundlegung dieser Arbeit ist es zunächst notwendig, sich mit der Kategorie „Geschlecht“ auseinanderzusetzen, da das männliche Geschlecht Aus- gangspunkt der Diplomarbeit zur „Jungenarbeit“ ist. Anschließend wird auf den in der aktuellen politischen Diskussion zum Thema Geschlecht verwendeten Begriff des „Gender Mainstreaming“ eingegangen. Im Anschluss daran werden die Mädchenar- beit und deren geschichtliche Entstehung kurz dargestellt, bevor sich die Grundle- gung hauptsächlich der geschlechtsspezifischen Jugendarbeit mit Jungen widmet.
1.1 Die Kategorie „Geschlecht“
In unserer Gesellschaft werden Menschen nach der Geburt auf der Grundlage des Geschlechts in zwei Kategorien eingeteilt: Jungen oder Mädchen. Diese Festlegung aufgrund des biologischen Geschlechts (englisch: „sex“) hat Auswirkungen auf unser soziales Verhalten in dieser Welt. Die Auseinandersetzung mit der Kategorie Ge- schlecht ist geprägt von der Frage, ob grundsätzlich von einer Gleichheit oder einer Differenz dieser beiden Geschlechter auszugehen ist. Von einer Beantwortung dieser Frage ist abhängig, welche Strategie zur Beendigung der bestehenden Ungleichver- hältnisse herangezogen wird (Boeser 2002, S. 17). Dies gilt auch für die Jungenar- beit. Christian Boeser verweist hierbei auf Sigrid Metz-Göckel, die drei theoretische Möglichkeiten nennt, wie die Verhältnisse zwischen Männern und Frauen bezeichnet werden können: als Ungleichverhältnisse, als Gleichheitsverhältnisse oder als Gleich- heitsverhältnisse unter Beibehaltung der Differenz. Liegt ein Ungleichverhältnis vor, dann ist die Beziehung zwischen den Geschlechtern hierarchisch geordnet. Diese Hierarchie geht meist zu Lasten des weiblichen Geschlechts. Bestehen hingegen Gleichheitsverhältnisse zwischen den Geschlechtern, herrscht zwischen ihnen eine gleichberechtigte Beziehung ohne konkrete Geschlechtsunterschiede. Gleichheits- verhältnisse unter Beibehaltung der Differenz liegen dann vor, wenn trotz vorhande- ner Unterschiede eine egalitäre Beziehung zwischen den Geschlechtern gegeben ist (ebd.). Eine ausführlichere Auseinandersetzung lässt sich bei Metz-Göckel finden.4
Außerdem weist Boeser auf eine, von Christina Thürmer-Rohr vorgenommene, Unter- scheidung zwischen den Geschlechtern hin. Sie unterscheidet zwischen der Gleich- heits-, der Differenz- und der dekonstruktivistischen Position (Boeser 2002, S. 18). Die erste Richtung innerhalb der Frauenbewegung und -forschung war die Gleich- heitsposition, bei der davon ausgegangen wird, dass das Geschlecht ein soziales Konstrukt darstellt und nicht von Natur aus gegeben ist. Menschen konstruieren sich ihre Wirklichkeit durch soziales Tun bzw. Handeln, d.h. auch das Geschlecht wird von jedem Menschen täglich neu konstruiert. Dies wird als „doing gender“5 bezeichnet (siehe 2.1). Ziel der Gleichheitsposition ist es, dass durch das biologische Geschlecht keine Festlegung auf einen bestimmten Charakter oder eine gesellschaftliche Rolle geschieht. Von Seiten der Differenztheoretikerinnen wird Kritik daran laut, da so - ihrer Meinung nach - eine Negierung männlicher und weiblicher Lebenszusammen- hänge stattfinde. Außerdem sei es zu einseitig, Mädchen und Frauen nur als defizitär gegenüber Jungen und Männer zu betrachten, den gegebenen „männlichen“ Nor- malzustand aber ohne eine kritische Anpassung einzufordern (Nissen 1998, S. 76). In dieser Position findet also eine starke Orientierung an den Defiziten des weibli- chen Geschlechts statt und deren Vertreter fordern daher eine Überwindung durch gezielte Förderung von Mädchen und Frauen in unserer Gesellschaft, z.B. durch pädagogisches Handeln bzw. durch eine kompensatorische Erziehung (Boeser 2007, S. 248). Eine gegenteilige Auffassung hat die sog. Differenzposition. Sie geht von der Existenz historisch entstandener geschlechtsspezifischer Unterschiede zwischen Männern und Frauen aus, die von der Natur gegeben sind und nicht nur im biologi- schen, sondern auch im sozialen Kontext gelten. Folgende Unterscheidung zwischen den beiden Positionen die entweder eine Gleichheit oder eine Differenz der Ge- schlechter annehmen, findet sich bei Ursula Nissen: „Während die Gleichheitsper- spektive davon ausgeht, daß die biologischen Unterschiede zu vernachlässigen und die auf der gesellschaftlichen, politischen Ebene auftretenden Unterschiede sozial konstruiert sind und zu sozialer Ungleichheit führen, unterstellt die Differenzposition (gemeint ist die Differenz zwischen den Geschlechtern, nicht innerhalb eines Ge- schlechts) einen grundsätzlichen essentiellen Unterschied, der entlang der biologi- schen Geschlechtszugehörigkeit verläuft und zu unterschiedlichen Lebenszusammenhängen führt“ (Nissen 1998, S. 70).
Gleichheitstheoretikerinnen werfen den Vertreterinnen der Differenztheorie also vor, dass sie die patriarchale Herrschaft stützen und den Feminismus verraten. Außer- dem kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Geschlechter, trotz einer prin- zipiellen Gleichheit von Mädchen und Jungen oder Frauen und Männern dieselben Interessen und Ziele verfolgen. Differenzen treten zudem nicht nur zwischen Mäd- chen bzw. Frauen und Jungen bzw. Männern auf, sondern auch innerhalb der eige- nen Geschlechtergruppe (Nissen 1998, S. 86). Der Versuch einen nicht- hierarchischen, demokratischen Differenzbegriff zu entwickeln, um dadurch die Gleichheits- und Differenzposition zu verbinden, wurde u.a. von Annedore Prengel unternommen (Nissen 1998, S. 77). Ihr demokratischer Differenzbegriff wird auch als anti-hierarchisch bezeichnet und „… wendet sich gegen Unterdrückung, Ausbeu- tung und Entwertung von Differenzen. Differenzen zwischen Frauen und Männern versteht sie (Prengel, d. Verf.) als strukturelle, alltagskulturelle Unterschiede in den Lebensweisen und der unterschiedlichen Verarbeitung von Lebensbedingungen, …“ (ebd.). Für Prengel stellt die Kontroverse Gleichheit versus Differenz eine falsche Alternative dar, da eine Differenz ohne Gleichheit gesellschaftliche Hierarchie, kultu- relle Entwertung sowie ökonomische Ausbeutung bedeutet, eine Gleichheit ohne Differenz dagegen Assimilation, Anpassung, Gleichschaltung und Ausgrenzung von „Anderen“ (Nissen 1998, S. 78). Für sie ist wichtig zu wissen, dass Gleichheit eine Differenz überhaupt erst ermöglicht. Das größte Problem an diesen Positionen, die beide aus feministischen Diskursen zur Geschlechterfrage entstanden sind, ist die Nichtberücksichtigung des männlichen Geschlechts mit seinen Schwierigkeiten. Im Vordergrund steht ausschließlich die Frage, ob Weiblichkeit durch Orientierung an männlichen Standards abgewertet oder durch Normierung des typisch Weiblichen aufgewertet wird. Dies liegt sicher an der Herkunft aus der feministischen Bewegung (Boeser 2007, S. 248 f). Daneben gibt es noch eine weitere Ansicht. Diese wird von der dekonstruktivistischen Position vertreten, in der zwischen den diskurstheoreti- schen und den ethnomethodologischen Ansätzen unterschieden wird.6 Sie geht im Extremfall davon aus, dass bereits das biologische Geschlecht und nicht nur das soziale Geschlecht konstruiert ist. Unterschiede können danach sowohl zwischen den als auch innerhalb der Geschlechter bestehen: „Die Diskriminierung einzelner, also die Zuordnung eines Menschen zu einer mit bestimmten Eigenschaften verbunde- nen Kategorie (soziales Geschlecht) aufgrund eines Merkmals (biologisches Ge- schlecht), ist eine Folge unserer zweigeschlechtlichen Kulturkonstruktion, die gleich- zeitig Orientierung vermittelt aber auch Anpassungs- und Identitätsprobleme mit sich bringen kann“ (Boeser 2002, S. 22 f). Diese Identitätsprobleme finden sich bei bei- den Geschlechtern. Auf die Problematik der männlichen Identitätssuche wird weiter unten noch genauer eingegangen (siehe 3.2). Zu beachten ist, dass sich die Rele- vanz der Auseinandersetzung Gleichheit versus Differenz nicht nur in der Wissen- schaft zeigt, „sondern auch in der Frauenbewegung und deren unterschiedlichen Ansätzen, sei es in der Politik oder in der Frauen- und Mädchenförderung“ (Boeser 2002, S. 23).
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass es zu der Kategorie „Geschlecht“ ver- schiedenste Ansichten gibt. Dabei scheint die Differenztheorie - zumindest aus mei- ner Sicht - die gelungenste Theorie zu sein, da sie, wie oben bereits beschrieben, von einer historischen Entstehung des Geschlechts ausgeht und es dadurch für ver- änderbar hält. Dieser Idee der Veränderung des Geschlechts schließt sich der austra- lische Männerforscher Robert W. Connell an: „Um das Geschlecht als soziales Muster erfassen zu können, müssen wir es als ein Produkt der Geschichte begreifen, aber ebenso als einen Produzenten von Geschichte“ (Connell 2006, S. 102). Weiter führt er aus: „Kein anderes Lebewesen hat und schafft eine Geschichte, ersetzt die natür- liche Entwicklung durch radikal neue Entwicklungsbedingungen“ (ebd., S. 103). An diese Position der Differenztheorie, die eben geschichtlich und kulturell entstandene Unterschieden zwischen Frauen und Männern annimmt, lehnt sich diese Arbeit auch weitestgehend an und geht davon aus, dass die geschlechtsspezifische oder besser die geschlechtstypische Sozialisation sowohl Chancen und Potenziale als auch Schwierigkeiten und Risiken birgt.
Nach der Bestimmung der Kategorie „Geschlecht“ wird im nächsten Kapitel nun der Begriff des „Gender Mainstreaming“ als Grundlage für die geschlechtsspezifische Jugendarbeit erläutert.
1.2 Gender Mainstreaming
Zum besseren Verständnis des Begriffs „Gender Mainstreaming“, ist zunächst eine Unterscheidung zwischen den englischen Bezeichnungen „sex“ und „gender“ not- wendig, die beide aus der angelsächsischen Geschlechterforschung stammen. Der Begriff „sex“ meint dabei das natürliche, angeborene und unveränderliche Ge- schlecht, mit dem Begriff „gender“ ist das erworbene, kulturell und historisch variab- le Geschlecht gemeint (Boeser 2002, S. 18). Letzteres wird auch als soziales bzw. sozial konstruiertes Geschlecht bezeichnet und in der Sozialwissenschaft dominiert die Meinung, „dass diese soziokulturellen Überformungen, gender also, ein Überge- wicht haben gegenüber der biologischen Grundausstattung, …“ (Brückner 2001, S. 180). Die Ergänzung „Mainstreaming“ bzw. „Mainstream“ bedeutet Hauptströmung und meint damit ein durchgängiges Prinzip der Gleichheitspolitik für alle Politikberei- che. Barbara Stiegler definiert „Gender Mainstreaming“ wie folgt:
„Gender Mainstreaming bedeutet die Entwicklung, Organisation und Evaluie- rung von Entscheidungsprozessen mit dem Ziel, die Geschlechterperspektive in alle politisch-administrativen Maßnahmen auf allen Ebenen durch alle am politischen Entscheidungsprozess beteiligten Akteure und Akteurinnen ein- zubringen. In jedem Politikbereich und auf allen Ebenen sollen die unter- schiedlichen Ausgangsbedingungen und Auswirkungen auf die Geschlechter berücksichtigt werden, um eine tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern zu erreichen. Dieser Prozess soll Bestandteil des normalen Hand- lungsmusters aller Ressorts und Organisationen werden, die an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt sind“ (Stiegler 2002, S. 13).
Für Alexander Bentheim ist mit dem Begriff „Gender Mainstreaming“ also die Idee gemeint, Geschlechterfragen in gesellschaftliche Hauptströmungen zu bringen (Bent- heim u.a. 2004, S. 13). Daher ist es „eine politische Strategie, der Gleichstellung von Frauen und Männern und dem Ziel von Geschlechtergerechtigkeit näher zu kommen. Der Auftrag von Gender Mainstreaming besteht darin, die unterschiedlichen Interes- sen und Lebenssituationen von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen mög- lichst weitgehend zu berücksichtigen“ (Bentheim u.a. 2004, S. 13 f). Aus diesem Grund wird „Gender Mainstreaming“ in verschiedenen Gesetzen und Verträgen gere- gelt. Die EU-Verträge (Artikel 2 und 3) und die Charta der Grundrechte der Europäi- schen Union (Artikel 23 Nr. 1) fordern seit 1996 die Durchsetzung von Chancen- gleichheit zwischen den Geschlechtern in allen EU-Staaten und ihre Verbindlichkeit. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland heißt es: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechti- gung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“ (GG Bundesrepublik Deutschland, Art. 3 Abs. 2).7 Durch diesen Absatz ist gesetz- lich festgelegt, dass der Staat sich um die Verankerung des Gender Mainstream- Konzepts in das gesellschaftliche Leben bemühen muss. Laut Beschluss des Bun- deskabinetts vom Juni 1999 zum Programm „Frau und Beruf“ wird sogar anerkannt, dass die Gleichstellung von Frauen und Männer durchgängiges Leitprinzip der Bun- desregierung ist und als Querschnittsaufgabe, d.h. in allen Bereichen, aktiv gefördert werden soll (Ehrhardt/Jansen 2003, S. 9). Die Kommission des 11. bzw. 12. Kinder- und Jugendberichts fordert: „Die besonderen Lebenslagen von Mädchen und Jungen sollen überall berücksichtigt, Angebote und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhil- fe geschlechtsgerecht ausgerichtet und Mädchen- und Jungenarbeit gefördert und evaluiert werden“ (Rohrmann 2005 a, S. 60). Dies bestätigt die Formulierung im § 9 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) von 1990, die aussagt, dass es der Jugendhilfe bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben gelingen soll, „die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu be- rücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mäd- chen und Jungen zu fördern“ (Erhardt/Jansen 2003, S. 10).
Dies sind eindeutige Forderungen an alle Organisationen der Jugendarbeit und auch an die Politik, sich für beide Geschlechter zu engagieren, d.h. etwa in der Jugendar- beit sowohl Mädchen- als auch Jungenarbeit anzubieten. Als schwierig stellt sich nur der Übertrag des Gender Mainstreaming auf die jeweils konkreten Angebote der Jugendarbeit heraus: „Diese politische und strukturelle Idee des Gender Mainstrea- ming kann jedoch nicht direkt in die Jugendhilfe übernommen werden“ (Bentheim u.a. 2004, S. 14). Hierzu bedarf es, wie Bentheim richtig anmerkt, einer Übersetzung. Insbesondere deshalb, weil Gender Mainstream die Jugendhilfe auch strukturell tangiert, da auch Leitungsstrukturen, Ressourcen der Mitarbeiter und räumliche Gegebenheiten in den Mittelpunkt rücken (ebd.). Zusammenfassend kann für die Kinder- und Jugendhilfe festgehalten werden, dass Gender Mainstreaming „ein fach- liches, prozess- und zielorientiertes Konzept mit zunehmend verbindlichem Charak- ter“ (Bentheim u.a. 2004, S. 16) ist.
Allgemein zielt das Konzept des Gender Mainstreaming einerseits unter den Stichworten „Geschlechtergerechtigkeit“ und „Geschlechterdemokratie“ auf gleiche Beteiligung beider Geschlechter und gegen geschlechtsbezogene Ausgrenzung. Dabei ist zu beachten, dass sich Gender Mainstreaming bei Geschlechterfragen eben nicht wie die meisten Feministinnen nur für die Abschaffung der strukturellen Benachteiligung von Mädchen und Frauen, sondern auch von Jungen und Männern einsetzt und andererseits deren Potenziale zur Entfaltung kommen lässt.8
Da die Perspektive dieses Konzepts geschlechtsübergreifend, also auch auf die Jun- gen- und Männerarbeit, ausgerichtet wurde, besteht nun die Hoffnung, dass eine größere Gruppe von Jungen und Männern angesprochen werden kann als zuvor (Sielert 2002, S. 38). Ob sich diese Hoffnung bereits erfüllt hat oder nicht, ist heute noch nicht festzustellen. Sicher ist jedoch, dass Gender Mainstreaming die ge- schlechtsspezifische Jugendarbeit mit beiden Geschlechtern ermöglicht, ja sogar fordert. Dies ist sicher ein großer Gewinn, besonders für die Jungenarbeit, die sich immer legitimieren musste, was sicher auch lange Zeit an dem defizitären Ansatz lag. Bentheim macht mit folgenden Worten Mut: „Mit Gender Mainstreaming erwächst für die Jungenarbeit ein Potential: einerseits das der stärkeren Durchsetzung dieser Arbeitsweise, andererseits das ihrer konzeptionellen Weiterentwicklung auch in Bezug auf Gender-Mainstreaming-Ansätze und die damit verbundenen aktuellen Geschlechtertheorien. Jungenarbeit bekommt durch Gender Mainstreaming neue Impulse und die Chance, sich auszuweiten und zu wachsen“ (Bentheim u.a. 2004, S. 12). Wie Jungenarbeit (und auch Mädchenarbeit) definiert wird und warum diese heutzutage notwendig erscheint wird auf den folgenden Seiten dargestellt.
1.3 Geschlechtsspezifische Jugendarbeit
Für die Durchsetzung des Konzepts des Gender Mainstreaming ist, wie gerade dargestellt wurde, eine geschlechtsspezifische Jugendarbeit unabdingbar. Gerade über den Begriff „geschlechtsspezifisch“ gibt es aber immer wieder Diskussionen.
Verschiedene Richtungen bzw. Institutionen fordern, die geschlechtsspezifische Jugendarbeit besser als geschlechtsgerechte, geschlechtstypische, geschlechtsbezo- gene, geschlechtsreflektierte oder geschlechtsbewusste Jugendarbeit zu bezeichnen. In dieser Arbeit werden die soeben genannten Begriffe jedoch abwechselnd verwen- det, wobei immer eine bewusste Auseinandersetzung mit den geschlechtstypischen Dispositionen von Jungen und Mädchen gemeint ist. Die geschlechtsspezifische Jugendarbeit wird in die Mädchen- und in die Jungenarbeit unterteilt. Diese beiden sollen im Folgenden näher ausgeführt werden, wobei der Schwerpunkt ganz klar auf die geschlechtsbezogene Auseinandersetzung mit den Jungen gelegt wird.
1.3.1 Mädchenarbeit
Der Beginn der geschlechtsbezogenen Jugendarbeit hängt eng mit dem Beginn der parteilichen Mädchenarbeit zusammen. Vor mehr als 35 Jahren warfen die Frauen der Jugendarbeit vor, ausschließlich Jungenarbeit zu sein. Dieser Vorwurf wurde laut, da ein Übergewicht der männliche Personal- und Besucherstruktur bestand, gerade an den Orten der Jugendarbeit, z.B. in den Jugendfreizeitstätten, nach dem Ende des zweiten Weltkrieges. Aus diesem Grund bemühten sie sich, eigene Räume für die Mädchen zu schaffen, so dass diese sich in dem neu geschaffenen, geschlechtsho- mogenen Rahmen der patriarchalen Gesellschaftsstruktur entziehen konnten. So setzte sich die Jugendarbeit in den 1950er-Jahren noch hauptsächlich mit der Rand- gruppe der sexuell gefährdeten Mädchen auseinander. Ansonsten war klar, dass Mädchen und Frauen in der Öffentlichkeit keinen Platz haben, sondern ihre Aufgabe in der Familie gesehen wurde. Dort waren sie als Hausfrau und Mutter v.a. für die Erziehung der Kinder vorgesehen. Mädchen und junge Frauen tauchten als eigene Zielgruppe nicht auf. Eine Benachteiligung und Vernachlässigung von Mädchen gerät auch in den 1960er-Jahren kaum in den Blick, da geschlechtsspezifische Unter- schiede nicht thematisiert wurden (Klees u.a. 2000, S. 12). Folgende Aussage hatte damals weiterhin Bestand: „Jugendarbeit ist Jungenarbeit. Jungen stehen im Zent- rum der Betrachtungen, sie geben den Ton an, liefern den Maßstab, die Orientie- rung. Die Probleme der Mädchen werden daraus abgeleitet. Mädchen nehmen eine marginale Stellung ein“ (ebd.). Mädchenarbeit fand keinen Platz in den pädagogi- schen Konzepten und in der offenen Jugendarbeit. Allenfalls wurde Mädchenbil- dungsarbeit mit Inhalten wie Hauswirtschaft und Kosmetik ergänzt um musisch- kulturelle Angebote sowie „weibliche“ Themen wie Ehe- und Familienvorbereitung angeboten. Ziel dieser Bildungsarbeit war es aber nicht, die Mädchen und Frauen zu emanzipieren, sondern ihnen Fähigkeiten beizubringen, die sie (ausschließlich) für andere einsetzen können. So kommt es aus heutiger Sicht zu folgender Aussage: „Sowohl die Opferperspektive als auch die Defizitperspektive betrachtet Mädchen nicht als eigenständige und gleichwertige, sondern als zweitrangige und minderwer- tige Menschen“ (Klees u.a. 2000, S. 13). Eine Ansicht dieser Zeit war, dass eine politische Beteiligung der Frauen nicht nötig sei. Ihre Aktivitäten in diesem Feld be- schränkten sich auf eine Vielzahl von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Dieses Defizit blieb in der Jugendarbeit noch einige Zeit bestehen. Erst gegen Mitte der 1970er-Jahre entwarfen engagierte Pädagoginnen, die aus der zweiten deutschen Frauenbewe- gung9 stammten, Ansätze einer feministischen Mädchenarbeit (Klees u.a. 2000, S. 14). Diese wollte sich parteilich für die Belange der Mädchen einsetzen und die Le- benssituation von Mädchen und Frauen verbessern. Dazu setzte sie bei den Soziali- sationsbedingungen und dem sich daraus ergebenden Verhalten sowie bei Zukunfts- vorstellungen an und stellte folgende Ziele auf: „Sie will Mädchen ermöglichen, in patriarchale Strukturen und ihre Wirkweisen Einsicht zu nehmen und sich ihrer be- wusst zu werden, um sich aus ihnen zu befreien, sich zu behaupten und sich eine eigenständige Identität als Frau zu erarbeiten“ (ebd.). Damit dies gelingen konnte, musste parteiliche Mädchenarbeit ihre Räume in der Jugendarbeit einfordern. Dies geschah gegen Ende der 1970er-Jahre v.a. in der Praxis der offenen Jugendarbeit. Vermehrt fanden damals Mädchengruppenstunden, häufig in eigenen Mädchenräu- men statt. Die Mädchen wurden in ihrer Persönlichkeit bestärkt und Eigenständig- keit, Selbstbehauptung, etc. unterstützt. Immer mehr Pädagoginnen kommen zu dieser Zeit für die weiblichen Jugendlichen als Identifikationsfigur in Frage. Bis in die 1980er-Jahre etablierte sich die Mädchenarbeit und war auch dank des sechsten Jugendberichts aus dem Jahre 1984 in aller Munde. Mittlerweile spielt die Mädchen- arbeit allerdings gerade in der öffentlichen Diskussion nicht mehr die große Rolle wie damals: „Inzwischen ist es ruhiger um sie geworden. Die erste Euphorie ist verklun- gen und der harte Alltag, das mühsame Kleingeschäft, eingekehrt. Jede hat zwar eine Ahnung, was parteiliche, befreiende Mädchenarbeit ist bzw. sein könnte. Bei ihrer Ein- und Durchführung tauchen aber vielerlei Fragen und Probleme auf“ (Klees u.a. 2000, S. 15). Sie hat aber heute ihren Platz in der Jugendarbeit gefunden. Festzuhalten bleibt, dass sich die Mädchenarbeit v.a. aufgrund einer über Jahre andauernden Unterdrückung der Frauen entwickelt hatte. Eine gezielte Stärkung der Mädchen sollte diesen später einen gleichberechtigten Platz in der Gesellschaft ermöglichen. Obwohl die Frauen selbst einen guten Startschuss gegeben haben, ist es ihnen bis heute nicht gelungen, dieses Ziel zu erreichen, auch wenn die Einfüh- rung einer zusätzlichen Jungenarbeit, als Antwort auf die Mädchenarbeit, dieses Ziel unterstützen sollte. Mädchenarbeit kann nur dann erfolgreich sein, wenn es auch für Jungen einen adäquaten Ersatz in Form einer geschlechtsspezifischen Jungenarbeit gibt Dies ist eine der Erkenntnisse, die sich aus der Mädchenarbeit und dessen wis- senschaftlicher Auseinandersetzung ergab. Im Idealfall sollte Jungenarbeit v.a. anti- sexistisch sein, d.h. die Jungen sollten das weibliche Geschlecht nicht abwerten, sondern respektieren lernen.
1.3.2 Jungenarbeit
Was genau ist Jungenarbeit? Wie wird sie definiert? Womit beschäftigt sie sich? Wann ist sie entstanden? Wie hat sie sich in Deutschland weiterentwickelt? Im Fol- genden wird insbesondere eine Definition der Jungenarbeit angeboten, was sich aufgrund der Vielfalt der Aussagen darüber, was Jungenarbeit ist, als durchaus schwer darstellt. Dennoch lassen sich in der Fachliteratur über die Jungenarbeit einige klare Linien erkennen.
1.3.2.1 Definitionen von Jungenarbeit
Jungenarbeit ist immer ein Teil der Jugendarbeit und dies nicht nur in Deutschland. In unseren Nachbarländern Österreich und Schweiz wird „Jungenarbeit“ z.B. als „Bu- ben-“, „Burschen-“ oder „Knabenarbeit“ bezeichnet (Bentheim u.a. 2004, S. 8).10
Jungenarbeit meint v.a. aber eine Spezialisierung im Feld der Pädagogik. Sie grenzt sich damit zunächst einmal von der allgemeinen Kinder- und Jugendhilfe sowie ge- genüber der Mädchenarbeit (siehe 1.3.1) ab. Mit Jungenarbeit ist aber nicht nur die praktische Umsetzung in der Arbeit mit Jungen gemeint, sondern auch ein fachlicher Diskurs bzgl. der Auseinandersetzung mit dem „richtigen Weg“ (ebd.). Der Begriff der Jungenarbeit hat sich dabei zum „… Sammelbegriff für Arbeitsansätze und Tätigkei- ten im geschlechtbezogenen Umgang mit Jungen in Erziehung, Pädagogik, Bildung, Sozialarbeit und -pädagogik, Psychologie und Betreuung entwickelt“ (ebd.). Hinter- grund der Jungenarbeit ist also der Gedanke der Spezialisierung. Es scheint u.a. aufgrund der unterschiedlichen Lebenslagen der Jungen sinnvoll zu sein, sich mit ihnen pädagogisch zu beschäftigen. Wann lässt sich aber exakt von Jungenarbeit sprechen? Häufig beurteilen Mitarbeiter der Jugendarbeit ihr Basketballspiel, bei dem nur Jungen mitmachen, bereits als Jungenarbeit, so „… wird Jungenarbeit ganz wörtlich und unreflektiert als Arbeit mit Jungen verstanden, die ja auch wirklich schon immer stattfindet, …“ (Zieske 2005, S. 62). Dadurch wird deutlich, dass Jun- genarbeit v.a. in der Anfangszeit häufig einen exklusiven Charakter hatte und insbe- sondere die Abwesenheit von Mädchen und/oder Frauen meinte. Bentheim stellt aber fest, „dass Geschlechtshomogenität als einziges Kriterium bei weitem nicht ausreicht, damit aus der Arbeit mit Jungen tatsächlich ‚Jungenarbeit’ wird“ (Bent- heim u.a. 2004, S. 8). Er stellt deshalb die Formel auf: „Geschlechtshomogenität plus Geschlechtsbewusstsein ergeben (…) erst ‚Jungenarbeit’“ (ebd.). Astrid Kaiser hingegen will Jungenarbeit nicht nur als sozialpädagogische Arbeit in Jungengruppen verstanden wissen, sondern v.a. als Umgang in der koedukativen Schule (Kaiser 2005 b, S. 14). Ob mit Jungen eher geschlechtshomogen oder -heterogen gearbeitet werden soll, ist eine bis heute andauernde Diskussion. Darauf wird später noch aus- führlicher eingegangen (siehe 5.1).
Darüber hinaus liefert Andreas Zieske folgende abweichende Definition: „Jungenar- beit ist keine Methode, sondern eine Sichtweise“ (Zieske 2005, S. 63). Für ihn ist Jungenarbeit daher „die Reflexion pädagogischer Arbeitsansätze unter einem ge- schlechterspezifischen Blickwinkel, in diesem Fall als pädagogisch arbeitender Mann und bezogen auf Jungen“ (ebd.). Ob man diese Meinung von Zieske teilt oder nicht, in jedem Fall ist dies eine interessante Herangehensweise, die Jungenarbeit als „Sichtweise“ und nicht als Methode, und damit eben nicht als eigenständiges Ar- beitsfeld anzuerkennen.
Eine zwar kurze, aber doch sehr prägnante Definition liefern meiner Meinung nach Olaf Jantz und Ignazio Pecorino, die Jungenarbeit als„die pädagogisch organisierte Begegnung von Männern mit Jungen, …“ (Jantz/Pecorino 2005, S. 39) sehen. Hier wird also vorausgesetzt, dass - um von Jungenarbeit sprechen zu können - eine geschlechtshomogene Begegnung zwischen Männern und Jungen stattfinden soll, aber auch, dass dies im Kontext pädagogischen Handelns geschieht. Als weitere Kriterien legen sie zudem fest, dass Jungenarbeit erst dann zur bewussten Jungen- arbeit wird, „wenn auch hinterfragt wird, unter welchen Bedingungen die Begegnung zustande kommt und was dies mit Männlichkeit(en) zu tun hat“ (ebd.). Sie fordern also eine Zielsetzung vor der Begegnung mit den Jungen und eine Reflexion der Jun- genarbeit. Die Methoden spielen, zumindest ihrer Meinung nach, dabei eine eher geringe Rolle.
Weiterhin definieren Reinhard Winter und Benedikt Sturzenhecker Jungenarbeit unter der Überschrift „Was ist Jungenarbeit?“ wie folgt:
„Unter ‚Jungenarbeit’ wird die geschlechtsbezogene pädagogische Arbeit er- wachsener Männer (Fachkräfte) mit Jungen verstanden. Jungenarbeit orien- tiert sich dabei auf der einen Seite an den Potenzialen des Junge- und Mannseins, konkret bezogen auf verschiedene Zielgruppen. (…) Jungenarbeit benötigt deshalb ein entsprechendes Problembewusstsein, Kenntnisse über Schwierigkeiten des Mannseins- und -werdens in der aktuellen gesellschaftli- chen Situation und - daraus abgeleitet - die entsprechenden pädagogi- schen Thematisierungsweisen …“ (Sturzenhecker/Winter 2006, S. 9).
Darüber hinaus legen sie sich fest, dass alle Jungen Zielgruppen von Jungenarbeit sein können. In der Praxis, insbesondere der professionellen Jugendhilfe, werden jedoch, v.a. aus Kostengründen, die Jugendlichen in den Randgruppen der Gesellschaft betreut, die sich problematisch verhalten (ebd.). In den ‚Leitlinien Jungenarbeit’ des Kreisjugendrings München-Stadt11 findet sich eine weitere, meines Erachtens sehr gelungene, Begriffsdefinition zur Jungenarbeit:
„Jungenarbeit ist bewusste geschlechtsspezifische pädagogische Arbeit von männlichen pädagogischen Fachkräften mit Jungen bzw. jungen Männern im geschlechtshomogenen Rahmen. In der Jungenarbeit bietet der Pädagoge in einem geschützten geschlechtshomogenen Rahmen ein individuelles männ- liches Modell an, an dem sich Jungen und junge Männer orientieren können“ (KJR München-Stadt 2007, Ziffer 9.4, S. 1).
Dort wird für die Jungenarbeit Geschlechtshomogenität gefordert, bei der der männli- che Pädagoge ein lebendiges Modell abgeben soll. Dem gegenüber steht die Arbeit mit Jungen, die sich dadurch von der klassischen, oben beschriebenen Jungenarbeit unterscheidet, dass entweder weibliche Fachkräfte mit Jungen arbeiten - sog. Crosswork - oder, zwar männliche pädagogische Fachkräfte mit den Jungen arbei- ten, aber nicht in einem geschlechtshomogenen Rahmen, d.h. es sind Mädchen oder Frauen anwesend (ebd.).
Womit beschäftigt sich nun aber die Jungenarbeit bzw. die Arbeit mit Jungen? Dazu finden sich ebenfalls in den „Leitlinien Jungenarbeit“ des Kreisjugendrings München- Stadt pädagogische Richtlinien bzw. Leitsätze, die eine mögliche Antwort geben:
„Jungenarbeit/Arbeit mit Jungen und jungen Männern knüpft an deren Stär- ken und Fähigkeiten an und nimmt sie in ihrer Lebenswelt und ihrem gesam- ten Handeln, Denken und Fühlen ernst. Sie orientiert sich an den individuel- len Bedürfnissen, Möglichkeiten und Kompetenzen der Jungen. Jungenar- beit/Arbeit mit Jungen setzt voraus, dass die Pädagog/innen einen reflektier- ten und differenzierten Blick auf die Jungen und jungen Männer in ihrer Ar- beit richten. Die professionelle pädagogische Beziehung des pädagogischen Fachpersonals zu den Jungen und jungen Männern ist von einer emanzipato- rischen, empathischen und ganzheitlichen Haltung bestimmt. (…) Ihre indivi- duellen Erfahrungen dienen als Grundlage für die pädagogische Aufgabe, sie bei ihrer Entwicklung zu einer selbstbewussten und verantwortlichen Persön- lichkeit zu unterstützen. Die Jungenarbeit/Arbeit mit Jungen bricht patriar- chalische Vorstellungen auf und fördert die Gleichberechtigung der Ge- schlechter in der gesamten Gesellschaft und bei jeder einzelnen Person im Denken, Fühlen und Handeln. Unterdrückte Hierarchien werden verändert, gegebenenfalls abgebaut“ (KJR München-Stadt 2007, Ziffer 9.4, S. 2).
Diese Definition bzw. die darin enthaltenen Forderungen sind sehr umfangreich und haben hohe Ansprüche an den jeweiligen Jungenarbeiter. Jungen sollen ihrer Le- benswelt entsprechend betreut und individuell gefördert werden. Es gibt aber nicht nur verschiedene Definitionen zur Jungenarbeit, sondern auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Ansichten und Ansätzen, wie mit Jungen gearbeitet und welche Ziele damit erreicht werden sollen. Um dies zu unterstreichen führt Kai- ser die Unterscheidung von Jens Krabel in sechs verschiedenen Ansätzen an: antise- xistische, emanzipatorische, parteiliche, patriarchalische, geschlechtsspezifische und maskulinistische Jungenarbeit (Kaiser 2005 a, S. 11). Auf diese wird hier aber zu- nächst nicht näher eingegangen, sondern die eine oder andere dieser Richtungen erst bei der Frage nach der Legitimation und Relevanz von Jungenarbeit (siehe 3.) bzw. bei der Darstellung der einzelnen Ansätze (siehe 4.1.2.2) genauer erläutert. Dasselbe gilt für die Frage nach den Zielen der Jungenarbeit (siehe 4.1.1).
Diese Vielzahl von Definitionen stellt jeden Pädagogen, der mit Jungen arbeitet, vor die Schwierigkeit, sich erst bewusst machen zu müssen, wann er wirklich Jungenar- beit betreibt. Im Allgemeinen kann festgehalten werden, dass zunächst v.a. der Grundsatz der Geschlechtshomogenität gewahrt werden muss, um von Jungenarbeit zu sprechen. Wichtig sind zudem das pädagogische Handeln und Kenntnisse über die Lebenswelt des einzelnen Jungen, seine Männlichkeitsbilder und sein Jungesein. Im nächsten Abschnitt sind zu einem besseren Verständnis grundlegende Begriffe zu klären.
1.3.2.2 Entstehungsgeschichte und Entwicklung
Seit wann gibt es überhaupt die Jungenarbeit bzw. wann sind die Jungen in den pä- dagogischen Blickwinkel geraten? Eine erste Beschäftigung mit den Jungen als Ziel- gruppe und eine erste Erforschung dieses pädagogischen Feldes fand ungefähr Mitte der 1980er-Jahre statt, zunächst eher von Seiten der pädagogischen Frauenfor- schung, dann aber immer mehr - v.a. seit Beginn der 1990er-Jahre - auch von Män- nern. So wurden seit 1990 einige bis heute aktuelle Schriften verfasst. Zu den be- kanntesten zählt sicher das Werk von Dieter Schnack und Rainer Neutzling „Kleine Helden in Not“ von 1990, das bereits viele Problemlagen der Jungen benennt und eine stärkere Auseinandersetzung der Eltern bzw. der Gesellschaft mit dem männli- chen Geschlecht fordert. Die Versuche hierzu sind doch recht unterschiedlich, so stellt z.B. Kaiser fest, „dass die von Frauen vorgeschlagenen Wege eher in Richtung des Anknüpfens an emotionale Probleme und Konflikte von Jungen, der Förderung von sozialen Kompetenzen oder in hausarbeitsdidaktischen Anregungen gehen, während von einigen Männern vorgeschlagene Wege (…) stärker an die aktuelle subjektive Welt von Jungen anschließen“ (Kaiser 2005 b, S. 13). Es wird deutlich, dass es den „richtigen“ Weg noch nicht gab bzw. gibt und es noch einer eingehenden Reflexion bedarf, um sowohl den Bedürfnissen der Jungen gerecht zu werden, als auch die Entwicklung des Geschlechterverhältnisses positiv zu beeinflussen (ebd.).
Ein Paradigmenwechsel in der Geschlechterforschung eröffnete schließlich eine neue Blickrichtung auf die Geschlechtsthematik. Die Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit als ein sich wechselseitig bedingendes System, war hierfür mit ausschlaggebend und eine Beschäftigung mit „Männlichkeit“ - zunächst allerdings fast ausschließlich von Seiten der Frauen - trat ein. Die Ansätze der Jungenarbeit kamen also ursprünglich aus der Richtung der feministischen Mädchenarbeit oder als Reaktion auf die Frauenbewegung. Mittlerweile haben sich aber bereits viele Männer mit den Jungen und der Jungenarbeit in Theorie und Praxis auseinandergesetzt. Hier seien nur die von mir in dieser Arbeit häufig zitierten Wissenschaftler wie Alexander Bentheim, Lothar Böhnisch, Kurt Möller und Uwe Sielert erwähnt.
Nach der Entstehungsphase von den 1980er-Jahren bis in die späten 1990er-Jahre, spätestens jedoch seit Beginn des 21. Jahrhunderts befindet sich die wissenschaftli- che Auseinandersetzung mit der Jungenarbeit, sowie diese selbst, in einem Stadium der Etablierung. Dennoch scheint Jungenarbeit und die Arbeit mit Jungen noch im- mer keine weit verbreitete Arbeitsweise zu sein (Bentheim u.a. 2004, S. 11). Die Gründe hierfür sind multikausal und werden später im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten der Jungenarbeit näher ausgeführt (siehe 5.). Die Anfänge in der Jungenarbeit waren hauptsächlich von der Beschäftigung mit auffälligen und schwie- rigen Jungen geprägt, die zudem aus den eher unteren sozialen Schichten stammten (Bentheim u.a. 2004, S. 30):
„Jungenarbeit wurde (und wird partiell) funktionalisiert in Bezug auf Gruppen besonders schwieriger oder ‚harter’ Jungen und männlicher Jugendlicher. Daraus abgeleitet wurde eine Tendenz zur Domestizierung extremer, hoch- problematischer oder besonders ‚wilder’ Jungen durch die Jungenarbeit. Im Mittelpunkt steht hier das Ziel, problematische Jungen bzw. Gruppen von Jungen sozialverträglich zu ‚machen’, sie zu befrieden oder von der Straße zu entfernen, sie also ‚in den Griff zu bekommen’. Ähnliche Prozesse sind aus der Entwicklung der offenen Jugendarbeit bekannt“ (ebd.). Interessierte bis Mitte der 1990er-Jahre im deutschsprachigen Raum v.a. die For- schung zur Bedeutung von Männern in der Herstellung von Herrschafts- und physi- schen Gewaltverhältnissen, wurde der Blick auf die Konstruktion von Männlichkeiten im Laufe der Zeit immer breiter und transparenter (Voigt-Kehlenbeck 2005, S. 117). Eine neue Perspektive auf die Jungen als Opfer warf aber, neben anderen Schriften, erst der oben bereits erwähnt Bestseller „Kleine Helden in Not“. Dort werden Jungen u.a. als Bildungsverlierer dargestellt (Schnack/Neutzling 2006, S. 179 ff). Bis heute stellen viele (besonders männliche) Pädagogen den Kontakt zu den Jungen in der Jungenarbeit erst einmal über die Opferseite her, was auch damit zusammenhängt, dass die schuldhafte Beteiligung des eigenen Geschlechts an den bestehenden Gewaltverhältnissen für Männer sehr unangenehm ist (Voigt-Kehlenbeck 2005, S. 118). Diese Perspektive verweist auf den engen Zusammenhang der hegemonialen Männlichkeit (siehe 3.3) und der Stigmatisierung des Jungen als Opfer.
Die Geschichte der Jungenarbeit in Deutschland brachte eine Vielzahl an Zielen, unterschiedlichen Ansätzen und eine Reihe praktischer Projekte hervor, mit denen sich die Arbeit weiter unten noch genauer befassen wird (siehe 4.1.1 und 4.2). Hier sollte jedoch bereits festgehalten werden, dass die ersten Konzepte ihren Schwer- punkt auf die Schwächen der Jungen legten, also vorwiegend defizitorientiert waren. So z.B. auch das Modellprojekt der nordrheinwestfälischen Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“12, das als Ausgangspunkt der praktischen Auseinandersetzung mit den Jungen gilt. Dieses Projekt wurde von Juli 1986 bis Juli 1988 mit Schülern eines Berufsvorbereitungsjahres durchgeführt. Der Ansatz der dort tätigen Pädago- gen wurde offiziell als „antisexistische Jungenarbeit“ bezeichnet (siehe 4.1.1.2) und aus Mitteln des Bundesjugendplanes finanziert. Ziel war es einen geschlechtsbezo- genen Bildungsansatz für Mädchen und Jungen in der außerschulischen Bildung zu erproben und zu evaluieren. Zu dieser Zeit wurden die aus der Frauenforschung stammenden geschlechtsbezogenen Erfahrungen aufgegriffen und einfach unreflek- tiert auf die Arbeit mit Jungen übertragen. Bereits dieses Modellprojekt „ging auf ein vergleichsweise noch deutlich feministisch beeinflusstes Verständnis zurück, demzu- folge sich Jungen an traditionellen Vorstellungen von Männlichkeit - mit Merkmalen wie Dominanz, Leistungsdenken, körperliche Härte gegen sich und andere - orien- tieren und dies auch weiter tun, wenn dem nicht frühzeitig pädagogisch gegenge- steuert wird“ (Bentheim u.a. 2004, S. 59). Richtungweisend für die Jungenarbeit war das Modellprojekt in Frille insofern, dass erstmals nicht nur traditionelle Ziele einer Jungenpädagogik, sondern neue Handlungsschwerpunkte einer Beschäftigung mit dem als „antisexistisch“ titulierten Jungen propagiert wurden. Damit gelang es der Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“ einen Meilenstein in der geschlechtsbezogenen Arbeit in Deutschland zu setzen.
Zu einer geographischen Einteilung der Jungenarbeit in Deutschland ist die Bemer- kung wichtig, dass die Wurzeln der geschlechtsbezogenen Arbeit mit Jungen in den westlichen Bundesländern verankert sind. Dort findet sie bis heute in verschiedenen Formen statt. Dagegen ist eine Jungenarbeit in den sog. neuen Bundesländern eher nur ein sehr randständiges Thema, auch wenn dort ab und an neue Projekte anlau- fen.13 Die Jungenarbeit hat sich dabei seit Ende der 1980er-Jahre bis in unsere Zeit von den Ballungsgebieten bis in den ländlichen Raum verbreitet. Die Aktivitäten finden aber nach wie vor hauptsächlich im Einzugsbereich größerer Städte statt (Bentheim u.a. 2004, S. 60).
Die Jungenarbeit in Deutschland weist also im Jahr 2008 bereits eine fast 30-jährige Geschichte auf, in der für die praktische Umsetzung unterschiedliche Ziele und Theo- rien formuliert wurden. Auf eine Auseinandersetzung mit diesen wird später näher eingegangen (siehe 4.1.1). Andere Autoren sehen die Ursprünge der Ansätze zur Jungenarbeit jedoch schon deutlich früher. So bezeichnet Kurt Möller die Jugendbe- wegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts z.B. mit den bürgerlichen Jugendbewegun- gen „Wandervogel“ und „Freideutsche Jugend“ als verdeckte Jungen- und Männer- bewegung14. Egal, wo genau man nun den Ausgangspunkt für die Jungenarbeit sieht, ob um 1900 oder erst mit Auftreten der Frauenbewegung, sicher ist nur, dass die Jungenarbeit bis ins 21. Jahrhundert Fuß gefasst hat und Bestandteil einer Vielzahl von politischen und pädagogischen Diskussionen ist. Schwierig stellt sich bis heute dar, dass die Jungenarbeit bundesweit noch keine klare Position hat, sondern viele Männer und Frauen den Jungen zwar eine größere Aufmerksamkeit schenken, aber unsicher sind, wie sie dies am besten tun sollen. Diese und weitere Schwierigkeiten, die auch auf fehlende wissenschaftliche Beiträge über die Jungen zurückzuführen sind, werden in einem späteren Kapitel benannt (siehe 5.).
2. Grundlegende Begriffe
In diesem Abschnitt werden die Begriffe „doing gender“, Männlichkeit, Mannsein und männlicher Habitus beschrieben, denen in der Auseinandersetzung mit der Jungenarbeit eine wichtige Rolle zukommt.
2.1 Doing Gender
Das Konzept des „doing gender“ geht davon aus, dass jeder Mensch sein Geschlecht täglich neu konstruiert, also die „gesellschaftliche Wirklichkeit von den einzelnen Individuen nicht nur passiv erfahren, sondern auch aktiv verarbeitet und mit gestal- tet wird“ (Fahrenwald 2006, S. 6). Damit ist jeder auch für sein Tun verantwortlich und kann seine geschlechtlichen Spezifika bzw. seine geschlechtstypischen Verhal- tensweisen nicht allein der Natur zuschreiben. Nicht nur Hormone - wie z.B. das Testosteron beim Jungen - bestimmen die täglichen Handlungen und Entscheidun- gen von Männern und Frauen, sondern eben auch deren gesellschaftliches Handeln selbst. Dieses ist der jeweils handelnden Person häufig nicht bewusst, sondern ge- schieht intuitiv. Sie orientiert sich dabei an bestimmten gesellschaftlichen Idealvor- stellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit (ebd.) Anzumerken ist jedoch, dass „doing gender“ nicht heißt, dass man sich als Junge bzw. Mann immer den idealisier- ten Männlichkeitsvorstellungen entsprechend verhalten muss, um als männlich zu gelten. Das liegt zum einen daran, dass sich jeder Mann seine Männlichkeit selbst konstruiert und damit eben auch sein „Mannsein“ gestaltet. Zum anderen ist bis heute unklar, was männlich und nicht mehr männlich (häufig als weiblich abgewer- tet) ist und was heutzutage unter dem Begriff „Männlichkeit“ verstanden wird.
2.2 Männlichkeit
Das Leben von Jungen ist nahezu durchgehend geprägt von ihrer Suche nach Männlichkeit. Was aber ist überhaupt Männlichkeit? Mit dieser Frage setzt sich die Arbeit hier auseinander, da von ihrer Beantwortung u.a. die praktische Herangehensweise der Jungenarbeit abhängt. Sollen die Jungen eher zu mehr oder eher zu weniger „Männlichkeit“ erzogen werden? Oder sollen sie zu ihren männlichen Wurzeln vordringen? Brauchen Jungen überhaupt eine pädagogische Unterstützung oder können sie ihre Entwicklungsaufgaben bzw. Probleme auf dem Weg zum Mann selbst bewältigen? Dies sind nur einige der Fragen, die sich hier stellen.
Zunächst ist es wichtig, eine Definition von „Männlichkeit“ zu erstellen und zwar nicht nur in Abgrenzung zur Weiblichkeit oder zum „Mannsein“. Ein nicht sehr gelungener, rein biologischer Definitionsversuch beschreibt „Männlichkeit“ als die Persönlichkeit eines jeden, „… der einen Penis besitzt, ein Y-Chromosom und eine gewisse Menge an Testosteron“ (Connell 2006, S. 63).
Eine bessere soziokulturelle Definition zur Eingrenzung bietet Bentheim an. Für ihn wird Männlichkeit ausgedrückt durch:
„... kulturell gewonnene und traditionell überlieferte Bilder, Botschaften und Aussagen über Männer. Abbilder von Männlichkeitsvorstellungen finden wir in alltäglichen Lebenswelten im Überfluss: in kulturellen Produktionen (Mär- chen, Mythen, Sagen, Literatur, Musik); in kulturell verdichteten Figuren (wie König, Held, Magier, Heiler); in kommerziellen Medien (Filme, Zeitschriften, Werbung, Videos, PC-Spiele). (…) Auch Eigenschaften gehören dazu, die Jun- gen und Männern zugeschrieben sind: z.B. Unabhängigkeit, Aktivität, Ent- scheidungskraft, Durchhaltevermögen, Belastbarkeit. Unter Männlichkeit werden vor allem Reduktionen, Idealisierungen und Ideologien verstanden: …“ (Bentheim u.a. 2004, S. 57).
Für Bentheim ist „Männlichkeit“ das, was den Jungen und Männern traditionell über verschiedene Medien vermittelt wird, sowie Charakterzüge, die den Jungen vorgeben, was männlich ist und was nicht. Wichtig ist die Erkenntnis, dass Männlichkeit eine ideologische Verankerung hat und daher idealisierend wirkt (ebd.). An diesen Bildern über Männlichkeit, die nicht selten Ideologien darstellen, orientieren sich die Jungen häufig in ihrer Sozialisation. Besonders dann, wenn den Jungen und jungen Männern Vorbilder in Form von Männern in ihrem Lebensumfeld fehlen. Bentheim fordert daher: „Jungenarbeit braucht deshalb eine kritische Reflexion der Ideologien der Männlichkeit(en). Diese Reflexion muss aber nicht (unbedingt) und immer von den Jungen bzw. Jugendlichen oder Männern selbst geleistet werden. Meistens genügt es, wenn Jungenarbeiter dies tun …“ (Bentheim u.a. 2004, S. 57). Diese Jungenar- beiter sind in der Praxis jedoch häufig gar nicht vorhanden, wie weiter unten noch ausgeführt wird (siehe 5.).
Böhnisch führt zur Definition der „Männlichkeit“ aus, dass dieser Begriff in Zusammenhängen gebraucht wird, die sich auf die gesellschaftliche Konstruktion der Männerfrage und die entsprechenden Männerbilder beziehen. Die Begriffe „Männerrolle“ und „Maskulinität“ werden hingegen anderweitig verwendet. Die Männerrolle verweist auf das interaktive und institutionsbezogene Handeln innerhalb einer Rolle, während von Maskulinität dann gesprochen wird, wenn es um psychodynamischemotionale Manifestationen geht (Böhnisch 2004, S. 21 f).
Connell unterscheidet grundsätzlich vier verschiedene Definitions-Strategien, näm- lich essentialistische, positivistische, normative und semiotische Ansätze. Bei einer essentialistischen Definition wird ein Aspekt der Männlichkeit herausgegriffen, z.B. die Aktivität und dem weiblichen Pendant gegenübergestellt, hier etwa der Passivität. Da das jeweilige Kriterium sehr willkürlich gewählt ist, scheint dies kein gelungener Weg zur Erklärung von Männlichkeit zu sein. Nach positivistischer Ansicht ist männ- lich einfach das, was bei Männern bzgl. ihres Verhaltens und ihren Einstellungen beobachtet werden kann, d.h. Männlichkeit spiegelt wider, wie Männer wirklich sind. Folgende drei Probleme ergeben sich aus dieser Definition: erstens gibt es keine Beschreibung ohne Standpunkt, weshalb diese nie neutral sein kann; zweitens ist hierzu zunächst eine Aufteilung in die Kategorien „Mann“ und „Frau“ notwendig, weshalb bereits Typisierungen vor ihrer Erforschung feststehen und drittens „verhin- dert eine solche Männlichkeitsdefinition, daß man auch eine Frau als ‚männlich’ oder einen Mann als ‚weiblich’ oder bestimmte Verhaltensweisen oder Einstellungen als ‚männlich’ oder ‚weiblich’ beschreiben könnte …“ (Connell 2006, S. 89). Normati- ve Definitionen erkennen diese Unterschiede an und sehen Männlichkeit als Norm an, also als das, wie Männer sein sollten. Der Schwachpunkt einer rein normativen Männlichkeitsdefinition ist, dass nur wenige Männer die Männlichkeitsnorm errei- chen können und damit die Mehrheit der Männer unmännlich wäre. Zudem erlaubt uns diese Definition keinen Zugriff auf die Persönlichkeitsebene. Auch semiotische Ansätze negieren diese Ebene und definieren Männlichkeit lediglich als Nicht- Weiblichkeit. Dabei ist Männlichkeit der Ort symbolischer Autorität. Weiblichkeit wird hingegen symbolisch durch Mangel an etwas definiert (Connell 2006, S. 91).
Der Diskurs um Männlichkeit besteht schon seit vielen Jahrzehnten und scheint deshalb in unserer Gesellschaft durchaus erforderlich zu sein. Während des Über- gangs vom 19. zum 20. Jahrhundert war es v.a. Sigmund Freud, der mit seiner Tie- fenpsychologie den ersten ernsthaften Versuch unternahm, Männlichkeit wissen- schaftlich zu erklären. Insbesondere sein „Ödipuskomplex“, der das Verlangen der Jungen nach der eigenen Mutter und das Hassgefühl gegenüber dem eigenen Ge- schlecht, also v.a. dem Vater gegenüber beschreibt, hat weltweit Berühmtheit er- langt.
[...]
1 Titel des bekannten Werkes von Schnack, Dieter/Neutzling, Rainer 2006: Kleine Helden in Not. Jungen auf der Suche nach Männlichkeit. 8. Auflage. Reinbek bei Hamburg.
2 Titel des Buches von Benard, Cheryl/Schlaffer, Edit 2005: Einsame Cowboys. Jungen in der Pubertät. 3. Auflage. München.
3 Vgl. z.B. Schnack, Dieter/Neutzling, Rainer 2006: Kleine Helden in Not. Jungen auf der Suche nach Männlichkeit. 8. Auflage. Reinbek bei Hamburg, S. 264-273.
4 Vgl. hierzu Metz-Göckel, Sigrid 1988: Geschlechterverhältnisse, Geschlechtersozialisation und Geschlechtsidentität. Ein Trendbericht, Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie, 2,8, S. 85-97.
5 „doing gender“ meint, das das soziale Geschlecht (Gender) nicht etwas ist, was man „hat“, sondern etwas, was man „tut“ (Leitlinien KJR München-Stadt); siehe auch 2.1.
6 zu einer kurzen Darstellung siehe Nissen, Ursula 1998: Kindheit, Geschlecht und Raum: sozialisa- tionstheoretische Zusammenhänge geschlechtsspezifischer Raumaneignung. Weinheim und Mün- chen, S. 84 ff.
7 Vgl. auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und das bayerische Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern (BayGIG).
8 Ein positives Beispiel eines Gender-Mainstreaming-Projekts, dessen Ziel u.a. ein Wandel der Orga- nisation mit dem Ziel der Geschlechtergerechtigkeit ist, wurde an der Universität Augsburg im No- vember 2003 eingeführt; vgl. http://www.uni-augsburg.de/projekte/gendermainstreaming/gm- projekt (zuletzt abgerufen am 25.03.2008).
9 Während die erste Frauenbewegung ab Mitte des 19. Jahrhunderts für die grundsätzlichen politischen und bürgerlichen Rechte der Frauen wie z.B. das Frauenwahlrecht, das Recht auf Bildung und das Recht auf Erwerbstätigkeit kämpfte, forderte die zweite Frauenbewegung ab ca. 1960 u.a. ein Ende weiterer Diskriminierungen von Frauen.
10 Mehr zur „Bubenarbeit“ findet sich z.B. bei Seebauer, Renate/Göttel, Johann 2008: „Männlichkeit ist das, was Weiblichkeit nicht ist“ - Buben und Burschenarbeit in Österreich. In: Holz, Oliver (Hrsg.): Jungenpädagogik und Jungenarbeit in Europa. Standortbestimmung - Trends - Untersuchungser- gebnisse. Münster, S. 25-37; oder alternativ in den Veröffentlichungen der Katholischen Jungschar Österreichs, u.a. in: Mannsbild. Geschlechtsbezogene Bubenarbeit. Hintergrund - Modelle - Praxis. Wien 2001.
11 Die Leitlinien sind dem Organisationshandbuch des Kreisjugendring München-Stadt (Stand: 01/2007) entnommen.
12 In dem Bericht zum Modellprojekt „Was Hänschen nicht lernt … verändert Clara nimmer mehr!“ wird Jungenarbeit erstmals in dieser Ausführlichkeit dargelegt; vgl. hierzu u.a. Winter, Reinhard 2001: Jungen (Stichwort). In: Otto, H.-U./Thiersch, H.: Handbuch Sozialarbeit/Sozialpädagogik. Neu- wied, S. 906.
13 Vgl. z.B. das Modellprojekt Jungenarbeit in Sachsen unter www.modellprojekt-jungenarbeit.de (zuletzt abgerufen am 25.03.2008) oder bei Switchboard. Zeitschrift für Männer und Jungenarbeit, 19, 183, S. 4-9.
14 Mehr zu dieser Aussage findet sich bei Möller, Kurt 1997: Nur Macher und Macho? Geschlechtsreflektierende Jungen- und Männerarbeit. Weinheim und München, S. 64 ff.
- Arbeit zitieren
- Andreas Fritsch (Autor:in), 2008, Relevanz, Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Jungenarbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128229
Kostenlos Autor werden


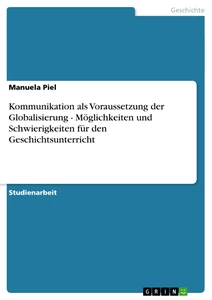










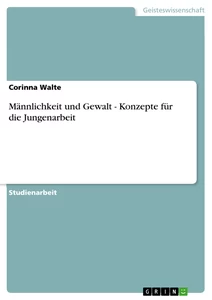



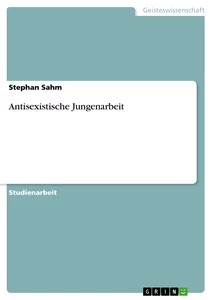




Kommentare