Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Forschungsüberblick Systemvergleich
2 Klassische Ansätze des Systemvergleichs
2.1 Steffani: Parlamentarismus - Präsidentialismus
2.2 Lijphart: Mehrheitsdemokratie - Konsensusdemokratie
2.3 Linder: Repräsentationsdemokratie – halbdirekte Demokratie - Direktdemokratie
3 Das politische System der Schweiz
4 Die Typologisierung des politischen Systems der Schweiz
4.1 Die Schweiz – Ein präsidentielles System?
4.2 Die Schweiz – Eine Konsensusdemokratie?
4.3 Die Schweiz – Eine Direktdemokratie?
Fazit
Literaturverzeichnis
Einleitung
Das Bilden von Typologien ist konstitutiv für die vergleichende Regierungslehre – oder in neuerem Duktus, die vergleichende Politikwissenschaft. Der Vergleich politischer Systeme ist im Zeitverlauf von der bestimmenden und namensgebenden Beschäftigung schlechthin zu einer Teildisziplin mit immer noch zentraler Bedeutung geworden. Der Vergleich erlaubt dem Forschenden, die Bedingungen ähnlich einem Experiment zu variieren, und so einerseits zu generalisieren und allgemeine Zusammenhänge erkennen zu können, andererseits aber das spezifische an einem Fall gezielter wahrzunehmen. Die Typologie erfüllt dabei die Funktion, die Gemeinsamkeiten der Einzelfälle systematisch und zusammenfassend zugänglich zu machen und verallgemeinerbare Aussagen zu erlauben.[1] Die Typologien wurden ursprünglich deduktiv aus den als Idealbildern angesehenen Realmodellen der englischen Westminsterdemokratie und dem amerikanischen republikanischen Präsidentialismus entwickelt, welche als Maßstab für Demokratien allgemein angesehen wurden. Insbesondere die Stabilität über momentane Krisen und andauernde gesellschaftliche Veränderungen hinweg hat diese Sichtweise begünstigt.
Dabei wurden Länder wie die Schweiz lange Zeit vernachlässigt: Sie ist ebenfalls eine stabile Demokratie mit langer demokratischer Tradition, ohne offensichtlich einem der angloamerikanischen Idealtypen zu entsprechen. Mit ihrer Entwicklung, die stark durch regional-föderale und später direktdemokratische Tendenzen, sowie die einmalige Institution des Bundesrats als oberstem Exekutivkollegiums gekennzeichnet ist, hat sie in mehrfacher Hinsicht einen Sonderweg beschritten, nicht nur im Vergleich zu den klassischen angloamerikanischen Demokratien, sondern auch gegenüber den kontinentaleuropäischen. Diese einmalige Kombination verschiedenster Demokratiekonzepte macht sie zu einem besonders interessanten Fall, was die Aussagekraft von Typologien angeht. Typologien sind ihrem Funktionsprinzip nach auf ein gewisses Maß an Abstraktion angewiesen, durch die Informationen verloren gehen. Welche der gängigsten Typologien können die Schweizer Demokratie angemessen klassifizieren? Ist dies überhaupt möglich?
Diese Frage soll, nach einem kurzen Forschungsüberblick über den Vergleich politischer Systeme, anhand der Betrachtung von drei klassischen Typologien geklärt werden: Der Unterscheidung nach Mehrheits- und Konsensusdemokratien nach Arendt Lijphart, der Einteilung in parlamentarische und präsidentielle Systeme nach Winfired Steffani und der Differenzierung in repräsentative und direkte Demokratie, wie sie Wolf Linder vorschlägt. Ihrer Darstellung folgt eine Betrachtung der Merkmale des politischen Systems der Schweiz, gegliedert anhand der in den Typologien zentralen Dimensionen: Auf der institutionellen Ebene wird einmal das Verhältnis von Regierung und Parlament, sowie die Funktion der Parteien im Mittelpunkt stehen (siehe Kapitel 2.1: Steffani). Ergänzt wird dies durch eine Darstellung des Umfangs der direktdemokratischen Elemente, sowie ihrem Zusammenwirken mit repräsentativdemokratischen (siehe Kapitel 2.3: Linder). Zuletzt ist ergänzend auch der föderale Aspekt, das Wahlrecht, sowie das Handeln der Akteure zu berücksichtigen (siehe Kapitel 2.2: Lijphart). In einem dritten und abschließenden Schritt soll für jede der drei Typologien anhand ihrer Einordnung der Schweiz in der jeweiligen Typologie überprüft werden, ob die Typologisierung weitere Schlussfolgerungen gemäß ihres jeweiligen eigenen Erkenntnisziels zulassen. Hier sollen zwei aufeinander aufbauende Ebenen betrachtet werden: Nur wenn die ähnlich typisierten Demokratien in den vergleichsrelevanten Dimensionen tatsächlich Ähnlichkeiten aufweisen, ist eine vergleichende Typologie auf der deskriptiven Ebene überhaupt als sinnvoll zu erachten. Optimal in forschungstheoretischer Hinsicht wäre es, würden die Typologien darüber hinaus die Bildung von empirisch überprüfbaren Hypothesen ermöglichen und diese wiederum durch die Einordnung des komplexen Sonderfalls Schweiz nicht falsifiziert. Indem überprüft wird, ob die typologischen Konstrukte diese Bedingungen erfüllen, sollen spezifische Stärken und Schwächen der jeweiligen Einordnung systematisch aufgezeigt werden.
1 Forschungsüberblick Systemvergleich
Ein Forschungsüberblick über die Typologisierung von Staatsformen wäre unvollständig ohne einen – zumindest kursorischen Verweis auf die griechische Antike: Die „aristotelische“ Trias von Monarchie, Aristokratie und Demokratie – ursprünglich bereits von Herodot fünf Jahrhunderte vor Christus erläutert. Darauf aufbauend ist noch die „Politeia“ von Platon (ca. 370 v. Chr.) zu nennen, der die Dreigliederung durch eine zweite Dimension ihrer jeweiligen Verfallstypen ergänzte. In vergleichender und typologisierender Hinsicht ist die Lehre der Staatsformen danach nicht wesentlich weiter entwickelt worden, die Klassiker der politischen Theorie in der Frühen Neuzeit, wie zum Beispiel Bodin, Hobbes oder Kant griffen im Wesentlichen auf die antiken Vorbilder zurück.[2]
Der Vergleich zwischen demokratischen Regierungssystemen – mittlerweile nur noch ein Feld unter vielen komparativen Ansätzen in der vergleichenden Politikwissenschaft – ist der „klassische“, da älteste Ansatz des Vergleichs von Demokratien.[3] Die wichtigste Kategorisierung des Herrschaftssystemvergleichs in der Nachkriegszeit ist zunächst die Unterscheidung zwischen parlamentarischer und präsidentieller Demokratie, mit den Systemen in den Vereinigten Staaten und England als Blaupausen.[4] In der deutschen – wie auch der internationalen – Politikwissenschaft ist zunächst eine Klassifikation anhand von „weichen“, also analytisch nicht trennscharfen, da von Interpretation abhängigen Faktoren vorherrschend. Dabei werden überwiegend institutionelle oder verfassungsrechtliche Kriterien angewandt. Für eine institutionelle Betrachtung kann stellvertretend für die Vielzahl von Autoren Klaus von Beyme genannt werden, der allerdings ergänzend Aspekte politischer Kultur nutzt.[5] Rein verfassungsrechtlich argumentiert Ernst Fraenkel, der dabei die Rechte und Pflichten der Regierung in den Fokus nimmt.[6] Winfried Steffani hingegen wählt für seine Herangehensweise einen neuen Ansatz: Nicht die funktionelle Unterscheidung von Legislative und Exekutive, sondern jene von Regierung und Opposition ist entscheidend. Daraus nun ergibt sich ein „hartes“, da verfassungsrechtlich eindeutiges Kriterium: Die Abberufbarkeit der Regierung. Dieses ergänzt er um weitere „weiche“ Faktoren (siehe Kapitel 2.1).[7] Diese Methode der Typologisierung lässt im Gegensatz zu ihren Vorgängern keine Mischformen zu, sie kennt nur „entweder – oder“.
Arend Lijpharts Ansatz der Konsensdemokratie als Gegenstück zur Mehrheitsdemokratie ergänzt die im klassischen Vergleich vorherrschende Konzentration auf den institutionellen polity -Bereich durch Hinzunahme von politics -Faktoren, also Akteuren und Prozessen. Für die Bestimmung der beiden Dimensionen Föderalismus – Unitarismus und Parteien – Exekutive arbeitet er – ebenfalls im Unterschied zu Ansätzen wie dem von Steffani – mit statistischen Zahlenwerten und erhält so ein Kontinuum zwischen den Idealfällen Mehrheitsdemokratie und Konsensdemokratie.[8] Die jeweiligen institutionellen Ausgestaltungen werden also hinsichtlich ihrer Machtkonzentration bzw. -teilung vermessen (siehe Kapitel 2.2). Die typologisierenden Untersuchungen zur Konsensdemokratie von 1984[9] und 1999[10] basieren dabei auf früheren Überlegungen Lijpharts zum normativen Konzept einer „consociational democracy“, einen Gegenentwurf zur Westminsterdemokratie, der seiner Meinung nach in einigen Belangen überlegen ist.[11]
Die Forschung zur Formen direkter Demokratie ist hinsichtlich ihrer Typologien nicht auf demselben Stand wie andere Forschungsfelder des Systemvergleichs. Ihr vergleichender Zweig ist durch eine Fülle von Studien zu Einzelfällen, einige wenige tatsächlich vergleichende Arbeiten[12] und ein völliges Fehlen von Typologien oder allgemein zwischen Systemen übertragbarer Ergebnisse gekennzeichnet. Die demokratietheoretische Diskussion hingegen kennt idealisierte Systemtypen: Sie arbeitet, verstärkt seit der gesellschaftlichen Inspiration in den 1970er Jahren, mit der Dichotomie Repräsentativdemokratie – Direktdemokratie, die jedoch in dieser Rigorosität keinerlei praktischen Wert zur Einordnung moderner politischer Systeme hat – da schlicht nur demokratische Systeme grundsätzlich repräsentativen Zuschnitts existieren.[13] Ein neuer, höchst elaborierte Ansätze zur theoriegeleiteten Typisierung aller potentiellen Spielarten direktdemokratischer Verfahren in den verschiedenen repräsentativen Systemtypen findet sich bei Sabine Jung. Sie kombiniert die Kategorien Steffanis und Lijpharts mit theoriegeleiteten Typisierungen direkter Demokratie. Allerdings mit nur bedingtem Praxisbezug: Es gibt schlicht nicht genug Fälle, um eine Typologie mit acht Kategorien vergleichend mit Leben zu füllen oder auch nur die Mehrheit der enthaltenen Hypothesen zu testen.[14] Wolf Linder umgeht diese Problematik, indem er die Schweiz schlicht als „halbdirekte Demokratie“ charakterisiert, eine Begrifflichkeit die er zwar scheinbar in typologisierender, also zumindest beschreibend-unterscheidender Absicht, aber nur hinsichtlich der Schweiz entwickelt hat.[15] Zusammen mit seinen Überlegungen zur Differenzierung von Elementen direkter Demokratie allgemein ergibt sich jedoch eine induktive Typologie mit der Schweiz als Extremtyp eines Mischsystems (siehe Kapitel 2.3).
Will man die drei behandelten Ansätze in die großen methodologischen Forschungstrends der vergleichenden Politikwissenschaft einordnen, so lässt sich sagen, dass sie alle dem institutionalistischen Bereich zuzuordnen sind, der sich in einen klassischen und einen neo-institutionalistischen Zweig aufspaltet. Daneben waren (und sind teilweise immer noch) wichtige Strömungen die des strukturorientierten politisch-soziologischen Ansatzes, sowie Behaviouralismus und Rational-Choice-Theorie. Der klassische Institutionalismus konzentriert sich vor allem auf die formalen Institutionen, während der neue Institutionalismus, ein Begriff, der Mitte der 1980er entstand, auch die informellen Institutionen und selbst die Akteursdimension mit einbezieht und dabei Modelle höherer, angemessener Komplexität entwickeln will.[16] Dabei sind Steffani und seine Zeitgenossen klar dem klassischen Institutionalismus zuzurechnen, der Ansatz von Linder, obgleich wesentlich neuer, letztlich auch, da er nur formale Kriterien in den Blick nimmt. Lijphart hingegen fokussiert zwar in seiner Herleitung auf institutionelle Faktoren, behilft sich bei der Messung jedoch mit Werten, die auch stark von der Akteursdimension geprägt werden und ist daher an der Schwelle zwischen den beiden Ansätzen zu verorten.
2 Klassische Ansätze des Systemvergleichs
2.1 Steffani: Parlamentarismus - Präsidentialismus
Das Erkenntnisziel von Winfried Steffanis Typologie ist das „Verständnis der Funktion und Bedeutung der Partei, der Partei- und Fraktionsdisziplin, sowie der Rolle der parlamentarischen Opposition“ in den typologisierten Systemen.[17] Er charakterisiert seinen Ansatz in Abgrenzung zur „historischen Differenzierung“ mit den Idealtypen USA und Großbritannien als „systematischen“ Ansatz, der durch die Betrachtung struktureller Eigenschaften Erkenntnisse gewinnt. Um sowohl die enge Orientierung Karl Loewensteins am idealisierten britischen Modell, als auch „terminologische Unsicherheiten“ wie Mischtypen bei Klaus von Beyme zu vermeiden, nutzt er ein zentrales, entscheidendes Kriterium. So soll gleichzeitig sichergestellt werden, dass alle möglichen demokratischen Systeme erfasst werden.[18]
Steffanis verfassungsrechtlich-institutioneller Ansatz nutzt die Abberufbarkeit einer Regierung als primäres Differenzierungskriterium: „Ist die Regierung vom Parlament absetzbar, so haben wir es mit der Grundform ‚parlamentarisches Regierungssystem’ zu tun, ist eine derartige Abberufbarkeit verfassungsrechtlich nicht möglich, mit der Grundform ‚präsidentielles Regierungssystem’“.[19] Die „supplementären“, also wahrscheinlich, aber nicht zwingend vorhandenen Merkmale ergeben sich dann entweder aus der Funktionslogik, oder wiederum der Anschauung der politischen Systeme in Britannien und den USA. Hier wäre das Recht der Exekutive zur Parlamentsauflösung (parlamentarisch) zu nennen, oder die Unvereinbarkeit von Regierungsamt und Abgeordnetenmandat (präsidentiell).[20] Steffani geht weiterhin davon aus, dass „in präsidentiellen Regierungssystemen das System der geschlossenen, in parlamentarischen Systemen das der doppelten Exekutive vorherrscht“.[21] Damit ist gemeint, dass die Funktion von Staatsoberhaupt und Regierungschef – oder gar Regierung – in einer Institution, also meistens auch einer Person, vereinigt sind. Hingegen nur aus der Anschauung, keinesfalls aber aus der Funktionslogik erklärbar ist das Merkmal der mächtigen zweiten Kammer, bzw. der Föderalen Struktur, die laut Steffani untypisch für den Parlamentarismus sind.[22]
Für Steffani ergeben sich aus den jeweiligen verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen der zwei Systemtypen nun folgende, „systemimmanente“ Konsequenzen für die Funktion der Parteien: Im parlamentarischen System bilden Parlamentsmehrheit und Regierung eine „Aktionseinheit“, da sowohl das Bestehen, als auch die Handlungsfähigkeit der Regierung vollkommen von den parlamentarischen Mehrheiten abhängig ist. Sowohl für die Parteien, als auch die Fraktionen ist Geschlossenheit vonnöten, damit die Funktionen als Regierungspartei(en), bzw. Oppositionspartei(en) ausgeübt werden können. Die Kontroll- und Kritikfunktion liegt bei der parlamentarischen Opposition.[23] Im präsidentiellen System ist nur die Handlungsfähigkeit der Regierung bedingt von der Kooperation des Parlaments abhängig, keinesfalls jedoch der Bestand der Regierung. So lassen sich zwei Modelle denken: Ein – gemessen am amerikanischen Idealtyp - atypisches, im Rahmen einer Aktionseinheit von parlamentarischer Mehrheit und Exekutive funktionierendes System, das eine dem parlamentarischen System vergleichbare Opposition vorbringt. Oder aber es besteht keine Aktionseinheit, das System wird vorwiegend vom institutionellen Gegensatz bestimmt, statt durch Fraktionsdisziplin ergeben sich Mehrheiten und Opposition ad hoc.[24]
[...]
[1] Vgl. Alexander Gallus: Typologisierung von Staatsformen und politischen Systemen in Geschichte und Gegenwart, in: Alexander Gallus / Eckhart Jesse (Hrsg.): Staatsformen. Von der Antike bis zur Gegenwart, Bonn 2007, S. 19-55, hier: S. 19.
[2] Vgl. den ausführlichen Überblick in Gallus: Typologisierung, S. 23-42.
[3] Vgl. Heidrun Abromeit / Michael Stoiber: Demokratien im Vergleich. Einführung in die vergleichende Analyse politischer Systeme, Wiesbaden 2006, S. 35.
[4] Vgl. exemplarisch für diese Herangehensweise Douglas V. Verney: The Analysis of political systems, London 1959.
[5] Vgl. Klaus von Beyme: Die Parlamentarischen Regierungssysteme in Europa, München 1970.
[6] Vgl. Ernst Fraenkel: Artikel „Parlmentarisches Regierungssystem“, in: Ernst Fraenkel / Karl Dietrich Bracher (Hrsg.): Staat und Politik, Neuausgabe, Frankfurt a.M. 1972, S. 240, zit. nach Gallus: Typologisierung, S. 44.
[7] Vgl. Gallus: Typologisierung, S. 44.
[8] Vgl. Abromeit / Stoiber: Demokratien, S. 48-50.
[9] Arend Lijphart: Democracies. Patterns of majoritarian and consensus government in twenty-one countries, New Haven / u.a. 1984.
[10] Arend Lijphart: Patterns of democracy. Government forms and performance in thirty-six countries, New Haven / u.a. 1999.
[11] Arend Lijphart: Consocational Democracy, in: World Politics 21 Ausgabe 2 (1969), S. 207-225.
[12] Vgl. exemplarisch Wolfgang Luthardt: Direkte Demokratie. Ein Vergleich in Westeuropa, Baden-Baden 1994; sowie weitere Beispiele bei Sabine Jung: Die Logik direkter Demokratie, Wiesbaden 2001, S. 16-24.
[13] Vgl. Jung: Logik, S. 16-26.
[14] Vgl. ebd., S. 235-245. Der Ansatz liefert allerdings in theoretischer Hinsicht durchaus wertvolle Hypothesen, die ihrer Prüfung – sofern durchführbar – standhalten.
[15] Vgl. Wolf Linder: Schweizerische Demokratie. Institutionen – Prozesse - Perspektiven, Bern / Stuttgart / Wien ²2005, S. 242 sowie S. 335-345.
[16] Vgl. André Kaiser: Mehrheitsdemokratie und Institutionenreform. Verfassungspolitischer Wandel in Australien, Großbritannien, Kanada und Neuseeland im Vergleich, Frankfurt a. M. 2002 (=Mannheimer Beiträge zur politischen Soziologie und positiven politischen Theorie, Band 4), S. 47-50.
[17] Winfried Steffani: Parlamentarische und präsidentielle Demokratie. Strukturelle Aspekte westlicher Demokratien, Opladen 1979, S. 44.
[18] Vgl. ebd., S. 37-39.
[19] Ebd., S. 39.
[20] Vgl. Steffani: Demokratie, S. 45-48.
[21] Ebd.: Demokratie, S. 41. Kursivsetzung entsprechend Original.
[22] Vgl. ebd., S. 48-50.
[23] Vgl. ebd., S. 52-55, sowie S. 58f.
[24] Vgl. ebd., S. 55-58, sowie S. 59f.
- Arbeit zitieren
- Christoph Sprich (Autor:in), 2008, Existiert ein eidgenössicher Einzelfall?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127052
Kostenlos Autor werden












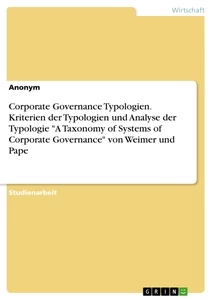
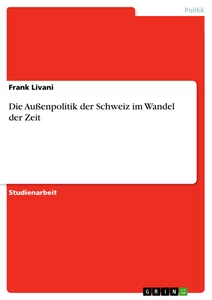








Kommentare