Leseprobe
Inhalt
I. Einleitung
II. Resilienz
II.1 Definition
II.2 Geschichtliche Herkunft/Wurzeln
II.3 Konzeptuelle Grundlagen
II.3.1 Risikoforschung
II.3.1.1 Risikofaktoren
II.3.1.2 Wirkungsweise von Risikofaktoren
II.3.2 Vulnerabilität
II.3.3 Forschung zu Schutzfaktoren
II.3.3.1 Definition
II.3.3.2 Wirkungsweise von Schutzfaktoren
II.3.3.3 Ausblick
II.3.4 Modelle der Wechselwirkung von Risiko- und Schutzfaktoren
II.3.5 Das transaktionale Stressmodell nach Lazarus
II.3.5.1 Primäre und sekundäre Bewertung
II.3.5.2 Bewältigungsformen
II.3.6 Das Konzept der Salutogenese
II.3.6.1 Definition
II.3.6.2 Generalisierte Widerstandsressourcen
II.3.6.3 Kohärenzgefühl
II.4 Resilienzmodell nach Kumpfer
II.5 Messung von Resilienz
II.6 Studien zu Resilienz
II.6.1 Die KauaiStudie
II.6.2 Das BielefeldErlangenResilienzProjekt
II.6.3 Die MannheimerRisikokinderstudie
II.7 Merkmale von Resilienz
II.7.1 Personale Merkmale
II.7.2 Soziale Merkmale
II.7.2.1 Familiäre Merkmale
II.7.2.2 Außerfamiliäre Merkmale
II.7.3 Biologische Aspekte von Resilienz
II.8 Resilienzförderung
II.8.1 Zielgruppe
II.8.2 Zeitpunkt und Dauer der Intervention
II.8.3 Ziele
II.8.4 Strategien
II.8.5 Ebenen
III. Ressourcenorientierung in der Sozialpädagogik
III.1 Begriffsbestimmungen Sozialarbeit - Sozialpädagogik
III.2 Definition Ressourcen
III.3 Ressourcenorientierung historisch
III.3.1 Ressourcenorientierung in der Erwachsenenfürsorge
III.3.2 Ressourcenorientierung in der Jugendfürsorge
III.4 Ressourcenorientierung heute
III.4.1 Die klassischen Methoden
III.4.1.1 Soziale Einzel(fall)hilfe
III.4.1.2 Soziale Gruppenarbeit
III.4.1.3 Gemeinwesenarbeit
III.4.1.4 Kritik
III.4.2 Methoden heute
III.4.2.1 Lebensweltorienterte Soziale Arbeit
III.4.2.1.1 Sozialpädagogisches Handeln
III.4.2.1.2 Dimensionen
III.4.2.2 Prävention
III.4.2.2.1 Kritik
III.4.2.2.2 Bedeutung für die sozialpädagogische Praxis
III.4.2.3 Empowerment
III.4.2.3.1 Empowerment und sozialpädagogisches Handeln
III.4.2.3.2 Ebenen
III.4.2.4 Fazit
III.5 Defizitblickwinkel in der Sozialpädagogik
III.6 Bedeutung der Ressourcenorientierung für sozialpädagogisches Handeln
III.7 Kritik
IV. Implikationen für die sozialpädagogische Praxis
IV.1 Sozialpädagogisches Arbeiten und Resilienzförderung
IV.1.1 Zeitpunkt der Förderung
IV.1.2 Adressaten der Förderung
IV.2 Resilienzförderung auf der individuellen Ebene
IV.3 Resilienzförderung auf der ElternEbene
IV.3.1 Eltern- und Erziehungskompetenzen
IV.3.2 Sozialpädagogisches Handeln auf der ElternEbene
IV.4 NetzwerkEbene
V. Die Bedeutung der Resilienzforschung für die Sozialpädagogik
V.1 Das Neue an der Resilienzforschung
V.1.1 Erfolgreiche Bewältigung und der Fokus auf die Stärken
V.1.2 Eigenaktivität
V.1.3 Vorhersagbarkeit
V.2 Resilienzforschung und Sozialpädagogik
V.2.1 Von der defizitorientierten zur resilienzorientierten Haltung
V.2.1.1 Defizitorientierung
V.2.1.2 Resilienzorientierung
V.2.2 Resilienzorientierung als Ressourcenorientierung
V.3 Erweiterung der Ressourcenorientierung durch die Resilienzorientierung
V.4 Resilienzorientierung in der sozialpädagogischen Praxis
V.4.1 Resilienzförderung und Prävention
V.4.2 Gemeinsame Ziele
V.4.3 Einfluss der Resilienzförderung auf die Präventionsarbeit
V.5 Grenzen resilienzorientierten Arbeitens
VI. Bewertung der Ergebnisse
Literatur
I. Einleitung
Du kannst auf dieser Welt nur Leben, wenn du sie zu
deiner Geliebten machst. Sie mit diesen ungeheuerlichen
Wundern und Grausamkeiten annimmst und zwischen
beiden das Gleichgewicht findest. Sonst wirst du sie
nie so verlassen können, wie du es vorhattest ... .“
(Janosch 2000, S. 52)
Janosch nennt dies „das erste Gesetz der Lebenskunst“, mit dem er die Kunst beschreibt, das Leben − trotz mancher Widrigkeiten − genießen zu können. Und schließlich ist es auch das Ziel von Erziehung, Menschen dazu zu verhelfen diese „Lebenskunst“ zu beherrschen: Sie sollen mündig werden und die Kompetenz herausbilden, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Einer solchen positiven Entwicklung können verschiedene Dinge im Wege stehen, man kann sie wie Janosch „Grausamkeiten“ nennen − oder Widrigkeiten, die in dem Leben jedes Menschen vorhanden sind. Die Pädagogik und die Sozialpädagogik widmen diesen Widrigkeiten besondere Aufmerksamkeit.
Gemeinhin wird von einer Zunahme von Belastungen gesprochen, denen Menschen heute ausgesetzt sind und die, besonders bei Kindern und Jugendlichen, einer positiven Entwicklung im Wege stehen können. Es handelt sich um Risiken, die sie „auf intraindividueller Ebene, innerhalb der Familie, in der Peergroup, in der schulischen und beruflichen Ausbildung oder im gesamtgesellschaftlichen Kontext erfahren“ (Wustmann 2004, S. 09). Die Sozialpädagogik setzt vor allem dort an, wo diese Risiken eine negative Wirkung nach sich ziehen und Entwicklungsdefizite entstehen. Sie versucht durch ihr Eingreifen den daraus folgenden Problemen entgegenzuwirken.
Obwohl augenscheinlich vermehrt Risiken und unerwünschte Entwicklungsdefizite vorhanden sind, wurde, beginnend in den 1950er und 1960er Jahren im Bereich der Entwicklungspsychopathologie, die Aufmerksamkeit auf ein anderes Phänomen gelenkt: Längst nicht alle Menschen, die einer erheblichen Anzahl von Risikobelastungen ausgesetzt sind, entwickeln Probleme und Störungen. Es ist ihnen möglich, sich trotz dieser Widrigkeiten durchaus ‚normal’ und sogar sehr positiv zu entwickeln.
Dieses Phänomen wurde anfangs noch als „Invulnerabilität“ − Unverletzlichkeit − bezeichnet. Doch im Zuge weiterer Forschung, in der das Phänomen empirisch bestätigt wurde, fand eine Ausdifferenzierung dieses neuen Konzepts statt, welches sich in den 1980er Jahren vollends unter dem Begriff der „Resilienz“ in der Forschung etablierte.
Die ursprünglich aus der Psychologie stammende Resilienzforschung fand bald Anklang in pädagogischen Kontexten und wird heute bereits in sozialpädagogischen Arbeitskonzepten verwendet. Für viele in diesem Bereich Tätigen geht von dem Begriff der Resilienz eine große Faszination aus, denn erstmals werden nicht nur die Risiken und die daraus resultierenden Defizite einer Person wahrgenommen. Mit ihm wendet sich der Fokus den Faktoren zu, die es einer Person ermöglichen, sich trotz aller Widrigkeiten positiv zu entwickeln und es stellt sich die Frage, wie es einigen Menschen möglich ist, dieses „Gleichgewicht“ zu finden um ihr Leben erfolgreich zu führen. Diese neue Blickrichtung in der Sozialpädagogik beschreiben Opp und Fingerle wie folgt:
„In der Zukunft wird es vor allem darum gehen, die Risiken kindlicher Entwicklung, die in modernen Gesellschaften für viele Kinder zunehmen, als Entwicklungsgefährdungen und nicht primär im Sinne von Defiziten zu erfassen. Im Zentrum des pädagogischen Interesses stehen mittlerweile die Potentiale und Ressourcen, die kindliche Entwicklung schützen und stärken.“
(Opp, Fingerle 2007, S. 07)
Es ist unbestreitbar, dass diese neue Sichtweise Folgen für die Sozialpädagogik nach sich zieht. Und auch die Faszination, die von dem Resilienzbegriff ausgeht, lässt sich nachvollziehen − ändert sich durch die Ergebnisse der Resilienzforschung doch anscheinend grundlegend die bisherige Auffassung von Risiken und deren Folgen für eine Person. Zudem liefern sie Antworten auf die Frage, was Erziehungspersonen dafür tun können, damit Kinder sich positiv entwickeln und Menschen allgemein erfolgreich mit den Widrigkeiten des Lebens umgehen können. Damit würde die Resilienzforschung zu einer Erweiterung der bisherigen Auffassung von der sozialpädagogischen Haltung und der sozialpädagogischen Praxis beitragen.
Doch welche Auswirkungen hat die Resilienzforschung tatsächlich auf die Sozialpädagogik?
Ausschlaggebende Fragen sind hierbei zum einen, wie die Erkenntnisse aus der Resilienzforschung in der sozialpädagogischen Praxis realisiert werden können. Was sind hierbei die für die Herausbildung von Resilienz ausschlaggebenden Potentiale und Ressourcen einer Person und ist es überhaupt möglich Einfluss darauf zu nehmen, dass Menschen resilient werden? Zum anderen stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die Erkenntnisse aus der Resilienzforschung für die Sozialpädagogik als wissenschaftliche Disziplin nach sich ziehen.
Mit der vorliegenden Arbeit wird das Ziel verfolgt, die Bedeutung der Resilienzforschung für die Sozialpädagogik herauszustellen. Hierbei wird zum einen auf die Umsetzbarkeit der Erkenntnisse der Resilienzforschung in der sozialpädagogischen Praxis eingegangen. Zum anderen wird untersucht, ob die Resilienzforschung zu einer sinnvollen Erweiterung der Sozialpädagogik beiträgt. Darin wird einerseits besonders die professionelle Haltung des Sozialpädagogen beleuchtet und andererseits an einem konkreten Beispiel aufgezeigt, wie die Resilienzforschung die Sozialpädagogik beeinflusst.
Um diese Fragen beantworten zu können, wird in einem ersten Schritt das Konzept der Resilienz in seiner Definition, Geschichte und seinen konzeptuellen Grundlagen dargelegt. Anschließend wird das Feld der Sozialpädagogik umrissen. Der Fokus wird hier auf die der Sozialpädagogik inhärenten Ressourcenorientierung gelegt und welche Bedeutung ihr innerhalb dieser zuteil wird. Für einen Bezug der Resilienzforschung auf die Sozialpädagogik im letzten Teil der Arbeit wird der Aspekt der Ressourcenorientierung bedeutsam sein, da die Resilienzforschung sich zu einem großen Teil auf die Ressourcen eines Menschen bezieht. In einem dritten Schritt wird aufgezeigt, wie sich die Erkenntnisse der Resilienzforschung in der sozialpädagogischen Praxis realisieren lassen können. Schließlich wird der Bezug zwischen der Resilienzforschung und der ressourcenorientierten Sozialpädagogik hergestellt: Dabei wird die Bedeutung der Resilienzforschung für die Sozialpädagogik herausgestellt und anhand des Beispiels der Präventionsarbeit veranschaulicht.
Die vorliegende Arbeit ist eine Literaturarbeit, zu deren Bearbeitung Originalliteratur, weiterführende Literatur sowie Ergebnisse von Studien herangezogen werden.
Innerhalb der Arbeit wird, gerade zu Beginn, zumeist der Bezug zu Kindern und Jugendlichen hergestellt. Die Forschung zur Resilienz erstreckt sich bis heute fast ausschließlich über das Kindes- und Jugendalter und welche Faktoren und Merkmale in diesem Zeitraum für das Herausbilden von Resilienz bedeutsam sind. Aus diesem Grunde werden die Erkenntnisse der Resilienzforschung und ihre Bedeutung für die sozialpädagogische Praxis in der vorliegenden Arbeit noch hauptsächlich auf Kinder und Jugendliche bezogen. Jedoch erfolgt im letzten Teil eine Übertragung der Erkenntnisse der Resilienzforschung auf sozialpädagogisches Arbeiten nicht nur mit Kindern und Jugendlichen, sondern auf Klienten der Sozialpädagogik aller Altersstufen.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden zur Bezeichnung unbestimmter Personen, die jeweils weiblich oder männlich sein können, auf die doppelte Schreibweise (männlich/weiblich) verzichtet.
II. Resilienz
Um das Konzept der Resilienz darzustellen, werden in diesem Kapitel zunächst die Definition des Resilienzbegriffs, die Entwicklung der Resilienzforschung sowie die konzeptuellen Grundlagen des Resilienzkonzept erörtert. Anschließend werden ein Resilienzmodell sowie Studien und Vorgehensweisen zur Messung von Resilienz vorgestellt. Schließlich werden die Merkmale von resilienten Personen sowie erste Ansätze zur Resilienzförderung dargelegt.
II.1 Definition
Der Begriff der Resilienz leitet sich von dem englischen Wort „resiliency“ ab und bedeutet übersetzt „Widerstandsfähigkeit“, „Spannkraft“ oder „Elastizität“ (vgl. Wustmann, 2004 S.18). Für das Konzept der Resilienz, wie es heute gebräuchlich ist, wurde das Wort aus dem Englischen übernommen. Es gibt zwar verwandte deutsche Wörter, wie „psychische Widerstandsfähigkeit“, „geistige Beweglichkeit“ oder das bereits gängige Wort der „Stressresistenz“, die der originalen Bedeutung nahe kommen (vgl. ebd., S.18), jedoch haben sie sich nicht innerhalb der Forschung durchgesetzt. Zurückzuführen ist dies auf den Umstand, dass diese Begriffe sich der Bedeutung des Wortes „resiliency“ zwar nähern, sie jedoch die Komplexität der Bedeutung nicht umfassend beschreiben.
Um eine erste (allgemeine) Definition von Resilienz zu geben, bietet sich, besonders in Anlehnung an die Wortbedeutung von ‚resiliency’, folgende an:
Mit Resilienz wird die Fähigkeit eines Organismus beschrieben nach einer (äußeren) Einwirkung zu seinem ursprünglichen Zustand zurückzukehren.
(vgl. Julius, Goetze 2000, S. 294)
Eine Untersuchung, die dem Resilienzkonzept folgt, beinhaltet Folgendes:
- Phänomene der biopsychosozialen Gesundheit trotz hohen Störungsrisikos
- Die Aufrechterhaltung von Kompetenz unter aktueller Belastung
- Die Erholung von Traumata
(vgl. Lösel, Bender 2003, S. 23)
Abstrakt wird Resilienz heute als die Fähigkeit einer Person oder eines sozialen Systems beschrieben, erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und negativen Folgen von Stress umzugehen.
Jedoch gibt es in der Fachwelt eine Reihe verschiedener Definitionsansätze des Resilienzbegriffs, die zum Teil stark variieren. Trotzdem lässt sich im Verlauf der Geschichte der Resilienzforschung eine klare Linie erkennen, wie sich die Definitionen von heute gegenüber früherer entwickelt und abgegrenzt haben:
In den Anfängen der Resilienzforschung wurde bei Kindern das Phänomen beobachtet, dass sie sich trotz hoher Belastungen positiv entwickelten. Zu diesem Zeitpunkt wurde dieses Phänomen noch als Invulnerabilität bezeichnet (vgl. Bender 1995, S.4), als eine Unverletzbarkeit gegenüber Risiken. Jedoch wurde an diesem Begriff bald kritisiert, dass er „eine absolute, stabile und konstitutionell angelegte Personeneigenschaft“ ausdrückt, welche eine Person von Geburt an besitzt (vgl. ebd., S. 05). Zudem wurden mit dem Begriff der Invulnerabilität falsche Assoziationen hervorgerufen. So verband man bald mit ihm das Schlagwort der so genannten „superkids“ (vgl. Kapitel II.2) und die Vorstellung von einer absoluten Immunität der betreffenden Person gegenüber negativen Lebensereignissen.
Mit der Zeit rückte man von der Annahme ab, dass es sich bei diesem Phänomen um ein rein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal handele (vgl. Wustmann 2005, S.193) und man verwendete den semantisch neutraleren Begriff der Resilienz (vgl. Bender 1995, S.05). Gleichermaßen revidierte man die Vorstellung von einem statischen Phänomen, welches in frühen Resilienzmodellen vorherrschte. Heute wird Resilienz als ein dynamischer, transaktionaler Prozess zwischen Person und Umwelt beschrieben (vgl. Wustmann 2005, S.193).
Demzufolge wird Resilienz gegenwärtig übereinstimmend definiert als eine psychische Widerstandsfähigkeit gegen Risikofaktoren, die auf den Menschen einwirken, welche biologische, psychologische und psychosoziale Risiken darstellen können und sich potentiell negativ auf die Entwicklung auswirken können.
(vgl. Wustmann 2004, S. 18)
Um als resilient bezeichnet zu werden, reicht es jedoch nicht aus, sich nur positiv zu entwickeln. Neben der positiven Entwicklung müssen folgende zwei Kriterien erfüllt sein, welche in ungenauen Definitionen zumeist vernachlässigt werden: Zum einen muss eine signifikante Bedrohung für die kindliche Entwicklung bestehen und zum anderen muss eine erfolgreiche Bewältigung der jeweiligen belastenden Lebensumstände stattgefunden haben (vgl. Wustmann 2004, S18; Luthar, Cicchetti, Becker 2000b, S.543). Menschen weisen also keine Resilienz auf, wenn niemals eine wirkliche Bedrohung für ihre Entwicklung bestand, welche das Potenzial aufwies, negativ auf die normale Entwicklung des Kindes einzuwirken (vgl. Masten 2001a, S.228).
Diese Definition impliziert, dass Resilienz nicht angeboren ist, sondern sich mit der Zeit und in Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickelt. Dies wiederum bedeutet aber auch, dass Resilienz keine absolute Widerstandskraft gegenüber belastenden Einflüssen ist, sondern sich über die Zeit verändern kann (vgl. Lösel, Bender 2003, S. 23). Zudem ist Resilienz nicht von Situation zu Situation beliebig übertragbar: Wenn ein Mensch in einem Bereich oder einer Situation resilient ist, heißt es nicht zwangsläufig, dass er im Bezug auf jede andere Situation gleichermaßen resilient ist. So kann ein negatives Lebensereignis sehr wohl vorübergehende Störungen bei resilienten Menschen hervorrufen. Außerdem kann der Grad der Resilienz im Verlauf des Lebens variieren (vgl. Rutter 1985, S. 608).
II.2 Geschichtliche Herkunft/Wurzeln
Die Resilienzforschung entstand in ihren Grundzügen eher zufällig als ein Nebenbefund aus Forschungen zur Psychopathologie, insbesondere der Entwicklungspsychopathologie (vgl. Gabriel 2005, S.209). Seit den späten 50er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts beschäftigten sich Forscher aus dem Bereich der Entwicklungspsychopathologie mit den negativen Auswirkungen von Risikofaktoren auf die kindliche Entwicklung (vgl. Werner,Smith 2001, S.02). In Zusammenhang mit der Forschung und Studien innerhalb der Entwicklungspsychopathologie sind den Forschern immer wieder Kinder aufgefallen, die − entgegen jeder Erwartung − trotz eines immensen Einflusses von Risikofaktoren auf ihre Entwicklung, keine psychischen Störungen entwickelten, sondern psychisch gesund blieben und sich sogar sehr positiv entwickelten (vgl. Fingerle, Freytag et al. 1999, S.303). Einhergehend damit hat es sich immer wieder gezeigt, dass es eine breite Variabilität darin gibt, wie Menschen auf psychosoziale Widrigkeiten reagieren. Durch diese Erkenntnisse wurde das Interesse der Forscher verstärkt darauf gelenkt, was dafür ausschlaggebend ist, dass sich diese Kinder ganz normal entwickeln.
Hinzu kommt eine zu dieser Zeit im Kreise einiger Forscher herrschende Unzufriedenheit mit der überwiegend defizitären Sichtweise auf Kinder, d.h. auf ihre Schwächen und darauf, was sie krank macht. Allmählich wandelte sich die allgemeine Sichtweise (vgl. Howard, Dryden et al. 1999, S.309) und der Fokus der Forschung richtete sich nun auf die inneren Stärken der Kinder.
Ende der 1960er Jahre begründete Redl das Konzept der „egoresiliency“ (vgl. Bender 1995 S.04). Redl überraschte es während seiner klinischen Tätigkeit, dass es Individuen gab, die äußerst traumatische Erfahrungen gemacht hatten, jedoch an diesen nicht „zugrunde“ gingen, sondern sich rasch von diesen erholten und einen erstaunlichen Grad psychischer Gesundheit aufwiesen (vgl. Anthony 1987, S.13; Bender 1995, S.04). Er definiert sein Konzept der egoresiliency durch zwei Aspekte: Zum einen beinhaltet es die Kapazität von Menschen, krankmachendem Druck zu widerstehen und zum anderen, sich in kurzer Zeit selbst und weitgehend ohne fremde Hilfe „von einem temporären Kollaps zu erholen“ (Bender 1995, S.04) und in ein normales oder sogar besonders gut funktionierendes Leben zurückzukehren (vgl. Anthony 1987, S.13; Bender 1995, S.04).
In den frühen 1970er Jahren etablierte sich schließlich die Diskussion über die Merkmale von Kindern, die keine Pathologie aufwiesen, obwohl sie Risiken ausgesetzt waren.
Drei der wichtigsten Vertreter der frühen Resilienzforschung sind Michael Rutter und Norman Garmezy durch ihre Forschung und Ausführungen zu protektiven Faktoren (siehe hierzu Garmezy 1985) sowie Elwyn J. Anthony. Gerade durch die Einführung des „syndrome of the psychopathological invulnerable child“ (Anthony 1987, S. 40) in die Literatur durch Anthony und einhergehend damit der Begriff der ‚Invulnerabilität’, gewann das Resilienzkonzept an Popularität (vgl. Bender 1995, S.05). In einem ersten Schwung von Enthusiasmus über das Resilienzkonzept führt Anthony eine Metapher mit Puppen an: Während einige Puppen aus praktisch unzerbrechlichem Material, wie z.B. Stahl, gemacht sind, bestehen andere Puppen aus anderen, leichter zu zerstörenden Materialien, so wie Plastik oder Porzellan. Die Puppe aus Stahl repräsentiert für ihn das so genannte unverwundbare Kind, „the invulnerable child“ (vgl. Noam, Kia et al 2001, S.209).
Der Begriff der Invulnerabilität gewann schnell an Beliebtheit, selbst wenn mit ihm bald falsche, bzw. irreführende Assoziationen verbunden waren, wie die der „superkids“ (vgl. Bender 1995, S.05), ein Begriff der durch einen im American Journal of Psychiatry erschienenen Artikel geprägt wurde (vgl. Laucht, Esser et al. 1997, S. 262).
Mit der Zeit kehrte man sich von diesem Begriff ab und wandte sich der neutraleren Bezeichnung der Resilienz zu. Im Gegensatz zu dem Begriff der Unverwundbarkeit, welcher eine absolute Immunität gegenüber Risikofaktoren impliziert (vgl. Bender 1995, S.05), beschreibt der Begriff der Resilienz eher den relativen Charakter dieses Phänomens (vgl. Fingerle, Freytag et al. 1999, S.302).
Eine der ersten, umfangreichsten und bedeutendsten Studien zu diesem Thema stammt von Emmy E. Werner und Ruth S. Smith. In ihrer Kauai Studie begleiteten sie seit 1954 etwa 700 Kinder und ihre Familien in ihrer Entwicklung. Die ersten Ergebnisse der Studie veröffentlichten sie 1971 in dem Buch „The children of Kauai“ (vgl. Werner, Smith 1982, S. XIV).
In den 1980er Jahren lag der Schwerpunkt auf der nun explizit genannten Resilienzforschung und Mitte der 1980er wurden die ersten Ergebnisse von weiteren Längsschnittstudien zu diesem Gebiet veröffentlicht.
Festzuhalten bleibt, dass der Resilienzbegriff mit der Zeit in seiner Bedeutung einen Wandel durchlaufen hat. Während er zu Beginn eher eine statische Bedeutung hatte und als ein feststehendes Persönlichkeitsmerkmal angesehen wurde, wird heute die dynamischtransaktionale Dimension des Begriffs betont und Resilienz wird unter dem Aspekt der Wechselwirkung zwischen dem Individuum und seiner Umwelt betrachtet.
II.3 Konzeptuelle Grundlagen
Dem Konstrukt der Resilienz liegen verschiedene konzeptuelle Grundlagen (zumeist aus der Psychologie) zugrunde. Eine zentrale Stellung nehmen hierbei Ergebnisse aus der Risikoforschung und der Forschung zu protektiven Faktoren ein. Denn innerhalb des Resilienzprozesses interagieren Risiko- und Schutzprozesse, die internal und external auf das Individuum einwirken (vgl. Olsson et al 2003). Jedoch spielen auch Ergebnisse aus der Stressforschung, insbesondere der erfolgreichen Bewältigung von Stress, und Konstrukte aus der Salutogenese eine Rolle.
Um zu verdeutlichen, welche Prozesse zu einer Resilienz führen können, werden im Folgenden die Erkenntnisse aus der Risikoforschung, der Forschung zu Vulnerabilitäten und protektiven Prozessen, der Stressforschung und der Salutogenese (vgl. Kapitel II.3.6) dargestellt. Sie liegen in ihrem Zusammenwirken dem Resilienzprozess zugrunde.
II.3.1 Risikoforschung
Die Wurzeln der Risikoforschung mit ihren Konzepten des Risikos und der Risikofaktoren liegen zum einen in der Epidemiologie (beginnend in den 1950er und 1960er Jahren) und der Medizin, zum anderen aber auch in wirtschaftlichen Bereichen, denn insbesondere im Zuge des Versicherungswesens hat die Risikoforschung an Bedeutung gewonnen (vgl. Bender 1995 S. 14; Wolke 2001, S. 277; Laucht, Schmidt et al 2000, S. 323). Die Epidemiologie untersucht die Verteilung von Krankheit in Raum und Zeit sowie die Faktoren, die Krankheit beeinflussen. Da anhand von Risikofaktoren Aussagen über die Auftretenswahrscheinlichkeit von Störungen, beispielsweise in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, getroffen werden können (vgl. Laucht, Schmidt et al 2000, S. 98), hat die Risikoforschung eine wichtige Stellung in der Epidemiologie.
Ziel der Risikoforschung ist es einerseits, Gruppen von Menschen zu identifizieren, deren Entwicklung gefährdet ist und andererseits Lebensbedingungen zu ermitteln, die mit einer Gefährdung der Entwicklung einhergehen (vgl. ebd. S. 98).
II.3.1.1 Risikofaktoren
Als ein Risikofaktor wird ein Merkmal bezeichnet, das eine biologische oder psychologische Gefährdung darstellt, welche die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer Störung bei den Menschen, auf die sie einwirkt, erhöht (vgl. Werner, Smith 1992, S. 03). Zu beachten ist, dass die Definition von Risikofaktoren den potentiellen Effekt dieser Faktoren beinhaltet: Nicht jeder Risikofaktor hat auf jede Person die gleiche Wirkung. Stattdessen wird mit dem Begriff nur die Wahrscheinlichkeit beschrieben, mit der sich ein Risikofaktor auf ein Individuum auswirken kann. So präzisiert auch Wolke: „Die Wahrscheinlichkeit bei Vorliegen eines bestimmten Faktors für ein definiertes nachteiliges Entwicklungsergebnis ist erhöht, jedoch nicht determiniert“ (Wolke 2001, S. 277).
Gerade dadurch, dass das Risikofaktorenkonzept kein kausales sondern ein Wahrscheinlichkeitskonzept ist, besteht keine generelle Einigkeit darüber, „welche Faktoren ein Entwicklungsrisiko darstellen und welche nicht“ (Bender 1995, S. 55).
Jedoch lassen sich Risikofaktoren in zwei große Gruppen einteilen. Zum einen nach Bedingungen, die sich auf biologische oder psychologische Merkmale des Individuums beziehen. Diese Merkmale werden auch als Vulnerabilitätsfaktoren bezeichnet. Zum anderen lassen sie sich nach Bedingungen einteilen, die psychosoziale Merkmale der Umwelt eines Individuums betreffen, welche wiederum auch Stressoren genannt werden (vgl. Laucht, Schmidt et al 2000, S. 98; Petermann, Niebank et al 2004, S. 323).
Des Weiteren lassen sich Risikofaktoren, laut Scheithauer und Petermann, nach folgenden Kriterien unterscheiden: Risikofaktoren können einerseits aus Faktoren bestehen, die sich nicht verändern oder nicht verändern lassen (wie beispielsweise das Geschlecht eines Kindes). Solche Faktoren sind so genannte „Fixe Marker“. Andererseits können auch Faktoren vorliegen (wie das Alter einer Person), die sich von selbst verändern oder verändern lassen. Handelt es sich um Letztere, spricht man von „Variablen Faktoren“ (vgl. ebd., S. 323).
Daneben wird eine Unterscheidung zwischen diskreten und kontinuierlichen Risikofaktoren getroffen. Es gibt Risikobedingungen, die sich nur zu bestimmten Zeitpunkten auf eine Person auswirken − die diskreten Risikofaktoren. Im Gegensatz dazu beeinflussen kontinuierliche Faktoren den gesamten Entwicklungsverlauf einer Person (vgl. Wustmann 2004, S. 37).
Ein weiteres Kriterium zur Unterscheidung von Risikofaktoren liegt darin, ob sie proximal oder distal wirken. Proximale Risikofaktoren sind näher umschriebene Bedingungen, die für gewöhnlich direkte negative Auswirkungen auf ein Kind haben (vgl. Petermann, Niebank et al 2004, S.324). Hierunter fallen unter anderem Streitigkeiten der Eltern oder ungünstige Erziehungspraktiken (vgl. Wustmann 2004, S. 37). Distale Risikofaktoren wirken sich eher indirekt über Mediatoren (z. B. über das Verhalten der Mutter oder die ElternKindInteraktion) aus und bilden nur eine „grobe Kategorie“ von Bedingungen, mit denen keine direkte Verknüpfung zu einem negativen Entwicklungsergebnis hergestellt werden kann. Distale Faktoren werden so z.B. von einem Kind nicht direkt erfahren, sondern werden durch proximale Faktoren, die hierbei als Mediatoren agieren, vermittelt (vgl. Baldwin, Baldwin et al. 1990, S. 258; Bender, Lösel 1998, S. 120).
Baldwin et al. sehen distale und proximale Faktoren als die Enden eines Kontinuums an. Innerhalb dieses Kontinuums lassen sich die verschiedenen distalen oder proximalen Faktoren nach der Stärke ihrer Effekte auf eine Person anordnen (Baldwin, Baldwin et al. 1990, S. 258). Wenn eine Familie beispielsweise Armut ausgesetzt ist, so ist dies für das Kind der Familie ein distaler Risikofaktor − er hat zunächst keine negativen Auswirkungen auf das Kind. Aus dem Risikofaktor der Armut kann es sich ergeben, dass beispielsweise die Mutter ängstlich und besorgt ist. Mit diesem Verhalten liegt die Mutter nun auf dem Kontinuum zwar noch auf der distalen Seite, bewegt sich jedoch schon hin zur proximalen Seite. Jedoch ist erst das direkte Verhalten der Mutter in der Interaktion mit dem Kind ein wirklich proximaler Faktor: Wenn sie zum Beispiel durch ihre Ängstlichkeit Gereiztheit gegenüber ihrem Kind zeigt oder es übermäßig in Schutz zu nehmen versucht. Dieses Verhalten stellt somit den eigentlichen Risikofaktor für das Kind dar, welcher negative Auswirkungen nach sich ziehen kann.
Fehlen jedoch die proximalen Faktoren als Mediatoren, so haben die distalen Faktoren keine Auswirkungen auf die Person. Auf das Konzept der Resilienz bezogen bedeutet dies, dass Kinder unter Umständen fälschlicherweise als resilient bezeichnet werden können. Das ist der Fall, wenn man glaubt, dass sie unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen sind, sie jedoch in der Realität zwar in Familien lebten, die Risiken ausgesetzt waren, diese auf das Kind aber nur distal wirkten und nicht proximal. Somit sind diese Kinder nicht zwangsläufig resilient, stattdessen sind sie einfach nur einem geringeren Risiko ausgesetzt als Kinder, die beiden Risiken, den distalen und proximalen, ausgesetzt sind (vgl. Rutter 1996, nach Bender, Lösel 1998, S. 120).
Eine bedeutsame Eigenschaft von Risikofaktoren besteht darin, dass sie eine große Heterogenität in ihren Risikoeffekten aufweisen (vgl. Laucht, Schmidt et al 2000, S. 102). Nicht jeder Risikofaktor wirkt sich gleich auf jede Person aus, es kann sogar sein, dass einund derselbe Faktor sich auf die eine Person negativ auswirkt und bei einer anderen Person überhaupt keine Wirkung zeigt. Somit sind Risikofaktoren „multifinal“ (Wustmann 2004, S. 44). Zudem können bestimmte Faktoren in einer Situation als Risikofaktoren auftreten, in einer anderen Situation aber vollkommen anders wirken (neutral oder als Schutzfaktor). Deshalb geht man dazu über, Risikofaktoren nicht nur isoliert zu betrachten, sondern den Fokus auf Risikomechanismen zu legen, welche der Risikowirkung zu Grunde liegen (vgl. Rutter 1993, S. 627).
II.3.1.2 Wirkungsweise von Risikofaktoren
Wie sich in den obigen Ausführungen gezeigt hat, weisen Risikofaktoren verschiedenste Merkmale auf. Ebenso ist schon ein erstes Wirken von Risikofaktoren im Zusammenhang mit diesen Merkmalen angeklungen. Jedoch gibt es noch weitere Merkmale und Bedingungen, die einen Einfluss darauf haben, wie Risikofaktoren wirken.
In Untersuchungen zu Risikofaktoren und ihrer Wirkungsweise hat es sich gezeigt, dass Risikofaktoren selten isoliert auftreten, sondern meistens mehrere Risikofaktoren zusammen auftreten und kumulieren, man spricht hier von einer Risikokumulation (vgl. Laucht, Schmidt et al. 2000, S. 100; Scheithauer, Petermann 1999, S. 05). Risikofaktoren stehen daher nicht alleine, sie sind vielmehr als „Indikatoren für Konstellationen von Risiken zu begreifen“ (Laucht, Schmidt et al 2000, S. 100). Laucht et al. nennen als Beispiel den Risikofaktor „psychische Erkrankungen der Mutter“ und erläutern, dass sich aus diesem Faktor weitere Risikofaktoren ergeben können, so dass „neben der Mutter das gesamte Familiensystem beeinträchtigt ist“ (z.B. durch psychische Erkrankung des Vaters, disharmonische Partnerbeziehung, etc.) (ebd., S. 100).
Bei Risikokumulationen sind die Entwicklungsergebnisse häufig schlechter (vgl. Masten 2001, S. 196). Rutter präzisiert, dass die Wahrscheinlichkeit eine Störung zu entwickeln bei Kindern, die nur einem Risikofaktor ausgesetzt sind, nicht höher ist als bei Kindern, die keinem Risikofaktor ausgesetzt sind (vgl. Segal 1983, S. 308). Treten jedoch mehrere Risikofaktoren zusammen auf, erhöht sich das Risiko immens: „the stresses potentiated each other so that the combination of chronic stresses provided very much more than a summation of the effects of the separate stresses considered singly“ (ebd. S. 308).
Ungünstige Bedingungen, denen eine Person in frühen Jahren ausgesetzt ist, wirken sich oft nicht sofort negativ aus, sondern „steigern die Wahrscheinlichkeit für weitere risikoerhöhende Bedingungen zu einem späteren Zeitpunkt“ (Wustmann 2004, S. 41). Von Bedeutung ist hier auch die Chronizität der negativen Einflüsse. Das chronische Auftreten von Belastungen wirkt sich stärker negativ aus (vgl. Segal 1983, S. 308), als „akute, negative Lebensereignisse“ (Scheithauer, Petermann 1999, S. 09). Wenn zu chronischen Belastungen zusätzlich akute negative Lebensereignisse auftreten, so wirken diese additiv zusammen (vgl. ebd, S. 09).
Zudem sind Risikofaktoren altersabhängig. Allgemein wird davon ausgegangen, dass biologische Risiken mit dem Alter an Bedeutung verlieren, psychosoziale Risiken hingegen in ihrer Bedeutung steigen (vgl. Laucht, Schmidt et al. 2000, S. 101). So schreiben Laucht et al.: „Unter den psychosozialen Risiken dominieren in der Kindheit familiäre Risiken, die im weiteren Verlauf der Entwicklung von Risiken aus dem schulischen Bereich, aus dem Freundeskreis und der jugendlichen Subkultur abgelöst werden“ (ebd., S. 101). Entscheidend bei der Wirkung von Risikofaktoren sind die Fähigkeiten eines Menschen mit ihnen umzugehen. Diese Fähigkeiten variieren mit dem Alter. Ein Kind hat beispielsweise noch ganz andere Möglichkeiten mit Belastungen umzugehen als ein Jugendlicher.
Neben dem Alter spielt auch das Geschlecht eine Rolle. Studien haben gezeigt, dass im Allgemeinen Jungen in der Kindheit für Belastungen anfälliger sind, Mädchen hingegen eher in der Adoleszenz (vgl. ebd, S. 101).
II.3.2 Vulnerabilität
Damit Risikofaktoren eine negative Wirkung auf eine Person haben, muss in den meisten Fällen eine Vulnerabilität bei einer Person vorausgesetzt sein (vgl. Wustmann 2004, S. 36).
Der Begriff der Vulnerabilität stammt aus dem medizinischen und psychiatrischen Sprachgebrauch und bedeutet „erhöhte Verletzlichkeit“ (Bender 1995, S. 18). Vulnerabilität wird allgemein als eine „individuell erhöhte Empfindlichkeit oder Bereitschaft, psychische Erkrankungen zu entwickeln“ (Fingerle 2000, S. 287) beschrieben. Das Konzept der Vulnerabilität zeigt eine starke Ähnlichkeit zu dem der Risikofaktoren, unterscheidet sich aber darin, dass es sich auf die ‚Verletzbarkeit’ einer Person bezieht (vgl. Bender 1995, S. 19; Petermann, Niebank et al. 2004, S. 326). Trotzdem werden die Begriffe der Vulnerabilitätsfaktoren und der Risikofaktoren oft (aufgrund mangelnder Definitionsleistungen) synonym verwendet.
Bender beschreibt, dass das Vulnerabilitätskonzept aktuell zwei Bedeutungen umfasst: Zum einen eine Prädisposition für eine spezifische Krankheit und zum anderen eine allgemeine Empfänglichkeit für Stress (vgl. Bender 1995, S. 19).
Man unterscheidet zwischen primären und sekundären Vulnerabilitäten. Primäre Vulnerabilitäten sind angeborene und während der Schwangerschaft, Geburt und frühen Kindheit erworbene Charakteristika. Sekundäre Vulnerabilitäten sind Charakteristika, die während der weiteren Entwicklung erworben werden (vgl. Bender 1995, S. 21).
Innerhalb des Vulnerabilitätskonzepts wird zwischen der Vulnerabilität und verschiedenen Vulnerabilitätsfaktoren differenziert. Der Begriff der Vulnerabilität beschreibt ein erhöhtes Erkrankungsrisiko und die dahinter stehenden Ursachen. Vulnerabilitätsfaktoren hingegen bezeichnen „Konstrukte, die ein Erkrankungsrisiko erhöhen oder sogar erst entstehen lassen“ (Fingerle 2000, S. 288). Die Konstrukte stellen hier psychische Strukturen dar, „die dazu führen, dass eine Person Umweltreize in einer Weise verarbeitet, die sich entweder direkt als ungünstiges oder dysfunktionales Verhalten äußert, oder solches Verhalten nach sich zieht“ (ebd., S. 288). Es gibt biologische Vulnerabilitätsfaktoren, welche prä- bis postnatale Beeinträchtigungen der kindlichen Entwicklung beinhalten (so wie genetische Faktoren, Frühgeburtlichkeit etc.) und es gibt psychosoziale Vulnerabilitätsfaktoren (wie z. B. ein negatives Selbstkonzept, unsichere Bindungserfahrungen oder inadäquate CopingStile) (vgl. ebd., S. 290f).
Anthony klassifiziert in einer frühen Arbeit zu der Vulnerabilität von Menschen vier Kategorien von Individuen bezüglich ihrer Vulnerabilität. Danach gibt es die (1) ‚Hypervulnerablen’, die sogar „normalen“ und vorhersehbaren Lebensereignissen „erliegen“, die (2) ‚Pseudoinvulnerablen’, womit er vulnerable oder äußerst vulnerable Individuen beschreibt, die mit einer überbeschützenden Umgebung „gesegnet“ waren und sich dadurch relativ unbehelligt entwickeln konnten. Jedoch scheinen sie nur invulnerabel zu sein, da sie in ihrer Entwicklung keinen wirklichen Gefährdungen ausgesetzt waren. Daneben gibt es die (3) ‚Vulnerablen’ mit erworbener Resilienz, die Traumata ausgesetzt sind oder waren, aber von jedem Stress, dem sie ausgesetzt sind, ‚abfedern’ und mit jeder solchen Erfahrung resilienter werden und die (4) ‚NichtVulnerablen’, die von Geburt an robust erscheinen und sich in jeder Umgebung gut entwickeln (vgl. Anthony 1987, S. 27f). Diese Ausführungen implizieren, dass es sich bei dem Konstrukt der Vulnerabilität um ein Kontinuum handelt, mit den beiden Polen der „totalen Vulnerabilität“ und der „Invulnerabilität“ (vgl. Bender 1995, S. 21). Diese Sichtweise hat sich mit der Zeit geändert und man nimmt heute nicht mehr an, dass eine Person vollkommen invulnerabel sein kann, sondern geht davon aus, dass jeder Mensch größere oder kleinere Vulnerabilitäten besitzt (vgl. ebd., S. 21).
Innerhalb des Vulnerabilitätskonzepts liegt das Augenmerk auch auf den so genannten „Phasen erhöhter Vulnerabilität“:
Vulnerabilität wird nicht nur als ein statisches, unveränderbares Persönlichkeitsmerkmal angesehen. Innerhalb der Entwicklung kann sich die Vulnerabilitätsschwelle verändern (vgl. Fingerle 2000, S. 291). So gibt es Phasen in der Entwicklung, in denen die Vulnerabilitätsschwelle besonders niedrig liegt. Das ist insbesondere bei Entwicklungsübergängen (Transitionen) der Fall. Wenn eine Person von einem Entwicklungsstatus in den nächsten übergeht, so ist diese Zeit davon gekennzeichnet, dass z.B. bestehende Gewohnheiten und Beziehungen gelockert werden oder sogar zerbrechen. Gleichzeitig dazu müssen eine Reihe von Entwicklungsanforderungen gemeistert werden (vgl. Petermann, Niebank et al. 2004, S. 326). Solche Phasen wirken vulnerabilitätserhöhend und ein Individuum ist in dieser Zeit besonders anfällig für Risiken, die auf es einwirken.
II.3.3 Forschung zu Schutzfaktoren
Das Interesse an Schutzfaktoren, die in der Entwicklung des Menschen eine Rolle spielen, ist noch jüngeren Datums. Die Suche nach Schutzfaktoren in der Entwicklung resultierte aus Ergebnissen der Risikoforschung, innerhalb derer festgestellt wurde, dass bestimmte Faktoren oder Mechanismen Risikobelastungen entgegenwirken. Das Interesse an diesem Gebiet als Forschungsthema hat sich erst in den letzten 15 Jahren etabliert (vgl. Petermann, Niebank et al. 2004, S. 343). Demzufolge liegen heute erst vergleichsweise wenig gesicherte Erkenntnisse darüber vor, was Schutzfaktoren sind und wie sie wirken. Dennoch stellt die Forschung nach Schutzfaktoren eine bedeutsame Erweiterung der traditionellen Risikoforschung dar (vgl. Lösel, Bender 2007, S. 57).
Die Forschung zu Schutzfaktoren erfolgt zumeist auf drei Wegen. Es werden (1) epidemiologische Kohortenlängsschnittstudien herangezogen, (2) große repräsentative Stichproben von Bevölkerungen, die „sehr ungewöhnlichen und bedrohlichen Situationen oder Umständen ausgesetzt waren“ (Petermann, Niebank et al. 2004, S. 343) und (3) kleine Stichproben ausgesuchter Individuen mit hohem Risiko werden betrachtet, „denen eine erhöhte Vulnerabilität für eine psychische Störung zugeschrieben wird“ (ebd., S. 343).
Es ist zwar zu früh um ein umfassendes theoretisches Konstrukt aufzustellen, jedoch lassen sich bereits bestimmte Rückschlüsse zur Definition, Vorstellung und Wirkung von Schutzfaktoren aus der bisherigen Forschung ziehen (vgl. Rutter 1985, S. 605).
II.3.3.1 Definition
Nach einer Definition von Rutter modifizieren, verbessern oder verändern Schutzfaktoren die Reaktion einer Person auf Risiken aus ihrer Umgebung, die wahrscheinlich zu einem negativen Entwicklungsergebnis geführt hätten (vgl. Rutter 1985, S. 600). Es sind also „Faktoren, die die potentiell schädlichen Auswirkungen von Belastungen verhindern oder ausgleichen können“ (Laucht, Schmidt et al. 2000. S.103).
Wustmann schreibt:
„Risikomildernden bzw. schützenden Bedingungen kommt eine Schlüsselfunktion im Prozess der Bewältigung von Stress- und Risikosituationen bei. Sie fördern die Anpassung eines Individuums an seine Umwelt bzw. erschweren die Manifestation einer Störung. Schützende Bedingungen erhöhen also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind gegenüber Belastungen besser gewappnet ist und erfolgreicher mit Problemsituationen umgehen kann. Sie scheinen die negativen Effekte der Risikobelastung abschwächen, kompensieren bzw. aufheben zu können . “
(Wustmann 2004, S. 46)
Hierbei unterteilt man grob zwei verschiedene Arten von Schutzfaktoren: Einerseits so genannte „Personale Ressourcen“, welche Schutzfaktoren in der Person des Kindes darstellen, und andererseits „Soziale Ressourcen“, welche Schutzfaktoren in der Umwelt einer Person bezeichnen (vgl. Laucht, Esser et al. 1997, S. 262). Scheithauer und Petermann differenzieren noch weiter in kindbezogene Faktoren, umweltbezogene Faktoren und in Resilienzfaktoren (vgl. Scheithauer, Petermann 1999, S. 09). Zudem kann man die Schutzfaktoren drei Einflussbereichen zuordnen: Dem Kind, seiner Familie und dem außerfamiliären sozialen Umfeld (vgl. Wustmann 2004, S. 46).
Garmezy macht drei große Gruppen von Variablen aus, die als Schutzfaktoren agieren. Darunter fallen: Charakteristika des Kindes (wie sein Temperament und seine kognitiven Eigenschaften), Familien die sich durch Wärme, Kohäsion und Struktur auszeichnen und die Verfügbarkeit von externalen Unterstützungssystemen (vgl. Sameroff, Gutman et al. 2003, S. 377). Wustmann weist darauf hin, dass diese Bereiche nicht isoliert voneinander betrachtet werden dürfen, „sie sind vielmehr miteinander verwoben und unterliegen gegenseitigen Wechselwirkungen“(Wustmann 2004, S. 46).
Viele der Schutzfaktoren sind schon aus der Risikoforschung bekannt (vgl. Laucht, Esser et al. 1997, S. 262), nur mit dem Unterschied, dass sie innerhalb des Konzepts der Schutzfaktoren genau gegenteilige Merkmale von Risikofaktoren bezeichnen. Ein und derselbe Faktor kann so gesehen entweder als Schutzfaktor oder als Risikofaktor wirken. So kann beispielsweise ein hohes Selbstwertgefühl als Schutzfaktor agieren, ein geringes Selbstwertgefühl hingegen als Risikofaktor (vgl. Rutter 1990, S. 182). Es besteht sogar die Gefahr, dass Schutzfaktoren als das Fehlen von Risikofaktoren beschrieben werden. Genau bei dieser Art von Definition wird von verschiedenen Autoren zur Vorsicht gemahnt, da es ihrer Ansicht nach falsch wäre, Schutzfaktoren nur danach zu bestimmen, dass sie die „Kehrseite einer Medaille“ bezeichnen (vgl. Laucht, Esser et al. 1997, S. 263; Rutter 1990, S. 182). Mittlerweile besteht jedoch Einigkeit darüber, dass Schutzfaktoren nicht nur durch das bloße Fehlen von Risiken definiert werden können, worauf im folgenden Kapitel noch näher eingegangen wird.
Die genannten Unklarheiten in der Definition weisen auch auf das Problem der noch zu ungenauen Abgrenzung der Schutzfaktoren von den Risikofaktoren hin, welche durch weitere Forschung auf diesem Gebiet noch auszudifferenzieren ist.
II.3.3.2 Wirkungsweise von Schutzfaktoren
Nach Rutter moderieren protektive Faktoren die schädlichen Wirkungen eines Risikofaktors, indem sie die pathogene Wirkung vorhandener Risiken vermindern (vgl. Lösel, Bender 1996, S.303; Laucht, Esser et al. 1997, S. 265). Er betont aber auch, dass protektive Faktoren besonders oder ausschließlich dann wirken, wenn eine Gefährdung vorliegt. Wenn das nicht der Fall ist, also kein Risiko vorhanden ist, dann sind auch die Schutzfaktoren nicht von Bedeutung und es geht von ihnen keine protektive Wirkung aus (vgl. Rutter 1990, S. 185; Wustmann 2004, S. 45; Laucht, Esser et al. 1997, S. 265). Hierin wird auch der Unterschied zwischen Risikofaktoren und Schutzfaktoren deutlich: Während Risikofaktoren direkt negative Auswirkungen nach sich ziehen können, wirken Schutzfaktoren indirekt und ihre Wirkungsweise wird erst in der Wechselwirkung mit Risikofaktoren deutlich (vgl. Rutter 1990, S. 188).
Wenn sich ein Faktor positiv auswirkt, unabhängig davon, ob ein Risiko vorliegt, spricht man anstatt von einem Schutzfaktor von einer generellen entwicklungsförderlichen Bedingung (vgl. Wustmann 2004, S. 45). Rutter fügt dieser Konzeptualisierung von Schutzfaktoren hinzu, dass diese nicht allein aus einer positiven Erfahrung bestehen, die eine Person macht. Stattdessen nennt er drei Charakteristika von Schutzfaktoren:
- 1. Schutzfaktoren müssen nicht aus einem angenehmen Ereignis bestehen. Unter bestimmten Umständen können unangenehme und potentiell gefährdende Ereignisse eine Person abhärten. Diesen Effekt benennt Rutter mit dem so genannten „steeling effect“ von Stressoren.
- 2 Im Gegensatz zu einer ‚normalen’ förderlichen Erfahrung, die meist zu einem direkten Vorteilseffekt für die Person führt, sind bei einem Schutzfaktor oft keine sichtbaren Effekte festzustellen. Die Wirkung eines Schutzfaktors zeigt sich nämlich nur, wenn ein Stressor auftritt; fehlt der Stressor, zeigt sich in dieser Zeit auch kein Effekt des Schutzfaktors, selbst wenn er in der Person vorhanden ist. Rutter weist hierbei darauf hin, dass es nicht die Rolle des Schutzfaktors ist, eine normale Entwicklung im direkten Sinne zu fördern, sondern vielmehr die Reaktion auf einen späteren Schaden zu modifizieren, sobald ein Stressor auftritt.
- 3 Schließlich betont Rutter, dass ein Schutzfaktor überhaupt keine Erfahrung an sich sein muss, sondern auch allein eine Eigenschaft einer Person betreffen kann. Hierunter fällt beispielsweise das Geschlecht einer Person.
(vgl. Rutter 1985, S. 600)
Ebenso wie Schutzfaktoren nur wirken, wenn ein Risiko vorliegt, bedeutet dies auch, dass das bloße Fehlen von Risikofaktoren nicht als ein risikomildernder Faktor angesehen werden kann (vgl. Scheithauer, Petermann 1999, S. 11).
Für die Definition und das Ausmachen von Schutzfaktoren ist es zudem wichtig, die zeitliche Komponente im Wirken zu berücksichtigen. Schutzfaktoren puffern Risiken, die auf ein Individuum treffen, ab und gewährleisten dadurch eine positive Entwicklung. Um diese Funktion zu erfüllen, müssen Schutzfaktoren schon vor dem Eintreten des Risikos vorhanden sein und müssen also „zeitlich vor den risikoerhöhenden Faktoren in Erscheinung“ (ebd., S. 11) getreten sein.
Garmezy, Masten und Tellegen stellen die Hypothese auf, dass Schutzfaktoren durch drei verschiedene Mechanismen wirken. Zu den drei Mechanismen gehören das von ihnen so genannte Kompensationsmodell, das Herausforderungsmodell und das Immunisierungsmodell.
Bei dem Kompensationsmodell addieren sich Stressfaktoren und Schutzfaktoren und führen zu einem bestimmten Entwicklungsergebnis. Hierbei kann durch das Überwiegen von Schutzfaktoren Stress entgegengewirkt werden.
Mit dem Herausforderungsmodell wird davon ausgegangen, dass Stress potentiell Kompetenzen fördern kann, allerdings unter der Voraussetzung, dass der Stressgrad nicht zu hoch ist. Die Beziehung zwischen einem Stressfaktor/Risikofaktor und einem Schutzfaktor kann hier kurvenförmig verlaufen: Je höher der Stressfaktor, desto höher kann auch die Wirkung des Schutzfaktors sein.
Das von Garmezy, Masten und Tellegen genannte Immunisierungsmodell deckt sich mit den Ausführungen Rutters zur Wirkungsweise von Schutzfaktoren. Innerhalb dieses Modells wird davon ausgegangen, dass Schutzfaktoren Risikofaktoren moderieren und bei Abwesenheit von Risikofaktoren nicht wirksam sind (vgl. Garmezy, Masten und Tellegan, nach Werner 2000, S. 116).
Werner weist darauf hin, dass diese drei Modelle sich nicht gegenseitig ausschließen sondern gleichzeitig oder nacheinander wirken können (vgl. Werner 2000, S. 116). Werner betont auch, dass Schutzfaktoren, ebenso wie Risikofaktoren, kumulieren und sich gegenseitig verstärken können (vgl. Wustmann 2004, S. 47).
II.3.3.3 Ausblick
Neuere Ansätze zur Beschreibung von Schutzfaktoren sehen diese nicht als einen feststehenden Faktor an, sondern legen Wert auf das Zusammenwirken von Schutzfaktoren und anderen Bedingungen. In diesem Zusammenhang wird nunmehr anstatt von Schutzfaktoren von Schutzmechanismen gesprochen. Kühl sagt dazu:
„Zwischen bestimmten Merkmalen eines Kindes einerseits, und Bedingungen seiner Umwelt andererseits, bestehen von Anfang an im Prozess der Entwicklung Wechselwirkungen, die im Einzelfall und situationsgebunden als Stärke des Kindes erscheinen können, widrigen Umweltbedingungen zu trotzen. Wenn man Entwicklung als einen dynamischen Prozess betrachtet, so bleibt <der Faktor> nicht von sich aus <stabil>, sondern erfährt in den alltäglichen Austauschprozessen seine zunehmende Stabilisierung, Entfaltung und Differenzierung“.
(Kühl 2003, S.53f)
II.3.4 Modelle der Wechselwirkung von Risiko- und Schutzfaktoren
Das Risikokonzept und das Schutzfaktorenkonzept bilden im Zusammenhang mit dem der Vulnerabilität grundlegende Konzepte der Resilienzforschung. Risikofaktoren und Schutzfaktoren sind die Konstrukte, die dem der Resilienz zugrunde liegen. Aus ihrer Wechselwirkung heraus ergibt sich ein bestimmtes Entwicklungsergebnis, welches sich je nach Ausgang als Resilienz erweisen kann. Die Frage hierbei ist, welche Prozesse dafür ausschlaggebend sind, dass sich ein Mensch zu einer resilienten Person entwickelt.
Als Basis dienen verschiedene Modelle, aufbauend auf den Modellen der Wirkungsweise von Risiko- und Schutzfaktoren, die diese (Wirkungsweise von Risiko- und Schutzfaktoren) in ihrer Interaktion erklären. Dazu gehören das Kompensationsmodell, das Modell der Herausforderung, das Modell der Interaktion und das Modell der Kumulation, welche im Folgenden dargestellt werden.
Modell der Kompensation
Das Kompensationsmodell geht davon aus, dass „das Ausmaß des risikoerhöhenden Faktors durch den risikomildernden Faktor kompensiert werden kann“ (Wustmann 2004, S. 57). Dabei besteht keine direkte Wechselwirkung zwischen dem Risikofaktor und dem Schutzfaktor, sie wirken eher unabhängig voneinander auf das Entwicklungsergebnis. Je mehr Schutzfaktoren vorhanden sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit ihnen Risikofaktoren ausgeglichen werden können. Je geringer die Schutzfaktoren sind, desto eher ist es möglich, dass Risikofaktoren eine negative Wirkung auf eine Person haben.
Innerhalb des Kompensationsmodells differenziert man zwei Arten von Modellen. Das erste Modell ist das HaupteffektModell. Nach diesem Modell wirken Schutz- und Risikofaktoren sich direkt auf die Entwicklung einer Person aus. Das zweite Modell ist das bereits erläuterte MediatorenModell, bei dem die Risiko- und Schutzfaktoren indirekt auf eine Person wirken. Demzufolge liegt bei diesem Modell der Schwerpunkt auf dem Mediator.
Modell der Herausforderung
Das Herausforderungsmodell legt den Fokus auf die Fähigkeiten, die bei einer erfolgreichen Bewältigung von Risikobedingungen gewonnen werden (vgl. Werner 2000, S. 116). Bei der erfolgreichen Bewältigung von auftretenden Risiken oder auftretendem Stress werden Kompetenzen gewonnen, welche für zukünftig anstehende Bewältigungsaufgaben von Nutzen sein können. Man versucht hier die Risikobedingungen als Herausforderung zu sehen, die es zu bewältigen gilt.
Modell der Interaktion
Das Modell der Interaktion geht von der Eigenschaft der Schutzfaktoren aus, dass sie mit Risikobedingungen in einer „interaktiven Beziehung“ (Wustmann 2004, S. 60) stehen. Sie werden nur wirksam, wenn ein Risiko vorliegt. Die Schutzfaktoren können ein auftretendes Risiko abschwächen und moderieren somit seine Auswirkungen. Dies hat zur Folge, dass Risikofaktoren nur indirekt auf eine Person einwirken.
Modell der Kumulation
Das Modell der Kumulation sagt aus, dass es auch von der Anzahl der Risiko- und Schutzfaktoren abhängt, wie diese auf eine Person wirken. Die Effekte von Risikofaktoren, ebenso wie die Effekte von Schutzfaktoren, können sich addieren. Je mehr Risiko- bzw. Schutzfaktoren aufeinander treffen, also kumulieren, desto stärker ist auch ihre Wirkung. Hinzu kommt, dass eine höhere Belastung besteht, je mehr Risikofaktoren gemeinsam gegenüber wenigen Schutzfaktoren auftreten. Es gilt: Je höher die Anzahl der Schutzfaktoren und je kleiner die der Risikofaktoren, desto geringer ist die Belastung.
II.3.5 Das transaktionale Stressmodell nach Lazarus
Neben der Risikoforschung und der Forschung nach protektiven Faktoren sowie ihrem Zusammenwirken ist ein weiteres dem Konzept der Resilienz zugrunde liegendes Element, die Frage nach dem Auftreten, Bewältigen und den Auswirkungen von Stress, der auf eine Person einwirkt. Obwohl es zu der Entstehung und Bewältigung von Stress zwar zahlreiche Modelle gibt, werden sich im Folgenden die Ausführungen auf das transaktionale Stressmodell, wie es von Lazarus beschrieben wurde, beschränken:
Lazarus beschreibt in seinem transaktionalen Stressmodell, dass die Entstehung von Stress immer von zwei Komponenten abhängig ist: Zum einen von den Anforderungen, die an einen Menschen gestellt werden, und zum anderen von den Fähigkeiten, die ein Mensch besitzt, um diesen Anforderungen entgegenzuwirken. Sobald die an die Person gerichteten Anforderungen deren Fähigkeiten zur Bewältigung beanspruchen oder übersteigen, können sich daraus stressende Konsequenzen ergeben (Lazarus, Launier 1981, S. 226). Maßgeblich in diesem Modell sind jedoch nicht nur die Anforderungen und Bewältigungsmöglichkeiten, sondern auch die subjektive Bewertung, die die Person diesen beiden Komponenten zuschreibt. Hierauf wird im nächsten Kapitel näher eingegangen.
Die beiden Komponenten der Anforderung und der Bewältigungsmöglichkeiten wirken nicht unabhängig voneinander, vielmehr stehen sie in einer gegenseitigen Interaktion. Das bedeutet, dass nicht nur die Umwelt den Menschen beeinflusst, sondern der Mensch auch durch seine Reaktionen Einfluss auf die Umwelt nimmt.
Es hängt von dieser Beziehung zwischen Person und Umwelt ab, ob Stress entsteht oder nicht. Sobald die Transaktionen zwischen Mensch und Umwelt nicht mehr im Gleichgewicht sind, entsteht Stress. Das kann zum Beispiel passieren, wenn eine Situation eine hohe Anforderung an jemanden stellt und dieser nicht über genug Möglichkeiten verfügt um diese zu bewältigen.
II.3.5.1 Primäre und sekundäre Bewertung
Ob Transaktionen als stressend empfunden werden, hängt zu einem großen Teil davon ab, wie Ereignisse und Reize aus der Umwelt von einem Menschen bewertet werden. Lazarus unterscheidet hier zwischen primärer und sekundärer Bewertung (vgl. Lazarus, Launier 1981, S. 233 und 239):
Die primäre Bewertung bezieht sich auf die Bedeutung, die die Person den Auswirkungen eines Ereignisses auf ihr Wohlbefinden zuschreibt. Hierbei gibt es drei Möglichkeiten, wie ein Ereignis bewertet werden kann. Es kann entweder als irrelevant, als günstig (positiv) oder als stressend (negativ) bewertet werden (vgl. ebd., S. 233).
Wenn ein Ereignis als irrelevant angesehen wird, so hat es keinerlei Auswirkung auf das Wohlbefinden der Person. Wenn ein Ereignis als günstig/positiv bewertet wird, so wird es als „ein Zeichen für Sicherheit oder für eine positive Lage der Dinge“ (ebd., S. 234) angesehen. In diesem Falle ist für die Person alles in Ordnung und sie kann sich entspannen. Ein Ereignis kann aber auch als stressend bewertet werden, und zwar dann, wenn das besagte Ereignis als eine Schädigung oder ein Verlust (das ist der Fall, wenn eine Schädigung bereits eingetreten ist) angesehen wird oder als Bedrohung empfunden wird (das ist der Fall, wenn die Schädigung oder der Verlust noch nicht eingetreten sind, aber bevorstehen). Eine Schädigung oder ein Verlust kann zum Beispiel in dem Tod eines geliebten Menschen bestehen. Dieser Verlust kann gleichzeitig auch als Bedrohung empfunden werden, z.B. wenn der Partner gestorben ist und man unsicher in Bezug auf die eigene Zukunft ohne ihn ist.
Andererseits kann ein Ereignis, wenn es als stressend bewertet wird, auch als eine Herausforderung gesehen werden. Im Falle der Herausforderung wird die Transaktion nicht als potentielle Schädigung bewertet. Stattdessen werden vielmehr der Nutzen, den die Person daraus ziehen kann, oder ihre Meisterung sowie die damit einhergehenden positiven Folgen wahrgenommen. Ein Ereignis als Herausforderung zu sehen, ist die wohl günstigste Form von Stress. Gerade die Herausforderung hängt stark von den einwirkenden Anforderungen ab und davon, in wieweit die Person von ihren persönlichen Bewältigungsmöglichkeiten überzeugt ist.
Die sekundäre Bewertung bezieht sich auf die verfügbaren Bewältigungsfähigkeiten und -möglichkeiten einer Person. Es geht darum, wie die Person ihre Bewältigungsfähigkeiten einschätzt. Ob eine Interaktion als stressend empfunden wird, hängt davon ab, ob die eigenen Bewältigungsfähigkeiten als ausreichend angesehen werden oder nicht. So kann dasselbe Ereignis auf verschiedene Personen unterschiedlich stressend wirken. Wenn eine Person das Ereignis so bewertet, dass es die ihr zur Verfügung stehenden Bewältigungsmöglichkeiten übersteigt, so wird sie es als stressender empfinden, als eine Person, die ihre Bewältigungsmöglichkeiten als ausreichend einschätzt.
Sekundäre Bewertung bedeutet nicht, dass sie der primären Bewertung zeitlich nachfolgen muss: Die beiden Bewertungen beeinflussen sich vielmehr gegenseitig. Denn schon während der primären Bewertung, bei der Einschätzung der Situation, können ebenso die eigenen Bewältigungsfähigkeiten in Bezug auf diese Situation eingeschätzt werden (sekundäre Bewertung).
Da von der Einschätzung der persönlichen Bewältigungsfähigkeit abhängt, in wieweit eine Interaktion als stressend empfunden wird, ist die sekundäre Bewertung der entscheidende Faktor für die Stressreaktion und bestimmt die Bewältigungsmaßnahmen.
Weil die Transaktionen zwischen Mensch und Umwelt immer dynamisch sind, können sich sowohl die Anforderungen aus der Umwelt, als auch die Reaktionen eines Menschen verändern. Man erhält Informationen über die eigene Reaktion und welchen Einfluss sie auf die Umwelt ausübt. Wenn man diese reflektiert, so kann es nach der primären und sekundären Bewertung zu einer Neubewertung der Transaktion kommen. Daraufhin können sich primäre und sekundäre Bewertung wiederum ändern, was zeigt, dass das transaktionale Stressmodell ein dynamisches Modell ist.
II.3.5.2 Bewältigungsformen
Es gibt verschiedene Bewältigungsformen, welche sich in zwei Arten von Funktionen unterscheiden lassen. Zum einen gibt es die instrumentelle Bewältigungsfunktion, mit der darauf abgezielt wird, die gestörte Transaktion zu verändern. Zum anderen gibt es die palliative Bewältigungsfunktion, die auf eine Regulierung der Emotionen gerichtet ist. Der Unterschied zwischen diesen beiden Funktionen besteht darin, dass bei der ersteren etwas unternommen wird um die stressende Situation zu ändern, bei der letzteren aber versucht wird, die eigenen Emotionen der gegebenen Situation anzupassen (was z.B. der Fall ist, wenn sich an einer Situation selbst nichts ändern lässt).
Innerhalb dieser Funktionen unterscheidet man vier Formen der Bewältigung: Informationssuche, direkte Aktion, Aktionshemmung und intrapsychische Formen.
Mit Hilfe der Informationssuche versucht man, sich die Informationen anzueignen, die man braucht, damit eine Änderung der Situation möglich wird. Denn dadurch, dass man herausfindet, was bei einem selbst oder an der Umwelt verändert werden muss, damit die Transaktion nicht mehr stressend ist, kann man die Stressursache bewältigen. Die Informationssuche bildet somit die Grundlage dafür, dass an einer stressenden Transaktion etwas verändert werden kann.
[...]
- Arbeit zitieren
- Christina Witteck (Autor:in), 2008, Zur Bedeutung der Resilienzforschung für die Sozialpädagogik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126780
Kostenlos Autor werden









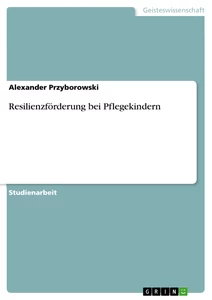


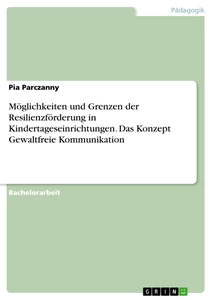


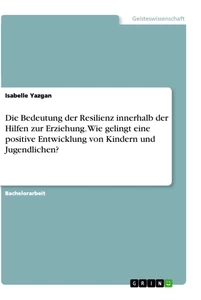






Kommentare