Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Der Philosoph und sein Projekt
1.1 Bemerkungen zum biographischen und zum philosophischen Werdegang im Vorfeld der PhW
1.2 Das Forschungsprojekt über die Natur der Wahrnehmung
2. Semantische Annäherung an die Gestalt
2.1 Gestalt - ein mehrdeutiges Konzept
2.2 Die semantische Form der Gestalt
2.2.1 Die Metapher im philosophischen Diskurs
2.2.2 Die Gestalt als Metapher bzw. als Unbegrifflichkeit
2.3 Bemerkungen zur Gestalt bei Goethe und bei Hegel
3. Gestalttheorie und Gestaltpsychologie
3.1 Die Berliner Schule der Gestaltpsychologie
3.2 Goldstein und Gelb
3.3 Von der Gestalttheorie zu einer‚nicht egologischen‘ Phänomenologie
4. Gestalt bei Merleau-Ponty
4.1 Gestalt als Artikulationsmöglichkeit der dritten Dimension
4.2 Entwicklung des Gestaltbegriffs in Die Struktur des Verhaltens
4.3 Gestalt im Übergang zur PhW
4.4 Die Radikalisierung der Phänomenologie
4.5 Die destruierende Funktion der Gestalt (Weder-Noch)
4.6 Die konstruktive Funktion der Gestalt
4.7 Lösungsansätze des Wahrnehmungsproblems
Schluss
SIGLEN & LITERATURVERZEICHNIS
EINLEITUNG
Gegenstand unserer Untersuchung ist ein Text, der nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1945 seinen Autor in Frankreich schlagartig bekannt gemacht hatte. Maurice Merleau-Ponty (1908 - 1961), ein Zeitgenosse und Freund Sartres, legte mit seiner Phänomenologie der Wahrnehmung die zweite seiner beiden Thesen zur Erlangung des Doktortitels vor. Diese vielschichtige Dissertationsschrift gilt als sein frühes Hauptwerk.
Große Resonanz löste zu jener Zeit hauptsächlich die Wiedergewinnung des Leibes für die Philosophie aus. Die Phänomenologie der leibhaften Existenz, die sich der konkreten Selbst- und Welterfahrung annimmt, hatte sich in Frank- reich seit Mitte der 30er Jahre in den Philosophien Henri Bergsons (1859 - 1941) und Gabriel Marcels (1889 - 1973) abgezeichnet, so dass dieser Schritt hin zum Leib als einem natürlichen Ich etwas war, das man insgeheim erwartet hatte.1 Die Zeit war irgendwie reif für diese leibliche Verankerung des Subjekts. Tatsächlich hatte sich seit Descartes vor allem die erkenntnistheoretische Be- deutung des cogitos entfaltet, wodurch ontologische Fragen, die das Subjekt betrafen, in den Hintergrund gedrängt wurden. Mit der zunehmenden Frag- würdigkeit dieses cartesianischen Subjekts wuchs die Bereitschaft, die Schwie- rigkeiten zu konfrontieren, die ein inkarniertes Subjekt zwangsläufig mit sich bringt.
So stellt die PhW über weite Strecken eine diskursive Auseinandersetzung mit Descartes dar, in deren Verlauf Merleau-Ponty versucht, anstelle des apodikti- schen cogitos Descartes, einen neuen Ort zu bestimmen, von wo aus er philo- sophiert und von wo aus philosophiert werden kann, einen Ort, der die ge- samte menschliche Erfahrung umfassen soll. Erfahrung fängt nämlich nicht erst da an, wo ein Ich sich selbst durch einen Akt reflexiven Denkens gewiss wird, auch wenn dieser Anfang alles andere als leicht zu bestimmen ist. So hatte sich der französische Philosoph für sein ganzes Schaffen den folgenden, rätselhaf- ten Satz aus Husserls Cartesianischen Meditationen zum Leitsatz gemacht: [Es ist die] „[…] noch stumme Erfahrung, die […] zur reinen Aussprache ihres eigenen Sinnes zu bringen ist“.2 Wie aber sollte es möglich sein, auf etwas Unartikuliertes, das dennoch Erfahrung ist, zu reflektieren?
Merleau-Ponty wendet sich mit seinem Vorhaben der Wahrnehmung zu, ist es doch kaum zu bezweifeln, dass die sinnliche Wahrnehmung zu Erfahrungen führt, ohne dass es sich dabei notwendigerweise um Verstandesakte oder auch um Akte eines bewussten Ich handeln müsste. In der Wahrnehmung erkennt der Philosoph jenes grundlegende Phänomen, das es zu untersuchen gilt, um die Bedingungen von dem zu erfassen, was überhaupt in Erscheinung treten kann. Das Phänomen der Wahrnehmung ist ihm Mittel und Weg, während sein Ziel darin besteht, eine neue Transzendentalphilosophie zu begründen. Er will also auf neue Weise, nämlich aus der Perspektive der sinnlichen Wahrneh- mung, die Bedingungen erkunden, die erfüllt sein müssen, damit Erkenntnis möglich ist. Der Leib als Subjekt dieser Wahrnehmung rückt dabei als Angel- punkt dieser Transzendentalphilosophie ins Zentrum des Interesses. Doch die Bestimmung dieses Leibbegriffs, die besser auf negative, ausschließende Weise gelingt, weist bereits darauf hin, mit welchen Widerständen eine solche Kon- zeption zu arbeiten hat: Der Leib ist nicht allein Körper und nicht allein Geist, er ist nicht nur Objekt und nicht nur Subjekt.
Die Wortwahl Widerstand verweist hier auf das in der Vorrede des Übersetzers3 erwähnte Gleichnis Kants:
„Die leichte Taube, indem sie im freien Fluge die Luft teilt, deren Widerstand sie fühlt, könnte die Vorstellung fassen, dass es ihr im luftleeren Raum noch viel besser gelingen werde. Ebenso verließ Plato die Sinnenwelt, weil sie dem Verstande so vielfältige Hindernisse legt, und wagte sich jenseits derselben auf den Flügeln der Ideen, in den leeren Raum des reinen Verstandes.“4
Mit diesem Zitat bringt der Übersetzer die Grundidee Merleau-Pontys sehr trefflich auf den Punkt. Die Dicke der Materie des Leibes ist genauso wie der „widerständige Weltstoff der Luft“5 nicht einfach ein lästiges Hindernis, sondern Bedingung der Möglichkeit unserer Erkenntnis. Mit dem Umgehen des Widerstandes, beraubt man sich der Möglichkeiten. Am Gleichnis der Taube lässt sich verdeutlichen, warum die negative Definition einer positiven vorzu- ziehen ist: nur die negative geht einher mit der notwendigen Passivität, die öffnet für die Erkenntnis, die sich in der Erfahrung des Widerstandes mögli- cherweise anbietet.
Nachzutragen ist, dass die so erfahrenen Strukturen, die das Phänomen der Wahrnehmung offenbart, nicht allein für die Wahrnehmung gültig sind, sondern dass sie ein Muster darstellen, das sich vielfältig in allen Registern der menschlichen Existenz wiederholt.
Der Hinweis auf die Passivität führt uns zu dem eigentümlichen Stil, in dem das Werk verfasst ist. Der Autor zielt nicht auf eine kurze, prägnante Darstellung der Sachverhalte. Er tastet behutsam ab, umkreist seine Themen in wie- derholenden Bewegungen, zieht in seinen Monographien eine Vielfalt von Phänomenen zu Rate und hält sich zurück mit Strukturen, die die Beobach- tungen notwendigerweise in einen Bedeutungsrahmen einfügen und das Un- passende zum Schweigen bringen würden. „Denk nicht, sondern schau“6, scheint hier vorerst einmal das Motto zu sein. Das macht es dem Leser nicht einfach. Er ist eingeladen mitzugehen auf diese diskursiven Reisen, ohne dass er die organisierende Mitte dieser Diskurse erkennen könnte. Oft kommt da eine gewisse Ratlosigkeit auf, welchen Platz dem Gelesenen im Gefüge der Ge- danken zuzuordnen wäre. Man fragt sich: „Was hat das zu bedeuten?“
Eben diesem Phänomen widmet sich die vorliegende Arbeit, die zum Ziel hat, dem Begriff der Gestalt auf den Grund zu gehen. Denn eines ist klar, diese drit- te Dimension, die sich als Ausschluss der Alternativen einer reinen Be- wusstseinsphilosophie einerseits, sowie einem quasi objektiven Naturalismus andererseits definiert, ist eng verbunden mit diesem Begriff der Gestalt. Dem Gestaltbegriff auf den Grund gehen, was heißt das? Zuerst einmal meinen wir damit die Begriffsbestimmung. Was genau bezeichnet der Begriff in der PhW? Dann meinen wir damit den Hintergrund. Auf was verweist das Wort Gestalt im normalen Gebrauch, welcher Sinngehalt wird damit verbunden? Und auf wel- che Erfahrungen verweist der Gestaltbegriff in jenem Horizont der Gestaltpsy- chologie, woher Merleau-Pontys Begriff stammt? Diese Fragen dienen als Vor- bereitung zur eigentlichen Frage dieser Arbeit: Was macht der Gestaltbegriff im Diskurs, welche Funktion oder welche Funktionen hat er in der PhW? Was leis- tet er da?
Von einer inhaltlichen These, die die Arbeit leitet, wollen wir an dieser Stelle absehen. Merleau-Ponty, so denken wir, wird seinen guten Grund gehabt ha- ben, warum er in diesem tastenden Stil vorgeht. Wir wollen es ihm gleichtun und nicht gleich zu Beginn dem Ganzen eine vorschnelle Bedeutung aufdrü- cken. Die These besteht also in einem diskursiven Leitbild, das anleitet, nach Hinweisen zu suchen, wie wir uns der Sache angemessen annähern sollen. Trifft unsere These zu, so sollten wir am Schluss auch in der Lage sein zu erklären, was es mit diesem Stil auf sich hat.
Im ersten Kapitel vollzieht sich diese Annäherung, indem wir uns einen Eindruck über das Milieu des Denkens des Philosophen mit einem Blick auf den biografischen und philosophischen Werdegang verschaffen. Entschiedener als sein bekannter Freund Sartre, der auch literarische Werke verfasste, hatte sich Merleau-Ponty der Philosophie verschrieben. Er tat es so sehr, dass er die von ihm als Krise empfundene Situation der Philosophie zu seiner Sache machte. Dies gibt uns einen narrativen Rahmen.
Ein Arbeitsentwurf und ein Fortschrittsbericht über das Forschungsprojekt vermitteln uns sodann wichtige Anhaltspunkte für eine erste Orientierung. Die Gestaltpsychologie zeigt sich als die entscheidende Referenzposition, die zu einer Revision grundlegender philosophischer Begriffe führen, und schließlich den Weg für eine neue Transzendentalphilosophie öffnen soll. Eine erste Be- stimmung deklariert die Gestalt als spontane Organisation des sensorischen Feldes.
Im zweiten Kapitel nähern wir uns der Sache semantisch an. Wir suchen etwas über die von unserem Philosophen betonte Ambiguität des Gestaltbegriffs zu erfahren, die uns mehr als eine übliche Zweideutigkeit zu sein scheint. Im Spie- gel der fremden Sprache wird der vieldeutige Gebrauch des Wortes Gestalt der normalen Sprache sichtbar. Vor allem die französische Sprache hebt den anthropomorphen Aspekt hervor, der der Gestalt eine sinnliche Ausstrahlung verleiht und die Möglichkeit sowohl für einen repräsentationalen wie auch für einen identifikatorischen Gebrauch des Wortes legt.
Auf der Suche nach einem theoretischen Rahmen für die Gestalt als Unbeg- rifflichkeit ziehen wir Blumenbergs Metapherntheorie zu Rate. Unsere Gestalt erscheint im Rahmen dieser Theorie im Unterschied zur Metapher, die auf ein zweidimensionales Bild referiert, als auf die dreidimensionale Gestalt in Be- wegung referierend.
Das dritte Kapitel widmet sich der Gestaltpsychologie und der Gestalttheorie als jenem theoretischen Hintergrund, aus dem Merleau-Ponty seine Gestalt herausbildet. Wir konzentrieren uns auf die wesentlichen Schritte der Rekons- truktion der Psychologie, die die Gründer der Berliner Schule zur Bewältigung der Krise in der Psychologie unternommen hatten. Wir suchen ferner jene Quellen auf, die für Merleau-Ponty besonders wichtig waren: Die Untersu- chungen von Gelb und Goldstein, sowie die Feldtheorie von Aron Gurwitsch. Besondere Aufmerksamkeit zollen wir in dieser Betrachtung jenen Momenten, die die Trennung von Subjekt und Objekt unterwandern, wie etwa das Phi- Phänomen, die besondere Untersuchungsmethode oder das Konzept der Selbstorganisation.
Im vierten und letzten Kapitel wenden wir uns dem Gestaltbegriff bei Merleau- Ponty und seinen beiden Werken zu, mit denen er sein Forschungsprojekt rea- lisiert hat. Wir folgen in groben Zügen der Artikulation der dritten Dimension in der SV. Vor dem Hintergrund, dass die Gestalt eigentlich Moment einer Bewe- gung ist, orientiert sich die Untersuchung in der PhW primär an der Funktion der Gestalt und weniger an den diversen Formen. So fragen wir uns: Auf wel- che Weise vermag der Bezug auf die Gestalt die Phänomenologie zu radikalisie- ren? Wie funktioniert die Kritik an den Interpretationen der Natur- wissenschaften und an der Bewusstseinsphilosophie? Worin besteht die kons- truktive Funktion der Gestalt? Schließlich prüfen wir, wie das Problem der Wahrnehmung letztlich gelöst wird.
Die Schriften Merleau-Pontys gelten als schwer zugänglich. Obwohl die vorlie- gende Arbeit durchaus die Absicht verfolgt, den Zugang zum Denken dieses Philosophen zu erleichtern oder auch zu vertiefen, tut sie das nur insofern, als diese Unwegsamkeit mit dem Gestalt-Konzept zu tun hat. Es ist weder eine vollständige, noch eine ausgewogene Darstellung der PhW. Dazu wäre unbe- dingt erforderlich, das zentrale Konzept des Leibes von Grund auf darzustellen. Diese Arbeit ist ausgerichtet auf eine Erhellung des Gestaltdenkens und dessen Hintergrundes, wie es in der PhW zur Geltung bzw. zur Anwendung kommt. Mehr dem Gegenstand und vielleicht weniger der Form7 der Sache angemes- sen, verlassen wir uns primär auf den Diskurs und nicht so sehr auf kritische Stellungnahmen.
1. DER PHILOSOPH UND SEIN PROJEKT
1.1 BEMERKUNGEN ZUM BIOGRAPHISCHEN UND ZUM PHILOSOPHISCHEN WERDEGANG IM VORFELD DER PHW
Maurice Merleau-Ponty wurde am 14. März 1908 in Rochefort-sur-Mer, einer Kleinstadt im Südwesten Frankreichs, als zweiter Sohn von insgesamt drei Kin- dern geboren. Das Milieu seiner Herkunft war stark vom Katholizismus geprägt. Die bevorzugten Berufe seiner Vorfahren waren Arzt und Offizier. Als Marine- Offizier war sein Vater oft über längere Zeit von der Familie getrennt. Die Mut- ter pflegte eine außereheliche Beziehung zu einem verheirateten Universitäts- professor, der der leibliche Vater von Maurice und seiner jüngeren Schwester war8. Aus diesen familiären Verhältnissen machte man kein Geheimnis, was auch vermuten lässt, dass die Auffassung des Katholizismus nicht allzu eng ge- wesen sein kann.
Nach dem frühen und überraschenden Tod seines Namens-Vaters - die zeitli- chen Angaben über diesen Einschnitt in das Leben der Familie Merleau-Ponty variieren von 1911 bis zum ersten Weltkrieg, wo er im Kampf gefallen sein soll9
- zog die Mutter mit den drei Kindern zuerst nach Le Havre und später nach Paris. Bereits mit 16 Jahren schließt Maurice Merleau-Ponty dort seine Ausbildung am Gymnasium mit dem Baccalauréat ab.
Trotz der verschiedenen durch die Umzüge bedingten Trennungen erinnerte sich Merleau-Ponty an seine Kindheit als eine sehr glückliche Zeit, wobei die emotionale Nähe zu seiner Mutter besonders tragend gewesen sein soll. Von 1926 bis 1930 besuchte Merleau-Ponty die Ecole Normale Supérieure (ENS), eine Elitehochschule, an der er u.a. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre und Jean Hyppolite kennenlernte, mit denen er sich befreundete. Er galt als ein wohlorganisierter und ehrgeiziger Student und gehörte neben Simone de Beauvoir und Simone Weil zu den drei besten seines Abschlussjahrgangs. Unter den Studenten der ENS, die ein linksgerichtetes, sozialistisches und ein „mili- tantes“, katholisches Lager bildeten, gehörte Merleau-Ponty zuerst zu letzte- rem, nahm jedoch bald eine Zwischenstellung ein.10 Überhaupt soll Merleau- Ponty eine äußerst ausgeglichene und ausgleichende Art gehabt haben, wie Simone de Beauvoir in den Memoiren wissen lässt. Er sei ein heiterer, gelasse- ner Mensch gewesen, der Exzesse verabscheut und die Klarheit seiner Gedan- ken selten mit Gefühlen vermischt habe. Nach dem Tod des Freundes schrieb sie über ihn: „Er interessierte sich mehr für die Randbezirke des Denkens, für die dunklen Seiten des Daseins als für den festen Kern. Bei mir war das Gegen- teil der Fall. […] Ich brachte eine Schärfe in unsere Diskussionen, die er lächelnd über sich ergehen ließ.“11
Über seine Neigung zur Philosophie war sich Merleau-Ponty stets und seit sei- ner ersten Unterrichtsstunde sicher. Von seinen frühen Lehrern der Philosophie ist Léon Brunschvicg (1869 -1944) hervorzuheben, der eine am Neu- kantianismus orientierte Bewusstseinsphilosophie vertrat, die auf das Be- wusstsein als absolutes Fundament von Erkenntnis vertraute. Merleau-Ponty war von Brunschvicgs Vielseitigkeit und dessen umfangreichem Wissen in Lite- ratur, Poesie, Geschichte und Naturwissenschaften beeindruckt und folgte ihm anfänglich in seinen standardisierten Auslegungen von Kant und Descartes12, entwickelte aber bald ein Misstrauen gegen dieses „klassische Denken“, wie er es später nannte. Insbesondere lehnte er es ab, dass „Mensch und Natur Ob- jekte universeller Konzepte“ sein sollten und er verabscheute ein alles über- schauendes Denken, das die „angeborene Herkunft vergaß“.13
So erregte Bergson, der Nobelpreisträger für Literatur von 1928, obwohl in universitären Kreisen der Philosophie zu jener Zeit eher verpönt, das besondere Interesse unseres Autors. Auf der Suche nach Ansätzen, die sich auf Erfahrung des wirklichen Lebens bezogen, waren dem jungen Philosophen die Kapitel L’intuition philosophique und La perception du changement aus Matière et Mémoire wegweisende Anregungen.
Auch in Husserls Phänomenologie erblickte Merleau-Ponty eine attraktive Al- ternative zu den damals im universitären Umfeld dominierenden philoso- phischen Strömungen; denn diese will nicht transzendentes Sein erschließen, sondern betrachtet das Wahrgenommene als etwas, das von einem wahr- nehmenden Bewusstsein vollzogen wird und Rückschlüsse auf letzteres er- laubt. Merleau-Ponty hatte Gelegenheit, Husserl persönlich zu begegnen. Ob- wohl er zu dieser Zeit nur über wenig Deutschkenntnisse verfügte, assistierte er bei den Pariser Vorträgen von 1929, die Husserl im Rahmen eines Vorlesungs- zyklus von Georges Gurwitsch an der Sorbonne über zeitgenössische deutsche Philosophie (d.h. über Husserl, Last und Heidegger) hielt14. Diese für die In- Gang-Setzung der Phänomenologiebewegung in Frankreich wichtigen Vorträge wurden später als Cartesianische Meditationen veröffentlicht. Merleau-Ponty fand darin den mittlerweile berühmten Satz, den er zum Leitmotiv seines gan- zen philosophischen Schaffens gemacht hatte und der in der PhW gleich zweimal vorkommt: „Es ist die noch stumme Erfahrung, die … zur reinen Aussprache ihres eigenen Sinnes zu bringen ist.“15
Neben Husserl war es insbesondere Aron Gurwitsch (1901 - 1973) der einen wichtigen Einfluss auf den Autor der SV und der PhW hatte. Aron Gurwitsch, der abgesehen von Philosophie auch Psychologie und Physik studiert hatte, verband in seiner Dissertation von 1928 Phänomenologie und der Thematik des reinen Ich die damals sich entfaltende Gestaltpsychologie mit der Phä- nomenologie. Über ihn wurde Merleau-Ponty vertraut mit den Theorien der Gestaltpsychologie der Berliner Schule, und ebenso mit den Untersuchungen des Psychologen und Philosophen Adhémar Gelb (1887 - 1936) und des Neu- rologen Kurt Goldstein (1875 - 1965), welche für die ersten beiden Werke Mer- leau-Pontys nach der Einschätzung von Waldenfels „schwerlich zu über- schätzen“16 sind.
Im Alter von 22 Jahren erlangte Merleau-Ponty die Zulassung für das Lehramt in Philosophie. Nachdem er anschließend seinen Militärdienst absolviert hatte, arbeitete er 4 Jahre als Gymnasiallehrer. Während dieser Zeit begann er mit seinem Forschungsprojekt über die Wahrnehmung, das schließlich zu seinen beiden Werken Die Struktur des Verhaltens und Phänomenologie der Wahrnehmung führte.
1935 kehrte Merleau-Ponty an die ENS zurück, wo er eine Stelle als Repetitor einnahm und die Studierenden bei der Vorbereitung ihrer Prüfungen unters- tützte. Zu dieser Zeit beteiligte er sich an der journalistischen Arbeit der Zeit- schrift L’Esprit und pflegte persönlichen Kontakt mit dem Existentialisten Gab- riel Marcel (1889-1973). Marcels Leibkonzeption in seinem Entwurf einer Phä- nomenologie des Habens inspirierte Merleau-Ponty maßgeblich für seine ei- gene Leib-Konzeption der PhW.17
In die Zeit von 1935 - 1937 fielen auch Merleau-Pontys Besuche der legendä- ren Hegel-Vorlesungen von Alexandre Kojève (1902 - 1968), der verschiedene seiner Zuhörer, unter ihnen Georges Batailles, Jacques Lacan und Jean Hyppoli- te, nachhaltig inspirierte. Auch wenn sich Merleau-Ponty nicht gleichermaßen wie manche seiner Kollegen für Kojèves Ausführungen zu begeistern vermoch- te18, so war der intellektuelle Kreis, an dem er hier teilnahm, dennoch eine große Bereicherung für den jungen Philosophen, dessen ideologie- und kultur- kritische Denkweise geschärft wurde.19 Merleau-Ponty löste sich in dieser Zeit allmählich vom Katholizismus, fand für einige Jahre Gefallen am Kommunis- mus, und gelangte schließlich zum Atheismus.
Eine Edmund Husserl gewidmete Spezialausgabe der Revue internationale de philosophie veranlasste Merleau-Ponty 1939, das Husserl-Archiv im belgischen Löwen zu besuchen. Das gab ihm die Gelegenheit, uneditierte Schriften der Krisis, einen Teil der Ideen II, sowie Erfahrung und Urteil zu studieren. Ent- scheidend für die Art und Weise seiner Husserl-Rezeption seien ferner die Ge- spräche mit E. Fink gewesen, der als Assistent beim Husserl-Archiv tätig war.20 Im Herbst 1939, nachdem er die erste seiner Thesen ein Jahr zuvor fertig ge- stellt hatte, musste der Philosoph seine Studien unterbrechen, weil er als Un- terleutnant Kriegsdienst zu leisten hatte. In den folgenden Kriegsjahren von 1940 bis 1944 arbeitete er an einem Gymnasium in Paris als Philosophielehrer. Er heiratete die von ihm schwangere Simone Jolibos und nahm den Kontakt mit seinen früheren Freunden wieder auf. Er traf sich häufig mit Simone de Beau- voir im legendären Café de Flore, wo Künstler und Intellektuelle verkehrten. 1941 trat er der Widerstandsgruppe Socialisme et Liberté bei, wo er wieder auf den aus der deutschen Kriegsgefangenschaft entlassenen Sartre traf. In den folgenden Jahren kam es zu einer engen Zusammenarbeit der beiden Freunde, (Marcel) bilden, die man auch das Innere im Außen nennen könnte. vgl. Geraets, S.18 ff., auch Günzel S. 33. die u.a. in der gemeinsamen Verantwortung für die Zeitschrift Les Temps Modernes ihren Niederschlag fand.
Nachdem Merleau-Ponty 1945 seinen Doktor-Grad erlangte, begann seine Universitätskarriere. Mit der Veröffentlichung der Phänomenologie der Wahrnehmung wurde er schlagartig bekannt.
1.2 DAS FORSCHUNGSPROJEKT ÜBER DIE NATUR DER WAHRNEHMUNG
Für die Promotion waren in Frankreich zu jener Zeit zwei Dissertationen zu ver- fassen. Eine sollte sich am aktuellen Forschungsstand orientieren und mit der anderen sollte ein eigenständiger Forschungsanteil nachgewiesen werden. Merleau-Ponty reichte seine beiden Thesen 1934 ein unter Angabe der Titel:
«Le problème de la perception dans la phénoménologie et dans la ,Gestaltpsychologie‘« und «La nature de la perception«. Die erste These wurde nach einigen tiefgreifenden Umformungen unter dem Titel La structure du comportement 1942 veröffentlicht und die zweite unter dem Namen Phénoménologie de la perception.21
Es ist nicht leicht, sich in dem umfangreichen Material der PhW in geeigneter Weise zu orientieren. Ein Rückgang zu den Anfängen des Forschungsprojekts, wie es der Philosoph entworfen und weiterentwickelt hat, erscheint uns des- halb als eine gute Möglichkeit für den Einstieg in die Thematik. Dem Arbeitsentwurf über die Natur der Wahrnehmung, den der 25-jährige Merleau-Ponty seinem Antrag für ein Stipendium 1933 für seine Dissertation beigelegt hatte, können wir die Absichten des damaligen Gymnasiallehrers für sein Forschungs-Projekt entnehmen:
Er will „das Problem der Wahrnehmung und insbesondere der Wahrnehmung des eigenen Leibes“ wieder aufnehmen. Er kritisiert, dass die Wahrnehmung „wie eine Operation des Verstandes“ behandelt werde, „durch die die aus- dehnungslosen Daten (die Empfindungen) aufeinander bezogen werden und
wodurch erklärt wird, dass sie schließlich eine objektive Welt darstellen.“ So erscheine die Wahrnehmung als „ein vermittelter Vorgang.“ (PW 7) Gegen diese Auffassung führt er Untersuchungsergebnisse der Gestalttheorie und Entwicklungen der Neurologie an. Erstere zeigen, dass es unmöglich sei, in der Wahrnehmung „eine zusammenhanglose Materie und eine Verstan- desform zu unterscheiden; die „Form“ sei vielmehr in der sinnlichen Erkenntnis selbst gegenwärtig.“ (PW 7) Die zweite lege nahe, dass die Korrelation der Sin- nesdaten „durch die Funktion des Nervensystems selbst garantiert“ werde und eben nicht durch eine „Verarbeitung durch das Denken“ (PW 8).. Der junge Philo- soph betont die Schwierigkeit, „eine Materie und eine Form der sinnlichen Er- kenntnis zu unterscheiden“ und dass diese „in Bezug auf die Wahrnehmung des eigenen Leibes noch grösser“ sei, „die Ausgedehntheit […] hängt hier der Emp- findung noch deutlicher an.“ (PW 8)
Von einer Bestätigung dieser Befunde durch seine Arbeit verspricht er sich eine Revision der „Postulate der klassischen Auffassung von Wahrnehmung“. Er be- tont, dass sich sinnlich Wahrnehmbares nicht allein auf verstandesmäßige Be- ziehungen zurückführen lassen und dass sich deshalb „die Welt der Wahrneh- mung“ nicht mit „der Welt der Wissenschaft angleichen“ (PW 9) lässt. Die Unter- suchung der Natur der Wahrnehmung und die Reflexion ihrer Bedeutung könn- te es schließlich nötig machen, „bestimmte psychologische und philosophische Begriffe, die gegenwärtig in Gebrauch sind, umzugestalten.“ (PW 9)
Dieser erste Arbeitsentwurf gibt uns bereits wesentliche Hinweise: Das For- schungsvorhaben zielt darauf ab, gängige Auffassungen von Wahrnehmung zu widerlegen. Merleau-Ponty nennt keine Namen, gegen deren Positionen er Stellung nimmt, er erwähnt lediglich, dass „eine bestimmte Lehre, die vom Geist des Kritizismus inspiriert ist“ (PW 7), die Wahrnehmung in jener von ihm kritisierten Weise darstelle, eben als ein vom Verstand vermittelten Vorgang. Dies betrifft allerdings nicht eine konkrete Lehre, vielmehr handelt es sich um einen paradigmatischen Grundgedanken, der die Theorien der Wahrnehmung in entscheidender Weise mitbestimmt hat. Diesem Paradigma zufolge sind es unbewusste Operationen des Verstandes, die aus losen Empfindungsdaten strukturierte Wahrnehmungen formen.22 Diese unbewussten Operationen wurden als unbewusstes Lesen (Thomas Reid), als unbewusstes Gestalten (Kon- rad Fiedler), als unbewusstes Schließen (Helmholtz), oder auch als unbewusstes Abduzieren (Peirce) von Empfindungen konzipiert. Merleau-Ponty fasst diese Variationen von Interpretationismus in der PhW unter der Bezeichnung „Intel- lektualismus“ zusammen und wendet gegen sie ein, dass die angeblich vor- gängigen Empfindungsdaten in Wahrheit eine nachträgliche Konstruktion sind, denn sie sind dem Wahrnehmenden in der Wahrnehmung selbst nicht gege- ben. Nach Merleau-Ponty gibt es diese Empfindungen, die als Prämissen für einen Schluss dienten, schlichtweg nicht (vgl. PhW 59).
Der Autor des Arbeitsentwurfs hingegen ist überzeugt, dass Wahrnehmung nicht durch den Verstand vermittelt ist und dass sie nicht durch eine Interpre- tation von Empfindungsdaten zustande kommt. Seine These ist: Es gibt eine sinnliche Form der Erkenntnis. Diese kann nicht auf verstandesmäßige Bezie- hungen zurückgeführt werden und entzieht sich somit der Welt der Wissen- schaft, die für die Erforschung einer Sache stets einen Interpretationsvorgang voraussetzt. Interpretation ist jedoch nicht Wahrnehmung. In dieser Differenz liegt ein wesentliches Anliegen der PhW, die bestrebt ist, die Phänomene von verstellenden Darstellungen von Modellen zu befreien und den Status der Wahrnehmung selbst wieder herzustellen. Das ist der Grund, weshalb die Ab- lehnung interpretationistischer Wahrnehmungstheorien zwangsläufig mit der Hinwendung zur Leibwahrnehmung verknüpft ist. So ist denn auch Merleau- Pontys Interesse an der Leiblichkeit in engem Zusammenhang mit der Bedeu- tung des Leibes für die Wahrnehmung zu sehen und nicht etwa als themati- sches Interesse an der Leiblichkeit an sich.23 Dieses Interesse lässt sich noch weiter spezifizieren: Der Forscher misst der Wahrnehmung des eigenen Leibes in seinem Vorhaben eine besondere Bedeutung zu, denn es geht ihm um die transzendentale Bedeutung des Leibes für die Wahrnehmung. Der Fokus auf den Eigenleib zum einen und die Revision der Wahrnehmungstheorie zum andern führen zusammengenommen zu einer Untersuchung des transzendentalen Gesichtspunktes. Es ist ja der Leib, der mittels seiner sinnlichen Wahrnehmung das ist, wodurch es Gegenstände überhaupt gibt. Vor diesem Hintergrund ist es tatsächlich zu erwarten, dass sich eine Umgestaltung philosophischer und psychologischer Begriffe aufdrängen dürfte, sofern sich die Überzeugungen des Autors bestätigen sollten.
Was bei näherer Betrachtung aus diesem ersten Arbeitsentwurf ebenfalls he- rauszulesen ist, ist die gewichtige, wenn nicht gar die zentrale Rolle, die die Gestalttheorie hier einnimmt. Diese wird zwar nur in einem kurzen Abschnitt erwähnt, doch stützen sich die wesentlichen, reformierenden Gedanken auf die Ergebnisse der Untersuchungen der Gestaltpsychologie. In ihr findet Merleau- Ponty die entscheidende Referenzposition, an die er anknüpfen und von wo aus er seine eigene Position ausarbeiten kann. Die Phänomenologie hingegen wird in diesem ersten Papier überhaupt nicht erwähnt, obwohl Merleau-Ponty mit dieser Philosophie längst vertraut ist. Das dürfte daran liegen, dass sich der Autor in diesem Beschrieb des Forschungsvorhabens im Wesentlichen auf die Neuerungen konzentriert, die von seinem Projekt hervorgehen können, und diese nehmen ihren Anfang in der Gestalttheorie und eben nicht in der Phä- nomenologie Husserls.
1934 beantragte Merleau-Ponty die Fortsetzung des Stipendiums und fügte dem Antrag einen Fortschritts-Bericht sowie Ausführungen seiner Absichten über seine Forschungen bei. Der Bericht beginnt mit einem Überblick über den Forschungsstand, der die Feststellung beinhaltet, dass es kaum möglich ist, „die Psychologie der Wahrnehmung durch die Physiologie des Geistes“ (PW 11) zu er- hellen. Auch die Pathologie, zumindest in Frankreich, sei nicht geeignet, einen Leitfaden abzugeben. Dennoch erhofft sich der Berichterstatter wichtige Hin- weise von der Neurophysiologie und der Pathologie und erwähnt in diesem Zusammenhang insbesondere die Studien von Gelb und Goldstein. Er bemerkt, dass der Zusammenhang von im Verhalten beobachtbaren Störungen einer- seits und von dafür zuständigen Hirnarealen andererseits bloß auf Vermutun- gen basiert, woraus Gelb und Goldstein für ihr methodisches Vorgehen die Fol- gerung ziehen, „vor jedem Versuch einer physiologischen Deutung […] eine möglichst genaue Beschreibung des krankhaften Verhaltens zu geben.“ ( PW 12) Der Philosoph weist weiter auf den Umstand hin, dass die Ausgestaltung der Experimente aus den leitenden Vorstellungen einer Psychologie der normalen Wahrnehmung nahe gelegt [werden] (im Falle Gelb und Goldstein durch die Vorstellungen der Gestaltpsychologie).“ ( PW 12)
Sodann hebt der Berichterstatter kritisch Vorannahmen hervor, mit denen die Begriffe der Empfindung (sensation), des geistigen Bildes (image mentale), und der Erinnerung (souvenir) belastet sind. In der Phänomenologie Husserls sieht er nun jenen neuen philosophischen Ansatz, der sich völlig vom Kritizismus un- terscheidet und dem er zutraut, dass er zu einer neuen Erkenntnistheorie führt (vgl. PW 8)
Was hier thematisiert wird, ist die Tatsache, dass sowohl die wissenschaftli- chen Experimente wie auch die Begriffe durch leitende Theorievorstellungen geprägt sind. Sie beinhalten zwangsläufig Interpretation. Obwohl Merleau- Ponty Husserls Wahrnehmungsphilosophie zurückweisen muss24, verspricht er sich von der Phänomenologie als Methode neue Erkenntnisse, die eine Alter- native zu dem interpretationistischen Modell der Wahrnehmung aufzeigen könnte. Die Devise ist: genaues Beschreiben des Verhaltens, statt dem Gege- benen unreflektiert bestimmte Vorstellungen durch Theorien zu überstülpen. Das Beschreiben des Verhaltens ist hingegen traditionell eine Aufgabe der Psy- chologie. So kommt es, dass sich der Schreiber des Fortsetzungsberichts offen- sichtlich genötigt sieht, sich mit den Beziehungen und Unterschieden zwischen der Phänomenologie und der Psychologie auseinanderzusetzen. Er beschreibt dieses Verhältnis als fruchtbare Ergänzung und hält zwei Unterschiede fest: Der erste bestehe darin, dass der Phänomenologe im Gegensatz zum Psychologen eine Reduktion vollziehe und den Wirklichkeitsbezug auf diese Weise einklammere. Den zweiten Unterschied sieht er in der eidetischen Methode des Phänomenologen gegenüber der induktiven des Psychologen.
Dieses Herausarbeiten des Unterschieds der beiden Disziplinen im Fortset- zungsbericht wirkt auffällig. Will der Schreiber einem Bedenken vorbeugen, etwa dass sich die Prüfer des Antrags in Anbetracht des dominanten Teils der Gestaltpsychologie fragen könnten, ob es sich nicht eher um ein psychologi- sches Projekt handelt und worin jetzt genau die Arbeit des Philosophen be- steht? Stellt sich die Frage dem Schreiber selbst, für den zwar kein Zweifel über die philosophische Absicht besteht, der sich aber sicher bewusst ist, dass er sich in dem erneuernden Moment voll und ganz auf das Gestalt-Konzept stützt? Tatsächlich wird dieser Grat zwischen Phänomenologie und Psychologie noch schmäler, wenn man bedenkt, dass Merleau-Ponty Husserls Reduktion eben nicht vollzieht. Es ist somit durchaus erhellend, wenn der Autor unter dem Abschnitt Philosophie der Wahrnehmung, bevor er zur Psychologie der Wahrnehmung übergeht, sein philosophisches Vorhaben mit der Bemerkung expliziert:
"Die Phänomenologie und die Psychologie, zu der sie hinführt, verdienen also die größte Aufmerksamkeit, da sie die Begriffe des Bewusstseins und der Empfindung selbst zu revidieren und die ,Spaltung‘ des Bewusstseins auf andere Weise aufzufassen vermögen." (PW 16)
Die Phänomenologie, von der Merleau-Ponty hier schreibt, ist nicht de- ckungsgleich mit der Phänomenologie Husserls. Es handelt sich um eine Phä- nomenologie, die durch die gestaltpsychologischen Erkenntnisse modifiziert wurde, denn nur unter dieser Bedingung trifft es zu, dass sie zu einer revidier- ten Auffassung der Spaltung des Bewusstseins führt. Unmissverständlich geht aus diesem Hinweis auch hervor, wie grundlegend das philosophische Anliegen des Autors ansetzt: an einer Revision des Bewusstseinsbegriffs!
Der Schreiber berichtet nun: „Ein großer Teil unserer Arbeit dieses Jahres war jedenfalls der Gestaltpsychologie gewidmet.“ (PW 17) Ein Blick auf die Literatur- angaben zeigt, dass er sich mit Werken von Wertheimer, Köhler, Koffka, Gur- witsch, Gelb und Goldstein, sowie einer ganzen Reihe von weiteren, z. T. we- niger bekannten Autoren befasst hatte. In diesem Dokument fasst er auf wenigen Seiten das zusammen, was er als das Wesentliche des Gestaltkonzepts für sein Projekt ansieht.
Merleau-Ponty beginnt mit der Zurückweisung der Konstanzannahme, wie sie von der früheren Psychologie vertreten wurde. Diese Hypothese postuliert, dass Empfindungen durch Reize der Sinnesorgane erzeugt werden in der Art, dass gleiche Reize stets gleiche Empfindungen zur Folge haben. Die Empfin- dungen als primäres Datenmaterial für das Bewusstsein werden anschließend, so die frühere Auffassung, durch Gedächtnis, Urteilsvermögen und Wissen zu dem wahrgenommenen Bild verarbeitet, was als eine Interpretation von Emp- findungen bezeichnet werden kann.
Im Gegensatz dazu erkläre die Gestaltpsychologie die Wahrnehmung mit Hilfe eines psychologischen Faktors, den sie als Gestalt bezeichne:
„Die Gestalt ist eine spontane Organisation des sensorischen Feldes, das die angeblichen ,Elemente, von ,Ganzheiten‘ abhängig macht, die selbst wieder in noch größere Ganzheiten eingegliedert sind. Diese Organisation ist nicht wie eine Form, die sich einer heterogenen Materie überstülpt; es gibt keine Mate- rie ohne Form. Es gibt nur mehr oder weniger stabile, mehr oder weniger ge- gliederte Organisationen.“ (PW 17)
Merleau-Ponty gibt hier - das ist eine seltene Ausnahme - eine positive Defini- tion von dem, was Gestalt bezeichnet. Ansonsten sind die negativen Defini- tionen die Regel, was wohl damit zu tun hat, dass Gestalt eigentlich etwas Un- begriffliches darstellt und es unserem Philosophen u.a. darum geht, dieses Un- begriffliche durch die Vereinnahmung und durch die Verformung des be- grifflichen Denkens zu schützen. Unter Gestalt müssen wir uns also einen Vor- gang vorstellen, der das sensorische Feld spontan organisiert und zwar in der Weise, dass eine bestimmte Struktur entsteht, die Struktur „Figur auf einem Grund“ (PW 18).
Aus dem Bericht geht weiter hervor, dass die Gestaltpsychologen diese Struk- tur analysierten, indem sie die sinnlichen Eigenschaften untersuchten, die in diesem Gestaltprozess wirksam sind. Dabei ging es etwa um Farbunterschiede, Ähnlichkeiten und Differenzen von Formen, Graduierungen der Abstände von Elementen, etc. und das Ziel war, die Art des Zusammenschlusses von Teilen zu einer erlebten Ganzheit zu erklären. Die Wahrnehmung, so zeigten die gestalt psychologischen Untersuchungen, sei eher durch „sichtbare und nicht gedachte Beziehungen“ als durch isolierte Elemente zu charakterisieren. (vgl. PW 19) Das gleiche Prinzip gilt für die Raumwahrnehmung, die traditionell - besonders die Tiefenwahrnehmung - als eine Operation interpretiert werde, bei der ein unbewusstes Urteil des Verstandes mitwirke, um die Perspektive richtig zu deuten. Die Gestaltpsychologie hingegen beschreibe die Raumwahrnehmung als einen spontanen Strukturierungsvorgang, wobei nach Wertheimer soge- nannte „Ankerpunkte“ des sensorischen Feldes eine „räumliche Ebene“ fest- legen und „die Feldlinien […] unmittelbar von den Anhaltspunkten ‚nach oben‘, ‚nach unten‘ ohne Urteil oder Vergleich beeinflusst“ würden. (PW 22, Hervorhebung im Original)
Man könnte von einem intrinsischen Koordinatensystem sprechen, das durch das sensorische Feld evoziert wird.
Die Organisation der Wahrnehmung bleibe im Verlauf des menschlichen Le- bens nicht immer gleich. So sei die Wahrnehmung des Kindes noch anders, im Sinne der Umweltanpassung schlechter organisiert als jene des Erwachsenen. Die Organisation der Wahrnehmung bilde sich im Entwicklungsprozess durch Neuorganisationen weiter in Richtung einer optimierten Anpassung. Merleau-Ponty resümiert, dass „diese völlig neue Auffassung des Inhalts des Bewusstseins […] wichtige Konsequenzen für die Theorie der sinnlichen Er- kenntnis“ (PW 25) hat. Das sei jedoch etwas, was die Gestaltpsychologie selbst kaum behandle, vielmehr nehme sie wie andere Psychologien eine Haltung ein, die „eine Welt der Dinge und eines immanenten Bewusstseins“ (PW 25) un- terscheide. Vielversprechend fährt er fort: „Wir glauben dagegen, dass man sich auf eine ganz andere Lösung hin orientieren muss.“ (PW 25) Doch verrät der Autor von dieser neuen Lösung noch nichts.
Bevor wir im vierten Kapitel dieser Arbeit auf diese verheißene Lösung eingehen, wollen wir uns dem Gestaltbegriff zuwenden, um uns so weit wie möglich den diesbezüglichen Hintergrund zu erarbeiten, aus dem Merleau-Ponty wesentliche Komponenten seiner Lösung entwickelt.
Wir sind in diesem ersten Kapitel einem herausragenden Studenten und so- dann einem jungen, ehrgeizigen Philosophen begegnet, der entschieden Position bezieht gegen ein alles überschauendes, sowie gegen ein alles zum Objekt machendes Denken, das er für die Krise verantwortlich macht25, in der die Phi- losophie nach seinem Urteil steckt. Er traut es sich offensichtlich zu, diese Kri- sensituation als Aufforderung zu verstehen, neue Lösungsansätze für eine Phi- losophie zu suchen, die die gesamte Erfahrung des Menschen umfassen soll. Er nimmt diese Krisensituation gewissermaßen als die seinige an.26
Im gestalttheoretischen Denken glaubt der französische Philosoph die ent- scheidende Referenzposition gefunden zu haben, die es ihm erlaubt, zu einer Revision der Grundbegriffe anzusetzen. Grundlegend ist dabei die Anerken- nung der Wahrnehmung, die selbst in sinnlicher Form Erkenntnisse stiftet und nicht als durch den Verstand vermittelt zu verstehen ist. Es ist die Gestalt, spontane Organisation des sensorischen Feldes, die das Mannigfaltige in der Wahrnehmung zu einem bedeutungsvollen Ganzen zusammenfügt und nicht eine intellektuelle Synthese.
Merleau-Ponty geht es allerdings nicht einfach um eine neue Theorie der Wahrnehmung, sondern darum, welche erkenntnistheoretischen Konsequen- zen aus der veränderten „Auffassung des Inhalts des Bewusstseins“27 zu ziehen sind und letztlich um den transzendentalen Gesichtspunkt schlechthin. Wir können uns deshalb nicht damit begnügen, verstehen zu wollen, was Ge- stalt für Merleau-Ponty in der PhW bezeichnet. Entscheidend wird vielmehr sein zu verstehen, wie oder inwiefern Gestalt „Inhalt des Bewusstseins“ sein kann, d.h. lässt sich Gestalt direkt ‚denken‘ oder nur als Beschreibung eines Prozesses darstellen?
2. SEMANTISCHE ANNÄHERUNG AN DIE GESTALT
„Wir haben also mit dem Begriff der ‚Gestalt' das geeignete Mittel gefunden, um die klassischen Antithesen […] zu vermeiden. Ganz allgemein erspart die- ser Begriff uns die Alternative einer Philosophie, die äußerlich verbundene Glieder nebeneinander ordnet, und einer anderen Philosophie, die die inne- ren Beziehungen des Denkens in allen Phänomenen wiederfindet. Doch gera- de deswegen ist dieser Begriff doppeldeutig [ambiguë].“ (SV 143)
Merleau-Ponty misst dem Gestaltbegriff bei der Fundierung seiner Philosophie eine entscheidende Funktion zu: Er ist ein Mittel, das es ermöglicht, über eine Fragestellung zu reflektieren, deren Gegenstandsbereich weder empiristische noch idealistische Denktraditionen erschließen können. Was hat es mit dieser Denkfigur auf sich, die eine Erfahrung, die bislang nicht zu Wort gekommen ist, in einen verstehbaren Zusammenhang überführen will?
Wenn wir nun die Spur des Gestaltbegriffs aufnehmen und ihr folgen, so in der Absicht, diese Gedankenwelt der Gestalt näher kennenzulernen und ihre Sinn- bezüge nachzuvollziehen. Um uns das, worin Merleau-Ponty eine Alternative zu bisherigen Philosophien erblickt, transparent zu machen, wollen wir unsere Aufmerksamkeit aber auch auf die Art und Weise der Repräsentation der Ge- stalt im Bewusstsein richten. Wir suchen auch das aufzuspüren, was man die Grammatik dieses Gestaltdenkens (oder müsste es heißen: Gestaltschauens?) nennen könnte. Wir suchen zu verstehen, welche Regeln dabei zum Zug kom- men.
Wir haben es dabei, das bereitet uns immer wieder von Neuem erhebliche Schwierigkeiten, einerseits mit einem Begriff zu tun und andererseits mit etwas Unbegrifflichem. Wir sehen diese Ambiguität am Werk, wenn sich das Phänomen im Denken bemerkbar macht, dass die Sache manchmal in den Griff zu kommen scheint, um sich alsbald wieder einem klaren Zugriff zu entziehen. Die im obigen Zitat erwähnte Ambiguität scheint uns nicht nur inhaltlicher Art zu sein, vielmehr betrifft sie auch die semantische Form.28
Wir werden uns deshalb zuerst mit der Gestalt als Begriff befassen und uns danach nach einer semantischen Form für das Unbegriffliche umsehen. Letzteres ist ein Experiment auf der Suche nach etwas Ordnung in diesem Hin und Her von Begriff und Unbegrifflichem; vielleicht hilft es zu klären, welchen Platz wir der Gestalt im Denken zuordnen sollen.29
2.1 GESTALT - EIN MEHRDEUTIGES KONZEPT
Der Begriff Gestalt steht „für eine typisch deutsche Diskurstradition.“30 Tat- sächlich gelingt die Übersetzung in andere europäische Sprachen nicht ohne Schwierigkeiten mit der Ausnahme von einigen nördlichen Sprachen, in denen sich, wie das Grimmsche Wörterbuch31 erklärt, dem Deutschen entlehnte Wör- ter ausgebildet haben wie etwa das polnische kształt, das niederländische ge- stalte, das schwedische gestalt oder das tschechische křstalt. Umfangreiche Online-Wörterbücher32 geben hingegen im Englischen eine ganze Reihe an Übersetzungsversionen an: form, build, character, coherent perception, con- formation, design, figure, form, frame, guise, likeness, shape, stature, und schließlich auch noch das deutsche gestalt - eine Wortauswahl, die eindrück- lich auf die Mehrdeutigkeit des Begriffs und auf dessen verschiedene Aspekte hinweist, wie etwa das ästhetische, das strukturelle, das genealogische, das holistische oder auch das phänomenologische Moment. Bei den Französisch- Übersetzungen33: configuration, créature, forme, individu, personne, personna Cassirer, Ernst: Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977, S. 175.
ge, silhouette, tournure kommt zudem der anthropomorphe Akzent noch deut- licher zum Ausdruck, ein Aspekt, der eine zentrale Rolle spielt, wenn es um die eigentümliche Qualität des Gestaltbegriffs geht. Die Assoziation mit der Vor- stellung des menschlichen Körpers verleiht dem Gestaltbegriff nicht nur eine sinnliche Ausstrahlung, daraus ergibt sich auch die Möglichkeit zur Identifizie- rung. Eine Gestalt kann man (als äußeres Objekt) wahrnehmen, man kann sie (als Subjekt) sein und man kann sie (als innere Objekt- und/oder Subjekt- Repräsentanz i.S. einer psychischen Struktur) in sich haben. Diese semantische Mehrdeutigkeit eröffnet ein breites Spektrum von Interpretations- Möglichkeiten, so dass sich das Gestaltkonzept als sehr anpassungsfähig für verschiedenste Theorieansätze erweist. Allerdings zieht dies auch Unklarheiten mit sich. Ob der vielen verschiedenen, zum Teil sogar widersprüchlichen Be- deutungs-Zuordnungen, verliert der Begriff seine Griffigkeit, er zerrinnt zwi- schen den Fingern, wenn man ihn begreifen will.
Lässt sich im Rückgang auf die Anfänge einen eindeutigeren Anhaltspunkt für den Begriff finden? Etymologische Wörterbücher klären auf, dass das Wort Gestalt in der nominalen Form (Singular) seit dem Mittelhochdeutschen in Ge- brauch ist. Es leitet sich von althochdeutsch ‚stellan‘ (setzen, stellen) her, und ist ein Partizip des Präteritum. Die Zeitform zeigt an, dass es sich um das Er- gebnis eines Tuns handelt, eines Prozesses, der ein Agens voraussetzt, eben dasjenige, welches gestaltet hat. Es ist bemerkenswert, dass die gestaltende Kraft nicht selbst wahrnehmbar ist, sondern nur ihre Spur in Form der Gestalt. Es ist gewissermaßen ein Prädikat ohne explizites Subjekt. Grimm34 führt fol- gende Bedeutungen für das Wort Gestalt auf:
1.) „die art, wie etwas gestalt, gestellt, beschaffen ist, wie es damit steht.
Die Gestalt bezeichnet erstens die Art der Beschaffenheit, die sich im Zustand, in der Reaktionsweise, im Verhalten oder auch im Stil zeigen kann. In gewisser Weise drückt sich etwas Inneres, die Konstitution, etwas, das eher erfahrbar als direkt sichtbar ist, in der Gestalt aus.
2.) die art, wie etwas aussieht, das aussehen, das äuszere.
Zweitens bezeichnet sie das rein Äußere, das Aussehen, wobei es sich auch um einen trügerischen Schein handeln kann.
3.) die art, wie sich etwas in festen Umrissen, mit unterscheidenden Merk-ma- len darstellt: mhd. diu driu wort 'bilde ...
Drittens bezeichnet das Wort Gestalt die Form, die sich von Anderem in charakteristischer Weise unterscheidet. Es kann sich dabei um eine rein physische oder um eine abstrakte oder geistige oder auch um eine symbolische Form (z.B. die Elemente im Sakrament des Abendmahls) handeln.
4.) Träger der Gestalt, Person, Wesen.“
Schließlich kann damit auch der Träger der Gestalt selbst gemeint sein. Meistens wird damit ein Wesen bezeichnet, das nicht klar erfasst, nicht in gewohnte Kategorien eingeordnet werden kann.
Die Gestalt erscheint etymologisch wie auch vom Gebrauch her als ein mehrdeutiges Konzept mit auffallend anthropomorphen Zügen, das Inneres und Äußeres, sowie Form und Prozesshaftes erfassen kann.
2.2 DIE SEMANTISCHE FORM DER GESTALT
Die Gestalt weist die semantische Eigenart auf, anstelle einer logischen Aus- sage Bedeutung in bildhafter, analoger Weise zu evozieren. Das trifft zwar nicht bei jedem Gebrauch dieses Wortes zu. Tatsächlich wird es heute häufiger in synonymer Weise zum Formbegriff verwendet. In unserer Thematik der Natur der Wahrnehmung geht es jedoch um das Sinnliche, primär um das Bildhafte35. Wir wollen prüfen, ob wir die Gestalt im Zusammenhang mit unserer Frage als eine Art Metapher ansehen können. Am Schluss möchten wir u.a. die folgende Frage beantworten können: Ist die Art und Weise, wie die Gestalt in der PhW zum Einsatz kommt, mit der Funktion einer Metapher vergleichbar? An dieser Stelle möchten wir dazu einige vorbereitende Fragen klären.
Wir fragen uns, was eine Metapher ist, welche Rolle sie im philosophischen Diskurs einnehmen kann und wie ein solcher Diskurs zu verstehen wäre. Im zweiten Schritt prüfen wir, inwiefern unsere Gestalt auf die MetaphernDefinition zutrifft und was sie allenfalls davon unterscheidet.
2.21 DIE METAPHER IM PHILOSOPHISCHEN DISKURS
Nach Aristoteles drückt die Metapher etwas bildhaft aus, indem sie etwas aus einem üblichen Gebrauchsbereich in einen fremden Bereich überträgt und so Bedeutungen freisetzt. Die Übertragung kommt durch eine Ähnlichkeit zustan- de, die bereits besteht oder die durch die Metapher hergestellt wird.36 Da sich die Metapher einer eindeutigen Bestimmung entzieht, gleichzeitig aber doch in ihrer stellvertretenden Funktion eine Präsenz markiert, eignet sie sich dazu, für eine logische Verlegenheit einzuspringen37. Wo der Begriff fehlt, kann eine Metapher überbrücken. Wie kommt das? Betrachten wir das Ganze der Sprache als das Ganze, was wir wissen können und die Metapher sowie den Begriff als Elemente dieses Ganzen. Die mehrdeutige Metapher zeigt sich in dieser Perspektive als ein Moment eines weniger differenzierten Standes auf dem Weg zur Begriffsbildung und - unter der Voraussetzung, dass es sich um einen Gegenstandsbereich handelt, der grundsätzlich in Begriffen fassbar ist, - als eine Vorform des Begriffs.
Blumenberg unterscheidet Metaphern als Restbestände und solche als Grund- bestände der philosophischen Sprache. Die ersteren sind als „Rudimente auf dem Wege vom Mythos zum Logos“38 zu sehen und weisen im Hinblick auf das Ideal des reinen Logos auf die Vorläufigkeit des jeweiligen Standes der philoso- phischen Begriffsbildung hin. Sie stellen Überbleibsel einer undeutlichen und unreflektierten Sprache dar, die noch auf den Begriff zu bringen sind. Die Letz- teren, Blumenberg bezeichnet diese als „absolute Metaphern“, stehen für Übertragungen, die sich überhaupt nicht in Begrifflichkeit überführen lassen.39
Doch was ist dieses ‚Etwas‘, das übertragen wird? Im Falle der absoluten Metaphern ist es das, was Waldenfels als ‚Bruchlinien der Erfahrung‘40 bezeichnet, es lässt sich nicht in Worte fassen.
In kognitiver Hinsicht ist die Metapher nicht nur Behelf. Ihr kommt im Werden des Begriffs eine eigenständige, strukturierende Leistung als eine Art der Welt- erschließung zu. Sie bildet selbst Welt und leitet Gedanken. Sie erfasst auf ihre Weise Zusammenhänge, die bestimmte Fortsetzungen nahe legen und andere Möglichkeiten wenig wahrscheinlich machen. In umgekehrter, gewissermaßen regressiver Richtung, vom Begriff zur Metapher, kann sie eine pragmatische Funktion ausüben. Sie stellt rückwärtig die Verbindung zur Lebenswelt wieder her.41 Können wir unsere Erfahrung im abstrakten Begriff kaum wiederfinden, so finden wir uns in der bildhaften und mehrdeutigen Metapher viel leichter. Das geht einher mit einer Re-Kontextualisierung.
Dem philosophischen Diskurs bietet sich die Metapher als semantische Form für das Vorfeld der Begriffsbildung an. Da, wo wir uns nicht auf bestehende Begriffe stützen können, da wo vertraute Paradigmen aufgelöst werden sollen, weil die ihnen impliziten Wert- und Handlungsorientierungen an hinderliche Schranken stoßen, leitet die Metapher wertvollen Dienst. Als „Artikulationsmit- tel des Unbegreifens und Vorbegreifens“42 weist sie auf jene Voraussetzungen hin, die bei der Begriffsbildung als Leitbilder involviert sind. Indem die bildhafte Metapher vom abstrakten Begriff zurück zur Anschauung führt, unterwandert sie die Begriffsarbeit und löst bestehende Strukturen auf, so dass normativ Ausgegrenztes wieder zum Vorschein kommen kann. Es ist eine Regression im Dienst der Revision von Konstitutionsgründen des Wissens.
Was sich im Nachhinein sachlich formulieren lässt, dürfte sich im Vollziehen einer solchen ‚Operation‘ allerdings weniger harmlos durchführen lassen. Wenn die Signifikanten ihren Dienst als Träger von definierten Bedeutungen versagen, wenn also die Bedeutung von tragenden Begriffen zweifelhaft wird,
lockert sich der durch sie befestigte Bedeutungsgrund und die pathischen Un- tergründe machen sich mit Affekten bemerkbar, Boten einbrechender Fremd- heit, Aufforderung zu Veränderung, etc.. Das macht ein Umdenken - vielleicht sogar ein radikales - erforderlich, das kaum sofort durchgehend gelingen kann, sondern in mühevoller Arbeit nach und nach entwickelt werden muss. Diese Erschütterungen können mitunter auch Selbstverständlichkeiten der philoso- phischen Berufsidentität in Frage stellen. Möglicherweise werden andere Ein- stellungen oder Haltungen herausgefordert. So ist es keineswegs selbstver- ständlich, dass die in Frage gestellten Strukturen nicht sogleich wieder irgend- wie befestigt werden, und dass dem Gleiten der Signifikanten nicht entgegen gewirkt wird. Doch ist es für einen vielseitigen Diskurs von Vorteil, wenn der Metapherologe die Unbestimmtheit als erwünschten Faktor schätzen kann. Es kann nicht seine Aufgabe sein, die die kulturelle Gemeinschaft betreffenden Fragen, die er aufgerissen hat, mit seinen eigenen Antworten zuzudecken. Es ist die offene Frage, die sichtbare Kontingenz, die den Diskurs in Bewegung versetzt.
Was hat das Ganze zu bedeuten? - Die Antworten auf diese Fragen entstehen in einem solchen Diskurs im Rückgang auf die Lebenswelt, wo in vielfältigen Perspektiven und Kontexten die konkrete (nicht die gedachte) Erfahrung zu befragen ist. Die Metapher dient als „provisorischer Ordnungsentwurf“, als ein „Anhalt von Orientierungen“, die einer Welt Struktur geben. Sie „repräsentieren das nie erfahrbare, nie übersehbare Ganze der Realität.“43
Was das Ganze bedeutet haben wird, wird sich erst aus einer Position der Nachträglichkeit beantworten lassen. „Die Wahrheit der Metapher ist eine véri- té à faire“.44
2.22 DIE GESTALT ALS METAPHER BZW. ALS UNBEGRIFFLICHKEIT
Können wir nach dem im letzten Abschnitt Gesagten der Gestalt die semantische Form der Metapher zuordnen?
Die Gestalt ist nicht in dem Sinn eine Metapher, dass sie selbst ein Wortbild wäre in der Art, wie etwa das Licht als Metapher für die Wahrheit stehen kann. Sie überträgt nicht Bedeutungen von einem üblichen in einen fremden Bereich, vielmehr überträgt sie ‚Etwas‘ in Bedeutung, sie ist das metapherein selbst. Trotz diesem Unterschied passt Blumenbergs Metapherntheorie so perfekt auf unsere Gestalt, dass wir den Eindruck gewinnen, letztere habe für erstere Mo- dell gestanden! Die Metapher begreift die Gestalt. Mit Hilfe der semantischen Form der Metapher lässt sich die Gestalt in der unbegrifflichen Funktion besser begreifen.
Das muss mit dieser Verknüpfungsart von Figur und Grund zu tun haben, mit der die Gestalt operiert. Kleist habe, so Blumenberg, die Unterscheidung der Menschen in zwei Klassen vorgeschlagen: „in solche, die sich auf eine Metapher und 2) in solche, die sich auf eine Formel verstehn.“45 Nur wenig Menschen ge- be es, die sich auf beides verstünden. Formeln verbinden Prozesse vom An- fangszustand zum Endzustand ohne Bezugnahme auf die konkrete Empirie zu erfordern. Die Konstanzannahme wäre hier also gültig. Hingegen will „Unbeg- rifflichkeit […] mehr als die ‚Form‘ von Prozessen oder Zuständen, sie will deren ‚Gestalt‘.“46 Unbegriffliches drängt zur Anschauung in der empirischen Gegens- tändlichkeit. Die dreidimensionale Gestalt wäre dann eine Stufe weiter weg vom unausgedehnten Begriff als die bildhafte Metapher. Den Rückgang in die Lebenswelt wäre demnach im Falle der Gestalt ganz konkret zu verstehen, ein Rückgang zum Tun, zum Erfahren in der leiblichen Existenz.
Wir sind in diesem Kapitel davon ausgegangen, dass die Ambiguität der Gestalt bei Merleau-Ponty nicht allein eine Mehrdeutigkeit des Bezeichneten meint, die Natur der Sachen betrifft, sondern dass sie auch das Denken selbst meint,
was sich entsprechend in der semantischen Form niederschlägt.47 Wir haben uns deshalb zuerst mit der Gestalt als Begriff befasst, der sich als mehrdeutiges Konzept mit anthropomorphem Charakter erweist. Die folgende Suche nach einem Platz in unserem Kopf für die unbegriffliche Seite der Gestalt führte uns über Blumenbergs Metapherntheorie zur Unbegrifflichkeit der dreidimensiona- len Gestalt, die als Referenz die konkrete, leibliche Erfahrung aufzusuchen drängt.
2.3 BEMERKUNGEN ZUR GESTALT BEI GOETHE UND BEI HEGEL
An dieser Stelle war es vorgesehen, im Sinne einer historisch-semantischen Erkundung, die Prägung der Gestalt durch Goethe und die Reflexion des Ge- staltbegriffs durch Hegel zu untersuchen. Das Ganze wurde jedoch zu umfang- reich. Es zeigte sich auch, dass der Beitrag zum vorliegenden Thema im Ver- hältnis dazu zu gering war, so dass wir uns mit wenigen Bemerkungen begnü- gen wollen.
Goethe, der im Rahmen seiner Morphologie den Gestaltungsprinzipien durch intuitive Schau auf der Spur war, prägte diese Denkfigur wesentlich und war für einige Gestaltpsychologen und insbesondere für Goldstein nachweislich eine stete Quelle der Inspiration. Sein „morphologischer Blick“48 impliziert ein Durchlässiger-Werden für das Nachfahren der Genese der Gestalt, denn der Bauplan dazu trägt der Schauende in seinem eigenen Leib.49 Diese Entspre- chung von innen und außen, die sich in den berühmten Zeilen Goethes: „Wär‘ nicht das Auge sonnenhaft, wie könnten wir das Licht erblicken?“50 ausdrückt, ist als etwas zu verstehen, das aufgrund der Lebensbedingungen (bzw. der Be- dingungen des Systems) geworden ist:
„Das Auge hat sein Dasein dem Licht zu danken. Aus gleichgültigen thierischen Hülfsorganen ruft sich das Licht ein Organ hervor, das seines Gleichen werde; und so bildet sich das Auge am Lichte für’s Licht, damit das innere Licht dem äußeren entgegentrete.“51
Wir erkennen in diesem Zitat einen Grundgedanken, den wir später bei Goldstein und auch bei Merleau-Ponty wiederfinden.52
Während Goethe durch vertiefende Schau in die Gestaltprinzipien des konkret Gegenwärtigen Erkenntnisse gewinnt, bildet Hegel aus wenigen abstrakten Begriffen durch logische und subtile Analyse und Konstruktion eine Reihe von lebensnahen Gestalten, wobei Hegel in der Ästhetik die Erfahrungen seines poetischen Freundes herbeizitiert. So erscheinen die beiden, Goethes erschaute Gestalt und Hegels logische Gestalt, als die zwei Nahtstellen, an denen sich anschauliches Bilden und Denken berühren.53
In der Erwartung, bei Hegel entscheidende Anhaltspunkte zu erfahren, hatten wir die Bewegung der Gestalt von der Enzyklopädie über die Vorlesungen zur Ästhetik bis hin zur Phänomenologie des Geistes verfolgt, an dessen Ende die Gestalt zum Begriff wird. Als Ergebnis für das vorliegende Thema können wir ein besseres Verständnis über die Enttäuschung unseres französischen Philosophen über die Kojève-Seminare anführen.
3. GESTALTTHEORIE UND GESTALTPSYCHOLOGIE
Auf der Schwelle zum 20. Jahrhunderts kam es zu einer erneuten Hochkonjunk- tur des Gestaltbegriffs54. Man kann die ganzheitliche Gestaltidee dabei als Ge- genbewegung, als Antipode oder auch als Ergänzung zum allgemeinen Trend der Modernisierung und der gesellschaftlichen Ausdifferenzierung verstehen. Jedenfalls liegt das holistische Gestaltdenken quer zu der sich unaufhaltsam fortsetzenden Differenzierung der modernen Wissenschaften und gerade des- halb gewinnt es an Attraktivität; es hat dieses ‚gewisse Etwas‘, eine Aura des Einzigartigen und irgendwie Rätselhaften. Insbesondere aber verspricht es mehr Sinn zu stiften, als das diesbezüglich oft unbefriedigende empirische Un- tersuchungen über irgendein praxisfernes Detail vermögen.
Die Initialzündung für die neue Welle des Gestaltdenkens erfolgte durch Chris- tian von Ehrenfels. In seinem mittlerweilen berühmten Aufsatz Über ‚Gestalt- qualitäten‘55 bezieht er sich auf die Schrift von E. Mach, Beiträge zur Analyse der Empfindungen (Jena 1886) und hebt daraus die Behauptung hervor, „dass wir Raumgestalten und selbst ,Tongestalten‘ oder Melodien unmittelbar zu ‚empfinden‘ vermögen.“56 Es handelt sich dabei nicht um eine „blosse Zusam- menfassung von Elementen, sondern als etwas (den Elementen gegenüber, auf denen sie beruhen) Neues und bis zu einem gewissen Grade Selbständiges“.57 Am Beispiel der Melodie zeigt Ehrenfels die Eigenschaften auf, die eine Gestalt auszeichnen, eben ‚die Gestaltqualitäten‘, deren Grundlage er an „Vorstellung- scomplexen im Bewusstsein“58 festmacht. Die Übersummativität besagt, dass eine Gestalt etwas anderes ist als die Summe ihrer Teile. So ist eine Melodie offensichtlich etwas anderes als die Summe der Töne, aus der sie besteht. In einer anderen Reihenfolge sind dieselben Töne nicht mehr als dieselbe Melodie zu erkennen. Hingegen kann die Melodie in einer anderen Tonart gespielt werden, so dass keines der ursprünglichen Elemente erhalten bleibt und dennoch die Melodie wiedererkannt wird. Letzteres stellt das zweite der beiden Ehrenfels-Kriterien für die Gestalt dar, die Transponierbarkeit.
Mit diesen Kriterien bereitete Ehrenfels einen anderen Zugang zum Gestaltkon- zept vor, der mit den wissenschaftlichen Methoden der Moderne besser zu vereinbaren war als die intuitive Schau Goethes oder die spekulative Systema- tik Hegels. Spezifische Eigenschaften der Erscheinungsform Gestalt mit dem Kernproblem von Teil und Ganzem konnten in empirischen Experimenten un- tersucht werden. Damit befassten sich insbesondere drei Schulen: die Grazer und die Wiener Schule der Gestaltpsychologie, die Leibziger Schule der Ganz- heitspsychologie und die Berliner Schule der Gestaltpsychologie.
Wir befassen uns an dieser Stelle allein mit der wichtigsten dieser drei Schulen, der Berliner Schule der Gestaltpsychologie, die für den Gestaltbegriff von Merleau-Ponty wegweisend war.
Obschon das Gestaltkonzept in der Psychologie die am meisten ausgeprägte Aufnahme fand, beschränkte sich das Interesse keineswegs auf dieses Wissensgebiet, sondern erstreckte sich auch auf andere Wissenschaften, wie die Biologie, die Physik, etc.. Dem trägt der allgemeiner zu verstehende Begriff Gestalttheorie Rechnung, der mit dem Anspruch einer allgemeinen Relevanz für die Wissenschaften im Sinne einer Metatheorie einhergeht und der seinen Anfang an der Wurzel der Berliner Schule nahm.
3.1 DIE BERLINER SCHULE DER GESTALTPSYCHOLOGIE
Die Frankfurter (später Berliner) Schule der Gestaltpsychologie wurde im Sommer 1913 gegründet. Die drei Gründer, Max Wertheimer, Kurt Koffka und Wolfgang Köhler reagierten mit diesem Schritt auf ein komplexes Orientie- rungs-Problem der damaligen experimentellen Psychologie Deutschlands. Die- se, verstrickt in diskursiven Normen, die auf einem mechanistischen und empi- ristischen Wissenschaftsmodell beruhten, war nicht in der Lage, sich in adäqua- ter Weise mit wichtigen Tatsachen des Bewusstseins und insbesondere der ästhetischen Erfahrung zu befassen.59 Wertheimer beschreibt diese Grundsituation in seinem Vortrag Über Gestalttheorie:
„Ist es nicht so, dass etwas an der Grundeinstellung der früheren Wissen- schaft ist, was sie vielfach, nicht immer, blind macht gegen gerade das We- sentliche, gerade das Lebendige, gerade das Entscheidende dessen, was uns im Leben und beim lebendigen Anschauen der Begebenheiten entgegent- ritt?“ 60
Das, was die Wissenschaft „blind macht gegen das Wesentliche“ glaubt Wer- theimer in dem zu erkennen, was er als das Grundproblem der Gestalttheorie formuliert:
„Es gibt Zusammenhänge, bei denen nicht, was im Ganzen geschieht, sich daraus herleitet, wie die einzelnen Stücke sind und sich zusammensetzen, sondern umgekehrt, wo - im prägnanten Fall - sich das, was an einem Teil die- ses Ganzen geschieht, bestimmt von inneren Strukturgesetzen dieses seines Ganzen.“61
Indem nun die Gestaltpsychologie die Gesetzlichkeiten von der Struktur des Ganzen her zu verstehen suchten, nahmen sie sich als Projekt eine radikale Rekonstruktion des psychologischen Denkens vor. Diese neue Psychologie sollte sowohl die Anforderungen an die Wissenschaftlichkeit der Methode erfüllen, als auch die Bedürfnisse nach Antworten auf philosophisch und psychologisch relevante Fragen befriedigen können.
Tatsächlich hatten die meisten Gestaltpsychologen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowohl Psychologie als auch Philosophie studiert und brachten daher die Voraussetzungen mit, sich in diesem Feld wissenschaftlich zu betäti- gen. Die drei Gründer der Berliner Schule waren da keine Ausnahme: Max Wertheimer, 1880 in einer deutschsprachigen, jüdischen Familie in Prag geboren, wurde von seiner literarisch versierten und musikalischen Mutter insbesondere musisch gefördert. Er spielte Klavier und Geige. Sein Vater war ein wohlhabender Geschäftsmann. Spinozas Ethik, die Max Wertheimer zum
10. Geburtstag vom Großvater geschenkt bekommen habe, soll er mit größtem
Interesse und Eifer gelesen haben.62 Wertheimer besuchte eine katholische Grundschule, danach das berühmte Neustadt Gymnasium. Außerhalb der Schu- le studierte er ferner Hebräisch und lernte die Torah. An der Charles Universi- tät in Prag schrieb Wertheimer sich zuerst in der juristischen Fakultät ein, be- suchte aber auch Kurse in Philosophie, Physiologie (bes. Medizin, Psychopatho- logie und Psychologie), Musik und Kunstgeschichte. Nach 5 Semestern wechsel- te er zur Philosophie, wo die Vorlesungen von Christian von Ehrenfels auf sei- nem Studienprogramm dominierten.
Kurt Koffka, geb. 1886 in Berlin, stammte aus einer kosmopolitischen Familie der Oberschicht. Der Vater war Jurist, wie mehrheitlich die Vorfahren. Von ei- ner Gouvernante lernte Kurt Koffka bereits als Kind englisch und er blieb zeitle- bens anglophon. Er besuchte das renommierte Wilhelmsgymnasium und inter- essierte sich früh für Philosophie. Er schrieb sich in diesem Fach in der Universi- tät ein und begann sein Studium unter dem Neukantianer Alois Riehl. Nach einem akademischen Auslandjahr in Edinburgh wechselte Koffka zur Psycholo- gie bei Carl Stumpf, weil er, wie er erklärte, zu realistisch sei um sich mit reinen Abstraktionen einer idealistischen Philosophie zufrieden zu geben.63
Wolfang Köhler wurde 1887 in Reval, dem heutigen Talinn geboren. Beide El- tern entstammten einem Milieu von Ministern. Der Vater war Direktor des Gymnasiums zuerst in Reval, dann in Wolfenbüttel, wo der Sohn graduierte. Köhler entschied sich zuerst für ein Philosophie-Studium, schrieb sich jedoch auf Rat von seinem Lehrer, Friedrich Geitel64, in ein mehr naturwissenschaft- lich ausgerichtetes Studium ein, wobei er sich jedoch einen breiten Mix von Fächern aussuchte: Mathematik, Naturwissenschaften, Psychologie, Philoso- phie und Geschichte. Er studierte zuerst in Tübingen, dann in Bonn und wech selte 1907 nach Berlin, um bei Stumpf in Psychologie zu dissertieren. Wie Wertheimer war auch Köhler musisch begabt; er spielte in einem Kammerorchester Klavier und Geige.
Wertheimer, Köhler und Koffka hatten sich während des Studiums einen brei- ten Background sowohl in Philosophie als auch in Naturwissenschaften angee- ignet. Alle drei beherrschten mindestens zwei der gängigen Forschungsmetho- den der Psychologie und hatten sich mit den konzeptuellen Präsuppositionen wie auch mit der experimentellen Untersuchungssituation auseinanderge- setzt.65 Ihr Projekt der Gestaltpsychologie war nicht nur eine Reaktion auf eine Krise der Psychologie, sie sahen darin auch einen Weg, auf experimentelle Art und Weise Philosophie zu betreiben.66
Ihre radikale Rekonstruktion der Psychologie lässt sich in vier Stadien untertei- len:
Erstes Stadium: Wertheimer konzipiert eine neue Epistemologie und verbindet sie mit seiner berühmten Untersuchung über das Phi-Phänomen. Die Epistemologie umfasst folgende Erkenntnisse67:
- Inhalte des Bewusstseins sind meistens nicht summativ, sondern konstituie- ren eine charakteristische Art des Zusammengefügtseins, welche sich auf eine bestimmte Struktur bezieht. Diese wird oft von einem inneren Zentrum her ‚verstanden‘, das jedoch nicht einem idealen Vorstellungsinhalt entspricht; vielmehr ist es z.B. optischer, akustischer, dynamischer oder auch intensitäts- mäßiger Art. Zu diesem sind die anderen Teile der Struktur in einem hierarchi- schen System organisiert. Solche Strukturen heißen Gestalten.
- Fast alle Eindrücke werden entweder in chaotischen Massen (was ein relativ seltener Fall ist) oder als chaotische Massen auf dem Weg zu schärferer For- mierung oder als Gestalten erfasst. Was schließlich erfasst wird, sind „Gebilde- fassungen“. Zu diesen gehören die Objekte in einem weiten Sinn des Wortes wie auch die „Beziehungszusammenhänge“68. Sie sind etwas spezifisch Unter- schiedliches von der Summe und mehr als die Summe der Elemente. Oft wird das Ganze erfasst, bevor die Elemente bewusst wahrgenommen werden.
- Der Erkenntnis-Prozess ist sehr oft ein Prozess der Zentrierung, der Strukturie- rung, wobei eine Einheitlichkeit der einzelnen Teile durch ein sinngebendes Ganzes erfolgt. Das Resultat dieses Prozesses ist ein Herausspringen von Ge- stalt von etwas, das noch nicht gestaltet ist. Durch diesen Vorgang werden Elemente und spezifische Zustände verständlich. Die so gewonnene Einheit hängt nicht allein vom Objekt, sondern auch vom betrachtenden Subjekt ab. Das Resultat ist aber nicht beliebig; nur jene Lösung kann richtig sein, die alle Elemente unter einer sinngebenden Idee zusammenfasst und so das Ganze verständlich macht.
Es ist eindrücklich, wie viel von dem, was später als entscheidende Neuerung anerkannt wird, bereits in dieser Konzeption von Wertheimer im Jahr 1913 angelegt ist: Die wesentlichen, grundsätzlichen Prinzipien der Gestaltpsycholo- gie sind hier bereits entworfen. Auch die unterschiedliche Konzeption des Be- wusstseins und das Primat der Wahrnehmung, das, was in Analogie zum ‚lin- guistic turn‘ als ‚perception turn‘ bezeichnet wurde, ist in dem neuen Ver- ständnis der Rolle, die den Sinnesdaten im Erkenntnisprozess zugeteilt wird, impliziert. Entscheidend ist die ambigue Verwendung des Terms Gestalt: Er bezieht sich sowohl auf individuelle Objekte, als auch auf die Organisation der Objekte im psychologischen Feld. Damit ist dieser Gestaltbegriff in der Lage, eine Zwischenstellung zwischen Subjekt und Objekt einzunehmen und deren scharfe Trennung zugunsten eines fließenden Übergangs aufzuheben. Was durch diesen epistemologischen Rahmen in den Blick kommt, ist die Perspekti- ve samt der Einsicht, dass diese eine notwendige Bedingung für Erkenntnis ist. Die Verbindung seiner Epistemologie mit den Untersuchungen über das soge- nannte Phi-Phänomen69 war für den Nachweis, dass der Übergang im seeli-
schen Gestalt annimmt70, sowie methodologisch von großem Interesse: Wer- theimer demonstrierte, wie psychologisch und philosophisch relevante Fragen mit einer wissenschaftlich fundierten, experimentellen Praxis zu verbinden sind. So konnte er mit den Ergebnissen aus den experimentellen Untersuchun- gen überzeugend zeigen, dass im Psychischen Gestalten das Ursprüngliche sind. Die Resultate verbindete Wertheimer mit einem physiologischen Modell. Er benützte dabei nicht eines der bekannten erkenntnistheoretischen Schema- ta: weder ein empiristisches noch ein rationalistisches, sondern er restruktu- rierte das Schema im Sinne einer physiologischen Theorie. Diese hat nach Wer- theimer zwei Funktionen in Verbindung mit experimentellen Untersuchungen: sie muss erstens diverse individuelle Resultate und generelle Regeln in einer vereinigenden Weise umfassen und diese von einer Theorie ableitbar machen. Und zweitens muss die Theorie weitere Fortschritte in der Forschung vorberei- ten durch konkrete experimentelle Fragen, die zuerst die Theorie prüfen und sodann zu einem vertieften Verständnis der Gesetzmäßigkeiten der Phänomegezeigt. Auf dem ersten (a) ist links eine senkrechte Linie zu sehen, auf dem zweiten (b) eine identische Linie waagerecht rechts unten. Bei idealem Präsentations-Intervall von 6o Millisek. der beiden Stimuli entsteht der Eindruck, dass sich die Linie (wie ein Scheibenwischer) bewegt. Wird das Tempo der Darbietung noch etwas erhöht, nimmt die Vpn Bewegung ohne Objekt wahr. Diese Bewegungsgestalt nennt Wertheimer das Phi-Phänomen. Es handelt sich dabei nach Wertheimer ausdrücklich nicht etwa um eine Täuschung. Wird nämlich bei einer Täu- schung die betreffende Versuchsperson darüber aufgeklärt, verschwindet das Phänomen, ganz im Gegensatz zum Phi-Phänomen und anderen Gestalten, die nach der Erklärung noch deutli- cher ausfallen. Wesentlich ist, dass diese Bewegung nicht unterschieden werden konnte von real bewegten Objekten. Das Phänomen an sich ist mindestens seit 1850 bekannt, doch erst Wertheimer konnte es befriedigend erklären. Es handelt sich bei diesen Phänomenen nicht um psychisch sekundär ergänzte Elemente, wie man es sich bisher erklärt hatte, sondern um pri- mär gegebene Zusammenhänge, ein spezifisches und vollgültiges seelisches Erleben. Psycholo- gisch gesehen bestehen Reize gar nicht. Was ist hier psychologisch gegeben, wenn man Bewe- gung sieht? - Es ist nach Wertheimer „Ein spezifisches Hinüber von Erregung“(Wertheimer 1912). Was in den seelischen Phänomenen das erste und ursprüngliche, eben das Phänomena- le (ɸ - wovon übrigens der Ausdruck Phi-Phänomen abgeleitet ist) ist, das sind Gestalten, Be- wegung, Zusammenhang, Übergänge. (Für eine detailliertere und gut leserliche Beschreibung der Experimente she. Fitzek/Salber 1996, S. 27 ff.). ne führen.71 Allem voran ging aber stets eine detaillierte phänomenologische Beschreibung.
Nach diesem ersten Stadium, also bereits 1913, waren die epistemologischen und methodologischen Positionen der Gestalttheorie in den wesentlichen Zügen bereits definiert.
Zweites Stadium: Die Gestaltpsychologen entwickeln Wertheimers theoretische Perspektive weiter und wenden sie zuerst auf die Wahrnehmung und auf menschliches Verhalten und dann auf Problemlösen von Tieren an.
Das Phi-Phänomen konturierte einen psychologischen Gegenstand, der ganz- heitliche, gestalthafte Züge aufwies. Die Gestaltpsychologen bemühten sich nun darum, dieses Übergangsphänomen zu spezifizieren. Sie suchten nach Ge- setzen, die die Wahrnehmung organisieren und entwarfen dazu Experimente mit figuralen Anordnungen. Die auf diesem Weg gefundenen Gestaltgesetze des optischen Erfahrungsraums stellen noch heute so etwas wie das Marken- zeichen der Gestaltpsychologie dar. Die Forscher fanden eine ganze Reihe sol- cher Gesetzmäßigkeiten, wie etwa das Gesetz der Gleichheit und das Gesetz der Nähe, die die Gruppenbildung betrafen oder auch die Gesetze der Geschlos- senheit, wobei eine objektiv nicht geschlossene Figur als geschlossene wahrge- nommen wird. Diese sind zusammengefasst in dem bekanntesten und gleich- zeitig am meisten kritisierten Gesetz der guten Gestalt (auch als Prägnanzge- setz bekannt), das besagt, dass die Wahrnehmung möglichst prägnante Formen zu erfassen sucht. So wird etwa undeutlich Wahrnehmbares zu einer möglichst eindeutigen Gestalt vereinfacht. Außerdem waren noch zwei Gesetze beson- ders wichtig: - Die Thematisierung der Figur gegenüber dem Grund, die häufig mit den sogenannten Kipp-Figuren untersucht wurden. (Dabei kippt die Wahr- nehmung zwischen Figur und Grund ohne einer bewussten Steuerung zu unter- liegen.) Und - die Einteilung des Wahrnehmungsfeldes in Wichtiges und Un- wichtiges, das im Zusammenhang steht mit der Intentionalität des Betrachters. Manche Figuren zeigten Unterschiede zwischen der Wahrnehmung von Erwachsenen und jener von Kindern und demonstrierten, dass die Wahrnehmungsgestalten durch Erfahrung geprägt werden.
Im Rahmen des gestaltpsychologischen Programms der Rekonstruktion der Psychologie versuchte Köhler nun, die Konstanzannahme zu widerlegen, mit der Helmholtz eine eins-zu-eins-Beziehung zwischen Reiz und Empfindung postuliert hatte. Obwohl diese Hypothese seit 20 Jahren immer wieder angeg- riffen wurde, hielt sie sich standhaft. Köhler zeigte in seinem Aufsatz von 1913 Über unbemerkte Empfindungen und Urteilstäuschung, dass sie weder veri- fiziert noch falsifiziert werden kann, weil durch sie nicht überprüfbare Akte (unbewusstes Urteilen) und Einheiten (Empfindungen) unterstellt werden, und gerade das mache sie als wissenschaftliche Hypothese unhaltbar.
Ein weiterer Schritt in der Restrukturierung der Psychologie markieren Koffkas Aufsätze zur Theorie der Wahrnehmung, die von Grund auf restrukturiert und gestaltpsychologisch formuliert wurde: Koffka postulierte, dass die Wahrneh- mung nicht von Empfindungen herzuleiten sei. Weder psychologisch, noch lo- gisch, noch geschichtlich seien elementare Empfindungen primär. Das Wahr- nehmungsganze bzw. die Gestalt lasse sich nicht auf weitere Teilsachverhalte zurückführen. Die Gestalt sei unableitbar. Koffka verlegte ferner den Reizbe- griff. Ein Reiz bezieht sich demnach nicht mehr wie bislang auf ein Muster von Erregungen an einem Sinnesorgan, sondern auf ein reales äußeres Objekt in funktionaler Beziehung zu einem wahrnehmenden und handelnden Organis- mus. Dasselbe Objekt kann dabei für den gleichen Organismus zu einem Zeit- punkt lediglich ein sensorischer Reiz und zu einem andern Zeitpunkt ein Ge- stalt-Stimulus sein. So ist ein Wurm für einen hungrigen Fisch ein anderer Sti- mulus als für einen satten. Damit wird deutlich, dass Ganzheiten nicht losgelöst von Intentionalität und Erfahrung, sondern in direkter Korrelation mit den Reiz- Erfahrungen konstruiert werden. Koffka zog nun den Schluss, dass Gestalten nicht nur in der Wahrnehmung festzustellen sind, sondern dass auch das Han- deln durch Gestaltprinzipien geleitet sei.
Diese Auffassung anerkannte auch Köhler, wie aus seinen allgemein bekannten Schimpansenversuchen hervorgeht. Er beobachtete und beschrieb das Verhal- ten von Affen in Problemlösungssituationen, die etwa darin bestanden, Bananen aus einer nicht ohne Hilfsmittel erreichbaren Distanz irgendwie herzuho- len. Das Gestaltexperiment kam hiermit erstmals in eine anschaulich lebens- nahe Situation. Im einsichtigen Problemlösungs-Verhalten der Affen stellte Köhler die bekannten Organisationsgesetze in Form einer gestalthaften Logik fest. Das Suchen und Einsetzen von Gegenständen im Sinne von Werkzeugcha- rakter vollzog sich nicht nach dem Zufallsprinzip, sondern nach einer gestal- thaften Struktur. Köhler betrachtete die Gestalten als mit eigener Dynamik ausgestattet: Sie tendierten hin zur ‚guten Gestalt‘, zur Prägnanz. Den Gestal- ten wird dabei eine die Handlung strukturierende und leitende Rolle zugespro- chen. Bei Köhler ging so weit, dass die gesamte Versuchsanordnung von den Gestalten gewissermaßen vereinnahmt wurde:
„Handlungssubjekt ist die zur Umstrukturierung tendierende Gestalt, nicht das Versuchstier und auch nicht der Versuchsleiter. Auch der Psychologe selbst folgt den gestalthaften Spannungen und ihren Vereinheitlichungsten- denzen. Als im Feld Beteiligter unterliegt er notwendig den Gestalttendenzen im Feld, sieht Gegenstände und Funktionen in Richtung der im Feld wirken- den ,Vektoren‘.“72
Wir sehen, dass hier offensichtlich eine Grenze überschritten wird73, was in dieser Weise in der Regel in wissenschaftlichen Experimenten konsequent zu vermeiden gesucht wird, dass nämlich der Versuchsleiter Einfluss auf die Resultate nimmt. Wir wollen bei dieser Gelegenheit hier kurz auf die Untersu-chungsmethode der Gestaltpsychologen eingehen.
Für die Gestaltpsychologie, die gerade in diesen Übergängen (zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Sein und Denken) angesiedelt ist, gilt ein anderes Unter- suchungsmodell, das sich vor allem auf sorgfältige und detaillierte Beobach- tung und Beschreibung der Phänomene verlässt und nicht auf eine von der all- täglichen Realität losgelöste Eliminierung der Subjektivität aus der Versuchs- anordnung. Man könnte einwenden, dass hier die Ideale der Wiederholbarkeit und die unpersönliche Objektivität, Kennzeichen eines modernen wissenschaft- lichen Settings, preisgegeben werden. Doch ist das Problem einer naturwissen- schaftlich orientierten, empirisch-analytischen Haltung im Feld der Psychologie, dass sie Bewusstseins-Inhalte versachlicht, d.h., wie materielle Dinge betrach- tet. Sie unterstellt, dass die Inhalte in Teile zerlegt werden könnten und isoliert kleinste Elemente, die sie in einem wissenschaftlichen Setting zu fassen kriegt. Was untersucht wird, ist abhängig von dem, was in dieser naturwissenschaftli- chen Perspektive erfassbar ist. Das führt dazu, dass sie letztlich i.d.R. nur noch Aussagen über Unwesentliches machen kann.74 Notwendigerweise musste die Gestaltpsychologie ein dem psychologischen Gegenstand angemesseneres Ver- fahren entwickeln. Es bestand darin, die psychologische Realität phänomeno- logisch sorgfältig zu beschreiben, die Bedingungen dieses Erscheinens zu defi- nieren und die Prinzipien der Organisation des Bewusstseins, eben den Ge- staltaspekt zu eruieren. Interaktionen mit dem Versuchsleiter in Form von Fra- gen und Hinweisen waren explizit erlaubt. Die Objektivität wurde eben nicht in einer unpersönlichen Methode, sondern in den Phänomenen lokalisiert. Die Beobachter der Untersuchungssituation wurden ausdrücklich angewiesen, nicht auf einzelne Punkte fokussiert zu bleiben, sondern die Augen offen zu halten und mehr ins Feld der Untersuchung einzubeziehen als allein die konkre- te Fragestellung. Gesucht waren Phänomene, die derart eindrücklich waren, dass ihnen zwangsläufig Objektivität zugeschrieben werden konnte. Solche Phänomene mussten dann bei allen Vpn - es waren kaum mehr als 10 - fest- gestellt werden können.75 Wir haben es also mit einer Objektivität zu tun, die, wenn auch in empirischen Experimenten ermittelt, eher rationalistisch begrün- det ist, insofern es Gesetzmäßigkeiten im Akt des Wahrnehmens (oder, das wäre zu klären, in der Beschreibung dieses Wahrnehmens76 ) sind, die hier fest- gestellt werden.
Drittes Stadium: Köhler erweitert das Gestaltprinzip auf die externe Welt und auf das psychophysische Problem.
Während Wertheimer auch in seinen psychophysiologischen Überlegungen stets nahe bei der Phänomenologie der Gestalten blieb und ihre Dynamik im- mer mehr an spürbaren Übergängen („ein Hinüber von Erregung“) lokalisierte, verstanden Köhler und Lewin Gestalten ausdrücklich im physikalischen Sinn77, was ihnen die Kritik, um nicht zu sagen den Hohn Merleau-Pontys eingetragen hat. Dieser physikalische Status der Gestalt kommt bei Köhler explizit zum Aus- druck in seinem philosophischen Hauptwerk Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand. Er weitete das Gestaltkonzept von der Wahr- nehmung und vom Verhalten auf die physische Welt aus und versuchte, den Holismus und die Naturwissenschaft unter einen Hut zu bringen. In seiner apersonalen Betrachtungsweise fragte er sich, welche Prozesse in den beo- bachteten Tieren ablaufen. Er suchte die neurophysiologischen Prozesse, die den Gestaltphänomenen unterlegt sind, in Termen der Physik von Feldkontinua zu formulieren. Er bezog sich konzeptuell auf Maxwells Treatise of Electricity and Magnetism (1873) und die darauf aufbauende Idee, dass Kraftfeldern eine unabhängige Existenz zukomme. Die Gestalten, die Köhler zu erfassen suchte, waren allerdings keineswegs wirklich physisch, sondern durchaus psycholo- gisch. Er ließ sich von einer physikalischen Feldtheorie leiten, entwarf daraus eine psycho-physische Feldtheorie, indem er die Ehrenfels Kriterien der Über- summativität und der Transponierbarkeit darauf anwandte. Hingegen sprach er nicht wie Ehrenfels von Gestaltqualitäten, sondern in der Art, dass diese Ge- stalten seien. Köhler betrachtete nämlich Prozesse, Fluss, Verteilung als ontolo- gisch und epistemologisch primär; fixe Objekte stellten dann erst daraus her- vorgehende sekundäre Arrangements dar. Sowohl psychophysische wie auch psychologische Gestalten sind nach Köhler geprägt durch reale Struktureigen- schaften, was er später als psychophysischen Isomorphismus bezeichnete. Köh- lers Ansatz mündete in eine Naturphilosophie des energetischen Feldes. Seine Idee des Feldes als gestalthafte Struktur wird von Lewin und auch von Gurwitsch aufgegriffen, auf dessen Feldtheorie wir im nächsten Abschnitt zurückkommen werden.
Viertes Stadium: Wertheimer präsentiert Studien über produktives Denken als Prolegomena einer neuen Logik.
Wertheimer, der während des ersten Weltkrieges u.a. Vorlesungen in allge- meiner Philosophie, Logik, Erkenntnistheorie und Pädagogik hielt, begann da- mit, die Gestalttheorie in Richtung einer neuen Logik zu entwickeln. Er befand, dass die traditionelle Logik mit dem klassischen Syllogismus kein neues Wissen hervorzubringen vermag und fragte sich, was in produktivem Denken vor sich geht. Er hatte darüber auch einmal in einem persönlichen Gespräch mit Albert Einstein gesprochen. Er hypostasierte, dass es neben der analytischen „Logik mit dem Messer“ eine andere, „die Logik mit dem Sack“ gebe, die eine Logik von Klassen sei. Er schlug vor, Abläufe im realen Leben nach produktiven Prob- lemlösungsmethoden zu untersuchen und danach, wie es hier zu einer Restruk- turierung oder Rezentrierung der Situation komme. Wertheimers Beispiele und seine diesbezügliche Betonung von visuellen Metaphern waren allesamt Remi- niszenzen von Köhlers ,Intelligenz-Tests‘ mit Affen. Stets war dabei das Denken eng verbunden mit Wahrnehmung und Handlung und der Veränderungspro- zess hatte diese charakteristische, diskontinuierliche Form, wie es bei den Af- fen der Fall war.78
Wir skizzierten in diesem Abschnitt, wie die Gestaltpsychologen allmählich die- se Zwischenposition zwischen einer reinen Bewusstseinsphilosophie und der Position der objektiven Naturwissenschaften entwickelten. Bereits Stumpfs Idee, für Antworten auf philosophische Fragen auch experimentelle Wege zu beschreiten, impliziert diese Mischung einer Logik mit dem Messer und jener mit dem Sack oder wie wir auch sagen können, von deduktiver Logik und induktiven Konklusionen.
Mit der Erforschung der Gestaltgesetze wird die Erfahrung befragt. Zwar ist auf der Ebene der Wahrnehmung nicht ohne weiteres klar, inwiefern es sich bei diesen Gestaltgesetzen eigentlich um eine Art Heuristiken - vereinfachende Prozess-Regeln, die sich in der Praxis bewährt haben - handelt, die sich mit der Erfahrung gebildet haben. Bei der Ausweitung der Gestalttheorie auf die Hand- lungsebene zeigt sich dies schon ausgeprägter. Wir haben es hier mit Erfah- rungsgesetzen und damit mit den Gesetzen einer praktischen Vernunft zu tun. Das ist zwar etwas, was durch die Tendenz Köhlers und Koffkas, die Gestalten im physikalischen Sinn verstehen zu wollen, verwischt wird, aber in Werthei- mers Studien über das produktive Denken wieder auf die kognitiven Operatio- nen des Subjekts zurückgeführt wird.
Bereits im Zusammenhang mit Blumenbergs Theorie der Unbegrifflichkeit sind wir darauf gestoßen, dass die Konstanzannahme hier, bei der Bezugnahme auf die empirische Gegenständlichkeit, beim Schließen durch Induktion, nicht gilt. Das zugrundeliegende Wahrheitsmodell prüft nicht auf logische Kohärenz, es ist nicht ein Denken in Formeln, sondern es beinhaltet eine pragmatische An- näherung an das, was sich in der Erfahrung bewährt. Deshalb ist es in der Lage, neues Wissen zu entwerfen. Aber diese Erkenntnis basiert auf Deutungsarbeit, es ist eine Präsumtion und diese ist abhängig von der Situation, aus der sie ent- sprungen ist. Das wird offensichtlich, wenn wir das Phänomen Gestalt im le- bensweltlichen, sozialen Kontext sehen, wie das bei Goldstein und Gelb der Fall war.
3.2 GOLDSTEIN UND GELB
Kurt Goldstein wurde 1978 in Kattowitz (Oberschlesien) geboren. Er war das siebte von insgesamt neun Kindern. Nach seinem Abschluss am Gymnasium in Breslau studierte er an den Universitäten Breslau und Heidelberg zuerst Philo- sophie und Literatur. Er wechselte dann zur Medizin und studierte bei Carl Wernicke, ein in der Neurologie bekannter Forscher, nach dem das von ihm entdeckte sensorische Sprachzentrum im Gehirn, das Wernicke-Areal benannt wurde.
Nach seiner Graduierung 1903 nahm Goldstein eine Assistenten-Stelle am Frankfurter Neurologischen Institut an unter Ludwig Edinger, einem erfolgrei- chen Hirnforscher und Professor für Neurologie. Von 1906 - 1914 arbeitete Goldstein als Psychiater und Neurologe in der Psychiatrischen Klinik Königs- berg, wo er sich auch für experimentelle Psychologie zu interessieren begann. 1914 kehrte er nach Frankfurt zurück als erster Assistent von Edinger.
Noch im gleichen Jahr eröffnete er jedoch sein eigenes Institut für hirnverletzte Soldaten auf der Basis privater Finanzierung. Auch wenn das Institut für die Erforschung der Folgeerscheinungen von Hirnverletzungen in seiner Bezeich- nung die Forschung betonte, so war sein Zweck doch in erster Linie von prakti- scher Art: die Pflege, Unterstützung und schließlich die Rehabilitierung der Ver- letzten, damit diese wieder mit ihrem Leben zurecht kamen, sei es zurück an der Front, in einer zivilen Beschäftigung oder als Rentner. Ein solcher Hinter- grund erlaubte es nicht, lediglich Experimente innerhalb eines engen theoreti- schen Rahmens zur Bestätigung einer bestimmten Theorie durchzuführen, wie es für eine empirische Untersuchung der damaligen Zeit typisch gewesen wäre. Das gängige Paradigma in der neurologischen Forschung, das von Carl Werni- cke geprägt war, sah nämlich hirnorganische Störungen als eine einfache Stö- rung einer Wahrnehmungs- oder einer motorischen Funktion an, die als psy- chologische Reflex-Bögen betrachtet wurden. Reflexbögen bezeichnen die Ver- bindung, über die Daten in spezifische zerebrale Zentren in der Nähe von Hirn- regionen mit höheren Funktionen gespeichert werden. Forscher identifizierten vor diesem Theorie-Hintergrund verschiedenste Störungen wie Agnosie, Agra- phie, Alexie, Akalkulie und Apraxie. Goldstein, der selbst an solchen Studien beteiligt gewesen war, vermochten die erzielten Forschungs-Resultate nicht von diesem Paradigma zu überzeugen.
Gegen dieses Theorie-Modell kam in der Tat zunehmend Kritik auf, z.B. von Sigmund Freud, Pierre Marie (Neuropathologe an der Salpétrière) und Konstan- tin von Monakow (ein in Zürich tätiger russischer Neuropathologe). Gegen eine strikte Lokalisierung sprach, dass verlorene Funktionen meist zu einem gewissen Grad durch andere Hirnregionen kompensiert werden konnten. Was bez- weifelt wurde, war die Beziehung von peripheren und zentralen, von tieferen und höheren Hirnzentren bzw. die Erklärung der Krankheit „von unten“, als einer Störung von fixen Reflexwegen zu spezifischen, lokalisierten Zentren. Max Wertheimer war auf diese Debatte von verschiedener Seite aufmerksam gemacht worden und beteiligte sich daran aufgrund von gestaltpsychologi- schen Forschungsergebnissen, die ebenfalls dem gängigen Theorie-Modell zu widersprechen schienen, ohne aber eine angemessenere Erklärung anbieten zu können.
Im Rahmen seines neuen Instituts hatte Goldstein die Möglichkeit, diese Zu- sammenhänge zu erforschen. Sowohl für diagnostische wie für Forschungs- Aufgaben richtete er eine psychologische Abteilung ein. Er rekrutierte Adhémar Gelb, der seine Dissertation über Gestaltqualitäten bei Carl Stumpf am Berliner Institut für Psychologie geschrieben hatte. Gelb war mit den Methoden der Gestaltpsychologie vertraut durch seine Anstellung als Assistent in Berlin wie auch durch seine Tätigkeit als Nachfolger von Koffka am Psychologischen Insti- tut der Universität Frankfurt.
Entscheidend war nun, dass Gelb die Untersuchungsmethoden modifizierte. Er benutzte wie andere Gestaltpsychologen auch Apparate wie das Tachistoskop, das sehr kurze Darbietungen von visuellen Reizen projizieren konnte. Um diffe- renziertere Analysen von Funktionsstörungen durchzuführen, erweiterte er jedoch die engen Grenzen der Untersuchungsanordnungen. Er ging dazu über, die Patienten zur Mitarbeit zu gewinnen und trainierte sie, ihm von sich aus zu rapportieren, was sie sahen. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten hätten die Patienten den Dreh zur Selbstbeobachtung bald begriffen und Resultate von eindrücklicher Qualität erzielt.
„He [Gelb] and Goldstein […] claimed, using Wertheimer’s language, that the- se were ‚pure‘ cases of the phenomena in question, and therefore of funda- mental theoretical importance. Paradigmatic was the case ‚Sch.‘...“ 79
Die Untersuchungsanordnungen unterlaufen also eine strikte Trennung von Subjekt und Objekt. Das Objekt der Untersuchung wird selbst zum aktiven Mituntersucher. Die Beobachtung von äußerem Verhalten vermischt sich mit der Selbstbeobachtung des Patienten, so dass es auch zu Überschneidungen von innen und außen kommt. Wir haben es hier eben nicht mit der Überprüfung einer Hypothese zu tun, die zu kausalen Attributionen führen soll, sondern mit dem Entwerfen neuer Deutungen über empirische Zusammenhänge, die an der Erfahrung in einer bestimmten, phänomenologisch beschriebenen Situation gemessen werden.
Wir wollen an dieser Stelle noch kurz auf den Fall „Sch.“ eingehen, einen 24- jährigen Mann, der zwei Schussverletzungen am Hinterkopf hatte, wovon eine Kugel das Hirn durchdrungen hatte. Es handelt sich offensichtlich um den Fall Schneider, auf den sich Merleau-Ponty immer wieder in seinen Studien bezieht. Sch. konnte sprechen, war aber nicht in der Lage, ihm präsentierte Figuren oder Wörter direkt zu erkennen. Sch. zeichnete die Figuren mit Kopf und Hand nach. Mittels dieser Bewegungen gelang ihm das Lesen. Sch. selbst war sich seiner Methode nicht bewusst und meinte, auf normale Art zu lesen. Gelb und Goldstein bezeichneten dies als „Figuren Blindheit“80, weil die Form als Ganzes in der Wahrnehmung nicht präsent war. Für diesen Zustand hatten sie einen entscheidenden diagnostischen Test, den sie mit dem Tachistoskop durchführ- ten und der zeigte, dass Sch. ohne Zuhilfenahme seiner Hände nur ‚isolierte Fetzen im Raum‘ sah. Landschaftsbilder erschloss sich Sch. durch logische Fol- gerungen. So erkannte er ein ihm gezeigtes Bild mit Bäumen auf den Seiten und einer Lichtung in der Mitte durch folgende Überlegungen „it may be a road coming out oft the forest because it is brighter at the opening“.81 Dies waren nach Gelb und Goldstein Beispiele dafür, dass Sch. den Verlust der Formerken- nung durch Reorganisation von sensorischen Funktionen auf einem tieferen Niveau kompensierte. Gelb und Goldstein schlossen aus dem Verhalten von Sch. auf einen Verlust der Funktion verbunden mit „Gestalt sehen“.82
Diese Hinweise beabsichtigen nicht die Untersuchung des Falls Schneider dar- zustellen. Sie sollen lediglich illustrieren, was man sich unter Kompensation durch niedrigere Funktionen vorstellen soll und was Gelb und Goldstein als ‚Gestalt‘ bezeichneten. Gestalt war übrigens, wie Goldstein feststellte, ein Phä- nomen das in reiner Form nur beim Sehen nachgewiesen werden konnte. Nach 1927 distanzierte sich Goldstein von der Gestalttheorie. Er bekräftigte zwar, dass die Psychologie für die Neurologie wichtig sei. Es sei jedoch nicht weise, sich als Neurologe durch irgendwelche psychologischen Sichtweisen leiten zu lassen. Die Doktrin von Assoziationismus und Reflex hatten ihre all- gemeine Akzeptanz in der Hirnforschung nicht eingebüßt und unterstützten die Lokalisierungstheorie. Nachdem nun seine und andere Untersuchungen auf der Basis von funktionaler Substitution und Kompensation diese Doktrinen angrif- fen, fragte er, ob er denn jetzt Vertreter der Gestaltpsychologie werden sol- le….83
Goldstein entschied sich anstelle der Gestaltpsychologie für eine Ganzheitsme- thode, um sowohl das Reflex-Lokalisations-Modell wie auch die damit verbun- denen Diagnostik- und Behandlungsmethoden zu ersetzen. Es beinhaltete 3 Prinzipien: 1. Untersuchungen sollten von einem phänomenologischen Ge- samtblick vom ganzen Organismus in einem partikularen Setting ausgehen. Nicht die Verletzung alleine, der Einfluss auf die ganze Person war entschei- dend für die Beeinträchtigung des Patienten. 2. Das Nervensystem ist als ein Netzwerk zu betrachten, und nicht als eine Kollektion von separaten anatomi- schen Teilen. Der Organismus ist eine psychophysische Einheit, ein selbstaktua- lisierendes Individuum, das seine bevorzugte Leistungsfähigkeit optimiert als Antwort auf äußere Irritation. 3. Die Genesung oder die Reorganisation im Falle der Krankheit wird vom gesamten Organismus getragen, der den Schaden zu kompensieren sucht.84
Goldsteins Ganzheitsmethode hatte unverkennbar Ähnlichkeiten mit der Ge- stalttheorie: Die Bemühung um eine ganzheitliche Sichtweise des Gegebenen, wie auch die Überzeugung, dass der Organismus als Ganzes eine Lösung auf seine Beeinträchtigung anstrebt, kennen wir von der Gestalttheorie. Hingegen bezog sich Goldstein nicht auf eine Beziehung zwischen Organismus und Umwelt als eine objektive Struktur, wie es die Gestaltpsychologen taten, sondern auf den Organismus allein. Goldstein, der regelmäßigen Kontakt mit seinem Cousin, Ernst Cassirer pflegte, kritisierte die Gestalttheorie in seinem Haupt- werk Der Aufbau des Organismus (1934) mit mehr Nachdruck als je zuvor. Er betrachtete eine ‚gute Gestalt‘ nicht als gut für sich, eine Sichtweise, die er den Gestaltpsychologen vorwarf. Ob eine Gestalt gut ist oder nicht, misst sich nach Goldstein vielmehr daran, wie der Organismus mit seiner Welt zurechtkommt, wie er sich am besten entsprechend seiner Natur aktualisiert. Goldstein bezieht somit die ‚gute Gestalt‘ auf die Erfahrung, wie es auch später Merleau-Ponty tun wird.
Der Blick auf die Theorie von Goldstein und seine mit Gelb durchgeführten Un- tersuchungen verdeutlicht, dass Merleau-Ponty den beiden, eigentlich auch dem mitwirkenden Schneider, insbesondere aber Goldstein, viel verdankt: Hier ist nicht nur die Quelle, das Entspringen der neuen Erkenntnisse über die Natur der Wahrnehmung zu finden, sondern auch die Einbindung dieser Erkenntnisse in eine Philosophie der Erfahrung, die etwa das Konzept der Selbstaktualisie- rung und die Konzeption des Organismus als eine Weise des Zur-Welt-Seins beinhaltet. Selbst die Kritik, die Merleau-Ponty an der Gestalttheorie äußert, ist hier bereits vorgedacht.
Nachdenklich stimmt, dass das individualistische Verwenden einer ganzheitli- chen Sichtweise Goldstein zwar profiliert, aber auch von der wissenschaftlichen Gemeinschaft separiert hatte. Die Tatsache, dass die Rehabilitation der Patien- ten nicht vollständig, sondern in beschränktem Ausmaß gelang, zeigt, dass die Ganzheitlichkeit bzw. die Anpassungsfähigkeit begrenzt ist. Auch ist nicht klar, ob eine Rehabilitierung von komplexen Funktionen verbunden mit einer eher undifferenzierten Ganzheitsorientierung dem Problem angemessener ist oder ob eine weniger rigide Konzeptualisierung von individuellen Funktionen mehr leisten könnte. Tatsache ist, dass die Hirnforschung auch heute noch von Ale- xie, Apraxie, Akalkulie etc. und von entsprechenden Hirnarealen spricht; gleich- zeitig wird aber auch dem Umstand bei der Rehabilitation Rechnung getragen, dass Fehlfunktionen teilweise kompensiert werden können.
3.3 VON DER GESTALTTHEORIE ZU EINER ‚NICHT EGOLOGISCHEN‘ PHÄNOMENOLOGIE
Inspiriert von Köhler, der den Feldbegriff der Physik auf die Gestalttheorie übertragen hatte, hatten verschiedene Forscher den Feldbegriff für ihre Disziplin nutzbar gemacht. Insbesondere in der Biologie fand der Feldbegriff rege Aufnahme, so etwa bei Alexander Gurwitsch mit seinem Konzept des morphischen Feldes in der Embryogenese.
Kurt Lewin (1890 - 1947), der wie Wertheimer, Köhler, Koffka und Gelb in Ber- lin bei Stumpf in Psychologie promoviert hatte, arbeitete in Berlin eng mit Wer- theimer und Köhler zusammen. Für seine sozialpsychologisch ausgerichteten Untersuchungen hatte er die gestaltpsychologische Methode modifiziert, in- dem er psychoanalytisches Gedankengut einfließen ließ. Das tat er auch bei der Entwicklung des Feldbegriffs für die Sozialpsychologie, wo er von der experi- mentellen Gestaltpsychologie kaum berücksichtigte Gebiete wie Wille, Affekt und schließlich auch das Unbewusste als steuernde Kraft in seine Konzeption mit einbezog. Ein sehr wesentlicher Schritt, der nach ihm auch Aron Gurwitsch vollzog, war aber die Verbindung der Feldtheorie mit Husserls Phänomenolo- gie. Indem die Erkenntnisse aus der Feldtheorie auf die Lebenswelt bezogen werden, wird letztere zu einem Ort der Theoretisierung des Bewusstseins-, des Wahrnehmungs- und des Handlungsfeldes.
Lewins phänomenologische Studie Kriegslandschaft ist inspiriert durch eigene Fronterfahrung. Diese Landschaft ist in Zonen eingeteilt, die entsprechend der aktuellen Kampfsituation einen Gefahr- oder einen friedlichen Charakter haben und die Vorstellungen wie auch das Verhalten der sich dort aufhaltenden Per- sonen mitbestimmt.
Anhand dieses anschaulichen Beispiels hebt Lewin drei theoretische Akzente der Feldtheorie hervor: - Das Umfeld ist für die betroffenen Personen bedeu- tungsvoll und es ist nach funktionellen Aspekten gegliedert. - Es übt eine dynamische Wirkung aus; es beinhaltet sogenannte Valeurs und Valenzen. - Die- ses strukturierte und dynamische Umfeld ist der Lebensraum.85 Plötzliche Ereignisse können die Situation und damit den Kontext des Gesamt- feldes schnell verändern. Dann verändern sich auch die Aufforderungscharak- tere, die vom Feld ausgehen, denn es sind die Tatsachen im Umfeld, die zu Handlungen und Verhalten auffordern. Der Aufforderungscharakter ist aber nicht nur von der äußeren Situation abhängig, sondern auch von der inneren Situation der Person, ihrer Bedürfnisse, ihrer momentanen Befindlichkeit, etc.. Auf diesem Weg entsteht eine dynamische Beziehung zwischen Umwelt und Person. Es ist dieser Aufforderungscharakter86, der zentral ist, um die Feld- struktur der Wahrnehmung und der Handlung zu erklären.
Wie aus dem Gesagten deutlich wird, gelang es Lewin, die physikalischen Begriffe der Energie und der Spannung in psychologische Phänomene umzudeuten, so dass das physikalische Moment verschwindet, während die dynamischen Feldeigenschaften bestehen bleiben.
Anders als die physikalische Feldtheorie Köhlers und auch anders als die psy- chologische Feldtheorie Lewins, die sich nicht auf den Horizontbegriff bezie- hen, bildet die Ebene des Horizonts eine Grundlage in Aron Gurwitschs phäno- menologischer Feldtheorie. Die phänomenologische Horizontstruktur kombi- nierte er mit einem gestalttheoretischen Element, der Struktur Thema- thematisches Feld, wobei das thematische Feld (wie Lewins Zonen) strukturiert und organisiert ist, im Gegensatz zum Horizont, der relativ unartikuliert ist. Es handelt sich bei diesem Strukturelement offensichtlich um eine Variation der gestalttheoretischen Struktur Figur/Grund, die nun aber auf die Dimension Feld ausgeweitet wird.87 Die Struktur Thema-thematisches Feld gilt ihm als eine uni-
versale Form der Selbstorganisation, sowohl für Beziehungen des Bewusstseins als auch für den sozialontologischen Bereich. Sie drückt die Relation Teil/Ganzes aus, wobei das Thema ein ausgezeichneter Teil darstellt im Ver- hältnis zum thematischen Feld, das für das Ganze steht.88 Wie wir von der Ge- staltpsychologie her wissen, erlaubt eine solche Struktur die Beschreibung ei- ner zweiseitigen bzw. einer zirkulären Beziehung.89 Das ermöglicht es grund- sätzlich, sowohl der Passivität wie einer aktiven Stellungnahme eines Ichs Rechnung zu tragen.
Gurwitsch entfaltet zuerst die Struktur Thema-thematisches Feld am Phäno- men Wahrnehmung und entsprechend am Wahrnehmungsbewusstsein und nicht an einem transzendentalen Bewusstsein. Seine grundlegende These be- steht darin, dass sich das Wahrnehmungsnoema autochthon organisiert, näm- lich durch einen spontanen Gestaltvorgang. Mit Hilfe des aus der Gestaltpsy- chologie adaptierten Strukturelements kann es Gurwitsch vermeiden, die Wahrnehmung im Sinne einer Leistung noetischer Akte eines reinen Ichs zu formulieren und stattdessen zu einer Strukturanalyse des Wahrnehmungs- noema übergehen, das die Form einer Analyse des Wahrnehmungssinnes an- nimmt. Dass diese ichlose Wahrnehmung dennoch offen bleibt für subjektive Anteile, dass sie also nicht 100 % passiv ist, sondern dennoch Wahrnehmungs- akt bleibt, geht letztlich auf die Ablehnung der Konstanzannahme zurück, wie wir sie von der Gestaltpsychologie her kennen.
Gurwitschs Wahrnehmungstheorie fundiert also nicht in einem urteilenden und Stellung nehmenden Ich bzw. einer egologischen Konzeption, sondern in einer vorprädikativen Erfahrung. Die Evidenz der Wahrnehmung bezieht sich dann auch auf das ganz normale, alltägliche Erleben, in dem die Andern von Anfang an ganz selbstverständlich da sind und wo es keinen Anlass dazu gibt, uns explizit zu versichern, dass es sie gibt.
sen Rubins betreffen also einen Sonderfall der allgemeinen formalen Struktur Themathematisches Feld“ . zit. nach Choi 1997, S. 92.
Das von Gurwitsch sogenannte non-egologische Bewusstseinsfeld ist natürlich durchaus zu vereinbaren mit Ich-Funktionen, die darin wirksam sind. Allerdings sei der Ich-verlorene Zustand vorherrschend. Das trifft nicht nur im Schlaf oder in der frühen Kindheit zu; selbst wenn ein Subjekt seine Aufmerksamkeit ganz auf einen Gegenstand seines Interesses richte, vergesse es sich selbst und es sei wenig wahrscheinlich, dass eine Repräsentation seines Egos in den bewuss- ten Handlungen interveniere. Nimmt das Subjekt eine reflexive Einstellung ein, wird das Erfahrene aufgrund eines intellektuellen Schemas der Ichaktivität re- konstruiert. Doch ein Ich, das als einzige Instanz der Erfahrung gilt und als Ak- teur, das alle Bewusstseinsakte betrachten könnte, gibt es nach Gurwitsch gar nicht.
Die Stärke dieser phänomenologischen Feldtheorie Gurwitschs liegt darin, dass sie neben dem aktiven auch den passiven Teil der Wahrnehmung berücksichti- gen kann. Der passive Teil besteht darin, dass Reize auf den Körper bzw. auf das Subjekt einwirken und Vorstellungen auslösen können. Die Schwäche liegt darin, dass sie auf die unmittelbare Erfahrung beschränkt bleibt. Merleau-Ponty übernahm wesentliche Züge dieser Theorie, allerdings nicht ohne diese Schwäche durch strukturelle Elemente zu beheben.
4. GESTALT BEI MERLEAU-PONTY
Gestalt ist bei Merleau-Ponty nicht ein Begriff unter anderen, sondern die fun- damentale Denkfigur, mit der er sich, mit Unterbrüchen zwar, immer wieder beschäftigte. Bereits im Arbeitsentwurf von 1933 haben wir gesehen, dass die gestaltpsychologischen Erkenntnisse eine zentrale Rolle in seinem Projekt ein- nahmen, ja, der Gestaltbegriff wirkte als Medium für etwas Re-Visionäres, das dem Philosophen irgendwie vorschwebte, und das er auf diese Weise in eine Denkform bringen konnte. Doch auch nach Vollendung dieses Projekts ließ ihm die Gestalt keine Ruhe. Auch im Spätwerk fragte Merleau-Ponty sich: „Qu’est-
ce qu’une Gestalt?“ (VI 258) Die Gestalt war so etwas wie ‚ein Ding an sich‘ für ihn; er versuchte sie immer wieder von Neuem zu denken.90 Auf unsere Frage nach dem Begriff der Gestalt in der PhW dürfen wir also nicht eine abschließende Antwort erwarten, wir haben es vielmehr mit einem Über- gang zu tun, mit einer Zwischenstation im Gestalt-Denken des Philosophen.
4.1 GESTALT ALS ARTIKULATIONSMÖGLICHKEIT DER DRITTEN DIMENSION
Auch der Anfangspunkt dieser Zwischenstation ist zu klären. Wie wir wissen, ist der Gegenstand unserer Untersuchung das zweite der beiden Werke, weshalb es notwendig erscheint, die Beziehung der beiden zueinander im Hinblick auf den Gestaltbegriff zu betrachten. Wir tun dies, indem wir die Zielrichtung des Gesamtprojekts ins Auge fassen und die Rolle der beiden großen PromotionsArbeiten darin zu bestimmen suchen.
Die Arbeiten sind eng aufeinander bezogen; sie sind Teil eines Projekts, das eine neue philosophische Dimension freilegen soll, die sich auf die „gesamte Erfahrung des Menschen“91 erstreckt. Ähnlich wie Wertheimers Kritik an der Psychologie, übte Merleau-Ponty Kritik an der (Reflexions-)Philosophie seiner Zeit. So bezog er etwa an der ENS im Rahmen seiner Repetitor-Tätigkeit Stel- lung92: Die Studenten seien
„nicht […] davon überzeugt, dass der ganze Mensch, ja nicht einmal, dass das Wesentliche des Menschen sich hier befindet. Sie suchen eine gesamte Aktivi- tät philosophisch zu bestimmen, durch eine […] Analyse […], die sich auf Ge- genstände der Erfahrung erstreckt, die nicht jene der exakten Wissenschaften sind: Das Phänomen der Kunst, […] des Andern, der Geschichte.“93
Die Suche nach der neuen Dimension ist letztlich eine Suche nach dem Platz des Menschen in der Philosophie. Die Alternative zwischen einer naturwissen schaftlichen Denkweise einerseits, die in der Bemühung um Objektivität alles Subjektive ausschließen muss und einer Philosophie des Bewusstseins anderer- seits, die im Äußeren nur die Wiederspiegelung der Ideen und Relationen des eigenen Geistes zu finden vermag, ist unbefriedigend. Ja, Merleau-Ponty geht von einer eigentlichen Krisensituation aus.94 Keine der bestehenden Alternati- ven kann der Eigenart der menschlichen Existenzweise, die stets eine Mischung von Aktivität und Passivität, von eignen Entscheidungs- bzw. Bewegungsmög- lichkeiten und Unterworfenheit unter gegebene Bedingungen ist, gerecht wer- den.
Nach dem, was wir mittlerweile über den Gestaltbegriff erfahren haben, er- scheint es uns als naheliegend, dass Merleau-Ponty darin das geeignete Mittel sah, die Möglichkeit einer dritten Dimension zu erkunden und zu artikulieren. Kann dieser ambigue Begriff doch innere Prozesse und äußere Formen, Aktivi- tät und Passivität bezeichnen. So wird ein Feld denkbar, auf dem sich diese dritte Dimension entfalten kann. Das geschieht in den beiden Werken auf ver- schiedene Weise.
In SV nimmt Merleau-Ponty den objektiven Blick der Wissenschaften an und das Feld der Untersuchung ist die äußere Welt, gesehen und vermessen durch wissenschaftliche Theorien.95 Indem er den klassischen, mechanistischen Theo- rien (wie der Stimulus/Reaktions-, kurz S-R-Theorie) die Ergebnisse der Ge- stalttheorie gegenüberstellt, zeigt er die Mängel der naturalistischen Sichtwei- se auf, stellt den aktuellen Stand der Wissenschaften und der Gestalttheorie zum Thema dar und entwickelt in Form einer Theorie des Verhaltens seine ei- gene Position. Die dritte Dimension eröffnet sich auf dem Weg der Vermitt- lungsbegriffe Gestalt und Struktur96 des Verhaltens, die sich der Unterschei- dung in res extensa und res cogitans widersetzen.
Mit der PhW wechselt das Untersuchungsfeld nach innen. Wenn auch nach wie vor mannigfache Untersuchungen der Gestaltpsychologen und insbesondere der Fall Schneider von Gelb und Goldstein zum Zug kommen und sich insofern die Sichtweise gegenüber der SV oft nicht ändert, so stehen diese Ergebnisse nun im Zusammenhang mit Fragen des Bewusstseins. Gefragt ist eine neue Definition der Transzendentalphilosophie, die „bis hin zum Phänomen des Rea- len“ (SV 259) alles zu integrieren vermag. Wie die Gestaltpsychologen sich eine radikale Restrukturierung der Psychologie auf der Basis des Gestaltbegriffs vor- genommen hatten, so geht es Merleau-Ponty um eine Restrukturierung der Philosophie auf der Basis der neuen, auf dem Verständnis der Gestalt auf- bauenden Theorie der Wahrnehmung. Das ist der Weg, auf dem sich in der PhW die dritte Dimension entfalten soll.
Während also in Auseinandersetzung mit den Wissenschaften und der Gestalttheorie der Gestaltbegriff in der SV entwickelt wird, wird er im Rahmen der PhW im Feld des Bewusstseins eingesetzt und so auf seine Konsequenzen hin für die Transzendentalphilosophie befragt.
Im folgenden Abschnitt wird der Gestaltbegriff der SV in den wesentlichen Zügen skizziert, um an die Ausgangslage der PhW heranzuführen.
4.2 ENTWICKLUNG DES GESTALTBEGRIFFS IN DIE STRUKTUR DES VERHALTENS
Merleau-Ponty erläutert in seiner Einleitung, dass er ein Verständnis gewinnen will „von den Beziehungen zwischen dem Bewusstsein und der Natur“ (SV 1). Er wählt als Objekt für seine Untersuchung den Verhaltensbegriff, weil er „in sich neutral ist gegenüber den klassischen Unterscheidungen von ‚Psychischem‘ und ‚Physiologischem‘ und uns so Gelegenheit gibt, beides neu zu definieren.“
(SV 2) Der Philosoph versteht, wie bereits Goldstein, Verhalten als ‚ständige Aus-
einandersetzung eines Organismus mit der Umwelt‘, und setzt anstelle des me- chanistischen Verhaltensbegriffs der amerikanischen Psychologie (SV 3 ) sein Ver- ständnis als Verhalten zu, in dem sich die besondere Beziehung zur Welt zeigt. Merleau-Ponty übernimmt von Koffka die Unterscheidung von geographischer Umgebung und der Umwelt des Verhaltens als jenen Teil seiner Umwelt, auf
die das Tier bzw. der Organismus reagiert (vgl. SV 151 ), eine Unterscheidung, die die Perspektive als Perspektive sichtbar macht. Das so verstandene Verhalten bezieht sich nicht auf ein wissenschaftliches, statistisches Universum, sondern auf eine konkrete Umwelt, ein Milieu, das Strukturen bzw. Gestalten erkennen lässt.
Es handelt sich dabei um einen Gestaltungsvorgang, in dem strukturiert und differenziert wird; in einer horizontalen Verklammerung97 von Organismus und Umwelt wird Ordnung produziert: Sowohl Reize wie Bewegungen formie- ren sich zu Reiz- bzw. Bewegungsgestalten und heben sich von Umgebendem ab. Nie ist das Verhalten als kausales Ergebnis bloß eines isolierten Reflexbo- gens zu verstehen. Es ist bedingt durch Gestalten von Reizen und Bewegungen, sowie durch die übergreifende Struktur des Organismus, die sich im Austausch mit der Umwelt entwickelt hat. Der Organismus selbst trägt dazu bei, Gestalten in der dialektischen Begegnung mit der Umwelt zu bilden. Das vollzieht sich in einem spontan ablaufenden Prozess der Selbstorganisation, wie wir ihn bereits bei Aron Gurwitsch angetroffen haben.
Dieses Modell bestätigt sich auf jeder Ebene des Verhaltens, der physischen, der vitalen und der menschlichen Ebene, welche miteinander in dialektischer Beziehung stehen und zusammen die Einheit des phänomenalen Leibes bilden. Dieses Gefüge von Ordnungen ist horizontal und vertikal in gestalthafter Weise strukturiert.
Bei der Beschreibung dieser Struktur erweisen sich Goldsteins Studien über das Verhalten Hirnverletzter als maßgebend. Sie belegen, dass eine einfache Ent- sprechung zwischen Hirnarealen und Verhaltenssektoren zurückzuweisen ist. Verletzungen eines Hirnareals zeigen sich nicht in einem Verlust bestimmter Inhalte, sondern wirken sich als strukturale Beeinträchtigung des Verhaltens aus, das sich von Neuem gestalthaft organisiert und im Rahmen der verbliebe- nen Möglichkeiten die inneren und äußeren Anforderungen optimal zu bewäl- tigen sucht (vgl. SV S. 73 ff... Selbstverständlich bedeutet das nicht, dass alle Hirnre- gionen sämtliche Funktionen übernehmen könnten, so dass das Hirn als ein globales, indifferentes System betrachtet werden könnte. Vielmehr ist die zer- ebrale Funktionsweise als ein Prozess vom Typ Figur-Grund zu verstehen, also als ein gestalthafter Vorgang (vgl. SV 107 ). Genau das ist es, was es erlaubt, diffe- renzierte Funktionen zu unterscheiden und gleichzeitig die Bedeutung vom ganzen System her zu verstehen. Darauf kommt es an, so Merleau-Ponty in SV, wenn es um die Analyse vitaler Strukturen geht. Ein Lebewesen kann nicht auf der Ebene von kausalen Abläufen, von physisch-chemischen Prozessen erfasst werden; das Phänomen Leben ist nur aus ganzheitlicher Sicht zu beschreiben. Die logische Figur der Gestalt bewahrt davor, dass diese Ganzheitlichkeit zu einer vitalistischen Denkweise zurückführt, weil sie parallel zur Totalität die Differenzierung der Teile zulässt. Wenn die Gestaltpsychologie sagt, dass das Ganze etwas anderes ist als die Summe der Teile, so können wir spezifizieren: Das Ganze unterscheidet sich von der Summe der Teile, insofern es Bedeutung für ein Bewusstsein ist.98 Die Analyse des spezifisch Vitalen führt also zurück zum Phänomenon: „Die Einheit […] des Organismus [ist] eine Bedeutungsein- heit“ (SV 178 ) und etwas weiter fügt er an: “eine Erscheinung im Kantschen Sin- ne.“ (SV 182 )
Während sich die Denkfigur der Gestalt bestens zur Kritik an der naiven Onto- logie des Naturalismus eignet, führen die Analysen, wie Merleau-Ponty fest- stellt, immer näher zu einer „transzendentalen Einstellung, d.h. zu einer Philo- sophie, die jede nur denkbare Realität als Bewusstseinsobjekt behandelt.“ (SV 234 ) So wird es notwendig, die Abgrenzung zum Kritizismus deutlich zu machen:
„Was den tieferen Gehalt der „Gestalt“ ausmacht, von der wir ausgingen, ist nicht die Idee der Bedeutung, sondern die der Struktur, die unlösliche Verbin- dung zwischen einer Idee und einer Existenz, das kontingente Arrangement, durch das Materialien vor unseren Augen einen Sinn annehmen, die Intelligi- bilität in statu nascendi.“ (SV 239 )
Stellte sich die nur aus ganzheitlicher Sicht erfassbare Bedeutung von Lebewe- sen als Abgrenzungskriterium gegenüber dem Naturalismus heraus, so gilt das nicht für den Vergleich mit dem Kritizismus. In einer ersten Schlussfolgerung gesteht Merleau-Ponty zu, dass die Bedeutung durch das Bewusstsein konsti tuiert wird, jedoch handelt es sich dabei nicht um eine Synthese des Verstan- des. Die Bedeutung entspringt der Struktur, die durch die spontane Selbstorga- nisation der Wahrnehmung entsteht und die Existenz mit einer Idee verbindet. Merleau-Ponty unterscheidet zwischen Gelebtem und Erkanntem99. Das Geleb- te ist notwendig gebunden an die leibliche Existenzweise und die sinnliche Wahrnehmung. Das Erkannte als das, was bereits auf den Begriff gebracht wurde, ist intellektueller Art.
„Der Begriff der Gestalt führte uns wie von selbst auf seine Hegelsche Bedeu- tung zurück, d.h. auf den Begriff, bevor er Selbstbewusstsein geworden ist. Doch der Begriff hat gerade als Begriff kein Äußeres, und so musste die Ge- stalt in der Folge gedacht werden als Einheit von Innerem und Äußerem, von Natur und Idee. Dementsprechend war das Bewusstsein, für das die Gestalt existiert, nicht das intellektuelle Bewusstsein, sondern die Wahrnehmungser- fahrung.“ (SV 244 )
Um mehr Klarheit über dieses Wahrnehmungs-Bewusstsein zu gewinnen, muss deshalb die Dimension der Existenz eingeführt werden. Eine solche Philosophie kann sich nicht auf das Bewusstsein beschränken, sondern muss den Leib, als die Grundlage unserer Weise des Existierens und damit der Art, wie wir Erfahrungen machen, miteinbeziehen.
Mit der Forderung, man müsste „die Transzendentalphilosophie neu definie- ren, und zwar so, dass man alles in sie integriert bis hin zum Phänomen des Realen“ (SV 259 ), führt Merleau-Ponty zur Ausgangslage der PhW, wo es gilt, das “Wahrnehmungsbewusstsein […] zu befragen, um in ihm die endgültige Aufklä- rung zu finden.“ (SV 244 ) Denn die Gestalt existiert nur im Sinn für ein Bewuss- tsein, aber dieser Sinn „ist noch kein intellektuelles Verstehen.“ (SV 259 )
4.3 GESTALT IM ÜBERGANG ZUR PHW
Wir haben im letzten Abschnitt gesehen, dass Merleau-Ponty von der Frage einer Beziehung ausgegangen ist, der Beziehung zwischen Bewusstsein und Natur. Das markiert eine Sicht- bzw. Denkweise, die die Beziehung als grundle- gend ansieht und nicht das Ding. Die Denkweise erinnert an eine Art Quanten theorie, die sich mit Wechselwirkungen, Unbestimmtheitsrelationen, relativen Raumzeitverhältnissen auseinandersetzt und die Schwierigkeit besteht immer wieder darin, dem Drang zu Festschreibungen, dem Wunsch, etwas dingfest zu machen, zu widerstehen. Dementsprechend sind die tragenden Begriffe solche der Beziehung und der Bewegung. Dazu gehören etwa der Begriff Verhalten zu, der in der PhW zum Begriff der Existenz mutiert und eben auch unser Gestaltbegriff. Die Bewegung wird im Gestaltbegriff durch dialektische Vermittlung gedacht, am Ende der SV zwischen den Polen Gelebtes und Erkanntes, wobei das synthetisierende Moment unbestimmt bleibt:
„Eine ,Gestalt‘ […] ist ein Ganzes, das einen Sinn hat und somit der intellek- tuellen Analyse einen Ansatzpunkt liefert. Doch gleichzeitig ist sie keine Idee - sie konstituiert sich, ändert sich oder reorganisiert sich vor uns wie ein Schauspiel. Die angeblichen körperlichen, sozialen und psychologischen ,Kausalitäten‘ reduzieren sich auf diese Kontingenz der gelebten Perspekti- ven, die unseren Zugang zu den zeitlosen Bedeutungen begrenzen.“ (SV 258).
In der PhW unternimmt unser Philosoph den Versuch, den Gestaltvorgang von der Seite des Bewusstseins her zu untersuchen und neu zu konzipieren. Wir wollen diesem Versuch in den folgenden Abschnitten nachgehen. Vor dem Hintergrund des oben Gesagten tun wir dies in der Art, dass wir uns nach der Funktion des Gestaltbegriffs fragen, also danach, was die Gestalt methodisch und im Verlauf des Texts bewirkt. Wir haben es ja mehr mit Bewegung und Beziehung zu tun und weniger mit haarscharfen Definitionen.
4.4 DIE RADIKALISIERUNG DER PHÄNOMENOLOGIE
Den Auftakt zu seinem Versuch einer neuen Transzendentalphilosophie macht Merleau-Ponty mit der Frage: „Phänomenologie - was ist das?“ Der Antwort darauf widmet er sein berühmtes Vorwort, von dem Kwant sagt: „Its pages are among the very best that have been written about phenomenology.“100 Nach einem kritischen Blick auf die z.T. widersprüchlichen Definitionen umschreibt Merleau-Ponty die Situation der Phänomenologie als „eine Bewegung“, als ei- nen „Stil“ des Denkens, das aber noch „nicht zu abgeschlossenem philosophi-
schen Bewusstsein gelangt“ (PhW 4 ) ist. In diese Bewegung schreibt er sich mit einem neuen Kapitel ein, indem er klar macht, was es für ihn heißt, auf die „Sachen selbst“ zurückzugehen, nämlich:
„zurückgehen auf diese aller Erkenntnis vorausliegende Welt, von der alle Er- kenntnis spricht und bezüglich deren alle Bestimmung der Wissenschaft not- wendig abstrakt, signitiv, sekundär bleibt, so wie Geographie gegenüber der Landschaft, in der wir allererst lernten, was dergleichen wie Wald, Wiese und Fluss überhaupt ist.“ (PhW 5 )
Dieser Rückgang unterscheidet sich grundsätzlich von einem idealistischen Rückgang auf ein transzendentales Ego, das durch die Reflexion in der Gewissheit seines Existierens gründet, aber nicht mehr in der eigenen Bezogenheit und Erfahrung von Welt. Merleau-Pontys Kritik, zunächst an die Adresse von Descartes, ist in den folgenden Zeilen auf den Punkt gebracht:
„Wenn man die Wahrnehmung […] auf das Denken des Wahrnehmens redu- ziert, so schließt man eine Versicherung gegen den Zweifel ab, deren Prämien kostspieliger sind als der Verlust, für den sie uns entschädigen soll: denn das bedeutet, auf das Verständnis der tatsächlichen Welt zu verzichten.“ (SU 58)
Auf dem Weg der Reflexion wird das ursprüngliche, leibliche Ich mit seinem natürlichen Bezug zur Welt wie auch zur Mit-Welt, das existierende Ich, einge- tauscht gegen das Absolute und Solipsistische eines denkenden Subjekts, das frei ist von Passivität. Man könnte es als ein außerweltliches cogito bezeichnen, das den Einflüssen der physischen und sozialen Bedingungen nicht unterliegt. Dieses cogito kann auch „als Erfassung der Gegenstände dieses Denkens“ ge- deutet werden, nicht „als Evidenz einer privaten Existenz, sondern auch der Dinge, an die dieses Seiende denkt…“ (PW 44). Ein solches Subjekt muss sich selbst absolut transparent sein. Die Kritik richtet sich also auch an Husserls transzendentales cogito, für das durch die phänomenologische Reduktion die Welt zur reinen „Sinn Welt“ (PhW 8 ), zu einer Geltungseinheit wird. Auch hier geht es darum, dass Evidenz an die Stelle der Existenz gesetzt wird:
„Sind so Ich und dann auch der Andere nicht in ihrer Verwobenheit mit dem Weltphänomen und eher als ‚geltend‘ denn als ‚existierend‘ gefasst, so ist nicht schwer zu verstehen, wie ich den Anderen denken kann.“ (PhW 9 )
Und etwas weiter:
„Reduziert mein Existieren sich auf mein Bewusstsein zu existieren, so bleibt der Andere ein leeres Wort;“ (PhW 9 )
Merleau-Ponty führt demgegenüber eine dritte Möglichkeit vor, wie das cogito zu verstehen ist, die ihm gemäß allein haltbar ist:
„Der Akt des Zweifelns, durch den ich alle möglichen Gegenstände meiner Erfahrung mit Ungewissheit belege, erfasst sich selbst in seinem Tun und kann sich selbst deshalb nicht in Zweifel ziehen.“ (PW 44)
Es geht um ein „Denken in Aktion“, das sich selbst gewahr wird und „das sich eher berührt, als dass es sich sieht“ (PW 45). Es ist ein Denken, das Klarheit sucht und sich dabei selbst erfasst. Dieses cogito gründet nicht in der Evidenz bzw. im Absoluten, sondern es nimmt sich wahr in seinem Entstehen, in der Auseinan- dersetzung mit seiner Umwelt. Aber wie lässt sich auf dieses Unreflektierte reflektieren? Müssen wir Introspektion betreiben, um das zu erfassen?
Wie wir wissen, wählt Merleau-Ponty einen anderen Weg:
„Die Psyche, so haben wir festgestellt, reduziert sich auf die Struktur des Verhaltens. Da diese Struktur zugleich von außen für den Betrachter wie auch von innen für den Akteur sichtbar ist, ist mir dieser Andere prinzipiell genauso zugänglich wie ich selbst, und wir sind beide Objekte, die sich vor einem unpersönlichen Bewusstsein ausbreiten.“ (SV 256 )
Wie bereits erwähnt versteht er wie Goldstein Verhalten als ständige Ausei- nandersetzung mit der Umwelt, das er in SV als ein Verhalten zu bezeichnet und das er in der PhW weitgehend durch den Begriff der Existenz101 ersetzt.102 Die Überlegung, dass sich Verhalten im phänomenalen Feld vollzieht, erschließt die Möglichkeit, auf die Unterscheidungen von Introspektion und Fremdbeo- bachtung, von innen und außen, von phänomenaler und realer Welt zu verzich- ten. Aus der Perspektive der Begrifflichkeit ließe sich sagen, dass diese Dualis- men durch den Vermittlungsbegriff des so verstandenen Verhaltens unterlau- fen wird. Aber folgen wir der Argumentation unseres französischen Philoso- phen, so müssen wir zugestehen, dass diese Dualismen erst durch den Vollzug des Verhaltens entstehen. Eigentlich ist die Bezeichnung dritte Dimension ver fänglich, weil es suggeriert, sie komme nach den ersten beiden, sei vielleicht eine Mischung daraus, doch ist sie eigentlich die erste, ursprüngliche, die sowohl unbewusste Abläufe wie unter speziellen Bedingungen bewusst gesteuertes Verhalten umfasst.
Wir haben bereits im Abschnitt über die phänomenologische Feldtheorie Gur- witschs gesehen, dass die Verbindung der Gestalttheorie mit der Phänomeno- logie als ihr wesentlichstes Ergebnis die Ersetzung eines egologischen cogitos durch ein anonymes Es beinhaltet. Ermöglicht wird das durch den Prozess der Selbstorganisation, der mit dem Gestaltbegriff bezeichnet wird. Merleau-Ponty übernimmt die Grundzüge der phänomenologischen Feldtheo- rie von Gurwitsch und baut sie weiter aus.103 Ähnlich wie Husserls Rückgang auf die Lebenswelt, sieht es Merleau-Ponty als erste „Aufgabe der Philosophie“, die Lebenswelt zu befragen, das jedoch
„um aus ihr Recht und Grenzen der Vorstellung einer objektiven Welt zu ver- stehen, […] das eigentümliche Weltverhältnis eines Organismus und die Ge- schlechtlichkeit der Subjektivität zu begreifen; um Zugang zu gewinnen zum phänomenalen Feld der lebendigen Erfahrung, in dem Andere und Dinge uns anfänglich begegnen, zum Ursprung der Konstellation von Ich, Anderen und Dingen; um die Wahrnehmung selbst ins Licht zu setzen…“. (PhW 80 )
Der Rückgang auf die Lebenswelt hat hier zum Ziel, Vorstellungen zu prüfen, Verhältnisse auszuloten und das phänomenale Feld der Erfahrung zu erschlie- ßen. Wir haben es also zu tun mit einer Betrachtung, Beschreibung und Analyse von Strukturen. Soll der Feldbegriff in der Phänomenologie herkömmlich Struk- turen des Bewusstseins bestimmen, so beansprucht er in Merleau-Ponty Phä- nomenologie universale Geltung, denn die im phänomenalen Feld untersuch- baren Gestalten und Strukturen der Erfahrung, der Handlung und der Sprache sind gleichzeitig Analysen über die Strukturen des Bewusstseins und seiner Ge- nese.104 Strukturen bzw. Gestalten werden als die „grundlegende Realität“ (vgl. SV Wo geschieht also die Wende hin zum Subjekt? Im Prinzip im Übergang von der SV zur PhW:
243) betrachtet; ihre Erscheinung ist an eine bestimmte Bedingung geknüpft, nämlich daran, dass sich etwas von anderem abhebt105: eine Figur von einem Grund.
Diese gestaltorientierte Betrachtungsweise hat den Vorzug, dass sie die dialek- tische Beziehung des Individuums mit seiner Umwelt mitbedenkt und sowohl Aktivität wie auch Passivität, die beiden Aspekte der Subjektivität, berücksich- tigen kann. Auch ermöglicht das strukturale Denken, Veränderungen in Form von Differenzierungs- und Entdifferenzierungsprozessen zu erfassen. Allerdings ist schon zu erwähnen, dass es sich hier um eine Phänomenologie im weiteren Sinne handelt, in der sich die phänomenale Beschreibung und die kausale Er- klärung „wechselseitige Dienste leisten“ (vgl. SV 180 ), denn ganz ohne Erklärung lassen sich Strukturen nicht beschreiben.
Inwiefern wird diese Phänomenologie der Strukturen einem ‚Denken in Aktion‘ gerecht, einem Denken also, das, wie Merleau-Ponty als die einzig haltbare Deutung fordert, “die Klarheit eher sucht, als dass es sie besitzt, und die Wahr- heit eher herstellt, als dass es sie findet“ (PW 45 )? Die Verlagerung im Rückgang auf die Lebenswelt mithilfe der Feldtheorie auf die Beschreibung von Struktu- ren ersetzt die transzendentale und konstituierende Subjektivität durch eine Ordnung von Strukturen und Gestalten, „gereinigt von jeglicher subjektiven Spur“106. Selbstverständlich präsentieren sich diese Strukturen nicht von selbst, das weiter oben zitierte ‚unpersönliche Bewusstsein‘, ‚vor dem wir uns als Ob- jekte ausbreiten‘, muss notwendigerweise eine Perspektive einnehmen, es muss den Untersuchungs-Rahmen gestalten, eben: eine Figur auf einem Grund wahrnehmen. Welche Strukturen untersucht werden, die im phänomenalen Feld der Lebenswelt oder die des Untersuchers, die Struktur des Problemlösens der Schimpansen oder die Struktur der Versuchsanlage Köhlers - das lässt sich nicht unterscheiden, sie beide werden betrachtet als Objekte. Stimmen wir dem ganz zu, dann gibt es keine Subjektivität, auch keine entspringende.Wo geschieht also die Wende hin zum Subjekt? Im Prinzip im Übergang von der SV zur PhW:
„Um hervorzuheben, dass die Objekte zugleich in intimer Nähe zum Subjekt stehen und feste Strukturen präsentieren, die sie von bloßen Erscheinungs- weisen unterscheiden, mag man sie ‚Phänomene‘ nennen, und sofern die Phi- losophie sich an dieses Thema hält, wird sie zu einer Phänomenologie, d.h. zu einer Inventur des Bewusstseins als des Universalmilieus [milieu d’univers].“107
Die Wende geschieht mit der Änderung der Perspektive von außen nach innen, dann ist die Subjektivität da, sozusagen als eine entsprungene. Deshalb kann man die SV auch als die Beschreibung der ursprünglichen Faktizität betrachten, die durch die Außenperspektive in den Blick kommt.
Indem Merleau-Ponty vom Gestaltbegriff ausgeht, als einer spontanen Organi- sation des Wahrnehmungsfeldes, fasst er die Erscheinung als Akt der Wahr- nehmung, als eine Figur auf einem Grund. Er zeigt so eine wesentliche Radikali- sierung an Husserls Phänomenologie, die für das Erscheinen im Bewusstsein einen Begriff einsetzt (sein ‚etwas als etwas‘ formiert auf der Ebene der Reprä- sentation) und so die Erscheinung als Präsenz (bzw. im Wahrnehmungsbewuss- tsein) verpasst.108
4.5 DIE DESTRUIERENDEFUNKTION DER GESTALT (WEDER-NOCH)
Die PhW stellt über sehr weite Strecken eine Auseinandersetzung mit zwei einander entgegengesetzten Positionen dar, deren Deutungen bzw. Erklärungen der thematisierten Phänomene durch eine dritte Position destruiert werden. Diese dritte Position, wie könnte es anders sein, wird durch den Bezug auf die Gestaltpsychologie ermöglicht.
Man kann diese Auseinandersetzung so verstehen, dass der Fokus der PhW einen Versuch darstelle, „to found an ontology that would overcome definitively the old oppositions of idealism-empiricism“109 ? Das Resultat oder der Lösungsweg bestünde dann etwa in einer definierten Ontologie, ausgehend von der dritten Dimension.
Man kann es aber auch anders verstehen, nämlich so, dass die Bewegung an sich das Wesentliche ist, so dass es mehr darum geht, diese in Gang zu setzten, sie zu reanimieren. Die PhW ist dann als Versuch zu verstehen, die beiden Positionen zu relativieren, um etwas Fundamentaleres sichtbar zu machen und so den Boden für einen Diskurs der Revision von hindernden Vorurteilen und Fehlentwicklungen zu bereiten. In diesem Abschnitt des Weder - Noch geht es uns um diesen dynamischen Aspekt.
Merleau-Pontys Argumentation, die durchaus polemische Züge trägt und sich deshalb oft eher mit Hilfe von theoretischen Extrempositionen bewegt, die er an ausgewählten Exempeln statuiert, als dass sie ausgewogene Stellungnah- men zu konkreten Richtungen oder Schulen aufzeigte, stellt auf die eine Seite den Empirismus, den Objektivismus oder auch den Naturalismus, auf die ande- re Seite den Idealismus, Kritizismus, Rationalismus oder in summarischer Be- zeichnung alle Richtungen, die den Wahrnehmungsinhalt als Interpretation verstehen, als den Intellektualismus. Mit Hilfe der Gestalt lässt sich der sprin- gende Punkt, mannigfach und weitläufig in verschiedenen Kontexten verwen- det, einfacher darstellen:
Der naive Realismus des Empirismus ist zurückzuweisen, insofern er nicht er- kennt, dass die ursprüngliche Wahrnehmung eine Gestalt ist, also eine von ei- nem Bewusstsein hervorgebrachte Synthese. Er sieht die Sache von den einfa- chen Empfindungen her, meint, das Ding sei dem Bewusstsein direkt gegeben. Doch ist das Ding dem Bewusstsein nur als Bedeutung gegeben. Die Empfin- dungen erweisen sich, wie Merleau-Ponty aufzeigt, als eine nachträgliche Hilfs- konstruktion, abgeleitet von der logischen Ordnung, bzw., wie es bei Lacan heißen würde, aus dem symbolischen Register, woher die Synthese des Empi- rismus fälschlicherweise kommt. Der Empirismus verwechselt also die transzendentale Ordnung mit der logischen Ordnung. Metaphorisch polemisiert Merleau-Ponty:
„Man baut die Wahrnehmungszustände auf wie ein Haus aus Steinen, und man ruft eine geistige Chemie zu Hilfe, um diese Materialien zu einem kompakten Ganzen zu verschmelzen.“ (PhW 42 )
Der Intellektualismus erkennt zwar, dass das Wahrgenommene eine vom Be- wusstsein geschaffene Ganzheit ist, es hat Sinn für ein Bewusstsein. Doch hat er das Konzept der Empfindung vom Empirismus übernommen und so kommt es nicht zu einer Reflexion der Wahrnehmung, sondern nur zu einem Umsturz: der empiristischen Beschreibung „wird der Index ,Bewusstsein von…‘ beige- fügt.“ (PhW 245) So führt er die Synthese des wahrgenommenen Dings auf einen intellektuellen Akt zurück statt auf eine autochthone Organisation des Wahr- nehmungsfeldes. Die Gestalt ist jedoch nicht etwas anderes als die Inhalte, die sie strukturiert. Der Intellektualismus nimmt die Synthese aus dem symboli- schen Register, statt, wie wir weiter unten sehen werden, aus dem imaginären.
„Die reflexive Analyse bricht zwar mit dieser Welt an sich, indem sie die Konstitution der Welt durch die Leistungen des Bewusstseins entdeckt, doch dieses konstituierende Bewusstsein selbst erfasst sie nicht an ihm selbst, sondern rekonstruiert es als die Bedingung der Möglichkeit der Idee eines absolut determinierten Seins.“ (PhW 62 /63)
Was die Einheit des wahrgenommenen Dings anbelangt, gehen schließlich beide von der Bedeutung eines Begriffs aus, unterstellen also, dass diese Bestimmung bereits vorliegt, um so die Synthese der Wahrnehmung zu ermöglichen. Merleau-Ponty erhebt deshalb den Vorwurf eines beiden Positionen gemeinsamen Vorurteils einer fertigen Welt: „Beide sind Ausdruck des Vorurteils eines vollkommen expliziten Universums an sich.“ (PhW 64 )
Die Destruktion dieses Vorurteils erfolgt aus dem Blickwinkel der Gestalt, die der Wahrnehmung das Primat einräumt: Die Wahrnehmung stellt den grundlegenden Zugang zu allem dar, was in Erscheinung treten kann. Sie ist eine Grundvoraussetzung und deshalb der
„Untergrund, von dem überhaupt sich Akte abzuheben vermögen. Die Welt ist kein Gegenstand, dessen Konstitutionsgesetz sich zum voraus in meinem Besitz befände, jedoch das natürliche Feld und Milieu all meines Denkens und aller ausdrücklichen Wahrnehmung.“ (PhW 7 )
Die Wahrnehmung vollzieht sich innerhalb eines bestimmten Horizonts und findet schließlich in der Welt statt. Weder Horizont noch Welt werden aus- drücklich erkannt, sondern sind auf praktische Art gegenwärtig. So kann Mer- leau-Ponty sagen, dass die Materie mit ihrer Form „schwanger“ geht (vgl. PW 26/27), eine Metapher, die etwa an einer Wahrnehmungssituation mit erschwer- ten Bedingungen, wie Nebel oder Dunkelheit, anschaulich wird: „Steht da ein Tier oder ist es ein Busch?“ könnten wir uns dann fragen. Das zeugt von unse- rer Bemühung, aus den diffusen Unterschieden von Figur und Grund eine klare Struktur auszumachen, um eine stabile Auffassung der umgebenden Wirklich- keit zu gewinnen. Es handelt sich um eine eigentlich schöpferische Tätigkeit, um einen Gestaltungsprozess, bei dem sich wahrgenommener Gegenstand und unsere Struktur der Wahrnehmung gleichzeitig herausbilden. Das Primat der Wahrnehmung ist als Fundierungsleistung zu verstehen. Das macht denn auch deutlich, warum es in der PhW um den transzendentalen Gesichtspunkt schlechthin geht: Die Erforschung der Bedingung der Möglichkeit der Gegens- tände von Erfahrung ist zugleich die Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung. Diese Wende wurde in Analogie zum linguistic turn als perceptual turn110 be- zeichnet, weil die Wahrnehmung als das betrachtet wird, was erst die anderen Arten des Bewusstseins ermöglicht, seien es nun Imaginationen, Gedanken oder Wünsche. Der Grund dafür ist, dass ein Bewusstsein von etwas ein Be- wusstsein von der Gegenwart von Vorstellungen sein muss. Das Wahrneh- mungsbewusstsein identifiziert Merleau-Ponty als das Gegenwartsbewusstsein. Er weist in diesem Zusammenhang auf den bemerkenswerten Umstand hin, dass in der Wahrnehmung die nicht sichtbare Seite eines betrachteten Gegens- tands als wirklich111 gesehen wird und eben nicht als möglich oder als notwen- dig, wie es dem Verstand entspräche. Die Wahrnehmung strukturiert das Gan- ze so, dass auch die nicht sichtbare Seite als gegenwärtig vorgestellt ist.
Die Synthese, die den Wahrnehmungsdaten Bedeutung zuweist und sie so zu- sammensetzt, ist, mit Husserl zu sprechen, eine Übergangssynthese bzw. eine Präsumtion. Vielleicht wird die zugewiesene Bedeutung durch die Sicht aus einer anderen Perspektive korrigiert oder sie erweist sich gar als Phantasma:
„Träume bieten zunächst sich mit gleichem Rechtstitel an wie Wahrgenom- menes im eigentlichen Sinne, und erst allmählich unterscheidet eigentliche, aktuelle und explizite Wahrnehmung sich durch kritische Arbeit von den Phantasmen.“ (PhW 31 )
Sowohl Perspektivität wie auch das Imaginäre sind notwendige Voraussetzun- gen für Erkenntnis. „Der Mensch ist zur Welt, er kennt sich allein in der Welt.“
(PhW 7) Das Zur-Welt-sein ist die Bedingung der Möglichkeit für Erkenntnis. „Das ,Sein-zur-Wahrheit‘ unterscheidet sich nicht vom Zur-Welt-sein.“ (PhW 449 ) Wir haben keine Beziehung zu einem ewig Wahren, an dem wir uns messen könn- ten. Erst die Erfahrung zeigt, was sich bewährt. „Wir sind zur Welt, das heißt: Dinge zeichnen sich ab.“ (PhW 465 ) Entsprechend besteht Rationalität nicht als vorliegendes Muster, sondern sie entsteht erst in der Erfahrung. Es handelt sich nicht etwa um die „äußere Entfaltung einer präexistenten Vernunft“ (PhW 85 ), wenn die Gestaltpsychologen Gesetze feststellen können, nach denen sich Ge- staltphänomene charakterisieren lassen. Vielmehr haben sich diese Gesetzmä- ßigkeiten in der Erfahrung herausgebildet. Die Gestalt ist ein schöpferischer Vorgang, der die Welt zur Erscheinung bringt, „nicht Erfüllung, sondern Entste- hung einer Norm, nicht Projektion eines Inneren ins Äußere, sondern Identität des Inneren und Äußeren.“ (PhW 465 )
Wie bei Kant, so auch bei Merleau-Ponty ‚fängt alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung an‘. Doch, wo fängt Erfahrung an? - Mit Merleau-Ponty könnten wir antworten: bei der spontanen Organisation des Wahrnehmungsfeldes im Gestaltvorgang. Auch die allmähliche Entwicklung der Rationalität ist Teil der Erfahrung, ist hervorgegangen aus dem natürlichen und faktischen Leben. Im Ich kann liegt die Grundlage des Ich denke.
Die Destruktion von etablierten Vorurteilen mit Hilfe der Gestalt hat Verschie- denes sichtbar gemacht: Die Notwendigkeit der Perspektivität und damit ver- bunden des Imaginären, sowie die Rationalität als hervorgegangen aus dem praktischen Weltbezug. Das bringt einige Konzepte ins Wanken, so wäre etwa die Psychologismuskritik von Husserl neu zu überdenken und, wie wir wissen, hat das Spiegelstadium Lacans vom Seminar I aufgrund der neu erkannten Be- deutung des Imaginären eine wesentliche Änderung erfahren. Es wurde verschiedentlich darauf hingewiesen, dass Merleau-Ponty in seinen ersten beiden Werken die Tendenz zeigte, „eine ,negative Philosophie‘ zu for- mulieren, die ein Weder (Empirismus) Noch (Intellektualismus) vorstellt“112. Wie wir gesehen haben ist diese kritische Funktion eng an den Gestaltbegriff gebunden. Am Ende von SV hat Merleau-Ponty dies auf den Punkt gebracht: „Eine ,Gestalt‘ wie z.B. die Struktur ,Figur - Grund‘ ist ein Ganzes, das einen Sinn hat und somit der intellektuellen Analyse einen Ansatzpunkt liefert. Doch gleichzeitig ist sie keine Idee - sie konstituiert sich, ändert sich oder reorgani- siert sich vor uns wie ein Schauspiel.“ (SV 258 ) Dass es ein Ganzes ist, kritisiert die empiristische Sichtweise und dass es keine Idee ist, kritisiert die intellektualisti- sche Perspektive. Hingegen verstehen wir die Aussage, dass sie der intellektuel- len Analyse als Ansatzpunkt dient, im Zusammenhang mit der von Blumenberg beschriebenen Überbrückungsfunktion der Metapher. Nur handelt es sich hier nicht um eine Metapher, die ein Bild als Anhaltspunkt gibt, sondern um ihr dreidimensionales Pendant, die Gestalt, eine Unbegrifflichkeit, die auf die Be- wegung, das Erlebnis, das Erfahren113 referiert. Die destruierende Funktion der Gestalt liegt eben darin begründet.
Schließlich sehen wir in der Aussage, dass sich die Gestalt sich vor unseren Augen konstituiert und reorganisiert, ein Hinweis auf eine weitere, diesmal konstruktive Funktion, die wir im folgenden Abschnitt erkunden wollen.
4.6 DIE KONSTRUKTIVE FUNKTION DER GESTALT
«Räumlichkeit mag die Projektion der Ausdehnung des psy- chischen Apparats sein. Keine andere Ableitung ist wahr- scheinlich. Anstatt Kants a priori Bedingungen unseres psy chischen Apparats. Psyche ist ausgedehnt, weiss nichts da- von.»114
Die konstruktive Funktion der Gestalt als Denkfigur ergibt sich aus der Tatsa- che, dass die Gestalt nicht zu trennen ist von dem, was das Wahrgenommene mit einer Bedeutung belegt und so strukturiert, aber dennoch nicht dem ent- spricht, was wir als konstituierendes Bewusstsein bzw. Ego aus den cartesiani- schen Meditationen kennen.115 Lässt sich das Erkannte in einer allgemeinen Ordnung, losgelöst vom individuellen Bewusstsein denken, so ist das Gelebte, bzw. die an die Sinne gebundene Wahrnehmung nicht vom Leib-sein zu tren- nen. Deshalb führt die Gestalt zwangsläufig zu einem leiblich fundierten cogito. Entsprechend haben wir es hier nicht mit einer positivistischen, sondern mit einer künstlerischen Reduktion zu tun. Das Strukturierende ist über die Struktu- ren hinaus, in die es hineingeschrieben ist. „Die organische Verbindung zwi- schen dem wahrnehmenden Subjekt und der Welt [umgreift] den Widerspruch zwischen der Immanenz und der Transzendenz.“ (PW 27) Die Frage, wie dieser „Widerspruch“ zu denken ist, führt uns zur Entfaltung der konstruktiven Funk- tion der Gestalt.
Anstelle eines transzendentalen ego, das den Sinn des Gegebenen konstituiert, betreten wir mit Merleau-Ponty eine Sphäre des Sinns, in der sich sowohl Be- deutungen der Gegenstände als auch das Bewusstsein konstituieren. Existie- rend in der Welt und nur auf diesem Grund des Engagements in der Welt kön- nen wir uns des Seins bewusst werden. Es geht „um die Einsicht in das Bewuss- tsein selbst als Entwurf der Welt, zugeeignet einer Welt, die es nie zu umfassen und nie zu besitzen vermag.“ (PhW 15 ; meine Hervorhebung) Merleau-Ponty spricht hier, mit Husserl, von einer fungierenden Intentionalität, die der Intentionalität der Akte vorausgeht und „gleichsam den Grundtext liefert, den unser Erkennen in eine exakte Sprache zu übersetzen sucht.“ (PhW 15 ) Das Subjekt der fungierenden Intentionalität ist ein Subjekt des Verhaltens, das an die leibliche Existenz gebunden ist. Diese bildet die Grundlage der Konstitution des Systems, aus dem sich zugleich ‚Ich‘, Anderer und Welt differenzieren.
Konzeptionelles Kernstück dieses Gestaltungsprozesses ist das Theorem des Körperschemas. Merleau-Ponty bezieht sich dabei auf das Konzept von Paul Schilder (1886 - 1940), Professor der Neurologie, Philosoph und ein dem Wiener Kreis zugehöriger Psychoanalytiker. In dessen Monographie Das Körperschema wird dieser Begriff wie folgt bestimmt:
„Als Körperschema bezeichne ich das Raumbild, das jeder von sich selber hat. Man darf annehmen, dass dieses Schema in sich enthalte die einzelnen Teile des Körpers und ihre gegenseitige räumliche Beziehung zueinander.“116
Schilder entwickelte seine Theorie im psychoanalytischen Kontext und anhand von Untersuchungen über Krankheitsfälle, insbesondere von Apraxie sowie von hysterischen Lähmungserscheinungen. Er hatte es also mit ähnlichen psychopathologischen Phänomenen zu tun, wie wir sie vom Fall Schneider von Gelb und Goldstein kennen, auch wenn sich die medizinische Ursache der Krankheit völlig unterscheidet. Bei Schilder stellt das Körperschema eine psychische Repräsentanz über die Wahrnehmung des eigenen Körpers dar.
Bei Merleau-Ponty bildet das Körperschema den Kern der leiblichen Konstituti- on, in der sich auch die Dimensionen des Raumes und der Zeit entfalten. Der Körper wird hier dadurch zum Leib, dass er als Gestalt empfunden wird, und eben dieses Gestaltempfinden ist es, was unter dem Begriff des Körperschemas eingeführt wird.
Das Körperschema ist nicht angeboren, es wird durch leibliches Verstehen, durch einen leiblichen Dialog mit der Welt erworben. Es ist als „Konstitutions- gesetz“ zu begreifen, denn „die räumliche und zeitliche, die intersensorische oder sensorisch-motorische Einheit des Leibes“ will der Philosoph gleichsam als eine „de jure herrschende“ (PhW 124 ) verstanden wissen. Die Einheit beschränkt „sich nicht auf die tatsächlich zufällig im Laufe unserer Erfahrung assoziierten Inhalte“, sondern ist „diesen in gewissem Sinne vorgängig“ (PhW 124 ), ermöglicht erst ihre Assoziation. Wir haben es hier also mit einer Verschränkung von ei- nerseits erlebter Leiblichkeit und andererseits mit einer (erst weiter unten be- stimmten) Einheit zu tun, die als einheitsstiftendes Moment die Integration mannigfaltiger Inhalte ermöglicht. Letzteres führt zur zweiten Definition des Körperschemas „als Gesamtbewusstsein meiner Stellung in der intersensori- schen Welt, somit als ,Gestalt‘ im Sinne der Gestaltpsychologie“ (PhW 125 ), d.h., die Bedeutung der Teile bestimmt sich aus der Ganzheit. Worin aber besteht diese Ganzheit bzw. wie kommt es dazu?
Das wird nun klar in der dritten Definition, in der Merleau-Ponty das Körperschema als „ein anderes Wort für das Zur-Welt-sein meines Leibes“ (PhW 126 ) bezeichnet und damit dem dynamischen Moment des Konzepts einen Rahmen und der Einheit bzw. Ganzheit eine Basis gibt:
„Letzten Endes kann mein Leib nur insofern eine ,Gestalt‘ sein und kann es vor ihm nur ausgezeichnete Figuren auf gleichgültigem Untergrunde geben, als er auf seine Aufgabe hin polarisiert ist, auf diese hin existiert und auf sich selbst zusammennimmt, um sein Ziel zu erreichen.“ (PhW 126 )
Die Einheit bestimmt sich also vom Ziel her, von dem her, was zu bewältigen ist. Indem auf eine Situation geantwortet wird, entsteht im praktischen Han- deln ein Ganzes. Diese dritte Definition basiert nicht mehr auf einer direkten visuellen Vorstellung von sich selbst, sondern auf der Gerichtetheit auf etwas hin.
Am Beispiel der Modifikation einer Gewohnheit zeigt Merleau-Ponty, wie es zu einer neuen Bedeutung kommt. Eine zentrale Rolle spielt dabei stets die Bewe- gung. Um z.B. einen neuen Tanz zu erlernen, müssen die neuen Bewegungs- elemente in die allgemeine Motorik integriert werden. Es ist dann der Körper selbst, „der die Bewegung „erfasst“ und „versteht“. Der Erwerb einer Gewohn- heit ist die Erfassung einer Bedeutung, aber die motorische Erfassung einer Bewegungsbedeutung.“ (PhW 172 ) Das illustriert Merleau-Ponty am eindrückli- chen Beispiel einer Frau, die „ohne jede Berechnung zwischen der Feder ihres Hutes und Gegenständen, die sie zerknicken könnten, einen Sicherheitsab- stand“ hält, denn „sie hat es im Gefühl, wo die Feder ist, wie wir fühlen, wo unsere Hand ist.“ (PhW 172 ) Das Körperschema lässt sich situativ ausweiten, zur Spitze der Feder oder auch zum Ende des Blindenstocks.
Daraus leitet sich die wichtige Unterscheidung ab von Positionsräumlichkeit einerseits, die auf Stellen im Raum verweist und Situationsräumlichkeit ande- rerseits, die stets mit dem leiblichen Hier einhergeht. Dieses Hier figuriert als ein Ankerpunkt, der die Orientierung im Raum möglich macht, indem er diesen auf sich ausrichtet. So erhalten die Präpositionen auf, unter, neben, etc. einen Sinn.
„Wenn ich von einem Gegenstand sage, er liege auf dem Tisch, so versetze ich immer mich in Gedanken in diesen Gegenstand und in den Tisch und wende auf beide einen Begriff an, der ursprünglich beheimatet ist in den Verhältnissen meines Leibes zu äußeren Gegenständen.“ (PhW 126 )
Solche Verhältnisse lassen sich nur in einer gestalthaften Weise beschreiben, nicht als kausale Verknüpfungen, sondern als Relationen der Struktur Figur/Hintergrund, wobei im obigen Beispiel die Figur bzw. die Gestalt als Repräsentant für die Projektion des eigenen Leibes in den Außenraum auftritt. Tatsächlich entfalten sich alle Aufgaben in einem doppelten Horizont, demjenigen des Außenraumes und demjenigen des Körperraumes.
„Was die […] Räumlichkeit betrifft, so ist der eigene Leib das beständig mi- tanwesende dritte Moment in der Struktur Figur-Hintergrund, und eine jede Figur profiliert sich in dem doppelten Horizont von Aussenraum und Körper- raum.“ (PhW 126 )
Die Aufgaben stellen sich im Außenraum der Welt. Erst in der Anerkennung dieser Aufgaben als die meinigen, entsteht der Bezug zu meinem Hier in einer Situation, die das Problem einer Lösung zuführen kann. So überkreuzt sich der Raum des eigenen Leibes mit dem objektiven Raum derart, dass ein Teil der Welt für mich bedeutsam wird, bedeutsam in Bezug auf eine Situation, in der manches naheliegt, anderes ferner.
Die Räumlichkeit wird demnach mit und durch die leibliche Existenz in ihren gelebten Situationen gegründet und ist nicht ein zum voraus gegebener objek- tiver Raum. Eng damit verbunden ist die Zeitlichkeit. Denn das Hier des Eigen- leibes ist nur durch die Ständigkeit möglich. Dadurch, dass mein Leib ständig gegenwärtig ist, ist er mir stets unter demselben Blickwinkel gegeben, während die Gegenstände der Welt mir in unterschiedlichen Perspektiven gegeben sind und nie ohne mögliche Abwesenheit sind. So markieren Hier und Jetzt eine ursprüngliche Gegenwart.
Das bedeutet allerdings nicht, dass es sich beim Körperschema um eine rein private Vorstellung handele. Auch wenn sich dieses Schema durch individuelle Erfahrung bildet und einen persönlichen Stil ausprägt, so ist die Struktur doch interleiblich und ermöglicht es gerade, z.B. die Gesten des Anderen zu verstehen oder mit dem Zahnschmerz des Andern mitzufühlen.
„Das Schema des Eigenleibes nimmt, gerade weil ich mich selber sehe, an al- len Leibern, die ich sehe, teil; es ist ein Verzeichnis [lexique] der allgemeinen Leiblichkeit, ein Entsprechungssystem der Innerlichkeit und der Äusserlich- keit,…“ (V 127)
Mit der Entwicklung des Körperschemas eröffnet sich die Welt in einem prakti- schen Dialog. So sind die Dinge in einer Greifintention gegeben, ohne dass sie zugleich schon in einer Erkenntnisintention gegeben sind. Die Gegenstände dieser praktischen Welt werden in einer Reihe von Handlungen vertraut und sind entsprechend eine „Sammlung von manipulanda“ (PhW 130 ) und nicht sog- leich kantische Objekte. Der „Leib als Vermögen bestimmten Tuns“ steckt „meine Umgebung als die Gesamtheit der möglichen Angriffspunkte dieses Vermögens“ (PhW 131 ) ab. Auf eben diese Weise eröffnet der Leib eine Welt.
Wie zu sehen ist, haben wir es hier nicht mit linear-kausalen Verknüpfungen zu tun, sondern mit einer Art Zirkularität: Was wir tun, erweitert den Horizont - eröffnet Welt und bildet Körperschema - und das wirkt sich wiederum auf das aus, was wir tun. Diese Zirkularität ist charakteristisch für die Struktur Fi- gur/Grund bzw. für Gestaltvorgänge, die im Übrigen nicht nur von der Gestalt- psychologie beschrieben wurden. So erstaunt es nicht, dass sich das Konzept des Körperschemas von Paul Schilder in eine gestalttheoretisch formulierte Struktur überführen lässt.117
Indem Merleau-Ponty das Gestaltkonzept beizieht, gelingt es ihm, eine überzeugende Darstellung davon zu geben, wie sich Erkenntnis auf ästhetischer Grundlage ausformen kann. Wesentlich dafür ist das Verhältnis von Körperraum und Außenraum, wobei der Bewegung eine zentrale Rolle zukommt, denn auf ihr beruht letztlich die Unterscheidung von innen und außen. Die von der Gestaltpsychologie aufgezeigte Struktur Figur-Grund erweist sich als sehr geeignetes Mittel, mit dem Merleau-Ponty den Begriff der Perspektive als Wechselspiel zwischen Figur und Hintergrund fasst.
Aber auch das holistische Moment der Gestalt ist grundlegend. Indem das Zur- Welt-sein als Gestalt verstanden wird, bezeichnet es die Gerichtetheit auf et- was hin und versieht die Perspektive mit ihrem intentionalen Grund, sowie die Synthese mit ihrer einheitsstiftenden Größe. Daraus geht das Transzendente hervor. Denn die Sache, das Objekt erscheint in einer Weise, in der wir sie in Besitz nehmen können, so dass es zu einer Bedeutung kommt, die das Gegebe- ne überschreitet.118
Wenn nun die Darstellung des Präreflexiven mittels Gestaltkonzept in plausib- ler Weise gelingt, so heißt das allerdings nicht, dass es auf diese Weise zustan- de gekommen ist. Es wäre zu prüfen, inwiefern Merleau-Ponty sein Konzept des Körperschemas wirklich von der Gestalt her entwickeln kann, also wie weit dieser erwähnte Anhaltspunkt wirklich trägt, und inwiefern es sich allenfalls um eine gestalttheoretische Umformulierung des bestehenden Konzepts des Kör- perschemas von Schilder handelt. Oder anders formuliert: Inwiefern ist es mög- lich, mit Hilfe des Gestaltkonzepts das Präreflexive zu reflektieren und inwie- fern ist dazu eine andere Methode oder besser gesagt, ein anderer Diskurs notwendig?
Im Detail kann die Frage hier nicht beantwortet werden, doch können wir festhalten, dass Gestalt in der hier beschriebenen konstruktiven Funktion als Begriff für bestimmte Strukturen bzw. Vorgänge dient. Er beschreibt Phänomene, doch ist er nicht selbst Erscheinen im Bewusstsein.
4.7 LÖSUNGSANSÄTZE DES WAHRNEHMUNGSPROBLEMS
Merleau-Ponty wollte die Gestalt nicht allein in der destruierenden Funktion (weder Empirismus noch Intellektualismus) und in der begrifflichen Form als Beschreibung von Prozessen denken, wie wir sie im Rahmen des Körpersche- mas gesehen haben, sondern die Gestalt - Synthese der Wahrnehmung - selbst im Bewusstsein denken bzw. entfalten. Wie kommt es zu dieser Bedeutung in der Wahrnehmung? Wie gestaltet sich diese Verbindung zwischen Wahrneh- mung und Denken? Merleau-Ponty präsentiert mit der Theorie des Körper- schemas eine plausible Theorie der Wahrnehmung. Doch wie der Übergang zu denken ist, bleibt verborgen. Jedenfalls gelingt sein Vorhaben nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte. Er äußert sich dazu im Spätwerk: „Die Probleme, die ich in der Phänomenologie der Wahrnehmung gestellt habe, sind unlösbar, weil ich dort von der Unterscheidung ‚Bewusstsein‘ - ‚Objekt' ausgehe“ (VI 257).119 Was dieses Bestreben anbelangt, stellt die PhW gegenüber der SV keinen grundlegenden Fortschritt dar.120 Der Philosoph löst das Problem der Wahr- nehmung und der Inkarnation ähnlich wie bei der SV. Die Spaltung des Bewuss- tseins wird dialektisch überbrückt, jetzt mit dem Rekurs auf die Zeitlichkeit: die leibliche Existenz in ihrem Weltbezug, welche die Tiefenschichten und Vorge- schichte als stumme Erfahrung in sich birgt, bildet den Horizont, aus dem die präsumtive Synthese der Wahrnehmung entspringt. Es ist eine vorläufige Syn- these, die durch die nachträgliche Erfahrung korrigiert wird. So entrückt die
Zeitlichkeit zwischen Vor- und Rückgriff das unmittelbar Gegebene. Es bleibt verborgen in der Falte121 der Zeit.
Eine solche Lösung verdeckt das Problem der Wahrnehmung eher, als dass es sie löst. Sie vermittelt den Eindruck, dass der Philosoph das Potential, das er mit der Gestalt vorbereitet hat, nicht ausschöpft bzw. deutlich unterschreitet. Das enttäuscht uns nicht wirklich, denn tatsächlich ist dieses Potential uner- schöpflich, es ist reine Bewegung, ɸ, Übergang, ‚Etwas‘, und wie sollte der Phi- losoph da - nahezu 12 Jahre sind seit seinem Arbeitsentwurf vergangen - an- ders zu einem Ende kommen als mit einem irgendwie gewaltsamem Schnitt? Wie im Zusammenhang mit der Unbegrifflichkeit der Gestalt erwähnt, kann ein so radikales Umdenken, wie es Merleau-Ponty im Sinn hatte, kaum auf Anhieb und durchgängig gelingen. Das vorhandene Begriffs-Repertoire tendiert dazu, das Denken in alte Bahnen zu leiten.
Doch finden sich in der PhW auch andere Ansätze zur Lösung des Wahrneh- mungsproblems, die sich konsequenter von bestehenden Begriffen einer Be- wusstseinsphilosophie lösen können, die aber erst im Spätwerk in den Kon- zepten des Chiasmus und des Fleisches (chair) stabile Form annehmen. Diese radikalere Deutungslinie, die sich an der Gestalt orientiert, zeichnet sich in der PhW dadurch aus, dass sie den Sinn direkt im Ereignis aufzuspüren sucht und eben nicht in der Vorgeschichte. Zwar ist es sicherlich so: die Erfahrung ist ge- prägt durch eine Geschichte, doch geht sie nicht in einer bloßen Wiederholung des Vergangenen auf. Bedeutungen entspringen im Prozess der Selbstorganisa- tion dem Ereignis selbst und sind nicht einfach von der Vorgeschichte eines Subjekts oder eines Objekts abzuleiten. Die Spaltung - zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Aktivität und Passivität, zwischen Sein und Denken - wird dann nicht dialektisch vermittelt und zugedeckt, sondern wird zum potentiellen Ort des Entspringens von Sinn.
Wie das zu denken ist, findet sich im Zusammenhang mit der Analyse der Emp- findung, die weder Aktivität noch Passivität ist, sondern diese Dualität aus- löscht, was Merleau-Ponty am Beispiel der Situation des Einschlafens darstellt, mit der er das Verhältnis von Empfindendem und sinnlich Empfundenem illust- riert: Ich rufe den Schlaf herbei, indem ich die ruhige Atmung des Schlafes mi- me; diese rhythmische Bewegung setzt sich selbst fort. Wenn der Schlaf kommt, sich die Erwartung erfüllt, verwandelt sich das, was vorher Bedeutung war, in eine Situation, die wie ein gemeinsamer Akt des Schläfers und der Welt ist: „als kommuniziere mein Mund mit einer riesigen äußeren Lunge, die mei- nen Atem anzieht und zurückdrängt.“ (PhW 249)
So stehen sich nach Merleau-Ponty in der Wahrnehmung Empfindender und Empfundenes nicht gegenüber, und die Empfindung ist nicht im Sinne einer Invasion des Empfindenden zu verstehen. Vielmehr ist es eine Öffnung auf eine Situation hin: „Die Farbe lehnt sich an meinen Blick, die Form des Ge- genstandes an die Bewegung meiner Hand. […] Ohne meinen forschenden Blick, meine tastende Hand und ehe mein Leib sich mit ihm synchronisiert, ist das Sinnliche bloß eine vage Erregung.“(PhW 251 ) Wesentlich ist, dass die Ord- nung von der Situation ausgeht, dass diese als ein Strukturierungsgeschehen gedacht wird, in das ich mich auf die sinnlichen Anregungen hin einfinden muss.
Der Chiasmus ist derart im Werk von 1945 bereits erkannt, doch nimmt er hier noch nicht die ontologische Bedeutung an, die er in den späteren Werken einnehmen wird.122
SCHLUSS
Einmal mehr stoßen wir in dieser Arbeit auf methodische Schwierigkeiten. Wie ist hier ein Schluss zu ziehen? Ein kausaler Schluss wird der gestellten Frage, was das bedeuten soll, nicht gerecht. Es macht auch wenig Sinn, Ergebnisse zu bilanzieren. Ein Hintergrund lässt sich nicht zusammenfassen. Unser Schluss auf die Frage der Bedeutung muss eine Gestalt sein, eine Figur, die sich aus den in unserer Arbeit zusammengetragenen Ergebnissen abzeichnet, und die den Sinn vom Ganzen her bezieht. Unsere Gestalt ist ein Ergebnis unseres Diskurses. Im diesem Werk von 1945 geht es um den Gestaltvorgang, der kein Begriff ist, kein Gegenstand des begrifflichen Denkens, sondern ein Vorgang, wie es spon- tan zu einer Bedeutung kommt. Das soll sich am Beispiel der Wahrnehmung zeigen, aber der Vorgang ist nicht allein gültig für die Wahrnehmung, sondern wiederholt sich in anderen Prozessen der Sinnfindung. Es handelt sich dabei um eine Präsumtion, eine Übergangssynthese.
Wir haben es mit einer Unbegrifflichkeit zu tun: es ist nicht möglich, Gestalt zu denken. Ähnlich wie die Metapher in Blumenbergs Theorie, aber noch radika- ler, führt die Gestalt in dieser kritischen Funktion weg vom kausalen Denken hin zu einem Vergleich mit der lebendigen Erfahrung. ‚Wie ging das noch mit dem Tanzen lernen‘, könnten wir uns etwa fragen. - Es sind eher die Füße als der Kopf, die zu Rate gezogen werden bei diesem Vergleich mit der erlebten Erfahrung. Wir prüfen, ist das plausibel, dass die Frau mit der Feder auf dem Hut weiß, wie viel Sicherheitsabstand sie halten muss? Wir stellen uns dabei nicht die Frau als Bild vor, sondern überprüfen es mit unserer Leiberfahrung. Der Schluss, der aus dieser Denkbewegung gezogen wird, ist nicht kausal, son- dern induktiv123, er basiert auf einer Wahrscheinlichkeitslogik.
Wenn wir uns in der Sprache nicht wiederfinden können, wenn eine Differenz entsteht zwischen dem, was wir ausdrücken wollen und dem, was die beste- henden Begriffe hergeben, so entsteht eine Spannung, die sich in einer explo- rierenden Hin- und Her-Bewegung zwischen Begriffen und erlebter Erfahrung zu entladen sucht. Unzufrieden mit den bestehenden Grundbegriffen der an der ENS gelehrten Philosophie, begibt sich Merleau-Ponty im Verlauf der PhW immer wieder in diese Bewegung. Weder Empirismus, noch Intellektualismus - dieses Weder - Noch ist eine negative Bestimmung der Gestalt, und genau das ist die einzige Möglichkeit, die Bewegung der Bedeutung (d.h. hier: das Gleiten der Signifikanten) im Rahmen begrifflichen Denkens zu erkunden.124 Das Phä- nomen des eigentümlich behutsam umkreisenden, suchenden und scheinbar ziellosen Diskurs-Stils Merleau-Pontys in diesem Werk macht Sinn unter dieser Perspektive der Dekonstruktion. Ebenso die Tatsache, dass verschiedene Be- deutungsschichten sich überlagern, wie im letzten Abschnitt anhand der Lö- sungsansätze des Wahrnehmungsproblems gezeigt. Die Bedeutungen beziehen sich nicht auf ein geschlossenes System, sondern spielen mit dem System.
Eine positive Bestimmung würde sagen, was die Bedeutung ist, und damit die Bewegung der Bedeutung unweigerlich anhalten. Vom begrifflichen Denken her kann der Passivität nur mit einer negativen Definition der nötige Raum bzw. das Feld zur Verfügung gestellt werden, das dieses explorierende Denken in Annäherungen möglich macht und auf dem sich die dritte Dimension entfal- ten soll. Darin finden wir den Grund für die wiederholten Hinweise Merleau- Pontys, dass die Unbestimmtheit als positiver Faktor zu schätzen sei. Diese Un- schärfe ist denn auch eine Bedingung dafür, dass eine neue Bedeutung ent- springen kann. Die Synthese kommt von selbst, sie befragt die noch stumme Erfahrung. Woher? - Aus der Falte!
Die destruierende Funktion öffnet und bringt in diesem Zwischen des Weder - Noch etwas zum Erscheinen. Entscheidend ist hier, dass die Gestalt fundamen- taler zu destruieren vermag als die Metapher, die am Bild hängen bleibt. Die Gestalt lässt das Produzieren von Übergangssynthesen selbst erscheinen, weil sie nicht auf die Anschauung, sondern auf die Bewegung (d.h. hier: Leiberfah- rung, sinnliche Wahrnehmung, im Kern Motrizität) referiert, die im Sein grün- det und nicht im Bild vom Seienden. Das ist die naheliegende und doch auch etwas verblüffende Einsicht, zu der wir über den Weg von Blumenbergs Meta- pherntheorie und im Durchgang durch die vier Stadien der Restrukturierung der Psychologie durch die Berliner Schule gelangt sind. Erstere hat uns bezogen auf den Denkablauf darauf aufmerksam gemacht, dass die Unbegrifflichkeit aus dem formalen Denken ausbricht und die empirische Gegenständlichkeit aufsucht, wodurch Begriffe destruiert werden. Die Gestaltpsychologie hat uns von der anderen Seite, nämlich von der Wahrnehmung her, in einzelnen Schritten zu Wertheimers Logik mit dem Sack geführt.
In der kritischen Methode sehen wir den Hauptbeitrag der Gestalt, doch leistet sie auch einen Beitrag zur Konstruktion, indem sie zwingend zum Leib als Sub- jekt dieser Wahrnehmung bzw. dieser Bewegung/Motrizität führt und den Deutungen als Anhaltspunkt dient. Damit ist jener Ort markiert, der außerhalb der Sprache liegt, sich der Verhexung durch die Sprache entzieht, und dennoch nicht privat ist, sondern „ein Verzeichnis der allgemeinen Leiblichkeit, ein Ent- sprechungssystem der Innerlichkeit und der Äußerlichkeit,…“ (V 127) darstellt.
So vermag Merleau-Ponty zu zeigen, dass Rationalität sich im leiblichen Dialog mit der Welt herausgebildet hat, als Anpassung an Umweltbedingungen und eben nicht in der Abbildung vermeintlich gegebener Ordnungen besteht.125 Dabei wird die Reflexivität in der leiblichen Existenz durch die sogenannten Doppelempfindungen (z.B. die eine Hand berührt die andere) vorbereitet. Was im Werk von 1945 mit dem Körperschema als Konstitutionsgesetz, als Ge- stalt und als zur-Welt-sein haarscharf vorbereitet, aber noch nicht konsequent ausgewertet ist, ist der Übergang zur Reflexion durch das Körperbild126 (im Spiegel) als die erste Repräsentation, Basis aller anderen Repräsentationen und damit des Denkens. Hier fallen Subjekt und Objekt zusammen. Dieses Bild, das uns die erste Realität gibt, ist eine Präsumtion, wie Merleau-Ponty offenbarte.
Die Gestalt ist in der Phänomenologie der Wahrnehmung das unbegriffliche und dennoch allgemein gültige Referenzsystem, das als Artikulationsmittel der dritten Dimension die dekonstruktive Methode ermöglicht, bei der die Be- griffsarbeit unterwandert und bestehende Strukturen aufgelöst werden. Auf diese Weise radikalisiert Merleau-Ponty die Phänomenologie derart, dass das Erscheinen als ein Phänomen der sinnlichen Wahrnehmung gefasst wird und nicht als Begriff. Das führt dazu, dass er das Denken als hervorgegangen durch die Erfahrung der leiblichen Existenz aufdecken kann.
Dieses Werk Merleau-Pontys stellt nicht allein von dieser neu gewonnenen Erkenntnis einen Durchbruch dar, sondern ist auch in methodischer Hinsicht ein Wegbereiter für später folgende Entwicklungen. Wir denken an den Struk- turalismus, an die Methode der Dekonstruktion und an die Diskursanalyse. Auf die Frage, die die Krise der Philosophie als Situation darstellt, verstehen wir Merleau-Pontys Antwort in Form dieses Werks als Aufgabe des Philosophen, die in den Begriffen enthaltenen Vorurteile sichtbar zu machen, um neue Ent- wicklungen zu ermöglichen. Der Akzent liegt hier auf der Auflösung von Begrif- fen, aber dennoch ist es Arbeit an Begriffen, als den Grundlagen des Denkens und der Kommunikation. Somit ist Philosophie Arbeit für und mit anderen. Mit anderen deshalb, weil der Aufbau der Begriffe der spontanen Organisation des Feldes, der Lebenswelt, überlassen wird.
Die Phänomenologie der Wahrnehmung macht es dem Leser nicht leicht, den Zugang zu diesem Werk zu finden. Wollte man es im üblichen Sinne kritisieren, so wäre die ungewöhnliche Begrifflichkeit, die nicht ausgewiesene Methode der Dekonstruktion, das intransparente Vorgehen und die sich überlagernden Bedeutungsschichten, die zwangsläufig mit mangelnder Kohärenz verbunden sind, zu erwähnen. Aber eine solche Kritik ist fehl am Platz, wenn man bedenkt, dass es um einen Diskurs geht, der sich zwischen dem Geschriebenen und dem Leser abspielt. Betrachten wir es vom Diskurs her, so ist das Rätselhafte, das Irritierende das, was Widerstände hervorruft und gleichzeitig produktiv ist. Denn erinnern wir uns an Kants Taube: Widerstände sind Bedingungen der Möglichkeiten.
SIGLEN & LITERATURVERZEICHNIS
SV Merleau-Ponty, Maurice: La structure du comportement, Paris : 2006
(1942), P.U.F. - Deutsch : Die Struktur des Verhaltens, Berlin, New York : 1966, de Gruyter
PW Ders.: Das Primat der Wahrnehmung, Frankfurt: 2003, Suhrkamp
PhW Ders.: Phénoménologie de la perception, Paris: 1945, Gallimard -
Deutsch: Phänomenologie der Wahrnehmung, übersetzt von R. Boehm, Berlin 1974 (1965), de Gruyter
AD Ders.: Die Abenteuer der Dialektik, Frankfurt: 1974, Suhrkamp
V Ders.: Vorlesungen I, Schrift für die Kandidatur am Collège de France,
Lob der Philosophie, Vorlesungszusammenfassungen, Die Humanwis- senschaften und die Phänomenologie, Berlin, New York: 1973, de Gruy- ter
VI Ders.: Le visible et l’invisible, Paris : 1964, Gallimard
Ash, Mitchell G. : Gestalt psychology in German culture, 1890 - 1967, Holism and the quest for objectivity, Cambridge 1998 (1995), University Press.
Barbaras, Renaud: "Merleau-Ponty et la psychologie de la forme", in: MerleauPonty - Le philosophe et les sciences humaines, Les Etudes Philosophiques, Paris: 2001/2, S. 151 - 163, P.U.F.
Bermes, Christian: Maurice Merleau-Ponty zur Einführung, Hamburg: 1998, Junius
Boehm, Gottried: „Der stumme Logos“, in: Métraux, Alexandre, Waldenfels, Bernhard (Hrsg.): Leibhaftige Vernunft, Spuren von Merleau-Pontys Denken, München: 1986, Fink, S. 289 - 304
Boehm, Rudolf: „Vorrede des Übersetzers“, in: Merleau-Ponty, Maurice: Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin: 1966, de Gruyter
Blumenberg, Hans: Ästhetische und metaphorologische Schriften, Frankfurt: Suhrkamp 2001
Ders.: Paradigmen zu einer Metaphorologie, Frankfurt: 1998, Suhrkamp
Ders.: Beobachtungen an Metaphern, in: Bermes, Ch., Dierse, U. und Rapp, Ch. (Hrsg.), Archiv für Begriffsgeschichte, Bd. 15, S. 161 - 214, Hamburg: Meiner 1971.
Buchwald, Dagmar: "Gestalt", in: Hrsg. Barck,V., Fontius, M., Schlenstedt, D., Steinwachs, B., Wolfzette, F.: Historisches Wörterbuch Ästhetischer Grundbegriffe, l, Stuttgart: 1998/99, Metzler, S. 820 - 863
Choi, Zaeshick: Der phänomenologische Feldbegriff bei Aron Gurwitsch, Frankfurt am Main: Lang 1997
Danzer, Gerhard; Merleau-Ponty, Ein Philosoph auf der Suche nach Sinn, Berlin 2003
Dupond, Pascal: Dictionnaire Merleau-Ponty, Paris: 2008, Ellipses
Cassirer, Ernst: Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs, Darmstadt: 1977, Wissenschaftliche Buchgesellschaft
Ehrenfels, Christian v.: „Über ‚Gestaltqualitäten‘“ 1890 (unveränderter Nach- druck). In: Weinhall, F (Hrsg.): Gestalthaftes Denken. Ergebnisse und Aufgaben der Morphologie, 11-43. Darmstadt: 1960, Wissenschaftliche Buchgesellschaft
Embree, Lester: „Merleau-Ponty’s Examination of Gestalt Psychology“ in: Research in Phenomenology 10, Leiden: 1980, Brill
Ferber, Rafael: Philosophische Grundbegriffe, Eine Einführung, München: 1999
Fitzek, H./ Salber W.: Gestaltpsychologie, Geschichte und Praxis, Darmstadt: 1996, Wissenschaftliche Buchgesellschaft
Freud, Sigmund: Ergebnisse, Ideen, Probleme. Gesammelte Werke Bd. XVII, Frankfurt: 1966, Fischer
Frostholm, Birgit: Leib und Unbewusstes, Freuds Begriff des Unbewussten interpretiert durch den Leib-Begriff Merleau-Pontys, Bonn, 1978, Bouvier
Geraets, Théodore F. : Vers une nouvelle philosophie transcendantale, the Hague : 1971, Martinus Nijhoff
Grimm, Jacob und Wilhelm: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Band 5, Leibzig: 1897, Hirzel
Good, Paul: Maurice Merleau-Ponty, Eine Einführung, Düsseldorf, Bonn: 1998, Parerga
Günzel, Stephan: Maurice Merleau-Ponty, Werk und Wirkung, Wien: 2007, Tu- ria + Kant
Heidenreich, Felix: Mensch und Moderne bei Hans Blumenberg, München: 2005, Fink
Husserl, Edmund: Cartesianische Meditationen, Hamburg: 1995 (1963), Meiner Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Hamburg: 1976 (1956), Meiner Langan, Thomas: Merleau-Ponty’s critique of reason, New Haven : 1966 Yale Untiversity
Levinas, Emmanuel : „Préface“, in : Geraets, Théodore F. : Vers une nouvelle philosophie transcendantale, the Hague : 1971, Martinus Nijhoff
Lück, Helmut, E.: Geschichte der Psychologie, Stuttgart: Kohlhammer 1991
Prechtl P. u. Burkhard F.-P.(Hrsg.),: Metzler Philosophie Lexikon, Stuttgart, Weimar: 1999 Metzler
Sack, Martin: Von der Neuropathologie zur Phänomenologie, Würzburg: 2005, Königshausen & Neumann
Schmitz, Hermann: „Der Gestaltbegriff in Hegels ,Phänomenologie des Geistes‘ und seine geistesgeschichtliche Bedeutung“, in: Gestaltsprobleme der Dichtung, Festschrift für Günther Müller, Bonn 1957, 315-334.
Simonis, Annette;, Gestalttheorie von Goethe bis Benjamin, Diskursgeschichte einer deutschen Denkfigur, Köln, Weimar, Wien: 2001, Böhlau
Taminiaux, Jacques: „Über Erfahrung, Ausdruck und Struktur: ihre Entwicklung in der Phänomenologie Merleau-Pontys“, in: Grathoff, Richard und Sprondel, Walter (Hrsg.): Maurice Merleau-Ponty und das Problem der Struktur in den Sozialwissenschaften, Stuttgart: 1976 Enke
Tilliette, Xavier, Métraux, Alexandre: „Maurice Merleau-Ponty: Das Problem des Sinnes“, in: Speck, Josef (Hrsg.): Grundprobleme der großen Philosophen, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
Thomas, Philipp: Selbst-Natur-sein, Leibphänomenologie als Naturphilosophie, Darmstadt 1996 Akademie Verlag
Toccafondi, Fiorenza; „Aufnahme, Lesarten und Deutungen der Gestaltpsy- chologie“, in: Gestalt Theory, Vol. 25 2003, No. 3, Opladen, Westdeutscher Ver- lag
Waldenfels, Bernhard: Bruchlinien der Erfahrung, Frankfurt: 2002, Suhrkamp Ders.: Das leibliche Selbst, Frankfurt: 2000, Suhrkamp
Ders.: Phänomenologie in Frankreich, Frankfurt: 1998, Suhrkamp
Ders.: Deutsch-Französische Gedankengänge, Frankfurt: 1995, Suhrkamp
Ders.: In den Netzen der Lebenswelt, Frankfurt: 1994, Suhrkamp
Ders.: Einführung in die Phänomenologie, München: 1992, UTB
Ders.; „Vorwort des Übersetzers“, in: Maurice-Merleau-Ponty: Struktur des Verhaltens, Berlin, New York: 1976, de Gruyter
Wertheimer, Max: „Über Gestalttheorie“, Reprint in: Gestalt Theory, Vol. 7 (1985), No. 2, 99-120, Opladen, Westdeutscher Verlag
Wittgenstein, Ludwig: „Philosophische Untersuchungen“ in: Werkausgabe Band I, München: 1984, Suhrkamp
Wiesing, Lambert: „Merleau-Pontys Entdeckung der Wahrnehmung“, in: Merleau-Ponty, Maurice: Das Primat der Wahrnehmung, Frankfurt: 2003, Suhrkamp, S. 85 - 127.
[...]
1 Vgl. Waldenfels, Bernhard: Einführung in die Phänomenologie, München: 1992, Fink, S. 53.
2 Husserl, Edmund: Cartesianische Meditationen, Hamburg: 1995 (1963), Meiner, S. 40.
3 Boehm, Rudolf: „Vorrede des Übersetzers“, in: Merleau-Ponty, Maurice: Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin: 1966, de Gruyter, S. XI.
4 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Hamburg: 1976 (1956), Meiner, S. 43 [A].
5 Boehm, a.a.O..
6 Wittgenstein, Ludwig: „Philosophische Untersuchungen“ in: Werkausgabe Band I, München: 1984, Suhrkamp, S. 277, § 66.
7 Gemeint ist die Abschlussarbeit.
8 Vgl. Danzer, Gerhard: Merleau-Ponty, Ein Philosoph auf der Suche nach Sinn, Berlin: Kadmos 2003, S. 3.
9 Vgl. Günzel, Stephan: Maurice Merleau-Ponty, Werk und Wirkung, Wien: Turia + Kant 2007, S. 9.
10 Ebda. S. 5.
11 Zit. n. Danzer, 2003, S. 5.
12 Vgl. Günzel, S. 11.
13 Sartre, der möglicherweise etwas übertrieben habe, « le voyait s’agacer de ‚ces braves gens qui se prenaient pour des aviettes et pratiquaient la ‚pensée de survol’ en oubliant notre enlisement natal.’ » Geraets, Théodore F. : Vers une nouvelle philosophie transcendantale, the Hague : 1971, Martinus Nijhoff, S. 6.
14 Ebenda S. 7.
15 PhW 12 und PhW 257, vgl. auch Geraets, S. 7.
16 Waldenfels, Bernhard: Phänomenologie in Frankreich, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1998, S. 154.
17 Marcels These ist, dass das Haben des Körpers die Grundlage von Sein ist. Er konzipierte den Körper als das Medium, welches das Ich hat und durch welches es existiert. Mit der Reflexion des Ich über dieses Haben des Körpers tritt das Ich in ein Verhältnis zu sich selbst, mit dem eine Doppelung einher geht. Das Innere und das Äußere geraten in eine Spannung zueinander, die in diesem Leib-Körper als „Mittelbegriff“ zwischen Innen und Außen eine „dritte Ordnung“
18 Grund für seine Enttäuschung war die von seiner eigenen Auffassung abweichenden Vorstellung von dem, was Phänomenologie ist: Beinhaltet das die Frage der sinnlichen Wahrnehmung, d.h. wie etwas überhaupt erscheinen kann oder geht es bei diesen Phänomenen allein um das Erscheinen im Geist? Trotz seiner diesbezüglichen Enttäuschung hat Merleau-Ponty sich immer wieder mit Hegels Philosophie befasst. vgl. Günzel, S. 14.
19 Vgl. Danzer, S. 14.
20 Vgl. Geraets, S. 30.
21 Vgl. Waldenfels, Bernhard: „Vorwort des Übersetzers“, in: Maurice-Merleau-Ponty: Struktur des Verhaltens, Berlin New York 1976, S. VI, auch Geraets, S. 12.
22 Vgl. Wiesing, Lambert: „Merleau-Pontys Entdeckung der Wahrnehmung“, in: Merleau-Ponty, Maurice: Das Primat der Wahrnehmung, Frankfurt: 2003, Suhrkamp, S. 87.
23 Vgl. Wiesing, S. 94.
24 Das hat den folgenden Grund: Obwohl Husserl selbst der Gestaltpsychologie vorwirft, dass sie die Wahrnehmung durch eine Art Atommodell erkläre, überwinden seine eigenen phänomenologischen Beschreibungen der Wahrnehmung den immanenten Dualismus von Stoff und Form nicht. Merleau-Ponty zufolge geht Husserl selbst unphänomenologisch vor, indem er die Wahrnehmung mit Hilfe einer unbewussten Interpretationstätigkeit deutet, eine Position, die unser Autor zwingend ablehnt. vgl. Wiesing, S. 98 ff..
25 she. Geraets, S. 31 ff..
26 Entsprechend der Philosophie Merleau-Pontys wird ein Gedanke dadurch situiert, dass er seine Situation annimmt, wodurch sich aus der anonymen Existenz eine persönliche formiert.
27 Ebda.
28 Der Begriff wird in Anlehnung an Cassirers Begriff der symbolischen Form verstanden als die Art und Weise wie ein geistiger Bedeutungsgehalt an ein Wort innerlich zugeeignet wird. „Un- ter einer ‚symbolischen Form‘ soll jede Energie des Geistes verstanden werden, durch welche ein geistiger Bedeutungsgehalt an ein konkretes sinnliches Zeichen innerlich zugeeignet wird.“
29 Wir leiten das von der Erkenntnis ab, dass manche psychische Phänomene erst durch die Bestimmung der Form zu ‚verstehen‘ sind. So führt etwa ein Rorschach-Experiment zu völlig unbefriedigenden Ergebnissen, wenn sich die Interpretation auf die Inhaltsebene beschränkt. Erst die Bezugnahme auf eine Theorie stellt den Bedeutungs-Rahmen und damit die Perspektive her, in der eine Bedeutung erscheinen kann.
30 Vgl. Simonis, A.: Gestalttheorie von Goethe bis Benjamin, Diskursgeschichte einer deutschen Denkfigur, Köln; Weimar; Wien: Böhlau , 2001.
31 Vgl. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Band 5, Leibzig: Hirzel 1897, Spalten 4178 - 4194.
32 LEO Online-Service unter: http://dict.leo.org/?lang=de, sowie Beolingus unter: http://dict.tu- chemnitz.de/
33 LEO Online-Service unter: http://dict.leo.org/frde?lp=frde&search=, sowie Pons unter: http://www.pons.de/home/specials/ponsline/
34 Grimm, a.a.O.
35 Wie wir von Goldstein wissen, konnte das Gestalt-Phänomen in reiner Form nur im visuellen Bereich festgestellt werden (she. 3.2 Goldstein und Gelb).
36 vgl. Prechtl P. u. Burkhard F.-P.(Hrsg.),: Metzler Philosophie Lexikon, Stuttgart, Weimar: Metzler (1999) S. 361.
37 vgl. Blumenberg, H.: Paradigmen zu einer Metaphorologie, Frankfurt: Suhrkamp 1998, S. 10.
38 vgl. a.a.O.
39 vgl. ebenda S. 12
40 Vgl. Waldenfels, Bernhard; Bruchlinien der Erfahrung, Frankfurt: 2002, Suhrkamp.
41 vgl. Blumenberg, Ästhetische und metaphorologische Schriften, Frankfurt: Suhrkamp 2001, S. 139 ff. und Heidenreich Heidenreich, Felix: Mensch und Moderne bei Hans Blumenberg, München: Fink 2005, S. 98.
42 Vgl. Blumenberg, 2001, S. 139.
43 Blumenberg, Hans: Paradigmen zu einer Metapherologie, Frankfurt: (1960) 1998 Suhrkamp, S. 25.
44 a.a.O., vgl. auch AD 78.
45 Blumenberg, 2001, S. 204.
46 Blumenberg, 2001, S. 205.
47 Vgl. PhW S. 202, z.B. „die Zweideutigkeit [l‘équivoque] ist der menschlichen Erkenntnis we- sentlich - alles was wir erleben oder denken, hat stets einen mehrfachen Sinn [plusieurs sens].“
48 Simonis, 2001, S. 97.
49 Vgl. Buchwald, Dagmar. Buchwald, Dagmar: "Gestalt", in: Historisches Wörterbuch Ästhetischer Grundbegriffe, hg. V. K.Barck, M.Fontius, D.Schlenstedt, B.Steinwachs, F.Wolfzettel, Stuttgart: Metzler 1998/99, S. 827.
50 Goethe, Zur Farbenlehre. Didaktischer Theil (1808/1810), in: Goethe, Abt. 2, Bd. I (1890), XXXI.
51 Ebda.
52 Dieser Prozess des Werdens, der „geprägten Form, die lebend sich entwickelt“( Goethe, J.W.: Urworte, Orphisch, Dämon, in: Werke Bd.1. S. 359.), bezeichnet Goethe in Anknüpfung an Aris- toteles als Entelechie. Die nichtorganische Welt ist allein durch Wechselwirkungen bestimmt; in der organischen Welt hingegen wirkt dieses entelechische Prinzip: Eine Kraft aus sich selbst, die nach Vollendung strebt in der Aktualisierung der Potentialität, der Realisierung der Anlage. Goethes Begriff der Entelechie unterscheidet sich jedoch von der aristotelischen entelecheia. Während letztere von Trieben frei ist und selbstgenügsam in sich selbst beschäftigt, „nur als ziehende Kraft dessen, was geliebt wird“ (she. Rappe, Guido. Archaische Leiberfahrung, S. 194) die Entwicklung lenkt, wirkt Goethes Entelechie von innen her im Sinne von Trieben und einem Gestaltungsdrang. Eine weitere Differenz besteht darin, dass in Aristoteles Konzeption die Bewegung zur Veränderung daher kommt, dass sie vom Mangelhaften zur Fülle des Seins drängt, während Goethe die Entfaltung des Werdens einem Überschuss an Kraft zuschreibt, der zur Offenbarung im schöpferischen Akt drängt. (ebda.) Die Entwicklung der Gestalt voll- zieht sich nach Goethe in Richtung einer fortschreitenden Differenzierung der Teile und einer zunehmenden Integration der Teile zum Ganzen.
53 Vgl. Schmitz, Hermann: „Der Gestaltbegriff in Hegels ‚Phänomenologie des Geistes‘ und seine geistesgeschichtliche Bedeutung“, in: Gestaltsprobleme der Dichtung, Festschrift für Günther Müller, Bonn 1957, 315-334, hier: S. 315.
54 Vgl. Simonis 2001, S. 366.
55 Ehrenfels v., Christian: „Über ,Gestaltqualitäten‘“ (unveränderter Nachdruck). In: Weinhall, F. (Hrsg.): Gestalthaftes Denken. Ergebnisse und Aufgaben der Morphologie, 11-43. Darmstadt 1960 (1890).
56 A.a.O., S. 11.
57 A.a.O., S. 12.
58 A.a.O., s. 13.
59 Vgl. Ash, Mitchell G.; Gestalt psychology in German culture, 1890 - 1967, Holism and the quest for objectivity, Cambridge: 1998 (1995), University Press, S. 103.
60 Wertheimer, Max: „Über Gestalttheorie“, Reprint in: Gestalt Theory, Vol. 7 (1985), No. 2, 99- 120, Opladen, Westdeutscher Verlag, hier: S. 102.
61 A.a.O., S. 105.
62 Ash zitiert einen Biographen S. 104: „the boy’s complete absorption in the book led his parents to restrict his reading, but he continued to read Spinoza secretely with the connivance of the maid, who concealed the book in her trunk.“
63 Vgl. Ash, 1989, S. 108.
64 Köhler schrieb später an Geitel: „When I expressed the intention of studying philosophy, you said me that in your opinion only a reasonably thorough study of mathematics and natural science would give hope for any achievements in that field. I have endeavored to follow your advice, and I must say today that I shudder at the thought that I should have neglected it.“ Köhler to Geitel, in: Siegfried Jaeger (Hsg.): Briefe Wolfgang Köhlers an Geitel 1907 - 1920, Passau 1989, S. 55, zit. nach Ash, 1998, S. 112.
65 Vgl Ash, 1989, S. 117.
66 Die Idee, die experimentelle Psychologie in den Dienst der Philosophie zu stellen, stammt von Carl Stumpf.
67 Wertheimers Gestalttheorie wurde, wie Ash erklärt, bislang nicht veröffentlicht. Ash gewann sie aus von ihm besuchten Vorlesungen Wertheimers und aus persönlichen Diskussionen mit ihm. Vgl. Ash 1989, S. 123 f..
68 Ebda..
69 Eines der Experimente in dem das Phi-Phänomen erschien, war wie folgt angelegt: Der Ver- suchsperson (Vpn - es waren dies oft die Assistenten des Instituts, Köhler und Koffka, sowie Frau Klein-Koffka) werden in schneller Folge mit Hilfe des Stroboskops alternierend zwei Bilder
70 Der Nachweis lässt sich wie folgt skizzieren: Gegeben ist - ohne Präjudiz: a ɸ b; ɸ bezeichnet das, was außer a und b wahrgenommen wird, das zwischen a und b Wahrgenommene. - 1.) ɸ betrifft a und b, verbindet beide. - 2.) der phänomenale Inhalt von ɸ ist durch subjektive Ergänzung objektiv nicht vorhandenen raum- und zeitkontinuierlichen Zwischenlagen gegeben. => Nach Wertheimer zeigen die Ergebnisse seiner Untersuchung jedoch, dass psychologisch nicht ein Inhalt a und ein Inhalt b und etwas dazwischen gegeben ist, sondern etwas “eindringlich gegebenes Spezifisches“, das „an der notwendigen Verkettung von a ɸ b zu rütteln“ vermag. Wertheimer 1912, 185 f. zit. nach Fitzek, Salber, 1996, S. 37.
71 Vgl. Ash 1989 S. 132.
72 Fitzek, H./ Salber W.: Gestaltpsychologie, Geschichte und Praxis, Darmstadt: 1996, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 52.
73 Die Tendenz in diese Richtung zeichnet sich schon vorher ab, etwa in der Auswahl der nicht unbedarften Vpn. und deren geringen Anzahl. Auch die Tatsache, dass die Vpn die wahrgenommenen Phänomene beschreiben sollen und dass diese Beschreibung gleichgesetzt wird mit dem Wahrgenommenen, lassen ein Setting erkennen, das die Grenzen zwischen Subjekt/Objekt und zwischen Erleben und Beschreiben (oder allgemeiner Sein und Denken) anders behandelt als die übliche empirische Forschung.
74 Das Unbehagen, das in der Krise der Psychologie manifest wurde, ist ja hier begründet, dass eben das Wesentliche nicht mehr Gegenstand ist. Die wissenschaftliche Methode hatte die Subjektivität sauber zu eliminieren gesucht und damit auch das Wesentliche.
75 Vgl. Ash 1998, S. 222.
76 Es ist ja bei diesen Experimenten nicht so, dass man im Verhalten ablesen könnte, was die Vpn sehen. Diese werden aufgefordert zu beschreiben bzw. zu sagen, was sie sehen.
77 Vgl. Fitzek H./Salber, W., 1996, S. 39.
78 Thomas Kuhn bezeichnete solche Wechsel als Gestalt switch. Vielfältige Untersuchungen dieser Thematik wurde später im Rahmen des sog. Neurolinguistischen Programmierens - NLP durchgeführt.
79 Ash 1998, S. 278, Bezug nehmend auf Goldstein, Die Behandlung, S. 23-25.
80 Ebda.
81 Zit. nach Ash, 1998, S. 279.
82 Ebda.
83 A.a.O. S.281.
84 Vgl. Ash, 1998, S. 281.
85 Vgl. Choi, Zaeshick: Der phänomenologische Feldbegriff bei Aron Gurwitsch, Frankfurt am Main: 1997, Lang, S. 15.
86 Der Begriff Aufforderungscharakter prägte Karl Bühler, Psychologe und Sprachtheoretiker im Umfeld der Gestaltpsychologie, der im Rahmen seines handlungstheoretischen Kommunikati- onsmodells damit die Wirkung einer Aufforderung in der kommunikativen Interaktion bezeich- nete, was z.B. zu einer aktiven Beteiligung bzw. zum Sprechen eines bislang stillen Zuhörers führte.
87 Edgar Rubin, ein dänischer Gestaltpsychologe, entwickelte manche der bekannten Kippfigu- ren, wie z.B. jene zwischen Gesichtern und Kelch im Rahmen seiner Analysen zur Struktur Fi- gur/Grund. Gurwitsch bezieht sich in Das Bewusstseinsfeld (1975, S. 259) auf ihn: „Die Analy-
88 Vgl. a.a.O. S. 143.
89 Der Teil bezieht seine Bedeutung aus dem Sinn des Ganzen, das Ganze besteht aus den Tei- len, wenn es auch nicht die Summe der Teile ist, so ist es dennoch abhängig von den Teilen.
90 Vgl. Barbaras, Renaud: "Merleau-Ponty et la psychologie de la forme", in: Merleau-Ponty - Le philosophe et les sciences humaines, Les Etudes Philosophiques, Paris: 2001/2, S. 151-163, P.U.F., hier: S. 151.
91 P 57, zit. n. Günzel, 2007 S. 25.
92 Anlass dazu war ein Diskussionsforum, das sich mit Reformen des Philosophiestudiums befasste im Anschluss an die Tatsache, dass hochbegabte Studenten im Vorjahr an den Prüfungen gescheitert waren. She. dazu Günzel, S. 24 f.
93 Merleau-Ponty, Maurice: Parcours. 1935 - 1951, Lagrasse: 1997, Verdier, S. 56, zit. n. Günzel, 2007, S. 25.
94 Vgl. Waldenfels, 1976, S. VIII. Nicht nur die Philosophie, auch die Wissenschaften sind be- troffen von dieser Krisensituation, die die Züge von der bereits von Husserl beschriebenen Krisis trägt.
95 Vgl. Geraets, 1971, S. 184, PhW S.30.
96 Die beiden Begriffe werden oft synonym verwendet. Die Gestalt bezeichnet jedoch insofern eine spezifische Struktur, als sie das Moment der Übergangssynthese berücksichtigt als die Figur, die spontan aus dem Hintergrund hervortritt.
97 Vgl. Waldenfels 1998, S. 154.
98 Vgl. Barbaras, 2001, S. 154.
99 Vgl. Waldenfels, Bernhard: Phänomenologie in Frankreich, Frankfurt: 1998, Suhrkamp, S. 157.
100 Vgl. Good, Paul: Maurice Merleau-Ponty, Eine Einführung, Düsseldorf, Bonn: 1998, Parerga, S. 20 .
101 Der Begriff der Existenz umfasst das intentionale, leibliche Dasein: „…wenn wir den phäno- menalen Leib […] als erkennenden Leib begreifen, und als Subjekt der Wahrnehmung an die Stelle des Bewusstseins die Existenz, d.h. das Zur-Welt-sein-durch-einen-Leib setzen.“ (PhW, 358), vgl. auch Dupond, Pascal: Dictionnaire Merleau-Ponty, Paris: 2008, Ellipses, S.80.
102 Vgl. Waldenfels, 1976, S. XI.
103 In einem Brief an Schütz schrieb Gurwitsch: “Ich höre aus dem Buch [PhW] enorm viel aus meinen Vorlesungen heraus. Er [Merleau-Ponty] hat viel von mir gelernt und viel übernommen. Nicht nur in den Einzelheiten, wo er manches entwickelt hat. Ich zweifle daran, ob er ohne meinen Einfluss auf die Idee gekommen wäre, das psycho-pathologische Material phänomeno- logisch auszudeuten.“ (Briefwechsel GS., 11. Aug. 1947 in: Grathoff 1985, 158) zit. nach Choi, 1997, S. 13/14.
104 Eigentlich geht es um den gleichen Grundgedanken, der schon in Goethes „Wär‘ nicht das Auge sonnenhaft, wie könnten wir das Licht erblicken?“ ausgedrückt ist.
105 Waldenfels bezeichnet das als die Urdifferenz, she. Waldenfels, Bernhard : In den Netzen der Lebenswelt, Frankfurt: 1994, Suhrkamp, S. 59.
106 „épuré de toute trace subjective“, Levinas, Emmanuel : « Préface », in : Geraets, 1971, S. XI..
107 SV, S. 230; ob und wie diese Wende in der SV eingeleitet und vorbereitet wird, wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht im Detail untersucht.
108 Diese Bezeichnung ist angelehnt an den Begriff der Dekonstruktion, wobei das (Begriffs-) Konstruierende entfernt wurde und mit dem Gerundium die Bewegung betont wird, so dass es das Begriffe auflösende Momentum bezeichnet.
109 Langan, Thomas: Merleau-Ponty’s critique of reason, New Haven : 1966, Yale Untiversity, S. 11.
110 Wiesing, 2003, S. 114.
111 PW 32, vgl. auch Wiesing, 2003, S. 116.
112 Bermes, Christian: Maurice Merleau-Ponty zur Einführung, Hamburg: 1998 Junius, S. 49.
113 Wir erinnern uns an Wertheimers „spezifisches Hinüber von Erregung“, an a ɸ b; und daran, dass psychologisch nicht ein Inhalt a und ein Inhalt b und etwas dazwischen gegeben ist, son- dern etwas “eindringlich gegebenes Spezifisches“, das „an der notwendigen Verkettung von a ɸ b zu rütteln“ vermag.
114 Freud, Sigmund: Ergebnisse, Ideen, Probleme. Gesammelte Werke Bd. XVII. Frankfurt am Main: 1966, Fischer, S.152. Diese Notiz Freuds aus dem Jahre 1938 stellt die Schlussfolgerung dar, die Freud aus der Abhandlung zog.
115 Vgl. Taminaux, Jacques: „Über Erfahrung, Ausdruck und Struktur: ihre Entwicklung in der Phänomenologie Merleau-Pontys“, in: Grathoff, Richard und Sprondel, Walter (Hrsg.): Maurice Merleau-Ponty und das Problem der Struktur in den Sozialwissenschaften, Stuttgart: 1976 Enke, S. 105.
116 Schilder, Das Körperschema, 1923, S. 2, zit. nach Sack, 2005, Martin: Von der Neuropathologie zur Phänomenologie, Würzburg: 2005, Königshausen & Neumann, S. 81.
117 Birgit Frostholm bezeichnet die Auffassung Merleau-Pontys vom Körperschema als „quasi- gestaltpsychologisches (oder strukturalistisches) Interpretationsmodell für die Freudsche Ich- werdung.“ (1978, S. 118). Für den Vergleich der Theorien von Wahrnehmung, Körperschema und Lernen bei Merleau-Ponty mit Freudschen Konzepten der Ichwerdung she. Frostholm, 1978, S. 94 ff..
118 Dieser Punkt ist insofern noch etwas unbestimmt, als dem Aspekt der sozialen Vermittel- theit (die Theorie des Spiegelstadiums) des Körperschemas im Rahmen dieser Arbeit nicht näher nachgegangen wurde. Das Körperschema hat nach Merleau-Ponty auch eine Scharnier- funktion zwischen dem, wie ich ‚für mich‘ und dem, ‚wie ich für Andere‘ bin. Merleau-Ponty führt dies im Spätwerk VI aus (vgl. Waldenfels, Bernhard: Das leibliche Selbst, Frankfurt: 2000, Suhrkamp, S.121). Das ist jedoch in der PhW bereits vorgedacht „Wenn […] der Leib kein trans- parenter Gegenstand und uns nicht, wie dem Geometer der Kreis, gegeben ist in Gestalt seiner Konstitution, wenn er vielmehr eine Ausdruckseinheit ist, die wir kennenzulernen vermögen, indem wir sie durch Übernahme uns zu eigen machen, so muss diese Struktur sich auch der sinnlichen Welt selbst mitteilen. Die Theorie des Körperschemas ist implicite schon eine Theo- rie der Wahrnehmung.“ (PhW 242, Hervorhebung im Original).
119 Das Problem sei zu überwinden, wenn man die Frage nach den Voraussetzungen des ver- meintlich Objektiven stelle. „Antwort: sie ist eine bestimmte Art und Weise, ein Ereignis des rohen und wilden Seins auszudrücken und aufzuzeichnen, das ontologisch vorrangig ist.“ (VI 257). vgl. dazu Boehm, Gottried, „Der stumme Logos“, in: Métraux, Alexandre, Waldenfels, Bernhard (Hrsg.): Leibhaftige Vernunft, Spuren von Merleau-Pontys Denken, München: 1986, Fink, S. 289 - 304, hier: S. 290.
120 Vgl. Barbaras, S. 157 f..
121 Mit metaphorischen Ausdrücken wie „Falte“, „Höhlung“, oder auch „Verflechtung“ sucht Merleau-Ponty behutsam nach einem neuen Begriff für diesen Zustand des Zwischen der drit- ten Dimension, das i.S. Husserls die Kluft zwischen Denken und Sein meint. Bei Merleau-Ponty bildet der phänomenale Leib als das natürliche Ich, diese Falte, die Sein und Denken ver- schränkt, denn er ist die einzige Instanz, die sowohl wahrnehmen als auch Gedanken ausdrü- cken kann. Der phänomenale Leib ist im Gegensatz zum objektiven ein Ausdrucksvermögen, „ein Vermögen dieser Welt“ (PhW 401), das sich dynamisch artikuliert mittels des Körper- schemas (she. PhW 123 u. 171). Vgl. Dupond S. 38 u. 40 und Günzel, S. 51 - 54.
122 She. Dupond, 2008, S. 23.
123 She. dazu: Ferber, Rafael: Philosophische Grundbegriffe, Eine Einführung, München: 1999, Beck, S. 61 ff..
124 Metaphorisch ausgedrückt: Wir sitzen in Platons Höhle und - der festen Bedeutungen der Begriffe durch die Destruktion beraubt - schauen auf die Bilder der Höhlenwände, die ‚Etwas‘ als Übergangssynthesen produziert. Doch verdecken diese Bilder nicht eine hinter dem Gege- benen gelegene Ideenwelt, sondern eine subjektive, deutende Annäherung an die Empirie.
125 Was u.a. Husserls Psychologismuskritik widerlegt.
126 In VI bezieht Merleau-Ponty Lacans Spiegelstadium in die Konstitution des Körperschemas mit ein.
- Arbeit zitieren
- Helena Glatt Viviani (Autor:in), 2008, Der Begriff der Gestalt in Maurice Merleau-Pontys "Phänomenologie der Wahrnehmung", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126634
Kostenlos Autor werden


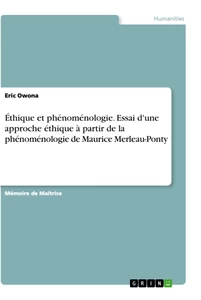

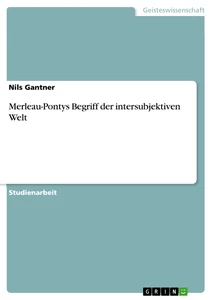




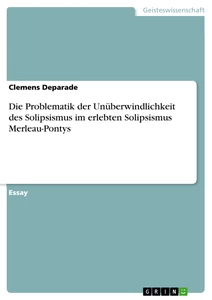


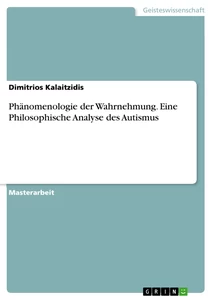



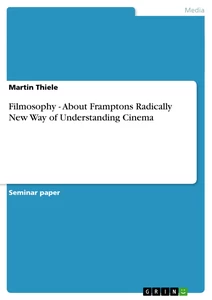





Kommentare