Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Teil I »Das Prinzip der inneren Differenzierung«
1. Zur gegenwärtigen Unterrichtspraxis
2. Zur Entfaltung des Differenzierungsproblems
3. Der Begriff der Differenzierung und seine Tücken
3.1 Der Begriff der Individualisierung
3.2 Offener Unterricht - eine Abgrenzung
3.3 Unterscheidungen zum Begriff der Differenzierung
4. Zur äußeren Differenzierung – ein Überblick
4.1 Interessendifferenzierung
4.2 Leistungsdifferenzierung
4.2.1 Streaming
4.2.2 Setting
5. Zur inneren Differenzierung
5.1 Warum muss Unterricht differenziert werden?
5.2 Ziele innerer Differenzierung
5.3 Innere Differenzierung und die Bildungspläne
5.4 Zum Bedingungsgefüge differenzierenden Unterrichts
5.4.1 Erfassung von Lernbedürfnissen und Lernvoraussetzungen
5.4.1.1 Personaler Entwicklungsstand
5.4.1.2 Sozialer Entwicklungsstand
5.4.1.3 Sachstruktureller Entwicklungsstand
5.4.1.4 Arbeitsmethodischer Entwicklungsstand
5.4.1.5 Problem bei der Erfassung der individuellen Disposition
5.4.2 Die Disponibilität der Lehrperson
5.4.3 Der optimale Passungsgrad im Unterricht
5.5 Zur Praxis der inneren Differenzierung
5.5.1 Differenzierung durch Variation der Sozialformen
5.5.2 Differenzierung in den Methoden
5.5.3 Differenzierung durch Medien
5.5.4 Differenzierung auf thematisch-intentionaler Ebene
5.5.5 Differenzierung in der Lehrerhilfe
5.6 Überlegungen für eine variable Sitzordnung
5.7 Ordnungs- und Suchraster zur inneren Differenzierung
Teil II »LRS in der Sekundarstufe I«
1. Zum Begriff „LRS“
1.1 Zur Geschichte der „LRS“
1.2 Der Begriff Analphabetismus - eine Abgrenzung
2. Developmental Spelling - Entwicklungspsychologische Modelle des Schriftspracherwerbs
2.1 Das Entwicklungsmodell von FRITH
2.1.1 Das logographemische Stadium
2.1.2 Das alphabetische Stadium
2.1.3 Das orthographische Stadium
2.2 Stufen des Lesen- und Schreibenlernens nach VALTIN
2.2.1 Das Stufenmodell der Schreibentwicklung nach VALTIN
2.2.2 Entwicklungsstufen beim Lesenlernen nach VALTIN
2.2.3 Was leistet das Modell?
3. Bedingungsmodell: Entstehung und Aufrechterhaltung der LRS
3.1 Frühkindliche Prinzipien: „Die Welt der Tassen“
3.2 Phonologische Bewusstheit
3.3 Phonologische Defizite
3.4 Aufmerksamkeitsverhalten und Gedächtniszugriff
4. Symptome der LRS
4.1 Primärsymptomatik
4.2 Sekundärsymptomatik
4.3 Das Leistungsversagen verbreitert sich
5. Der baden-württembergische Runderlass vom 10.12.1997
5.1 Allgemeine Fördermaßnahmen
5.2 Besondere Fördermaßnahmen
5.3 Förderbedürftige Schüler
5.4 Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung
5.5 Zeugnis
6. Erfassung der Rechtschreibfertigkeit in der Sekundar- stufe I mit der Hamburger Schreibprobe (HSP)
6.1 Lern- und entwicklungspsychologisches Konzept der HSP
6.2 Erfasste Merkmale des Rechtschreibkönnens
Teil III »Praxis der Inneren Differenzierung im Lernbereich Rechtschreibung in der Realschule «
1. Innere Differenzierung im Rechtschreibunterricht
2. Fördermöglichkeiten bei LRS im Rechtschreibunterricht der Sekundarstufe I
2.1 Kriterienkatalog zur Förderung bei LRS in der Sekundarstufe I
2.2 Aneignung der Grundlagen der Rechtschreibung durch Lesen
2.3 Rechtschreibtraining durch Verwendung des Wörterbuchs und der Rechtschreibkartei
2.4 Dynamisch-integrative Förderung von Sprechen Schreiben Lesen
3. „Lernen an Stationen“ - eine Möglichkeit
3.1 Begriffsklärung
3.2 Grundidee der Arbeitsform
Abbildungsverzeichnis
Anlagen
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 04.12.2003
Literatur: Das Prinzip der inneren Differenzierung
Literatur: LRS in der Sekundarstufe I
Einleitung
Allerspätestens seit den Studienergebnissen von PISA (Programme for International Student Assessment) und TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) ist bekannt, dass die Schülerinnen und Schüler unserer deutschen Schulen im internationalen Vergleich nur mittelmäßig abschneiden.
Es fehlen die sogenannten Schlüsselqualifikationen wie z.B. Selbstständigkeit, Eigeninitiative, Methodenbeherrschung, Problemlösungsvermögen, Kommunikations- und Teamfähigkeit, deren Bedarf gerade für die Arbeitswelt als wichtige Ergänzung zu Allgemein- und Fachwissen immer wieder von Vertretern der Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften sowie von Politikern betont und gefordert wird (vgl. MEISTER, 2000, S. 13).
Als Grund für diese Misere wird die gegenwärtige Lernkultur in den Schulen Deutschlands angesehen, denn „nach allem, was wir über die alltägliche Unterrichtspraxis wissen, ist der Frontalunterricht die häufigste Sozial- und Organisationsform des Unterrichts“ (BÖNSCH, 1995, S. 78).
Auch Studien bezüglich des Methodenrepertoires von Lehrerinnen und Lehrern gelangen zu der Erkenntnis, dass nach wie vor der sogenannte Frontalunterricht in der Mehrzahl der gehaltenen Unterrichtsstunden dominiert (vgl. HAGE u.a., 1985).
Problematisch an dieser momentanen Situation ist vor allem die primäre Orientierung entweder an den leistungsstarken Schülerinnen und Schülern einer Klasse oder an einem Klassendurchschnitt. Dieses Orientieren an einem Durchschnittsmenschen führt letztendlich zu einer Vernachlässigung des Individuums (vgl. MEISTER, 2002, S. 12; vgl. MEYER-WILLNER, 1979, S. 18).
Nun wies zwar bereits vor mehr als 200 Jahren der damalige amerikanische Präsident THOMAS JEFFERSON (1743-1826) auf „die verfassungsmäßige Gleichheit der Menschen“ (JEFFERSON, zit. nach SCHRÖDER, 2000, S. 185) hin, erkannte aber auch zugleich das Grundproblem jeder Demokratie und Pädagogik, nämlich „die faktische Ungleichheit in physischer, seelisch-geistiger und sozialer Hinsicht“ (JEFFERSON, zit. nach SCHRÖDER, 2000, S. 185).
Somit stellt sich die Frage, wie Unterricht angemessen auf die „Verschiedenheit der Köpfe“ (HERBART, zit. nach SÖLL, 1976, S. 17) und die „unausweichliche Ungleichheit der Schüler“ (HERBART, zit. nach SÖLL, 1976, S. 17) reagieren kann, so dass zugleich der allgegenwärtigen Schulmüdigkeit und dem Schulverdruss, nach Erachten der Autorin ein Resultat aus dem zu oft frontal gesteuerten Unterricht, entgegengewirkt werden kann?
Denn gerade Schulverdruss und Schulmüdigkeit sind es, die sich in der Arbeit der Verfasserin mit Schülerinnen und Schülern mit LRS bemerkbar machen.
In den über zwei Jahren Tätigkeit in einer privaten Fördereinrichtung für Lernhilfe und Lerntherapie, die sich neben der üblichen Nachhilfe besonders auf Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten wie Dyskalkulie und LRS spezialisiert hat, fällt häufig auf, dass viele zwar in der außerschulischen Förderung enorme Fortschritte machen, diese aber im Schulalltag nicht gewürdigt werden und die Kinder weiterhin mit schulischen Rückschlägen und nach wie vor schlechten Noten, nicht nur im Fach Deutsch, zu rechnen haben.
Grund hierfür ist einerseits die Leistungsmessung, die sich meistens am Klassendurchschnitt orientiert und individuelle Fortschritte völlig vernachlässigt und andererseits das Unterrichten im Gleichschritt, bei dem Leistungsschwächere oder Kinder mit Lernschwierigkeiten niemals dasselbe erreichen werden wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, die mit keinen Lernproblemen zu kämpfen haben.
Letztendlich führt dies zu Frust, darüber hinaus zu einer völlig falschen Selbsteinschätzung bezüglich der eigenen Fähigkeiten sowie der Verletzung des Selbstwertgefühls.
Eine mögliche Antwort auf die anfangs gestellte Frage der angemessenen Reaktion auf die unterschiedlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, stellt für die Autorin das Prinzip der inneren Differenzierung dar.
Dieses Prinzip wurde hauptsächlich in den 70-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts heftig diskutiert. So verwundert es kaum, dass in dieser Zeit eine Vielzahl an Publikationen zu diesem Thema erschienen. Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts verschwand der Begriff der Differenzierung allerdings fast weitgehend aus den Bibliografien.
Momentan scheint sich jedoch eine Wiederkehr des Begriffes in der schulpädagogischen Literatur der vergangenen fünf Jahre anzudeuten. Renommierte Verlage nehmen sich wieder dieses Themas an und das Wort Binnendifferenzierung hat sich gerade nach PISA zu einem „Modebegriff“ (AHLRING, 2002, S. 5) entwickelt.
Aufgrund der momentanen Aktualität dieses Themas und der allgegenwärtigen Diskussion über das Phänomen LRS scheint es sinnvoll sich mit beiden Gebieten näher auseinander zu setzen.
Anspruch dieser wissenschaftlichen Hausarbeit ist es, beispielhaft darzustellen wie Schülerinnen und Schüler durch differenzierenden Unterricht im Rahmen ihrer zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu einem bestimmten Ziel innerhalb eines Zielgebietes gelangen können und welche Rolle die Lehrerin bzw. der Lehrer bei der Anleitung und Begleitung dieser individuellen Lernwege übernimmt. Ferner soll nicht nur lese-rechtschreibschwachen Kindern und Jugendlichen, die ein relativ individuelles Rechtschreib- und/oder Lesetraining innerhalb des Unterrichts benötigen, ein Unterrichten nach dem Prinzip der inneren Differenzierung die Lust am Unterricht zurückbringen, sondern auch allen Schülerinnen und Schülern, die eines Lernens im Gleichschritt müde sind. Ganz nach dem Motto: Viele Wege führen nach Rom. Welchen Weg man dabei geht, um das eigentliche Ziel zu erreichen, spielt keine Rolle.
Der Aufbau dieser Arbeit gestaltet sich so, dass zunächst die beiden großen Themenkomplexe „Innere Differenzierung“ und „LRS“ in ihren theoretischen Grundlagen separat voneinander behandelt werden.
In einem dritten Teil sollen dann die zur Theorie gemachten Überlegungen sinnvoll zusammengeführt werden, so dass das Endprodukt eine Unterrichtseinheit nach dem Prinzip der inneren Differenzierung für den Rechtschreibunterricht unter besonderer Beachtung von Kindern mit LRS sein wird.
Teil I »Das Prinzip der inneren Differenzierung«
1. Zur gegenwärtigen Unterrichtspraxis
Bereits eingangs wurde kurz auf die Dominanz des Frontalunterrichts in der Mehrzahl der gehaltenen Unterrichtsstunden hingewiesen. Dies geht aus zahlreichen älteren wie neueren Studien bezüglich des Methodenrepertoires von Lehrerinnen und Lehrern (vgl. HAGE u.a., 1985; vgl. BOHL, 2000; vgl. BAUMERT, 2003) hervor, die eine „überwältigende Vorherrschaft eines streng vom Lehrer gelenkten Frontalunterrichts“ (MEYER-WILLNER, 1979, S. 12) eindeutig belegen.
So berichten KLAUS HAGE u.a., dass in ca. 75% des in ihrer Untersuchung beobachteten Unterrichts immer dasselbe Methodenspektrum angewendet worden sei. Dabei handle es sich meist um fragend-entwickelnde Verfahren mit einer stark ausgeprägten Dominanz der Lehrkraft und vergleichsweise geringer Aktivitäten seitens der Schülerinnen und Schüler (vgl. HAGE u.a., 1985, S. 147ff).
Charakteristisch für diese Form des Unterrichtens ist, dass die Lehrperson ihre Aufgabe darin sieht , „alle [Schülerinnen und Schüler] zur gleichen Zeit mit gleichen Verfahren zum gleichen Ziel zu bringen.“ (MEYER-WILLNER, 1979, S. 11). Diese Vorgehensweise liegt in der Annahme begründet, relativ alters- und begabungshomogenen Lerngruppen könnten in gleicher Zeit die gleichen Lernprozesse zugemutet werden (vgl. BÖNSCH, 1995, S. 78).
Natürlich soll der frontal ausgerichtete Unterricht an dieser Stelle nicht pauschal verurteilt werden, denn auch diese Unterrichtsmethode muss neben vielen anderen ihren festen Platz in einem guten Unterricht finden. Wichtig ist nur, in welchem Maße er in der Unterrichtspraxis realisiert wird. So zählt GERHARD MEYER-WILLNER neben einer Reihe von Nachteilen auch dessen Vorzüge auf (vgl. MEYER-WILLNER, 1979, S. 17f).
Doch trotz all dieser Vorteile, die so mancher Befürworter des Frontalunterrichts anführen könnte, erfährt das kreative und eigenständige Denken der Kinder und Jugendlichen durch die beliebte Frage-Antwort-Methode keinerlei Förderung. Darüber hinaus treten kooperative und solidarische Verhaltensmuster der Schülerinnen und Schüler weitgehend in den Hintergrund, falls es nicht sogar zum völligen Ausschluss dieser kommt. Zusätzlich orientiert sich solch ein Unterricht gerade nicht an der Individualität eines Menschen, sondern entweder an den Leistungsstarken einer Klasse oder an einem Klassendurchschnitt, so dass die besonderen Stärken oder aber auch die Schwächen der einzelnen Schülerinnen und Schüler völlig vernachlässigt werden (vgl. MEISTER, 2002, S. 12; vgl. MEYER-WILLNER, 1979, S. 18).
Das heißt, dass individuelle Unterschiede, die de facto bestehen, keinerlei Beachtung finden, obwohl zahlreiche Autoren, unter anderem MEYER-WILLNER, immer wieder darauf hinweisen. So differenziert MEYER-WILLNER zwischen den sogenannten interindividuellen Unterschieden bezüglich der Fertigkeiten und Fähigkeiten, den Bedürfnissen und Interessen, der Konzentrations- und Gedächtnisfähigkeit, den Lerntypen, der Leistungsmotivation sowie dem Lerntempo, die wiederum durch unterschiedliche häusliche Bedingungen, unterschiedliches genetisches Potential sowie Unterschiede im sozialen Milieu bedingt sind, und den sogenannten intraindividuellen Unterschieden. So kann eine Schülerin bzw. ein Schüler sehr gut im Rechnen sein, dafür aber Probleme mit dem Rechtschreiben haben oder sie bzw. er interessiert sich außerordentlich für Fremdsprachen, dafür jedoch nicht für naturwissenschaftliche Fächer (vgl. MEYER-WILLNER, 1979, S. 20).
Wenn nun Schule gewissen Forderungen wie freie Entfaltung der Persönlichkeit, Anspruch auf optimale Förderung, Ausgleich sozialer Benachteiligungen und gerechte Verteilung von Bildungs- und Lebenschancen nachkommen und entsprechen will (vgl. MEYER-WILLNER, 1979, S. 20), muss eine (partielle) Abkehr vom nach wie vor am häufigsten praktizierten Frontalunterricht erfolgen.
Darüber hinaus belegen Forschungsergebnisse und zahlreiche Publikationen, dass Schülerinnen und Schüler heute anders sind und weitgehend andere Erfahrungen, Interessen und Beeinträchtigungen mit in die Schule bringen als noch in den vergangenen Jahrzehnten (vgl. ERDMANN, 1996; vgl. FÖLLING-ALBERS, 1997; vgl. ROLFF, 2001). So spricht auch INGRID AHLRING von immer bunter, interkultureller sowie leistungsheterogener werdenden Lerngruppen und sieht die dringende Notwendigkeit auf diese Veränderungen einzugehen, um der Vielfalt gerecht werden zu können (vgl. AHLRING, 1997, S. 9). Die Aufgabe der Schule besteht nun darin, auf diese „externen Bedingungen“ (MEYER-WILLNER, 1979, S. 29) angemessen zu reagieren.
Wie aber kam es überhaupt erst zur Entfaltung des Differenzierungsproblems, mit dessen man im Grunde nur konfrontiert wird, wenn Kinder bzw. Jugendliche in größeren Lerngruppen zusammengefasst werden? Wie versuchte man in der Vergangenheit der Differenzierungsproblematik entgegenzuwirken? Diese Fragen sollen im folgenden Kapitel beantwortet werden.
2. Zur Entfaltung des Differenzierungsproblems
Bereits in den Schulen des Mittelalters versuchte man den individuellen Lernvoraus-setzungen der Lernenden gerecht zu werden, indem man sie entsprechend ihres bereits vorhandenen Kenntnis-, Fertigkeits- und Fähigkeitsstandes, unabhängig vom Alter, in bestimmten Abteilungen, unter anderem auch „Haufen“, „Zirkel“, „Ordines“ und „loca“ genannt, zusammenfasste (vgl. FISCHER, 1972, S. 9).
Diese Abteilungen können als Stufen eines bestimmten Lehrganges verstanden werden. Die Teilnehmenden solch eines Zirkels erarbeiteten den festgelegten Unterrichtsstoff mit dem zur Verfügung stehenden Lehrbuch und erhielten zusätzlich seitens der Lehrperson Einzelzuwendung (vgl. FISCHER, 1972, S. 10). Das Lehrbuch für diese Kleingruppen war nicht für ein bestimmtes Alter konzipiert, sondern legte lediglich die Reihenfolge des Lehrstoffes fest (vgl. SÖLL, 1979, S,15). Eine am Ende jeder Abteilung anstehende Prüfung ließ den Schüler schließlich bei Bestehen in die nächst höhere Gruppe rücken (vgl. SCHRÖDER, 2000, S. 184).
Indem sich jeder Lernende nach eigenem Ermessen mit dem Lernstoff auseinandersetzen konnte und jedem die Zeit für das Erreichen des Lehr- bzw. Lernziels gegeben wurde, die er benötigte, wurden die individuellen Lernprozesse berücksichtigt und ermöglicht. Diese Vorgehensweise war allerdings nur auf Grund der kleinen Schülerzahlen möglich, denn eine Schulpflicht zu dieser Zeit war noch nicht eingeführt und eine schulische Ausbildung war im Wesentlichen Privileg der Aristokratie und des Klerus (vgl. FISCHER, 1972, S. 10). Der folgende Holzschnitt schafft eine Vorstellung von Schule im Mittelalter.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Schule im Mittelalter, aus: SCHIFFLER/WINKELER, 1994, S. 67
Es existierten demnach keine Klassen nach unseren heutigen Vorstellungen, die durch das gleiche Alter und damit verbunden den gemeinsamen Schuleintritt der Schüler und Schülerinnen sowie die in der Regel gemeinsame Versetzung in die nächst höhere Klasse geprägt ist.
Zu Beginn der Neuzeit allerdings kam es zu einer gravierenden Veränderung, die sich bis in die heutige Zeit nachhaltig auswirkt.
JOHANN AMOS COMENIUS (1592-1670) entwarf in seiner „Didactica magna“ eine Grundkonzeption des Klassenunterrichts und forderte, dass alle Kinder Schulunterricht erhalten sollen, Jahrgangsklassen gebildet werden, die sich durch eine große Anzahl an Schülern, den gemeinsamen Schulbeginn und die Versetzung auszeichnen, die Kinder im Klassenverband gemeinsam unterrichtet werden, der zu lehrende Stoff in eine auf das Alter abgestimmte zeitliche Reihenfolge gebracht wird und in allen gleichen Altersjahrgangsklassen parallel unterrichtet wird (vgl. SÖLL, 1979, S. 15).
COMENIUS strebte „also eine allgemeine, in der stofflichen und zeitlichen Dimension einheitlich geregelte Volksbildung“ (SÖLL, 1979, S. 15) an.
Diese Forderungen basierten auf der Annahme, dass Kinder gleichen Alters in etwa auf dem gleichen Entwicklungsstand stünden, was wiederum ungefähr eine gleiche Auffassungskraft und Leistungsfähigkeit zur Folge habe (vgl. SCHRÖDER, 2000, S. 184).
Ausgehend davon richtete COMENIUS vier Schularten ein. Es entstand ein gestuftes Schulsystem mit den Schulen der Kindheit, des Knabenalters, des Jünglingsalters und des beginnenden Mannesalters (vgl. FISCHER, 1979, S. 11). In diesen Jahrgangsklassen wurden alle zu einer festgelegten Zeit mit demselben Unterrichtsstoff konfrontiert, dessen Strukturierung unter der Beachtung erfolgte, dass nie das „Fassungsvermögen“ (FISCHER, 1979, S. 11) des „Kollektivwesens Klasse“ (FISCHER, 1979, S. 11) überstiegen wurde.
Vorteil dieser neuen Unterrichtskonzeption war die Möglichkeit eine sehr große Anzahl an Schülern gemeinsam zu unterrichten, so dass Schulbildung weiteren Bevölkerungsschichten ermöglicht werden konnte und nicht mehr länger Vorrecht der Geistlichkeit und des Adels war.
Diese Art von Unterricht bedurfte jedoch andere Unterrichtsformen, so dass die Lehrperson von nun an nicht mehr für jeden Einzelnen da sein konnte, sondern von einem Katheder herunter eine 'Masse' unterrichten musste, wie das folgende Bild einer Dorfschule zeigt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Eine Dorfschule im Schwarzwald, aus: SCHIFFLER/WINKELER, 1994, S. 111
Im 17. Jahrhundert übte AUGUST HERMANN FRANCKE (1663-1727) an der Konzeption des Jahrgangsunterrichts des COMENIUS heftige Kritik. Für ihn war es äußerst fragwürdig, Kinder gleichen Alters im gleichen Tempo zum gleichen Ziel bringen zu wollen (vgl. SÖLL, 1976, S. 16). Er verfolgte vielmehr das Ziel, Lernende hinsichtlich des Kriteriums Leistung in bestimmten Lerngebieten in homogene Gruppen zusammenzufassen, den sogenannten Fachklassen.
Weitere Beispiele für die Bildung homogener Lerngruppen sind die Leistungsklassen im Schulsystem von ANTON SICKINGER (vgl. SÖLL, 1979, S. 17f) und die reifehomogenen Klassen von ALFONS KERN (vgl. SÖLL, 1979, S. 18).
Noch im 19. Jahrhundert wurden heftige Diskussionen geführt, welche Methode der Differenzierung die richtige oder bessere sei: die Jahrgangsklassen von COMENIUS oder die Fachklassen von FRANCKE.
Die größere Durchsetzungskraft besaß letztendlich das Konzept von COMENIUS, laut FISCHER aus organisatorischen Gründen, denn das System der Fachklassen erfordert „eine kaum zu meisternde Organisation“ (FISCHER, 1972, S. 18).
Bisher versuchte man also den individuellen Unterschieden durch eine scheinbare Homogenisierung der Lerngruppen bezüglich eines bestimmten Kriteriums entgegenzuwirken. Dahinter steht die Annahme, in homogenen Gruppen sei das Lernen effizienter.
Seit dem Aufkommen der reformpädagogischen Bewegung allerdings wurden zahlreiche Versuche unternommen, mit der Heterogenität der Schülerschaft sinnvoll zu arbeiten und aus dieser Nutzen zu ziehen. Einige sollen im Folgenden stichpunktartig aufgelistet werden, da eine vollständige Darstellung im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist:
- das Prinzip der Auflockerung des Klassenunterrichts, z.B. bei BERTHOLD OTTO und MARIA MONTESSORI
- Schülergruppierungen durch wechselnde Abteilungen, z.B. die Stammgruppen und Niveaukurse im Jena-Plan PETER PETERSENS
- sie Auflockerung des Frontalunterrichts durch individualisierende Verfahren, z.B. individual work im Dalton-Plan bei HELEN PARKHURST
- sie Auflockerung des Frontalunterrichts durch gruppenunterrichtliche Verfahren, z.B. die Freitätigkeit und das arbeitsteilige Verfahren in der Arbeitsschule von HUGO GAUDIG (vgl. SCHRÖDER, 2000, S. 185).
Mit dem Vorhaben, den „spontanen individuellen Bildungserwerb“ (FISCHER, 1972, S. 21) ins Zentrum des erzieherischen Bemühens zu stellen, griffen die Reformpädagogen die Gedanken von JEAN JAQUES ROUSSEAU (1717-1778) auf, die er in seinem Erziehungsroman Emile entwickelt hatte.
ROUSSEAU vertrat die Ansicht, dass Wiss- und Lernbegierde dem Menschen inne wohne, so dass jeder den eigenen Wissens-, Fähigkeits- und Fertigkeitsstand erweitern könne, wenn der eigene Lernweg gegangen werden könne und dürfe (vgl. FISCHER, 1972, S. 21).
Wirft man nun zuletzt noch einen Blick auf die Institution Schule der letzten Jahrzehnte, zeigt sich eins eindeutig: Die Unterrichtsorganisation in Jahrgangsklassen nach COMENIUS hat sich zumindest in Deutschland weitgehend durchgesetzt und somit auch das Verfahren mit einer scheinbar homogenen Gruppe zu arbeiten.
Tatsächlich ist diese angestrebte Homogenität aber nicht vorhanden, sondern vielmehr herrscht eine große Heterogenität in den Klassen. Daraus ergibt sich für die Autorin die Konsequenz, Überlegungen für einen Unterricht nach dem Prinzip der inneren Differenzierung anzustellen, damit der Versuch unternommen und dem Anspruch entsprochen werden kann, jede Schülerin und jeden Schüler entsprechend ihrem Potential zu fördern. Denn ein nach dem Prinzip der inneren Differenzierung geplanter und durchgeführter Unterricht berücksichtigt zum einen die vielfältigen, bereits beschriebenen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler und passt sich diesen an. Zum anderen fördert ein differenzierender Unterricht die Freude am Lernen und versucht der allgegenwärtigen Schulmüdigkeit sowie dem Schulverdruss entgegen zu wirken. Ferner soll Schule eine Stätte sein, „die die verfassungsrechtlichen Grundsätze der Gleichheit und Freiheit auch im Unterricht ernst nimmt“ (MEYER-WILLNER, 1979, S. 23) und den Kindern und Jugendlichen, neben der Vermittlung von Allgemein- und Fachwissen, Raum für ihre persönliche Entfaltung gibt. Um dies erreichen zu können, muss Schule bzw. Unterricht versuchen mehr an Flexibilität zu gewinnen und das Lern- bzw. Lehrangebot besser auf die Einzelne bzw. den Einzelnen auszurichten (vgl. MEYER-WILLNER, 1979, S. 23), denn ein Unterricht im ewigen Gleichschritt kann diesen Ansprüchen und Anforderungen nicht gerecht werden.
3. Der Begriff der Differenzierung und seine Tücken
Der Begriff der Differenzierung (von lat. differentia = Verschiedenheit) findet in der schulpädagogischen Literatur häufig Verwendung. Von einem einheitlichen Gebrauch dieses Terminus kann allerdings keine Rede sein.
Die zahlreichen Definitionsversuche unterscheiden sich sowohl in Bezug auf die Aufgaben als auch bezüglich der Methoden und Formen der Differenzierung (vgl. MEYER-WILLNER, 1979, S. 7). Trotz aller Unterschiede lassen sich auch Gemeinsamkeiten finden.
Um die wesentlichen Merkmale des Begriffes Differenzierung herausarbeiten zu können, müssen einige Definitionen aus der Literatur aufgeführt werden.
Nach HARTWIG SCHRÖDER ist Differenzierung „die Auflösung des heterogenen Klassenverbandes zugunsten homogener Gruppen in Bezug auf die Leistungsfähigkeit oder Interessenrichtung der Schüler“ (SCHRÖDER, 1993, S. 152).
WOLFGANG KLAFKI versteht unter Differenzierung „alle organisatorischen und methodischen Bemühungen, die darauf zielen, den individuellen Begabungen, Fähigkeiten und Neigungen, Interessen einzelner Schüler und Schülergruppen innerhalb einer Schule oder Klasse gerecht zu werden“ (KLAFKI, 1961, Sp. 180f).
In einer weiteren Definition wird Differenzierung als „das breite Spektrum schul- und unterrichtsorganisatorischer Maßnahmen“ (WINKELER, 1975, S. 8) verstanden, „mit deren Hilfe die Schule den vielfältigen und sehr unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen der Lernenden einerseits und den mannigfaltigen Anforderungen der Gesellschaft andererseits gerecht zu werden versucht“ (WINKELER, 1975, S. 8).
MANFRED BÖNSCH versteht unter Differenzierung „einmal das variierende Vorgehen in der Darbietung und Bearbeitung von Lerninhalten, zum anderen die Einteilung bzw. Zugehörigkeit von Lernenden zu Lerngruppen nach bestimmten Kriterien. Es geht um die Einlösung des Anspruchs jedem Lernenden auf optimale Weise Lernchancen zu bieten, dabei die Ansprüche und Standards in fachlicher, institutioneller und gesellschaftlicher Hinsicht zu sichern und gleichzeitig lernorientiert aufzuarbeiten. Differenzierung stellt sich für die Organisation von Lernprozessen als Bündel von Maßnahmen dar, Lernen in fachlichem, organisatorischem, institutionellem wie individuellem und sozialem Bezug zu optimieren“ (BÖNSCH, 1995, S. 21).
Alle Autoren verweisen in ihren Definitionen auf die individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler. WINKELER und BÖNSCH beziehen zusätzlich noch die gesellschaftlichen Ansprüche und Anforderungen mit ein, die sich besonders in den letzten Jahren enorm geändert haben, denn die Gesellschaft fordert von den künftigen Generationen das Vorhandensein von den bereits erwähnten Schlüsselqualifikationen sowie die Fähigkeit und vor allen Dingen die Initiative zu lebenslangem Lernen. All dies sind Qualifikationen, die laut BÖNSCH, keinesfalls frontal im Gleichschritt durch Anhäufung von Fach- und Allgemeinwissen erlernt werden können (vgl. BÖNSCH, 1995, S. 97). Auf Grund dieser zwei Tatbestände werden Differenzierungsmaßnahmen ergriffen, die zu einer Gruppierung der Lernenden nach bestimmten Kriterien führen.
Des Weiteren bedeutet für die Autoren Differenzierung, das didaktische Bemühen jede Schülerin und jeden Schüler optimal zu fördern. Dies geschieht durch eine Variation bezüglich der Lernziele bzw. Lerninhalte oder der Methoden bzw. Medien (vgl. SCHITTKO, 1984, S. 22).
Ferner verfolgt Differenzierung Ziele, bei denen YATES zwischen den individuellen und den gesellschaftlichen unterscheidet. Er erklärt weiter, dass die gesellschaftlichen Ziele auf einer Skala zwischen Erhaltung des status quo und gesellschaftlichem Wandel, die individuellen Zielvorstellungen auf einer Skala zwischen individuell-humanistisch und konformistisch-reglementiert, anzusiedeln sind (vgl. YATES, 1972, S. 94f).
Die definitorischen Schwierigkeiten können an dieser Stelle natürlich nicht behoben werden, doch erscheint die gemeinsame Verständigung auf die Definition nach KLAUS SCHITTKO der Autorin als sinnvoll, da diese alle herausgearbeiteten Gemeinsamkeiten aufweist: „Differenzierung meint die Bemühungen, angesichts der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und unterschiedlicher gesellschaftlicher Anforderungen durch eine Gruppierung nach bestimmten Kriterien und durch didaktische Maßnahmen den Unterricht so zu gestalten, daß die für das schulische Lernen gesetzten Ziele möglichst weitgehend erreicht werden können“ (SCHITTKO, 1984, S. 23)
3.1 Der Begriff der Individualisierung
Wie der Begriff der Differenzierung findet auch der Begriff der Individualisierung in der Literatur in mannigfaltiger Form Verwendung. So werden die beiden Bezeichnungen zum Teil synonym gebraucht oder aber Individualisierung wird als Terminus für die sogenannte innere Differenzierung verwendet.
Des Weiteren wird mit Individualisierung ein Ziel bezeichnet, das mit einem differenzierenden Unterricht erreicht werden soll. Demnach sind dann unter Differenzierung die Maßnahmen zu verstehen, die das Prinzip der Individualisierung zu realisieren helfen. Hierzu muss die Berücksichtigung der individuellen Lernvoraussetzungen im Vordergrund stehen und der Unterricht muss den Lernwünschen und Lernfortschritten jeder einzelnen Schülerin bzw. jedem einzelnen Schülers angepasst und entsprechend gestaltet werden (vgl. SCHITTKO, 1984, S. 23).
ROLF WINKELER, ERWIN SCHWARTZ u.a. fassen dieses Vorgehen unter dem Begriff der „optimalen Passung“ (WINKELER, 1979, S. 29; SCHWARTZ, 1976, S. 38) zusammen. Im Extremfall führt Differenzierung demnach zu einer Individualisierung, bei der dann Einzellernen erfolgt.
3.2 Offener Unterricht - eine Abgrenzung
Der Begriff offener Unterricht ist momentan in aller Munde und lässt sich relativ schwer eingrenzen.
Häufig wird diese Bezeichnung gleichbedeutend mit dem Begriff der Differenzierung verwendet. Es gilt an dieser Stelle also zu klären, ob die beiden Termini identisch, teilidentisch sind oder ob sie sich gegenseitig ausschließen.
Nach ELISABETH NEUHAUS-SIEMON bezeichnet dieser Begriff eine Form des Unterrichts, „dessen Unterrichtsinhalt, -durchführung, -verlauf nicht primär vom Lehrer, sondern von Interessen, Wünschen und Fähigkeiten der Schüler bestimmt wird, wobei der Grad der Selbst- und Mitbestimmung des zu Lernenden durch die Schüler zum entscheidenden Kriterium des offenen Unterrichts wird“ (NEUHAUS-SIEMON, 1989, S. 409).
Für die Autorin gilt mit dieser Definition geklärt, dass sich beide Begriffe ausschließen, da differenzierender Unterricht primär von der Lehrperson geplant wird, während offener Unterricht, nach Erachten der Verfasserin, auf einer spontanen Auseinandersetzung mit der Umwelt des Individuums basiert und autonomes Lernen als Grundlage sieht.
3.3 Unterscheidungen zum Begriff der Differenzierung
In der Schulpädagogik werden verschiedene Arten von Differenzierung unterschieden. Dabei wird gerade in der deutschsprachigen Literatur die Vielfalt der Begriffe sehr uneinheitlich verwendet (vgl. HAUSSER, 1980, S. 21).
Im Folgenden soll nun der Versuch unternommen werden, dieses terminologische Wirrwarr ein wenig zu ordnen und überschaubarer zu machen, damit die begriffliche Grundlage für diese wissenschaftliche Hausarbeit gelegt werden kann.
Nach HAUSSER lässt sich zwischen der Schulsystem-, der Schul- und der Unterrichtsdifferenzierung unterscheiden, die den gleichnamigen Ebenen Schulsystem, Schule und Unterricht zugeordnet werden können (vgl. HAUSSER, 1980, S. 21).
Diese Zuordnung entspricht den in der deutschsprachigen Literatur häufig vorfindbaren Begriffen der institutionellen, äußeren und inneren Differenzierung.
In der englischsprachigen Literatur findet man bei HEATHERS die Unterscheidung zwischen „interschool grouping” (HEATHERS, 1969, S. 560), „interclass grouping” (HEATHERS, 1969, S. 564) und „intraclass grouping” (HEATHERS, 1969, S. 567).
MEYER-WILLNER dagegen unterscheidet zwischen organisatorischer und didaktischer Differenzierung. Während die organisatorische Differenzierung auf dem Prinzip erfolgt, möglichst homogene Gruppen zu bilden, versucht die didaktische Differenzierung die bestehende Heterogenität einer Gruppe sinnvoll zu nutzen (vgl. MEYER-WILLNER, 1979, S. 29f).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Differenzierungsgrafik, aus: MEYER-WILLNER, 1979, S. 29
Für die Bildung homogener Gruppen sind in der Regel schulorganisatorische Differenzierungsmaßnahmen erforderlich und es wird das Ziel der Leistungsoptimierung im Zuge der Selektion verfolgt. Dem hingegen rückt bei der Arbeit mit heterogenen Gruppen, neben der Leistungsförderung, vor allem das soziale Lernen sowie die soziale Integration in den Mittelpunkt. Für diese Form der Differenzierung sind Maßnahmen didaktischer Art notwendig (vgl. MEYER-WILLNER, 1979, S. 29f).
In einem weiteren Schritt unterteilt MEYER-WILLNER die organisatorische in die interschulische und intraschulische Differenzierung.
Die interschulische Differenzierung ist im Schulsystem der BRD konsequent verwirklicht. Im Laufe der Zeit wurden für die unterschiedlichen Ausbildungsbedürfnisse jeweils eigene Schulformen mit eigenem Bildungsauftrag und einem bestimmten Adressatenkreis eingerichtet. In allen Bundesländern verläuft die Selektion und Zuweisung der Schülerinnen und Schüler nach Verlassen einer Grundschule, deren Besuch allerdings von unterschiedlich langer Dauer sein kann, in die verschiedenen Schulformen gleich. Ferner existieren noch Unterscheidungsmöglichkeiten nach alt- und neusprachlichen sowie wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen, technischen und musischen Gymnasien, wobei die jeweiligen Zweige sehr konkrete Lehrplanentscheidungen bewirken (vgl. PARADIES/LINSER, 2001, S. 24)..
Bei der intraschulischen Differenzierung werden in der Regel zwei Formen unterschieden: die Leistungsdifferenzierung sowie die Interessendifferenzierung.
Diese Differenzierungen, die innerhalb einer Schule stattfinden, jedoch die Klassen zum Teil oder sogar ganz auflösen, bezeichnet man als Maßnahmen der sogenannten äußeren Differenzierung. Hierbei wird eine bessere Passung zwischen den Lernanforderungen und den jeweiligen Gruppierungen angestrebt. Manchmal wird der Begriff der äußeren Differenzierung auch für die Aufteilung der Schülerinnen und Schüler auf die verschiedenen Schularten benutzt (vgl. MEYER-WILLNER, 1979, S. 30).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Formen der äußeren Differenzierung, aus: MEYER-WILLNER, 1979, S. 31
Mit innerer Differenzierung, auch häufig Binnendifferenzierung oder wie bei MEYER-WILLNER der Fall auch didaktische Differenzierung genannt, meint man „alle Maßnahmen, die innerhalb einer Klasse oder Lerngruppe (Kurs) getroffen werden“ (MEYER-WILLNER, 1979, S. 30). Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, den unterschiedlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen und Lernbedürfnissen der Schülerinnen und Schüler zu entsprechen, um sie optimal fördern zu können (vgl. BÖNSCH, 1995, S. 99).
4. Zur äußeren Differenzierung – ein Überblick
Äußere Differenzierung bezeichnet nach KLAFKI und STÖCKER alle Maßnahmen, in denen „Schülerpopulationen nach irgendwelchen Gliederungs- oder Auswahlkriterien - z.B. den Gesichtspunkten unterschiedlichen Leistungsniveaus oder unterschiedlicher Interessen – in Gruppen aufgeteilt werden, die räumlich getrennt und von verschiedenen Personen bzw. zu verschiedenen Zeiten unterrichtet werden“ (KLAFKI/STÖCKER, 1993, S. 173).
Ziel dabei ist es, möglichst homogene Gruppierungen bezüglich eines bestimmten Kriteriums zu erhalten. Hierbei wird, wie bereits erwähnt, zwischen interschulischer und intraschulischer Differenzierung unterschieden (vgl. SCHRÖDER, 2000, S. 188).
Die gebräuchlichsten Kriterien für Gruppierungen der intraschulischen Differenzierung sind Leistung sowie Interesse. Diese werden als besonders wichtig angesehen. BÖNSCH sieht Leistung sogar „als das Differenzierungskriterium par excellence“ an (BÖNSCH, 1995, S.22). Neben Interesse und Leistung als Differenzierungskriterium wären noch zahlreiche weitere denkbar wie z.B. Geschlecht, Religion und Alter (vgl. MEYER-WILLNER, 1979, S. 31). Einige dieser Kriterien haben in der Vergangenheit eine nicht unwesentliche Rolle gespielt, verlieren aber in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung, weswegen die Verfasserin im Folgenden nur auf die Interessen- sowie die Leistungsdifferenzierung eingehen wird.
4.1 Interessendifferenzierung
BÖNSCH versteht unter Interessendifferenzierung Arrangements, „die einem Lernenden statt Vermittlung und Erarbeitungspflicht die Chance geben, in freier Entfaltung sich auf Inhalte, Handlungen einzulassen, um ein latentes oder manifestes Interesse zu identifizieren, zu entwickeln oder zu verstärken“ (BÖNSCH, 1995 S. 23).
Nach WINKELER hat Interessendifferenzierung zwei Funktionen, die er in den Kurzformeln „Entfaltung der Persönlichkeit“ (WINKELER, 1975, S. 32) und „Ausbildung von Spezialisten“ (WINKELER, 1975, S. 32) ausformuliert. Damit werden die drei allgemeinen Ziele Selbstbestimmung, selbstständiges Lernen und kooperatives Arbeiten verfolgt (vgl. BÖNSCH/SCHITTKO, 1981, S. 205). Die erste Funktion orientiert sich an den Interessen des Individuums, während sich die letztere auf ein gesellschaftliches Interesse bezieht, denn eine Differenzierung nach Interessen sorgt für die notwendige und angemessene Ausbildung von Spezialisten in einer arbeitsteilig organisierten Gesellschaft (vgl. WINKELER, 1975, S. 32).
4.2 Leistungsdifferenzierung
Werden Schülerinnen und Schüler nach dem Jahrgangsprinzip in Schulklassen eingeteilt, weisen sie trotz des gleichen Alters meist sehr unterschiedliche Leistungsstände auf. Bei der Leistungsdifferenzierung werden sie deswegen in bestimmte Gruppen eingeteilt, dies kann kurz-, mittel- oder sogar längerfristig geschehen. Solch eine Zuordnung erfolgt auf Grund der gemessenen oder angenommenen allgemeinen Leistungsfähigkeit der bzw. des Einzelnen (vgl. BÖNSCH, 1995, S. 22).
Formen der Leistungsdifferenzierung sind das sogenannte streaming und das sogenannte setting.
Mit diesen Leistungsdifferenzierungsformen wird versucht, die Heterogenität einer Schülerschaft einzudämmen, um zumindest tendenziell zu leistungshomogenen Lernverbänden zu kommen. Hinter dieser Vorgehensweise steckt die Vorstellung, dass, je feiner die Leistungsunterschiede in einer Lerngruppe sind, Lernen umso besser und erfolgreicher erfolgt (vgl. VOLLSTÄDT, 1997, S. 37).
4.2.1 Streaming
Bei dem streaming-Verfahren werden die Schülerinnen und Schüler nach ihrer allgemeinen Leistungsfähigkeit in (vermeintlich) homogene Klassen eingeteilt (vgl. BÖNSCH, 2000, S. 170).
Es stellt die Weiterentwicklung der um die Jahrhundertwende eingerichteten Mannheimer Leistungsklassen des Mannheimers Stadtschulrates ANTON SICKINGER dar, der nach dem Kriterium allgemeiner Leistungsfähigkeit drei durchlässige Parallelzüge bildete.
Da den drei Zügen eine unterschiedliche Zahl an Klassenstufen mit verschiedenen Stoffplänen zugeteilt wurde, konnten alle Schülerinnen und Schüler, völlig unabhängig von ihrem Leistungsvermögen, einen Schulabschluss erreichen. In der Bundesrepublik Deutschland hat das streaming eher eine untergeordnete Rolle gespielt, außer in den hessischen Förderstufenversuchen der fünfziger und frühen sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Allerdings wurden hier die Kinder und Jugendlichen nur in den Hauptfächern Englisch, Mathematik und teilweise in Deutsch zu 'streams'gruppiert, während in den restlichen Fächern weiterhin in heterogenen Klassen unterrichtet wurde (vgl. BÖNSCH, 2000, S. 170).
4.2.2 Setting
Das bekannteste, aber wohl auch meistdiskutierte, setting-Modell in der Bundesrepublik Deutschland ist das sogenannte FEGA-Modell. Es wurde im Rahmen der Berliner Gesamtschulen entwickelt und geht von der Prämisse aus, dass Lerngeschwindigkeit und Leistungshöhe korrelieren und somit Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlicher Leistungsfähigkeit auch unterschiedlich schnell lernen (vgl. KEIM, 1977, S. 70).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Das FEGA-Modell, aus: BÖNSCH, 2000, S. 171
Am FEGA-Modell, das in der Walter-Gropius-Gesamtschule in Berlin/Britz-Buckow-Rudow erprobt wurde (vgl. WINKELER, 1975, S. 13), soll im Folgenden das Prinzip des setting verdeutlicht werden.
Es bezieht sich auf die 7. bis 10. Klassenstufen. Diejenigen Schülerinnen und Schüler mit den besten fachspezifischen Leistungen im ersten Halbjahr des 7. Schuljahres, besuchen ab der zweiten Hälfte des 7. Schuljahres den sogenannten F(Fortgeschritten-en)Kurs. Es folgen der E(Erweiterungs-)Kurs, der G(Grund-)Kurs und der A(Aufbau/Anschluss-)Kurs, bei denen das Anspruchsniveau von Kurs zu Kurs immer geringer wird.
Für alle Kurse ist ein sogenanntes Fundamentum verbindlich. Das sogenannte Additum, das für den F-Kurs und den E-Kurs bereitgestellt wird, beinhaltet Zusatzstoffe und Zusatzziele. Daraus ergibt sich folgende Kurseinteilung (vgl. KEIM, 1977, S. 71):
F ortgeschrittenenkurs Fundamentum + Additum + Additum
E rweiterter Kurs Fundamentum + Additum
G rundkurs Fundamentum
A ufbau- (Anschluss-)kurs Fundamentum + bessere Lernbedingungen
Alle Kurse erarbeiten zunächst das Fundamentum, erst danach werden Zusatzstoffe aus dem Additum zur Bearbeitung bereitgestellt. So ist es jeweils nach Ende eines jeden Halbjahres möglich, ohne Probleme die Kurse zu wechseln (vgl. WINKELER, 1975, S. 14). BÖNSCH führt allerdings eine Reihe von Punkten als Kritik an (vgl. BÖNSCH, 2000, S. 171f):
- Die Schülerinnen und Schüler werden nicht auf Grund aktueller, sondern auf Grund zurückliegender Lernleistungen in die jeweiligen Niveaustufen einge-wiesen.
- Die Bildung solch relativ stabiler Leistungskurse kann zu einer Desintegration der Schülerinnen und Schüler mit der Gefahr der Reproduzierung sozialer Schichten führen.
- Die erhoffte Durchlässigkeit des Systems konnte nicht erhalten bleiben und die angestrebte Homogenität der jeweiligen Kurse ging sehr schnell wieder verloren
- es gibt keine gesicherten Nachweise für den Leistungsvorteil homogener Grup-pen gegenüber leistungsheterogenen Gruppen.
- Bei solchen Modellen besteht die Gefahr, den Leistungsstand der einzelnen Schülerinnen und Schüler zu stabilisieren, was eventuell zum dem sogenannten selffulfilling-prophecy-Effekt führen kann. Damit ist gemeint, dass die Einteilung in bestimmte Kurse das Selbstbild der Schülerinnen und Schüler sowie ihre Leistungsentwicklung bestimmen kann.
Neben den Fachleistungskursen zählt die sogenannte flexible Differenzierung ebenfalls zu dem setting-System. Mit der flexiblen Differenzierung will man den oben genannten Problemen des setting entgehen. Flexible Differenzierung kann grafisch folgendermaßen dargestellt werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Flexible Differenzierung, aus: BÖNSCH, 2000, S. 172
Der Vorteil der flexiblen Differenzierung wird in der Möglichkeit gesehen, sie für jede Unterrichtseinheit einsetzen zu können. Dabei wechselt sich die Arbeit in heterogenen und homogenen Leistungsgruppen immer wieder ab. Nach der ersten heterogenen Phase, in der die Vermittlung der Grundlernziele angestrebt wird, folgt ein für alle Schülerinnen und Schüler identischer Diagnosetest, der Lernlücken ermitteln soll.
Nach dieser Lernstandsermittlung werden homogene Gruppen gebildet, so dass sich folgende Kurse ergeben: Zusatz-, Wiederholer/Zusatz- und der Gesamtwiederholungskurs.
Der Zusatzkurs erarbeitet Zusatzlernziele, da diese Schülerinnen und Schüler die Grundlernziele bereits erreicht haben. Im Wiederholer-/Zusatzkurs wiederholen alle, die ein oder zwei Grundlernziele nicht erreicht haben, nochmals die Inhalte und verfolgen nach einem bestandenen Nachtest ebenfalls die Zusatzlernziele. Der Gesamtwieder-holungskurs erfasst die Schülerinnen und Schüler, die kein Grundlernziel erreicht haben, und beinhaltet eine vollständige Wiederholung mit anderen Methoden und Medien (vgl. BÖNSCH, 2000, S. 172f).
Als Vorteile einer flexiblen Differenzierung zählt BÖNSCH die „gezielte Förderung nach genauer Lerndiagnose, die Verwirklichung zielerreichenden Lernens, die hohe Kursdurchlässigkeit, die nur geringe schichtspezifische Auslese und die kurze Kurszugehörigkeit“ (BÖNSCH, 2000, S. 172) auf.
Unvermeidbar sind jedoch (vgl. BÖNSCH 2000, S. 172) unter anderem die ständige Fluktuation und damit verbunden die Behinderung sozialen Lernens, eine Kursstabilisierung auf eine lange Dauer hinaus, der hohe Arbeitsaufwand für die Lehrperson und der hohe Organisationsaufwand in der Schule (vgl. BÖNSCH 2000, S. 172).
5. Zur inneren Differenzierung
WINKELER versteht unter innerer Differenzierung „alle unterrichtsorganisatorischen Maßnahmen, die der Lehrer innerhalb der Klasse ergreift, um der Individualität des Schülers optimal angemessene Lernprozesse zu ermöglichen. Innere Differenzierung versteht sich als Gegenbegriff zur äußeren Differenzierung und als Gegenbegriff zum individualisierten Einzelunterricht. Im Gegensatz zum individualisierten Einzelunterricht wird an einem für alle Schüler einheitlichen und gemeinsamen Unterrichtsgeschehen in einem stabilen sozialen Netz prinzipiell festgehalten; im Gegensatz zur äußeren Differenzierung wird auf eine Homogenisierung der Klassen verzichtet und die Heterogenität der Klasse als Ausgangspunkt im Unterricht akzeptiert. Ein auf die Schülerindividualität zugeschnittener Unterricht in heterogenen Klassen ist jedoch ohne weitgehenden Verzicht auf das traditionelle frontale Unterrichtsverfahren undenkbar. Innere Differenzierung erfordert eine variable und zeitweise unterschiedliche Unterrichtsgestaltung für einzelne Schülergruppen oder einzelne Schüler unter prinzipieller Wahrung des insgesamt einheitlichen und gemeinsamen Unterrichtsgeschehen für alle Schüler der Klasse“ (WINKELER, 1979, S. 19f).
5.1 Warum muss Unterricht differenziert werden?
„Die sogenannte Jahrgangsklasse ist keine homogene Lerngruppe! Wer das ignoriert, übergeht die tatsächliche Unterschiedlichkeit der in einer Klasse zusammengefassten Schüler“ (KLAFKI/STÖCKER, 1993, S. 176), so die Aussage von KLAFKI und STÖCKER in ihrem Beitrag „Innere Differenzierung des Unterrichts“ erschienen in „Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik“.
Nichtsdestotrotz wurden in der Vergangenheit in erster Linie immer wieder Versuche unternommen, möglichst homogene Lerngruppen zu bilden, um Lehren und Lernen effektiver zu gestalten, so z.B. die Jahrgangsklassen nach COMENIUS oder die Mannheimer Leistungsklassen nach ANTON SICKINGER.
Grund hierfür ist die im deutschen Schulsystem vorherrschende und bereits mehrmals erwähnte Überzeugung, Schülerinnen und Schüler würden in leistungshomogenen Gruppen erfolgreicher lernen als in leistungsheterogenen. Doch gerade diese Annahme scheint in Frage gestellt werden zu müssen, besonders seit den Veröffentlichung von TIMSS und PISA. Denn gerade die Länder, in denen heterogene Lerngruppen eine Selbstverständlichkeit darstellen, zählen zu den PISA-Spitzengruppen (vgl. VIELUF, 2003, S. 34).
Doch bereits weit vor der Veröffentlichung der Studienergebnisse von TIMSS und PISA stellten WOLFGANG KLAFKI und HERMANN STÖCKER das Schulsystem in Deutschland in Frage und erhoben in dem oben erwähnten Beitrag fünf Einwände gegen die Homogenisierung von Lerngruppen.
Mit dem ersten Argument gegen die Bildung homogener Gruppen verweisen beide Autoren darauf, dass die Annahme selbst, homogene Gruppen bilden zu können, nicht realistisch sei, denn die immense Vielfalt an unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten führe dazu, dass das Ziel „ wirklich ausgangshomogene Gruppen zu bilden bzw. Gruppen, die in ihren Lernmöglichkeiten einander gleichen, nur sehr begrenzt erreichbar“ (KLAFKI/STÖCKER, 1993, S. 176) sei.
Zweitens ist ihrer Ansicht nach das Bilden homogener Gruppen nur in Bezug auf ein einziges Kriterium möglich oder man müsste aber annehmen, dass es „zwar verschiedene Kriterien, unter denen Lerngruppen zusammengestellt werden können, [gebe], aber die Ausprägung der verschiedenen Kriterien bei bestimmten Schülergruppen in analoger Weise [erfolge]“ (KLAFKI/STÖCKER, 1993, S. 177). Dies sei aber nicht der Fall.
Grundlage des dritten Kritikpunktes ist die Annahme, dass die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, die Kinder und Jugendliche mit in die Schule bringen, weitgehend lebensgeschichtlich bedingt sind, weswegen Homogenisierung vor allem die Gefahr einer Trennung der Schülerinnen und Schüler nach sozialer Herkunft in sich birgt und damit gleichbedeutend zu unterschiedlicher schulischer Behandlung führe (KLAFKI/STÖCKER, 1993, S. 177).
Das vierte Argument, das KLAFKI und STÖCKER anführen, erscheint der Autorin als eines der wichtigsten, denn hinter den immer wiederkehrenden Versuchen homogene Lerngruppen zu bilden, steht stets die Annahme, dass durch das Verfahren der Homogenisierung bei Lerngruppen der Lernerfolg gesteigert werden könne. Ferner könne in homogenen Gruppen die kognitiven Fähigkeiten weitaus besser gefördert werden. KLAFKI und STÖCKER verweisen jedoch darauf, dass diese Annahme bereits durch einige empirische Forschungsergebnisse widerlegt werden konnte. Vielmehr zeigen die Ergebnisse, dass sich Homogenität in Lerngruppen für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler eher nachteilig auswirkt. Für die Leistungsstärkeren scheint es weder positive noch negative Folgen zu haben (vgl. KLAFKI/STÖCKER, 1993, S. 179).
Neuere Studien, wie z.B. die Längsschnittstudie „Erhebung von Aspekten der Lernausgangslage und der Lernentwicklung“, kurz „LAU“ unter der Leitung von RAINER LEHMANN (Humboldt-Universität zu Berlin), verzeichnen gleiche Ergebnisse. So konnte ebenfalls gezeigt werden, dass heterogene Lerngruppen wichtig für eine effektivere Förderung leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler sind und eine Heterogenität der Lerngruppe keinerlei Auswirkungen auf die Entwicklung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler hat (vgl. VIELUF, 2003, S. 34f). KLAFKI und STÖCKER nennen hierfür drei Gründe:
- den leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern fehlt der Ansporn durch die leistungsstärkeren.
- in homogenen Gruppen kommt es häufig zu einer Stabilisierung des Leistungsstandes, einmal weil die Lehrperson und deren Erwartungen sich auf ein bestimmtes Leistungsniveau einstellen, dies aber auch gleichermaßen auf Seiten der Schülerinnen und Schüler geschieht.
- die Leistungsentwicklung bestimmt sehr oft das Selbst- wie auch Fremdbild der Schülerinnen und Schüler, so dass sich dieses bei der Einteilung in die leistungsstärkere Lerngruppe in positiver Weise verändert, während das Einteilen in die leistungsschwächere Lerngruppe eher ein negativeres Selbstbild prägt.
Als fünftes und letztes Argument führen KLAFKI und STÖCKER an, dass Schule nicht nur einen Bildungsauftrag, sondern darüber hinaus auch einen Erziehungsauftrag übernommen hat. So ist es deren Aufgabe, den Kindern und Jugendlichen Raum für „die Entfaltung von individueller Identität und sozialer Beziehungsfähigkeit“ (KLAFKI/STÖCKER, 1993, S. 180) zu geben. Dies kann aber, so der Hypothese von KLAFKI und STÖCKER folgend, nur in heterogenen Lerngruppen gewährleistet werden. Denn nur hier können eigene Fähigkeiten (emotional-expressive, organisatorisch-praktische usw.) herausgefunden und erprobt, eigene Erfahrungen mit eingebracht und Rücksichtnahme geübt werden (vgl. KLAFKI/STÖCKER, 1993, S. 180f).
Diese fünf Einwände gegen eine Homogenisierung stellen zugleich eine Begründung und Zielsetzung von innerer Differenzierung dar. So schreiben KLAFKI und STÖCKER: „Wenn Unterricht jeden einzelnen Schüler optimal fördern will, wenn er jedem zu einem möglichst hohen Grad von Selbsttätigkeit und Selbständigkeit verhelfen und Schüler zu sozialer Kontakt- und Kooperationsfähigkeit befähigen will, dann muss er im Sinne innerer Differenzierung durchdacht werden.“ (KLAFKI/STÖCKER, 1993, S. 181).
5.2 Ziele innerer Differenzierung
Nach KLAFKI und STÖCKER dient innere Differenzierung in erster Linie „der Zielsetzung optimaler Förderung aller Schüler bei der Aneignung von Erkenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten“ (KLAFKI/STÖCKER, 1993, S. 181).
Die Realisierung dieses Ziels hat oberste Priorität, weswegen differenzierender Unterricht an den vielfältigen Voraussetzungen, die Kinder und Jugendliche bereits bei Schuleintritt aufweisen, anknüpfen und Stärken sowie Schwächen beachten muss.
So besteht für jede Schülerin und jeden Schüler die Chance, ihr bereits vorhandenes Potential zu nutzen oder aber sinnvoll und effektiv an den eigenen Schwächen zu arbeiten. Dies geschieht natürlich alles auf der Grundlage einer gemeinsamen Grundausbildung.
So fordert auch FRANZ E. WEINERT, dass „die Unterschiedlichkeit der Lernvoraussetzungen, -fähigkeiten und –stile der Schüler [...] nicht durch die Monokultur der einen Methode nivelliert werden [darf]. Vielmehr sind methodische Variationen einzusetzen, die eine Anpassung des Unterrichts an die individuellen Unterschiede erlauben.“ (WEINERT, 1997, S. 50).
WEINERT betont an dieser Stelle die Notwendigkeit des differenzierenden Unterrichts, besonders die der methodischen Differenzierung, die auf die unterschiedlichen kognitiven, motivationalen und sozialen Lernvoraussetzungen und Verhaltensstile der Schülerinnen und Schüler eine Antwort geben soll. Statt die Lern- und Leistungsunterschiede zu ignorieren, weist WEINERT auf das Muss einer „Anpassung des Unterrichts an die lernrelevanten Unterschiede zwischen den Schülern“ (WEINERT, 1997, S. 51) hin. Dieser Vielfalt ist also mit einer Differenzierung des Unterrichts zu entsprechen, so dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler, im idealen Fall alle, einer Klasse bei ihren Lernprozessen optimal unterstützt werden.
Außerdem soll innere Differenzierung „die Selbständigkeit jedes einzelnen Schülers fördern, ihn also 'das Lernen lehren' oder besser: 'das Lernen lernen lassen'“ (KLAFKI/STÖCKER, 1993, S. 181). Ziel einer jeden Lehrperson sollte es demnach sein, „die Eigenaktivität des Schülers herauszufordern und ihn zum selbständigen, selbstbestimmenden und verantwortlichen Denken und Handeln im personalen, interpersonalen und gesellschaftlichen Bereich zu befähigen.“ (GEPPERT/PREUSS, 1981, S. 18).
Als drittes Ziel innerer Differenzierung soll sie „die Kooperationsfähigkeit der Schüler, ihre Fähigkeit zu bewußtem sozialem Lernen und in diesem Rahmen ihre Kooperationsfähigkeit entwickeln (während der herkömmliche, undifferenzierte Klassenunterricht den einzelnen Schüler, ob gewollt oder ungewollt, weitgehend isoliert)“ (KLAFKI/STÖCKER, 1993, S. 181). Differenzierender Unterricht isoliert demnach die Schülerinnen und Schüler nicht, sondern eröffnet im Gegenteil, z.B. durch Partnerarbeit oder Arbeit in Kleingruppen, eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Kooperation, die erstens „die sozialen Bezüge auf der Basis gegenseitiger Wertschätzung erweitern helfen, d.h. die Schüler zu verstärkter Zusammenarbeit, wechselseitiger Hilfe und gegenseitigem Verständnis anregen“ (GEPPERT/PREUSS, 1981, S. 19) und zweitens „dem einzelnen Schüler innerhalb der Gruppen die Möglichkeit zur Selbsterfahrung und Selbstverwirklichung bietet.“ (GEPPERT/PREUSS, 1981, S. 19). Damit leistet differenzierender Unterricht einen enormen Beitrag zum sozialen Lernen, das im Grunde nur im dialogischen Miteinander möglich ist.
Als Viertes verweisen KLAFKI und STÖCKER darauf, dass innere Differenzierung „die Entwicklung verschiedener Persönlichkeitsdimensionen und ihre wechselseitige Beziehung anregen und unterstützen“ (KLAFKI/STÖCKER, 1993, S. 181) soll. Dies kann gelingen, da innere Differenzierung jeder Schülerin und jedem Schüler den nötigen Freiraum „zur Erprobung seiner individuellen Fähigkeiten und Interessen“ (GEPPERT/PREUSS, 1981, S. 18) gewährt.
Als Fünftes sei an dieser Stelle der für diese wissenschaftliche Hausarbeit besondere Differenzierungsanspruch erwähnt, bei individuellen Lernschwierigkeiten und Lernblockierungen helfend einzugreifen, so dass die immer mehr auftretenden Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten einzelner Schülerinnen und Schüler innerhalb des Unterrichts so weit wie möglich behoben oder gegebenenfalls akzeptiert werden können (vgl. GEPPERT/PREUSS, 1981, S. 18).
[...]
- Arbeit zitieren
- Nadine Zunker (Autor:in), 2006, Viele Wege führen nach Rom - Innere Differenzierung als Fördermöglichkeit im Deutschunterricht der Realschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126064
Kostenlos Autor werden







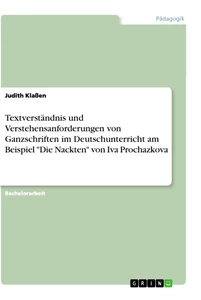




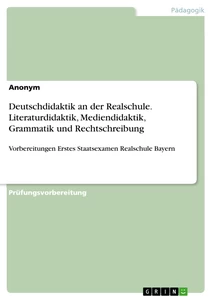




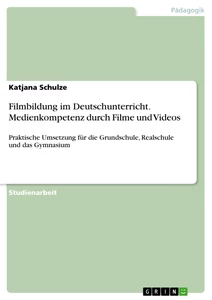




Kommentare