Leseprobe
Inhaltsangabe
1 Einleitung
2 Entwicklungspsychologische Relevanz der Eltern-Kind-Bindung
2.1 Bindungssystem
2.2 Bindungsmuster
2.3 Bindung und sozio-moralisches Verhalten
2.4 Zusammenfassung
3 Die Konsequenzen eines Elterverlustes
3.1 Irreversible Bindungstrennung
3.2 Trauerprozess
3.3 Charakteristik kindlichen Trauerns
3.3.1 Todesverständnis im Kindesalter
3.3.2 Reaktionen unter günstigen und ungünstigen Umständen
3.4 Zusammenfassung
4 Elterverlust durch Suizid
4.1 Begriffserläuterungen zum Suizid
4.2 Suizid im Familiensystem
4.2.1 Ursächliche Hintergründe
4.2.2 Die Situation der Hinterbliebenen
4.3 Auswirkungen auf die kindliche Trauer
4.4 Zusammenfassung
5 Psychische Traumatisierung des Kindes
5.1 Psychotraumata
5.1.1 Definitionen und Differenzierungen
5.1.2 Die neurobiologische Komponente des Traumaerlebens
5.1.3 Reaktionen und Prozesshafigkeit im Kindesalter
5.2 Psychotraumatologische Störungsbilder
5.2.1 Anerkannte Diagnosen
5.2.2 Kormorbiditäten
5.3 Psychotraumatologische Diagnostik des Kindesalters
5.3.1 Anamnestische Grundlagen
5.3.2 Anerkannte Erfassungsinstrumente
5.4 Zusammenfassung
6 Akute Interventionen bei traumatisierten Kindern nach Eltersuizid
6.1 Grundsätzliche Intension, Nützlichkeit und Ausführungsorgane
6.2 Übermittlung der Todesnachricht an ein Kind
6.2.1 Vorbereitungsphase
6.2.2 Mitteilungsphase
6.2.3 Begleitungsphase
6.2.4 Verabschiedungsphase
6.3 Problematische Situationen
6.3.1 Ungünstige Reaktionen naher Bezugspersonen
6.3.2 Inobhutnahme des Kindes
6.4 Zusammenfassung
7 Traumatherapeutische Elemente in der Akutphase – Der Ansatz des Eyes Movement Dezensitization and Resprocessing (EMDR)
7.1 Allgemeine traumatherapeutische Maximen der Akutphase
7.2 Die Methodik des EMDR
7.3 EMDR als Akutintervention bei Grundschulkindern nach Eltersuizid?
7.4 Zusammenfassung
8 Relevanz für die Handlungswissenschaft der Sozialen Arbeit
8.1 Soziale Dimensionen des psychischen Traumas
8.2 Der Auftrag Sozialer Arbeit in Abgrenzung zur Psychotherapie
8.3 Die Handlungsansätze der Sozialen Arbeit
8.4 Weiterbildungsbereitschaft und –möglichkeiten
8.5 Zusammenfassung
9 Resümee
Literatur
Anhang
1 Einleitung
Befasst man sich gegenwärtig mit dem Bereich der Suizidologie, trifft man hauptsächlich auf die Phänomenerörterungen der steigenden Suizidneigung von Jugendlichen und älteren Menschen. Dabei ist es nicht verwunderlich, dass bevorzugt Erwachsene in den Fokus der Hinterbliebenenarbeit rücken und das anhand dessen, eine Literatur über spezifische Trauerreaktionen, Risiken und Begleitungsangebote erarbeitet wird. So gibt es beispielsweise eine ersichtliche Zunahme von Publikationen, die sich an verwaiste Eltern richtet.
Demgegenüber gibt es jedoch eine recht spärliche Auseinandersetzung hinsichtlich der Begleitung von Kindern, welche einen Elternteil durch Suizid verloren haben. Besonders aber die Berücksichtigung des im Kindesalter vorliegenden Verluststatus der Eltern-Kind-Beziehung sowie der altersgerechten kognitiven und emotionalen Schemata, lassen andere Reaktionen und tiefgreifendere Risiken vermuten und bedürfen daher einer gesonderten Betrachtung. Die vorjährig veröffentlichten Daten des Bundesamtes für Statistik verdeutlichen zudem eine relativ hohe Suizidtendenz bei Menschen der Altersspanne zwischen 15 – 45 Jahren, in der die Betroffenen typischerweise einen Elternstatus erlangen.[1]
Aufgrund meiner Berufstätigkeit als Rettungsassistent in Dresden, trete ich unmittelbar am Ort des Geschehens mit dem Phänomen der Selbsttötung in Kontakt. Seit Jahren weist das Bundesland Sachsen durchschnittlich die höchsten Suizidzahlen der Bundesrepublik auf[2], eine Tatsache, die auch den Arbeitsbereich des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt zunehmend dazu auffordert, spezielle Weiterbildungsinhalte für eine psychosoziale Akutbetreuung für Hinterbliebene zu installieren. Hierbei liegt das Augenmerk ebenso primär auf der Erwachsenenarbeit. Die Praxis zeigt aus meiner Erfahrung jedoch, dass gerade der Umgang mit Kindern einen seltenen und somit ungeübten Einsatzgegenstand darstellt und das Mitarbeiter hinsichtlich einer dementsprechenden psychischen Notfallversorgung beunruhigt wirken.
Für mich persönlich ist die Beschäftigung mit einer kinder- und jugendzentrierten Betreuungsarbeit ins Zentrum des Interesses gerückt, da mir die Angebote für diese Altersgruppen als ungenügend erschienen. Im Zuge meines berufsbegleitenden Studiums habe ich mich dahingehend besonders um Einblicke in die Entwicklungspsychologie und die Psychotraumatologie bemüht, um meine eigenen Fähigkeiten zu verbessern und um eventuell eine neue berufliche Ausrichtung einzuleiten, die sich mit dem Gegenstand der psychosozialen Kinder- und Jugendbetreuung im Notfallsystem der Stadt Dresden beschäftigt. Zudem hat mich die geringe Anzahl von spezifischen Veröffentlichungen dazu angeregt, Überlegungen aus den oben genannten Disziplinen für einen thematischen Überblick zusammenzutragen, welchen ich anhand dieser Arbeit vorstellen möchte.
Dabei geht es mir im Nähren um die Darstellung dreier Sachverhalte. Zum einen soll das elternbezogenen Bindungsgefüge beleuchtet werden, welches konstitutiv einen Einfluss auf die gesunde biopsychosoziale Entwicklung eines Kindes nimmt. Die irreversible Auflösung dieser fundamentalen Beziehung beansprucht weiterhin die Erörterung des kindlichen Verlusterlebens und des daraus resultierenden physischen, psychischen und sozialen Gefährdungspotenzials. Dahingehend wird besonders eine Betrachtung hinsichtlich der emotionalen Schemata des Trauerns relevant sowie gegenüber den damit korrespondierenten Phänomen der psychischen Traumatisierung. Letztlich wird es von Bedeutung sein, Hilfeinterventionen zu beleuchten, die einer Gefährdung des Kindes entgegenwirken. Da meine berufliche Handlungsfähigkeit im Arbeitsfeld der Notfallversorgung verankert ist, möchte ich diesbezüglich nach der Möglichkeit von Sofortmassnahmen suchen, die unmittelbar nach dem Verlusterlebnis eingeleitet werden können. Hinsichtlich dieser Betrachtungsweise lassen sich zwei thematische Fragestellungen formulieren.
(1) Welche Relevanz übt eine Eltern-Kind-Beziehung auf die kindliche Entwicklung aus und inwieweit leitet ihre Auflösung, im Kontext eines Eltersuizides, eine mögliche trauma-basierende, psychopathologische Störung des Kindes ein?
(2) Welche Massnahmen der kindlichen Akutbetreuung lassen einen adäquaten Beitrag zur kognitiven und emotionalen Rehabilitierung des Kindes versprechen?
Um dem gegenüber Antworten offen legen zu können, habe ich mich für die folgende inhaltliche Herangehensweise entschieden:
Eingangs beschäftigt sich das Kapitel 2 mit entwicklungspsychologischen Aspekten der Eltern-Kind-Beziehung. Hierbei soll grundlegend die Korrespondenz zwischen dem Geborgenheitsgefühl und der Gesundheit des Kindes hervorgehoben und mit bestimmten Beziehungsdynamiken aus der Bindungstheorie nach John Bowlby erklärt werden. Die Konsequenzen eines Elterverlustes werden im Kapitel 3 vorgestellt und umfassen die Beleuchtungen des Trauerbegriffes und der kindlichen Trauerreaktionen unter günstigen und ungünstigen Umständen, wobei es weitergehend von Nöten sein wird, dass kindliche Todesverständnis zu erörtern. Da dieses abhängig von der kognitiven Auffassungsgabe des Kindes ist, habe ich mich im Hinblick auf eine inhaltliche Reduzierung dafür entschieden, eine spezielle Altersgruppe in den Fokus zu nehmen. Es wird fortfolgend die Entwicklungsstufe des Grundschulalters (6 – 12 Jahre) betrachtet, da während dieser die kognitiv bedeutsamen Todeskomponenten überwiegend internalisiert sind. Das Kind versteht in diesem Kontext die Unterscheidung zwischen Sterben und Getötet-werden und lässt dahergehend im Hinblick auf eine Suizidhandlung eine andere emotionale und kognitive Reaktion als ein Kleinkind erwarten (vgl. hierzu Kapitel 3.3.1). Systemisch-mehrgenerationale Überlegungen sowie Beobachtungen aus der Hinterbliebenenarbeit verweisen im Kapitel 4 auf die Ursächlichkeit und Auswirkung der Suizidalität in Familien und heben dabei einen Zusammenhang gegenüber Bindungsdynamiken aus dem zweiten Kapitel hervor. Daraus ableitend sollen dysfunktionale Traueremotionen und Verhaltensweisen des Kindes erklärbar werden. Fortfolgend (Kapitel 5) wird das suizidbedingte Verlusterleben im Kontext der Psychotraumatologie des Kindes vorgestellt. Neben Definitionen, Differenzierungen und Erläuterungen von traumatischen Reaktionen, bzw. deren kindlichen Ausdrucksweisen, kommen zudem für das Kindesalter anerkannte traumabasierende Diagnosen, Kormorbiditäten und Diagnostiken zur Sprache. Darauf aufbauend werden im Umgang mit einem Kind nach Eltersuizid die Arbeitsinhalte von psychischen Akutinterventionen dargestellt. Dabei nimmt sich einerseits Kapitel 6 den Aufgabengebiet der Krisenintervention an, wobei die Darlegungen von Definitionen und organisatorischen Strukturen der psychosozialen Notfallbetreuung, ebenso wie deren Intension, bzw. Nützlichkeit eine Erwähnung finden müssen. Außerdem sollen wichtige Aspekte der Übermittlung einer Todesnachricht an ein Kind in Zusammenhang mit integrierten Betreuungselementen beschrieben sowie mögliche erschwerte Situationen, die nötigenfalls eine Inobhutnahme des Kindes veranlassen müssen, angemerkt werden. Folglich beinhaltet das Kapitel 7 andererseits die spezifische Einsatzmöglichkeit von psychotraumatherapeutischen Maßnahmen in der Akutphase. Die in jüngster Zeit erfolgreich angewandte und wissenschaftlich geschätzte therapeutische Methodik des EMDR (Eyes Movement Desensitization and Reprocessing) nach Shaipiro, wird diesbezüglich aus einer Fachdebatte heraus, häufig in Erwägung gezogen. Ein entsprechender Einblick auf therapeutische Grundsätze und die EMDR-verfahrensweise und -empirie soll kritisch betrachtet werden, um eine Anwendungsabwägung für den Gegenstand des Eltersuizides ersichtlich zu machen. Erscheinen die Maßnahmen der psychosozialen Versorgung überwiegend im Aufgabenfeld der Notfallpsychologie und -psychotherapie zu liegen, dürfen dennoch sozialarbeitswissenschaftliche Handlungsansätze nicht untergraben werden. Dahergehend soll in einem gesonderten Abschnitt (Kapitel 8), unter Berücksichtigung einer gesetzlich geregelten Unterscheidung zur Psychotherapie, die Bedeutsamkeit des Arbeitsfeldes der Sozialen Arbeit hinsichtlich des Gegenstandes der Krisenintervention sowie der weiterführenden Begleitung traumatisierter Kinder benannt werden. Hierbei sollen insbesondere die Inhalte des Überlegungsansatzes der Traumapädagogik in den Vordergrund gestellt und in Verbindung zur Konzeption der Lebensbewältigung nach Lothar Böhnisch dargelegt werden.
Die Textabschnitte zwei bis acht erhalten jeweils eine separate Zusammenfassung der skizzierten Inhalte. Somit sollen wichtige Hypothesen im Hinblick auf die Fragestellungen hervorgehoben und relevante Bezugspunkte zwischen den Kapiteln offen gelegt werden. Ein Resümee (Kapitel 9) wird auf diese Überblicke zurückgreifen, um sie in ihrer Ganzheitlichkeit zu erfassen. Zudem soll ein Ausblick auf die sozialarbeiterische Praxisorientierung und Berufshaltung zu einer kritischen Auseinandersetzung hinsichtlich der Thematik einladen.
2 Entwicklungspsychologische Relevanz der Eltern-Kind-Bindung
2.1 Bindungssystem
Erstmalig postulierte der Kinderpsychiater John Bowlby Überlegungen hinsichtlich einer biologisch determinierten Interaktion zwischen dem Säugling und einer primären Fürsorgeperson (die Eltern, insbesondere die Mutter), welche das Überleben des noch unreifen und hilflosen Neugeborenen gewährleistet. Dabei wird zugleich die Reproduktion der menschlichen Spezies anhaltend gesichert.[3] Mittels genuinem Bindungsverhaltensweisen (Lächeln, Anschmiegen, Schreien, Festklammern, Aufsuchen der Mutter) signalisiert das Kind Bedürfnisse nach Schutz und Geborgenheit in Belastungs- und Gefahrensituationen und fordert dabei die komplementären Reaktionen eines prompt einsetzenden und rücksichtsvollen Fürsorgeverhaltens (Zärtlichkeit, Trost).[4] Wird dieses durch die emotionale Präsenz der Eltern kontinuierlich gewährleistet, können dem Nachwuchs bedrohliche Eindrücke rasch unterbunden werden. Das Kind deaktiviert daraufhin sein Bindungsverhaltenssystem und fühlt sich im Beisein der Mutter und des Vaters sicher. Hierbei kann von einem feinfühligen Fürsorgeverhalten gesprochen werden, wobei man nach Bowlby von einer „sicheren Basis“ spricht.[5] Die Zielgerichtetheit nach Zuneigung wird als eigenständiges Motivationssystem betrachtet und dahergehend nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den Trieben nach Nahrung, Aggression und Sexualität beschrieben.
„Obwohl Nahrung und Sexualität manchmal eine wichtige Rolle in solchen Beziehungen spielen, bestehen die Beziehungen doch aus sich heraus und haben eine eigene Überlebensfunktion, nämlich die Schutzfunktion.“ (Bowlby, John 1997 : 21)
Eine weiteres Bestreben des Menschen liegt im Erkunden (Explorieren) seiner Umwelt, sodass das Kind beginnt weitere Objekte und Personen in seiner Nähe spielerisch zu deuten. Auch hierbei muss die Fürsorgeperson ein feinfühliges Gespür für die Intension des Kindes erzeugen, um ihm einen adäquaten Raum für Eigenständigkeit zu bieten. Ist das Kind jedoch verunsichert und fühlt sich geängstigt, aktiviert es seine Bindungsverhaltensweisen, um sich mit dem Verlangen nach Schutz ganz seiner Bindungsperson zuzuwenden. Daraus resultiert, dass ein aktives Bindungssystem mit der Deaktivierung des Explorationssystems korrespondiert. Erst wenn sich für das Kind ein schützender, geborgener Kontakt hergestellt hat, kann es die Umwelt unter Ausschluss von bedrohlichen Motiven wahrnehmen. Das deaktivierte Explorationssystem wird allmählich wieder aktiviert und das Kind verliert seine spannungsvolle Mimik und Körperhaltung.[6] Daraus lässt sich ableiten, dass feinfühlig reagierende Eltern im Umgang mit ihrem Kind die Bewerkstelligung der beiden Bedürfnisse nach Bindung und Exploration in einem harmonischen Zusammenspiel gestalten können.
Ist die elterliche Fürsorge dagegen von inadäquaten Verhaltensweisen (Vernachlässigung, übertriebene Strenge oder Behutsamkeit) geprägt, wird das Kind sich hilflos fühlen, indem ihm eine innere Unschlüssigkeit hinsichtlich der Bedürfnisentscheidung nach Autonomie oder Interdependenz bleibt.
„ Es ist deshalb keineswegs überraschend, dass das Fehlen oder Misslingen einer Reaktion der Bezugsperson (ob nun aufgrund physischer Abwesenheit oder aufgrund des Unvermögens, angemessen zu reagieren) immer Stress bedingt und daß es dadurch manchmal auch zu traumatischen Erfahrungen kommt.“ (Bowlby, John 1997 : 23)
Wie lernt das Kind jedoch die emotionale Qualität der Beziehungsebene zu seinen Fürsorgepersonen einzuschätzen? Die Bindungsforschung nimmt an, dass ein Kind bis Ende seines ersten Lebensjahres ein beachtliches Wissen über sich selbst und seine Bindungsperson hat und dieses im sogenannten inneren Arbeitsmodell organisiert. Dieses spiegelt Repräsentanzen der Umwelt und des Selbst anhand von prozedualen Gedächtnisspuren generalisierter Bindungserfahrungen wider und hat die Funktion, Ereignisse in der Realität zu simulieren, sodass das Individuum in die Lage versetzt wird, sein Verhalten einsichtig und vorausschauend zu planen. Somit erkennt das Kind bestimmte Einflüsse unter denen es sich schutzbedürftig oder erkundungsfreudig fühlt und kennt zudem die Stimmungen, Interessen und Absichten der Bindungsperson, welche die Feinfühligkeitscharakteristika typisieren. Damit hat das Kind eine bestimmte Vorstellung von den Reaktion der Bindungsperson beim Einsetzen seiner Bedürftigkeit nach Bindung, bzw. Exploration. Es entsteht eine komplex wechselseitige Beziehung mit der Bindungsperson, die ebenfalls ihr eigenes inneres Arbeitsmodell von sich und dem Kind hat. Diese Modelle werden täglich unbewusst angewandt und steuern Denk – und Handelsvorgänge.[7] Zudem werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit von der primären Bindungsperson auf weitere Beziehungsrepräsentanzen in der Ontogenese des Kindes (z.B. Peers, Partnerschaften, eigene Kinder) übertragen und wirken sich somit konstitutiv auf die sozialen Realitätsdeutungen des Einzelnen aus.[8]
„Sie bilden den unbewussten Interpretationsrahmen für alle späteren situativen Erfahrungen. Vor diesem Hintergrund entwickeln sich zentrale Verhaltensmuster (Coping-Stile), die das unverwechselbare „Naturell“ eines Individuums ausmachen.“ (Christ, Hans 2001 : 4)
2.2 Bindungsmuster
Die Bindungsforschung geht davon aus, dass ein adäquates und kontinuierlich erfahrenes Fürsorgeverhalten die Realitätsinterpretationen des Kindes erleichtert und ihm die Möglichkeit verleiht, eine Bindung auch bei räumlicher Distanz gedanklich aufrecht zu erhalten. Seine sozialen Erfahrungen repräsentieren sich in einem inneren Arbeitsmodell, welches ein Vertrauen in weitere Beziehungen bereitstellt und ein gesundes Selbstwertgefühl gewährleistet. Reagiert die Bindungsperson jedoch inadäquat und/oder ambivalent auf die kindlichen Bedürfnisse, wird es dem Kind erschwert die Zusammenhänge zwischen seinen Handlungenabläufen und Handlungsergebnissen abzuwägen. Ein ausgeglichenes Vertrauen, bzw. Identitätsempfinden kann dem Kind im weiteren sozialen Umgang somit vorbehalten werden.[9] Das jeweilige Modell übt somit auch ein potentielles Risiko für das spätere mangelnde Pflegeverhalten gegenüber den eigenen Kindern aus.[10]
Bezüglich dieser Annahmen hat die Bindungsforschung empirische Studien vorgenommen, um eine Differenzierung von möglichen Arbeitsmodellgenerierungen benennen und beschreiben zu können. Dabei spricht man von Bindungsmustern.
„Die Messinstrumente zur Erfassung der Bindungsmuster sind das Adult Attachment Interview (AAI), welches das Sprachverhalten Erwachsener nach formalen Kriterien der Kohärenz untersucht, und der Fremde-Situationstest (FS), indem Kinder einem festgelegten Trennungsstress von der Mutter und dem Umgangsstress mit einer fremden Person ausgesetzt wird. Untersucht wird das Trennungs- und Wiederannäherungsverhalten von Mutter und Kind.“ (Christ, Hans 2001 : 5)
Es wurde mit Hilfe dieses experimentellen Rahmens eine erstaunliche Wiederholbarkeit von folgenden vier Hauptbindungsmuster ersichtlich[11], wobei die Ergebnisse der „Fremden Situation“ überwiegend aufgrund der Resultate der Elterninterviews vorhersagbar waren.[12]
Unsicher-vermeidendes Bindungsmuster (A-Typ)
Die Bindungsperson lehnt die Bedürfnisse ihres Kinder nach Geborgenheit auf vorhersagbare Weise ab. Dieses lernt daher seine Affekte zurückzuhalten und ablehnende Reaktionen zu vermeiden, indem es sich überwiegend der Sachumwelt zurichtet. A-Typus-Kinder verinnerlichen kohärente Repräsentanzen, in denen das Selbst als wenig liebenswert und die Objekte als ablehnend generalisiert werden. Dahergehend vermeiden die Kinder die Nähe zur Bindungsperson und bevorzugen diese nicht gegenüber fremden Personen. Sie zeigen nach Außen wenig Belastungsreaktionen, wobei ihre physiologischen Stressparameter stark erhöht sind.[13]
Sicheres Bindungsmuster (B-Typ)
Die Bedürfnisse des Kindes werden durch die Bindungsperson feinfühlig und angemessen wahrgenommen. Beide Partner können sich vorhersagbar dialogisch erreichen, was dazu führt, dass das Kind eine kohärente Repräsentanz internalisiert, in der das Selbst und die Objekte liebenswert und wirkungsvoll aufeinander bezogen empfunden werden. In Stress-Situationen sucht das Kind den Kontakt bevorzugt bei der Bindungsperson und lässt sich durch sie schnell beruhigen. B-Typus-Kinder haben die günstigsten Entwicklungsverläufe.[14]
Unsicher-ambivalentes Bindungsmuster (C-Typ)
Den Bedürfnissen des Kindes wird ein inkonsistentes Verhalten entgegnet, welches zwischen einem intensiv anklammernden und aggressiv ablehnenden Charakteristik oszilliert. Dies ist besonders dann der Fall, wenn das Kind explorieren möchte. Die Unvorhersehbarkeit der bindungspersonellen Zuneigung entwickelt eine grenzwertige kohärente Repräsentanz, die das Selbst und die Objekte einerseits liebenswert und erreichbar erfahren lassen (positive Interaktionen) und andererseits dem Kind verinnerlichen, dass es störend ist und somit alleingelassen werden muss (negativ verstrickte Interaktionen). Diese Unsicherheit erklärt eine enorm hohe Angstspannung der C-Typus-Kinder. In Stress-Situationen reagieren sie affektiv heftig und wenden sich abwechselnd ihren Bindungspersonen zu, bzw. passiv oder aktiv ab. Dahergehend wird ihr Bindungssystem nur sehr schwer deaktiviert.[15]
Desorganisiertes Bindungsmuster (D-Typ)
Charakteristisch für den D-Typus ist das Verhalten eines Kindes, dessen Bindungssystem aktiviert ist und sich der Zuhilfenahme der sicheren Basis seiner Bindungsperson nicht gewahr wird. Das Pflegeverhalten der Eltern scheint dem Kind ebenfalls eine Quelle von Angst und Stress zu sein, sodass das Kind auf sich allein gestellt wirkt („the look of fear with no-where to go“).[16] Die D-Bindung wurde dahergehend als Folgeentwicklung unverarbeiteter elterlicher Traumatisierung konzeptualisiert, welche sich über eine transgenerationale Vermittlung auf die Kinder überträgt. So ist sie vor allem in „Hochrisikofamilien“ zu erwarten, welche die Gefährdungsfaktoren von Vernachlässigung, körperlicher Misshandlung, sexuellen Missbrauchs, sowie unverarbeiteten Verlusten oder Depressionen der Eltern aufweisen.[17] Wenn die Bedrohung nicht nur von üblichen Stressoren, sondern zudem von der Bindungsperson selbst ausgeht, kommt es zu einer fatalen Konstellation. Die Deaktivierung des Bindungssystems sowie der Drang nach Exploration wird unterbunden. Dem Bedürfnis nach Bindung unterlegen, verfällt das Kind in ein „paradoxes Bindungsverhalten“, indem es bei seiner Bindungsperson Schutz sucht, trotz aller Bedrohungen, die von ihr ausgehen. Dem geht eine „traumatische Spirale“ voraus, eine Art der kindlichen Unschlüssigkeit, sich an die Bindungsperson anzunähern oder vor ihr zu fliehen.[18] Desorganisierte Kinder wirken dahergehend impulsiv und zeigen bezüglich der sicheren Basis konfuse Bewegungen und Affekte.[19] Durch die gleichzeitige Aktivierung dieses Annäherungs- und Fluchtbedürfnisses kommt es folglich zu einem kurzfristigen Kollaps der Verhaltens- und Aufmerksamkeitsstrategien des Kindes, der einer dissoziativen Abwehr zugesprochen werden kann.[20] Es kommt dabei im Allgemeinem zu einem psychophysiologischen Prozess, bei dem Informationen in ihrer Wahrnehmung, Speicherung und Reaktion aktiv daran gehindert werden, sich mit ihren gewöhnlichen oder erwartenden Assoziationen zu verbinden. Dahergehend kommt es zu einer Abspaltung von Erinnerungen oder eigenen Gefühle, wie etwa Angst, Schmerz, Hunger oder Durst.[21] Dies kann hauptsächlich an einer plötzlich eintretenden trance-ähnlichen Bewegungslosigkeit und an mimisch abwesend wirkenden Ausdrucksweisen des Kindes beobachtet werden. Das paradoxe Bindungsverhalten verursacht einen gravierend destruktiven Internalisierungsprozess des kindlichen Arbeitsmodells. Karl Heinz Brisch spricht hierbei im allgemeinen von einer Bindungsstörung.
„Den unterschiedlichen Mustern der Bindungsstörung liegt eine schwerwiegende Fragmentierung bis Zerstörung des inneren Arbeistmodells von Bindung zugrunde. Das Kind entwickelt daraufhin andere Verhaltens- und Überlebensstrategien, die oft den Bindungskontext nicht mehr erkennen lassen.“ (Brisch, Karl Heinz 2003 : 108)
Die Zerstörung des Arbeitsmodells von D-Typus-Kindern meint im engeren Sinne eine Generierung von inkohärenten und multiplen Repräsentanzen, die nebeneinander existieren. Die inkompatiblen Bilder der schützenden, wie auch bedrohenden Bindungsperson werden getrennt und unbezogen zueinander ins kindliche Gedächtnis gespeichert. Eine Möglichkeit der Auflösung dieses Konfliktes bildet konstitutiv die Dissoziation. Dahergehend spricht man auch von dissoziativ-geteilten Repräsentanzen. Mit ihnen verinnerlicht das Kind ein Schema, bei dem das Selbst hilflos und ohnmächtig ist und die Objekte eine unberechenbare, ängstigende Qualität besitzen.[22]
2.3 Bindung und sozio-moralisches Verhalten
Die Ausbildung eines inneren Arbeitsmodells wird als sozial-kognitive Leistung des Kindes anerkannt.[23] Der Begriff der „sozialen Kognition“ umfasst die Kenntnisnahme über soziale Ereignisse, ebenso wie über den Prozess des Verstehens von Menschen, ihrer Beziehungen sowie der sozialen Gruppen und Institutionen, an denen sie teilnehmen.[24] Die symbolischen Repräsentanzen von Bindung verdeutlichen dabei ein fundamental emotionales Teilwissen, welches ausschlaggebend für die adäquate Bewältigung von weiteren sozial-kognitiven Entwicklungsstadien des Kindes wird.[25] Dahergehend dient die Klassifikation der vier skizzierten Bindungsqualitäten als Ausgangspunkt verschiedener Studien, welche einen Zusammenhang zwischen einer angemessenen Eltern-Kind-Beziehung und einem späteren sozio-moralisch geeigneten Verhalten des Kindes untersuchen (Edelstein, Keller; Schröder 1990; Tavecchio et al. 1999; Gloger-Tippelt et al. 2003; Kochanska et al. 2005). Die frühen Bindungserfahrungen werden als Interpretationsrahmen gegenüber sozialen Systemen betrachtet und sind dahergehend vorbestimmend, hinsichtlich der sozialen Kompetenz Emotionen zu regulieren, Konflikte zu lösen und Gefühle teilen zu können.[26] Daraus erschließt sich für das Kind zudem eine moralische Vorstellung. Im Zusammenhang zur moralischen Entwicklung wird grundlegend auf die zwei Überlegungen des kategorischen Imperativs nach Immanuel Kant verwiesen.[27]
„Handle so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.“
„Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“
(Kunzmann, Peter; Burkard, Franz-Peter; Wiedmann, Franz 2005 : 143)
Kant schreibt dabei nur dem menschlichen Handeln eine moralische Intension zu, welches sich nicht um seines eigenen Erfolges heraus äußert, sondern aufgrund des alleinigen Gefühles der Vernünftigkeit dieser Maximen evoziert wird.[28] Dies deutet darauf hin, dass beide Zitate auch lediglich intellektuell verständlich und pädagogisch vermittelbar werden könnten, ohne dabei ein individuelles Gefühl für das Grundbedürfnis nach Wertschätzung und Gerechtigkeit des Menschseins zu sensibilisieren. Die Bindungsforschung geht ebenso davon aus, dass der in der Beziehungsqualität verankerte Grad einer Berücksichtigung der Bedürfnisse von Schutz, Geborgenheit, Vertrauen und Freiheit zum konstitutiven Faktor dafür wird, ob soziale Normen vom Kind verstanden und berücksichtigt werden und ob ihre Einhaltungsintentionen verstärkt aus der gefühlten Moralität heraus oder im Bezug auf rationelle Überlegungen, gegenüber einer eigennützigen Gesetzeseinhaltung geschehen.[29]
Grundlegend konnte bestätigt werden, dass die konsistent sicheren Repräsentanzen die besten Voraussetzungen für das kindliche Erlernen eines sozialen Verständnisses bewerkstelligen.[30] Die B-Typus-Kinder bewältigen überwiegend eine entwicklungsentsprechende, emotionale und kognitive Perspektivübernahme ab dem Grundschulalter und sind daher in der Lage Empathievorstellungen und Eigenverantwortung zu erzeugen. Das Einfühlen hinsichtlich der Emotionen anderer Personen sensibilisiert das Kind für eine Befähigung von Sympathie und Betroffenheitsgefühl und trägt somit sein affektives Verständnis von vernünftigen und verlässlichen Normen.[31] Die Kinder treten in einen ausgeglichenen Kontakt mit den Anforderungen der Familie, der institutionellen Gefüge (z.B. der Schule) und der Peergroups, da sie gelernt haben sich in einer sicheren Umwelt zu befinden und bei möglichen Konflikten Trost für Anstrengungen und Anerkennung für Lösungen zu erhalten.[32] Dahergehend folgen sie Geboten und Verboten anhand der moralischen Absicht, einen Ausgleich zwischen Eigeninteresse und Normen der Familie, der Gemeinschaft, der Kultur und Menschheit zu bewerkstelligen.[33] Ihre Erfahrungen erzeugen vermehrt ein Interesse an prosozialen Verhaltensweisen, welche intendiert sind, einem anderen etwas Gutes zu tun und gesellschaftliche Regeln zu respektieren.[34]
Im Gegensatz zur sicheren Bindung weisen unsicher klassifizierte Kinder eine Emotionsregulationsstörung auf. Je nach Bindungsmuster bedingen unterschiedliche affektive Unstimmigkeiten ein erhöhtes Stressarousal des Kindes und beeinträchtigen dabei seinen dialogischen Austausch in weiteren Beziehungsanforderungen. Dies hemmt einerseits ein Verständnis gegenüber normativen Grenzen und beansprucht andererseits kompensatorische Maskierungsstrategien, welche sich in einem antisozialen Verhalten äußern. Aus klinisch-psychologischer Sicht versteht man darunter verschiedene sozial unerwünschte Problemverhaltensweisen, die nach Intensität und Stabilität als externalisierende oder internalisierende Verhaltensauffälligkeiten bezeichnet werden. Erstere sind von aggressiven und dissozial regelverletzenden Verhaltensweisen nach außen hin gekennzeichnet, wohingegen die nach innen gerichteten Muster von sozialer Rückzugshaltung, von ängstlich-depressiven Verhalten oder von psychosomatischen Beschwerden, Letztere charakterisieren.[35]
Beide Formen wären etwa bei einer unsicher-vermeidenden Bindungsqualität denkbar, bei der das Kind aufgrund der situationsunangepassten Unterdrückung von Affekten verängstigt und gekränkt wird. Eine Deaktivierung seiner Bindungsbedürfnisse und eine dementsprechend erhöhte Ausrichtung auf die Sachumwelt führt zu aggressiven Reaktionen oder depressiven Verstimmungen. Gegenüber dem A-Typus wird das psychische Ungleichgewicht eines unsicher-ambivalent gebundenen Kindes durch seine Hyperaktivierung des Bindungssystems hervorgerufen. Die Gleichzeitigkeit eines doppelwertigen Fürsorgeverhaltens hinterlässt eine ärgerliche Ungewissheit und übertriebene affektive Reaktionen, welche besonders auf der Verhaltensebene durch externalisierende Auffälligkeiten deutlich werden. Eine desorganisierte Bindungsdynamik wies in empirischen Beobachtungen das höchste Risiko von beiden Verhaltensauffälligkeiten auf. Dissoziative Muster führen zum völligen Handlungsversagen und Rückzug oder werden anhand destruktiv aggressiver Handhabungen maskiert. Grundlegend bedingt die Störung der elterlichen Aufmerksamkeit des D-Typus eine Rollenumkehr in der Eltern-Kind-Beziehung, die sich unterschiedlich ausdrücken kann. So werden in Fallstudien kontrollierend-fürsorgliche oder kontrollierend-punitive Strategien als Orientierungsversuche des Kindes beschrieben. Die einen dienen dem Kind zur Beschwichtigung der dominant und feindselig auftretenden Eltern, die anderen der Bestrafung eines hilflos und inkompetenten wirkenden elterlichen Verhaltens.[36]
2.4 Zusammenfassung
Die bindungstheoretischen Überlegungen gehen davon aus, dass ein Kind im Rahmen der elterlichen Fürsorge affektive und kognitive Schemata erkennt und diese interpretativ in seine individuelle Wirklichkeitskonstruktion integriert. Dahergehend spricht die moderne Entwicklungspsychologie von einem „kompetenten Säugling“, da er mit seinen Vorstellungen und Ausführungen wesentlich zur Gestaltung der bindungsrelevanten Beziehungsebene beiträgt und sie in einem rekursiven Lernprozess individuell auf sich und seine Umwelt beziehen kann.[37] Ein dialogischer Austausch, in dem die anthropologischen Bestrebungen nach Selbstverwirklichung und sozialer Gebundenheit konsistent berücksichtigt werden, fördert dabei ein Verständnis, welches das eigene Selbst und seine im Bezug stehende Umwelt als sinnvoll erachtet. Das Individuum kann mit diesem Urvertrauen im weiteren Verlauf seines Lebens einen Platz im Spannungsfeld der Autonomie und Interdependenz finden, der ihm eine emotionale Ausgewogenheit gewährleisten lässt und zu seinem Wohlbefinden beiträgt. Dahingegen bedingen unangemessene frühe Bindungserfahrungen ein feindseliges Wirklichkeitsempfinden. Die Bedürfnisse werden anhand dessen auf unterschiedliche Art und Weise verletzt und müssen dahingehend unterdrückt werden. Ein daraus resultierendes erhöhtes Stressarousal geht mit einer intrapsychischen Inbalance einher, welche entwicklungshemmende Folgeerscheinungen hervorrufen lässt. Diese sind etwa durch antisoziale Maskierungsstrategien, Lern- und Konzentrationsschwächen, neurologische Veränderungen und verstärkte psychodynamische Abwehrmechanismen gekennzeichnet. Neben einer Reihe von psychopathologischen Bildern (Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, endogene Psychosen, Neurosen) können dabei ebenso körperliche Beschwerden ausgelöst werden, wie etwa bei Somatisierungsprozessen, Suchtneigungen oder Teilleistungsstörungen der Betroffenen. In Anbetracht solcher weitreichend empirisch gesicherten Erkenntnisse muss der emotionalen Qualität der frühen Eltern-Kind-Beziehung ein prägender Gehalt für die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen zugesprochen werden. Bezüglich der Entwicklungsstufe des Grundschulalters steht besonders die Bewältigungsfähigkeit neuer institutioneller Aufgaben, in Abhängigkeit zur Verlässlichkeit einer feinfühligen familiären Beziehungsebene, im Vordergrund. Sicher gebundene Kinder zeigen dabei das beachtlichste Maß an sozialer Kompetenz gegenüber Gleichaltrigen und Lehrern sowie an kognitiver Reife und psychischer Belastbarkeit.
3 Die Konsequenzen eines Elterverlustes
3.1 Irreversible Bindungstrennung
Der kurzzeitige Verlust eines Elternteiles verdeutlicht in der Fremden Situation nach Mary Ainstworth die Notwendigkeit einer wiederherzustellenden elterlichen Präsenz zur Reduzierung von reaktiven Bindungsverhaltensweisen (z.B. Weinen, Schreien und Aufsuchen der Mutter oder des Vaters), welche mit einem Gefährdungs- und Angstgefühl des Kindes korrelieren.[38] Selbst unsicher gebundene Kinder, die entweder unbeteiligt (A-Typus) oder verängstigt (D-Typus) gegenüber der eigenen Fürsorgeperson wirken, weisen erhöhte Stressparameter auf und bestätigen damit die Überlegung, dass trotz eines vermeidenden oder bestrafenden Pflegeverhaltens, eine elternbezogene Bindungsausrichtung vom Kind internalisiert wird.[39] Die von der Bindungsqualität geprägten Repräsentanzen sind bei der örtlichen Trennung entscheidend hinsichtlich der kindlichen Fähigkeit, eine schutzerzeugende Bindung gedanklich aufrecht zu erhalten. Sicher gebundene Kinder bewältigen diese Aufgabe am angemessensten.[40]
Der Tod eines Elternteiles stellt jedoch die irreversible Trennung einer primären Bindungsbeziehung dar, welche aufgrund ihrer zeitlichen Unbegrenztheit eine kurzzeitige Deaktivierung des Bindungssystems überdauert. Das Kind wird sich emotional und kognitiv zunehmend bewusst, dass seine Fürsorgeperson durch keine Bindungsstrategie auffindbar wird. Dies bedingt ein Aufbrechen orientierungsbezogener Handlungs- und Denkprozesse seines inneren Arbeitsmodells. Die Wirklichkeitszusammenhänge, welche konstitutiv über die Gebundenheit zur nun unerreichbaren Bezugsperson geordnet wurden, müssen vom Kind auf andere Beziehungen übertragen werden. Die dabei heraustretenden Unterschiedlichkeiten bedürfen einer Neustrukturierung und erfordern dabei das höchste Maß kindlicher Anpassungsleistung.
„Sowohl Fachleute als auch Kinder und Jugendliche stimmen darin überein, dass die Erfahrung eines Elternverlusts bei einem Vergleich aller möglichen Lebensereignisse die größte Anpassungsleistung für ein Kind erfordert.“ (Schneekind, Klaus A.; Weiß, Joachim 1998 : 1037)
Dieser adaptive Prozess korrespondiert mit einem hohen Angst- und Gefährdungsgefühl für jedes betroffene Individuum und verdeutlicht das biologisch determinierte, menschliche Phänomen des Trauerns.[41]
Im folgenden soll auf diese Erscheinung näher eingegangen werden. Um im Rahmen des bindungstheoretischen Modells plausibel weiter zu argumentieren und im Blickfeld des Kindesalters zu bleiben, bietet sich diesbezüglich eine Vorstellung der Arbeiten von John Bowlby an. Diese integrieren psychoanalytische Überlegungen ebenso wie Konzeptanteile der Neurophysiologie und der Copingtheorien. Sie haben dahergehend einen Einfluss auf anerkannten Darstellungen des Trauerbegriffes genommen, wie etwa die der Standardwerke von Verena Kast (1982) und Yorick Spiegel (1973) sowie eines jüngeren Stressbewältigungsmodells nach Stroebe und Shut (2001). Weiterführend wird die Kontroverse über kognitive Voraussetzungen zum Todesverständnis des Kindes vorgestellt, um von ihr aus Rückschlüsse auf ein spezifisches Trauern des Grundschulkindes zu erhalten.
3.2 Trauerprozess
Im allgemeinen wird unter dem Begriff der Trauer das schmerzliche Wahrnehmen eines Verlustes von Dingen, Lebensumständen und vor allem von geliebten Personen sowie die damit zusammenhängenden Ausdrucksphänomene, wie beispielsweise Zurückgezogenheit, Weinen oder aggressives Verhalten, verstanden.[42] Dieses Erleben unterliegt einem Prozess der Zeit benötigt und der nach der Konfrontation mit einem Objektverlust darauf hinausläuft, dessen Abschied zu akzeptieren und ihn in die Struktur der eigenen Daseinsweise zu integrieren.[43] In seinem zeitlichen Verlauf treten typische Muster auf, welche häufig in Phasen beschrieben werden. Hierbei muss festgehalten werden, dass es keine empirischen Belege für einen in Phasen verlaufenden Trauerprozess gibt, da dieser individuell zu stark variiert. Eine ausschlaggebende Ursache dafür ist etwa der unterschiedlich kulturelle Umgang mit dem Ereignis des Todes. So können bestimmte Verhaltensmuster während der Trauer ausbleiben oder bestimmte Phasen zeitlich höchst unterschiedlich andauern. Jedoch dient eine Aufgliederung der Heuristik zur Thematik Trauer und verleiht Betroffenen eine Orientierung.[44]
Die Hinweise zur Ursache und Ausdrucksform von Trauer lassen eine deutliche Analogie gegenüber dem Bindungssystem eines Menschen erkennen. Dieser Bezug verdeutlicht einen evolutionstheoretischen Hintergrund, indem der Trauerprozess als Adaption für das langfristige Überleben einer Spezies verantwortlich wird. Hierfür wird die Argumentation verwendet, dass diese Reaktionen die Kosten für soziale Tiere und Menschen sind, enge Beziehungen einzugehen und es die Funktion der Trauer ist, soziale Bindungen auch dann aufrecht zu erhalten, wenn die BindungspartnerIn über längere Zeit abwesend ist. Trauer wird dahergehend unter der biologischen Perspektive als Nebenwirkung einer höchst adaptiven Eigenschaft betrachtet. Sie gewährleistet es, soziale Verbände aufrechtzuerhalten, selbst wenn diese räumlich und zeitlich getrennt sind. Dahergehend ist die Reaktion des Trauerns normal und anfänglich nicht als pathogen einzustufen.[45]
In Anlehnung an die bindungstheoretischen Beobachtungen von Kindern mit Mutterverlust, bemühte sich Colin Murray Parkes eine Verbindung zum Trauerablauf herzustellen. Diese Überlegungen, welche er gemeinsam mit John Bowlby 1970 öffentlich postulierte, beschreiben folgende vier Phasen.[46]
(1) Betäubung
In der ersten Phase reagieren die Betroffenen auf eine Todesnachricht hauptsächlich mit Verleumdung und starrer Empfindungslosigkeit. Die Tatsache des Verlustes eines nahestehenden Menschen wird nicht realisiert, oft mit einem schlimmen Alptraum assoziiert, aus den man wieder erwachen könnte. Dies ist nicht vergleichbar mit einer „Gefühllosigkeit“, sondern äußert sich in einem Gefühlsschock. Er dient als Vermeidungsfunktion und verhindert eine überwältigende Empfindungsvielfalt, welche eine Bündlung sämtlicher Emotionsausbrüche im Verlauf der Trauer wiederspiegelt. Ihr direktes Bewusstwerden würde das psychische System überfordern und extrem starke psychosomatische Schmerzen mit sich führen. Diese Abwehrform kann die Hinterbliebenen zudem unbetroffen wirken lassen, obgleich ihre physiologischen Stressparameter enorm erhöht sind.[47]
(2) Sehnsucht und Protest
Die zweite Phase tritt in der Regel nach einigen Stunden bis wenigen Tagen nach einem Verlust auf und veranlasst die Betroffenen dazu, zwischen zwei geistigen Zuständen zu oszillieren. Einerseits wird das eigentliche Verlusterlebnis in Verbindung mit den Gefühlen von Schmerz, Angst und Traurigkeit realisiert und andererseits mit einem episodisch eintretenden Unglauben verleugnet, indem die Betroffenen, angetrieben von einer hoffnungsvollen Sehnsucht, die Verlustperson bewusst und unbewusst aufsuchen. Dies geschieht durch eine wahrnehmungsorientierte und gedankliche Aufmerksamkeit auf bestimmte Örtlichkeiten, Aktivitäten und Beziehungssymboliken und wird durch ein rastloses Umhergehen und Absuchen der Umgebung sowie durch ein intensives Denken, Träumen oder schluchzendes Rufen charakteristisch. Es werden alle Reize, welche die Anwesenheit der vermissten Person vermuten lassen fokussiert, wobei Wahrnehmungen, die nicht diesem Zwecke dienen, ignoriert bleiben. Dahergehend kommt es häufig zu aufdringlichen Bildern oder Geräuschen halluzinativen Charakters, welche mit einem Wiederzusammentreffen assoziiert werden. Beide Formen implizieren weiterhin das Empfinden eines starken Zornes, da die aufsuchenden Verhaltensweisen erfolglos bleiben und das sukzessive Begreifen des Geschehens dazu führt, die Verantwortlichkeit gegenüber des Verlustes zu personalisieren. So manifestieren sich resignierend aggressive Gefühlsmomente, die sich anhand Schuldzuweisungen auf die/den Toten selbst sowie auf in den Sterbeprozess einbezogene Dritte, wie etwa ÄrztInnen, Verwandte oder Unfallbeteiligte entladen. Dies gründet ebenso auf einer adaptiven Komponente des Menschen. Wütende Affekte dienen der Aufrechterhaltung von Trennung, in der Absicht eine Wiedervereinigung zu erlangen.[48]
(3) Desorganisation und Verzweiflung
Die Verwirrungen des hoffnungsvollen Aufsuchens und einer tiefen Betrübnis können im Verlauf von einigen Monaten bis Jahren anhaltend bleiben, bis die Hinterbliebenen die Unwiderruflichkeit der Trennung erkennen und akzeptierend daraus die Nötigkeit erschließen, diese Redundanzen abzulegen. Folglich kommt den Trauernden die kognitive Aufgabe zu, sich der Umformung ihrer inneren Vorstellungsmodelle anzunehmen, um den aktuellen Alltag mit unvermeidlich neuen Rollen und Fertigkeiten bewältigen zu können. Diese ersten gedanklichen Schritte gehen mit einem tiefen Schmerzempfinden der Verzweiflung einher und vermitteln den Trauernden grundlegend eine Orientierungslosigkeit.[49] Dabei kommt es häufig zu depressiven und apathischen Reaktionen. Häufig hemmen Formen eines identifikatorischen Verhaltens diese Hürde des Trauerns. Die Aneignung bestimmter Lebensstile der Verlustperson haben die Funktion des Rettens alter Gewohnheiten und des Widerstandes gegenüber unvermeidbaren Veränderungen. Daraus herleitend führen die Hinterbliebenen oft loyalitätsbezogene Zwiegespräche mit einer inneren Repräsentanz der/des Verstorbenen, welche ihnen Schuldgefühle vermitteln können.[50]
(4) Reorganisation
Der Weg zur Phase des Selbst- und Weltbezuges erschließt sich dadurch, dass die/der Verstorbene zu einer inneren Figur geworden ist. Die Zwiegespräche sind in diesem Trauerstadium abgeschlossen. Die innere Figur ist bezüglich neuer Lebensaussichten wandelbar, d.h. die Hinterbliebenen spüren, dass vieles was sie in der Beziehung gelebt haben, nun ihre eigenständige Möglichkeit ist. Neue Rollen, Beziehungen und Lebensstile werden eröffnet. Das jede Beziehung vergänglich ist und alles Einlassen auf das Leben an den Tod grenzt, wird als Erfahrung integrierbar.[51]
Beachtet werden muss, dass der skizzierte Trauerprozess einer rhizomatischen Verlaufsform unterliegt, sodass sich bestimmte Phasenübergänge meist wiederholen können. So formt sich etwa wechselwirkend aus einem betäubenden Gefühl ein aggressives Verhalten oder aus einer Reorganisationsbereitschaft ein Gefühl der Verzweiflung.[52] Darin wird die Bewältigungsstrategie der Hinterbliebenen ersichtlich, gleichzeitig eine Trauerarbeit mit einer neuen Lebensorientierung zu strukturieren. Es entsteht eine sich ständig erneuernde Aufgabensituation, in der die nötige Trauerarbeit mit der erforderlichen Neuintegration abgeglichen werden muss. Beide dosieren sich gegenseitig, um eine sukzessive emotionale und kognitive Reorganisation zu erzielen.[53] Eine unangemessen häufige Wiederkehr basiert auf dem Umstand, dass die Betroffenen ihre emotionalen Protestreaktionen unterdrücken oder aufgrund mangelnder sozialer Ressourcen und eigens empfundener Kontrollverluste unfähig bleiben, die Symbiose zum Toten zu mindern.[54] Hierbei sind Gefühle, wie Zorn, Angst, Schuld und Scham nicht angemessen in eine Sinnhaftigkeit integrierbar und blockieren dementsprechend die Ausbildung eines klaren Trauergefühls, welches fortführend inhibitorische Verhaltensweisen ablegen und Reorganisationsstrukturen bereitstellen lassen könnte. Besteht eine längeranhaltende Behinderung gegenüber der Kumulation der vier Phasen, droht ein chronisch angelegtes Aufschaukeln dysfunktionaler Emotionsschemata zu entstehen. Folglich kommt es zu einer biopsychosozialen Beeinträchtigung des Betroffenen, welche etwa durch die Anzeichen von destruktiven Verhalten (Substanzmissbrauch, Autoaggression), Panikattacken, depressiven Reaktionen, exzessiver Reizbarkeit, Schlaf- und Ess-Störungen, beruflichem Desinteresse oder sozialem Rückzug charakteristisch wird.[55] Tritt diese Symptomatik in den Vordergrund, wird die Trauer als gestört (Bowlby, John 1991), pathogen (Langenmayr, Arnold 1999) oder kompliziert (Znoj, Hansjörg 2004) beschrieben.
3.3 Charakteristik kindlichen Trauerns
Trotz der Tatsache, dass sich die oben skizzierte Grundannahme des Trauerns bevorzugt aus den Trennungsstudien von Kindern hergeleitet hat, basiert ihre Phasierung auf der Beobachtung von erwachsenen Menschen, welche ihre LebenspartnerIn verloren haben.[56] In der Literatur sind ebenso vermehrt Hinweise zu finden, die von einer Übereinstimmung zwischen dem kindlichen und erwachsenen Trauern absehen. Grundlegend wird anhand einer divergierenden geistigen Entwicklung und eines sozialen Abhängigkeitsstatus beider Gruppen argumentiert. Fortfolgend wird es wichtig sein, wesentliche Unterschiede zu beleuchten.
3.3.1 Todesverständnis im Kindesalter
Das wissenschaftliche Interesse über den Begriffszugang der Verständlichkeit war anfänglich konstitutiv auf die kognitive Reife des Kindes ausgerichtet. Somit verweisen die häufigsten Standpunkte auf die geistige Entwicklungstheorie nach Jean Piaget, um das kindliche Begreifen des Todes anhand von Stufen zu beschreiben.[57] Um von einer angemessenen Auffassungsgabe sprechen zu können, muss das Kind die drei Hauptkomponenten des Todes anhand einer logisch-physikalischen Herangehensweise erkennen und erklärbar machen. Dabei muss es die Unausweichlichkeit des menschlichen Sterbens (Universalität), die Unwiderruflichkeit des menschlichen Lebens (Irreversibilität) sowie die damit verbundene Beendigung der körperlichen und geistigen Lebensfunktionen des Menschen verinnerlichen.[58]
Bis zum zweiten Lebensjahr befindet sich das Kind im sensomotorischen Reifestadium, sodass es ihm an jeglicher Möglichkeit fehlt, über das Nichtsein zu reflektieren. Der bedeutsame Fortschritt der Objektpermanenz steht einer Vorstellung des Todes sogar entgegen, indem er dem Kind eine Reversibilität vermittelt.
„Das Kind lernt, dass ein Gegenstand auch dann noch existiert, wenn er nicht zu sehen ist. Analog bleibt eine verstorbene Person doch repräsentiert – die Objektpermanenz ist die Vorbedingung für die ursprüngliche Vorstellung, dass der Tod eine Art reduziertes Weiterleben sei: die Verstorbenen sind fortgegangen“ (Ramachers, Günter 1994 : 37)
Ab dem zweiten Lebensjahr besitzt das Kind ein voroperatorisch-anschauliches Denken, welches grundlegend von seiner egozentrischen Sichtweise geprägt ist. Dabei kann es sich noch nicht angemessen genug in andere Menschen hineinversetzen (kognitive und emotionale Perspektivübernahme), wobei eine Reflexionsfähigkeit in seiner Gegenwartsperspektive gefangen bleibt. Ein weiterer Aspekt der zweiten Entwicklungsstufe ist die Fähigkeit des Kindes, die Ergebnisse seines Handelns zu begreifen. Daraus resultiert die Annahme, dass ein Konzept des Machens dem Kind die Handhabung des Tötens nahe legt, wobei es selbst noch kein Verständnis vom Tod an sich besitzt. Dahergehend wird das Sterben zum Getötet-Werden und das Kind ist bei der Vorstellung des Todes an eine tötende Instanz gebunden, d.h. es verleiht ihm ein animistisches Wesen, welches durch Gewalt (Schusswaffen, Gift, Krankheiten) ein Sterben verursacht. Neben dem Egozentrismus versperrt diese Tatsache dem Kind das Verstehen des Alterns und damit des natürlichen Todes. Die Universalität und die Beendigung der Lebensfunktionen kann dabei unausreichend verinnerlicht werden, selbst wenn das Kind das Nichtwiedereintreten der Lebendigkeit anhand von Erklärungen akzeptieren kann.[59] Das konkret-operatorische Denken der Altersspanne zwischen fünf bis zwölf Jahre fördert das kindliche Todesverständnis in einem erheblichen Maße, wobei besonders die Grundschuljahre relevant werden.[60]
„Das Kind beginnt, sich aus den Fesseln der egozentrischen Perspektive zu lösen. Die Fähigkeit zur Bildung mit Klassifikationssystemen mit Unter- und Oberklassen wir erworben, Quantifikationen wie „einige“, „manche“, „alle“ werden allmählich verstanden. Damit wird z.B. sylloogistisches Schließen möglich. Der operationale Zahlenbegriff wird entwickelt, ebenso bildet sich ein Konzept von Verursachung heraus, das nicht mehr an das Modell des Machens gebunden ist.“ (Ramachers, Günter 1994 : 44 f.)
Das Kind versteht auf dieser Stufe die Unterteilung von Lebendem, Totem und Unbelebendem und kann die Irreversibilität und Universalität des Todes fassen. Die Auflösung einer animisitischen Weltsicht ermöglicht die Unterscheidung zwischen einem Sterben und Getötet-Werden. Bei strenger Berücksichtigung der Überlegungen Piagets bleibt das Extrapolieren dieser Informationen, d.h. das hypothetische Übertragen von Allgemeinaussagen auf eigene Voraussetzungen, dem formal-operatorisch denkenden Jugendalter ab dem zwölften Lebensjahr vorbehalten. Dies betrifft konstitutiv die Konzeption des Todes als eine natürliche Gegebenheit, welche für jeden Mensch aufgrund seiner beschränkten Lebenszeit zutrifft. Ähnlich verhält es sich bei dem allgemeinen Begriff der Nichtexistenz, welcher dem induktiv denkenden Gehalt der konkreten Erfahrungen entgegen steht. Somit wird die Beendigung der Lebensfunktion in Bezug auf den Alterungsprozess eines Menschen als letzte Komponente kognitiv verinnerlicht.[61]
Dem Bild einer rein kognitiven Todesvorstellung stehen jedoch einige Erkenntnisaspekte berichtigend gegenüber. Zum einen wird der Ausschluss eines idiosynkratischen Wahrnehmens kritisiert, welches eine emotionale Betroffenheit des Kindes untergräbt und als Auffassungsmittel des Todesphänomen vernachlässigt.[62] Besonders stellen die bindungstheoretischen Überlegungen zum inneren Arbeitsmodell eine konträre Auffassung kindlicher emotionaler Auffassungsgabe dar, auch wenn diese hauptsächlich unbewusst agiert. Weiterhin beleuchten etwa Studien, wie die von Orbach et al. (1986), einen Zusammenhang zwischen einer sich intensivierenden Ängstlichkeit und einer gehemmten kognitiven Auffassungsgabe des Kindes. Daraus entstehen zum anderen interindividuelle Reifeprozesse, welche sich nicht mehr in die strikt abgegrenzten Entwicklungsstadien nach Piaget einordnen lassen.[63] Diese unterschiedlichen Herangehensweisen können damit kein kohärentes Bild repräsentieren, sodass ebenso die zusammenfassenden Darstellungen des Gegenstandes (Speece & Brent, 1984; Stambrook & Parker, 1987; Wittkowski, 2003) nur zu vorläufigen, teils widersprüchlichen Belegen führen.[64] Darüber hinaus hat sich dennoch ein wissenschaftlicher Konsens entwickelt, die emotionale Relevanz gegenüber den kognitiven Komponenten eines reifen Todesverständnisses zu berücksichtigen.[65] Die signifikantesten Hinweise verschiedener Studien deuten diesbezüglich auf eine Ausprägung im Grundschulalter hin.[66]
3.3.2 Reaktionen unter günstigen und ungünstigen Umständen
John Bowlby hält in Anlehnung an die kinderanalytischen Beobachtungen der Cleveland-Projektgruppe um Erna Furman fest, dass Kinder ab dem vierten und fünften Lebensalter einen ganz ähnlichen Trauerverlauf wie Erwachsene aufweisen, obgleich sich ihre kognitiven Zugangsarten anders gestalten und verdeutlichen.[67] Dabei zeigen Kinder ihre Trauer grundlegend in kürzeren und wechselhafteren Gefühlszuständen, sodass es für den Betrachter häufig schwierig wird, diese sachlich zu beurteilen.
„Wenn Erwachsene Trauerprozesse oft mit dem Waten durch einen Fluss vergleichen, dessen Ufer nicht zu erkennen ist, dann stolpern Kinder in Pfützen der Trauer hinein und springen wieder weiter.“ (Ennulat, Gertrud 2008 : 59)
Im Gegensatz zu Erwachsenen stehen Kinder zudem in einem enorm höheren Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem nahen sozialen Umfeld, da sie eine geringere Kontrollfähigkeit hinsichtlich ihre eigenständige Lebensbewältigung besitzen. Der familiäre Umgang mit dem Todesverlust nimmt somit einen grundlegenden Einfluss auf die Interpretationen und Reaktionen des Kindes.[68] Im folgenden sollen typische Eindrücke und Bewältigungsstrategien des trauernden Kindes kurz beleuchtet werden, welche sich, je nach Grad der familiären Unterstützungsbereitschaft, zu einem günstigen, bzw. ungünstigen Trauerverlauf manifestieren können.
Die ersten Trauerreaktionen können, ebenso wie beim Erwachsenen, anhand einer Apathie oder eines psychischen Erregungszustandes verdeutlich sein. Meist wird zudem eine Ungläubigkeit und der Versuch einer Ausgangsumkehr charakteristisch. Kinder verhalten sich dann weiterhin so, als ob der verstorbene Elternteil noch da wäre, indem sie beispielsweise für ihn den Tisch eindecken oder Alltagsaufgaben erledigen.[69] Selbst wenn die Todeskomponente der Irreversibilität bereits verstanden worden ist, kann es zur Vermutung einer zeitbefristeten Trennung und Rückkehr kommen. Oft wird eine lange Reise von Mutter oder Vater angenommen.[70] Hierbei ist es wichtig, dass Kind zeitnah und wahrheitsgemäß über die Tatsache eines Nichtwiedersehens aufzuklären, da die uneinlösbaren Hoffnungsgedanken entscheidende Emotionen der Trauerbewältigung blockieren würden. Dieser Aspekt wird im Kapitel 6.2, „Übermittlung einer Todesnachricht an ein Kind“, noch einmal ausführlicher zur Sprache kommen. Besonders im Grundschulalter hegen Kinder ein Interesse an der Äußerlichkeit des Todes. Sie begreifen die Tatsache des Erlöschens aller körperlichen und geistigen Funktionen des Menschen sowie die eigene Sterblichkeit. Daraus begründet sich ein episodisch eintretendes Angstempfinden. Kinder träumen vom eigenen Sterben, bzw. von dem einer geliebten Personen und treten demzufolge gelegentlich mit übertriebenen und entwicklungsunangepassten Bindungsverhalten zu Tage.[71] Kinder verweigern dahergehend gelegentlich den Schulbesuch und wirken beaufsichtigend und kontrollierend gegenüber ihren Familienangehörigen.[72] Diesem Bedürfnis muss sich besonders feinfühlig angenommen werden, um ein angemessenes Geborgenheitsempfinden zu gewährleisten. Ebenso muss bedacht sein, dass dieses zunehmende Begreifen für das Kind eine kognitive Bereicherung hinsichtlich der Trauerbewältigung darstellt. Dahergehend sollte das Kind unter einer guten Vorbereitung in die familiären Trauerfeierlichkeiten eingeweiht und integriert werden. Dabei hat das Kind einerseits die Möglichkeit sich körperlich spürbar von seinem verstorbenen Elternteil zu verabschieden, was die Gefährdung eines Reversibilitätsverständnisses vermindert und andererseits kann es an der Begegnung trauernder Gefühlsäußerungen teilnehmen, wobei es lernt seine schmerzlichen Empfindungen nicht unterdrücken zu müssen.[73] Das Bedürfnis des Aufsuchens der verlorenen Person zeigt sich bei Kindern in der Regel deutlicher anhand identifikatorischen und regressiven Verhaltens, um die bedeutende Bindungsrepräsentanz zum vermissten Elternteil aufrecht erhalten zu können. So nässt ein Kind etwa wieder ein, um ein Fürsorgeempfinden seines Säuglingsalters zu erzielen, oder fällt mit einem übertriebenen Schulehrgeiz und stoischen Verhalten auf, da ihm der verstorbene Elternteil mit Leistungsorientierung und mentaler Stärke in Erinnerung bleibt.[74] Zudem sind Kinder auf der Suche nach Antworten, um die Ursachen und Auswirkungen des Todesgeschehens zu verstehen. Damit ist hauptsächlich die Hoffnung hinsichtlich einer möglichen Wiedervereinigung verbunden.[75] Beachtet werden muss, dass sich Kinder des Grundschulalters wesentlich an der Vorstellung orientieren, der Sterbeprozess sei ein Ausdruck von Bestrafung. Demzufolge reagieren sie enorm sensible gegenüber Tadel, Kritik sowie sonst üblichen kurzen Trennungen oder kleinen familiären Streitigkeiten, da deren Auseinandersetzungen mit den Gegensätzlichkeiten von Gut und Böse bestimmte Schuldurteile und Todesängste bezüglich dem eigenen Selbst und nahestehenden Personen implizieren. Um dem entgegenzuwirken bedarf es ebenso einer wahrheitsgemäßen Aufklärung der Todesursache.[76] Die Ausdrucksform des Protestes können auf verschiedene Umstände der kindlichen Trauer zurückgeführt werden. Kinder hegen meist zornige Selbstvorwürfe hinsichtlich der Loyalität zur/zum Verstorbenen, da sie ihre übermäßigen, meist identifikatorisch begründeten Erwartungen, nicht erfüllen können oder weil sie sich für den Tod des Elternteiles verantwortlich fühlen.[77] Gegenüber Dritten kann ebenso ein missbilligendes Verhalten geäußert werden. Zum einen wird dies etwa durch Schamgefühle aufgrund der Tatsache einer Vater- und Mutterlosigkeit bedingt, wobei besonders der Vergleich zu anderen Kindern zum Anlass eines Neidempfindens beiträgt.[78] Andererseits fühlt sich ein Kind in seiner Trauer oft unverstanden, da das soziale Umfeld seine wechselhaften Bedürfnisse nicht immer deuten und prompt berücksichtigen kann. Weiterhin kann das ärgerliche Unbehagen auf den verstorbenen Elternteil selbst gerichtet sein. Ein Grund dafür kann zum Beispiel eine vor dem Todesereignis getroffenen Versprechung sein, die vom Kind als nicht eingehalten verstanden wird.[79]
Grundlegend bedarf es der Zuhilfenahme der Fürsorgepersonen, welche dem Kind auf angemessene Art und Weise die Todeskomponenten verdeutlichen, um die Verwirrungen seines Verlustes und seiner eigenen geistigen Kognitionsentwicklung zu vermindern und in ein angepasstes Verhältnis zu bringen.[80] Die kindlichen Todesassoziationen und reaktiven Verhaltensweisen müssen verstanden, gelegentlich geduldig akzeptiert und liebevoll miteinander besprochen werden. Diesbezüglich sollten auch weitere soziale Bereiche (Schule, Hort, Vereine, u.a.) des Kindes über den Elterverlust informiert werden, um Fehlinterpretationen hinsichtlich Verhaltensveränderungen zu vermeiden und eine angemessene Berücksichtigung zu bewerkstelligen. Gefährdende Trauermerkmale können im dialogischen Austausch mit der Familie und den Institutionen sukzessiv reduziert und zu einer reorganisierten und entwicklungsfördernden Lebenseinstellung transformiert werden. Dagegen bedingt eine Verhüllung des Todesereignisses sowie eine Nichtberücksichtigung der kindlichen Probleme eine Chronizität der komplizierten Emotions- und Verhaltensstrukturen. So leiden Kinder bei ungünstigen Bedingungen unter einer dauerhaften Angst vor weiterem Verlust, bzw. dem eigenen Sterben oder werden gegenteilig dazu wiederkehrend von einem starken Todeswunsch getrieben, in der Hoffnung den vermissten Elternteil zurück zu erlangen. Weiterhin sind vor allem die repetitiven Anzeichen von hoffnungsvoller Euphorie, aggressiven, bzw. destruktiven Verhaltens, zwanghafter Fürsorge, anhaltender Selbstvorwürfe und Fremdbeschuldungen sowie psychosomatischer Beschwerden, welche mit der Todesursache des Elternteiles in Zusammenhang stehen, beobachtet wurden.[81]
3.4 Zusammenfassung
Der Tod eines Elternteiles wird in der Literatur als das schmerzlichste Verlusterlebnis eines Kindes beschrieben, unabhängig von der zuvor bestehenden emotionalen Qualität der Eltern-Kind-Beziehung. Internalisierte Wirklichkeitszusammenhänge können durch die zerstörte Bindungsbeziehung nicht mehr bedient werden und erfordern eine adaptive Reorganisation, um in neuen sozialen Gefügen eine gesunde Weiterentwicklung zu gewährleisten. Dieser Prozess wird mit dem psychologischen Phänomen der Trauer beschrieben. Erste reaktive Emotions- und Verhaltensmuster eines Personenverlustes sind, in Anlehnung an bindungstheoretische Überlegungen, biologisch determiniert und autark vom kognitiven Verständnis des Betroffenen. Demzufolge trauern Kinder und Erwachsene in ähnlicher Art und Weise, obgleich ihre intellektuellen Zugänge unterschiedlich sind. Die Annahme darüber, Kinder könnten aufgrund formal-logischer Defizite kein Empfinden für einen Verlust aufzeigen, ist somit überholt. Anders hingegen wird das kognitive Begreifen relevant hinsichtlich längerfristiger Bewältigungsstrategien. Eine gesunde Neustrukturierung kann nur dann gewährleistet werden, wenn eine Trennung zur vermissten Person akzeptiert wird. Nur so können schmerzliche emotionale Schemata verstanden und überwunden werden, bevor sie bei längerfristigen Auftreten zu gestörten Entwicklungsverläufen beitragen. Der nötigen Anerkennung eines Verlustes und eines neuen sozialen Gebundenheitszusammenhanges muss ein Verständnis über die menschliche Endlichkeit sowie eine angemessene emotionale Sicherheit voraus gehen. Bei dieser Aufgabe benötigt ein Kind unweigerlich die Hilfe seines sozialen Umfeldes. Daraus lässt sich schließen, dass besonders die Bindungsmuster zu weiteren Familienangehörigen einen bedeutenden Einfluss auf den Trauerverlauf des Kindes nehmen. Gerade die Hinweise des vorausgegangenen Kapitels, welche von einer Abhängigkeit zwischen der emotionalen Qualität und einem kognitiven Entwicklungsverlauf sprechen, weisen darauf hin, dass bei unsicher gebundenen Beziehungen eine höhere Inzidenz von gestörten Trauerverläufen zu erwarten ist.
4 Elterverlust durch Suizid
4.1 Begriffserläuterungen zum Suizid
Im wissenschaftlichen Diskurs dient der Begriff des Suizides der adäquatesten Bestimmung einer Selbsttötung, welche eine gegen das eigene Leben willentlich und zielgerichtete Handlung, mit einem tödlichen Ausgang darstellt.[82] Das Bundesamt für Statistik fasst etwa in seinem Suizidbericht 2007 solche Akte nach ihrem Häufigkeitsaufkommen zusammen, wobei vor allem die Formen der Vergiftung mit toxischen Flüssigkeiten und Gasen sowie der Strangulation oder des Sturzes aus großer Höhe vielfach in Erscheinung treten.[83] Die Unterlassung bestimmter lebenswichtiger Maßnahmen gilt im korrekt rechtlichen Sinne nur dann als suizidales Verhalten, wenn die/der lebensmüde Betroffene das Unterlassungsgeschehen selbst tatsächlich beherrscht, etwa bei dem wissentlich und auf den Tod gezielten Verzicht von Nahrung, Flüssigkeit oder Medikamenten.[84] Dagegen kann die Ablehnung einer voraussichtlich vor dem Tod rettenden ärztlichen Maßnahme keine Suizidhandlung darstellen.[85] Andere umgangssprachliche Bezeichnungen, wie etwa der Selbstmord oder der Freitod, sind juristisch eher problematisch und sollten für eine allgemeine Darstellung nicht verwendet werden. Zum einen ist der Suizid im Gegensatz zum Mord nicht strafbar, da die Entscheidungs- und Willensautorität des eigenen Lebensverzichtes zur Selbstbestimmungsfreiheit eines jeden Menschen zählt. Das Recht auf Leben gemäß dem Art. 2 EMRK steht dieser nicht entgegen, da es auf keiner Weiterlebenspflicht beruht.[86] Zum anderen handeln die meisten Betroffenen aus einer irrtumsbedingten und mangelnden Einsichtsfähigkeit heraus, da ihre Suizidhaltung in den häufigsten Fällen ein Symptom einer psychischen Störung ist, die mit einer Geschäftsunfähigkeit einhergeht. Somit kann in der Regel nicht von der eigenverantwortlichen Einwilligung einer freien Wahl gesprochen werden.[87]
[...]
[1] vgl. Rübenach, P. Stefan 2007 : 966
[2] vgl. Felber, Werner 2008 (URL), siehe zudem Anhang 1
[3] vgl. Rauh, Hellgard 1998 : 237 f.
[4] vgl. Gloger-Tippelt, Gabriele 2007 : 70
[5] vgl. Grossmann, Klaus E.; Grossmann, Karin 2001 (URL)
[6] vgl. Grossmann, Klaus E.; Grossmann, Karin 2001 (URL)
[7] vgl. Bowlby, John 1997 : 23
[8] vgl. Christ, Hans 2001 (URL)
[9] vgl. Fremmer-Bombik, Elisabeth 1995 : 111
[10] vgl. Christ, Hans 2001 (URL)
[11] vgl. ebd.
[12] vgl. Main, Mary 1995 : 125
[13] vgl. Christ, Hans 2001 (URL)
[14] vgl. ebd.
[15] vgl. ebd.
[16] vgl. Main, Mary 1995 : 128
[17] vgl. Christ, Hans 2001 (URL)
[18] vgl. ebd.
[19] vgl. Main, Mary 1993 : 126
[20] vgl. Christ, Hans 2001 (URL)
[21] vgl. Putnam, Frank 1989: 26
[22] vgl. Christ, Hans 2001 (URL)
[23] vgl. Keller, Monika, Malti, Tina; Dravenau, Daniel 2007 : 132
[24] vgl. Silbereisen, Rainer K. 1998 : 823
[25] vgl. Keller, Monika, Malti, Tina; Dravenau, Daniel 2007 : 132
[26] vgl. Gloger-Tippelt, Gabriele 2007 : 72
[27] vgl. Montada, Leo 1998 : 862
[28] vgl. Mader, Johann 2005 : 214
[29] vgl. Grossmann, Klaus E.; Grossmann, Karin 2007 : 152
[30] vgl. Keller, Monika, Malti, Tina; Dravenau, Daniel 2007 : 129 f.
[31] vgl. Silbereisen, Rainer K. 1998 : 832 ff.
[32] vgl. Gloger-Tippelt, Gabriele 2007 : 76
[33] vgl. Grossmann, Klaus E.; Grossmann, Karin 2007 : 170
[34] vgl. Gloger-Tippelt, Gabriele 2007 : 72
[35] vgl. a.o.O. : 73
[36] vgl. Gloger-Tipplet 2007 : 76 f.
[37] vgl. Fremmer-Bombik, Elisabeth 1997 : 109 ff.
[38] vgl. Bowlby, John 1980 : 61
[39] vgl. Christ, Hans 2001 (URL)
[40] vgl. Rauh, Hellgard 1998 : 241
[41] vgl. Znoj, Hansjörg 2004 : 7
[42] vgl. Meyers Lexikon (URL)
[43] vgl. Meier, Christof; Perren-Klinger, Gisela 2002 : 20 f.
[44] vgl. Znoj, Hansjörg 2004 : 6
[45] vgl. Meier, Christof; Perren-Klinger, Gisela 2002 : 20 f.
[46] vgl. Bretherton, Inge 1997 : 38
[47] vgl. Bowlby, John 1980 : 115
[48] vgl. Bowlby, John 1980 : 115 ff.
[49] vgl. a.o.O. : 124 f.
[50] vgl. Kast, Verena 1982 : 68
[51] vgl. Bowlby, John 1980 : 126
[52] vgl. a.o.O. : 114
[53] vgl. Znoj, Hansjörg 2004 : 34 f.
[54] vgl. Ramachers, Günter 1994 : 51
[55] vgl. Znoj, Hansjörg 2004 : 35 f.
[56] vgl. Bowlby, John 1980 : 115
[57] vgl. Habermas, Tilmann; Rosemeier, Hans Peter 1990 : 263
[58] vgl. Ramachers, Günter 1994 : 14
[59] vgl. Ramachers, Günter 1994 : 39 ff.
[60] vgl. a.o.O. : 43
[61] vgl. Ramachers, Günter 1994 : 45 f.
[62] vgl. Habermas, Tilmann & Rosemeier, Hans Peter 1990 : 267
[63] vgl. Ramachers, Günter 1994 : 49 f.
[64] vgl. a.o.O. : 37
[65] vgl. a.o.O. : 53
[66] vgl. Habermas, Tilmann & Rosemeier, Hans Peter 1990 : 263
[67] vgl. Bowlby, John 1980 : 375
[68] vgl. a.o.O. : 376
[69] vgl. Ennulat, Gertrud 2008 : 113
[70] vgl. Bowlby, John 1980 : 360
[71] vgl. Ennulat, Gertrud 2008 : 21
[72] vgl. Bowlby, John 1980 : 363
[73] vgl. a.o.O. : 355
[74] vgl. a.o.O : 359 ff.
[75] vgl. a.o.O. : 356
[76] vgl. Ennulat, Gertrud 2008 : 21
[77] vgl. Bowlby, John 1980 : 373
[78] vgl. Ennulat, Gertrud 2008 : 74
[79] vgl. Bowlby, John 1980 : 367
[80] vgl. Ramachers, Günter 1994 : 52 f.
[81] vgl. Bowbly, John 1980 : 455 ff.
[82] vgl. Baumgarten, Mark-Oliver 1998 : 105
[83] vgl. Rübenach, Stefan P. 2007 : 965
[84] vgl. Nationaler Ethikrat 2006 : 66
[85] vgl. Baumgarten, Mark-Oliver 1998 : 105
[86] vgl. a.o.O. : 93
[87] vgl. Nationaler Ethikrat 2006 : 78 f.
- Arbeit zitieren
- Benjamin Loibl (Autor:in), 2009, Psychische Traumatisierungsprozesse beim Grundschulkind nach Elternsuizid, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125229
Kostenlos Autor werden



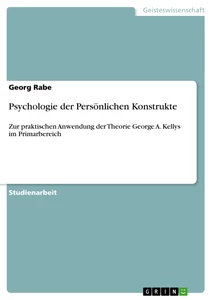

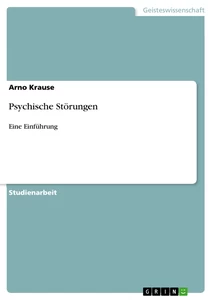
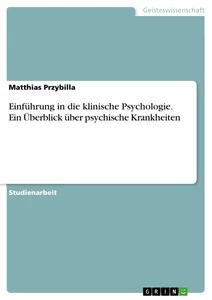

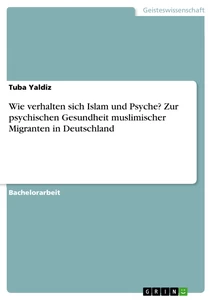




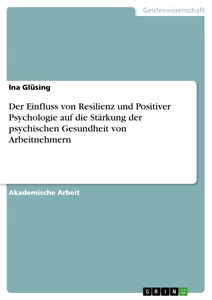
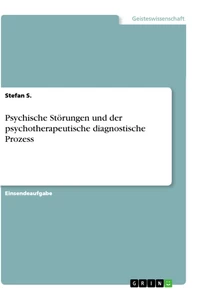





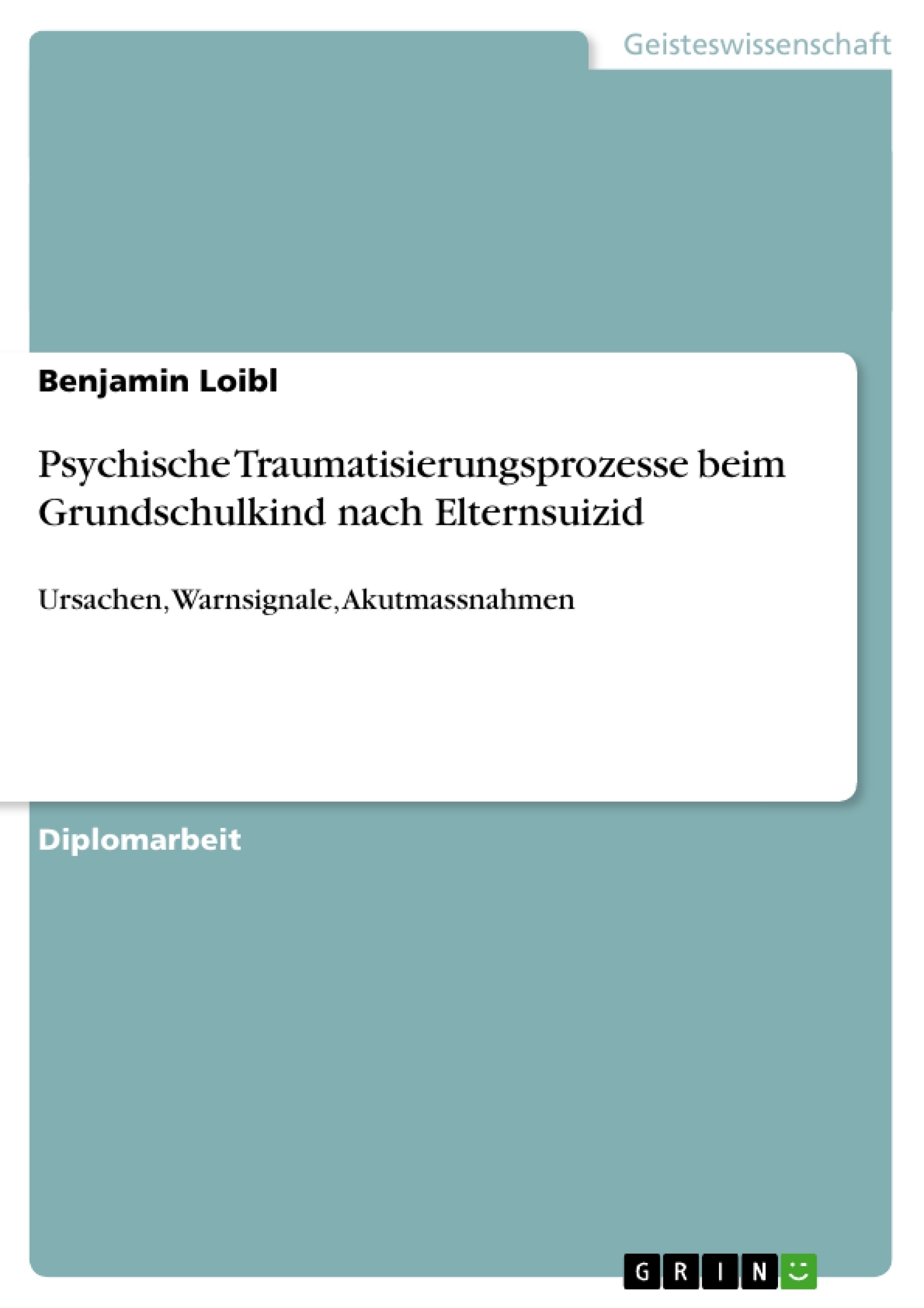

Kommentare