Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abstract
1. Einleitung
2. Wissenschaftlicher Hintergrund
2.1 Geschlechtsdimorphismen
2.1.1 Allgemeine Geschlechtsdimorphismen
2.1.2 Hirnstrukturelle Geschlechtsdimorphismen
2.2 Geschlechtsentwicklung des Menschen
2.2.1 Männlich oder weiblich? – Die Geschlechtsentwicklung
2.2.2 Wirkung d. Geschlechtshormone auf d. menschliche Gehirn
2.2.3 Geschlechtshormone und das Aggressionsverhalten
2.3 Der 2D:4D Quotient
2.3.1 Was sagt der 2D:4D Quotient aus?
2.3.2 Der 2D:4D Quotient und das Aggressionsverhalten
2.4 Die Basisemotion Angst
2.4.1 Angst und Phobien
2.4.2 Evolutionäre Begründung der Arachnophobie
2.4.3 Physiologische Grundlagen der Angst
2.4.4 Messbarkeit von Angst
2.4.5 Angst und der 2D:4D Quotient
2.5 Ziel der Arbeit und Hypothesen
3. Material und Methoden
3.1 Erstellung des Fragebogens
3.2 Datenerfassung
3.3 Auswertung der Fotographien
3.4 Statistik
4. Ergebnisse
5. Diskussion
Anhang
1 Literaturverzeichnis
2 Anhang zur Hypothese
3 Anhang zur Hypothese
4 Anhang zur Hypothese
5 Anhang zur Hypothese
6 Anhang Statistische Auswertung
Abstract
Die hier vorliegende Untersuchung betrachtet den Zusammenhang zwischen einer arachnophobischen Neigung und dem Verhältnis des Zeigefingers (2D) zum Ringfinger (4D).
Der so genannte 2D:4D Quotient wird im menschlichen Körper durch pränatales Testosteron beeinflusst und wurde bereits für viele Untersuchungen zu geschlechtsdimorphistischen Ausprägung verschiedenster Eigenschaften genutzt. Viele klinische Studien haben beispielsweise bereits einen möglichen Zusammenhang zwischen pränatalem Testosteron und kognitiven Eigenschaften beim Menschen untersucht.
Das vorgeburtliche Wachstum der Finger wird durch einen erhöhten Testosterongehalt negativ beeinflusst. So weisen Männer im Vergleich zu Frauen einen geringeren Quotienten auf, aber auch innerhalb eines Geschlechts gibt es natürliche Unterschiede.
Hier setzt diese Untersuchung an. Es wird vermutet, dass Frauen mit einem eher weiblichen Quotienten eine größere Tendenz zur Ausprägung einer Arachnophobie haben, als diejenigen, die einen eher männlichen/höheren Quotienten aufweisen. Hierbei zeigte sich jedoch, dass in dieser Studie kein signifikanter Zusammenhang für die rechte Hand gefunden werden konnte, was unter Umständen jedoch mit dem methodischen Vorgehen bei der Ermittlung der arachnophobischen Neigung sowie der Stichprobengröße zusammenhängen kann. Bei Betrachtung der linken Hand konnte ein Zusammenhang festgestellt werden, der jedoch besagt, dass Frauen mit einem männlichen Fingerlängenverhältnis eher zur Arachnophobie neigen.
Diese Studie kann nicht als endgültiges Ergebnis gesehen werden, sie sollte vielmehr als Anlass dienen, diese Fragestellung nochmals näher zu betrachten.
1. Einleitung
Spinnen - für manch einen sind sie ganz normale Tiere, die mit einem Glas aus der eigenen Wohnung hinaus befördert, in dunklen Kellern und Garagen meist geduldet werden. Sie sind vielleicht nicht gerade wie kleine Eisbärenbabys, die seit Knut die Sympathieträger schlechthin sind, sie kümmern einen einfach nicht und werden nicht beachtet. Manche interessieren sich sogar für diese Geschöpfe.
Andere jedoch werden panisch. Ihr Blick wird von den kleinen Monstern magisch angezogen. Der Puls erhöht sich, der Atem geht stoßweise. Der Anblick der acht flinken Beine und des fetten Hinterleibs sind nicht gerade das, was man in seinem Schlafzimmer vorfinden möchte. Was nun? Ein Glas drüber stülpen? Nein, sie könnte ja mit ihren ekeligen Beinen loskrabbeln. Im Wohnzimmer schlafen? Dann ist sie morgen irgendwo im Schlafzimmer verschwunden, was ein noch viel größeres Problem darstellen würde. Einsaugen? Dann krabbelt sie bestimmt wieder aus dem Staubsauger heraus. Fragen wir doch einfach einen Mann, der wird sie schon nach draußen setzen.
Aber ist das wirklich so? Sind die Geschlechterrollen so einfach zu verteilen? Gibt es Eigenschaften, die typisch Mann oder typisch Frau sind? Jeder kennt die vielen Vorurteile bezüglich der Geschlechter. Nicht umsonst gibt es ganze Bücher über Frauen, die nicht einparken und Männer, die nicht zuhören können. Aber nicht nur die Medien haben sich mit diesem Phänomen beschäftigt. Wissenschaftler und Forscher wollen schon seit jeher wissen, was genau „den Mann“ und was „die Frau“ ausmacht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 screenshot: planet wissen und Quarks & Co
Angst vor Spinnen zählt zu den Eigenschaften, die eher der Frau zugesprochen werden. Männer hingegen sind gemäß ihrer Sozialisation furchtlos und ekeln sich natürlich nicht vor Spinnen. Sie können die ungebetenen Gäste meist einfach mit der Hand aus der Wohnung befördern. Es ist in der Tat wirklich so, dass anteilmäßig mehr Frauen unter Arachnophobie leiden als Männer. Dass dieses Thema aktuell ist (siehe Abb. 1 und 2), zeigen die zahlreichen Berichte der Medien sowie Studien vieler Wissenschaftler. Vor allem die Psychologen forschen nach Ursachen und Therapiemöglichkeiten. Angst vor Spinnen kann einschränken und nicht jeder möchte auf ein Picknick im Freien verzichten nur weil sich dort womöglich diese kleinen achtbeinigen Krabbeltiere befinden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2 screenshot: die Zeit und Focus online
Viele wissenschaftliche Studien haben sich in der Vergangenheit ebenfalls mit der geschlechtsdimorphistischen Ausprägung von Fingerlängenverhältnissen im Zusammenhang mit verschiedensten Eigenschaften, wie beispielsweise das Aggressionspotential, die sexuelle Orientierung etc., beschäftigt. Hier wurde teilweise festgestellt, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Fingerquotienten und der betreffenden Eigenschaft gibt, oft konnte jedoch auch kein Zusammenhang festgestellt werden.
Die vorliegende Studie untersucht einen möglichen Zusammenhang des Fingerlängenverhältnisses (2D:4D) bei der Frau und der Arachnophobie. Es stellt sich die Frage, ob man eine Neigung zur Angst vor Spinnen mit morphologischen Merkmalen, die durch pränatales Testosteron beeinflusst werden, in Zusammenhang bringen kann. Haben vielleicht Frauen mit einem weiblichen Fingerquotienten generell mehr Angst vor Spinnen als diejenigen, die einen männlichen Quotienten aufweisen? Oder stimmen die Vorurteile womöglich gar nicht?
Ein Vergleich zwischen Männern und Frauen kann in dieser Studie, da hier nur Frauen befragt wurden, nicht gemacht werden, jedoch wird eine parallele Studie mit ausschließlich männlichen Probanden von Hanim Özata an der Universität Duisburg Essen durchgeführt.
2. Wissenschaftlicher Hintergrund
2.1 Geschlechtsdimorphismen
2.1.1 Allgemeine Geschlechtsdimorphismen
In der Literatur wird der Begriff Geschlecht verwendet, ohne dass er expliziert definiert wird, denn jeder kann sich darunter etwas vorstellen. Es ist allgemein bekannt, dass dieser Begriff der Klassifizierung von Lebewesen als männlich oder weiblich dient. Hierbei werden das genetische sowie das genitale Geschlecht, welches durch primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale charakterisiert wird, unterschieden (HOFFMANN-LA ROCHE AG, 1998). Das gonadale Geschlecht hingegen wird durch die Keimdrüsen des Embryos bestimmt. Welche allgemeinen Unterschiede gibt es aber zwischen männlichen und weiblichen Individuen beim Menschen?
Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen zu verhaltensbezogenen und kognitiven Unterschieden beider Geschlechter, wobei es hier nicht darum geht, das eine Geschlecht als „besser“ oder „leistungsfähiger“ darzustellen. Es werden lediglich kognitve Unterschiede, die auf biologischen und/oder sozialen Faktoren basieren, untersucht (HAUSMANN, 2007). FENSON ET AL. (1994) haben beispielsweise in einer Studie herausgefunden, dass Frauen hinsichtlich verbaler Fähigkeiten besser abschneiden als Männer. Sie können sich unter anderem Wortreihen besser merken oder auch mehr Wörter mit dem gleichen Anfangsbuchstaben in einer bestimmten Zeit aufzählen. Auch die kanadische Psychologin DOREEN KIMURA (1999), die zahlreiche kognitive Fähigkeiten Untersucht hat, bestätigt dieses Ergebnis.
Wenn es um die Raumkognition geht, so gibt es bei einigen Aufgaben Geschlechtsunterschiede, bei anderen jedoch nicht. Eindeutige Ergebnisse liefern Tests zur mentalen Rotation. Bei diesen Tests müssen Probanden unter Zeitdruck gleiche Würfelfiguren identifizieren (siehe Abb. 3). Es werden ihnen mehrere Würfelfiguren gezeigt. Einige dieser können durch mentales Rotieren in Übereinstimmung gebracht werden und müssen dann von nicht passenden Figuren abgegrenzt werden (HAUSMANN, 2007). Bei diesem Test liegen die Männer eindeutig im Vorteil. Frauen hingegen schneiden in Tests zum Ortsgedächtnis von Objekten eindeutig besser ab (EALS & SILVERMAN 1994). Auch KIMURA konnte diese Aussage durch ihre Studien belegen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3 Mentaler Rotationstest bei dem die beiden Vergleichsfiguren markiert werden sollen, die die Originalfigur in rotierter Position abbilden.
Quelle: HAUSMANN, M., (2007), S. 108
Es gibt zahlreiche weitere Untersuchungsgebiete, die sich mit geschlechtsdimorphistischen Fähigkeiten befassen. Beispielsweise Tests zur Wahrnehmungsgeschwindigkeit oder zu motorischen oder mathematischen Fähigkeiten. Nun wirft sich die Frage auf, warum sich diese Unterschiede entwickelt haben bzw. woher sie stammen. Hierzu können zum einen soziokulturelle, auf die in dieser Arbeit nicht eingegangen wird, als auch biologisch begründbare Einflüsse, auf die im Folgenden eingegangen wird, benannt werden.
2.1.2 Hirnstrukturelle Geschlechtsdimorphismen
Das menschliche Gehirn ist für jegliche Verarbeitung von afferenten und efferenten Reizen verantwortlich. Es hat bezüglich der grundlegenden anatomischen Strukturen bei beiden Geschlechtern einen einheitlichen Aufbau. Oberflächlich betrachtet gibt es zunächst keine Unterschiede bei Männern und Frauen, man kann das Gehirn, welches zusammen mit dem Rückenmark das Zentralnervensystem bildet, in fünf große Abschnitte unterteilen (siehe Abb. 4).
Die Medulla oblongata (Verlängertes Mark) wird meist, aufgrund der räumlichen Nähe, mit der Brücke (Pons) zusammen genannt. Durch diese Strukturen werden unter anderem vegetative Funktionen, wie Schlucken, Atmen oder der Blutkreislauf, gesteuert (CAMPBELL 2000). Weiterhin gibt es das Mesencephalon (Mittelhirn), das Diencephalon (Zwischenhirn), das Cerebellum (Kleinhirn) und das Telencephalon (Großhirn).
Das Mesencephalon „kann als Schaltzentrum angesehen werden, von dem aus die codierten sensorischen Informationen an bestimmte Regionen des Vorderhirns gesendet werden.“ (CAMPBELL, 2000, S. 1106). Afferente Impulse werden also vom Mittelhirn weitergeleitet.
Das Diencephalon kann in Epithalamus, Hypothalamus sowie die paarige Struktur des Thalamus unterteilt werden. Der Thalamus beinhaltet verschieden funktionelle Kerne, die unterschiedliche sensorische Informationen weiterleiten (ebd. 2000). Im Hypothalamus werden Körperfunktionen wie Atmung, Kreislauf, Nahrungsaufnahme und Körpertemperatur, also Funktionen, die die Homöostase eines Organismus betreffen, geregelt. In dessen Nähe liegt basal die Hypophyse, welche unter anderem an der Ausschüttung von ACTH, auf welches im Abschnitt 2.4.3 eingegangen wird, regelt. Der Thalamus leitet fast alle einkommenden sensorischen Reize an die Großhirnrinde weiter.
Dem Kleinhirn kommen vor allem motorische Aufgaben zu. Haltung und Bewegung, Blickmotorik sowie die Feinmotorik werden von hier aus gesteuert (TREPEL, 2007). Das Kleinhirn steuert somit Koordination und Bewegungsabläufe.
Das Großhirn wird in zwei Hemisphären unterteilt, die durch den Balken miteinander verbunden sind (ebd., 2007). Sulci (Furchen) und Gyri (Windungen) charakterisieren die Oberfläche des Telencephalon. Weiterhin ist im Großhirn das limbische System, welches hauptsächlich für emotionale und vegetative Reaktionen des Organismus verantwortlich ist, verortet (ebd., 2007).
Wenn auch der funktionelle Aufbau des männlichen und weiblichen Gehirns gleich ist, so gibt es trotzdem Unterschiede. Das männliche Gehirn ist im Durchschnitt schwerer und größer als das weibliche (ALOISI, 2007). Ebenfalls wurde durch Studien festgestellt, dass die Dichte und Anzahl der Neuronen im Kortex bei Männern höher sind, was darauf zurückzuführen ist, dass der höhere Testosteronspiegel der Männer die Apoptose der Neuronen, vor allem in der Zeit der embryonalen Entwicklung, hemmt (ebd., 2007). Man vermutet, dass kognitive Unterschiede durch die verschiedenen Sexualhormone, bzw. deren unterschiedlichen Konzentrationen, beeinflusst werden (GÜNTÜRKÜN, HAUSMANN, 2007). Der pränatale Einfluss von Sexualhormonen beeinflusst demnach eine geschlechtsdimorphistische Entwicklung des Gehirns (KAWATA, 1995, zitiert nach GÜNTÜRKÜN, HAUSMANN, 2007).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4 Die Abschnitte des erwachsenen menschlichen Gehirns
Quelle: PINEL, J. P. J. ; PAUL, P. (Hg.), (2007)
Frauen hingegen haben mehr kortikale Windungen (ARNOLD, 2007) und verfügen über eine gleichmäßige Verteilung der grauen Substanz, die bei Männern in der linken Hemisphäre höher ist (CRAIG & LOAT, 2007). Daraus folgend weisen Frauen eine geringere Lateralisierung als Männer auf. Bei Schädigungen der linken Hemisphäre der Männer kommt es zu verbalen Problemen, welche bei Störungen der rechten nicht auftreten. Bei Frauen werden verbale Aufgaben durch Störungen beider Hemisphären beeinträchtigt (ebd., 2007).
Auf der Grundlage der geschlechtstypischen Lateralisierung und der unterschiedlichen kognitiven Leistungen wurden Untersuchungen durchgeführt, die einen möglichen Zusammenhang zwischen den geschlechtlichen Unterschieden der Asymmetrien mit denen der kognitiven Leistungen herstellten (GÜNTÜRKÜN, HAUSMANN, 2007). „ Für die Geschlechtsunterschiede des Neokortex existiert momentan noch kein klares funktionelles Korrelat, aber wahrscheinlich sind sie, ähnlich wie die zerebralen Asymmetrien, an der Generierung kognitiver Geschlechtsunterschiede beteiligt […]“ (ebd., S. 100).
2.2 Geschlechtsentwicklung des Menschen
2.2.1 Männlich oder weiblich? – Die Geschlechtsentwicklung
Ob ein Fötus sich zu einem männlichen oder weiblichen Organismus entwickelt, wird in erster Linie durch das chromosomale Geschlecht bestimmt. „Daher werden Personen mit zwei X-Chromosomen (XX) als weiblich, Individuen mit der Kombination von X- und Y-Chromosomen (XY) dagegen als männliche angesehen“ (ALOISI, 2007, S. 4). Nach der Fusion von Eiund Spermienzelle wird die diploide Zygote somit durch eine der beiden Kombination der Geschlechtschromosomen charakterisiert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5 Geschlechtsentwicklung beim Säuger Quelle:www.de.wikipedia.org/wiki/Bild:Genitalentwicklung_bei_S% C3A4ugern.PNG
Der Embryo besitzt in seinen frühen Stadien zunächst, unabhängig vom chromosomalen Geschlecht, ein so genanntes Ur-Genitalsystem. Zu dieser Zeit ist er hinsichtlich der Ausprägung seiner Geschlechtsorgane noch indifferent, er ist also bisexuell angelegt. Ein Embryo entwickelt sich zu einem Mann, da sich auf seinem Y-Chromosom Gene befinden, die auf dem zweiten X-Chromosom der Frau nicht auftauchen (KLEI NE, ROSSMANITH, 2007). Dem auf dem Y-Chromosom befindlichen SRY Gen (sex Region Y) kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Durch das Ablesen dieses Gens bildet der Embryo Enzyme, die im Folgenden das Hormon Testosteron synthetisieren (ebd., 2007).
Folglich werden typisch männliche Zellen, die Sertolliund Leydig- Zellen, ausgebildet. Aus den im Embryo angelegten Wolff´schen Gängen entwickeln sich Samenleiter, Hoden und Hodensack (siehe Abb. 5). Weiterhin wird in den Sertolli Zellen das so genannte Anti-Müller- Hormon gebildet, welches eine Rückbildung der Müller´schen Gänge bewirkt (MÜLLER, 2004).
Ist das SRY -Gen nicht vorhanden, so entwickelt sich der Embryo zu einem weiblichen Organismus. Entfernt man beispielsweise dieses Gen bei männlichen Mäusen, so bilden diese Eierstöcke aus. Umgekehrt haben weibliche Mäuse, wenn das SRY -Gen in ihrem Genom eingebaut wird, Hoden (ARNOLD, 2007). Fehlt also das SRY -Gen, so entwickeln sich aus den Müller´schen Gängen die Tuben, Uterus und Vagina, sowie aus den Gonadenanlagen die Ovarien, die Wolff´schen Gänge werden zurückgebildet (KLEINE, ROSSMANNIT, 2007).
Die Ausbildung von Hoden im Fötus hat zur Folge, dass diese während und auch nach der Embryonalphase Testosteron produzieren. Werden weibliche Föten einem erhöhten Testosteronspiegel im Mutterleib ausgesetzt, so kommt es zu einer Vermännlichung dieser (ARNOLD, 2007; KLEINE, ROSSMANITH, 2007). Testosteron hat also einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Embryonen.
Testosteron gehört zu den dominierenden androgenen Geschlechtshormonen im männlichen Organismus und ist im Wesentlichen daran beteiligt, die Entwicklung der primären Geschlechtsmerkmale auszubilden. Aber auch im weiblichen Organismus kommen geringe Konzentrationen dieses Hormons vor. Zu den weiblichen Geschlechtshormonen gehören vor allem die Östrogene, die teilweise aus Testosteron gebildet werden, und die Gestagene (siehe Abb. 6). Beide weiblichen Hormone wiederum kommen in geringen Konzentrationen auch im männlichen Organismus vor. In der frühen prä- und postnatalen Entwicklung ist der Testosteronspiegel im männlichen Organismus weitaus höher als im weiblichen (KIMURA, 1999). Es wird vermutet, dass dies einen erheblichen Einfluss auf die organi-sationale, d.h. langfristige Entwicklung des Gehirns, welches in dieser Zeit hierfür besonders empfänglich ist, hat (ebd, 1999). Die meisten Geschlechtshormone gehören zu den Steroiden, die aus Cholesterol synthetisiert werden (siehe Abb. 6).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6 Sexualhormone und ihre Verwandtschaft Quelle: Purves, (2006), S.1006
Geschlechtshormone und auch die dazu gehörigen Rezeptoren sind demnach in typischen Konzentrationen im männlichen als auch im weiblichen Organismus vorhanden. Sie werden vor allem in den Gonaden, jedoch auch in der Nebennierenrinde und im Gehirn produziert und dann über das Blut im menschlichen Körper zu den Zielzellen gebracht (MÜLLER, 2004).
2.2.2 Wirkung der Geschlechtshormone auf das menschliche Gehirn
Die bereits beschriebenen Geschlechtshormone üben ebenfalls im Gehirn eine Wirkung aus. Viele Hormone können die Blut-Hirn-Schranke überwinden und somit an Rezeptoren im Gehirn binden. Aber auch das Gehirn selber produziert geringe Mengen an Geschlechtshormonen.
„Gonadenhormone haben eine niedrige Molekularmasse (270-379 KDa) und sind ausreichend lipophil, um die Blut-Hirn-Schranke durch einfache Diffusion passieren zu können“ (ALOISI, 2007).
Dabei sind Hormonwirkungen immer spezifisch, denn sie benötigen die richtigen Rezeptoren um wirken zu können. Organisierende Effekte treten, wie bereits erwähnt, schon während der embryonalen Entwicklung auf. Im adulten Stadium haben die Geschlechtshormone aktivierende Effekte (ebd., 2007). Studien haben gezeigt, dass beispielsweise Östradiol entzündungshemmende Eigenschaften aufweist, welche Gehirnschäden in bestimmten Maße entgegenwirken können (ebd., 2007).
Eine Untersuchung an weiblichen Meerschweinchen, die im Embryonalstadium künstlich einem erhöhten Testosteronspiegel ausgesetzt waren, ergab, dass diese im geschlechtsreifen Alter vermännlichte Verhaltensweisen während der Kopulation zeigten (ARNOLD, 2007). Dieses Ergebnis ließ die Forscher davon ausgehen, dass „eine relativ kurze Einwirkungsphase von Testosteron im Fötalstadium [ausreichte] um das Gehirn zu differenzieren“ (ebd., 2007, S.25). Weitere Studien, unter anderem von RAISMANN UND FIELD (1971, 1973), bestätigten die Annahme, dass Geschlechtshormone einen Einfluss auf eine sexuell dimorphe Ausprä- gung der Gehirnfunktionen haben. Testosteron kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu. Die „Einwirkung fördert die Ausbildung anatomischer Geschlechtsunterschiede und in der Folge geschlechtlich dimorphe Verhaltensweisen und Funktionen“ (GOY U. MCEWEN, 1980 zitiert nach CRAIG, LOAT, 2007).
Weitere Belege für den Einfluss von Geschlechtshormonen auf das menschliche Gehirn wurden bereits in Kapitel 2.1.1 und 2.1.2 erläutert.
2.2.3 Geschlechtshormone und das Aggressionsverhalten
Auch hinsichtlich des aggressiven Verhaltens eines Individuums kommt dem Steroid Testosteron eine wichtige Bedeutung zu. Die oberste Koordinationseinheit für aggressives Verhalten ist der Hypothalamus des menschlichen Gehirns.
Eine hohe Produktion von Testosteron, wie sie beispielsweise bei jungen Männern vorkommt, führt nicht selten zu einem erhöhten Aggressionslevel dieser, sie reagieren hinsichtlich physischer und verbaler Aggressionen stärker (BIRBAUMER, SCHMIDT, 2006). Ein weiterer Hinweis dafür, dass Testosteron hier maßgeblich verantwortlich ist, lässt sich durch Tierstudien liefern. Hier wurde festgestellte, dass weibliche Tiere, die ein hohes Testosteronniveau aufweisen, wie beispielsweise Hyänen, weitaus aggressiver sind als diejenigen mit einem niedrigeren Testosteronspiegel (ebd., 2006). Dies wird auch durch Studien an Ratten bestätigt. Weibliche Ratten, denen nach der Geburt Testosteron gespritzt wurde, reagierten gleichermaßen (FRANK, 1997). Konträr reagierten männliche Ratten, die kastriert und somit der Produktion der Geschlechtshormone durch die Gonaden beraubt wurden, mit einem verminderten Aggressionsverhalten (CRAIG, LOAT, 2007).
Einen Zusammenhang zwischen einem höheren Testosteronspiegel und einem erhöhten Aggressionslevel hat man auch bei Menschen nachweisen können. HANNAN ET AL. wiesen in einer Studie nach, dass Testpersonen, denen sechs Wochen lang Testosteron zugeführt wurde, feindseliger und aggressiver waren, als die Kontrollgruppe.
Aggressives Verhalten kommt bei Tieren wie auch beim Menschen vor. Viele Tierversuche bestätigen, dass es einen Zusammenhang mit einem erhöhten Aggressionspotential und dem Testosteronspiegel des Individuums gibt (TURNER, 1994, zitiert nach CRAIG, LOAT, 2007).
Diese Ergebnisse sind jedoch nicht eins zu eins auf den Menschen übertragbar. Während eine positive Korrelation zwischen aggressivem Verhalten 12 bis 13 jähriger Jungen und einem erhöhten Testosteronniveau aufgedeckt wurde, haben andere Studien, die dies bei 15 bis 16 jährigen männlichen Probanden untersuchten, nicht bestätigt (TURNER, 1994, zitiert nach CRAIG, LOAT 2007).
Betrachtet man jedoch aggressives Verhalten in Bezug auf die geschlechtlichen Unterschiede, so ist es nicht verwunderlich, wenn männliche Probanden in der Regel, aufgrund ihres natürlich höheren Testosteronspiegels, aggressiver reagieren als Frauen, die natürlicherweise einen niedrigeren Testosteronspiegel haben (VAN GOOZEN ET AL., 1995, zitiert nach BENDERLIOGLU ET AL. 2004). Studien von HANNAN ET AL. (1991) untersuchten Probanden denen sechs Wochen lang Testosteron gespritzt wurde. Diese zeigten ein weitaus aggressiveres und feindseligeres Verhalten als die Kontrollgruppe.
Wenn nun das Fingerlängenverhältnis durch die Anwesenheit von Testosteron beeinflusst wird (siehe Kapitel 2.3.1), kann man dann auch einen Zusammenhang zwischen dem 2D:4D Quotienten und einem erhöhten Aggressionslevel feststellen?
Einem möglichen Zusammenhang zwischen dem 2D:4D Quotienten und verbaler Aggression soll in der vorliegenden Studie unter anderem nachgegangen werden.
[...]
- Arbeit zitieren
- Ulrike Weiß (Autor:in), 2008, Ist das Fingerlängenverhältnis (2D:4D) der Frau ein morphometrisches Korrelat für Arachnophobie?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121087
Kostenlos Autor werden


















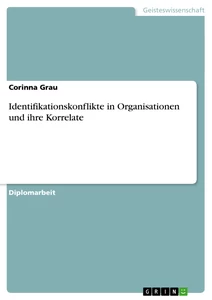

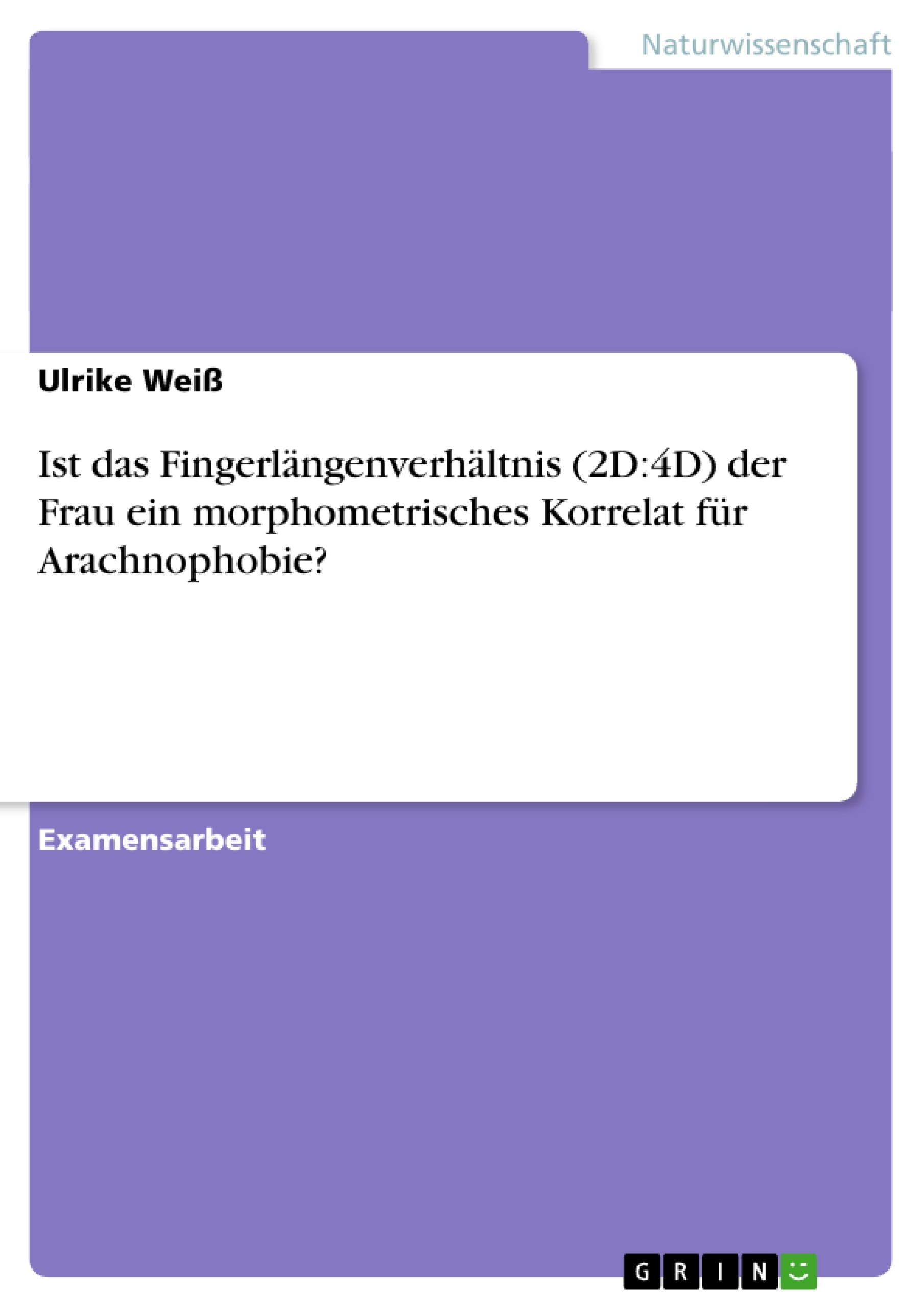

Kommentare