Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
0.Einleitung
0.1 Ausgangslage
0.2 Tiedemann: Sensualismus und Funktionalismus
0.3 Inhaltsverzeichnis von Tiedemanns Versuch einer Erklärung des Ursprungs der Sprache
1. Eine funktionalistische Sprachtheorie
1.1 Grundlegung einer funktionalistischen Theorie der Sprache
1.2 Funktion und Form
2. Eine funktionalistische Sprachursprungstheorie
2.1 Möglichkeit – Notwendigkeit– Wirklichkeit
2.2 Form und Funktion
3. Zusammenfassung und Schlusswort
4. Literaturliste
4.1 Tiedemanns Schriften
4.2 Zitierte Literatur
0. Einleitung
0.1 Ausgangslage
Mit seiner 1710 erschienenen Brevis designatio meditationum de originibus gentium ductis potissimum ex indicio linguarum (Kurze Schilderung der Erwägungen zur Herkunft der Völker, die sich am ehesten aus dem, was die Sprachen zu erkennen geben, ableiten läßt) hat Leibniz eine Auseinandersetzung über den Ursprung der Sprache angestoßen, die gewiß zu den Marksteinen in der Geschichte der Preußischen Akademie zählt. Das Problem fand im 18. Jahrhundert nicht nur das Interesse von Spezialisten, sondern berührte den Kern der philosophischen Debatte über die Natur des Menschen und seine Stellung im Universum. [...] Nach Herders berühmter Abhandlung (1792) blieb die Berliner Akademie der Ort, an dem hierüber debattiert wurde, etwa anläßlich der Akademievorträge von Grimm (1851) und Schuchardt (1920). (BBAW-Internetseite)
Diese Worte stammen aus der Einleitung zum Programm der Internationalen Tagung zum Ursprung der Sprache, die in der Zeit vom 16. bis zum 18. Dezember 1999 in der Berlin-Brandenburgischen (ehemals Königlich-Preußischen) Akademie der Wissenschaften (BBAW) stattfindet.
Zwei Punkte in diesem Zitat ziehen die Aufmerksamkeit des in Sprachursprungstheorien interessierten Wissenschaftlers: Leibniz wird hier als derjenige angesehen, der die Diskussion in Gang brachte; und – was für diese Seminararbeit eine größere Rolle spielt – für die Zeit der deutschen Aufklärung wird Herder als die Autorität schlechthin in Sache Sprachursprungstheorie dargestellt.
Dies wird in der zitierten Passage freilich nicht für die Gesamtproblematik, sondern nur im Rahmen der Geschichte der Berliner Akademie postuliert, innerhalb derer Leibniz und Herder bekannter- und unbestrittenermaßen eine wesentliche Rolle gespielt haben: Die Gründung der Akademie im Jahre 1700 ist auf Leibniz ens Plänen zurückzuführen; dessen in der oben zitierten Passage erwähnter Artikel Brevis designatio... eröffnet die erste wissenschaftliche Publikation der Akademie, die Miscellanea Berolinensia[1]; Herder gewann mit seiner Abhandlung über den Ursprung der Sprache die Preisfrage der Akademie für das Jahr 1770 (Herder 1772).
Die Aussagen in diesem Zitat beziehen sich also nur auf die Verhältnisse innerhalb der Akademie. Sie entsprechen aber auch einer in der Literatur zu der Geschichte der Sprachwissenschaft im allgemeinen und den Sprachursprungstheorien insbesondere ziemlich verbreiteten Perspektivierung der Dinge, in der einige wenige ausgezeichnete Namen einer Epoche immer wieder hervorgehoben, während viele andere gerade einmal mit einer kurzen Erwähnung gewürdigt werden, wenn dies überhaupt geschieht.
So sind z.B. in den von Gessinger/Rahden 1989 herausgegebenen Theorien zum Ursprung der Sprache gleich mehrere Artikel zu finden, in denen Herder entweder als Hauptgegenstand oder zumindest als Gegenstand mehr oder minder direkter Bezugnahme erscheint. Es überrascht nicht, dass der andere in diesem Werk gewürdigte Name für das Deutschland des 18. Jahrhunderts der von Leibniz ist.
Auch in den Akten zur vierten, 1987 in Trier realisierten International Conference on the History of the Language Sciences (ICHoLS IV), herausgegeben von Niederehe/Koerner 1990, befassen sich die Artikel über deutsche Sprachphilosophie im 18. Jahrhundert nur oder hauptsächlich mit Leibniz und Herder.
Angesichts dieser Konstellation bildet Rickens Gesamtdarstellung zur Sprachphilosophie der europäischen Aufklärung eine willkommene Ausnahme: Ricken beschäftigt sich im Kapitel zur deutschen Sprachphilosophie (Ricken 1990a) lieber mit Christian Wolff als mit Leibniz und im Abschnitt zum Sprachursprung berichtet er nicht nur über Herders, sondern auch über Adelungs Gedanken ausführlich. Eine andere willkommene Ausnahme ist der von Haßler/Schmitter 1999 herausgegebene Band Sprachdiskussion und Beschreibung von Sprachen im 17. und 18. Jahrhundert, in dem Leibniz zwar wieder einmal große Würdigung erfährt, der aber auch Jutta Steinmetzens Artikel mit dem vielsagenden Titel Im Schatten Herders. Johann Peter Süßmilchs Sprachursprungstheorie beinhaltet.
Und gerade was Theorien zum Sprachursprung angeht, bieten die Arbeiten von einigen deutschen Gelehrten des 18. Jahrhunderts, wie den erwähnten Adelung und Süßmilch 1766, aber auch Fichte 1795 oder eben Tiedemann 1772, um nur einige Namen zu erwähnen, höchst interessante und nicht selten für die moderne Sprachwissenschaft fruchtbare Fragestellungen und Ansätze an. Trotzdem haben diese Autoren wenig Eingang in die Sekundärliteratur gefunden. Mit Ausnahme von Süßmilch, der oft mit einigen Zeilen bedacht wird, wenn von Herder die Rede ist, und vom oben erwähnten Fall Adelung bei Ricken 1990a und Süßmilch bei Steinmetz 1999, herrscht in den von mir bekannten Gesamtdarstellungen und Papieren zu Konferenzen eine gewisse Indifferenz gegenüber diesen Autoren.
Zwar leistet z.B. die Zeitschrift Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft (BGS), Organ des StudienkreisesGeschichte der Sprachwissenschaft und des WerkverbandsGeschiedenis van de Taalkunde, seit ihrer ersten Ausgabe (1991) wertvolle Beiträge zur Verbesserung der Lage der Sekundärliteratur zur Geschichte der Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie zu vervollständigen, indem neuere Forschungsergebnisse veröffentlicht werden[2]. Aber noch wird die Bedeutsamkeit vieler Denker unter Sprachwissenschaftshistorikern weiterhin verkannt.
Die Situation der Primärliteratur ist nicht viel besser. So wurde Süßmilchs Versuch eines Beweises, daß die erste Sprache ihren Ursprung nicht von Menschen, sondern vom Schöpfer erhalten hat (1766) 1998 zwar wieder neugedruckt, der Band ist allerdings in öffentlichen Bibliotheken der Bundesrepublik so gut wie nicht zu finden [3] . Die Berliner Staatsbibliothek besitzt zwei Exemplare der Originalausgabe von 1766, die trotz OPAC-Angabe „Kriegsverlust möglich“ doch in gutem Zustand erhalten sind, auch wenn der Zugang zu den Bänden aber alles andere als einfach ist. Noch nicht einmal die Bibliothek der Berliner Akademie der Wissenschaften besitzt ein Exemplar davon, noch ist die Schrift in der zwischen 1746 und 1771 von der Akademie herausgegebenen Schriftenreihe Histoire de l'Académie Royale[4] erschienen, obwohl Süßmilchs Versuch die Druckform zweier Vorträge darstellt, die er 1756 an der Akademie gehalten hatte (vgl. Hartung 1977:85).
Was Tiedemanns 1772 oder Fichtes 1795 Abhandlungen zum Sprachursprung angeht, wäre die Reihe History of linguistics: 18th and 19th Century German Linguistics 1995 nicht herausgegeben worden, hätte man heutzutage kaum die Möglichkeit, diese Werke im Originaltext zu lesen.
Mir ist außerdem unbekannt, wo Adelungs Primärtexte zu finden sind.
0.2 Tiedemann: Sensualismus und Funktionalismus
Angesichts der oben geschilderten Literatur- und Forschungslage möchte ich mit diesem Aufsatz einen Beitrag zur Forschung der deutschen Sprachphilosophie in der Zeit der Aufklärung insofern leisten, als hier Dietrich Tiedemanns weitgehend unbekannter Versuch einer Erklärung des Ursprunges der Sprache, der 1772 – also in demselben Jahr, in dem Herders viel gefeierte Abhandlung ebenfalls veröffentlicht wurde – in Riga erschien, diskutiert wird.
Dietrich Tiedemann (1748-1803)[5], der in Göttingen Mathematik, Philosophie, Theologie und Klassische Literatur studierte, in Riga als Hofmeister der Kinder des Barons Bubberg tätig war (1769-1774), 1776 auf Empfehlung vom Philologen Heyne zum Professor des Lateins und Griechischen am Collegium Carolinum in Kassel ernannt wurde und zehn Jahre später eine Professur für Philosophie an der Marburger Universität erhielt, der außerdem als Mitbegründer der Kinderpsychologie gilt und auch in Kontakt zum Philosophen und Psychologen Tetens stand, besticht in seinem Versuch durch die Aufstellung einer Theorie der Sprache, die Ansätzen aus Antike, Spätmittelalter und natürlich auch Aufklärung verpflichtet ist, und gleichzeitig modern anmutende Schlussfolgerungen und Annahmen beinhaltet.
Tiedemann, der durch den Einfluss seines Jugendfreundes Meiners die Theologie aufgab und sich der philosophischen Literatur widmete, schließt an sensualistische Auffassungen zu Erkenntnis und Sprache in der Antike und im 18. Jahrhundert an, ist mit Ansätzen der Grammatica speculativa offenbar bestens vertraut, und stellt anhand dieser Voraussetzungen Hypothesen zur Erklärung sprachlicher Strukturen sowohl im phylogenetischen als auch im ontogenetischen Sinne auf, die an die aktuellen funktionalistischen Bemühungen, den Anspruch nach Erklärungsadäquatheit grammatischer Theorien zu genügen, denken lässt. Da Tiedemanns Fragestellung Phylogenese und Ontogenese betreffen, bettet er seine Theorie zum Ursprung der Sprache in eine ausführliche allgemeine Sprachtheorie ein.
Die vorliegende Arbeit wird deshalb, wie Tiedemanns Versuch, in zwei große Abschnitte gegliedert: Im ersten Abschnitt wird seine Sprachtheorie dargelegt, bevor seine Gedanken zur Erfindung der Sprache erörtert werden.
0.3 Inhaltsverzeichnis von Tiedemanns Versuch einer Erklärung des Ursprungs der Sprache
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Eine funktionalistische Sprachtheorie
1.1 Grundlegung einer funktionalistischen Theorie der Sprache
Die Frage von dem Ursprunge der Sprache ist bereits vom Epikur und nach ihm vom Lukrez behandelt worden, obgleich nicht in ihrem ganzen Umfange. Lukrez sagt nur, daß wie die Thiere, so auch die Menschen bey gewissen Gelegenheiten Töne hervorbringen, daß aus diesen Tönen endlich die Sprache entstanden sey, daß die Worte nicht von einem allein, sondern von verschiedenen Menschen erfunden sind. Wie die verschiedenen Theile, die eine Sprache ausmachen, erfunden sind, wie nach und nach Ordnung in die Sprache gekommen ist, und aus welchen Ursachen alles dieses geschehen ist, davon berühret er nichts. (Vorrede, 2V., Hervorhebungen im Original)[6]
So der Wortlaut vom ersten Absatz der Abhandlung Tiedemanns zum Ursprung der Sprache, der für sie programmatisch ist. Darin sind Tiedemanns Grundgedanken und Anliegen in kondensierter Form zu finden.
Tiedemann knüpft zunächst einmal an sensualistische Ansätze an. Es wird in der Passage zwar nicht klar, dass die Epikureer die Erfindung der Sprache durch die Menschen über den Weg der Empfindungen und Sinneswahrnehmungen, also durch Eindrücke, sehen; der Philosophiehistoriker Tiedemann muss das aber sicherlich gewusst haben.
Dabei ist es bemerkenswert, dass er in dieser eröffnenden Passage nicht etwa zeitgenössische Autoren, deren Arbeit er sicherlich kannte, sondern antike Autoren erwähnt. Wenn Tiedemann dieses tut, wenn er also Epikur und Lukrez im Zusammenhang mit der Frage nach dem Sprachursprung erwähnt, will er zunächst einmal verdeutlichen, dass diese Frage alles anders als neu ist, wie es in der folgenden Passage klar wird:
Diejenigen, die für die Vorzüge der neuern Weltweisheit eingenommen sind, ohne sich um die Geschichte der ältern bekümmert zu haben, werden sich wundern, daß eine Frage, die erst in unsern Zeiten aufgeworfen zu seyn scheint [d.h. die Sprachursprungsfrage; S.B.], schon so alt ist. (Vorrede, 2R.)
Zwei Fragen histori(ographi)scher Natur drängen sich hier allerdings auf:
1. Will Tiedemann hier auf die Debatte um den Sprachursprung andeuten, die an der Berliner Akademie hauptsächlich seit Maupertuis ausgetragen worden war und nun durch Herders preisgekrönte Abhandlung als abgeschlossen galt?
2. Wenn Tiedemann auf das Alter dieser Debatte verweisen will, warum nennt er nicht eher Platon, der in seinem fast hundert Jahre vor Epikur verfassten Kratylos die ihrerseits noch viel ältere Kontroverse physis-thesis in gebündelter Form diskutiert?
Die Antwort auf die erste Frage lautet: „Ja“. Denn man darf sicherlich davon ausgehen, dass der sonst aufmerksame Tiedemann, der von 1767 bis 1769 in Göttingen studierte und zwischen 1769 und 1773 in Riga lehrte, über die Berliner Sprachursprungsdebatte mehr oder minder gut informiert war. Maupertuis und Süßmilch werden auch in diesem Zusammenhang mehrmals genannt, obwohl man bei der Lektüre des Tiedemannschen Versuch s den Eindruck hat, dass Tiedemann die Abhandlung Süßmilchs entweder selber nicht gelesen, oder aber bei der Verfassung seiner eigenen Abhandlung kein Exemplar davon bei sich in Riga hatte[7].
Ob Tiedemann Herders Abhandlung kannte, ist allerdings eine noch schwierigere Frage. Selbst wenn er von der Preisfrage von 1770 und davon, wer sie gewonnen hat, wusste, so ist es trotzdem denkbar, dass ihm der Inhalt der preisgekrönten Abhandlung doch nicht bekannt war, wurde Herders Abhandlung 1772 doch in geringem Umfang veröffentlicht. Herder wird in Tiedemanns Versuch jedenfalls an keinerlei Stelle erwähnt.
Was die zweite Frage angeht, so darf man mutmaßen, dass Tiedemanns Auswahl auf die Epikureer deshalb fällt, weil diese sensualistische und kommunikationsfunktionalistische Komponenten in ihrer Darstellung zum Sprachursprung miteinander verbinden. Epikur (341-270) hat doch laut Diogenes Laertius die zu seiner Zeit schon Jahrhunderte währende Kontroverse Naturalismus vs. Konventionalismus durch die Hypothese gelöst, dass es dabei keine Kontroverse gebe, dass beide Hypothesen – wenn auch zeitlich versetzt – miteinander vereinbar seien: Die ersten Urwörter seien insofern natürlich, als die Menschen sie gemäß ihren „Eindrücken und Vorstellungen, wobei auch noch die Verschiedenheit der Wohnorte eine Rolle spielt“, erfunden haben; durch spätere Konvention aber „hat jedes Volk gemeinsam die ihm eigenen Ausdrücke festgelegt“ und zwar „um die Mitteilungen eindeutiger zu machen und um sich einander in kürzerer Form mitteilen zu können“ [8].
Diese physis-thesis -Kontroverse endet im Platonischen Kratylos dagegen aporetisch, in einer Weder-Noch-Behauptung, während bei Epikur eine Versöhnung beider Ansichten festzustellen ist, ein Sowohl-Als-Auch, was Tiedemanns Gedanken eher entsprechen.
Unwissenheit in bezug auf die zweite Frage kann man dem belesenen Historiker der Philosophie jedenfalls nicht unterstellen, er scheint doch da unmissverständlich durch, wo die Würdigung der „Alten“ gefordert wird. Dabei solle man sie doch nicht etwa in Auszugsform lesen. Man solle ihre Weisheit sozusagen in der Quelle und in volle Züge trinken. Nur so könne man ihren Verdienst in Punkto Auffassungsgabe wie Originalität würdigen:
Nach den Auszügen ihrer Systeme zu urtheilen, sollte man glauben, daß es sehr trocken um ihre Philosophie müsse ausgesehen haben. Liest man hingegen ihre Meynungen nebst ihren Beweisen in den Alten selbst: so erscheinen sie in einem ganz andern Lichte, und an statt sie zu verachten oder ihre Kenntniß für überflüßig zu halten, wird man mit der größten Hochachtung für ihre Scharfsinnigkeit erfüllet, und man wundert sich oft, sehr vieles, was man für neu, und erst kürzlich erfunden hielte, schon von den Alten entdeckt zu sehen. (Vorrede, 2R.f.)
Aber zurück zum ersten Absatz der Abhandlung. Es ist sehr interessant, wie Tiedemann hier fast nebenbei, innerhalb einer indirekten Rede nämlich, die Erfindung von Sprache durch die Menschen postuliert. Für das europäische 18. Jahrhundert, das noch vielfach zwischen christlichem Glauben und Säkularisierung in spekulativer und experimenteller Philosophie schwankte, ist die Hypothese von Sprache als menschlicher Erfindung noch keine Selbstverständlichkeit, auch wenn sie mehr und mehr an Terrain gewinnt. Man denke hier an die Position Süßmilchs, dass die Sprache ihren Ursprung in der göttlichen Schöpfung habe. Süßmilch stellt seine Annahme durchaus nicht als bloße Glaubensfrage dar, sondern er versucht, seine christlich basierte Ansicht, ganz im Sinne der Aufklärung, durch logisches Argumentieren zu untermauern (siehe hierfür Abschnitt 2.1 der vorliegenden Arbeit).
Für Tiedemann jedenfalls scheint die Hypothese des menschlichen Sprachursprungs selbstverständlich zu sein. Im Verlauf seiner Abhandlung geht es ihm allerdings nicht so sehr darum, diese Hypothese endgültig zu beweisen. Tiedemanns Anliegen ist ein ganz anders: Nicht nur das Was, sondern eher das Wie (und das Warum) interessiert ihn. Man kann unter Verwendung einer anderen Ausdruckweise diese Aussage revidieren und sagen, dass Tiedemann das Was (die menschliche Hypothese) durch das Wie beweisen möchte, wie das im 2. Abschnitt problematisiert wird. Vgl. dazu Vorrede, S. 4:
Der Ursprung der Sprache, oder ihre Entstehungs-Art, oder, bestimmter zu reden, die Art und Weise, wie die Sprache von Menschen hat können erfunden werden, und wie sie wahrscheinlicher Weise ist erfunden worden, ist der Gegenstand dieser Abhandlung. (Vorrede, 4R.f.)
Es wurde oben erwähnt, wie sehr Tiedemann den Verdienst der „alten“ Denker anerkannt haben will, und wie er darauf hinweist, dass Epikur und Lukrez sich bereits mit der Frage nach dem Ursprung der Sprache beschäftigt haben. Gleichzeitig aber – wie man im ersten Absatz nachlesen kann – bemängelt er, dass sie sich nicht darum gekümmert haben, zu erklären, wie oder genauer: warum konkret Sprache entstand und entsteht.
Und dieses ist es, was Tiedemann interessiert: herauszufinden bzw. Hypothesen darüber aufzustellen, welche praktische Motivationen zur Erfindung von konkreten sprachlichen Formen geführt haben. Tiedemann bietet dabei ein funktional-pragmatisches Verständnis von Sprache an, das man heute ‚ikonisch‘ nennen möchte[9].
Wenn er nämlich im ersten programmatischen Absatz von den „verschiedenen Theile [n] , die eine Sprache ausmachen“ und von „Ordnung“ in der Sprache redet, so bezieht er sich auf die formale Seite von Sprache, es geht hier – wie wir noch sehen werden – v.a. um die Wortarten (die „Theile“) und ihrer Verknüpfung mittels der Morpho-Syntax (die „Ordnung“). Wenn er aber von den „Ursachen“, die die Entstehung der Wortarten und der syntaktischen Verknüpfung erklären, redet, so bezieht er sich auf präzise funktionale Motivationen, die Entstehung und Beschaffenheit erster sprachlicher Strukturen und ihren weiteren Ausbau bedingen.
Es wird bereits hier deutlich, dass Tiedemann um ein zeichentheoretisches Verständnis von Sprache bemüht ist. Mehr noch, Tiedemann erkennt eine semiotische Beziehung zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem. Diese Beziehung versteht Tiedemann allerdings nicht in dem Arbitraritätssinn, wie über 100 Jahre später von Saussure bzw. dessen Schülern und Interpreten angenommen, aber eigentlich schon seit der Antike immer wieder tradiert, in dem Arbitrarität irrtümlicherweise mit der Konventionsthese gleichgesetzt wird[10]. Die Beziehung zwischen signifiant und signifié ist bei Tiedemann eindeutig eine ikonische, also gerade stets motivierte, aber erst durch Konvention institutionalisierende Beziehung zwischen sprachlicher (v.a., aber nicht nur, grammatischer) Form und derer (funktional-pragmatischer) Funktion. Dies wird in Tiedemanns direkter Forderung nach einer Gegenstandsdefinition, wie Sprache charakterisiert werden soll, noch einmal deutlich:
Kann man die Enstehungs-Art der Sprache erklären, wenn man nicht weiß, was sie ist? Kann man überhaupt den Ursprung irgend einer Sache deutlich machen, wenn man von ihr keinen Begriff hat? Nein. [...] Wir reden alle eine Sprache, allein daraus folgt noch nicht, daß wir auch die innere Beschaffenheit der Sprache, ihre Theile, und den Zusammenhang der Theile, nebst ihrer Absicht, einsehen. (Vorrede, 5V.)
Noch einmal ist hier die Andeutung auf die Beziehung zwischen (v.a. morphosyntaktischer) Form („Beschaffenheit der Sprache, ihre Theile, und den Zusammenhang der Theile“) und ihrer Funktion („ihrer Absicht“) zu finden. Und spätestens hier wird klar, dass Tiedemanns Theorie zum Sprachursprung nur eingebettet in eine allgemeine, funktionalistisch basierte Theorie der Sprache denkbar ist. Und er beklagt sich darüber, wie wenig in den „philosophischen Untersuchungen“ diesem ikonischen Charakter der Sprachen Rechnung getragen wird:
Wir haben noch zu wenig philosophische Untersuchungen über besondere Sprachen, worinn von allen ihren Beschaffenheiten, Regeln und Gesetzen ein richtiger Grund angegeben würde. (Vorrede, 8V.)
Einer diachronen Theorie des Sprachursprungs muss also eine synchrone Beschreibung von dem vorausgehen, was eine Sprache als voll ausgebildetes und gut funktionierendes System ist bzw. sein muss.
Tiedemann – wie Süßmilch und andere deutschsprachige Sprachphilosophen der zweiten Hälfte des 18. Jhs. – benutzt hierfür den Begriff der ‚Vollkommenheit‘. Nach Tiedemann wird dieser Begriff folgendermaßen verstanden: Eine Sprache verdiene erst das Prädikat „vollkommen“, wenn sie den höchsten Maß an Formvollendung („gebildet“, „schön“) und Funktionalität der Formen („brauchbar“, „nützlich“) erreicht hat, wie das z.B. bei bestimmten europäischen Sprachen der Fall sei:
Die Europäischen Sprachen [...] werden von allen für die gebildesten und brauchbarsten gehalten. Wir wollen also sie zum Muster wählen, und nach ihnen die Eigenschaften einer Sprache überhaupt, wenn sie schön und nützlich seyn soll, bestimmen. (Vorrede, 6R.)
Tiedemanns Bemühung um eine funktional-pragmatische Theorie der Sprache, die auf den unmittelbar beobachtbaren Beschaffenheiten der „gebildesten Sprachen“ basiert, ist in folgender Passage noch deutlicher :
Denn von diesen [d.h. den „gebildesten“ Sprachen, S.B.] kann man zuverläßig behaupten, daß sie alles in sich enthalten müssen, was einer Sprache zukommen muß, wenn sie vollkommen verständlich seyn soll. Verbindet man mit dieser Art der Erfahrung die Theorie, und untersucht nach Grund-Sätzen, die aus der Natur des menschlichen Geistes genommen sind, warum diese Theile [d.h. die sprachlichen Strukturen, S.B.] da sind, und wozu sie dienen [d.h. welche Funktionen sie verwirklichen, S.B.]: so wird die Ueberzeugung von ihrer Unentbehrlichkeit noch größer, indem sich Erfahrung und Theorie die Hand bieten. (5f.)
Ich möchte an dieser Stelle die Aufmerksamkeit auf die unverkennbar eurozentristische Sicht Tiedemanns ziehen, der hier eine Einschränkung auf „die galanten Sprachen“ Europas vornimmt:
Ohne mein Erinnern wird man schon eingesehen haben, daß ich unter die Europäischen Sprachen nicht die Lappländische und andere erfrorne Mund-Arten verstehe, sondern nur die, die man die galanten Sprachen zu nennen pfleget. (Vorrede, 6R.f.)
Dieser Eurozentrismus wird übrigens gleich auf der nächsten Seite wieder relativiert, wenn er eine kurze Inhaltsangabe vom zweiten Teil seiner Abhandlung liefert, der vom Ursprung der Sprache im engeren Sinne handelt, und zwar insofern, als Tiedemann der diachronen Dimension von Sprache Rechnung trägt: Auch die „rohen“ Sprachen werden sich noch weiter entwickeln:
Hierauf wird gezeigt, wie die Menschen die Sprache allmählig ausgearbeitet, Ordnung und Zusammenhang darin eingeführt und sie vollkommen gemacht haben. [...] Wir haben zu wenig historische Nachrichten von den Sprachen, die noch ganz roh sind, und von der Art, wie sie sich allmählig ausbilden. (Vorrede, 7R.f.)
Die diachrone Dimension, die Tiedemann einbringt, wird allerdings auch gleich mit relativiert, indem er davon ausgeht, dass die „ galanten “ Sprachen sich nicht mehr weiter entwickeln, keinen Wandel mehr erfahren werden, da sie den höchsten Grad an Vollkommenheit erreicht haben.
Eine andere Frage, die sich hier stellt, ist außerdem, welche Sprachen genau Tiedemann mit „vollkommenen“, „ gebildesten “, „ galanten “ Sprachen meint. Andere Sprachen, als die sog. Kultursprachen, wie Latein, Griechisch und Französisch gehören sicherlich nicht dazu. Aber auch seine Muttersprache wird Tiedemann wohl dazu gezählt haben, andernfalls würde er sich nicht dermaßen bewusst um die Verbreitung einer deutschen Fachterminologie bemühen, in dem konkreten Fall für seine Lehre der Redeteile. Hier sind Parallelen zu Christian Wolff zu sehen, der bereits fast 50 Jahren vor ihm den Gebrauch des Deutschen als Wissenschaftssprache gefordert hatte. Und wie Wolff übersetzt auch Tiedemann die deutschen Termini durch die lateinischen, damit Erstere verständlich bleiben:
Es schien mir unschicklich zu seyn, in einer deutschen Rede lateinische Worte zu mischen, da wir schon gute deutsche haben, die eben das [d.h. die Redeteile, S.B.] anzeigen. Ueberdem ist die Bemühung, sich diese Worte bekannt zu machen, sehr klein, und um sie noch mehr zu erleichtern, werde ich in der Abhandlung selbst die lateinischen Nahmen dabey setzen. (7f.)
1.2 Funktion und Form
Aber zurück zur Theorie der Sprache. Sprachliche Strukturen existieren, um bestimmte Funktionen zu erfüllen, bestimmte Zwecke zu genügen. Was genau meint Tiedemann mit „Theilen der Sprache“ und mit dessen „Absicht“ ? Was ist genau die formale und die funktional-pragmatische Komponente der Sprache?
Ich habe bereits auf die Bedeutsamkeit der kommunikativen Funktion von Sprache im theoretischen Gebäude Tiedemanns angedeutet, und wie nach ihm dieses Prinzip der Zweckmäßigkeit die Erfindung und Ausbau von Sprachen durch die Menschen bedingt, (ja sogar erzwingt, wie wir noch sehen werden) . Wir haben auch gesehen, dass gerade diese Ansicht ihn bestimmten antiken eher als zeitgenössischen Denkern näher bringt, wurde im 18. Jh. die Kognition doch eher als die Kommunikation in den Vordergrund gestellt. Der Vorrang der kommunikativen Zweckmäßigkeit von Sprache bei Tiedemann wird in folgender Passage am deutlichsten:
Die Sprache wird zu etwas gebraucht. Das, wozu sie gebraucht wird, kann man ihre Absicht nennen, weil sie doch bloß um des Gebrauchs willen da ist. [...] Der Haupt-Gebrauch, oder die Haupt-Absicht der Sprache ist ohne Zweifel andern seine Gedanken zu erkennen zu geben, sie zu unterrichten, zu bitten, ihnen zu befehlen, mit ihnen zu berathschlagen, und sich zu vergnügen. Der Philosoph, der Dichter, der Redner, der Pöbel, alle, gebrauchen die Sprache in dieser Absicht. Dies lehren die Weltweisen, ein jeder giebt es zu [...]. (26f.)
Dies bedeutet aber nicht, dass Tiedemann die kognitive Funktion von Sprache und die wechselseitige Bedingtheit von Sprache und Denken etwa verkennt. Aber die Sprache wird nach ihm eher als ein Werkzeug verwendet, um immer komplexere „Reihen von Schlüssen“, Abstraktionen und Erkenntnisse behalten zu können, die aber primär durch die Sinneswahrnehmungen gewonnen werden. Ohne Sprache könne der Mensch nicht richtig denken. Aber nicht deshalb, weil es keine Vorstellungen und Erkenntnissen ohne Sprache geben könne, wie Süßmilch annimmt. Für Tiedemann sind erste Stufen einer Vernunft durchaus ohne Sprache möglich, wie wir noch ausführlich sehen werden. Ohne die Sprache könne der Mensch deshalb nicht richtig denken, weil er sie dafür als Gedächtnisstütze verwende und nur so zum Gebrauch seiner bereits vorsprachlich bestehender Vernunft komme (S. 33f.):
Daß ein Mensch ohne Sprache einzelne sinnliche Vorstellungen haben, daß er sich auch eine Art von Gemählde in seiner Einbildungskraft entwerfen kann, welches gewisse Sätze in sich fast, das läst sich begreifen, aber daß er sollte ganze Reihen von Schlüssen, von zusammenhängenden Wahrheiten sich denken können, das ist unbegreiflich. [...] Daß wir also unsern Verstand gebrauchen können, [...] dieses haben wir der Sprache zu danken. (32)
Mittels der Sprache kann der Mensch also im Geist und auf relativ rasche Weise Schussfolgerungen ziehen oder Hypothesen aufstellen über die materielle wie die geistige Welt, die auf dem Weg der Sinneswahrnehmung und der Erfahrung und bedingt durch das begrenzte Erinnerungsvermögen nur sehr mühsam oder vielleicht gar nicht erst zu gewinnen wären. Das Denken wäre also als eine Art Simulation von Erfahrung zu verstehen, für welche das Werkzeug Sprache unentbehrlich ist, wobei Denken und Sprache sich in ihrem weiteren Ausbau wechselseitig bedingen.
Aber es ist bezeichnend, dass Tiedemann die Rolle der Sprache für die Erkenntnis als allerletzte erwähnt. Zunächst einmal steht die kommunikative Funktion im Vordergrund. Danach kommt die institutionalisierende Funktion von (v.a. Schrift-) Sprache in Gesellschaft und Wissenschaft zur Vermittlung von alltagsweltlichen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, eine Funktion also, die auch als kommunikativ bezeichnet werden kann (31). Erst zum Schluss wird auf die Funktion von Sprache für das schöpferische Denken verwiesen.
Man kann aus den vorhergehenden Ausführungen schließen, dass für Tiedemann die kognitive Funktion der kommunikativen untergeordnet ist und bleibt, dass jeder Sprachgebrauch nur dann Sinn hat, ja sogar sich erst dann verwirklicht, wenn er aus dem Bedürfnis nach Kommunikation heraus entspringt. Der Mensch schaffe, entwickle und auch erlerne seine Sprache, nicht in erster Linie um Erkenntnisse über die Welt zu gewinnen, sondern vielmehr um diese Erkenntnisse seinen Mitmenschen mitteilen zu können. Dieses Mitteilungsbedürfnis, das bei Tiedemann ontogenetisch (Spracherwerb) wie phylogenetisch (Sprachursprung) verstanden wird, bedinge nun seinerseits die konkreten sprachlichen Formen in den verschiedenen Stufen der Erfindung, des Erwerbs und Wandels von Sprache, da diese Formen wiederum die Mittel zur Kommunikation darstellten.
Synchron gesehen, also in bezug auf seine Sprachtheorie, benutzt Tiedemann in diesem Zusammenhang den Begriff der ‚ Vollkommenheit‘, wie bereits erwähnt: Eine Sprache hat als System den höchsten Grad an Vollkommenheit erreicht, wenn sie optimal gebildete Strukturen für eine optimale Realisierung der kommunikativen Bedürfnisse innerhalb einer hochspezialisierten Gemeinschaft zur Verfügung stellt.
Welche Mittel genau muss nun eine Sprache aufweisen, um als „vollkommen“ gelten zu können? Diese sind nach Tiedemann:
-„allgemeine Ausdrücke“, „besondere Ausdrücke“, „Reichthum“, „Deutlichkeit“
- „Zierlichkeit“
- „ Biegsamkeit “, „ Theile der Sprache “ („ Nennwort “, „ Fürwort “, „ Zeitwort “, „ Bestimmungswort “, „ Wortfügung “)
Auch wenn Tiedemann diese Merkmale nicht so gliedert, wie oben dargestellt, so scheint er doch intuitiv ein modulares Verständnis von Sprache zu haben, wie es in der modernen Sprachwissenschaft spätestens seit Saussure üblich ist. Wenn man sich nämlich unserer modernen Terminologie bedienen will, so muss man hier von lexikal-semantischen, phonetisch-phonologischen und morphosyntaktischen Mitteln reden.
Zunächst einmal muss eine „vollkommene“ Sprache einen reichen Bestand an „allgemeinen“ (35ff.) und „besonderen Ausdrücken“ (51ff.) vorweisen. Sie dienen der Bezeichnung von den „Substanzen“ und von den „Beschaffenheiten“, oder genauer: der Bezeichnung von deren Begriffen, die im menschlichen Verstand mittels der Sinneswahrnehmung entstehen. Hiermit schließt Tiedemann an Aristoteles’ Ontologie an, in der Substanzen (eigenständig existierende Dinger) und Akzidenzien (die nur in den Substanzen existierenden Dinger) unterschieden werden.
Eine gut ausgebildete, „vollkommene“ Sprache muss insofern „Reichthum“ (59ff.) aufweisen, als sie Mittel dafür zur Verfügung stellt, dass eine optimale „Absonderung der Beschaffenheiten von den Substanzen“ (34) möglich ist und somit die genaue Bezeichnung der Gedanken gewährleistet. Tiedemann scheint mit seinem „Reichthum“ -Begriff – zumindest theoretisch – nicht viel von Tropen zu halten. Sicher ist auf jeden Fall, dass „Reichthum“ durch „Deutlichkeit“ (83ff.) in Grenzen gehalten werden soll. Das heißt, (wortschatz)reich zu sein, ist kein Vorteil, wenn dieser Reichtum extreme und überflüssige Synonymie und Polysemie bedeutet. Tiedemann erwähnt das zu der Zeit verbreitete Beispiel, dass es im Arabischen mehrere Bezeichnungen für ‚Schwert‘ gibt, was von ihm, wie von vielen anderen, die des Arabischen nicht mächtig waren, belächelt wird.
Als phonetisch-phonologisches Merkmal erwähnt Tiedemann die „Zierlichkeit“ (69ff.), womit er schlicht und einfach meint, dass eine „vollkommene“ Sprache den Ohren angenehm sein muss. Dadurch bezeugt er keine große Toleranz gegenüber Dialekten und Sprachen, die von ihm als ‚rauh‘ bezeichnet werden, eine Einstellung, die selbst in den heutigen Zeiten der political correctness noch gang und gäbe ist.
Die morphosyntaktischen Merkmale einer gut ausgebildeten Sprache umfassen zunächst einmal das Merkmal der „Biegsamkeit“ (77ff.), womit Tiedemann die Flexion meint. Das entspricht einer weiteren noch heute verbreiteten vorgefassten Meinung, Flexionsreichtum sei ein Zeichen für Überlegenheit einer Sprache.
Dann stellt Tiedemann eine Vier-Wortarten-Lehre auf, bzw. man müsste eher sagen: eine Fünf-Wortarten-Lehre, da er ja die morpho-syntaktische Verbindung – die „ Wortfügung “ – auch zu den „Theilen der Sprache“ zählt. Diese sind: das „Nennwort“ (92ff.), das „Fürwort“ (117ff.), das „Zeitwort“ (123ff.), das „Bestimmungswort“ (137ff.) und die „Wortfügung“ (142ff.).
In dieser Aufstellung einer terminologisch und definitorisch basierte Wortartenlehre sind ebenfalls Aristotelische Einflüsse zu erkennen, und zwar über den Weg der modistischen Wortartenlehre. Alle in den letzten Jahrzehnten in Verruf geratene Versuche der traditionellen Grammatik, der Klassifizierung der Wörter und Wortarten logische, also außersprachliche Kriterien zugrunde zu legen, darunter auch der Versuch Tiedemanns, basieren bekanntermaßen auf den mittelalterlichen Traktaten der Modisten. Und der Versuch der Modisten, in ihrer Grammatica speculativa die Modi significandi, also außersprachliche Bedeutungs- und Bezeichnungsarten oder -funktionen der Wörter und Wortarten aufzustellen, ist ja auf die Aristotelische Klassenlehre zurückzuführen. Die Erklärung Tiedemanns zu den Wortarten sollen in Zusammenhang mit derer Erfindung erläutert werden (s. Abschnitt 2.2).
Soviel zur Sprachtheorie Tiedemanns, also zu seiner synchronen Sicht vom Sprachsystem. Mit diesen Informationen gewappnet, kann man nun dazu übergehen, aufzuzeigen, wie sich Tiedemann die Erfindung der oben geschilderten sprachlichen Formen, also den Sprachursprung im phylogenetischen Sinne, vorstellt.
2. Eine funktionalistische Sprachursprungstheorie
2.1 Möglichkeit – Notwendigkeit– Wirklichkeit
Hierbey kommt zuerst die Frage vor: ist es möglich, daß eine Sprache von Menschen, die noch unwissend waren, hat können erfunden werden? Herr Süßmilch hat mit scharfsinnigen Gründen ihre Verneinung unterstützet. Ich wage es, die bejahende Antwort anzunehmen [...]. (Vorrede, 7R.)
Man liegt vielleicht nicht falsch, wenn man Tiedemann in dieser Passage eine gewisse Ironie gegenüber Johann Peter Süßmilch unterstellt. Mit „scharfsinnigen Gründen“ meint Tiedemann sicherlich die geschickte Argumentationsweise Süßmilchs, die er als Beweis für die göttliche Sprachursprungshypothese darbringt. Vgl. dafür Hartung 1977:87:
Süßmilch argumentierte wie folgt: Sprache ist notwendig, um zum Gebrauch der Vernunft zu gelangen. Wenn sie menschlich entstanden wäre, dann sei dies entweder auf natürlichem oder auf künstlichem Wege geschehen. Natürlich sind die Laute der Tiere. In diesem Sinne kann die menschliche Sprache aber nicht natürlich sein. Folglich müßte sie künstlich entstanden sein, und zwar entweder durch Zufall oder durch Absicht. Zufall scheidet aber aus, weil er Unordnung brächte. Folglich ist jede menschliche Sprache das Werk der Vernunft. Der perfekte Gebrauch der Vernunft bedarf nun aber seinerseits des vorangegangenen Gebrauchs von Zeichen. Folglich kann nicht der Mensch die Sprache erfunden haben, sondern nur ein Wesen, das höher steht als der Mensch.
Süßmilchs Überlegung basiert auf der Prämisse, dass die menschliche Vernunft ohne Sprache nicht möglich sei; Sprache aber könne nur mit Vorsatz, nach Plan erfunden werden; ein Plan wiederum sei aber immer das Ergebnis von Überlegung und damit das Ergebnis von Vernunft; der noch sprachlose Mensch habe eben aufgrund seiner Sprachlosigkeit noch nicht über Vernunft verfügt; ergo könne er die Sprache nicht erfunden haben, sondern nur ein überlegenes, vernünftiges Wesen, nämlich: Gott.
Tiedemann dagegen wagt, „die bejahende Antwort anzunehmen“ und die menschliche Hypothese zu postulieren.
Dabei verläuft seine Argumentationsweise von der menschlichen Möglichkeit zur menschlichen Notwendigkeit, Sprache zu erfinden, und diese Notwendigkeit ist es, was für ihn die menschliche Erfindung der Sprache zu einer zwangsläufigen Wirklichkeit macht.
Um die Möglichkeit der menschlichen Erfindung von Sprache darzubieten, untersucht Tiedemann zunächst die Grundlagen der theologischen Hypothese; dann widmet er sich dem Huhn-Ei-Problem des Verhältnisses von Sprache und Vernunft. Eine dritte Argumentationsart, die Tiedemann vorbringt, betrifft die anatomische Veranlagung der menschlichen Spezies, wobei er – wie Süßmilch, allerdings mit anderen Ergebnissen – einen Vergleich zu der Sprache der anderen Tiere zieht. Von der Möglichkeit geht Tiedemann zur Wirklichkeit über, indem er Argumentationen und Beispiele dafür vorbringt, dass der Mensch die Sprache einfach erfinden musste.
Also fangen wir mit dem Problem der Möglichkeit der Erfindung der Sprache durch den Menschen an.
Wie oben dargelegt, schließt Süßmilch durch logische Schlussfolgerung die Möglichkeit aus, dass der Mensch Sprache erfinden könnte, zumindest was die allererste Sprache angeht, so dass nur die theologisch basierte Hypothese als plausibel erscheint. Man merkt es an Süßmilch: Das Glauben an bestimmten Dogmen alleine reicht in der Aufklärungszeit nicht mehr aus. Das vernünftige Denken und Urteilen muss hinzugezogen werden, um entgegengesetzte Hypothesen möglichst ‚wissenschaftlich‘, und das bedeutet in der Aufklärungszeit: wenigstens logisch-spekulativ gegeneinander abzuwägen, wo eindeutige empirische Grundlagen fehlen. Damit liegt Süßmilch ganz im Trend der Zeit.
Bei Tiedemann ist es ähnlich, aber eben umgekehrt. In ebenfalls für die Zeit typischer Weise besteht Tiedemanns Anliegen zunächst einmal offenbar gerade nicht so sehr darin, die göttliche Hypothese endgültig zu widerlegen und für abwegig zu erklären. Um die theologisch basierten Dogmen nicht allzu sehr zu belasten, wobei Tiedemann damit sicherlich vermeiden wollte, womöglich des Atheismus bezichtigt zu werden, geht es ihm schlicht und ergreifend darum, plausible Argumentationen, Evidenzen, Indizien für die Möglichkeit der menschlichen Erfindung der Sprache zu finden und zu präsentieren.
Der vornehme Grund, auf den sich Herr Süßmilch, wo mich nicht mein Gedächtniß trüget, stüzt, ist die Unmöglichkeit, von Seiten der Menschen, eine Sprache zu erfinden. Um ihn aus dem Wege zu räumen, muß die Möglichkeit dargethan werden, daß die Menschen [...] eine Sprache erfinden können, und daß es auch den rohesten Menschen nicht unmöglich ist, eine Sprache zu erfinden. (149)
Tiedemann untersucht zunächst einmal die Grundlagen und Möglichkeiten einer göttlichen Erfindung der Sprache, aber auf solch eine vorsichtige Weise, dass diese zwar nicht eindeutig und restlos widerlegt wird, die menschliche Hypothese aber – was zunächst einmal Tiedemanns Hauptanliegen zu sein scheint – doch als möglich, als plausibel erscheint.
Mit seinem ausgeprägten Sinn für die Diachronie gibt Tiedemann als erstes das Argument des Sprachwandels an als Evidenz dafür, dass der Mensch sehr wohl in der Lage ist, Sprache zu erfinden:
Entweder hat Gott die ganze Sprache mit allen ihren Worten, Wendungen, und ihrer ganzen Einrichtung; oder nur einen Theil der Worte und der Einrichtung den Menschen gegeben. [...] Da [...] die Sprachen so sehr zunehmen, ganz umgeschmolzen werden; so ist offenbahr, daß Gott nicht die ganze Sprache, nebst ihrer ganzen Einrichtung den Menschen gegeben hat. Ist nun dieses nicht: so hat er ihnen nur einen Theil der Sprache und ihrer Oekonomie gegeben. Folglich haben die Menschen das übrige dazu erfunden, nach ihrem eigenen Gutdünken. Da sie nun das Vermögen hatten, einen großen Theil der Sprache zu erfinden: warum hatten sie denn nicht auch das die ganze Sprache zu erfinden? (158f.)
Implizit in dieser Aussage ist nicht nur die verständige Ansicht, dass Sprachwandel ein menschliches Werk ist, sondern darüber hinaus, dass Sprachwandel ein schöpferisches „Vermögen“ und den freien Willen der Menschen voraussetzt, und dass dieser freie Wille den Menschen eigen sein muss, ansonsten wären sie nicht in der Lage, Sprachen „nach ihrem eigenen Gutdünken“ ‚ umzuschmelzen ‘. Da Sprachwandel mit der Urerfindung von Sprache vergleichbar ist, so dient die (übrigens zwar anti-theologische, aber eben noch nicht als atheistisch zu bezeichnende) Prämisse, dass der Mensch schöpferische Fähigkeiten kombiniert mit dem libre arbitre besitzt, als Evidenz dafür, dass die allererste Erfindung von Sprache ebenfalls ein menschliches Werk sein kann. Dass Gott aber den Menschen eventuell „einen Theil der Sprache und ihrer Oekonomie gegeben“ hat, wird aber nicht endgültig als abwegig dargestellt.
Noch in der diachronen Schiene führt Tiedemann außerdem die „ Verschiedenheit “ der menschlichen Sprachen als Argument für die Erfindung durch den Menschen an:
Die große Verschiedenheit der Sprache giebt uns ferner einen sehr wichtigen Grund, aus dem man behaupten kann, daß sie nicht von Gott sind. Denn alle diese Sprachen stammen unmöglich von einer einzigen Mutter ab [...] Also ist es gewiß, daß viele Sprachen von Menschen erfunden sind.“ (160f.)
Tiedemann scheint an dieser Stelle vorauszusetzen, dass, wenn Gott den Menschen die Sprache gegeben hat, dann nur eine einzige Ursprache. Dass es so viele unterschiedliche Sprachen gibt, das ist für Tiedemann offenbar eindeutig und selbstverständlich auf menschliches Wirken zurückzuführen, denn er scheint eine logische Erklärung dafür nicht für notwendig zu halten. Wieder schließt Tiedemann hier die theologische These nicht ganz aus: Gott mag den Menschen eine Sprache gegeben haben; die zahlreichen, tatsächlich existierenden Sprachen stammen aber nicht von ihr ab, sondern wurden von den Menschen erfunden.
Aber gerade wegen der Selbstverständlichkeit, mit der Tiedemann von der menschlichen Erfindung von Sprache und von den verschiedenen Sprachen ausgeht, wirkt die Stelle, an der er einen Zeitpunkt in der menschlichen Geschichte dafür annimmt, um so verwirrungsstiftender: Tiedemann setzt die Erfindung der Sprache nämlich in einer Zeit nach der Sprachverwirrung an, also nach der biblischen Zeit des Turms zu Babel! Denn nach Tiedemann fällt die Erfindung der Sprache mehr oder minder mit der Erfindung der ersten Gemeinschaften zusammen, wie wir noch sehen werden. Und diese beiden Erfindungen markieren das Ende eines Zustandes der Wildheit, was sehr vernünftig und einleuchtend klingt. Nur: Dieser ‚natürliche’ Zustand soll nach Tiedemann mit der Sprachverwirrung begonnen haben! Dazu seine eigenen Worte:
Diese Periode [d.h. der Wildheitszustand, S.B.] muß nach der biblischen Geschichte in die Zeit der Verwirrung der Sprachen bey dem Babylonischen Thurmbaue, gesetzt werden. Denn damahls wurden die Menschen in alle Welt zerstreuet, keiner verstund damahls den andern, und folglich war es so gut als ob keine Sprache auf dem ganzen Erdboden war, weil sich die Menschen erst um die Ausdrücke vergleichen, und sie erfinden musten, deren sie sich, ihre Gedanken sich mitzutheilen, bedienen wollten. (184)
Hat Tiedemann tatsächlich an diese biblische Parabel geglaubt? Auf den ersten Blick scheint er sie in dieser Passage für bare Münzen zu halten. Aber: Wenn das der Fall ist, dann müsste er auch davon ausgehen, dass vor dem Turm zu Babel eine Ursprache existierte, und dass diese womöglich von Gott gegeben war. Das würde mit den oben aufgeführten Erläuterungen bezüglich einer Ursprache zusammenpassen. Tiedemann schreibt allerdings nicht etwa: „man verstand sich nicht mehr“ oder „es war so, als ob keine Sprache mehr auf dem ganzen Erdboden wäre“. In beiden Aussagen fehlt das Adverb ‚ mehr’ bei den Negationswörtern, die auf die Annahme des Bestehens einer Sprache vor dem Turm zu Babel hinweisen würde.
Mehr noch: Tiedemann liefert hier die Argumentation, dass die Sprachverwirrung, also die („nach der biblischen Geschichte“ wieder gottgegebene und plötzliche) Verschiedenheit der Sprachen, so wirkt, „als ob keine Sprache auf dem ganzen Erdboden war“. Aber solch eine Behauptung ist in Anbetracht seiner ausgeprägten diachronen und säkularisierten Sprachphilosophie mindestens konsternierend, ja sie widerspricht Tiedemanns gesamtem philosophischem Projekt der menschlichen Erfindung der Sprache. Denn die Verschiedenheit der Sprache, die andernorts in der Abhandlung als ein menschliches Werk dargestellt wird, stellt Tiedemann hier als ein übernatürliches Ereignis dar, und die Erfindung leitet sich aus den wie durch ein Wunder entstandenen Ausdrücken ab.
Man kommt deshalb zum Verdacht, dass diese Passage nichts weiter ist als ein Zugeständnis an die christlichen Dogmen und an die mächtigen Kirchenväter, die man nicht so ohne weiteres abstreiten durfte, ohne gleich als Atheist zu gelten, was sich für den jungen Hauslehrers in Livland alles andere als vorteilhaft erweisen mochte. Diese Vermutung wird durch folgende Tatsache bestärkt: Bereits in seiner Göttinger Studienzeit fasste Tiedemann den Plan, eine Geschichte der Menschheit zu schreiben, und zwar angeregt durch die Lektüre von Reisebeschreibungen, von denen er auch Übersetzungen angefertigt hat (s. Liste seiner Schriften in Abschnitt 4.1); auch sein Versuch ist mit Beispielen aus solchen Reiseberichten reich bestückt.
Wie dem auch sei: Nachdem Tiedemann die Grundlagen der theologischen Hypothese untersucht, geht er auf die Hauptprämisse Süßmilchs ein, ohne Vernunft, ohne Verstand könne die Sprache nicht erfunden werden.
Es wurde im ersten Teil der vorliegenden Arbeit bereits zur Genüge erläutert: Für Tiedemann hat die Sprache zwar eine kognitive Funktion, diese sei aber immer der kommunikativen Funktion untergeordnet. Außerdem sei für die Erfindung der Sprache kein vollkommener Gebrauch der Vernunft notwendig, wie Süßmilch es behauptet. Im Gegenteil: erst durch die Sprache gelangt der Mensch zur Entwicklung und zum perfekten Gebrauch seiner kognitiven Fähigkeiten. Von daher ist es nach Tiedemann durchaus möglich, dass der Mensch, der sich noch im Zustand der „ Wildheit “ befindet, Sprache erfinden kann:
[Es] erfinden auch rohe Menschen, von denen man nicht viel Verstand erwarten darf, Sprachen. (162)
In diesem Statement scheint Tiedemann, wie viele seine Zeitgenossen und auch noch viele im ausgehenden 20. Jahrhundert, ‚ Verstand‘, ‚ Vernunft’ mit Bildung und mit wissenschaftlichem Fortschritte zu verwechseln. Aber als Ausgleich dafür bringt Tiedemann die viel gebrauchte Idee der Unvollkommenheit der menschlichen Schöpfungen als Argument für seine These der menschlichen Erfindung der Sprache und formuliert diese theologisch basierte Idee dermaßen um, dass sie selbst für die Zeit der Aufklärung als blasphemisch eingestuft werden könnte:
Man weiß, daß alle menschliche Erfindungen im Anfange roh und unvollkommen sind, warum will man denn die Sprache hiervon ausnehmen? [...] Ist aber die Sprache nach und nach erfunden, verbessert, und endlich vollkommen gemacht worden: so sehe ich nicht, warum nicht eben die Zeit und die Erfahrung, die Ordnung und Zusammenhang in die übrigen menschlichen Wissenschaften gebracht haben, sie auch der Sprache nicht haben mittheilen können. (173f.)
Und an einer anderer Stelle heißt es:
Wenn der menschliche Verstand erst auf die Spur einer Sache gekommen ist, und es die Bedürfnisse erfordern sie weiter zu treiben: so bietet er alle ihm untergeordnete Kräfte auf diese Spur zu verfolgen, und die Sache auszudehnen, und vollkommener zu machen. So ist es mit der Weltweisheit, so ist es mit der Mathematik, so ist es mit allen menschlichen Künsten gegangen. (190f.)
Nur „im Anfange“ sind menschliche Erfindung unvollkommen, durch die „Zeit und die Erfahrung“, aber auch durch die „Bedürfnisse“ können sie, darunter die Sprache, zur Vollkommenheit gebracht werden, und zwar weiterhin durch menschliches Zutun! Zu der Zeit hätten sicherlich immer noch sehr Viele Anstoß an solch einer ‚gottlosen’ Behauptung genommen, dass die unvollkommenen Menschen perfektionsfähig sind und dieses Vermögen auch in die Tat umsetzen können, sobald es notwendig genug ist.
Aber die Diskussion geht noch weiter und zwar an einer Stelle, in der Tiedemann den semiotischen Charakter des sprachlichen Zeichens problematisiert. Siehe dafür zunächst einmal folgende Passage:
Kein Mensch zweifelt daran, daß die Worte und Vorstellungen keine nothwendige Verbindung haben. Also kann der Mensch so wol Töne ohne Gedanken, als Gedanken ohne Töne, oder Worte haben. (165)
Was das sprachliche Zeichen – hier: das Wort – betrifft, so stellt Tiedemann erst einmal fest, dass der Mensch im allgemeinen durchaus in der Lage ist, Begriffe zu entwickeln, für die (noch) keine Bezeichnung existieren bzw. deren Bezeichnungen dem Menschen unbekannt oder augenblicklich nicht gegenwärtig sind. „Diese Art der Vorstellungen“ – so Tiedemann – „kann man sinnlich allgemein nennen. Sie finden sich auch bei den Thieren“ (166). Also die Fähigkeit, Begrifflichkeiten zu entwickeln, „die man ohne Worte haben kann“ 165), ist allen Tieren eigen, darunter auch den Menschen. Deshalb muss beim Menschen zunächst einmal die Begrifflichkeiten entstanden sein:
Fragt man, welches von diesen beyden Dingen zuerst bey den Menschen sich findet, so fällt der Ausspruch zum Vortheil der Begriffe aus. Denn wenn man auch einen Schall vorbringt, ohne damit eine Vorstellung zu verknüpfen : so ist es ein leerer Ton, und folglich kein Wort. (167)
Festgehalten werden muss hier: Der Mensch, wie alle Tiere, kann Vorstellungen ohne Bezeichnung haben; aber es kann kein Wort, keine Bezeichnung ohne einen entsprechend Begriff geben. Mit der heutigen Terminologie würde man sagen, dass dies deshalb so ist, weil das sprachliche Zeichen ein semiotisches Zeichen ist.
Und da das sprachliche Zeichen nun einmal semiotisch ist, also immer verknüpft mit einer Bedeutung, mit einer Vorstellung, mit einem Begriff, kann die Sprache doch nicht vor der Entwicklung der Vernunft bei den Menschen entstanden und deshalb nur von Gott erfunden worden sein, wie Süßmilch behauptet. Denn die Vernunft besteht ja „aus Vorstellungen und Begriffen“:
Ohne Sprache soll kein Verstand, keine Vernunft seyn können, diese aber bestehen ja aus Vorstellungen und Begriffen, also müssen ja die Begriffe auch nicht ohne Sprache statt finden können. [...] Nicht die Sprache, sondern die angestellten Beobachtungen, die allgemein gemachten Begriffe und Sätze, die wir durch Beyhülfe der Sprache behalten und fortpflanzen, sind die Ursachen der Ausübung des Verstandes und der Vernunft. (167f.)
In der obigen Passage wird noch einmal deutlich, welche Beziehung Tiedemann zwischen Sprache und Vernunft sieht, und wie nach seinen Begriffen Vernunft entsteht und sich entwickelt:
1. Nach Tiedemann ist die Sprache als Gedächtnisstütze und Tradierungsmedium für die „ Ausübung “ und weiteren Ausbildung der Vernunft unerlässlich, aber sie ist nicht die Quelle der Vernunft. Der Mensch ohne Sprache besitzt durchaus erste Formen von Vernunft, die noch nicht perfekt sein müssen, um Sprache erfinden zu können. Womit Tiedemann die Hauptprämisse Süßmilchs widerlegt und dessen theologische Hypothese für ungültig erklärt, oder wie Tiedemann es anders herum ausdrückt: „Das ist die Auflösung des wichtigsten Beweises gegen die Erfindung der Sprache vom Menschen“ (169). Denn, wie bereits erwähnt, geht Tiedemann ja gegen die theologische These mit Argumentationen vor, die weniger zu ihrer Widerlegung führen sollen, als zur ‚Plausibilisierung’ der menschlichen These.
2. Bei Tiedemann wird das Huhn-Ei-Problem von Sprache und Vernunft also so gelöst, dass er dem sprachlosen Menschen phylogenetisch wie ontogenetisch eine Vernunft zuschreibt, die aus Ideen und Vorstellungen besteht, welche wiederum erst durch empirische Erlebnisse entstehen. Dass sich Sprache und Vernunft in ihrer Weiterentwicklung (wobei sie „in Ordnung und Zusammenhang gebracht“ werden, 169) gegenseitig bedingen, ist eine Selbstverständlichkeit, denn beide sind menschliche Errungenschaften. Sowohl in ihrer Entstehung als auch in ihrer Weiterausbildung sind Vernunft und Sprache mit der Sinneserfahrung und mit dem Lernen untrennbar verbunden.
Tiedemann ist, wie man leicht sehen kann, eindeutig kein Verfechter der Cartesianischen These der angeborenen Ideen. Ganz im Gegenteil: Er scheint die Aristotelische Maxime beherzigt zu haben, dass im menschlichen Bewusstsein nichts ist, was nicht auf dem Weg der Wahrnehmung („die angestellten Beobachtungen“, 168) dahin gelangt wäre. Womit die These am Anfang des ersten Teils der vorliegenden Arbeit, weshalb denn Tiedemann sich eher auf Epikur als auf Plato in Punkto Sprachursprung beruft, bestätigt wird: Weil er sich nämlich in der Kontroverse zwischen Rationalismus/Nativismus und Sensualismus/Empirismus für Letzteres entscheidet. Man kann annehmen, dass Tiedemann sich von der Platonischen Ideenlehre distanzieren wollte, da in dieser die Sinnenwelt als eine Schattenwelt, die Ideenwelt dagegen als die einzig wahre Welt dargestellt wird, eine Welt, in der die ewigen Konzepte aller vergänglichen Dinger der Sinnenwelt existieren und in der die Seelen der noch ungeborenen Menschen leben, so dass diese bei ihrer Geburt diese Konzepte mitbringen, was auf die mentalistische These hinausläuft.
Zu guter Letzt argumentiert Tiedemann außerdem mit der physiologischen Veranlagung der Menschen, Sprache zu artikulieren, wobei er den Vergleich zieht, dass die anderen Tiere, die diese Veranlagung nicht besitzen, genau so wie der Mensch in der Lage sind, Vorstellungen bzw. Empfindungen durch Töne auszudrücken:
Was ist denn endlich an dieser Sache so wunderbar, daß das menschliche Geschlecht, welches eine dazu geschickte Stimme und Zunge hat, nach seinen verschiedenen Gedanken und Absichten die verschiedenen Dinge mit Worten bezeichnet; da so gar das stumme Vieh, und alle wilde Thiere mancherley Geschlechts, mancherley und verschiedenen Töne hervorbringen, wenn sie sich fürchten, oder Schmerz leiden, oder wenn schon das Vergnügen in ihren Adern wallet? (194f.)
Nur in diesem rein physiologischen Aspekt scheint Tiedemann, die Menschen von den anderen Tieren zu unterscheiden, zumindest in Hinblick auf Sprache. Denn die geistige Fähigkeit, Begrifflichkeiten zu entwickeln, für welche keine Bezeichnung existieren, trifft – wie oben bereits erwähnt – nach Tiedemann für alle Tiere zu, darunter den Menschen. Aber das steigert sich noch: Die geistige Fähigkeit, Begrifflichkeiten mit Symbolen zu verbinden, die für das Erfinden eines Zeichensystems nötig ist, schreibt Tiedemann ebenfalls nicht nur den Menschen zu:
Vielleicht wird es einigen lächerlich vorkommen, daß ich eine an sich so offenbahre Sache, als es das Vermögen der Menschen ist, Töne mit Vorstellungen zu verknüpfen, weitläufig zu beweisen suche. [...] Auch die Tiere können dieses. [...] Es gehören eben keine sehr erhabene Kräfte der Seele dazu, diese Verknüpfung zu bewerkstelligen. [169ff.]
Damit sind die Hauptargumentationen Tiedemanns für die Möglichkeit der Erfindung der Sprache durch die Menschen erläutert. Aber das genügt noch nicht, und deshalb fragt sich Tiedemann folgerichtig:
Allein die bloße Möglichkeit ist hier noch nicht hinlänglich [...]. Es fragt sich also: wie ist diese Möglichkeit in die Wirklichkeit übergegangen? (149)
Also: Die noch sprachlosen Menschen hatten das Vermögen, Sprache zu erfinden. Schön und gut. Warum sind sie nun dazu übergegangen, dieses Vermögen in die Tat umzusetzen? Man kann die Frage mit einem kurzen Satz beantworten: Weil sie es mussten, weil sie die Sprache brauchten und sie schlicht und ergreifend erfinden mussten.
Tiedemann formuliert das Problem und dessen Lösung mit dem Bewusstsein, dass Sprache ein semiotisches System ist: Von der Behauptung „Die Menschen können Töne mit Vorstellungen verbinden“ (Überschrift vom Dritten Hauptstück, ab S. 169) geht er zur „Nothwendigkeit der Verbindung der Töne mit Vorstellungen“ (Überschrift vom Vierten Hauptstück, ab S. 174) über.
Aber Tiedemann geht nicht nur semiotisch vor, er beschäftigt sich hier auch mit philosophisch-anthropologischen Fragen. Es wurde oben schon erwähnt, dass Tiedemann von der Hypothese eines „natürlichen Zustandes“ (176) ausgeht, in dem der Mensch sprachlos ist. In diesem Zustand ist er aber nicht nur sprachlos, er kennt auch noch keine Gemeinschaften. Tiedemann stellt sich diesen folgendermaßen Zustand vor:
Um diese Nothwendigkeit [d.h. die „Nothwendigkeit der Verbindung der Töne mit Vorstellungen“, S.B.] in ihrer ganzen Stärke zu übersehen, stelle man sich Menschen vor, die noch keine Sprache haben, die folglich ganz vollkommen roh und wild sind. Diese werden ohne alle Kenntniß von Künsten und Wissenschaften seyn. Die Bemühung ihren Hunger zu stillen, ihren Durst zu löschen, ist ihre einzige Beschäftigung, ihre ganze Arbeit. Sie sind einander weder Freund noch Feind, aber bey der geringsten Ursache, die ihre Bedürfnisse angeht, Feind, vollkommen so wie die jetzigen Europäischen Potentaten [...]. Vernunft, Verstand, Vorhersehung dieses sind ihnen noch unbekannte Dinge, und ungebaute Felder. Sie leben unter sich ohne einige gesellschaftliche Verbindung, ohne Rechte, ohne Gesetze, ohne Richter. Sie selbst haben sich noch keine Gesetze gegeben, und die Stimme der Natur verstehen sie nicht, weil sie zu unwissend sind. (174f.)
Der Mensch ohne Sprache ist gleichzeitig noch kein Zoon politikon, kein gesellschaftliches Wesen, um Aristoteles wieder zu erwähnen. Zu einem Zoon politikon wird er erst durch seine „Erfahrung“, also nicht durch angeborene Veranlagung. Und seine Erfahrung zeigt ihm, dass er „ eine bessere Lebensart“ im v.a. materiellen, aber auch seelischen Sinne eher in der Gruppe denn als Einzelgänger erreichen kann:
Dieser Zustand der Wildheit aber konnte nicht immer dauern, durch lange Erfahrungen wurden die Menschen klüger, und folglich nach einer bessern Lebensart begierig. Die Unbequemlichkeiten des damahligen Zustandes musten sie nothwendig fühlen, worin sie mit so vieler Beschwerlichkeit sich ihren Unterhalt suchen musten, wo so oft einer dem andern sein nothwendiges entriß, wo sie oft dem Hunger, der Kälte, und allen andern Beschwerlichkeiten unterworfen wurden; wo sie in ihren Krankheiten keinen Beystand, keine Hülfe, keinen Trost hatten; wo sie von den wilden Thieren oft verfolgt, geängstiget, und dahin gerissen wurden. [184f.]
Die Fähigkeit, Bezeichnungen und Begriffe einander zuzuordnen, wird, wie oben schon erwähnt, nach Tiedemann zur Wirklichkeit, wenn sie zur Notwendigkeit wird, und das heißt: Wenn der Mensch das Bedürfnis nach Kommunikation verspürt. Das Bedürfnis nach Kommunikation entsteht wiederum in Zusammenhang mit der Entstehung erster Formen gemeinschaftlichen Lebens und wieder bedingt durch die Erfahrung. Denn: Erfahrung und Bedürfnis – das sind menscheneigene, säkulare, pragmatische Größen, die für den Materialisten Tiedemann von fundamentaler Bedeutung bei Entstehung und Entfalten von Sprache sind:
Wenn nun verschiedene Menschen sich vereinigten, und auf die Art eine gewisse Gattung von Gesellschaft ausmachten: so war es nothwendig, daß sie nach gemeinschaftlichen Absichten arbeiteten [...] Wie konnten sie aber nach gemeinschaftlichen Absichten handeln, wenn nicht einer dem andern seine Gedanken, seine Gesinnungen, seinen Rath mittheilen konnte? Dieses sahen sie gar bald aus der Erfahrung, und durch sie wurden sie begierig gemacht, sich ihre Gedanken zu offenbahren, und sie von einander zu erfahren. Diese Begierde ist die erste Ursache der Sprache, weil sie die Menschen antrieb, alle ihre Kräfte auf alle Art anzuwenden, um ein Mittel das Verborgene der Seele sich zu erkennen zu geben, ausfindig zu machen. [185f.]
2.2 Form und Funktion
Mit der letzten zitierten Passage kommt der Mitteilungs-Aspekt von Sprache und die funktionalistische Sicht Tiedemanns, die im ersten Teil der vorliegenden Arbeit anlässlich der Tiedemannschen Sprachtheorie erörtert wurde, wieder zur Sprache, diesmal in bezug auf den Sprachursprung: Die Hauptfunktion und damit „die erste Ursache der Sprache“ ist, Gedanken und Gesinnungen mitteilbar zu machen, also die Kommunikation bzw. das Bedürfnis nach Kommunikation.
Es hat nach Tiedemann allerdings noch eine Zeit gedauert, bis der Mensch seine Gedanken und Ansichten in vollständiger Form bilden und artikulieren konnte. Unter Anwendung moderner Termini, v.a. aus der Sprechakttheorie Austins und Searles könnte man sagen, dass der Mensch erst nach verschiedenen Phasen der Entwicklung der Sprache in der Lage gewesen ist, vollständige Propositionen bestehend aus Ausdrücken für Referenten und Prädikate, sowie für Beziehungen zwischen Referenten, zu artikulieren. Erst die Erfahrung und das Bedürfnis konnten das bewirken. Tiedemann stellt sich die Entwicklung von den ersten bedeutungstragenden Zeichen bis zu vollständigen Proposition ziemlich genau und plastisch vor:
Zunächst hat man sich einer „Sprache der Gebärden“ (186) bedient, denn: „Dies ist noch jetzt die Sprache derer, die sich sonst nicht verstehen können.“ (187f.) Und hier erwähnt Tiedemann Stumme, aber auch „Reisende in fremde (n) Länder [n] “ (187). Aber „in einer großen Entfernung, des Nachts, oder im Dunkeln“ konnte man sich nicht durch Gebärden verständigen: Es war notwendig, Zeichen zu erfinden, „deren man sich in allen Umständen mit Leichtigkeit und Deutlichkeit bedienen konnte“ (187). Und so fing der Mensch an, seine Vorstellungen durch Töne verständlich zu machen, also Begriffe mit akustischen Zeichen zu verbinden. Das ging nach Tiedemann folgendermaßen vor sich:
Die Menschen bemerkten, daß die Gemüthsbewegungen ihnen Töne ablockten, sie wurden auch gewahr, daß die Thiere sich derselben mit gutem Erfolge bedienten. Was war natürlicher, als daß sie suchten sich diese Entdeckung zu Nutze zu machen, und die Töne zu Zeichen ihrer Gedanken zu gebrauchen? [187]
Tiedemann mutmaßt – wie viele vor und nach ihm, die von einem motivierten (hier konkret: lautmalenden) Ursprung der Sprache ausgehen –, daß diese erste Lautsprache eine onomatopoetische („nachahmende“, 188) Sprache war. Als Evidenz für diese Annahme nennt Tiedemann die Tatsache, daß in den verschiedenen Sprachen eine hohe Anzahl an Ausdrücken anzutreffen ist, „die den Schall der Dinge nachahmen“ (189f.). Dass die Motivation in Zusammenhang mit der Erfindung von Sprache eine sehr wichtige Kategorie für Tiedemann ist, wird klar, wenn er beklagt, dass durch Sprachwandel viele onomatopoetischen Wörtern aus „der jetzt gewöhnlichen feinern Sprache“ verschwunden sind, im Gegensatz zu den Dialekten:
Vielleicht wäre es gut gewesen, wenn man von diesen mehrere in die hochteutsche Sprache aufgenommen hätte, weil sie eine vorzügliche Schönheit haben, nemlich daß sie das Bild einer Sache weit lebhafter und stärker erregen, als die weiter hergeholten Worte. (190)
Wie Epikur unterstützt Tiedemann hier die naturalistische These, um dann die Konventionsthese gleichfalls zu bestärken, denn, wie bereits im ersten Teil der vorliegenden Arbeit erwähnt, bilden beide Thesen keinen Widerspruch:
Es ist leicht zu begreifen, daß der Gebrauch solcher Töne sich bald ausbreitete, und daß sie von allen, die die Gesellschaft ausmachten, ohne Mühe gebraucht und angenommen wurden. Sie waren gar zu bequem zu lernen und zu verstehen, als daß man sie hätte verwerfen sollen. (190)
Zeit, Erfahrung und Notwendigkeit trieben die Menschen dann dazu, Bezeichnungen „zu ersinnen, die weniger Aenhlichkeit mit den Dingen selbst hatten“ (191). In dieser Phase wurden die Menschen durch Ausübung ihrer Kreativität und Erinnerungsvermögen „desto geschickter diese entferntern Töne zu entdecken, und die entdeckten zu behalten“ (192). Es ist hier klar, dass Tiedemann im Einklang mit seinem sprachphilosophischen Projekt mit „entdecken“ ‚erfinden’ meint, er würde ansonsten hier nicht von „Einbildungskraft“ reden (192).
Für Tiedemann – wie für Lukrez, den Tiedemann in diesem Zusammenhang auch zitiert – ist es aber auch sehr wichtig zu betonen, dass die Sprache von vielen Menschen – und zwar nach arbeitsökonomischen und sprachökonomischen Kriterien – und nicht etwa von einem Einzeln allein erfunden wurde:
Auf diese Art also erfand bald dieser bald jener von der Gesellschaft ein Wort, je nachdem es ihm seinem Gebrauche und seinem Bedürfnisse nach am bequemsten und am nöthigsten war. (193f.)
Es ist nicht uninteressant zu bemerken, wie Tiedemann hier stillschweigend wieder Abstand von Plato nimmt, in dessen Kratylos im Zusammenhang mit der Konventionsthese von einem ersten „Namengeber“ die Rede ist. Sein Urteil zu solch einer Ansicht ist eindeutig, wobei hier die pragmatische Zweckmäßigkeit von Sprache noch einmal deutlich wird:
Glauben, daß damahls jemand den Dingen allein die Nahmen gegeben habe, und daß daher die Menschen die ersten Worte gelernt haben, heist thöricht seyn. Denn warum sollte dieser alles mit Worten bezeichnen können, und verschiedene Töne durch die Zunge hervorbringen, andere aber sollten zu derselben Zeit dieses Vermögen nicht gehabt haben? [...] Ferner konnte ein einziger nicht mehrere zwingen, [...] daß sie die Nahmen der Dinge lernten [...]; denn sie würden es nicht gern zugeben, daß unbekannte Töne sie betäubten, ohne daß sie Nutzen davon hätten.“(194)
Der Mensch – genauer: die menschliche Spezies in der Gemeinschaft hat also nach Tiedemann zunächst eine Gebärdensprache, danach eine onomatopoetische Sprache entwickelt, mit der Zeit erfanden die Menschen mehr und mehr Wörter, die immer weniger Ähnlichkeit mit den damit bezeichneten Dingen hatten, bis die lautmalerischen Wörter nur noch einen geringen Anteil des Wortschatzes ausmachten. Im gesamten Prozess fand eine Konventionalisierung der Wörter statt, die die Kommunikation erleichterten.
Die Fragen, die Tiedemann als nächstes beschäftigen, lauten: Welche Art von Wörtern wurde zuerst erfunden? Welche Art von Dingen bekam zuerst eine sprachliche Bezeichnung? Wie sind die verschiedenen Wortarten und die Flexion der Wörter entstanden? Wie hat man angefangen, vollständige Propositionen zu artikulieren? Ohne Anspruch auf Vollständigkeit soll in der Folge auf diese Fragen eingegangen sein. Es soll dabei konkret demonstriert werden, wie stark das Bewusstsein Tiedemanns für die Funktion der Wörter, ihrer Flexion und ihrer Verbindung im Satz ist, und wie für seine Begriffe die praktischen Größen ‚Notwendigkeit’ und ‚Erfahrung’ die Menschen zur zwecksgerichteten Erfindung der verschiedenen Wortarten und der Morphosyntax sozusagen erzwungen hat.
In Anlehnung an Hobbes, den Tiedemann in diesem Zusammenhang zitiert, geht er davon aus, dass die menschliche Sprache in ihrem Anfang „sehr arm gewesen seyn muß“ (195), denn die Menschen waren damals „Epikurische Weisen, sie hatten eingeschränkte Begierden, sie lebten wie die Thiere und dachten auch größtenteils so wie sie“ (196). Die Menschen waren in erster Linie um ihr Überleben bemüht, und deshalb liegt es nahe, dass sie zunächst Bezeichnungen für die Dinge erfunden haben, die in direkten Zusammenhang mit ihrem Überleben standen:
Weil diese Menschen nichts unternahmen, was nicht mit ihrer Erhaltung eine genaue Verbindung hatte: so kann man leicht den Schluß machen, daß sie keinen andern Dingen Nahmen gegeben haben, als von denen sie nach ihrer Lage beständig reden mußten. (197)
Eben aus diesem Grunde geht Tiedemann davon aus, dass die ersten Wörter Substantiva gewesen sein müssen, denn es war für die Menschen notwendig, die Substanzen bzw. „die Begriffe, die sie von den Dingen selbst hatten“ (204) zu benennen, die ihr Überleben sicherten oder gefährdeten:
Die Menschen hatten stets mit Substanzen zu thun, sie waren es, die ihnen Leben oder Tod bringen konnten. [...] Die ersten Worte waren ohne Zweifel Hauptwörter, weil man denjenigen Dingen zuerst Nahmen geben muste, die am nächsten den Menschen angiengen. (203)
Nach und nach wurde allerdings notwendig, die Akzidenzien, also die Eigenschaften der Dinge ebenfalls zu benennen und so entstanden die ersten Adjektive:
Es war aber nicht genug die Substanzen bloß zu nennen, man muste sie auch beschreiben, und denen, welche sie noch nicht gesehen hatten, kenntbar machen können. Die Beschaffenheiten und Eigenschaften der Substanzen musten gleichfalls ihre Benennungen haben, das heist, man muste auch für Nebenwörter sorgen. [204]
Wie Plato geht Tiedemann also davon aus, dass der erste Akt von Spracherfindung der Benennungsakt, der Akt der Namensgebung gewesen ist, und zwar ging es zunächst um die Benennung von den eigenständig existierenden Substanzen (darunter den Menschen selbst) und den nur in den Substanzen vorzufindenden Akzidenzien, so dass man als Erstes die Substantiva und Adjektive erfunden hat. Nach Tiedemanns Terminologie geht es hier um die Entstehung der „Hauptwörter“ und der „Beywörter“, denen Tiedemann den Oberbegriff „Nennwörter“ verleiht (vgl. 203ff.)
Nach den „ Nennwörter “ folgen die „Fürwörter“, die „Zeitwörter“, die „Bestimmungswörter“ und die „Wortfügung“. Dabei ist es im Text Tiedemanns nicht immer ganz eindeutig, ob er eine strikt chronologische Reihenfolge in der Folge der Kapitel sieht, die sich mit den „Theilen der Sprache“ beschäftigen. Mit der Chronologie möchte ich mich auch nicht besonders viel beschäftigen, sondern eher mit der Art und Weise, wie diese „Theile der Sprache“ nach Tiedemann erfunden wurden.
Die „Fürwörter“ (Pronomina) müssen nach Tiedemann erst in einer viel späteren Phase entstanden sein, denn da wirkte weniger eine Notwendigkeit, noch nicht vorhandene Benennungen zu erfinden, sondern ‚nur’ „die Unbequemlichkeit der beständigen Wiederholung eines [bereits vorhandenen, S.B.] Nennwortes“ (220).
Die „Zeitwörter“ (Verben) dagegen müssen schon bald nach der Erfindung von Nomina und Adjektiven entstanden sein, denn es war „nothwendig auf Worte zu sinnen, die eine Veränderung, die ein Ding hervorbringt, oder, den Begriff der Veränderung nebst dem der Hervorbringung anzeigten, und dieses war das Zeitwort“ (226f.).
Was die „ Bestimmungswörter “ angeht, hier sind sowohl Interjektionen („ Zwischenwörter “, die „plötzlich entstehende Gemüthsbewegungen“ anzeigen, vgl. 244, als auch Konjunktionen („ Bindewörter “, die z. B. dazu dienen, „die Art des Schlusses, der Folgerungzubezeichnen, um dadurch anzugeben, wie eines aus dem andern fließen, welches der Grundsatz, und welches die Folgerung seyn sollte“, vg. 246f.), Präpositionen („ Vorwörter “ für die Bezeichnung davon, „auf welche Art eine Substanz auf die andere, und mit der andern zugleich gewirkt hatte“, 246), und Adverbien („Nebenwörter“, um beispielsweise „besondere Umstände des Ortes, der Zeit“ anzugeben, 247) zu finden.
Ein wichtiger (semantischer) Schritt für die Äußerung von vollständigen Propositionen stellte die Flexion dar. Wieder einmal ist die aus der Erfahrung entsprungene Notwendigkeit der Beweggrund dafür: Es musste beispielsweise gewährleistet werden, dass die beobachteten und erkannten Beziehungen der bereits mit Benennungen versehenen Referenten zueinander angezeigt werden. Das konnte u.a. durch die Deklination geschehen:
Nachher [...], als sie, durch die Noth gezwungen, ordentlich denken, ihre Vorstellungen verknüpfen, und die Verhältnisse der sie umgebenden Dinge besser kennen lernten: so musten sich auch diese verschiedenen Verbindungen ihrer Seele nach und nach darstellen. [...] Um sich einander verständlich zu werden, musten sie suchen diese Verbindungen, die sie bemerkt hatten, auch andern durch die Sprache kenntlich zu machen. [...] Was war natürlicher, als daß sie suchten durch Worte die Verbindungen der Substanzen kenntlich zu machen? Dieses konnte auf zweyerley Art geschehen, entweder daß sie die Hauptwörter selbst ein wenig abänderten, oder daß sie besondere Worte zur Bezeichnung der Abänderungen erdachten. [...] und so wurden die ersten Grundlagen der Fallendungen geleget. [207f.]
Für die Artikulierung von eindeutigen Propositionen waren außerdem andere formale Komponenten vonnöten: die Setzung von entsprechenden Deklinationsendungen, die Kongruenz und die Syntax („ Wortfügung “). Der unmittelbare Grund für die Erfindung von diesbezüglichen Regeln war nach Tiedemann „die Deutlichkeit im Reden“ (248). Denn, wie alles in der Sprache, so erklären sich auch die morphosyntaktischen Regeln nach Tiedemann durch die Notwendigkeit einer eindeutigen Kommunikation:
Durch den Wunsch andern ihre Kenntnisse richtig und genau mitzutheilen angetrieben, gaben sie [d.h. die Menschen, S.B.] der Sprache die Deutlichkeit. (256)
3. Zusammenfassung und Schlusswort
Sensualistisch und funktionalistisch, das sind die Stichworte, die für das Verständnis von Tiedemanns Überlegungen ausschlaggebend sind.
Sensualistisch deshalb, weil Tiedemann in der Sinneswahrnehmung die primäre Quelle der Vorstellungen, der Ideen, und somit die Quelle der Vernunft sieht. Für die Verknüpfung einfacher Ideen zu komplexeren Ideen spiele die Sprache zwar eine wesentliche Rolle, aber Sprache sei ‚nur‘ als Werkzeug für die Entwicklung der Vernunft wichtig, sozusagen als Gedächtnisstütze, da das menschliche Erinnerungsvermögen ohne das Instrument Sprache für längere Ketten von Schlussfolgerungen nicht tauge. Erstere – wenn auch einfache – Vorstellungen und Erkenntnisse, d.h. erstere Stufen einer nicht-apriorisch begründeten, sondern erst vermittels der Sinneserfahrung hervorgerufenen ratio, können also Tiedemann zufolge durchaus ohne Sprache entstehen.
Funktionalistisch deshalb, weil Tiedemann von der Funktionalität, von der Zweckmäßigkeit von Sprache ausgeht, um diese synchron wie diachron, und Sprachursprung ontogenetisch wie phylogenetisch zu erklären. Und zwar ist für Tiedemann die aller erste Funktion von Sprache die der eindeutigenKommunikation. Ohne Bedarf nach Kommunikation in der Gemeinschaft könne eine Sprache weder entstehen noch sich verändern. Was die kognitive Rolle von Sprache angeht, herrscht nach Tiedemann eine gegenseitige Bedingtheit zwischen Sprache und Kognition erst ab einer späteren Entwicklungsstufe. Kognition sei in einer anfänglichen Phase ohne Sprache möglich. Die kognitive Funktion bleibe außerdem der kommunikativen Funktion stets untergeordnet. Der Mensch schaffe und entwickle seine Sprache nicht nur, um Erkenntnisse über die Welt zu gewinnen, sondern vielmehr um diese Erkenntnisse seinen Mitmenschen mitteilen zu können. Dieses Mitteilungsbedürfnis bedinge die konkreten sprachlichen Formen (in den Bereichen Lexik, Lexikalsemantik und Morphosyntax) in den verschiedenen Stufen der Erfindung, des Erwerbs und Wandels von Sprache.
Ein besonderer Verdienst Tiedemanns ist darum, gezeigt zu haben, dass eine Theorie zum Ursprung der Sprache am wirksamsten ist, wenn man sie in eine umfassende, funktionalistische Sprachtheorie einbettet. Das entspricht auch seinem philosophisch-universalistischen Ansatz, denn in seiner Abhandlung behandelt er noch viele andere interessante Probleme anthropologischer, soziologischer, politischer, psychologischer , ökonomischer und theologischer Natur – um nur einige zu nennen –, die mit seinen Hauptideen im Zusammenhang stehen.
Man konnte feststellen, dass Tiedemanns Hauptannahmen nicht besonders originell und manchmal vereinfachend sind. Man findet sie in mehr oder minder abgewandelter Form in zuvor veröffentlichten und allgemeinbekannten Werken von Locke, Condillac, Wolff u.a. Der junge Philosophiehistoriker Tiedemann (zur Zeit der Veröffentlichung seines Versuch s war er erst 24 Jahre alt) beruft sich auch an mehreren Stellen auf diese Autoren. An anderen Stellen tut er es wieder nicht, was bekanntermaßen ganz im Trend der Zeit liegt.
Und trotzdem: Tiedemanns Versuch weist trotz allgemeinem Mangel an Originalität eine dreifache historiographische Relevanz auf:
1. Zunächst einmal allgemein wissenschaftshistorisch gesehen insofern, als er ein Beispiel für den nicht selten zwiespältigen Geist der spekulativen Philosophie der Aufklärung zwischen einem an der Antike neuorientierten Anspruch auf Säkularisierung und ‚Wissenschaftlichkeit‘ einerseits und bestimmten, seit dem Mittelalter verbindlichen und z.T. weiterhin bestehenden christlichen Denkmustern andererseits darstellt.
2. Vor allen Dingen sprachwissenschafts- bzw. sprachphilosophisch-historisch gesehen dadurch, dass Tiedemanns Versuch als ein wichtiger Kapitel innerhalb der Geschichte der funktionalistischen Sprachreflexion gesehen werden kann bzw. muss.
3. Darüber hinaus sprachwissenschaftshistoriographisch gesehen deshalb, weil Tiedemann selbst in seinem Versuch einen wertvollen Beitrag zu der Geschichtsschreibung funktionalistischer Herangehensweisen leistet.
4. Literaturliste
4.1 Tiedemanns Schriften
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[11]
4.2 Zitierte Literatur
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
[1] Miscellanea Berolinensia ad incrementum scientiarum.- Ex scriptis Societatis Regiae Scientiarum exhibitis edita.- Band 1.- Berlin: Joh. Chr. Papen, 1710.-
[2] In bezug auf Deutschland siehe hierfür z.B. den Artikel von 1997 der bereits erwähnten Jutta Steinmetz zu Süßmilch, Zieglers 1997 Artikel zu Fichte und Haß-Zumkehrs 1999 Aufsatz zur Geschichte der germanistischen Linguistik.
[3] Laut DBI-OPAC vom 22.08.99 nur in der ULB Halle.
[4] Histoire de l'Academie Royale des Sciences et Belles-lettres de Berlin. Berlin: Ambrosius Haude (ab 1747 Haude et Spener), 1745(1746)-1769(1771).
[5] Für die biographischen Angaben stütze ich mich auf Hutton 1995:xiii und den Artikel zu Tiedemann in der ADB 1970 [1890]: 276f.
[6] Die Orthographie und Interpunktion der Originalausgabe von 1772 wurde in der vorliegenden Arbeit beibehalten. Diese Ausgabe hat, wie das zu der Zeit nicht selten vorkam, zwei Paginierungen: einmal für die Vorrede und einmal für die restliche Abhandlung. Die Paginierung der Vorrede ist, ebenfalls für die Zeit typisch, eigenwillig: Die Seitenzahlen beziehen sich offenbar jeweils auf zwei Seiten, wobei nicht klar ist, ob links und rechts oder Vorder- und Rückseite gemeint sind; ich bin in den Zitaten von der zweiten Variante ausgegangen, auch da, wo die Seitenzahlen fehlen. Wo Passagen aus der Vorrede zitiert werden, wird dieses explizit gemacht; dazu kommen die Angaben V. (für Vorderseite) und R. (für Rückseite). Ansonsten beschränkt sich die Quellenangaben stets auf die Seitenzahlen.
[7] Diese Vermutung basiert auf das gelegentliche Vorkommen von Formulierungen wie „wo mich nicht mein Gedächtniß trüget“ (149), wenn von Süßmilchs Abhandlung die Rede ist.
[8] Epikur, wiedergegeben nach Diogenes Laertius: De Vitis philosophorum lib. X, 10. Buch, § 75f.- Zitiert in: Arens 1969: 16.-
[9] Siehe z.B. das Konzept von „iconicity of syntactic structures“ in Givón 1984.
[10] Selbst in modernen Werken ist diese unzulässige Gleichsetzung immer noch weit verbreitet. Wie Epikur schon vor über 2000 Jahren (siehe oben) mit Recht bemerkte, können/müssen selbst natürlich (d.h. sonst wie motiviert) entstandene Benennungen konventionalisiert werden, damit die Kommunikation erleichtert wird. Ein anderer, sehr verbreiteter Irrtum besteht darin, das Konzept von Arbitrarität mit Beliebigkeit gleichzusetzen; dabei ist die Arbitraritätsthese auch mit der Natürlichkeitsthese vereinbar, indem aus verschiedenen Möglichkeiten eine einzige arbiträr ausgewählt wird, wie Christian Wolff zeigte.
[11] Diese Angaben stammen aus dem Karlsruher Virtuellen Katalog (Angaben vom 22.08.99), sowie aus der ADB 1970 [1890]:277.
- Arbeit zitieren
- Suzie Bartsch (Autor:in), 1999, Dietrich Tiedemann: Funktionalistische Sprachtheorie und Sprachursprungstheorie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12074
Kostenlos Autor werden














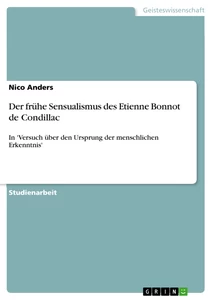







Kommentare