Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Anmerkung:
1 Einleitung
1.1 Problemdarstellung
1.2 Zielsetzung und Thematischer Aufbau der Arbeit
2 Beweglichkeit und Beweglichkeitstraining
2.1 Begriffsbestimmung von Beweglichkeit
2.1.1 Definition von Beweglichkeit
2.1.2 Beweglichkeit als Komponente der sportlichen Leistungsfähigkeit
2.1.3 Einordnung in die motorischen Fähigkeiten
2.1.4 Formen der Beweglichkeit
2.1.5 Bedeutung der Beweglichkeit
2.1.6 Determinanten von Beweglichkeit
2.2 Physiologischer Exkurs zur Beweglichkeit
2.2.1 Der aktive Bewegungsapparat
2.2.1.1 Die Skelettmuskulatur
2.2.2 Der passive Bewegungsapparat
2.2.2.1 Gelenke
2.2.2.2 Sehnen und Bänder
2.2.3 Dehnfähigkeit des tendomuskulären Systems
2.2.3.1 Die Dehnfähigkeit der Muskulatur
2.2.3.2 Dehnungsverhalten des Bindegewebes (Sehnen, Bänder)
2.2.4 Neurophysiologische Faktoren der Dehnfähigkeit
2.2.4.1 Der Muskelspindelreflex
2.2.4.2 Der Sehnenspindelreflex
2.3 Trainingseffekte in der Beweglichkeit
2.3.1 Begriffsbestimmung Training
2.3.2 Methoden des Beweglichkeitstrainings
2.3.2.1 Klassische Dehnmethoden
2.3.2.2 Neuere Dehnmethoden
2.3.2.3 Alternative Dehnmethode
2.3.3 Normativa des Beweglichkeitstrainings
2.3.4 Effektivität der Dehnmethoden
2.3.5 Beweglichkeitstraining im Schulsport
2.3.5.1 Besonderheit im Kindes- und Jugendalter
2.3.6 Trainingseffekte des Beweglichkeitstrainings
2.3.6.1 Senkung der Ruhespannung
2.3.6.2 Beseitigung muskulärer Dysbalancen
2.3.6.3 Verletzungsprophylaxe und Vermeidung von Muskelkater
2.3.6.4 Psychophysische Wirkung
2.3.7 Nachhaltigkeit von Trainingseffekten
2.3.7.1 Begriffsbestimmung Nachhaltigkeit
2.3.7.2 Nachhaltige Trainingseffekte
2.3.8 Erklärungsansätze für Trainingseffekte
2.3.8.1 Titin als Quelle der Ruhespannung
2.3.8.2 Strukturelle Veränderungen
2.3.8.3 Erhöhte Dehntoleranz und Habituation
3 Darstellung der Empirischen Untersuchung
3.1 Voraussetzende Bezüge und Ansatzstellen der empirischen Untersuchung
3.2 Methodische Überlegungen
3.3 Forschungsfragen und Forschungshypothesen
3.4 Untersuchungsmethodik
3.4.1 Personenstichprobe
3.4.2 Variablenstichprobe
3.4.2.3 Gütekriterien
3.4.3 Treatmentstichprobe
3.4.4 Ablauf der Untersuchung
3.4.5 Statistik
3.5 Darstellung der Ergebnisse
3.5.1 Effektivität der Dehnprogramme
3.5.1.1 Stand and Reach
3.5.1.2 Grätsche
3.5.1.3 Rumpfbeuge sw
2.5.2.4 Ausschultern
3.5.2 Effektivitätsvergleich der angewandten Dehnmethoden unter besonderer Berücksichtigung der Normativa des Beweglichkeitstrainings
3.5.2.1 Stand and Reach
3.5.2.2 Grätsche
3.5.2.4 Ausschultern
3.5.3 Nachhaltige Trainingseffekte
3.5.3.1 Stand and Reach
3.5.3.2 Grätsche
3.5.3.3 Rumpfbeuge seitwärts
3.5.3.4 Ausschultern
3.5.4 Geschlechtsspezifische Unterschiede
3.5.4.1 Stand and Reach
3.5.4.2 Grätsche
3.5.4.3 Rumpfbeuge seitwärts
3.5.4.4 Ausschultern
3.5.5 Häufigkeit der sportlichen Betätigung
3.5.5.2 Grätsche
3.5.5.3 Rumpfbeuge seitwärts
3.5.5.4 Ausschultern
3.6 Diskussion
4 Zusammenfassung und Ausblick
5 Literaturverzeichnis
6 Abbildungsverzeichnis
7 Tabellenverzeichnis
8 Anhang
Fragebogen zur sportlichen Aktivität
Tabellen und Abbildungen zur Testauswertung
Basisübungen PI-Effekt aus (Anrich, 2000, S. 25ff.)
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anmerkung:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden alle Personen in der maskulinen Form verwendet. Altersangaben in Lebensjahren werden ebenfalls aus oben stehenden Gründen nicht ausgeschrieben.
1 Einleitung
1.1 Problemdarstellung
Kinder und Jugendliche wachsen in unserer Gesellschaft mit einem ihm zugeschriebenen Wahrnehmungsbild auf, wonach stetiger Medienkonsum, rückläufiger Bewegungspensum, veränderte Ernährungsgewohnheiten und psychosoziale Stressfaktoren ihre gesundheitliche Lage immer mehr verschlechtern (Wiad, 2003, S. 5). Der damit verbundene Bewegungsmangel der Heranwachsenden hat immense negative Auswirkungen auf ihre sportmotorische Entwicklung und Leistungsfähigkeit (Wiad, 2003, S. 7). Nach Angabe der WIAD-AOK-DSB Studie II von 2003 erreichen heute nur noch 80 Prozent der Jungen und sogar nur 74 Prozent der Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren noch die Durchschnittsleistungen ihrer Altersgenossen von 1995 (Wiad, 2003, S. 13). Ein vergleichbarer immenser Rückgang der Motorik wurde schon in den Jahren zwischen 1985-1995 durch Eggert, Brandt, Jendritzki und Küppers ermittelt (Eggert et al., 2000, S. 351f.).
Das Motorik-Modul (MoMo) hat in ihrer noch laufenden bundesweiten Studie zur motorischen Leistungsfähigkeit bei bisher 4.529 getesteten Schülern alarmierende Ergebnisse hinsichtlich der Beweglichkeit feststellen müssen. Bei der Rumpfbeuge vorwärts konnten im Durchschnitt nicht einmal 43% der Kinder- und Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren das Fußsohlenniveau erreichen (Opper, 2007). Und auch der Trend für die nächsten Jahre zeigt einen Rückgang der körperlichen Leistungsfähigkeit. (Wiad, 2003, S. 12)
Auch wenn sich die pädagogischen Blickwinkel des Schulsports verändert haben, und sich eine ganzheitliche Gesundheitserziehung in den neuen Lehrplänen festgesetzt hat, ist im Bereich der Beweglichkeitsförderung in der Praxis noch wenig getan wurden. In meinen Praktika im Rahmen der Schulpraktischen Studien hatte ich ein besonderes Auge auf die geplanten und durchgeführten Erwärmungsphasen der Sportlehrer gelegt. Dehn- oder Stretchingübungen waren vielleicht einmal Bestandteil vor einer Turnstunde. Die Aussage eines Lehrers blieb mir in besonderer Erinnerung. Er meinte, dass ein effektives Dehntraining am Anfang der Stunde mindestens 15 Minuten dauern würde und deshalb zeitlich oft nicht realisierbar wäre. Gegensätzlich dieser Meinung behaupte ich, dass ein wirksames Beweglichkeitstraining nicht mehr als 5 Minuten einer Schulstunde in Anspruch nimmt. Auf dieser Grundlage habe ich meine Staatsexamensarbeit konzipiert.
1.2 Zielsetzung und Thematischer Aufbau der Arbeit
Jede körperliche Bewegung ob alltäglicher Art oder sportlicher Leistung wird von der Muskulatur erbracht. Um diese Aufgabe richtig ausführen zu können, ist der Körper anatomisch zweckmäßig gebaut und an Versorgungs- und Kommunikationssysteme, den Blutkreislauf und das Nervensystem angeschlossen. Die Muskulatur schafft einerseits die Verbindungen der Knochen in ihre Stellungen im Raum, zu verändern, und andererseits bei einer starren Haltung jede Bewegung zu vermeiden. Beides bewerkstelligt die Muskulatur nur, wenn bestimmte Eigenschaften wie Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit vorhanden sind (Sölveborn, 1983, S. 7). Da Bewegung im Alltag aber nicht mehr zwangsläufig in dem Maß gegeben ist, wie es der Körper speziell die Muskulatur zum Ausgleich von mangelnder Bewegung brauchen würde, kommt es zu vielen Bewegungseinschränkungen, die mit Zwangs- und Fehlhaltungen (z.B. durch langes Sitzen) dazu führen, dass die Muskulatur nicht mehr genügend Reize zur Entwicklung und zum Erhalt ihrer Funktionen bekommt. Da aber eine gut entwickelte/augebildete Muskulatur wesentlich zum gesunden und beschwerdefreien Leben beiträgt (Jordan & Schwichtenberg, 2005, S. 7), müssen Gegenmaßnahmen getroffen werden, um die oben genannten motorischen Fähigkeiten Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit zu erhalten und zu fördern. Die Schule und vor allem der Sportunterricht spielen dabei eine entscheidende Rolle. Denn hier verbringen die Kinder und Jugendlichen die meiste Zeit ihrer jungen Lebensjahre. Zu einer Zeit, in der die genannten motorischen Fähigkeiten ausgebildet und auch noch verbessert werden können.
Genau hier setzt die Idee dieser Arbeit an. Diese Examensarbeit soll sich mit der Förderung und Verbesserung der Beweglichkeit im Rahmen des Sportunterrichts befassen. Werkzeug wird dabei das Beweglichkeitstraining sein. Mit zwei sehr unterschiedlichen Dehnungsprogrammen und einer kurzen Interventionszeit von drei Wochen und reduzierten Rahmenbedingungen soll aufgezeigt werden, dass eine Verbesserung der Beweglichkeit auch auf dieser Grundlage möglich ist. Voraussetzende Bezüge sind die Arbeiten von Maier (2005) und Preiß (2005). Die beiden ehemaligen Studenten haben sich auch im Rahmen ihrer Staatsexamensarbeit mit dem Thema Beweglichkeitstraining befasst. Deren Ziel war es nachzuforschen, inwiefern sich nach einer Trainingszeit von sechs Wochen die Beweglichkeit der sieben bis elf jährigen Grundschüler verbesserte. Weiterhin sollte nach einer interventionsfreien Zeit von 6 Monaten (Preiß, 2005, S. 2) nachgegangen werden, ob zu diesem Zeitpunkt noch Effekte Beweglichkeitsleistungen beobachtbar sind. Auf deren Grundlage wurden in dieser Arbeit auch Beobachtungen hinsichtlich nachhaltiger Trainingseffekte in einem Zeitraum von drei Wochen unternommen.
Diese Examensarbeit stellt nicht den Anspruch, eine repräsentative Analyse zu erstellen, vielmehr soll eine mögliche Wirkung von „untraditionellem“ Beweglichkeitstraining durch die zwei angewandten Dehnprogramme Dehnen nach dem PI-Effekt und dem intuitiven Stretching getestet und überprüft werden. Dies wird vor- und dargestellt sowie kritisch betrachtet und hinterfragt. Um dies zu erreichen, gliedert sich die Arbeit in zwei Teile, den theoretischen Grundlagen und der empirischen Untersuchung. Im theoretischen Bereich wird zu Beginn der Terminus Beweglichkeit näher betrachtet und ausführlich definitorisch bestimmt. Weiterhin wird die Beweglichkeit als Komponente der sportlichen Leistungsfähigkeit und den motorischen Fähigkeiten eingeordnet. Ferner wird auf die Bedeutung der Beweglichkeit im Alltag und im Sport eingegangen. Einen wichtigen Bestandteil bilden die leistungsbeeinflussenden bzw. leistungslimitierenden Faktoren von Beweglichkeit, die sich in den Kapiteln Determinanten von Beweglichkeit und Physiologischer Exkurs zur Beweglichkeit wiederfinden. Diese Punkte liefern die Basis für den folgenden, der sich mit dem Thema der Trainingseffekte der Beweglichkeit befasst. Voraussetzend wird der Begriff Training näher erläutert und in Bezug zu dem speziellen Training, dem hier behandelten Beweglichkeitstraining gesetzt. Folglich werden die klassischen und die neueren Dehnmethoden sowie das alternative Stretching vorgestellt. Einen wichtigen Baustein dieser Arbeit bildet der Bezug zur praktischen Umsetzung des Beweglichkeitstrainings im Schulsport. Dieses Thema wird im Kapitel Beweglichkeitstraining im Schulsport angesprochen und unter altersbedingten Voraussetzungen des Kinder- und Jugendalters gesetzt. Abschließend werden die Effektivität der Dehnmethoden und der aktuelle Forschungsstand der Trainingseffekte als weiterer wichtiger Baustein dieser Arbeit dargestellt.
Ausgehend von den vorgestellten Erkenntnissen der theoretischen Grundlagen von Beweglichkeit und Beweglichkeitstraining, beginnt die empirische Untersuchung mit der Beschreibung der Ansatzstellen dieser Arbeit und den methodischen Überlegungen zur durchgeführten Untersuchung. Auf Grundlage der theoretischen Auseinandersetzung und den voraussetzenden Bezügen werden nun die zentralen Fragestellungen in Hypothesen umgewandelt. Weiterhin wird die konkrete Untersuchungsmethodik, mit dessen Variablen vorgestellt. Hierzu gehört die Vorstellung der Versuchsgruppen, dem Versuchsort, der Treatmentstichprobe und der Beweglichkeitstests sowie der Ablauf der Untersuchung. Nach der Vorstellung der angewandten statistischen Methode, werden die Beweglichkeitstests ausgewertet und die Ergebnisse dargestellt. Daraufhin folgt eine kritische Diskussion der vorher genannten Ergebnisse der Untersuchung mit einem abschließenden Gesamtfazit und einem kurzen Ausblick für zukünftige Untersuchungen, die sich mit dem Beweglichkeitstraining, vielleicht auch im Rahmen des Sportunterrichts, beschäftigen werden.
2 Beweglichkeit und Beweglichkeitstraining
2.1 Begriffsbestimmung von Beweglichkeit
Die Sportwissenschaft bedient sich beim Begriff Beweglichkeit einer großen Anzahl synonymer Bezeichnungen. So wird Beweglichkeit (Harre, 1986, S. 180; Bös & Mechling, 1983, S. 198; Hohmann et al. 2003, S. 241) auch als Flexibilität (Grosser, 1989, S. 85; Adolph & Schmidt, 2004, S. 39; Tidow, 1997, S. 3; Hollmann et al., 2000, S. 152), Gelenkigkeit (Grosser, 1989, S. 85; Mende, 1989, S. 9), Biegsamkei t (Letzelter, 1983, S. 15), Dehnfähigkeit (Sölveborn, 1982, S. 7), Geschmeidigkeit (Knebel, 1985, S. 11), Gelenksbeweglichkeit (Grosser, 1977, S. 38), Wendigkeit (Letzelter, 1983, S. 15) oder die englische Bezeichnung flexibility (Röthig & Größing, 2003, S. 78) bezeichnet. Prinzipiell werden sie für den gleichen Sachverhalt gebraucht, trotzdem erscheint der Begriff Beweglichkeit inhaltlich und sprachlich am besten geeignet zu sein (Maehl, 1986, S. 10; Bös & Mechling, 1983, S. 199). So hat sich der Terminus Beweglichkeit in den letzten Jahren (Thienes, 2000, S. 9; Anrich, 2003, S. 15; Weineck, 2007, S. 1041) als feste Größe in der Wortvielfalt behauptet und wird auch in den weiteren Ausführungen dieser Arbeit als Terminus weitergeführt.
2.1.1 Definition von Beweglichkeit
Wie auch bei der Begriffsbestimmung, gibt es unterschiedliche definitorische Überlegungen zur Beweglichkeit. Es lassen sich zwei generelle Auffassungen finden, die einer „engen“ und einer „weiten“ Definition. Die enge Begriffsdefinition wird als die Fähigkeit verstanden, Körper- und Gliedmaßenbewegungen mit einer Schwingungsweite (Amplitude) ausführen zu können (Bös & Mechling, 1980, S. 464), die von dem anatomischen Aufbau des passiven Bewegungsapparates und der Dehnfähigkeit der Muskulatur, Sehnen und Bänder (aktiver Bewegungsapparat) zugelassen wird (Martin et al., 1999; S. 117; Klee & Wiemann, 2005, S. 8). Damit wird deutlich, dass die Beweglichkeit konstitutionelle und eine konditionelle Faktoren einschließt. Im weiteren Sinne wird neben der Gelenkigkeit auch die Komponenten motorische Reaktionsfähigkeit und psychomotorische Anpassungsfähigkeit berücksichtigt. Dabei wird der Begriff im Sinne von „Gewandtheit“ zur Fähigkeit, anatomisch vorgegebene und durch konditionelle Merkmale geprägte Reichweiten der Gelenke im Laufe von Bewegungen genau und zweckmäßig auszunutzen (Klee & Wiemann, 2005, S. 8).
Die Beweglichkeit lässt sich wie folgt unter den Termini Dehnfähigkeit und Gelenkigkeit unterscheiden (Thienes, 2000, S. 31).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2-1: Komponenten der Beweglichkeit (mod. nach Thienes, 2001, S. 6)
Wobei damit die Dehnfähigkeit von Muskeln, Bändern, Sehnen und Gelenkkapseln einerseits, sowie Gelenkigkeit als Ergebnis der anatomischen Bedingungen knöcherner Verbindungen, so genannter Gelenke (Kap. 3.2.2.1) gemeint sind.
Grundsätzlich lässt sich die Gelenkigkeit durch Training nicht verbessern, wobei die Dehnfähigkeit durch kontinuierliches Training eine beträchtliche Verbesserung der Beweglichkeitsleistung zulässt (Thienes, 2000, S.31).
2.1.2 Beweglichkeit als Komponente der sportlichen Leistungsfähigkeit
In der Leistungstheorie beziehungsweise Leistungslehre der Trainingswissenschaft gibt es für die Begrifflichkeit sportliche Leistungsfähigkeit auch den Terminus sportmotorische Leistungsfähigkeit. Damit sind beiderseits motorische Handlungsfähigkeiten einschließlich der Bewegungsfähigkeiten, speziell bei sportlicher Tätigkeit gemeint (Schnabel et al., 1994, 146f.). Die weiteren Ausführungen beschränken sich auf den Terminus sportliche Leistungsfähigkeit (Kap. 2.1.2)
Nach Weineck stellt die sportliche Leistungsfähigkeit den Ausprägungsgrad einer bestimmten sportmotorischen Leistung dar und wird aufgrund ihres komplexen Bedingungsgefüges von einer Vielzahl spezifischer Faktoren bestimmt (Weineck, 2007, S. 25).
Schnabel et al. (1994, S. 43) unterscheiden im Gegensatz zu Weineck die sportliche Leistungsfähigkeit, in die „inneren“ und die „äußeren“ Leistungsvoraussetzungen. Zu den äußeren, auch „apersonale“ Leistungsvoraussetzungen (Thienes 2001, S. 10) genannt, gehören Rahmenbedingungen wie zum Beispiel die Beschaffenheit von Sportanlagen, Sportgeräte und Ausrüstungen; das Interaktionsverhalten der Spieler einer Mannschaft; klimatische Bedingungen oder die Beziehungen zu Trainer und Betreuer und so weiter. Ein sportliches Training richtet sich aber zumeist auf die personalen Leistungsvoraussetzungen (Schnabel et al., 1994, S. 43; Thienes, 2001, S. 10)
Als personale Faktoren der sportlichen Leistungsfähigkeit werden die einzelnen konditionellen Fähigkeiten, taktisch-kognitive Fähigkeiten, psychischen Eigenschaften (Harre, 1986, S. 62), veranlagungsbedingte, konstitutionelle und gesundheitliche Faktoren sowie soziale Fähigkeiten genannt (Weineck, 2007, S.25).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2-2: Vereinfachtes Modell der Komponenten der sportlichen Leistungsfähigkeit
(mod. nach Weineck, 2007, S. 25)
Die Technik wird in koordinative Fähigkeiten und Bewegungsfertigkeiten unterteilt. „Koordinative Fähigkeiten sind Prozesse der Bewegungssteuerung und –regelung (Hohmann et al., 2003, S. 103). „Sie befähigen den Sportler, motorische Aktionen in vorhersehbaren und unvorhersehbaren Situationen sicher und ökonomisch zu beherrschen und sportliche Bewegungen relativ schnell zu erlernen“ (Weineck, 2007, S. 793). Sie gelten zum einen als eigenständiger Lerninhalt wie zum Beispiel beim Gleichgewichtstraining, zum anderen als Ergänzung des Techniktrainings (Thienes, 2000, S. 12).
Die Bewegungsfertigkeiten bzw. sportartspezifischen Fertigkeiten nach Thienes (2000, S. 11) beinhalten die jeweiligen Techniken einer Disziplin, wie zum Beispiel die Schlagtechniken im Tennis oder die Wurftechniken in der Leichtathletik. Bewegungsfertigkeiten sind somit ein Ergebnis langwieriger sportartspezifischer Lernprozesse. Die koordinativen Fähigkeiten unterscheiden sich demnach von den Bewegungsfertigkeiten in der Ausführung der Bewegungshandlungen. Bewegungsfertigkeiten beziehen sich auf verfestigte, teilweise auch automatisierte konkrete Bewegungshandlungen. Im Gegensatz dazu stellen die koordinativen Fähigkeiten generalisierte, für eine ganze Reihe von Bewegungshandlungen grundlegende Leistungsvoraussetzung des Menschen dar (Hirtz, 1981, S. 349).
Unter dem Begriff Taktik versteht man im Hinblick auf die sportmotorische Leistungsfähigkeit das Training oder einen Wettkampf zu analysieren, Handlungspläne und Entscheidungsalternativen zu entwickeln und das Trainings- und Wettkampfverhalten so zu regulieren, dass ein optimaler sportlicher Erfolg möglich wird (Hohmann et al., 2003, S. 123).
Die Taktik beziehungsweise Wettkampftaktik richtet sich meist am Leistungspotenzial des Gegners aus. Dabei spielen sowohl individuelle (Individualtaktik), als auch kollektive (Gruppen- oder Mannschaftstaktik) Leistungskomponenten eine wichtige Rolle (Thienes, 2000, S. 12; Hohmann et al., 2003, S. 123). Für einen erfolgreichen Wettkampf sind auch die kognitiv-taktischen und psychischen Leistungsvoraussetzungen unabdingbar. Sie führen dazu, dass der Spieler schwierige Wettkampfsituationen objektiv analysiert und seine Entscheidungen einer neuen Spielsituation anpasst (Hohmann et al., 2003, S. 123).
Unter den körperlichen Gegebenheiten werden veranlagungsbedingte, konstitutionelle und gesundheitliche Faktoren gemeint. Dieser Aspekt kommt hauptsächlich im Hochleistungssport und somit im Grenzbereich körperlicher Leistungsfähigkeit vor. Dazu gehören Sportarten wie Fußball oder Turnen, in denen häufige Verletzungen und Überbelastungssyndrome den körperlichen Zustand belasten (Thienes, 2000, S. 13). Die konstitutionell veranlagungsbedingte körperliche Leistungsfähigkeit findet dann zumeist bei den körperbaulichen Eigenschaften seine Grenzen (Martin, 1999, S. 72f.).
Die psychischen Fähigkeiten sind wichtige Entscheidungsträger in schwierigen Wettkampfsituationen. Sie sind ein Indiz für das konditionelle und koordinativ-technische Potenzial eines Spielers. Um also ein hohes konditionelles, technisches und taktisches Leistungsniveau zu erreichen, muss eine optimale psychische Bereitschaft und Stabilität vorhanden sein (Thienes, 2000, S. 12).
Der Begriff Kondition umfasst die motorischen Fähigkeiten Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit bzw. hier Flexibilität. Nach Grosser & Starischka (1989, S. 9) beinhaltet die Kondition mit deren Eigenschaften eine gewichtige Summe der körperlichen Fähigkeiten und kann somit als Ausdruck des Trainingszustandes beschrieben werden. Dieser Aussage liegt zu Grunde, dass unter den konditionellen Fähigkeiten ursächlich energetische Faktoren bestimmbarer Leistungsbereiche zusammengefasst werden (Thienes, 2000, S. 11). Die Beweglichkeit nimmt unter den konditionellen Fähigkeiten eine besondere Stellung ein. Sie gehört eher zu den konstitiutionellen als zu den energetischen Leistungsvoraussetzungen (Schnabel et al., 1994, S. 148). (Kap. 2.1.3)
Als letzte Komponente nennt Weineck (Abb. 2.2) die soziale Fähigkeit. Sie gehört wie schon oben erwähnt, nach Meinung von Schnabel et al. (1994, S. 43) und Thienes (2000, S. 10) zu den apersonalen Leistungsvoraussetzungen. Weineck integriert sie in die Übersicht der wesentlichen Faktoren der sportlichen Leistungsfähigkeit, ohne sie zu differenzieren. Gleichermaßen werden damit aber die sozialen Interaktionen im Sport gemeint. Also die Kompetenz soziale Beziehungen herzustellen und mit andern Menschen zu kommunizieren (Kent, 1998, S. 385). Beziehungen zwischen Trainer und Betreuer, die soziale Akzeptanz in der Gruppe oder auch die Integrationsfähigkeit.
Die Darstellung der einzelnen Komponenten sportlicher Leistungsfähigkeit soll aufzeigen, dass es eine Vielzahl von Voraussetzungen und Bedingungen bedarf, um hohe sportliche Leistungen zu ermöglichen. Der Flexibilität beziehungsweise Beweglichkeit aber wird als einer dieser Komponenten eine wesentliche Bedeutung zugesprochen (Schönthaler et al., 1998, S. 223). Nach Schönthaler et al. (1998, S. 223) ist eine Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit, die aus trainingstheoretischer Sichtweise auf ein umfassendes Zusammenwirken von anatomisch-funktioneller, kognitiv-affektiver und situativer Komponenten beruht, neben der genetischen Bestimmung und der Verbesserung sportmotorischer Fertigkeiten grundsätzlich vom Ausprägungsgrad der Beweglichkeit als sportmotorische Fähigkeit abhängig.
2.1.3 Einordnung in die motorischen Fähigkeiten
Ähnlich vielfältig wie das Begriffsspektrum zu sportlicher Leistungsfähigkeit ist die Auseinandersetzung der Einordnung von Beweglichkeit in die motorischen Fähigkeiten (Bös & Beck, 1995, S. 9). Grundlach (1968) und Mattausch (1973) ordnen die Beweglichkeit explizit zu den koordinativ determinierten Fähigkeiten. Meinel (1976) wiederum vertritt die Auffassung, dass Beweglichkeit nicht eindeutig konditionell oder koordinativ determiniert ist (Bös & Mechling, 1983, S. 198).
Nach Bös & Beck (1995, S. 9) werden die motorischen Fähigkeiten auf der Hierarchie in energetische, determinierte, konditionelle und in informationsorientierte koordinative Fähigkeiten unterteilt. In einer weiteren Stufe werden die zentralen Komponenten Kraft, Ausdauer, Koordination, Schnelligkeit und Beweglichkeit unterschieden, wobei die Schnelligkeit und die Beweglichkeit nicht eindeutig zu den konditionellen oder den koordinativen Fähigkeiten zugeordnet wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2-3: Systematisierung motorischer Fähigkeiten. (mod. nach Bös 1987, S. 94)
(AA aeorobe Ausdauer, AnA Anaerobe Ausdauer, KA Kraftausdauer, MK Maximalkraft, SK Schnellkraft, AS Aktionsschnelligkeit, RS Reaktionsschnelligkeit, KZ Koordination unter Zeitdruck, KP Koordination bei Präzisionsaufgaben, B Beweglichkeit)
Auch Hirtz (1994, S. 138) und Meinel & Schnabel (1998, S. 227) sind der Überzeugung, dass die Beweglichkeit weder zu den konditionellen noch zu den koordinativen Fähigkeiten gerechnet werden kann, und somit eine Art Zwischenstellung einnimmt. Sie besitzt eine konstitutionelle, eine energetisch-konditionelle und eine koordinative Grundlage.
Auf der konstitutionellen Ebene ist die Beweglichkeit hauptsächlich von den anatomischen Bedingungen des passiven Bewegungsapparates, von dem Bau der Gelenke, der Dehnbarkeit der Gelenkkapseln, Sehnen und Muskelhüllen (Faszien) bestimmt. Als energetisch-konditionelle Komponente wird die Kraftfähigkeit der bewegenden Muskeln gemeint, wenn sie in den Grenzbereichen der möglichen Exkursion gegen einen erhöhten inneren Widerstand arbeiten müssen. Koordinativ ist die Beweglichkeit bestimmt, weil sie eine stufenweise und zeitlich genaue Dosierung von Aktivität und Entspannung der Muskeln (der Agonisten, Antagonisten und Synergisten) erforderlich macht (Meinel & Schnabel, 1998, S. 227).
Im Bezug auf die weiteren Ausführungen wird Beweglichkeit nach Hirtz (1994, S. 138), sowie nach Schnabel & Meinel (1998, S. 227) als Mittelposition zwischen den konditionellen und den koordinativen Fähigkeiten angesehen und kann somit keiner Fähigkeit exakt zugeordnet werden.
2.1.4 Formen der Beweglichkeit
Die Beweglichkeit untergliedert sich grundsätzlich in drei unterschiedliche Merkmale:
1. nach ihrem sportartspezifischen Bezug,
2. danach, ob die Bewegungsamplitude länger aufrechterhalten werden kann, und
3. nach der Art der Krafteinwirkung, bei der eine große Amplitude und außergewöhnliche Haltungen ermöglicht werden (Thienes, 2000, S. 33).
Daraus ergibt sich folgende schematische Darstellung der Beweglichkeit in Erscheinungsweisen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2-4: Formen der Beweglichkeit (mod. nach Letzelter, 1983, S. 15)
Die allgemeine Beweglichkeit beschreibt das durchschnittlich entwickelte Bewegungsausmaß in den drei großen Gelenksystemen des Körpers: Schultergelenk, Wirbelsäule und Hüftgelenk. Sie besitzt für den Sport und die sportliche Leistung eine nur untergeordnete Bedeutung und wird allenfalls innerhalb der Beweglichkeitsschulung im Grundlagentraining angewandt (Letzelter, 1983, S. 15f.).
Die spezifische Beweglichkeit zielt auf die überdurchschnittlichen Beweglichkeitsanforderungen einer bestimmten Disziplin. Die Beweglichkeit bezieht sich dabei auf bestimmte, in den Bewegungsabläufen bevorzugt beanspruchte Gelenke. So beanspruchen zum Beispiel die Hürdenläufer überdurchschnittlich die Hüftbeugefähigkeit des Hürdenbeines und die Spreizfähigkeit des Abdruckbeines und auch Turner benötigen zum „Ein- und Auskugeln“ im Schultergelenk eine entsprechend spezielle Beweglichkeit (Letzelter, 1983, S. 15; Grosser et al., 2004, S. 153; Klee & Wiemann, 2005, S. 9).
Unter aktiver Beweglichkeit soll hier die größtmögliche Bewegungsamplitude, die in einem Gelenk durch innere Kraftentwicklung der Muskulatur und der resultierenden Dehnung der antagonistischen Muskeln erreichbar ist, verstanden werden. Antagonisten sind zum Beispiel der m. biceps und der m. triceps brachii, die an dem Ellbogengelenk gegensätzliche Bewegungen bewirken (Thienes, 2000, S. 34).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2-5: Beispiele aktiver Beweglichkeit bzw. Eigendehnung (a) und passiver Beweglichkeit bzw. Fremddehnung (b) (Harre, 1986, S. 182)
Im Gegensatz dazu ist die passive Beweglichkeit die größtmögliche Bewegungsamplitude in einem Gelenk, die unter Einwirkung äußerer Kräfte, wie zum Beispiel der Schwerkraft eines Trainingspartners oder eines Gerätes, erreicht werden kann. Naturgemäß ist die passive Beweglichkeit größer als die aktive Beweglichkeit (ebd., Klee & Wiemann, 2005, S. 9).
Harre übte schon in den 70er Jahren Kritik an der Verwendung der Begriffe aktive und passive Beweglichkeit. Seiner Meinung nach würden sie den Sachverhalt nicht exakt widerspiegeln, da selbst das passive Dehnen, zum Beispiel durch Partnerhilfe, eine aktive Komponente, nämlich die Entspannungsfähigkeit der Antagonisten, enthalten würde. Gleiches übernimmt er bei den aktiven und passiven Dehnübungen (Kap. 2.3.3) (Harre, 1986, S. 181).
Weiter wird zwischen der statischen und dynamischen Beweglichkeit unterschieden. Die statische Beweglichkeit erfordert das Halten einer Gelenkstellung über eine gewisse Zeit. Die Gelenkstellung kann dabei aktiv, durch den Sporttreibenden selbst, oder passiv, durch äußere Kräfte (siehe oben) eingenommen werden. Ein Beispiel wäre hierzu die Standwaage beim Turnen. Das Halten der Standwaage in der Endstellung erfolgt in beiden Fällen aktiv (Maehl, 1986, S. 15; Grosser et al., 2004, S. 154).
Die dynamische Beweglichkeit hingegen ist charakterisiert durch ein kurzfristiges erreichen der Bewegungsweite, die durch Schwingen, Wippen oder Nachfedern erreicht werden kann. Auch hier gilt: Die dynamische Beweglichkeit ist stets größer als die statische Beweglichkeit (Thienes, 2000, S.36).
In der medizinischen Trainingstherapie existieren zudem zwei pathologische Erscheinungsformen: Die Überbeweglichkeit (Maehl, 1986, S. 61), beziehungsweise Hypermobilität und die eingeschränkte Beweglichkeit (Hypomoblilität). Sie unterscheiden sich markant in einem oder mehreren Gelenken von der normalen Beweglichkeit. Die normale Beweglichkeit wird durch eine anatomische Bewegungsgrenze, eine limitierte maximale Bewegungsamplitude bei passiven Bewegungen und eine physiologisch erreichbare Bewegungsamplitude der aktiven Bewegung definiert (Thienes, 2000, S. 37).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2-6: Hypermobilität in der Hals- und Lendenwirbelsäule (Tittel, 1994, In: Wick, 2005, S. 77)"
Die Hypermobilität definiert eine über die anatomische Bewegungsgrenze hinausgehende Beweglichkeit. Mögliche Ursachen für hypermobile Gelenke können genetischer, trainingsbedingter Überbelastungen oder traumatischer Natur sein (Ückert, 2003, S. 140; Thienes, 2000, S. 37f.). Die Hypermobilität kann unter zwei Gesichtspunkten gesehen werden. Zum einen als Hinderungsgrund bei der Erzielung von sportlichen Leistungen. Hierbei wird die durch eine allgemeine Bindegewebsschwäche bedingte generalisierte Überbeweglichkeit oder veranlagte lokale Überbeweglichkeit praktische Ausübung von bestimmten Sportdisziplinen, wie zum Beispiel Ballsportarten, kaum zu realisieren sein. Im Gegensatz dazu kann die Hypermobilität auch als Voraussetzung zur Erzielung von Leistungen beziehungsweise Höchstleistungen angesehen werden. So ist eine lokale Überbeweglichkeit, die als Resultat eines extremen Trainings bestimmter Körperregionen wie zum Beispiel beim Turnen, in der Gymnastik, im Ballett oder im Speerwurf notwendige Voraussetzung um Höchstleistungen zu erbringen (Maehl, 1986, S. 61f.). Die Hypomobilität entspricht einer stark eingeschränkten Bewegungsamplitude in einem oder mehreren Gelenken. Diese pathologische Erscheinungsform kann infolge einseitiger hoher muskulärer Belastungen, die mit Muskeldysfunktionen (muskuläre Dysbalancen) (Kap. 2.3.6.2) einhergehen. Daraus ergibt sich eine zunehmende Einschränkung des möglichen Bewegungsausmaßes und benötigt deshalb eine spezielle Behandlung des Trainierenden und einer gleichzeitigen Umstellung des Trainings (Ückert, 2003, S. 141).
2.1.5 Bedeutung der Beweglichkeit
Schon Harre sprach in den 80er Jahren der Beweglichkeit eine hohe Bedeutung zu. Er meinte, dass die Beweglichkeit eine „elementare Voraussetzung für eine qualitativ und quantitativ guten Bewegungsausführung“ sei (Harre, 1986, S. 180). Eine optimale Ausbildung wirkt sich in komplexer Weise positiv auf die Entwicklung koordinativer, konditioneller Fähigkeiten und sportlicher Fertigkeiten aus und führt damit zu einer Steigerung der sportlichen Handlungsmöglichkeiten (Maehl, 1986, S. 56f.). Bei einer gut ausgebildeten Beweglichkeit können Übungen mit einer größeren Bewegungsamplitude schneller, leichter, kräftiger, fließender und ausdrucksvoller ausgeführt werden (Weineck, 2007, S. 738). Nach Bös & Mechling (1980, S. 464) spielt die Beweglichkeit im Gefüge jedoch keine leistungsbestimmende, aber eine leistungsbegrenzende Rolle. Weiterhin nennt Weineck Vorteile hinsichtlich der Verletzungsprophylaxe (Kap. 2.3.6.4). Denn eine optimal entwickelte Beweglichkeit kann zu einer hohen Elastizität, Dehnbarkeit und Entspannungsfähigkeit der beteiligten Muskeln und Sehnen führen, und leistet somit einen bedeutenden Anteil für eine gute Belastungsverträglichkeit (Weineck, 2007, S. 739).
Die Beweglichkeit ist aber nicht nur in der Sportmotorik eine Voraussetzung für optimale Bewegungsausführungen sondern ist auch in der Alltagsmotorik Bedingung zur mühelosen Erledigung von Alltagstätigkeiten. Als Alltagstätigkeiten werden Reinigungs-, Haus- und Gartenarbeiten oder einfach das An- und Auskleiden bezeichnet. Manchmal kann es notwendig sein, schnell und geschickt auf alltägliche Situationen zu reagieren, und Hindernissen auszuweichen oder Gefahrensituationen zu umgehen. Das ist besser umsetzbar, je mehr der Körper zu großen Bewegungsamplituden fähig und in der Lage ist, diese schnell und zielsicher anzuwenden (Klee & Wiemann, 2005, S. 12f.).
Die Beweglichkeit gehört zu den motorischen Eigenschaften, die im Altergang am schnellsten rückläufig ist. Somit sollte eine Beweglichkeitsschulung ein fester eigenständiger Bestandteil jedes Trainings beziehungsweise Sportunterrichtes sein (Weineck, 2007, S. 738).
2.1.6 Determinanten von Beweglichkeit
Die Determinanten der Beweglichkeit sind Faktoren, die die Beweglichkeit beeinflussen. Laut Maehl (1986, S. 11) werden sie in exogene Faktoren, wie zum Beispiel die Tageszeit, den Grad der Erwärmung und die Außentemperatur sowie in endogene Faktoren eingeteilt. Hierzu gehören das Alter, die psychische Verfassung und das Geschlecht.
Darüber hinaus können die endogenen Faktoren nach ihrem Grad der Beeinflussung hinsichtlich ihrer Beweglichkeit unterteilt werden. Zum einen in beeinflussbare Faktoren, womit die Dehnfähigkeit der antagonistischen Muskulatur, neurophysiologische Bedingungen sowie antagonistische Kraft und Stoffwechsel gemeint sind (Kap. 2.2.1). Andererseits in kaum beeinflussbare Faktoren, hierzu gehören die Struktur des Gelenks, der Muskelmasse (Kap. 2.2.2) und anthropogene Voraussetzungen (Maehl, 1986, S. 11; Schönthaler & Ohlendorf, 2002, S. 12).
Weiterhin wird den tageszeitlichen Veränderungen der Beweglichkeit hohe Bedeutung zugesprochen. Die Beweglichkeit ist morgens nach dem Aufstehen, gegen 9 Uhr am geringsten, wobei im Tagesverlauf das Bewegungsausmaß zunimmt (Schönthaler & Ohlendorf, 2002, S. 12; Grosser et al., 2004, S. 167; Ückert, 2003, S. 145). Bei einer Zunahme der Außen-, Haut- und Muskeltemperatur vergrößert sich das Beweglichkeitsausmaß signifikant, bei entsprechendem Abkühlen der genannten Faktoren, verringert sich die Bewegungsamplitude. Bereits ein wärmendes Bad kann äußerst positive Auswirkungen auf die Beweglichkeit haben. Grund dafür ist die Tatsache, dass alle Stoffwechselvorgänge unter erhöhter Temperatur schneller ablaufen und sich Reibungswiderstände innerhalb der Muskulatur und auch im Gelenkbereich verringern (Grosser et al, 2004, S. 167; Thienes, 2000, S. 56f.).
Ein ermüdendes Training kann zu einer Verringerung der Bewegungsreichweite führen. Ückert (2003, S. 146) liefert einen Erklärungsansatz, bei dem biomechanische Prozesse direkte Auswirkungen auf die Beweglichkeit haben. Denn nach einem anstrengenden Training nimmt der ATP-Spiegel in der Muskulatur ab. Dabei können die Brückenbindungen der Aktin- und Myosinfilamente aufgrund der fehlenden „Weichmacherwirkung“ des ATPs nicht so schnell gelöst werden wie im ausgeruhten Zustand. Darüber hinaus wird die Erschöpfung des Muskeltonus (Kontraktionszustand nach Kent, 1998, S. 282) erhöht, wodurch der Dehnung ein höherer Widerstand entgegengesetzt wird. Ein müder Muskel ist somit weniger dehnfähig und auch verletzungsanfälliger als ein „frischer“ Muskel (ebd).
Als endogener Faktor nimmt das Alter einen gewichtigen Einfluss auf die Beweglichkeit. Grundlegend kann man sagen, dass die Beweglichkeit im fortschreitenden Alter abnimmt. Jugendliche zwischen 14-21 Jahren weisen bereits im Vergleich zu Kindern zwischen 6-12 Jahren eine deutlich schlechtere Beweglichkeit auf. Gründe dafür sind zum Beispiel eine Verminderung der Zellzahl, zunehmenden Wasserverlust und die Verringerung der Anzahl an elastischen Fasern (Sehnen, Bänder, Muskelfaszien) (Ückert, 2003, S. 145; Thienes, 2000, S. 56).
Auch das Geschlecht nimmt in allen Alters- und Entwicklungsphasen, vor allem in der Pubertät einen starken Einfluss auf Beweglichkeitsleistungen. Mädchen respektive Frauen weisen eine höhere Beweglichkeit gegenüber Jungen und Männern auf (Schwab, 1993, S. 5). Grosser et al. (2004, S. 166) meinen, dass zum einen in der Form der Gelenke anatomische Unterschiede bestehen, und zum anderen bei Frauen die Knochenführung nicht so ausgeprägt ist wie bei Jungen beziehungsweise Männern und für das Gelenk eine größere Bewegungsamplitude besteht. Beispielsweise wäre hier die besondere Überstreckbarkeit der Ellenbogengelenke bei der Frau zu nennen (Grosser et al, 2004, S. 166). Nach Weineck (2007, S. 745) wird die Elastizität und Dehnungsfähigkeit der Muskulatur sowie der Bänder und Sehnen beim weiblichen Geschlecht als erhöhter angesehen. Die Ursache für die höhere Beweglichkeit wird auf hormonelle Unterschiede zurück geführt, damit ist der erhöhte Östrogenspiel und den damit resultierenden vermehrten Wasserretention und der erhöhte Fettgewebs- beziehungsweise verringerte Muskelmassenanteil des weiblichen Geschlechts gemeint. Somit beträgt bei Frauen am Beispiel des Oberarmquerschnitts, der Muskelanteil gegenüber eines Mannes nur 75,7%, der Fettanteil aber hingegen fast das Doppelte (Fukunaga, 1976). Daraus folgt, dass die Dehnungsfähigkeit der Frau aufgrund der geringeren Gewebsdichte etwas erhöht ist (Weineck, 2007, S. 745).
Als bedeutsame leistungslimitierende Faktoren für die Beweglichkeit werden auch die psychische Verfassung und Stressfaktoren genannt. Der Muskel befindet sich auf Grund der Erregung des ZNS (zentrales Nervensystem) immer in einem Spannungszustand, auch unter Ruhebedingungen, wie zum Beispiel beim Schlafen. Durch psychische Belastungen, wie zum Beispiel Affekte, Ängste im Sport, private oder berufliche Spannungen, aber auch extreme Freude kann die Beweglichkeit stark beeinflusst werden. Der genannte Spannungszustand erhöht sich dann dermaßen, dass es zu Muskelverhärtungen kommen kann (Grosser et al., 2004, S. 167; Thienes, 2000, S. 59).
2.2 Physiologischer Exkurs zur Beweglichkeit
Die Bewegungsmöglichkeiten des Menschen basieren auf den funktionellen Gegebenheiten des passiven und aktiven Bewegungsapparates, dem Verhalten der unterschiedlichen Gewebe unter Dehnungsbedingungen sowie neuromuskulären Faktoren (Thienes, 2000, S. 39).
Zum passiven Bewegungsapparat gehören Knochen, Sehnen, Bänder, Knorpel, die durch ihre (sehr geringe) Elastizität und Dehnbarkeit sowie eine Bewegungshemmung des umgebenen Bindegewebes gekennzeichnet sind (Klee & Wiemann, 2005, S. 20). Den aktiven Teil bildet die Skelettmuskulatur, die durch ihre Fähigkeit der Kontraktion in der Lage ist, zwei gelenkig verbundene Knochen gegeneinander zu bewegen (Thienes, 2000, S. 39; Albrecht & Meyer, 2005, S. 6).
2.2.1 Der aktive Bewegungsapparat
Der aktive Bewegungsapparat ist primär durch die Muskulatur, speziell die Skelettmuskulatur gekennzeichnet. Sie stellt das größte Organ des menschlichen Körpers dar. Unter Abhängigkeit von Alter, Gewicht, Geschlecht, Trainingszustand etc. nimmt die Skelettmuskulatur etwa 40 % der Körpermasse und etwa 50 % des Gesamtkörperwassers ein (Berg, 2007, S. 159). Im Themenfeld Beweglichkeit und körperliche Leistungsfähigkeit spielt die quergestreifte Skelettmuskulatur, ihr Aufbau und ihre Funktionen sowie die Erscheinungsweisen ihrer Eigenschaften, eine entscheidende Rolle (Knebel, 1985, S. 32; Dickhuth et al., 2000, S. 127).
2.2.1.1 Die Skelettmuskulatur
Die Skelettmuskulatur besteht aus Hunderten verschiedener Muskeln, die einzeln mit mindestens zwei Sehnen an mindestens zwei Knochen des Skeletts befestigt sind. Darüber hinaus läuft jeder Muskel über mindestens ein Gelenk. Durch dieses Zusammenspiel und die Fähigkeit der Skelettmuskulatur sich zusammenzuziehen (Kontraktion), wird Bewegung möglich (Mießner, 2006, S.27).
Struktur des Muskels
Der Skelettmuskel wird von einer bindegewebigen Muskelhaut, der Muskelfaszie, ummantel. Sie grenzt den Muskel aufgrund ihres straffen Bindegewebes von der Umgebung ab. In Längsrichtung durchziehen den Muskel Hunderte nebeneinander liegende Faserbündel (Sekundärbündel). Diese wiederum umfassen mehrere hundert Primärbündel. Beide Bündel werden durch Bindegewebshüllen, das Epimysium und das Perimysium umhüllt. Epimysium und Perimysium ermöglichen einerseits eine freie Verschiebbarkeit der Faserbündel bei einer Kontraktion beziehungsweise Erschlaffung des Muskels, und andererseits vermindern sie durch das Herabsetzen der Reibung einen Kraftverlust. Die Primärbündel werden ihrerseits in Längsrichtung durch die kleinste selbstständige Baueinheit der Skelettmuskulatur, die Muskelfaser, durchzogen. Jede Muskelfaser wird von einer Membran umschlossen, der Muskelfasermembran. Das Sarkolemm ist ein Stumpf aus gitterähnlich verwobenen Bindegewebsfibrillen (kollagene Fibrillen) und umgibt die gesamte Muskelfaser. Die Bindegewebsfibrillen werden bei einer Dehnung der Faser in Längsrichtung gestrafft und bei einer Entdehnung wieder aufgelockert. Am Ende einer Muskelfaser gehen die Bindegewebsfibrillen in die kollagenen Fasern der Sehne über. Die Sehne gilt als Verbindung zwischen Muskel und Skelett. Neben dem Zellplasma (Sarkoplasma) besitzen die Muskelfasern noch das sarkoplasmatische Retikulum, den randständigen Zellkern, die für die Energieversorgung wichtigen Mitochondrien und vor allem die Myofibrillen (Klee & Wiemann, 2005, S. 28). Diese fadenförmigen Eiweißstrukturen, auch „Kraftkammern“ genannt, werden nach dicken und dünnen Myofilamenten differenziert. Diese erscheinen im lichtmikroskopischen Bild als abwechselnd helle und dunkle Streifen, somit ergibt sich die quergestreifte Struktur der Muskulatur. Die Streifen bilden die funktionelle Untereinheit, die so genannten Sarkomere. Sie sind der eigentliche Teil des Muskels, in dem Verkürzungsprozesse stattfinden. An den beiden Enden des Sarkomers befinden sich 2000 dünne Filamente, die unter anderem aus Aktin(filamenten) und Myosin(filamenten) bestehen. Sie arbeiten beide als Partner (Aktomyosin-System) bei der Muskelkontraktion zusammen und das Aktin agiert zudem als Hauptprotein der dünnen Filamente, die sich beim Übergang in das nächste Sarkomer zu Z-Streifen (I-Banden) verdichten. In der Sarkomermitte befindet sich die M-Linie, an der ca. 1000 (dicke) Myosinfilamente an ihren Mittelstücken miteinander verknüpft sind. Diese bilden eine A-Bande (Klee & Wiemann, 2005, S. 28; Dickhuth et al., 2000, S. 130). Je nachdem, ob sich die Myosinfilamente und die Aktinfilamente überlappen, befindet sich der Muskel in Ruhe- oder Kontraktionszustand. Darüber hinaus gibt es noch Proteine, die das Zytoskelett der Myofibrillen bilden. So zum Beispiel das (Kap. 2.2.3.1, Kap 2.3.8.1) und das Nebulin. Sie sind Proteine innerhalb des Sarkomers, die hauptsächlich für die Skelettmuskelelastizität im Ruhezustand beziehungsweise für die Anordnung von Aktin verantwortlich sind (Dickhuth et al., 2000, S. 130f.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2-7: Struktureller Aufbau der Skelettmuskulatur (mod. nach Markworth, 1983, S. 29)
Auf Besonderheiten bei der Dehnung des Muskels wird im Kapitel weiter eingegangen.
2.2.2 Der passive Bewegungsapparat
Das menschliche Skelett besteht aus ca. 200 Knochen. Sie nehmen je nach Länge, Stärke oder Entwicklungsgrad Einfluss auf unser äußeres Erscheinungsbild. Die Knochen können somit als Gerüst des Körpers bezeichnet werden. Wegen ihrer bemerkenswerten Bauweise sind sie verhältnismäßig leicht, stabil und weisen dennoch eine gewisse Flexibilität auf (Mießner, 2006, S. 25). In den weiteren Ausführungen werden die Gelenke, Sehnen und Bänder als elementare, beweglichkeitslimitierende Bestandteile des passiven Bewegungsapparats nach der Einteilung nach Mießner (2006, S. 25ff.) und Thienes (2000, S. 39ff.) erörtert.
2.2.2.1 Gelenke
Eine von vielen Voraussetzungen für Bewegung im Alltag und Sport sind die Gelenke, welche immer durch zwei aufeinander treffende Knochenenden gebildet werden (Mießner, 2006, S. 26).
Im Rahmen des passiven Bewegungsapparats kommt der Architektur der Gelenke eine spezielle Bedeutung zu (Klee & Wiemann, 2005, S. 20). Die Gelenkigkeit kann ebenso wie die Dehnfähigkeit der Muskeln, allerdings in einem begrenzten Umfang, in ihrer Beweglichkeit verbessert werden. (Weineck, 2007, S. 741). Die Bewegungsrichtung und die jeweilige Bewegungsamplitude wird durch die Form der an der Gelenkbildung beteiligten Gelenkbänder, die Anordnung der Gelenkkörper, die Formen der Gelenkhemmung und die knöcherne Umgebung der Gelenke bestimmt (Klee & Wiemann, 2005, S. 20).
Je nach Ausbildung der genannten Strukturen unterscheidet man verschiedene Gelenkstypen. Wenn die miteinander verbundenen Knochen nicht gegeneinander beweglich sind, also eine kontinuierliche Knochenverbindung besteht, nennt man diese Verbindungen unechte Gelenke (Synarthrosen oder Haft) (Lötzerich, 2001, S. 35 Thienes, 2000, S. 45). Je nach Art der Verbindung werden Bandhaften (Syndesmosen), Knochenhaften (Synostosen) oder Knorpelhaften (Synchondrosen) unterschieden.
Die Synarthrosen, wie zum Beispiel die Verbindung von Elle und Speiche oder die verknöcherten Verbindungen des Kreuzbeines, erlauben keine oder nur sehr geringe Bewegungsfreiheit (Mießner, 2006, S. 26; Thienes, 2000, S. 45).
Die echten Gelenke (Diathrosen), wie zum Beispiel das Schulter-, Knie- oder Hüftgelenk, werden im Allgemeinen von zwei Knochenenden gebildet, dem Gelenkkopf (konvex) (Abb. 2-8 [1]) und der Gelenkpfanne (konkav) (Abb. 2-8 [2]). Diese sind mit einer hyalinen, druckelastischen Knorpelschicht (Abb. [3]) überzogen und werden von einer doppelschichtigen Gelenkkapsel (Abb. 2-8 [4] und [5]) umschlossen (De Mareés, 1994, S. 10).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2-8: Schematischer Aufbau eines Gelenks (Frontalschnitt"
Die Diathrose ist zudem durch einen Gelenkspalt zwischen den Knochenenden charakterisiert.
In dem Spalt zwischen den Gelenkflächen befindet sich die Gelenkschmiere (Abb.
2-8 [6]), welche zusammen mit der Gelenkkapsel ein reibungsfreies Gleiten der
Gelenkflächen aufeinander garantiert (Thienes, 2000, S. 45). Zu den genannten Bestandteilen eines Gelenks, gehören noch die Verstärkungsbänder beziehungsweise Hemmungsbänder (Abb. [7]). Sie übernehmen einen Teil der Funktionen der Gelenkkapsel, zudem sichern sie noch den Zusammenhalt der Gelenkflächen und schränken das Ausmaß der Bewegungsmöglichkeiten ein (Tittel, 2003, S. 45).
Die Bewegungsfreiheit eines Gelenks hängt darüber hinaus davon ab, zu welchem Gelenktyp es gehört. Das Maß an Beweglichkeit wird nach der Anzahl der Freiheitsgrade bestimmt, die sich durch die Zahl der Gelenkkörper ergibt. Einfache Gelenke enthalten zwei Gelenkkörper in einer Kapsel. Wenn sich mehr als zwei Gelenkkörper in einer Kapsel, wie zum Beispiel beim Ellenbogengelenk, befinden, spricht man von zusammengesetzten Gelenken. Zudem können Gelenke aufgrund ihrer jeweiligen Bewegungsmöglichkeiten eingeteilt werden. Wenn ein Gelenk sich nur in einer Ebene, wie zum Beispiel beim Beugen und Strecken, bewegt, spricht man von einem Einachsigen Gelenk (Scharniergelenk, Abb. 2-9). Zweiachsige Gelenke, wie zum Beispiel das Sattelgelenk, vergrößern das Bewegungsausmaß, weil sie eine weitere Bewegungsebene erlauben. Freie oder Kugelgelenke werden als vielachsige Gelenke bezeichnet. Sie besitzen die maximale Ausschöpfung der Bewegungsmöglichkeiten, weil die gelenkbildenden Knochen nicht nur die Gelenkflächen zueinander verschieben, sondern noch eine Drehung um sich selbst zulassen. Als die wichtigsten Gelenkformen gelten das Walzengelenk, das Scharniergelenk, das Rad- und Zapfengelenk, das Kondylengelenk, das Kugelgelenk, das Eigelenk beziehungsweise Ellipsoidgelenk, das Sattelgelenk und das plane Gelenk (Klee & Wiemann, 2005, S. 21; Thienes, 2000, S. 45)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2-9: Gelenkformen und Bewegungsmöglichkeiten ( Tillmann & Töndury, 1998, S. 109)
Die schon oben vorgestellten Freiheitsgrade eines Gelenks bestimmen die Bewegungsmöglichkeiten, aber nicht das Ausmaß der erreichbaren Möglichkeiten. Denn das Bewegungsausmaß hängt von den umgebenden Strukturen eines Gelenks ab. Diese Einschränkung gibt dem Gelenk zwar Stabilität, Führung und Schutz, jedoch wird dabei die Bewegungsamplitude verkleinert und das Gelenk gehemmt (Klee & Wiemann, 2005, S. 23). Um die Gelenkbeweglichkeit einzuschränken bedient sich der menschliche Körper so genannten Vorrichtungen. Dazu gehören die Knochenhemmung, die Bänderhemmung, die Massenhemmung und die Muskelhemmung (Weineck, 1994, S.61).
Bei der Knochenhemmung (Abb. 2-10 [a]) stößt während einer Bewegung ein Knochenfortsatz des einen an einem Gelenk beteiligten Gelenkkörpers gegen einen zweiten Gelenkkörper. Damit wird jede weitere Bewegung des Gelenks gehemmt. Eine Massenhemmung (Abb. 2-10 [b]) liegt vor, wenn Binde- und Fettgewebe oder Muskelmasse die Gelenkamplitude in ihrer Beweglichkeit behindern (Klee & Wiemann 2005, S. 23). Man spricht von einer Muskelhemmung (Abb. 2-10 [c]), wenn die über mehrere Gelenke hinweg ziehenden Muskeln wegen ihrer passiven Spannung, der so genannten Ruhespannung (Kap. 2.2.3.1) die Gelenkbewegung stoppen (Klee & Wiemann, 2005, S. 24; Weineck, 1994, S. 61). Bei einer Bänderhemmung (Abb. 2-10 [d]) wird der Bandapparat eingeschränkt und damit das Überschreiten eines bestimmten Gelenkwinks unterbunden (Klee & Wiemann, 2005, S. 24).
2.2.2.2 Sehnen und Bänder
Sehnen und Bänder sind die Art von Gewebe im Körper, die vorwiegend bei Zugbewegungen beansprucht werden. Sie werden oft im Sport überbelastet und es kommt zu Verletzungen. Saziorski et al. (1984) meinen hierzu, dass bis zu 66 % der auftretenden Sportverletzungen auf Bänderzerrungen, -anrisse oder -risse zurück zuführen sind (Wick, 2005, S. 78).
Die Sehnen sind dafür zuständig, die von der Skelettmuskulatur entwickelte Kraft (Zugspannung) auf das knöcherne Gewebe zu übertragen (Thienes, 2000, S. 46) Sie bestehen aus straffen, kollagenen Bindegewebsfasern (Fibrillen), die parallel oder spiralartig ineinander verdreht sind (Klee & Wiemann, 2005, S. 32). Der Grund für ihre begrenzte Dehnbarkeit liegt an den spiralartigen Wicklungen und dem gegenüber der Muskulatur geringen Anteil an elastischem Material (Grosser et al., 2004, S. 159).
Die Bänder sind schwach durchblutete Bindegewebsstränge und haben vorwiegend die Aufgabe der Halte- und Führungsfunktion (Thienes, 2000, S. 48). Sie unterstützen an den Gelenkstrukturen und der Wirbelsäule die Gelenke in den vorgegebenen Freiheitsgraden. Sie bestehen ebenfalls aus straffem, elastizitätsarmem Bindegewebe (Hüter-Becker et al., 1999 zit. von Wick, 2005, S. 79). Je nach Aufgabe an den Gelenken lassen sie sich in Verstärkungs-, Führungs- und Hemmungsbänder unterscheiden. Verstärkungsbänder sind eine feste Verbindung zur Gelenkkapsel und unterstützen den Zusammenhalt des Gelenks. Die Führungsbänder halten den Gelenkkopf und die Gelenkpfanne (Kap.) während einer Bewegung fest. Die Hemmungsbänder gewährleisten Bewegungseinschränkungen zum Schutz beteiligter Strukturen vor Überbelastungen (Thienes, 2000, S. 48).
Eine unterschiedliche Anordnung und ein unterschiedlicher Anteil der kollagenen Fasern wirkt sich aber auf die Dehnbarkeit der Sehnen und Bänder aus. Wobei den Sehnen nur 2-6 % Dehnbarkeit zugesprochen wird, bieten die Bänder eine 20-35 % höhere Dehnbarkeit. Dieser Mechanismus bedeutet für den passiven Bewegungsapparat, wie die Knochen, Sehnen und Bänder, einen gewissen Schutz. Da Kräfte nicht schlagartig auf die Ansatzstellen an den Knochen übertragen, sondern leicht gedämpft werden. Zudem werden Sehnen auch Hilfsorgane des Muskels genannt. Denn sie besitzen für die Steuerung und Regelung der Muskeltätigkeit bedeutende sensorische Bausteine, die so genannten Sehnenspindeln (Golgi-Sehnen-Apparate Kap. 2.2.4), deren hauptsächliche Aufgabe es ist, Spannungen und Spannungsänderungen zu erfassen und dem ZNS zu melden (Hüter-Becker et al., 1999 zit. von Wick, 2005, S. 79).
2.2.3 Dehnfähigkeit des tendomuskulären Systems
Die in den vorigen Kapiteln genannten unterschiedlichen Gewebestrukturen des aktiven und passiven Bewegungsapparates weisen ein jeweils unterschiedliches Verhalten bei Längenänderungen auf (Thienes, 2000, S. 48). Nach Grosser et al. (2004, S. 160) kann dieser Gesamtkomplex in einem Dreikomponentensystem dargestellt werden. Dabei werden die kontraktilen, parallelelastischen und serienelastischen Komponenten differenziert (Grosser et al., 2004, S. 160). Die kontraktilen Elemente der Muskulatur (Aktin-Myosin-Komplex) besitzen plastische Eigenschaften und setzen der einwirkenden Kraft keinen fortwährenden Widerstand entgegen. Nach Aussetzen der Dehnbelastung kehren die Filamente nur teilweise in ihre Ausgangsposition zurück und es verbleibt ein Verformungsrückstand (Dickhuth et al., 2000, S. 135; Thienes, 2000, S. 48). Die serienelastische Komponente ist gekennzeichnet durch die Sehnen und Hälse der Myosinköpfe. Wohingegen der parallelelastische Teil unter anderem durch die Fasermembran und die Bindegewebsfascien entsteht (Grosser et al., 2004, S. 160). Sie setzen den einwirkenden Kräften einen zunehmenden Widerstand entgegen (Dickhuth et al., 2000, S. 135) und verhindern, dass die kontraktilen Filamente in Ruhe bei Dehnung auseinander gezogen werden. Wenn also ein passiver Muskel gedehnt wird, wird dabei die parallelelastische Komponente beansprucht. Bei der Dehnung eines aktiven Muskels hingegen werden serien- und paralleleastische Anteile in Anspruch genommen (Grosser et al., 2004, S. 160f.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2-11 : Muskelmodell eines Skelettmuskels (mod. nach De Marées, 1994, S. 38)
2.2.3.1 Die Dehnfähigkeit der Muskulatur
Ein Muskel in Ruhespannung (elastische Spannung des inaktiven Muskels) setzt einer beginnenden Dehnung zunächst keinen Widerstand entgegen (Wiemann et al., 1998, S.111). Zu sehen am flachen Anfangsteil der Kurve in Abb. 2-12. Die dehnende Kraft wird an den beiden Enden des Muskels über die Sehnen, die Transmembranfilamente und die Aktinfilamente auf die Sehnenfibrillen übertragen. Als Folge werden die Myofibrillen und somit auch die einzelnen Sarkomere in die Länge gezogen und eine Spannung eingenommen (Thienes, 2000, S. 50). Bei geringen Kräften verlängert sich der Muskel zunächst stark. Durch weitere Muskeldehnung müssen immer größere Kräfte zur weiteren Dehnungen aufgewendet werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2-12: Ruhespannungs-Dehnungs-Diagramm: A = Muskelansatz, U= Muskelursprung (Wiemann, 1993, S. 92)
Eine hohe Bedeutung wird in diesem Zusammenhang dem seit den 80er Jahren bekannt gewordenen Protein, dem so genannten Titin zugesprochen (De Marées, 1994, S. 37). Titinfilamente heften sich an die freien Enden der Myosinfilamente und verlaufen parallel zu den Myosinfilamenten bis hin zu den M-Scheiben. Als „Quelle der Ruhespannung“ (Wiemann et al., 1998, S. 111) gelten sie als „hochelastische molekulare Federn innerhalb der Sarkomere“. Deren Hauptaufgaben liegen im Zusammenhalten der Myosinmeleküle mittig zwischen den Z-Scheiben und im Verhindern des Ausbrechens des Myosins aus der parallelen Struktur, wenn bei extremer Dehnung nahezu keine Überlappung von Aktin und Myosin mehr vorhanden ist (Abb. 2-12 unten rechts) (Thienes, 2000, S. 50 f.). Darüber hinaus sind die Titinfilamente dafür zuständig, die Ruhelänge nach einer Dehnung des Sarkomers wieder herzustellen, während sie die Myosinfilamente wieder in Richtung Z-Scheibe in die Ausgangsposition zurückziehen (Abb. 2-12 links unten) (Wiemann et al., 1998, S. 112).
Der Kurvenverlauf in Abb. 2-13 zeigt, dass ein gedehnter Muskel bei Entdehnung nicht ganz in seine ursprüngliche Ausgangslage zurückkehrt. Es bleibt ein gewisser Dehnungsrückstand in einer vorher gedehnten Muskulatur zurück. Grund dafür sind das unterschiedliche Verhältnis zwischen Kraft und Längenänderung bei Dehnung und Entdehnung des Muskels (Thienes, 2000, S. 51). Der Unterschied zwischen Dehnungs- und Entdehnungskurve, hier grau unterlegt, wird als Hysterese bezeichnet (Schönthaler et al., 1998, S. 227).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2-13: Dehnungs-Spannungs-Diagramm eines Muskels (mod. nach Stegemann, 1984, S. 10)
Dieses unterschiedliche Verhalten der Muskulatur bei Dehnung und Entdehnung wird als Resultat der Reibungsverluste in der Phase der Entdehnung angesehen (Thienes, 2000, S. 51). Nach Freiwald besteht eine Hysterese nur nach kurzfristigem Dehnen. Wenn längerfristig gedehnt wird, also über mehrere Wochen, kommt es zu einer Anpassung des Gewebes und zur Erhöhung des Dehnungswiderstandes (Freiwald, 2006, S. 16).
2.2.3.2 Dehnungsverhalten des Bindegewebes (Sehnen, Bänder)
Das Bindegewebe speziell die Sehnen zeigen gegenüber der Muskutur ein anderes Verhalten bei Dehnung. Zu unterscheiden sind dabei das Spannungsverhalten der Sehnen bei einmaliger Dehnung und die Anpassung des Sehnenmaterials an lang andauernde Dehnbelastungen. Wie in Abb.2-14 zu erkennen ist, nimmt das Spannungs-Diagramm einer Sehne folgenden schematisierten Verlauf (Thienes, 2000, S. 51).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2-14: Spannungs-Dehnungs-Diagramm einer Sehne (mod. nach Ullrich, et al., 1994, S. 337)
Der in Abb. 2-14 sichtbare Dehnungsverlauf einer Sehne zeigt die charakteristischen Phasen (Glättung, Aufnahme, Anstieg, Reduktion, Abriss). In der a-Phase findet zunächst eine Glättung der welligen Struktur statt. Bei der Aufnahme der Zugspannung (Phase b) wird eine Verlängerung der Struktur um 1,5-4% gegenüber der Ausgangslänge erreicht. Nach dieser geringen Spannungszunahme erfolgt ein steiler Anstieg der Spannung (Phase c). Bei zunehmender Spannung flacht der Verlauf in Phase d zunächst ab. Beim Überschreiten der tolerierbaren Dehngrenze findet in Phase e eine Ruptur (Riss) des Gewebes statt (Thienes, 2000, S. 52; Grosser et al., 2004, S. 161).
Wird wie in Abb. 2-14 über einen längeren Zeitraum ein gewisser Dehnreiz konstant aufrechterhalten, zeigen sich zwei unterschiedliche Resultate. Zum einen findet in der bindegewebsartigen Struktur, zum Beispiel Sehne, eine Längenanpassung statt. Dies ist auf die viskoelastischen Eigenschaften des bindegewebigen Materials zurückzuführen. Die Abnahme der Spannung bei anhaltender konstanter Dehnung wird als längenkonstante Relaxation bezeichnet. Weiterhin zeigt sich, dass die effektive Länge der kollagenen Strukturen bei konstanter Spannung zunimmt und sehr langsam zurückgeht. Dieser Nachwirkungseffekt einer Dehnung bezeichnet man als creeping-Effekt (Grosser et al., 2004, S. 161). Mit diesem Phänomen wird klar, warum Beweglichkeitstraining bei Sehnen und bindegewebigen Strukturen der Skelettmuskulatur sehr lange Trainingszeiträume von etwa zwei bis sechs Monaten beanspruchen (Thienes, 2000, S. 52).
2.2.4 Neurophysiologische Faktoren der Dehnfähigkeit
Neben den mechanischen Bedingungen der Gelenke (Kap. 3.1.1) und der Skelettmuskulatur (Kap. 3.2.1) sowie den Gewebseigenschaften der Muskeln und des Bindegewebes (Kap. 3.3) besitzt auch das Nervensystem einen Einfluss auf die Beweglichkeit und Dehnfähigkeit. Diese Einflussnahme kann willkürlicher, unwillkürlicher und reflektorischer Art sein. Für die sensorische und motorische Versorgung des Muskels ist das zentrale Nervensystem (ZNS) und ist als übergeordnete Instanz für die muskuläre Kontraktion mittels eines nervalen Impulses verantwortlich (Albrecht & Meyer, 2005, S. 8; Klee & Wiemann, 2005, S. 32). Von den Nervenzellen des Gehirns laufen die motorischen Befehle über Nervenfasern zu den im Rückenmark befindlichen Nervenzellen (Alpha-Motoneuronen). Jedes Motoneuron innerviert dann über die peripheren Nerven die dazugehörigen Muskelfasern. Die Vorderhornzelle (Nervenzelle) und alle von ihr versorgten Muskelfasern bilden eine motorische Einheit. Jeder Muskel besteht aus einer Vielzahl von motorischen Einheiten. (Albrecht & Meyer, 2005, S. 8f.). Die Muskelfasern einer motorischen Einheit arbeiten alle mit der gleichen, vom Motoneuron vorgegebenen Intensität. Folglich kann die Stärke der Kontraktion eines Muskels zum einen durch die vom ZNS ausgewählte Anzahl der motorischen Einheiten und zum anderen durch den unterschiedlichen Grad der Aktivierung der Motoneurone entsprechend abgestimmt werden (Klee & Wiemann, 2005, S. 33).
Dem Zentralnervensystem werden über spezielle Sensoren erfasste Veränderungen der Muskellänge und die auf die Sehnen übertragene Zugspannung übermittelt. Die Längenveränderung wird innerhalb der Muskulatur durch ein längensensibles Kontrollsystem, der so genannten Muskelspindel registriert. Die in den Sehnen übertragene Stärke und Veränderung der Spannung wird von den so genannten Golgi-Organen (Sehnenorganen) erfasst (Thienes, 2000, S. 52). Die beiden „Feedback-Systeme“ (Grosser et al., 2004, S. 162) sollen im Folgenden beschrieben werden.
2.2.4.1 Der Muskelspindelreflex
Die Muskelspindeln sind kleine, wenige Millimeter lange, aus einer Vielzahl an Spindelfasern zusammengesetzte Organe, die an den Faserhüllen der Muskelfaser befestigt und von einer spindelförmigen, bindegewebigen Hülle umschlossen sind. Die Spindelfasern (intrafusale Fasern) bestehen aus einem nicht kontraktilen Mittelstück und zwei kontraktilen Endstücken (Klee & Wiemann, 2005, S. 34; De Marées, 1994, S. 63). An den beiden Enden sind die Muskelspindeln am Perimysium (Kap. 2.2.1.1; Abb. 2-7) den extrafusalen Fasern verbunden. Die Muskelspindeln liegen aufgrund ihrer baulichen Anordnung parallel zu den quergestreiften Fasern (kontraktile Fasern). Aufgrund dessen erfolgt eine synchrone Längenänderung der Muskelfaser (Grosser et al., 2004, S.162; De Marées, 1994, S. 63).
Die Muskelspindel verfügt über zwei Innervationsmechanismen, die afferente und die efferente Innervation. Die afferente Innervation erfolgt über afferente Nervenfasern, den primär sensiblen Endigungen (Ia-Fasern) und den sekundären Muskelspindelendigungen (II-Fasern). Die Ia-Fasern wickeln sich mehrmals um den kontraktilen Mittelteil der intrafusalen Fasern (Abb. 2-15) und verarbeiten dynamische Änderungen der Muskellänge und statische Dehnbelastung und leiten sie zum ZNS weiter. Die II-Fasern (Abb. 2-15) sind ausschließlich für die Registrierung statischer Dehnreize zuständig (Thienes, 2000, S. 54; Grosser et al., 2004, S. 163). Die Ia - und II-Fasern übermitteln somit Dehnungsmeldungen und informieren die im Rückenmark liegenden Motoneurone und auch die sensorischen Zentren im Gehirn über den Dehnungszustand des Muskels (Klee et al., 2005, S. 34). Neben der genannten afferenten Innervation verfügt die Muskelspindel noch über efferente Innervationen (Gamma-Innervationen). Deren Aufgabe ist es, die Schwelle und den Empfindlichkeitsbereich des Dehnungsrezeptors, unabhängig des gegenwärtigen Längenzustands des Muskels, im Bereich einer optimalen Messfähigkeit zu halten (Grosser et al., 2004, S. 165). Weiterhin besitzen die Muskelspindeln mit den so genannten Gamma-Fasern eine eigene motorische Erregungsleitung. Vergleichbar ist diese Innervation mit der Innervation der bekannten Muskelfasern durch Alpha-Motoneuronen. Dabei versorgt ein Gamma-Motoneuron mehrere intrafusale Fasern in unterschiedlichen Spindeln eines Muskels (Haase, 1976, S. 120 zit. von Thienes, 2000, S. 54).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2-15: Schematischer Aufbau einer Muskelspindel (mod. nach Schmidt et al., 1995, S. 98)
Aufgrund der miteinander verbundenen neuronalen Mechanismen der Muskelspindeln entstehen unterschiedliche Reflexe, die jeweils spezielle Funktionen für die Haltung und Bewegung sowie Regulierung der Muskelspannung und –länge besitzen. Zu den unterschiedlichen Reflexmechanismen gehören der monosynaptische Dehnungsreflex, die Gamma-Spindel-Schleife, die Alpha-Gamma-Koaktivierung und die Reziproke Hemmung. Aufgrund der Vielfalt an unterschiedlichen Reflexmechanismen wird in dieser Arbeit nur auf die für das Beweglichkeitstraining (Dehnmethoden) (Kap. 2.3.2) relevanten Mechanismen, den monosynaptischen Dehnungsreflexes und der Reziproken Hemmung eingegangen.
Der monosynaptische Dehnungsreflex auch Reflex der autogenen Erregung oder Eigenreflex genannt, ist dafür zuständig, die Muskellänge zu kontrollieren und zu regulieren. Das ist für das Aufrechterhalten eines Haltetonus in der Stützmotorik von Bedeutung (Thienes, 2000, S. 54; Grosser et al., 2004, S. 163). Wenn ein Muskel gedehnt wird, wird dies von den Muskelspindeln registriert und über afferente Impulse über die Ia- und II-Fasern zum Rückenmark weitergeleitet. Dort veranlassen die Alpha-Motoneuronen des gedehnten Muskels zu einer Entladung, was wiederum zu einer Kontraktion des gedehnten Muskels führt. Da der Muskel über ein Längenkontrollsystem verfügt, kann die Dehnung auf diese Weise reflektorisch wieder rückgängig gemacht werden (Klee & Wiemann, 2005, S. 34) Die Stärke der Spindelerregung hängt von zwei Faktoren ab, von der Größe der Dehnung (Längenzunahme) und der Dehnungsgeschwindigkeit (Längenänderung pro Zeiteinheit). Beide Regelungsmechanismen führen bei Überbeanspruchung zu starken Reflexantworten (Thienes, 2000, S. 54).
Die reziproke Hemmung wird auch antagonistische Hemmung oder Antagonistenhemmung genannt, weil bei dieser Art von Hemmung die Ia-Afferenzen eines Muskels die Einschränkung der Innervation des Antagonisten durch seine Motoneurone bewirken. Die reziproke Hemmung unterstützt in ihrer Funktion die Kontraktion des Agonisten, bei einer gleichzeitigen Hemmung des am selben Gelenk angreifenden Antagonisten. Damit kann zum Beispiel die Streckmuskulatur an einem Gelenk gehemmt werden, um die Aktivität der Beugemuskulatur bei verringerter Gegenspannung durch den Strecker laufen zulassen (Thienes, 2000, S. 55).
2.2.4.2 Der Sehnenspindelreflex
Die Golgi-Sehnenorgane (Kap. 3.2.2) messen die Spannung der Sehne über spannungssensible Sensoren, die in Serie zum Muskel angelegt sind (Klee & Wiemann, 2005, S. 34; Thienes, 2000, S. 55). Die genaue Lokalisation befindet sich im muskulären Ursprung der Sehnenfaserbündel. Sie bestehen aus circa zehn extrafusalen Fasern, die mit einer bindegewebigen Haut ummantelt sind und von afferenten Nervenfasern (Ib-Faser) versorgt werden (Grosser et al., 2004, S. 165). Die Golgi-Sehnenorgane werden mit Hilfe ihrer Spannungsrezeptoren bei passiver Dehnung und aktiver Kontraktion des Muskels aktiviert. Gegenüber den Muskelspindeln liegt die Reizschwelle der Sehnenorgane deutlich höher, folglich werden sie erst bei starker Dehnung oder Kontraktion angesprochen (Thienes, 2000, S. 55). Eine entsprechende Meldung (Überdehnung) fließt auf dem Wege über erregende und hemmende Schaltzellen zu den Motoneuronen und zu den sensorischen Zentren des ZNS. Aufgrund dieser neuronalen Verschaltungen und weiteren zusätzlichen Einflüssen, wie zum Beispiel Meldungen von Gelenk-, Bindegewebs- und Schmerzrezeptoren, reagieren die Motoneurone (Klee & Wiemann, 2005, S. 34). Das Golgi-Sehnenorgan bedient sich der autogenenen Hemmung (Eigenhemmung) um die Dehnfähigkeit des Muskels zu beeinflussen. Mit der autogenen Hemmung wird der Schutz der Sehne vor Überbelastung aufgrund zu starker Spannungszunahme gemeint. Dabei werden die Alpha-Motoneurone des betreffenden Muskels gehemmt. Von Eigenhemmung spricht man, weil die Sehnenorgane nur auf die Muskel-Sehnen-Einheit wirken, in der sie liegen (Thienes, 2000, S. 55).
2.3 Trainingseffekte in der Beweglichkeit
Das Kapitel Trainingseffekte der Beweglichkeit beschäftigt sich grundlegend mit einer besonderen Art des Trainings dem Beweglichkeitstraining und welche Effekte beziehungsweise Wirkungen von ihm ausgehen, mit Hilfe welcher Methoden Beweglichkeitsförderungen durchgeführt werden und welche Effektivität diese haben. Weiterhin wird Beweglichkeitstraining im Rahmen des Schulsports speziell bei Jugendlichen angewendet. Letztlich werden die Trainingseffekte, die als elementare Voraussetzung jeden Trainings gelten und deren aktueller Forschungsstand erläutert. Ausgehend davon werden Erklärungsansätze geliefert, die Aufschluss hinsichtlich der Leistungssteigerungen durch Beweglichkeitstraining geben sollen.
2.3.1 Begriffsbestimmung Training
Der Begriff Training entstammt ursprünglich dem lateinischen „trahere“ (ziehen, schleppen) (Schnabel et al., 1994, S. 239) und wird im heutigen Sprachgebrauch mit unterschiedlicher Bedeutung verwendet (Harre, 1986, S. 17). So zum Beispiel für physische, psychische, motorische, kognitive und affektive Bereiche, die dabei meistens einen Übungsprozess, der eine Verbesserung im jeweiligen Zielbereich anstrebt, beinhalten (Weineck, 2007, S. 21).
In den 60er und 70er Jahren wurde Training nach den beiden „Nestoren“ (Hohmann et al., 2003, S. 11) Harre (1971) und Nett (1964) noch als ein Abzielen auf hohe und höchste sportlichen Leistungen charakterisiert (Harre, 1971, S. 14).
Sportliches Training ist der nach wissenschaftlichen Erkenntnissen geführte pädagogische Prozess der sportlichen Vervollkommnung, der durch systematisches Einwirken auf die psychophysische Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft darauf hinzielt, Sportler zu hohen und höchsten sportlichen Leistungen zu führen […] (Harre, 1986, S. 17).
Diese wesentliche Funktion wurde durch Mellerrowicz und Meller (1972) durch das Einbeziehen der Erhaltung und Wiederherstellung von Leistungsfähigkeit und Gesundheit ergänzt. Somit haben sie schon früh erkannt, dass das Training ein wirksames Mittel gegen Bewegungsmangelkrankheiten ist und der Wiederherstellung dient. Damit wird dem Begriff nicht nur einen Hochleistungsgedanke, sondern auch die motorische Fitness des Breiten- oder Schulsports zugerechnet. In Folge dessen wurde dem Training ein offener Trainingsbegriff proklamiert, der mittlerweile in vielen wissenschaftlichen Disziplinen und im Alltagsgebrauch Verwendung findet. Mit dieser Öffnung ebnete sich für den Begriff Training eine Vielfalt an Begriffsbestimmungen. Aus den Blickwinkeln der Sportmediziner und der Sportpädagogen wird der Trainingsbegriff unterschiedlich betrachtet. Die Sportpädagogen sehen Training als pädagogischen und Sportmediziner als biologischen Vorgang (Hohmann et al., 2003, S. 13f.). Das biologische Training beschreibt eine „systematische Wiederholung überschwelliger Muskelanspannungen mit morphologischen und funktionellen Anpassungserscheinungen zum Zwecke der Leistungssteigerung“ (Hollmann & Hettinger, 1976 zit. von Hohmann et al., 2003, S. 14).
Aus der Sicht der Trainingswissenschaft ist diese Definition zu eng gewählt. Im umfassenderen Sinne beinhaltet sie Anpassungen konditionell-energetischer und technisch-koordinativer, psychischer und sozialer, kognitiver und affektiver Art. Damit werden Willenskraft, Taktik, Kooperations- und Integrationsvermögen trainiert. Der pädagogische Grundgedanke basiert darauf, welchen Einfluss das Training auf Personen nimmt und wie es die Überführung vom Ist- zu einem Sollzustand schafft.
Integriert wird beim Training die Interaktion zwischen Trainer und Sportler beziehungsweise Lehrer und Schüler sowie Vermittlungen, die der Trainer seinen Schülern hinsichtlich der Wertevermittlung, Zielorientierung und die Legitimation von Werten und Menschenbild gibt. Aus den genannten Ausführungen ergibt sich ein ganzheitlicher, umfassender Trainingsbegriff, der biologische Anpassungsprozesse und Interventionen soziokultureller Kontexte einschließt. Aus dieser trainingswissenschaftlichen Perspektive ergibt sich eine neue Begriffsbestimmung:
Training ist die planmäßige und systematische Realisation von Maßnahmen (Trainingsinhalte und Trainingsmethoden) zur nachhaltigen Erreichung von Zielen (Trainingsziele) im und durch Sport (Hohmann et al., 2003, S. 15).
Unter Planmäßigkeit und Systematik wird das Training von anerkannten Gesetzmäßigkeiten hinsichtlich der Trainingsziele, -methoden, -inhalte, -organisation und Trainingsaufbau geleitet und findet seinen Ausdruck in Plänen für die Leistungsentwicklung, -faktoren und -voraussetzungen. Es entsteht auf diese Weise ein Trainingskonzept, das durch seinen planmäßigen und systematischen Charakter verhilft, wichtige Bestandteile des Trainings miteinander zu verknüpfen und eventuelle Fehlbelastungen des Sportlers zu vermeiden (Schnabel, et al., 1994, S. 240; Hohmann, et al., 2003, S. 15; Weineck, 2007, S. 21).
Trainingsziele definieren die Zielgerichtetheit eines Trainings. Dieses Prinzip äußert sich darin, dass das gesamte Training, jede Anforderung, jede Maßnahme, jede angewandte Methode, auf ein Ziel hingerichtet ist. Die Trainingsziele lassen sich in kurz-, mittel- und langfristige Einheiten unterteilen (Schnabel et al., 1994, S. 240) Nach Hohmann et al. (2003, S. 15) werden Ziele im Training nachhaltig verfolgt. Das Training soll damit seine Wirksamkeit über die Trainingszeit hinweg hinaus erhalten. Angeeignete Fertigkeiten, verbesserte Fähigkeiten sollen dauerhaft Bestand haben. Folglich soll eine hohe Leistungsfähigkeit für beispielsweise den nächsten Wettkampf erreicht und darüber hinaus gesundheitsprotektive psychische Eigenschaften dauerhaft positiv beeinflusst werden (ebd.).
Mit Trainingsinhalten und –methoden sind in dem Zusammenhang alle praktischen Maßnahmen gemeint, mit denen planmäßig und systematisch Trainingsziele erreicht werden können.
Das sportliche Training kann nach seinen Anwendungsfeldern (innerhalb, außerhalb) unterschieden werden. Innerhalb des Sports finden sich die sportinternen Trainingsziele wieder, die hauptsächlich auf Komponenten der sportlichen Leistungsfähigkeit, wie zum Beispiel der Verbesserung der Schnelligkeit, Ausdauer oder Beweglichkeit, abzielen. Innerhalb des Sports lassen sich aber auch sportexterne Ziele lokalisieren, so zum Beispiel wenn die persönlichkeitsbildenden Eigenschaften des Nachwuchs-Leistungssports betont werden. Sofern das Training innerhalb einer Konzeption fällt und deren Entfaltung nicht dem Zufall überlassen wird, spricht man von sportexternen Trainingszielen. Sie sind im Schulsport, Gesundheitssport, Seniorensport von Bedeutung. Der Sport dient dabei als Medium, da primär die Ziele des Anwendungsfeldes verfolgt werden. Dabei sollen hauptsächlich gesundheitsfördernde und erzieherische Absichten umgesetzt werden (Hohmann et al., 2003, S. 16).
Die erläuterte Begriffsbestimmung von Hohmann et al. (2003, S. 15) verfolgt das offene Trainingsverständnis konsequent und setzt somit den Trainingsbegriff für planmäßige und systematische Erreichung von sportlichen Zielen ein.
Des Weiteren wird auf eine spezielle Art des Trainings eingegangen, das so genannte Beweglichkeitstraining. Es stellt eine Voraussetzung dar, um gezielt Trainingseffekte in der Beweglichkeit zu erreichen.
2.3.2 Methoden des Beweglichkeitstrainings
Das Beweglichkeitstraining ist eine Trainingsart, die in der Trainingslehre meist dem Konditionstraining zugeordnet wird. Im direkten Trainingsprozess ist die Dehnfähigkeit der Muskulatur, im Gegensatz zu den ebenfalls leistungsbeeinflussenden Faktoren der Gelenkstrukturen und den Eigenschaften des tendomuskulären Systems (Kap. 2.2.3), beeinflussbar und erhält damit den Hauptaugenmerk von Beweglichkeitstraining. Nach den zwei Komponenten der Beweglichkeit, Dehnfähigkeit und der Gelenkigkeit (Kap. 2.1.1) werden Muskeldehntechniken und Techniken der Gelenkmobilisation als Methoden des Beweglichkeitstrainings differenziert. Die Übungen zur Gelenkmobilisation finden hauptsächlich in der medizinischen Trainingstherapie ihre Anwendung, um nach Verletzungen eine normale Gelenkigkeit zurückzuerlangen. Die Muskeldehntechniken werden im Beweglichkeitstraining zur Steigerung oder Optimierung (Beweglichkeitsreserve) der sportlichen Leistungsfähigkeit eingesetzt (Röthig & Größing, 2003, S. 80). Letztere Trainingsart wird in den folgenden Ausführungen präferiert, da sie als theoretische Grundlage für die empirische Studie des zweiten Teils dient.
Bei der Literaturrecherche nach möglichen Dehnmethoden wird deutlich, dass eine verwirrende Vielzahl von Bezeichnungen und Abkürzungen für Dehntechniken existiert (Klee, 2003, S. 87). Jeder Autor bildet eigene Bezeichnungen und versucht diese jeweilige Dehntechnik scheinbar als allgemein gültig zu etablieren (Schönthaler & Ohlendorf, 2002, S. 17). An dieser Stelle soll nur eine kleine Auswahl der Begriffsvielfalt dargestellt werden.
So findet sich unter anderem, ACR (Agonist-Contract-Relax ), aktiv-dynamische Dehnungsübungen, passiv-dynamische Dehnungsübungen, PNF Methode, Prolonged Stretch, Relaxation Method, statisches Dehnen, Kontraktion-Relaxations-Stretching (KR), Antagonistisches-Kontraktions-Stretching (AK), dynamisches Dehnen, statisches Dehnen, AC-Stretching, CR-Stretching, CR-AC-Stretching, intermittierendes Dehnen, CRS-Methode, Release-Stretch, Hold-Stretch, Progressiv-Intermmittierend, CHRS-Methode, Postisometrische Relaxation, Permanentes Dehnen, bewegt-statisch, Progressiv-Statisch, Starr-Statisch, Anspannungs-Entspannungsdehntechniken, einfaches Dehnen, aufbauendes Dehnen, Ein-Phasen-Stretch, CR-Dehnen, Postisometrisches Dehnen, AED (CR), PI-EFffekt (Weineck, 2007, S. 749; Buck et al., 1993, S. 2 ; Sölveborn, 1983, S. 116; Wiemann, 1993, S. 99f.; Maehl, 1986, S. 81; Scheid et al., 2003, S. 149f.; Klee & Wiemann, 2001, S. 4; Altenberger et al., 2001, S. 354; Thienes, 2000, S. 82; Wydra & Glück, 2002, S. 2; Anrich, 2000, S. 17; Knebel, 1991, S. 59; Jordan & Schwichtenberg, 2005, S. 40; Maehl, 1987, S. 20, Albrecht et al., 2005, S. 25, Klee, 2003, S. 89; Anderson et al, 2000, S. 13; Wydra, 2004, S. 4f., Klee & Wiemann, 2005, S. 65; Freiwald, 2006, S. 23ff.; Anrich, 2000, S. 14).
Um die Begriffsvielfalt zu vereinfachen, wird in den weiteren Ausführungen auf die gängigsten Dehnmethoden eingegangen.
Der Themenbereich Dehnmethoden hat in den vergangenen 25 Jahren einen inhaltlichen Wandel erlebt und sich quantitativ stark verändert (Klee, 2003, S. 87). Grundsätzlich reduziert sich die Entwicklung der Dehnmethoden auf zwei Ausgangspunkte.
1. Das traditionelle Dehnen beruhte vor 1980 auf maximale Reizintensität,
statische Übungen, dynamische Ausführungen und teilweise auf explosive Bewegungsgeschwindigkeit.
2. Das sanfte Stretching führte Anderson als Alternative zum traditionellen Dehnen ein. Es beinhaltete statische Ausführen mit submaximaler Reizintensität.
Auf Grundlage dieser Ausgangspunkte entwickelte sich ein regelrechter Boom in den 80er Jahren. Sölveborn (1983) und Anderson (1980) waren Vorreiter, die ihre Werke in in Deutschland auf den Markt brachten. Auch deutschsprachige Autoren, wie Knebel (1985) oder Spring et al. (1986), nahmen die Strömungen der Stretchingwelle auf (Klee, 2003, S. 87). Nach dem Kreuzfeuer der Kritik vor allem gegen das dynamische Dehnen, der so genannten „Zerrgymanstik“ (Sölveborn, 1983, S.13) und das statische Dehnen nach Anderson (1980) wurden zunehmend empirische Untersuchungen über die Wirkungsweise der unterschiedlichen Dehnmethoden veröffentlicht (Klee, 2003, S. 87; Klee & Wiemann, 2005, S. 63). Zudem wurde die verwirrende Vielfalt von Dehnmethoden (Kap. 2.3.2) auf die fünf gebräuchlichsten Dehnmethoden reduziert.
2.3.2.1 Klassische Dehnmethoden
Zunächst werden die klassischen Dehnmethoden dynamisches Dehnen und statisches Dehnen und deren Vorgehensweise dargestellt, um dann die weiterentwickelten Variationsformen des statischen Dehnens (Klee & Wiemann, 2005, S. 65), die PNF-Methoden (Kap. 2.3.2.2) kurz zu erläutern.
1. Dynamisches Dehnen bezeichnet ein Einnehmen der Dehnposition mit einer
schnellen Bewegung. Wobei die Dehnposition schnell wieder verlassen und
dann meist mit kurzen Ausholbewegungen wiederholt eingenommen wird (intermittierendes Dehnen). Wenn die Bewegungsfolge einem Federn oder Wippen gleicht, wird von rhythmischen oder ballistischen Dehnen gesprochen. In der Abb. 2-16 wird die hintere Oberschenkelmuskulatur (ischiocrurale Muskeln) dynamisch gedehnt. Hier zu sehen in einem einbeinigen Kniestand mit vorgestrecktem zu dehnendem Bein und möglichst geradem Rumpf.
2. Statisches Dehnen, auch SS oder statisches Stretching genannt, wird durch
langsame Bewegung bis die Dehnposition eingenommen ist, charakterisiert.
Diese Dehnung wird dann eine bestimmte Zeit (mehrere Sekunden bis
Minuten) beibehalten (Abb. 2-16) (Klee & Wiemann, 2005, S. 64).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2-16: Die klassischen Dehnmethoden am Beispiel des Dehnens der ischio- cruralen Muskeln (mod. nach Klee, et al., 2005, S. 65)
2.3.2.2 Neuere Dehnmethoden
Die PNF-Methode wurde von Kabat entwickelt, von Knott & Voss (1968) verbreitet und diente anfangs der Behandlung von Lähmungen durch Bewegungsbahnung, die Dehnung stand dabei nicht im Vordergrund (Klee & Wiemann, 2001, S. 3).
Die PNF-Methode Propriozeptive Neuromuskuläre Faziliation) beruhen nach Kabat (1950) auf der Behandlungsphilosophie, dass jeder Mensch über latente motorische Möglichkeiten verfügt (Buck et al., 1993, S. 1), die durch passende, so genannte Fazilitationen (Erleichtern von Bewegungen) aktiviert und stimuliert werden können. Die Fazilitation bildet somit die Basis des PNF-Konzepts. Propriozeptiv meint die Propriozeptoren, die als sensorische Rezeptoren für die Tiefensensibilität zuständig sind, die Informationen über Haltung und Bewegungen aufnehmen und an das Kleinhirn und zur Großhirnrinde weiterleiten. Der neuromuskuläre Aspekt beinhaltet das Gefüge von Nerven und Muskeln (Buck et al., 1993, S. 1). Die PNF-Methode lässt sich in drei unterschiedliche Dehnungsmethoden unterscheiden, die im Folgenden dargestellt werden.
1. Das AC-Stretching (AC = Antagonist-Contract) ist dem statischen Dehnen ähnlich und unterscheidet sich nur dadurch, dass der Antagonist (Gegenspieler) des Zielmuskels maximal kontrahiert und damit die Dehnposition vertieft wird. Auf der Abb. 2-17 [1] werden die ischiocruralen Muskeln gedehnt und der Hüftbeugemuskel und/oder der gerade Schenkelmuskel (M. rectus femoris) angespannt. Bestens eignet sich die Rückenlage, da diese Art des Stretchings im einbeinigen Kniestand schwierig auszuführen ist. Aufgrund der isometrischen Kontraktion des Antagonisten soll während der Dehnung eine reziproke Vorwärtshemmung (Kap. 2.2.4.1) ausgelöst werden. Damit wird die Einnahme einer tiefen Dehnposition nicht durch eine unwillkürliche Kontraktion behindert.
2. Beim CR-Stretching (CR = Contract-Relax oder Anspannung-Entspannungs-Dehnen) wird noch bevor die beabsichtigte Dehnung erfolgt, eine maximal isometrische Kontraktion des Zielmuskels durchgeführt. Daraufhin erfolgen meist eine kurze Relaxphase und anschließend eine statische Dehnung des Zielmuskels. In der Abb. 2-17 [2] legt die zudehnende Person ihr rechtes Bein bei angewinkeltem Knie auf die Schulter der Hilfsperson und drückt durch maximale Anspannung der ischiocruralen Muskulatur nach unten. Im Anschluss wird die Muskulatur wieder statisch gedehnt. Dadurch soll eine hemmende Wirkung der Sehnenspindeln auf den Dehnungsreflex (autogene Hemmung, Kap. 2.2.4.2) des Zielmuskels ausgelöst werden. Folglich kann sich der Zielmuskel so nicht reflektorisch der Dehnung sperren.
3. Das CR-AC-Stretching (Abb. 2-17 [3]) verbindet das CR-Stretching mit dem AC-Stretching. Damit erhofft man sich auch ein Zusammenwirken der beiden oben genannten Hemmungsmechanismen, der autogenen Hemmung und der reziproken Vorwärtshemmung (Klee & Wiemann, 2005, S. 65f.).
[...]
- Arbeit zitieren
- Franziska Maresch (Autor:in), 2008, Beweglichkeit fördern - Vergleichende Analyse zweier unterschiedlicher Dehnungsprogramme, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120147
Kostenlos Autor werden




















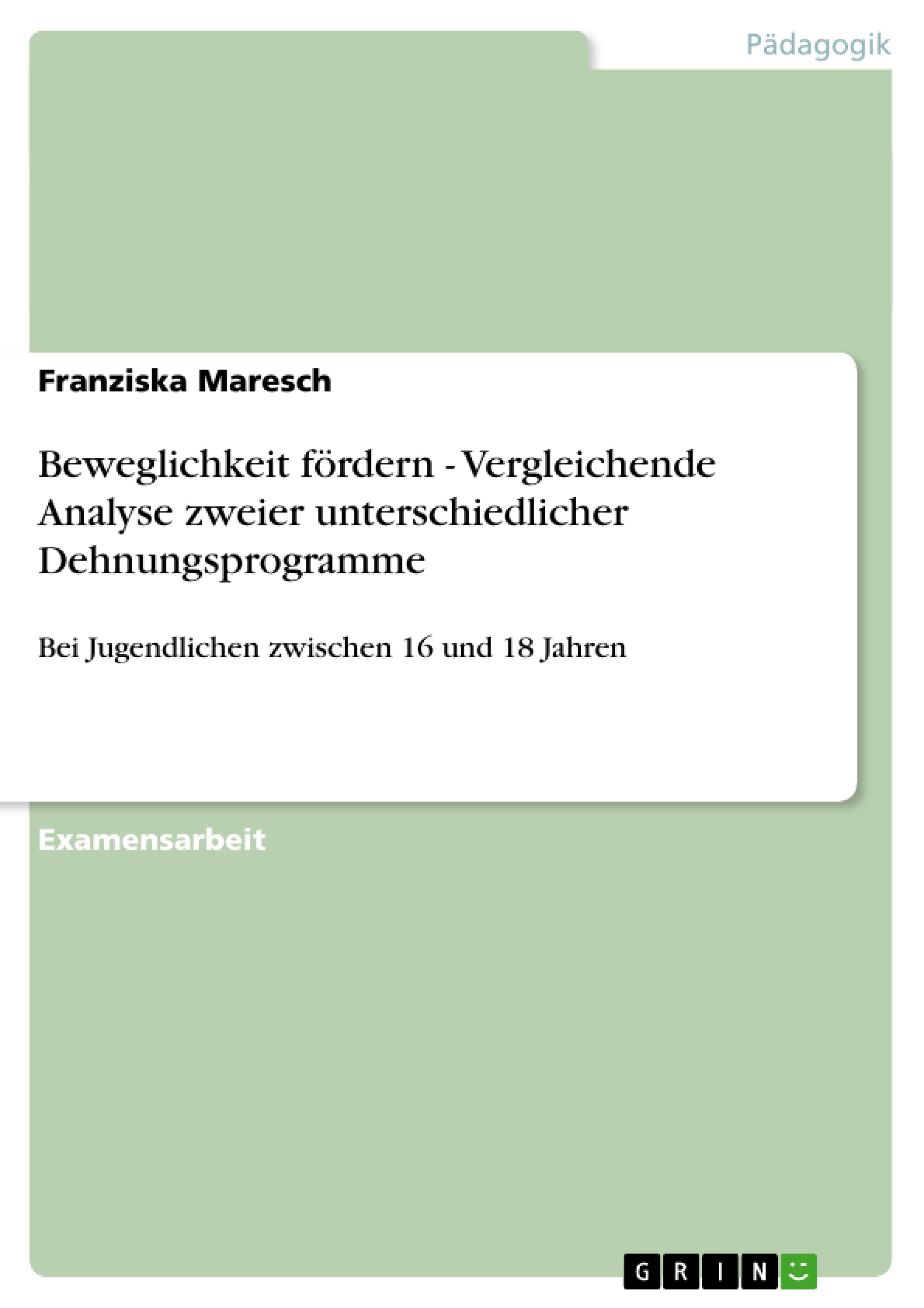

Kommentare