Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Freizeit: Historischer Rückblick und aktuelle Entwicklungslinien
2.1 Begriffsgeschichte und neuere Definitionen von Freizeit
2.1.1 Zur Begriffsgeschichte
2.1.2 Negative Definitionsansätze
2.1.3 Positive Definitionsansätze
2.1.4 Festlegung einer Freizeitdefinition für diese Arbeit
2.2 Soziologisch orientierte Freizeitwissenschaft
2.2.1 Historischer Rückblick auf die soziologisch orientierte Freizeitwissenschaft
2.2.2 Methoden der soziologischen Freizeitforschung
2.3 Zum Einfluss des gesellschaftlichen Wandels auf die Entwicklung der Freizeit
2.4 Zur Funktions- und Bedeutungsdimension von Freizeit
2.4.1 Individuelle Bedeutungen und Funktionen
2.4.2 Soziale Bedeutungen und Funktionen
3 Freizeitwissenschaft als Lebensstilforschung
3.1 Zu den Wurzeln der Lebensstilforschung
3.2 Hintergründe zur Ausbreitung des Lebensstilkonzeptes
3.3 Neuere Lebensstilkonzepte
3.3.1 Zu Bourdieu
3.3.2 Zu Lüdtke
3.3.3 Zu Schulze
3.4 Zusammenfassender Vergleich der Lebensstilkonzepte
3.5 Freizeitstile: Theoretische Überlegungen und empirische Befunde einzelner Autoren
3.5.1 Zu Giegler
3.5.2 Zu Uttitz
3.5.3 Zu Gluchowski
3.5.4 Zu Vester
3.5.5 Zu Garhammer
3.5.6 Zu Lamprecht und Stamm
3.5.7 Zusammenfassender Vergleich der einzelnen Autoren
4 Fokus: Jugendphase
4.1 Historische Betrachtung der Jugendphase
4.2 Jugend heute: Definitions- und Abgrenzungsprobleme
4.3 Zur Bedeutungsdimension von Freizeit in der Jugendphase
4.4 Freizeitstile Jugendlicher
4.5 Besonderheiten der Jugendphase im ländlichen Raum
5 Versuch einer Stilbildung auf Grundlage einer Untersuchung zum Freizeitverhalten Jugendlicher der Stadt Schwalmstadt
5.1 Untersuchungsort und Beschreibung der Stichprobe
5.2 Methoden
5.2.1 Design
5.2.2 Instrument
5.2.3 Pretest
5.2.4 Haupterhebung
5.2.5 Auswertungsverfahren des deskriptiven Teils
5.3 Soziodemographische Merkmale der befragten Jugendlichen
5.3.1 Alter
5.3.2 Nationalität
5.3.3 Wohnort
5.3.4 Religionszugehörigkeit
5.3.5 Familiäre Situation
5.3.6 Berufstätigkeit der Eltern
5.3.7 Zusammenfassung der soziodemographischen Merkmale
5.4 Freizeit der Jugendlichen: Deskriptive Ergebnisse
5.4.1 Freizeitassoziationen
5.4.2 Freizeitaktivitäten
5.4.3 Organisierte Freizeit
5.4.3.1 Sportvereine
5.4.3.2 Außerunterrichtliche schulische Angebote
5.4.3.3 Kirchliche Angebote
5.4.3.4 Jugendpflege
5.4.3.5 Weitere organisierte Freizeitangebote
5.4.4 Medienkonsum
5.4.4.1 Musikverhalten
5.4.4.2 Fernseh- und Videonutzung
5.4.4.3 Lesegewohnheiten
5.4.4.4 Computer- und Spielkonsolenbenutzung
5.4.5 Sozialkontakte und Freundschaften
5.4.6 Freizeitgestaltung am Wochenende
5.4.7 Hausaufgaben und Mithilfe im Haushalt
5.4.8 Finanzielle Mittel
5.4.9 Werthaltung der befragten Jugendlichen
5.5 Freizeitstile der befragten Jugendlichen
5.5.1 Auswertungsverfahren zur Stilbildung
5.5.2 Beschreibung der vier Freizeitstile
5.5.2.1 Freizeitstil 1: „Moderne Aktivität“
5.5.2.2 Freizeitstil 2: „Intellektuelle Enklave“
5.5.2.3 Freizeitstil 3: „Mainstream“
5.5.2.4 Freizeitstil 4: „Geselligkeit“
6 Zusammenfassung und Abschlussdiskussion
7 Literaturverzeichnis
8 Anhang
1 Einleitung
Am Anfang des neuen Jahrtausends verfügen die Menschen in Deutschland über ein zunehmend wachsendes Ausmaß an freier Zeit und in der wissenschaftlichen Literatur wird die Vorstellung evident, dass es Abschied zu nehmen heißt von der traditionellen Arbeitsgesellschaft (OPASCHOWSKI 1997, S.11). Der moderne Mensch verbringt – grob geschätzt - nur noch jede sechste Stunde seines Lebens in der Schule oder an seinem Arbeitsplatz (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.17).
„In dem Maße, wie die Freizeit an Bedeutung gewinnt und zum großen Geschäft wird, beginnt sie, das gesellschaftliche Leben und unsere Denk- und Vorstellungsmuster mitzuprägen“ (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.18).
Da die Soziologie eine Wissenschaft ist, die sich mit den Strukturen und Funktionen der Gesellschaft auseinandersetzt, darf sie einen gesellschaftlichen Bereich, der im Leben der Menschen so viel Platz einnimmt wie die Freizeit, nicht außer Acht lassen.
Mit Erscheinen von Bourdieus „Die feinen Unterschiede“ hat seit Anfang der achtziger Jahre in der Soziologie die Lebensstilforschung Konjunktur (GARHAMMER 2000, S.296). Die Wissenschaftler dieser Forschungsrichtung gehen davon aus, dass im Zuge einer Individualisierung und Pluralisierung der Lebenslagen, einhergehend mit einer Entstrukturierung der Klassengesellschaft, die lebensweltliche Plausibilität von herkömmlichen Klassen- und Schichtmodellen zur Interpretation sozialer Wirklichkeit abnimmt (MÜLLER 1992, S.11f.). Die Lebensstilforschung, so nimmt man nun an, könne als analytisches Werkzeug die klassischen Messungen sozialer Ungleichheit ergänzen oder gar ersetzen (GEORG 1991, S.359).
Dabei wird darauf hingewiesen, dass die Freizeit, gerade im Verhältnis zur Arbeit, als Lebensbereich mit dem breitesten Spielraum für individuell disponibles und expressives Verhalten gilt. Sie ist der bevorzugte Bereich zur Verfolgung persönlicher Präferenzen und es bietet sich daher an zu versuchen, Lebensstile auf Basis von Daten des Freizeitverhaltens zu rekonstruieren (LÜDTKE 1989, S.90f.).
Die Lebensstilforschung hat meistens die erwerbstätige Bevölkerung als Forschungsgegenstand. Ich fokussiere in dieser Arbeit eine andere Zielgruppe. Für mich wird die Jugendphase von besonderem Interesse sein.
Meine Arbeit ist der Versuch, eine Verknüpfung der soziologischen Forschungsrichtungen „Freizeit“, „Lebensstil“ und „Jugend“ herzustellen.
Wenn in der soziologischen Wissenschaft die Thematik „Jugend und Freizeit“ aufgegriffen wird, bleibt oft die räumliche Dimension des Freizeitverhaltens unberücksichtigt. Gerade dem Freizeitverhalten der Jugendlichen im ländlichen Raum wird wenig Interesse entgegengebracht.
Ich habe selbst meine Jugendphase in einer ländlich geprägten Region, der Schwalm, verbracht, so dass es mir interessant und lohnenswert erscheint, die Freizeit Jugendlicher in diesem Gebiet aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu betrachten. Mich interessiert dabei insbesondere die Frage, ob sich auch hier unter Jugendlichen verschiedene Freizeitstile ausfindig machen lassen.
Um darauf eine Antwort zu finden, habe ich eine eigene empirische Studie in Schwalmstadt durchgeführt. Mir war es möglich, im April 2001 an einer Haupt- und Realschule und an einem Gymnasium 127 SchülerInnen schriftlich zu befragen.
Die Arbeit gliedert sich in vier größere Abschnitte.
Zunächst beschäftige ich mich in Kapitel 2 mit der historischen Entwicklung, dem Stand und den Tendenzen in der Freizeit und in der Freizeitforschung. Dabei beginne ich mit einem kurzen historischen Rückblick zum Freizeitbegriff und diskutiere anschließend einige neuere Freizeitdefinitionen. Danach ist die soziologisch orientierte Freizeitwissenschaft Thema meiner Ausführungen. Nach einem Rückblick auf die Forschungsgeschichte stelle ich hier exemplarisch einige Methoden der soziologischen Freizeitforschung vor. In den weiteren Ausführungen gehe ich der Frage nach dem Einfluss des gesellschaftlichen Wandels auf die Entwicklung der Freizeit nach. Zum Schluss des ersten größeren Abschnitts versuche ich aufzuzeigen, dass die Freizeit sowohl individuelle als auch soziale Funktionen und Bedeutungen vorweisen kann.
Kapitel 3 dieser Arbeit hat das, auch in der Freizeitwissenschaft angewandte, Konzept der Lebensstilforschung als Gegenstand. Zu Beginn ist es von Interesse, in Auszügen etwas über die historischen Wurzeln dieses Konzeptes zu erfahren, denn schon Weber und Simmel beschäftigten sich mit dieser Thematik.
Danach stelle ich drei ausgewählte neuere Lebensstilansätze vor und vergleiche diese miteinander. Bei der Vorstellung der einzelnen Ansätze gehe ich auf empirische Befunde der Autoren nicht näher ein. Das angestrebte Erkenntnisinteresse meiner Arbeit lässt mich an dieser Stelle den Fokus auf den speziellen Bereich der Freizeitstilbildung verengen. Dabei thematisiere ich neben theoretischen Überlegungen auch empirische Befunde der einzelnen Autoren.
Im folgenden größeren Abschnitt (Kapitel 4) wende ich mich der Jugendphase zu. Hier richte ich mein Augenmerk als Erstes wiederum auf die historische Dimension, nämlich auf die Frage, wie sich die Jugendphase im Verlauf der Geschichte darstellt. Anschließend wird erörtert, welche Phase man im Leben eines Menschen heute aus soziologischer Sicht als Jugend bezeichnen kann und wo sich Definitions- und Abgrenzungsprobleme ergeben. Die weiteren Ausführungen beschäftigen sich mit der Bedeutungsdimension von Freizeit für Jugendliche. Einige Autoren haben versucht, Freizeitstile unter Jugendlichen auszumachen. Ihre Ergebnisse stelle ich kurz dar. Am Ende dieses Abschnitts beschreibe ich die Besonderheiten der Jugendphase im ländlichen Raum.
In Kapitel 5 wird meine eigene Untersuchung präsentiert. Wie üblich werden zunächst die Stichprobe und das methodische Vorgehen erläutert. Danach stelle ich die soziodemographischen Merkmale der befragten SchülerInnen vor und werte die erhobenen Daten aus den verschiedenen Bereichen der Freizeit deskriptiv aus. Auf Grundlage dieser Daten versuche ich dann abschließend eine eigene Stilbildung für die Freizeit der Jugendlichen der Stadt Schwalmstadt vorzunehmen.
2 Freizeit: Historischer Rückblick und aktuelle Entwicklungslinien
2.1 Begriffsgeschichte und neuere Definitionen von Freizeit
Im vorliegenden Kapitel werde ich mich, im Sinne einer allgemeinen Annäherung, der Frage widmen, was unter dem Begriff „Freizeit“ eigentlich zu verstehen ist. Hierbei gebe ich zunächst einen historischen Rückblick zum Freizeitbegriff, bevor ich neuere Freizeitdefinitionen thematisieren und diskutieren werde.
2.1.1 Zur Begriffsgeschichte
Wissenschaftliche Begriffe unterliegen einem Wandlungsprozess. Am Freizeitbegriff lässt sich dies besonders deutlich ablesen. Soll die heutige Bedeutung des Begriffes „Freizeit“ erfasst werden, so darf der historische Kontext, in dem sich diese entwickelt hat, nicht außer Acht gelassen werden (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.29f.).
In der Antike existierte das heutige Wort „Freizeit“ noch nicht; Begriffe wie „Muße“, „Erholung“ oder „Spiel“ beschrieben dieses Phänomen (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.30). Vor allem die Muße war hoch geschätzt (FERCHHOFF/DEWE 1994, S.424). Cicero z.B. war der Meinung, dass es sich nur dank der Muße (otium) lohne zu leben und Aristoteles verstand Freizeit (schole) ausdrücklich als Freiheit von der Notwendigkeit zu arbeiten. Freizeit war in der Antike aber etwas Ernsthaftes und nicht gleichbedeutend mit absoluter Handlungsfreiheit. Geeignete Freizeitaktivitäten sah man in kulturellen, musischen und politischen Bereichen. Dieses Muße-Ideal hatte zwar auch im römischen Reich Geltung, wurde aber zunehmend durch Unterhaltungsangebote für breitere Bevölkerungsschichten erweitert und teilweise verdrängt. Es kam also zu einer Trennung von „Muße“ im Sinne von „Vertiefung“ und „Spiel“ im Sinne von „Unterhaltung“ (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.31f.). In Folge der Christianisierung und deren ökonomischen und soziologischen Begleiterscheinungen verlor der Gedanke an die Muße, aber vor allem der an die Unterhaltung, an Bedeutung. Es kam zu einer völligen Aufwertung der Arbeit (FERCHHOFF/DEWE 1994, S.424).
Der Sonntag und die Feiertage waren nicht zum Vergnügen[1], sondern primär für den Gottesdienst, die Besinnung und die Regeneration der Arbeitskraft bestimmt (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.32).
Die etymologischen Wurzeln des Wortes „Freizeit“ fallen in die Zeit des späten Mittelalters. Sie beziehen sich auf eine Wortkombination, die mit dem heutigen Gebrauch des Wortes wenig gemeinsam hat. Gemeint ist der Ausdruck „frey zeyt“, der seit dem 14. Jahrhundert in der Bedeutung von „Marktfriedenszeiten“ verwendet wurde. Mit diesem Begriff ist eine Zeitspanne gemeint, in der Marktgänger gesteigerten Rechtsschutz genossen und kämpferische Auseinandersetzungen und Übergriffe zu ruhen hatten (PRAHL 1977, S.17).
Die in der Christianisierung begonnene Aufwertung der Arbeit festigte sich seit der Reformation in der protestantischen Arbeitsethik mit ihrem Streben nach Erfolg im Erwerbsleben. Im Sinne einer kapitalistischen protestantischen Denkweise wird Freizeit und Muße nur dann geduldet, wenn man sie sich durch Arbeit erst verdient hat und sie der Regeneration der Arbeitskraft dient (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.32f.).
Im Gefolge des Humanismus jedoch kam es um 1600 zu einer Individualisierung, indem „freye zeyt“ wieder mit der Vorstellung des lateinischen „otium“, also der (persönlichen, privaten) Muße verbunden wurde. Ende des 17. und im 18. Jahrhundert definierte sich Freizeit in Form der „Freystunde“ wiederum über die Abgrenzung zur Arbeitszeit. Sie war einerseits Rekreationszeit, anderseits aber auch Zeit für eine nützliche Tätigkeit außerhalb von Arbeit und Schule (WALLNER 1978, S.13).
Verbunden mit der Aufklärungsbewegung des 18. Jahrhunderts entwickelte sich, anknüpfend an den Humanismus, die pädagogisch-politische Forderung, die „Freizeit“ als „Zeit der (individuellen) Freiheit“, als eine „Zeit zu freier Tätigkeit“ zu sehen (NAHRSTEDT 1988, S.43). So schrieb Rousseau 1762 in Emile von einer „temps de liberté“, auf die eine Erziehung hin ausgerichtet werde sollte (NAHRSTEDT 1988, S.33). Belege für das heutige Wort „Freizeit“ findet man erst seit dem 19. Jahrhundert. Opaschowski vermutet, dass Pestalozzi, Fröbel und Schmeller 1808 das Wort geschaffen haben (NAHRSTEDT 1988, S.31). Aus dem Jahre 1828 stammt dann der erste schriftliche Beleg von Fröbel (NAHRSTEDT 1988, S.43). Im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte sich der Begriff im allgemeinen Sprachgebrauch durch (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.30). Vor allem mit der Industrialisierung und der damit verbundenen Durchsetzung der Forderung der Arbeiter nach mehr freier Zeit wurde Freizeit zu einer bedeutenden Kategorie für die Gesellschaft (NAHRSTEDT 1988, S.43).
Seit den 50er Jahren haben sich unzählige Freizeitdefinitionen herausgebildet, so dass hier die Freizeitforschung ein kaum zu überschauendes Gebiet darstellt. Die Fülle der Definitionen darzustellen, ist nicht leistbar (HAMPSCH 1998, S.19). In der deutschsprachigen Literatur wird meistens zwischen „negativen“ und „positiven“ Definitionsansätzen differenziert.
2.1.2 Negative Definitionsansätze
Die meisten Ansätze gehen vom „Primat der Arbeit“ aus (OPASCHOWSKI 1976, S.12). Freizeit wird als Residualkategorie gegenüber der Arbeit gesehen (NAUCK 1983, S.274f.). Dies birgt aber einige Probleme. So wird vorausgesetzt, dass „Arbeit“ ein eindeutiger Begriff ist. Doch ein allgemeiner Begriff wie „Arbeit“ ist ein uneinheitliches Feld von Tätigkeiten, Handlungen und Motivationen und setzt eine theoretische Klärung voraus. Diese Schwierigkeit lässt sich auch nicht mit dem Versuch lösen, Arbeit als konkrete Erwerbsarbeit zu sehen. Die Kategorie „Erwerbsarbeit“ ist ebenfalls nicht eindeutig. Es gibt viele Arten von Erwerbsarbeit (z.B. normale Arbeitszeit, Nebenarbeit, Schwarzarbeit, Überstunden) und viele Gruppen von Erwerbstätigen, die nicht über eindeutige und somit schwer messbare Arbeitszeiten verfügen. Doch noch schwerwiegender ist der Einwand, dass mit solch einem Verständnis Gruppierungen ausgeschlossen oder aber als reine Freizeitgruppen definiert werden, die keine Arbeit in diesem Sinne haben. Hier sind z. B. Arbeitslose, Hausfrauen, Kinder und Pensionäre zu nennen (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.34). Es ist also festzustellen, dass eine eindeutige Unterscheidung in „Nur-Arbeitszeit“ und „Nur-Freizeit“ kaum möglich ist (HAMPSCH 1998, S.22). Aus diesem Grund wurden modifizierte negative Freizeitdefinitionen, die auch Bereiche jenseits der Arbeit erfassen, entwickelt. So zum Beispiel von Schmitz-Scherzer. Für ihn ist Freizeit diejenige Zeit, die nach Abzug von Schlaf, Hygiene, Wegzeiten, Wartezeiten, Berufs- und Hausarbeit übrig bleibt (SCHMITZ-SCHERZER 1974, S.9). Die Schwäche einer solchen Begriffsbestimmung ist aber in den subjektiven Einschätzungen der Personen, hinsichtlich dessen, was sie unter Freizeit subsumieren, zu sehen. Einige sehen Hausarbeit und Hygiene durchaus als Freizeit im Sinne eines Ausgleichs zu anderen Beschäftigungen an (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.34). Einen Übergang von rein negativen hin zu positiven Definitionen bietet der Ansatz von Scheuch. Er versucht, den Gegensatz von Arbeit und Freizeit durch das Heranziehen der Rolle, die ein Individuum ausfüllt, aufzuheben (TOKARSKI/SCHMITZ-SCHERZER 1985, S.229). Der Freizeitbegriff wird allgemeiner als Freisein von allen Rollenzwängen definiert: „Freizeit sind diejenigen Tätigkeiten, die sich nicht notwendig aus zentralen funktionalen Rollen ergeben“ (SCHEUCH 1972, S.43).
Damit kommt es zu einer negativen Abgrenzung der Freizeit gegenüber Zwängen der zentralen Rollen (z.B. Berufs-, Alters- oder Geschlechtsrollen). Jedoch bereitet die Bestimmung der „zentralen Rollen“ Schwierigkeiten (PRAHL 1977, S.20).
2.1.3 Positive Definitionsansätze
Im Gegensatz zu den negativen Begriffsbestimmungen versuchen positive Freizeitdefinitionen die Freizeit jenseits der engen Zeitperspektiven als eigenständiges soziales Handlungs- und Orientierungsfeld zu sehen. Das heißt, Freizeit wird zu einem Bereich, der nicht mehr nur im Zusammenhang mit Arbeit zu sehen ist, sondern über eigene konstitutive Merkmale verfügt. Abgestellt wird vor allem auf die Beziehung zwischen der Freizeit und den individuellen Wahl- und Handlungsmöglichkeiten der Akteure (TOKARSKI/SCHMITZ-SCHERZER 1985, S.229f.). So ergänzt z. B. Lüdtke die negativen Definitionen, indem er schreibt: “Freizeit ist freie Zeit plus selbstgewähltes Handeln“ (LÜDTKE 1975, S.25). Dumanzedier stellt mit seiner Definition mehr auf die Selbstverwirklichung des Akteurs ab, indem Freizeit als „ Aktivität – jenseits der Verpflichtungen von Arbeit, Familie, und Gesellschaft -, in der das Individuum nach eigenem Willen entweder Entspannung, Zerstreuung, Verbreiterung seines Wissens, spontane soziale Teilhabe oder die freie Entfaltung seiner Kreativität sucht“, beschrieben wird (DUMANZEDIER 1967, S.16, zitiert nach PRAHL 1977, S.21). Aber auch diese Sichtweise birgt Probleme. So sind die Begriffe wie „Selbstverwirklichung“, „Wahl“, „Freiheit“, etc. ebenfalls schwer zu fassen und mit präzisem Inhalt zu füllen. Ferner können nach dieser Sichtweise auch Arbeitsleistungen freizeitähnliche Merkmale aufweisen. Nach positiven Definitionen ist für den Freizeitbereich vor allem ein Streben der Akteure nach einer emotionalen Befriedigung bei einer hohen Entscheidungsfreiheit kennzeichnend. Dieses wird von der Arbeit nur unzureichend erfüllt, so dass der Freizeit eine Ausgleichsfunktion zuteil wird. Gerade diese Ausführungen zeigen aber, dass auch bei den positiven Freizeitdefinitionen ein Verhältnis bzw. ein Bezug zum Bereich der Arbeit hergestellt wird. „Freizeit“ ist also ein nur schwer zu fassender Begriff, der nicht einheitlich definiert wird. In ihm verschmelzen offensichtlich objektive (zeitliche) und subjektive (emotionale) Handlungselemente. So versuchen einige Autoren, wie z.B. Kaplan, in ihren Definitionen den objektiven Zeitaspekt mit subjektiven Sinn- und Handlungselementen zu vereinen. Solche Konzepte sind aber hoch differenziert und daher nur schwer zu operationalisieren (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.36ff.).
2.1.4 Festlegung einer Freizeitdefinition für diese Arbeit
Bezieht man die Definitionen von Freizeit auf die für diese Arbeit relevante Gruppe der Jugendlichen, so ist zu sehen, dass die Definitionen eher in Bezug auf Erwachsene formuliert wurden und nur begrenzt auf Jugendliche übertragbar sind (PIEPER 1998, S.11).
Die in dieser Arbeit befragten Jugendlichen stehen noch nicht im Berufsleben und haben deshalb keine ausgewiesene Arbeitszeit. Als ihre Arbeitszeit sind die Schule und die damit verbundenen Pflichten zu sehen.
Die Schulzeit hat aber ihre spezifischen Merkmale und ist daher nicht mit der Arbeitszeit eines Erwachsenen gleichzusetzen (PIEPER 1998, S.12).
Ich werde für meine Arbeit trotz der angesprochenen Probleme eine eher negative Definition von Freizeit heranziehen:
„Für die Jugendlichen kann Freizeit als die Zeit bezeichnet werden, die ihnen jenseits von Schulzeit, Berufsausbildungszeit, Erwerbszeit und der Zeit der Einbindung in die hauswirtschaftliche Mithilfe zur Verfolgung vor allem ihrer eigenen Interessen zur Verfügung steht“ (LANGE 1997, S.89).
2.2 Soziologisch orientierte Freizeitwissenschaft
Schon ein Blick in die Literatur zeigt, dass es unmöglich ist, von einer Freizeitwissenschaft als solcher zu sprechen. Freizeitwissenschaft wird von vielen Disziplinen, wie Psychologie, Soziologie, Pädagogik und Geographie betrieben. Zusehends häufiger beschäftigen sich auch Historiker, Ethnologen, Volkskundler, Ökonomen und Politologen mit diesem Thema. Jede Disziplin hat eigene Forschungsinteressen, Erkenntnisinteressen, Theoriebestände und methodologische Vorgehensweisen, aus denen eine kaum zu überschauende theoretische und empirische Mannigfaltigkeit resultiert. Gerade diese Heterogenität macht die Beschäftigung mit der Freizeitforschung interessant. Einzelne Bereiche können sich gegenseitig anregen und befruchten (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.40f.). Doch ist es im Rahmen dieser Arbeit nicht leistbar, eine systematische Übersicht über sämtliche Ansätze und Disziplinen zu geben. Da es andererseits aber schwierig und sogar fragwürdig ist, eine klare Grenze zwischen soziologischer und nicht-soziologischer Forschung zu ziehen, werde ich zwar den Schwerpunkt meiner Darstellung auf die soziologisch orientierte Freizeitforschung legen, jedoch Gesichtspunkte aus anderen Disziplinen berücksichtigen, wenn sie für meine Arbeit von Erkenntnisinteresse sind.
2.2.1 Historischer Rückblick auf die soziologisch orientierte Freizeitwissenschaft
Sieht man zurück, so ist festzustellen, dass sich die eigentliche sozialwissenschaftliche Freizeitforschung erst im späten 19. Jahrhundert entwickelt hat, also noch relativ jung ist.
Als Wegbereiter der Diskussion sind die Philosophen zu nennen. Nietzsche glaubte das „Übermenschliche“ spielerisch in der Erholungszeit finden zu können, und das 1883 erschiene Werk „Recht auf Faulheit“ von Lafargues, das sich kritisch mit der arbeitszentrierten Gesellschaft auseinandersetzt, gilt noch heute als bedeutendes Werk. Die soziologischen Klassiker beschäftigten sich eigentlich nur am Rande mit der Thematik der Freizeit. Im Zuge des raschen Wandels der sozialen Bedingungen wurde mehr den Fragestellungen, die sich im Zusammenhang mit der Arbeit, Produktion und Verteilung von Gütern ergaben, Aufmerksamkeit geschenkt (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.42f.). Dennoch wurde mit Karl Marx und der Arbeiterbewegung das Verhältnis von Arbeitszeit und freier Zeit im Sinne von Regenerationszeit vor allem zu einem politischen aber auch wissenschaftlichen Thema (HAMMERICH 1974, S.272f.). Marx schaffte mit seinen philosophischen Schriften zwischen 1840 und 1883 eine materialistische Theorie von „disponibler Zeit“ und „freier Zeit“. Eine Verkürzung der Arbeitzeit ist nach Marx Voraussetzung für die Entwicklung eines „Reichs der Freiheit“ als Grundlage einer emanzipierten Gesellschaft (NAHRSTEDT 1993, S.46). Die Freizeit an sich (z.B. die Gestaltung der Freizeit) wurde aber noch nicht als sozialwissenschaftliches Thema erkannt und stellte vor allem noch kein empirisch relevantes Phänomen dar (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.43.).
Mit einer eintretenden Verbesserung der Lage der Arbeiter, hervorgerufen durch die Einführung des 8-Stunden-Tages und der 48-Stunden-Woche in der Weimarer Republik, begann eine explizit auf Freizeit bezogene Diskussion (NAHRSTEDT 1993, S.43). Seitdem kann man von einer systematischen sozialwissenschaftlichen Freizeitforschung sprechen. Der Sozialwissenschaftler Sternheim verfasste 1921 einen Artikel in der Zeitschrift für Sozialforschung, in dem er sich mit aktuellen Problemen der Freizeitgestaltung auseinandersetzte. Auch der Pädagoge Klatt sowie die Psychologen Greenberg und Feige sind hier zu nennen. Klatt publizierte 1929 die ersten Grundsätze zur Freizeitgestaltung. Greenberg veröffentlichte 1932 die erste psychologische Studie über Freizeit und drei Jahre später folgten dann die entwicklungspsychologischen Arbeiten von Feige, die eine systematisch-historische Abhandlung über den Erlebniswandel vom Feierabend zur Freizeit beinhalten (OPASCHOWSKI 1997, S.287).
Besonders seit den 50er Jahren wurden freizeitwissenschaftliche Fragestellungen vermehrt in der soziologischen Forschung aufgegriffen, wobei Freizeit im komplementären Verhältnis zur Erwerbsarbeit gesehen wurde (FERCHHOFF/DEWE 1994, S.424). Es entstand eine große Zahl von theoretischen Beiträgen, die vor allem von Ansätzen aus der Betriebs- bzw. Industriesoziologie (Wilensky 1960, Berger 1962) bestimmt sind. Schelsky und Blücher verfassten Rezeptionen der amerikanischen Freizeitforschung. Aus den theoretischen Beiträgen resultierend entstanden ab den 60er Jahren verschiedene empirische Arbeiten. Hier sind die Arbeiten von Thomae, Brinkmann und Lehr zu nennen, wobei Thomae die Beziehung zwischen Persönlichkeitsstruktur, Freizeitverhalten und sozialen Faktoren untersuchte und Brinkmann sowie Lehr die psychologischen Beziehungen zwischen Arbeit und Freizeit betrachteten (OPASCHOWSKI 1997, S.287).
Ab Ende der 60er Jahre wurde Freizeitwissenschaft durch die kritische Theorie und den Emanzipationsbegriff beeinflusst. So stellten Giesecke und Opaschowski die emanzipatorische Bedeutung von Freizeit und Tourismus heraus (NAHRSTEDT 1993, S.44). An den Arbeiten der 50er und 60er Jahre wurde vor allem bemängelt, dass sie, durch die Fixierung auf ein Erwerbsleben, die Nicht-Erwerbstätigen ausschlössen. Diesem Mangel versuchten verschieden Autoren durch eine inhaltliche Erweiterung des Freizeitbegriffs entgegenzutreten. So wurde Freizeit im Verhältnis zu anderen Lebensbereichen gesehen, wie etwa in den Studien zur Freizeit in der Familie (z.B. Nave-Herz/Nauck 1978 und Rapoport/Rapoport 1975) und unter verschiedenen geographischen, sozio-kulturellen Wohnbedingungen, sowie in verschiedenen Lebensabschnitten (Schmitz-Scherzer 1973, Nave-Herz/Nauck 1978) (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.46f.).
Andererseits kam es auch zu einer Renaissance der Arbeitsorientierung so etwa bei Kramer und Maase. (NAHRSTEDT 1993, S.44).
Die sozialliberale Koalition machte die Diskussion über Freizeit zu einem Politikum, indem sie ein freizeitpolitisches Konzept plante. Hierfür gab die Koalition zahlreiche Forschungsvorhaben in Auftrag. Die Gründung der Europäischen Gesellschaft für Freizeit 1971 brachte die deutsche Freizeitforschung in einen stärkeren europäischen Zusammenhang (NAHRSTEDT 1993, S.44).
Schmitz-Scherzer legte 1974 mit seinem Werk „Sozialpsychologie der Freizeit“ eine erste Monographie der Freizeitforschung im Bereich Psychologie und Soziologie vor (OPASCHOWSKI 1997, S.287).
Seit Ende der 70er und frühen 80er Jahren kam es zu einer handlungsorientierten innovatorischen Freizeitwissenschaft (z.B. Nahrstedt 1980; 1983). Tokarski ebnete mit seiner sozialpsychologischen Studie (1979) bestimmte Wege für eine erfahrungswissenschaftlich-theorieorientierte Erforschung der Freizeit (OPASCHOWSKI 1997, S.287f.). Andere Wissenschaftler versuchten Freizeit und Freizeitverhalten mit Hilfe von Konzepten der allgemeinen Theorie zu erklären, so z.B. Lüdtke in Anlehnung an die Rollentheorie (1980), Kaplan (1975) und Bardmann (1986) mit systemtheoretischen Konzepten und Winter (1983) und Vahsen (1983) in Anlehnung an handlungstheoretische Konzepte. In den modernen Klassikern von Elias und Bourdieu finden sich ebenfalls bedeutende freizeitspezifische Beiträge (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.47).
Seit 1989 existiert laut Nahrstedt eine potsmoderne Freizeitwissenschaft. Es werden vermehrt Fragestellungen hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Medien und Wirklichkeit, zwischen Tourismus und lokaler Existenz, zwischen Freizeit und Umwelt, zwischen weiblicher und männlicher Freizeit fokussiert. Die Internationalisierung der Freizeitwissenschaft wird vorangetrieben (NAHRSTEDT 1993, S.45).
2.2.2 Methoden der soziologischen Freizeitforschung
So uneinheitlich wie sich die Begriffsbestimmung von Freizeit und die Geschichte der Freizeitforschung darstellt, so ist auch ihre methodische Vorgehensweise. In der Freizeitwissenschaft wird mit nahezu allen den Sozialwissenschaften zur Verfügung stehenden Methoden gearbeitet. In diesem Abschnitt werde ich grundlegende Probleme, die sich bei der Erforschung des Phänomens „Freizeit“ ergeben, sowie einige exemplarisch ausgewählte methodische Schwerpunkte der soziologischen Freizeitforschung diskutieren. Ausklammern werde ich in diesem Kapitel den Ansatz der Lebensstilforschung, da diesem das gesamte dritte Kapitel meiner Arbeit gewidmet ist.
Unter die Methoden der Freizeitwissenschaft subsumiert Lüdtke:
„Strategien und “Paradigmen“ der Forschung als “Erkenntnispolitik“, Auswahl- und Messverfahren bzw. Techniken der Datensammlung, Rollen und Interaktionen von Forschern und Beforschten, Urteile über das Verhältnis von Theorie und Empirie, Modelle der Reduktion und Analyse von Daten sowie Prozeduren ihrer Anwendung etc.“ (LÜDTKE 1986, S.9).
Bei der Auswahl und Verwendung von Methoden müssen die spezifischen Merkmale des Freizeitbereiches berücksichtigt werden. So ist das für den Freizeitsektor typische Verhalten expressiver Natur. Dieses ist mit diffusen Motiven verbunden und gestattet eine hohe Flexibilität des Zeitaufwandes, des Ortes und der Interaktion mit Partnern. Das Freizeitverhalten Einzelner außerhalb von Vereinen und Organisationen ist schwer zu erfassen, da die Personen ihre Freizeit vor allem in informellen Partnerschaften und Kleingruppen verbringen. Die Untersuchung solcher emotionaler Beziehungen erweist sich als störanfällig. Aber auch innerhalb von Organisationen ist es schwierig, das Freizeitverhalten angemessen nach dem Muster zielgerichteter bürokratischer Systeme zu untersuchen, da die Mitgliedschaft und Beteiligung freiwillig ist. So wie sich Freizeit weitgehend linearer Planung und hierarchischer Kontrolle entzieht, können Organisationen ein fehlerhaftes Bild der internen und externen Freizeitwirklichkeit aufzeigen. Lüdtke plädiert für eine Kombination einzelner Methodenverfahren (LÜDTKE 1986, S.11f.).
Es ergeben sich verschiedene Perspektiven, unter denen eine sozialwissenschaftliche Freizeitforschung geplant werden kann. So kann die Freizeitmenge (zeitlicher Aspekt), Freizeitgüter und Freizeitsituation (objektiv bestehende Möglichkeit zur Freizeitnutzung) und das Freizeitverhalten (umfasst sowohl Tätigkeit als auch Bedeutung) untersucht werden (GIEGLER 1982, S.9).
Die soziologische Freizeitforschung arbeitet überwiegend mit relativ konventionellen Methoden der empirischen Sozialforschung[2]. Dabei sind die meisten Studien quantitativer Art. Innerhalb der quantitativen Erhebungsmethoden ist die Methode der Befragung die am meisten praktizierte (VESTER 1988, S.58).
Ein Forschungsschwerpunkt hat sich im Bereich der Aktivitätsforschung herausgebildet, die Freizeit als eine Summe von Aktivitäten auffasst. Dieses bringt Vorteile, da Aktivitäten gleichsam zwischen den quantitativen und qualitativen Elementen der Freizeit vermitteln. So sagt die Wahl der Freizeitaktivität, mit der freie Zeitsegmente ausgefüllt werden, auch etwas über die Handlungsbedürfnisse aus. Möglich ist dies aber nur, wenn klar ist, was eigentlich als Freizeitaktivität zu gelten hat. Eine klare Grenze zwischen Freizeit- und Nicht-Freizeitaktivitäten ist aber nicht gegeben, da sich Freizeitbereich und andere Lebensbereiche häufig überlagern. So kann das Einkaufen z.B. von einigen Personen als Arbeit angesehen werden, während es für andere ein reines Vergnügen ist. Außerdem wäre eine vollständige Bestandsaufnahme schon aufgrund der immensen Bandbreite möglicher Freizeitaktivitäten kaum zu gewährleisten. Um brauchbare Ergebnisse zu erhalten, ist es notwendig, den einzelnen Aktivitäten eindeutige Bedeutungsdimensionen zuzuweisen. Solch eine Zuweisung dürfte aber abhängig von der sozialen Lage und dem Handlungskontext des jeweiligen Probanden und damit immer problematisch sein (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.155ff.).
Als ein weiteres bedeutsames Konzept der Freizeitwissenschaft kann die Zeitbudget- oder Zeitverwendungsforschung verstanden werden. Diese Forschungsrichtung ist schon stark internationalisiert und arbeitet in den verschiedenen Ländern methodisch weitgehend mit identischen Befragungen (OPASCHOWSKI 1997, S.300). Im Zentrum dieser Methode steht der Versuch, möglichst genau die Häufigkeit und die Dauer der Ausübungen spezifischer Tätigkeiten von Personen zu messen (BLASS 1980, S.15). Um ein Zeitbudget einer Person zu erfassen, nennt Blass 5 Methoden: Zeitbudget-Interview, Zeitbudget-Questionnaire (schriftliche Befragung), Zeitbudget-Beobachtung, Zeitbudget-Dokumentenanalyse und Zeitbudget-Protokoll (Tagebuchmethode) (BLASS 1980, S.106). Unter diesen Methoden ist die am meisten angewandte Erhebungs- und Erfassungstechnik die des Zeitbudget-Protokolls, in dem Zeitsegmente einem vorgegebenen Aktivitätskatalog zugeordnet werden müssen (vollstandardisiertes Protokoll) (BLASS 1980, S.125). Solche Studien erlauben einen Einblick in den Tagesablauf der Probanden. Es können auch vorsichtige Aussagen zum Verhältnis von Arbeit, Freizeit und anderen Lebensbereichen gemacht werden. Mit Längsschnittstudien können zudem Änderungen bezüglich der Zeitverteilung der Menschen dargestellt werden. Diese Zeitbudgetstudien sind aber nicht unumstritten. Die Brauchbarkeit einer Studie richtet sich z.B. danach, wie fein das Raster für verschiedene Zeitsegmente und Aktivitäten aufgestellt wird. Sind die Aufteilungen zu groß gewählt, gehen viele Informationen verloren. Aber auch wenn mit einem engen Kategorienraster gearbeitet wird, sind bestimmte Probleme nicht völlig auszuschließen. Einige Tätigkeitsbereiche können sich inhaltlich überlappen, bestimmte Aktivitäten können entweder zu stark oder aber unter Gebühr berücksichtigt werden (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.129). Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass einige Aktivitäten gleichzeitig ausgeübt werden können (OPASCHOWSKI 1997, S.300).
Kritik gibt es aber nicht nur hinsichtlich der Methode, sondern auch hinsichtlich der Aussagekraft von Zeitbudgetstudien. Reine Zeitangaben erlauben keine Aussage über die Bewertung und Bedeutung der Tätigkeit für den einzelnen Befragten. Auch werden die Ursachen unterschiedlicher Ergebnisse kaum systematisch untersucht (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.130f.).
Auch qualitative Methoden werden in der Freizeitwissenschaft angewendet. So können z.B. durch teilnehmende Beobachtung, Tiefeninterviews oder die Analyse der von der Werbung vermittelten Freizeit-Leitbilder wichtige Informationen gewonnen werden. Diese Verfahren können jedoch die quantitativen Methoden der Datengewinnung u.a. aufgrund mangelnder Repräsentativität und Standardisierung nicht ersetzen (PRAHL 1977, S.58f.). Die methodische Vorgehensweise, die meiner eigenen Untersuchung zugrunde liegt, werde ich an entsprechender Stelle ausführlich erläutern.
2.3 Zum Einfluss des gesellschaftlichen Wandels auf die Entwicklung der Freizeit
Für das folgende Kapitel habe ich gesellschaftliche Veränderungen unter dem Aspekt ihrer Relevanz für die Entwicklung vor allem der Quantität von Freizeit ausgewählt.
Die öffentliche Meinung ist von der Vorstellung geprägt, dass der Umfang an Freizeit beständig zunehme. Dies bedarf aber einer differenzierteren Betrachtung. Nimmt man die Frühzeit der industriellen Revolution in England, Frankreich und Amerika als Bezugspunkt, so ist bis heute sicher ein Anstieg der freien Zeit für die Menschen zu verzeichnen. Blickt man jedoch weiter zurück, so wird man feststellen, dass die Frühzeit der industriellen Revolution im Vergleich zu früheren Zeitabschnitten ein immenser Rückschritt hinsichtlich der für die Menschen zur Verfügung stehenden freien Zeit war (OPASCHOWSKI 1997, S.25). So bestand bei den primitiven Agrarvölkern und auch in der Antike fast die Hälfte des Jahres aus verschiedenen Ruhetagen. In der aristokratischen Gesellschaftsstruktur der Griechen verrichteten die Sklaven und sog. „Banausen“ die unfreiwillige Lohnarbeit, während die freien Griechen sich der Politik und der Kunst hingaben. Doch selbst die Sklaven und Banausen genossen das ganze Jahr über viele Festtage und Festzeiten (PRAHL 1977, S.36ff.). Laut Prahl summierten sich in der römischen Republik in der Mitte des 4. Jahrhunderts die Ruhetage bzw. Festtage mit öffentlichen Veranstaltungen (Zirkusspiele, Wettkämpe) auf ca. 200 pro Jahr[3] (PRAHL 1977, S.38).
Im dreizehnten Jahrhundert waren Sonntags- und Nachtarbeit noch eine absolute Ausnahme und der Feierabend begann meistens zwischen 16 und 17 Uhr (OPASCHOWSKI 1997, S.26). Auch damals kamen rund 150 Tage im Jahr zusammen, die für religiöse und ständische Feiertage, Märkte und Turniere reserviert waren (PRAHL 1977, S.39), wobei einige Handwerker noch 30 Tage Ferien zusätzlich bekamen (OPASCHOWSKI 1997, S.26).
Eine Wende ist seit dem 15. Jahrhundert zu verzeichnen, denn seit dieser Zeit begann die Anzahl der Ruhetage im Zusammenhang mit der aufkommenden protestantischen Berufsethik abzunehmen (TOKARSKI/SCHMITZ-SCHERZER 1985, S.29). Mit dem Beginn der modernen Industriegesellschaft zwischen 1750 und 1800 verschärfte sich die Situation und die Menschen mussten ihre ganz Aufmerksamkeit der Befriedigung der elementaren Bedürfnisse widmen. Nur für eine kleine Schicht von Herrschern bestand das Leben auch zu jener Zeit zum überwiegenden Teil aus Muße (OPASCHOWSKI 1997, S.26).
Unter dem Eindruck bürgerlicher Freiheitsvorstellungen und der reformpädagogischen Bewegung des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts entwickelte sich ein Verständnis, das Freizeit mit Freiheit von Zwängen des Erwerbslebens gleichsetzte (NAHRSTEDT 1988, S.47). Dieser Freiheitsgedanke hatte aber zu dieser Zeit keine Bedeutung für die Arbeiterschaft, sondern war nur auf eine kleine Personenzahl des Bürgertums beschränkt, die über genügend freie Zeit verfügte, um diese auch sinnvoll gestalten zu können (HEIMKEN 1989, S.18f.).
Für das Proletariat war im Zuge einer immer größeren Mechanisierung der Arbeit Freizeit kein Thema mehr. Es kam zu einem erheblichen Anstieg der Arbeitszeit von täglich zwölf auf 16 Stunden, selbst an Sonntagen musste teilweise mehrere Stunden gearbeitet werden. Auch Kinder wurden nicht geschont. Sie mussten ebenfalls bis zu zwölf Stunden täglich arbeiten. Diese Entwicklung wurde durch die neuzeitlichen Säkularisierungstendenzen und den damit einhergehenden Machtverlust der Kirche, die vorher erheblichen Einfluss auf die zeitlichen Strukturen des Tages- und Jahresablaufes hatte, gefördert. Die Festigung der „protestantischen Wirtschaftsethik“ brachte eine neue Einschätzung von Arbeit und Leistung als positive und gottgefällige Eigenschaften mit sich (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.80). Mit der Mechanisierung der Arbeit und der Arbeitsteilung, die die Anwesenheit vieler Menschen zur selben Zeit erforderte, wurde der Grundstein für den Übergang von einer aufgaben- hin zu einer zeitorientierten Arbeitsleistung und damit auch für ein neues Arbeits- und Zeitbewusstsein gelegt (SCHMIED 1985, S.69f.).
In Preußen entschärfte sich die Lage 1839 für Frauen und Jugendliche mit dem sog. Fabrikregulativ, das die tägliche Arbeitszeit für diese Personengruppe auf maximal zehn Stunden festlegte (OPACHOWSKI 1997, S.27). Seit Mitte des 19. Jahrhunderts begannen sich die Arbeiter gewerkschaftlich und politisch zu organisieren. Sie verbuchten bald darauf erste Erfolge, indem die täglichen Arbeitszeiten schrittweise reduziert, die Sonntagsarbeitszeit fast ganz aufgehoben und in Ansätzen die Samstagsarbeitszeit verkürzt wurde (PRAHL 1977, S.45). Durch die Verkürzung der Arbeitszeiten sowie die Verbesserung der Löhne und später auch durch die Einführung von Ferien- und Rentenansprüchen konnte auch bei den Arbeitern ein stärker inhaltlich akzentuiertes Freizeitbewusstsein entstehen. Zu dieser Zeit entstanden unter Leitung des Bürgertums neben den wenigen vorher gekannten „Freizeitaktivitäten“, wie Spaziergänge, Kirch-, Verwandten-, und Wirtshausbesuchen sowie sporadischen Volksfest- und Jahrmarktbesuchen, weitere Aktivitäten, die später auch von anderen Bevölkerungsschichten aufgegriffen wurden. Hier kam es zu zwei gegenläufigen Tendenzen. Einerseits wurde Freizeit auf den häuslichen Bereich eingeschränkt. Hausmusik, gemeinsame Brett- und Kartenspiele, Lektüre von Büchern sowie auch Häkel- und Strickarbeiten zählten schon vorher zum Repertoire der Tätigkeiten, werden nun aber bewusst als eigentliche Freizeitaktivitäten wahrgenommen. Andererseits kam es auch immer mehr zu außerhäuslichen Aktivitäten, die aber meistens auf Männer beschränkt blieben[4] (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.102f.). Zu nennen ist hier der Aufschwung des Vereinswesens (AGRICOLA 1997, S.42) und die in den Städten boomende Unterhaltungsindustrie. So entstanden Theater, Variete, Showbetriebe und Tanzhallen in größerem Umfang (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.103). Kaffee- und Wirtshaus galten nicht mehr als verruchte Orte und wurden zusehends soziale Treffpunkte (ROBERTS 1982, S.139). Seit dieser Zeit lässt sich also im Freizeitbereich ein Expansions- und Differenzierungsprozess verzeichnen (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.103).
In den Jahren 1918/19 kam es dann mit der Einführung des 8-Stunden-Tages zum Durchbruch für die Arbeiterschaft. Die Mehrheit der Bevölkerung verfügte nun über ein gewisses Ausmaß an gesetzlich geregelter, als solche definierter, freier Zeit (TOKARSKI/SCHMITZ-SCHERZER 1985, S.35).
Im dritten Reich war die Freizeit - wie alle Lebensbereiche - nicht zur individuellen Verfügung gedacht, sondern musste nach den Grundsätzen des Nationalsozialismus ausgerichtet sein. Sie wurde zur „Indoktrinierung und Mobilisierung der Massen“ genutzt (TOKARSKI/SCHMITZ-SCHERZER 1985, S.36).
Nach Kriegsende war das Leben noch von Arbeit und dem Erschaffen einer Existenz geprägt. Freizeit war im Wesentlichen Erholungszeit. Es herrschte die 6-Tage und 48-Stunden-Woche (OPACHOWSKI 1997, S.29). 1955/56 erfolgte die schrittweise Einführung der 5-Tage-Woche und ab 1965 kam es zur allmählichen Einführung der 40-Stunden-Woche als Normalarbeitszeit (HAMPSCH 1998, S.18). Dennoch lebte die Arbeitsgesellschaft weiter, gerade als Legitimation und ökonomische Basis für den Konsum von Wohlstandsgütern. Freizeit war aber nicht mehr nur Erholungszeit, vor allem das Wochenende wurde zu einer eigenen Erlebniswelt (OPACHOWSKI 1997, S.29.).
Tokarski und Schmitz-Scherzer weisen nach, dass sich die Freizeit zwischen 1964 und 1980 stetig ausgedehnt hat. 1964 betrug sie noch 5,7, 1980 7,5 Stunden pro Tag. Dies ist ein Zuwachs von rund 30 Prozent. Im gleichen Zeitraum haben sich die Arbeitzeiten aber nur um rund 20 Prozent verringert. Deshalb ist anzunehmen, dass bei einem in etwa gleichgebliebenen Aufwand für die Befriedigung der Grundbedürfnisse, auch die Hausarbeit an Bedeutung verloren hat (TOKARSKI/SCHMITZ-SCHERZER 1985, S.70).
Zu erwähnen ist aber, dass sich der Rückgang der Arbeitszeiten für Erwerbstätige seit den 70er Jahren verlangsamt hat und von einem linearen Trend nicht mehr geredet werden kann (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.136).
Um 1990 hat der soziale Struktur- und Wertewandel den Stellenwert der Arbeit spürbar verändert. Freunde und Freizeit haben eine Aufwertung erfahren und sind mindestens ebenso wichtig wie die Erwerbsarbeit geworden. Die Arbeitsgesellschaft gerät in eine Legitimationskrise, weil sich Arbeit und Freizeit –quantitativ und qualitativ- immer näher kommen. Freizeitaktivitäten bekommen Arbeitscharakter und innerhalb der Arbeitswelt kommt es zu freizeitorientierten Ansprüchen (OPACHOWSKI 1997, S.29f.). Heute fordern die Gewerkschaften die 35-Stunden-Woche (HAMPSCH 1998, S.18), und neuerdings ist sogar von einigen Politikern und Gewerkschaftlern zu lesen, die sich für eine 4-Tage-Woche aussprechen.
Es stellt sich nun die Frage, wie die Entwicklung der freien Zeit bei Kindern und Jugendlichen aussieht. In der gängigen freizeitwissenschaftlichen Literatur wird dieser Themenkomplex nur am Rande thematisiert. Engelsing weist in seinem Aufsatz auf einen Roman des polnischen Schriftstellers Sienkiewiscz hin. Dieser lässt 1893 einen ehemaligen Lehrer feststellen, dass ein Kind, rechne man zu den rein schulischen Verpflichtungen noch den zeitlichen Aufwand für Hausaufgaben hinzu, auf eine Arbeitzeit von bis zu zwölf Stunden kommt. Dabei erwähnt er noch, dass sich ein Beamter während der Dienstzeit noch unterhalten und rauchen könne, das Kind aber in allen Stunden angestrengt zuhören müsse, um im Unterricht mitzukommen (ENGELSING 1982, S.69).
Vergleicht man diese Feststellung mit den heutigen schulischen Verpflichtungen von Kindern und Jugendlichen, dann wird der historische Zuwachs an freier Zeit besonders evident (HAMPSCH 1998, S.19). So kommen Strzoda/Zinnecker im Rahmen ihrer repräsentativen Jugendstudie 1996[5] zu dem Ergebnis, dass Jugendliche heutzutage an einem Werkstag im Durchschnitt fünf Stunden Freizeit haben (STRZODA/ZINNNECKER 1996, S.281ff.). Dieser Wert ist identisch mit dem Wert, den auch Lange im Rahmen seiner Studie zum Jugendkonsum feststellt (LANGE 1997, S.89)[6].
Als Ergebnis dieses Kapitels ist festzuhalten, dass gegenüber der Industrialisierungsphase eine Zunahme von Freizeit zu verzeichnen ist. Doch muss man auch sehen, dass diese Zunahme eigentlich nur eine Wiedergewinnung eines Lebensbereiches ist, der in einer vorindustriellen Gesellschaft schon vorhanden war. Nur wurde er hier noch nicht als eigenständiger Bereich wahrgenommen (OPASCHOWSKI 1997, S.28).
Der geringen freien Zeit während der industriellen Hochphase im 19. Jahrhundert kam für die Menschen und der Gesellschaft nur eine Funktion zu, nämlich die der körperlichen Regeneration. Der fortschreitende gesellschaftliche Wandel und die daraus resultierende Zunahme von Freizeit führte auch zu einer Zunahme ihrer Funktionen und Bedeutungen (HAMPSCH 1998, S.24), welche Thema des folgenden Kapitels sein sollen.
2.4 Zur Funktions- und Bedeutungsdimension von Freizeit
Häufig werden die Begriffe „Bedeutung“ und „Funktion“ von freier Zeit nicht klar getrennt und selbst wenn, erhellt die begriffliche Unterscheidung meistens wenig (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.139). Trotzdem darf man nicht der Annahme verfallen, beide Begriffe seien deckungsgleich.
Der Bedeutungsbegriff, im Zusammenhang mit Freizeit, bezeichnet die subjektive Komponente der Wahrnehmung und Einschätzung der Freizeit. Er umfasst unabhängig von objektiven Merkmalen der Freizeit die von den Menschen gehegten Vorstellungen und Wünsche, was Freizeit ist bzw. sein sollte. Der Funktionsbegriff beschreibt das, was Freizeit jenseits von Wahrnehmungen, Bedürfnissen und Wunschvorstellungen faktisch ist und wie sie sich auswirkt. Zwischen der Bedeutung und der Funktion muss nicht notwendigerweise eine Übereinstimmung bestehen, wie das folgende Beispiel zeigt: Individuelle Wünsche nach Ruhe und Erholung im Urlaub werden ungenügend eingelöst werden, wenn sich der Urlauber dem täglichen Stress des Kampfes um freie Liegestühle oder einem freien Platz im Restaurant ausgesetzt sieht (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.140f.).
Konzepte, die Funktionen und Bedeutungen von Freizeit beschreiben und klassifizieren wollen, können entweder auf der individuellen oder auf der gesellschaftlichen Ebene ansetzen.
2.4.1 Individuelle Bedeutungen und Funktionen
Faktisch wird bei den meisten Beschreibungsansätzen auf individueller Ebene nicht zwischen Bedeutungen und Funktionen unterschieden. Selbst wenn in den Konzepten von „Funktion“ die Rede ist, stellen sie implizit den Bedeutungsaspekt in den Vordergrund und geben wenig Auskunft über die faktische Zielerfüllung (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.142f.).
Für Tokarski und Schmitz-Scherzer gibt es vier freizeitspezifische Bedürfnisse: Entspannung/Erholung, Kommunikation, Information und Bewegung (TOKARSKI/SCHMITZ-SCHERZER 1985, S.108). Für Kramer (1990) ist Freizeit Eigen- ,Tätigkeits- und Bildungszeit. Für d’ Epinay et al. (1982) sind die drei einfachen Hauptfunktionen der Freizeit individueller Ausdruck (expression), Informationssuche und Interaktion. Und Dumazedier (1974) stellt drei Funktionen der Freizeit heraus, nämlich Erholung, Abwechslung und Unterhaltung sowie persönliches Wachstum (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.143).
Diese theoretischen Bedeutungsbestimmungen werden von empirischen Befunden gestützt. So charakterisierten in einer deutschen Studie von Tokarski 91 Prozent der Befragten Freizeit mit dem Attribut „Freude und Vergnügen“. Als weitere Attribute mit hoher Zustimmung erwiesen sich „Sinn“, „Zufriedenheit“, „Verwirklichung eigener Interessen“, „ menschliche Kontakte“ und „Aktivitäten“ mit je über 75 Prozent Zustimmung (TOKARSKI 1979, S.305). Auch neuere Studien fügen sich in dieses Bild. Nach einer Untersuchung des Kommunalverbands Ruhrgebiet[7] von 1998 sind die wichtigsten Aspekte der Freizeit „Erholung“, „Freunde“ und „Spaß“ (AGRICOLA 1999, S.27)[8]. So kann angenommen werden, dass aus subjektiver Sicht Abwechslung, Unterhaltung sowie Persönlichkeitswachstum zusammen mit sozialen Kontakten zu den zentralen Bedeutungsinhalten gehören (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.145).
2.4.2 Soziale Bedeutungen und Funktionen
Die Frage der Bedeutungen auf sozialer Ebene wird in der Literatur meistens gar nicht untersucht; gleichwohl können sie im Sinne von kollektiven Vorstellungen und „Mythen“ über Freizeit existieren (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.141).
Parker (1976) stellt zu den drei individuellen „Funktionen“ Dumazediers drei soziale: erstens die Sozialisationsfunktion der Freizeit, die die Vorbereitung auf Anforderungen anderer Lebensbereiche meint, zweitens die Zielerreichung, die sich auf Regenerationsleistungen der Freizeit bezieht und drittens einen Aspekt, den er mit „Integration“, „Stabilisierung“ und „Solidarität“ beschreibt. Jedoch ist hier zu kritisieren, dass sich die sozialen Funktionen nicht ohne Weiteres aus den individuellen ableiten lassen, denn sie erzielen Leistungen, die von den Individuen nicht wahrgenommen und nicht direkt verfolgt werden. Über die von Parker genannten Funktionen hinaus werden häufig systemstabilisierende Sonderfunktionen genannt, die den Akteuren häufig selber unbewusst sind und in Kontrast zum „Freiheitsmythos der Freizeit“ stehen. Dies sind insbesondere die Ideologie- und Kommerzfunktionen sowie Funktionen, die unter dem Arbeit–Freizeit-Paradigma zu sehen sind. Hinter der Ideologiefunktion steht die Annahme, Freizeit sei eine Spielwiese, auf der Spannungen in kontrollierter Weise abgebaut werden können, ohne dass dabei die Gesellschaftsordnung gefährdet wird. Die Kommerzfunktion trägt den modernen marktwirtschaftlichen Zusammenhängen Rechnung. Freizeit liegt demnach unter einem zunehmenden Kommerzialisierungsdruck und die Akteure sind in einer passiven Konsumentenrolle gefangen (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.146f.).
Wippler ist der Meinung, dass alle Hypothesen hinsichtlich des Arbeit-Freizeit-Paradigmas in zwei Haupthypothesen zusammengefasst werden können. Unter die Kontrast-Hypothese fallen Verhalten in der Freizeit, die sich deutlich von denen der Arbeit unterscheiden (WIPPLER 1974, S.99). Wenn sich die Gegebenheiten der Freizeit und der Arbeit ähneln, kann auf die Kongruenz-Hypothese verwiesen werden (KARST 1987, S.65f.) Zur Kontrast-Hypothese zählen neben der bereits erwähnten Regenerationsfunktion, nach der die Freizeit, wie im 19. Jahrhundert, der Auffrischung neuer Kräfte für die Arbeit dient, Kompensations- und Ausgleichsfunktionen, die heute mehr zum Tragen kommen. Sie nehmen an, die Freizeit gleiche Bedürfnisse aus, die in der Arbeit nicht befriedigt werden können. Die psychischen Anforderungen und die Sinnleere der Arbeit müssen durch die Freizeit substituiert werden. Auch müssen während der Arbeit entstandene Spannungen und Unlustgefühle durch Ausgleichshandlungen abgebaut werden (HAMPSCH 1998, S.24ff.).
Kongruenz-Hypothesen, wie Suspensions- und Kontinuitätsthese, gehen davon aus, dass die Verhaltensweisen, die in der Arbeit erworben werden, in der Freizeit reproduziert werden. Nach der Suspensionsthese beeinflusst die Arbeit den Menschen so nachhaltig, dass er in der Freizeit dem Zwang unterliegt, sich so zu verhalten, wie der Beruf es vorschreibt. Von dieser Annahme geht auch die Kontinuitätsthese aus. Kontinuitives Freizeitverhalten ist dadurch bestimmt, dass der Leistungsgedanke aus der Arbeitswelt so internalisiert wird, dass er auch zum Leitprinzip in der Freizeit erklärt wird (HAMPSCH 1998, S.27). Während die Suspensionsthese von einer negativ erlebten Arbeitswelt ausgeht, wird nach der Kontinuitätsthese Arbeit positiv erfahren, entweder, weil das Arbeitsethos nahezu vollständig internalisiert ist, oder weil die Arbeitsbedingungen wirklich positiv sind (VESTER 1988, S.43).
3 Freizeitwissenschaft als Lebensstilforschung
In diesem Kapitel werde ich den Lebensstilansatz im Hinblick auf dessen Bedeutung für die Freizeitwissenschaft darstellen. Zunächst werde ich die Entwicklung der Lebensstilforschung von seinen Wurzeln bis hin zu aktuellen Ansätzen in groben Linien nachzeichnen. Daran anschließend fokussiere ich speziell Freizeitstile, die zur Erklärung individuellen Freizeitverhaltens hilfreich sind. Hierbei werde ich wieder vorwiegend die soziologische Sichtweise thematisieren. Arbeiten aus der Marktforschung und der Psychologie werden vernachlässigt.
3.1 Zu den Wurzeln der Lebensstilforschung
Schon Max Weber beschäftigt sich mit dem Thema „Lebensstil“, wobei er jedoch den Begriff „Lebensführung“ bevorzugt. Er setzt ihn bei seiner Analyse von Klassen und Ständen sowie der Entwicklung der protestantischen Ethik ein und sieht den Begriff „Lebensführung“ in Abgrenzung zu dem Begriff „Klasse“ (LÜDTKE 1989, S.24). Einer ökonomischen Schichtung nach unterschiedlichen Klassenlagen stellt er eine soziale Schichtung gegenüber, die sich nicht durch Besitz unterscheidet, sondern durch „Ehre“. Diese spezifische Ehre beanspruchen die Stände (GEORG 1998, S.61f.). Die Stände unterscheiden sich durch eine gemeinsam geteilte Lebensführung, die mit einer Monopolisierung ideeller und materieller Güter oder Chancen einhergeht (WEBER 1985, S.535f.).
Die spezifische Standesehre beruht stets auf Exklusivität und Distanz und drückt sich u.a. in Kleidung, Speisen, dem Recht auf Waffen tragen und der Kunstausübung aus (WEBER 1985, S.537).
Georg Simmel, Zeitgenosse Webers, definiert Lebensstil nicht als Art der Lebensführung einer Gruppe oder einer sozialen Schicht, sondern als die für eine spezifische Gesellschaft typische Struktur der Organisation von Identität, Wirklichkeitsaneignung und Bezugnahme auf die soziale Umgebung (GEORG 1998, S.57).
Ein individueller Lebensstil entsteht aus identitätsstabilisierenden Kompromissbildungen zwischen einer zunehmend fremden, verobjektivierten Außenwelt und der subjektiven Wirklichkeit des Individuums (KONIETZKA 1995, S.19).
Bestand früher zwischen der symbolischen Ausstattung der privaten, individuellen Lebenswelt und der Gesamtkultur eine weitgehende Kongruenz, so entfernen sich beide Bereiche mit der fortschreitenden Arbeitsteilung, der Industrialisierung, der Durchsetzung des Geldverkehrs und individualistischer Orientierungen zunehmend voneinander (LÜDTKE 1989, S.26). Das Stilangebot vervielfältigt sich so schnell, dass der einzelne Mensch nicht mehr unter dem inhaltlichen Diktat eines einzelnen Stils steht (MÜLLER 1992, S.373).
„Erst eine Mehrheit der gebotenen Stile wird den einzelnen von seinem Inhalt lösen, derart, dass seine Selbstständigkeit und von uns unabhängigen Bedeutsamkeit unsere Freiheit, ihn oder einen anderen zu wählen, gegenübersteht. Durch die Differenzierung der Stile wird jeder einzelne und damit der Stil überhaupt zu etwas Objektivem, dessen Gültigkeit vom Subjekte und dessen Interessen, Wirksamkeiten, Gefallen oder Missfallen unabhängig ist. Dass die sämtlichen Anschauungsinhalte unseres Kulturlebens in eine Vielfalt von Stilen auseinandergegangen sind, löst jenes ursprüngliche Verhältnis zu ihnen, in dem Subjekt und Objekt noch gleichsam ungeschieden ruhen, und stellt uns einer Welt nach eigenen Normen entwickelter Ausdrucksmöglichkeiten, der Formen, das Leben überhaupt auszudrücken, gegenüber...“(SIMMEL 1920, S.523).
Die Differenzierung der Stile führt zwar einerseits zu mehr Wahlfreiheit, andererseits überlastet diese Freiheit aber das Individuum. Hätte das Individuum lediglich eine total persönliche Note, wäre eine soziale Bestätigung seiner Identität von außen nicht gewährleistet. Daher muss seine persönliche Note in eine objektivierbare, allgemeine Form gebracht werden. Zeigt das Individuum eine bestimmte Stilisierung des Lebens, also eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kategorie von Ähnlichen oder Gleichen, führt dies gleichzeitig zu einer gewissen Distanz zu anderen, den Ungleichen (LÜDTKE 1989, S.27).
Ein weiterer Ansatz in der Lebensstilforschung stammt von Thorstein Veblen. In seinem Werk „Theorie der feinen Leute“ (1899) macht er die Beziehung zwischen sozialer Stellung und Prestige zum Thema, um der Symbolisierung gesellschaftlichen Erfolgs auf die Spur zu kommen. Der symbolische Ausdruck gesellschaftlichen Erfolges geschah in einer archaischen Gesellschaft, in der kämpferische Auseinandersetzungen alltäglich waren, durch physische Tapferkeit und das Erlangen von Beute (MÜLLER/WEIHRICH 1991, S.103f.). In traditionalen Gesellschaften, für die Arbeit und Mühe in der Landwirtschaft kennzeichnend war, erfolgte dies durch demonstrativen Müßiggang (conspicuous leisure). Industrielle Gesellschaften mit hoher sozialer Differenzierung, die Ansehen über Reichtum definieren, symbolisieren Erfolg zunehmend durch demonstrativen Konsum ( conspicuous consumption) (MÜLLER 1992, S.372).
Einige Autoren erwähnen noch Alfred Adler (so LÜDTKE 1989, S.28ff. oder ZAPF/et al. 1987, S.13f.), den ich hier aber nicht näher erläutern will, da er einen psychologischen Lebensstilbegriff geprägt hat, der vornehmlich auf charakteristische Persönlichkeitsmerkmale eines Individuums abzielt und die soziale Komponente außer Acht lässt (KONIETZKA 1995, S.19).
3.2 Hintergründe zur Ausbreitung des Lebensstilkonzeptes
Seit Anfang der 80er Jahre sind eine Vielzahl von Publikationen entstanden, die sich im Feld der Lebensstilforschung einordnen lassen (HARTMANN 1999, S.11). Dieser Boom resultiert aus einer in der Sozialstrukturanalyse aufkeimenden konzeptuellen Debatte. Den klassischen Schicht- und Klassenmodellen wird vorgeworfen, dass sie aufgrund zunehmender Pluralisierungs- und Differenzierungstendenzen innerhalb der Gesellschaft, soziale Ungleichheit nur noch unzureichend erklären könnten (MÜLLER 1992, S.11). So argumentiert Beck in seiner Individualisierungsthese, dass mit der wachsenden Wohlfahrtsentwicklung, der zunehmenden sozialen und räumlichen Mobilität und der Bildungsexpansion seit Ende der 60er Jahre die Schichten ihre sozialintegrative Bedeutung verlören (BECK 1986, S.139ff.). Es kommt zu einer Herauslösung aus historisch vorgegebenen Sozialformen und –bindungen im Sinne traditionaler Herrschafts- und Versorgungszusammenhänge, zu einem Verlust von traditionalen Sicherheiten im Hinblick auf Handlungswissen, Glauben und leitende Normen aber damit auch zu einer neuen Art der sozialen Einbindung[9] (BECK 1986, 206).
Müller begründet die Attraktivität des Lebensstilkonzepts demnach folgendermaßen:
„Denn mit wachsendem gesellschaftlichem Reichtum, gestiegenem Lebensstandard und neuen Lebenschancen nimmt die lebensweltliche Plausibilität von herkömmlichen Klassen- und Schichtmodellen zur Interpretation sozialer Wirklichkeit ab...“ (MÜLLER 1992b, S.12).
Der soziokulturelle Wandel infolge der beschleunigten Modernisierung und die damit einhergehende Individualisierung von Lebenslagen äußern sich dann auch in einer Pluralisierung von Lebensstilen (ULBRICH-HERRMANN 1998, S.15).[10]
Die Lebensstilforschung will nun nachweisen, dass sich mit Hilfe von Lebensstilen menschliches Verhalten besser vorhersagen lässt, als mit demographischen und sozioökonomischen Variablen (HARTMANN 1999, S.11).
Ich selbst teile jedoch die Meinung einiger anderer Autoren, dass man nicht auf die klassischen Schichtansätze verzichten sollte, sondern vielmehr eine Kombination von Lebensstilansätzen mit Schicht- und Klassenmodellen sinnvoll ist. So stellt Spellerberg fest, dass „die objektiven Lebensbedingungen und die Stellung in der Gesellschaft nach wie vor mit Lebensstilen in Verbindung stehen“ (SPELLERBERG 1996, S.224) und auch Georg kommt in seiner Untersuchung zu dem Resultat, das Lebensstile „überzufällig mit vertikalen Merkmalen der sozialen Lage (bzw. spezifischen Handlungsressourcen) verknüpft sind“ (GEORG 1998, S.14f.).
Da sich Anfang des letzten Jahrhunderts schon die soziologischen Klassiker Max Weber und Georg Simmel mit dem Thema „Lebensstile“ beschäftigt haben (siehe u.a. LÜDTKE 1989, S.24ff.; KONIETZKA 1995, S.18ff.; GEORG 1998, S.57ff.), bezeichnet Lüdtke den Begriff „Lebensstil“ als „wiederentdeckte Kategorie der sozialen Differenzierung“ (LÜDTKE 1990, S.433). Um den Rahmen meiner Arbeit nicht zu sprengen, beschränke ich mich im nächsten Kapitel auf die Darstellung drei bedeutender Lebensstilkonzepte neueren Datums.
3.3 Neuere Lebensstilkonzepte
3.3.1 Zu Bourdieu
Die neuere Lebensstildiskussion wurde vor allem durch die Veröffentlichung von Pierre Bourdieus „Die feinen Unterschiede“ (1984) angeregt. Er konzipiert eine allgemeine Theorie der soziologischen Ungleichheit in kapitalistischen Gesellschaften unter Einschluss des Klassenbegriffs. Dabei versucht er aufzuzeigen, dass und warum sich soziale Klassen nicht nur hinsichtlich der sozioökonomischen Lage unterscheiden, sondern auch hinsichtlich ihrer Verhaltensmuster und ihrer Wahrnehmung untereinander (LÜDTKE 1989b, S.11). Bourdieu erweitert den Kapitalbegriff, so dass neben das ökonomische Kapital das soziale und das kulturelle Kapital treten (LÜDTKE 1989, S.35). Die Klassen sieht er in eine Auseinandersetzung um die Aneignung von materiellen und kulturellen Gütern verstrickt (BOURDIEU 1997, S.388). Diese Auseinandersetzung findet im „sozialen Raum“ statt (KRÄMER 1995, S.540).[11]
Dem Lebensstil kommt dabei eine bedeutende Distinktionsfunktion zwischen den einzelnen Klassen zu (BOURDIEU 1997, S.388f.), so dass sich die Kategorie des Geschmacks als Unterscheidung von Klassen anbietet. Hier wird der Begriff „Habitus“ bedeutsam, der einen Zusammenhang zwischen Klassenstruktur und Geschmackskultur herstellt. Er steht für ein Denk-, Beurteilungs- und Handlungsschema, das zunächst aus einer Klassenstruktur entsteht, dann aber seinerseits Lebensstilformen hervorbringt, welche die Klassenstruktur reproduzieren (MÜLLER/WEIHRICH 1991, S.113). Der Habitus ist also erstens ein Erzeugungsprinzip von Verhaltensweisen und darüber hinaus auch ein Klassifikationsprinzip, also ein Wahrnehmungs- und Bewertungsschema (BOURDIEU 1997, S.277f.).
Die Leistung Bourdieus für die Entwicklung der Lebensstilforschung ist vor allem in der Erweiterung des Kapitalbegriffs zu sehen. Des Weiteren wird mit Rückgriff auf seine Habitustheorie eine sinnvolle theoretische Verknüpfung der Bedingungen der objektiven Lebenslage mit dem jeweils praktizierten Lebensstil möglich (ULBRICH-HERRMANN 1998, S.38).
3.3.2 Zu Lüdtke
Eine erste deutsche theoretische Untermauerung der empirischen Lebensstilforschung findet sich bei Hartmut Lüdtke (HARTMANN 1999, S.108). Sein Ansatz zielt im Gegensatz zu Bourdieu stärker auf eine individualistische Akteursperspektive. Im Alltag des Akteurs bildet sich eine bewährte Ebene von Praktiken heraus (Alltagsroutinen), die sich subjektiv als erfolgreich im Hinblick auf das Erreichen von Zielen mit vorhandenen Ressourcen bewiesen haben (GEORG 1998, S.75f.).
Von den handlungstheoretischen Grundannahmen des Constrained-Choice- Ansatzes ausgehend, beschreibt Lüdtke den Akteur als ein utilitaristisches und rational handelndes Wesen. Lebensstile können erst dann entstehen, wenn die Akteure in der Lage sind, ihre Lebensweise bewusst zu gestalten. Das Erlangen eines bestimmten Lebensstils ist Resultat einer Wahl zwischen verschiedenen komplexen Handlungen, wobei sich zahlreiche Einzelakte schließlich zu einem bewährten Lebensstil verfestigen (LÜDTKE 1989, S.53ff.). Dies geschieht in Wechselwirkung mit der Umwelt des Akteurs, indem sich äußere Bezugsgruppeneigenschaften und die Verhaltensmuster des Individuums aufeinander einspielen (HARTMANN 1999, S.108).
Lüdtke geht von einer Entstrukturierung sozialer Ungleichheit aus. Lebensstile als Ergebnis bewusster Wahlentscheidungen sind auch nur mit einer Individualisierung der sozialen Ungleichheit denkbar, da die Möglichkeit gegeben sein muss, Ressourcen „nach individuellen Präferenzen oder nach exklusiven Gruppennormen der Lebensweise“ verwenden zu können (LÜDTKE 1989, S.53f.). Zumindest eine zunehmende Minderheit der Bevölkerung ist in hochindustrialisierten Konsumgesellschaften in der Lage, bewusst Präferenzen in der Praxis ihrer Lebensorganisation zu verfolgen. So können Lebensstile zu einer partiell unabhängigen Dimension sozialer Ungleichheit werden (LÜDTKE 1989, S.39).
Lüdtke definiert „Lebensstil“ auf Grund dieser Annahmen als[12]
„ unverwechselbare Struktur und Form eines subjektiv sinnvollen, erprobten (d. h. zwangsläufig angeeigneten, habitualisierten oder bewährten) Kontextes der Lebensorganisation (mit den Komponenten: Ziele bzw. Motivationen, Symbole, Partner, Verhaltensmuster) eines privaten Haushaltes (Alleinstehende/r, Wohngruppe, Familie), den dieser mit einem Kollektiv teilt und dessen Mitglieder deswegen einander als sozial ähnlich wahrnehmen und bewerten “ (LÜDTKE 1989, S.40)[13].
Lüdtke unterscheidet vier theoretische Dimensionen der Lebensorganisation (LÜDTKE 1989, S.42ff.):
- Die sozioökonomische Situation umfasst das ökonomische und teilweise auch soziale Kapital nach Bourdieu sowie Bedingungen der Arbeitssituation, Haushaltstruktur, Wohnumwelt etc.
- Mit Kompetenz werden durch Ausbildung erworbene kognitive, sprachliche und soziale Qualifikationen bezeichnet. Dazu gehört Bourdieus kulturelles Kapital in Form von Wissen und Fähigkeiten, aber ebenso soziale Kompetenzen, wie z.B. die Fähigkeit zur Konfliktverarbeitung.
- Die Performanz bezieht sich in Anlehnung an Bourdieus Praktiken und Werke auf die Summe der relevanten Handlungs- und Interaktionsäußerungen.
- Die Motivation enthält Handlungsdispositionen, die sich als Bedürfnisse, Einstellungen, Ziele und allgemeiner auch als Sinn des Handels, bezeichnen lassen.
Zwischen diesen Dimensionen existiert ein Fließgleichgewicht, das den Lebensstil eines Individuums aus der jeweiligen Struktur und Form der Lebensorganisation im Rahmen der vier Dimensionen entstehen lässt (LÜDTKE 1989, S.44).
Der Komplexität und der damit einhergehenden Problematik der Unübersichtlichkeit ist sich Lüdtke bewusst. Um einer analytischen Unschärfe zu entgehen, schlägt er vor, einen Lebensstil zunächst durch Indikatoren der Performanz zu beschreiben und die Typenbildung auf diesen Bereich zu beschränken. Danach können die so gewonnenen Lebensstile mit den anderen Dimensionen in Beziehung gesetzt werden (LÜDTKE 1989, S.45f.).
Als Variabeln in denen sich Lebensstile artikulieren nennt er u.a. Wohn- und Kleidungsstil, Ernährungsverhalten, Freizeit- und Urlaubsverhalten, kulturelle Praxis- und Alltagstechniken (LÜDTKE 2000, S.38).
3.3.3 Zu Schulze
Als weiterer Ansatz ist Gerhard Schulzes Werk „Die Erlebnisgesellschaft“ von 1992 zu thematisieren.
Schulze nimmt eine individualisierte Perspektive ein, wobei er unter „Individualisierung“ nicht eine Atomisierung der Subjekte, sondern eine Veränderung des Verhältnisses von Subjekt und Situation versteht. Für ihn sind soziale Milieus gewählte Wissens- und Zeichengemeinschaften. Soziale Milieus existieren als Großgruppen und Platz der Sozialintegration weiterhin, die Zugehörigkeit wird aber nicht mehr über eine Beziehungsvorgabe (der Akteur wird aufgrund seiner Herkunft oder seines Berufes in ein Milieu verortet), sondern über eine Beziehungswahl (das Individuum „wählt“ ein Milieu aufgrund ähnlicher Präferenzstrukturen) bestimmt (GEORG 1998, S.79f.).
Schulze geht von der Annahme aus, dass sich ein Übergang von einer „Knappheitsgesellschaft“ hin zu einer „Überflussgesellschaft“ vollzogen hat. Im Zuge der allgemeinen Wohlstandsvermehrung haben sich die Bedingungen der Lebensführung verändert und die sozioökonomisch strukturierten Klassenmilieus haben sich aufgelöst (KONIETZKA 1995, S.87).
Mit diesen Veränderungen einhergehend hat sich auch ein Wandel der Existenzform des Individuums vollzogen. Ist für die „alte“ Existenzform noch materielle Knappheit, die für eine Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten verantwortlich ist, charakteristisch, so zeichnet sich die „neue“ Existenzform durch die Abnahme strukturdeterminierten Handelns und damit einer größeren Handlungsautonomie des Subjekts, aus (GEORG 1998, S.81). Dadurch kommt es zu einer „Erlebnisorientierung des Handelns“ (KONIETZKA 1995, S.87). Schulze ist weiterhin der Auffassung, dass die gestiegenen Wahl- und Handlungsmöglichkeiten das Individuum überfordern und systematisch Unsicherheiten und Enttäuschungen produzieren (KONIETZKA 1995, S.80). Durch diese Unsicherheiten steigen die individuellen Orientierungs- und Ordnungsbedürfnisse. Diese Bedürfnisse sind das Einfallstor für kollektive Schematisierungen des Erlebens. Der Akteur übernimmt Vereinfachungen und intersubjektive Muster des Erlebens und entwickelt Präferenzstrukturen (KONIETZKA 1995, S.88).
Die Präferenzstrukturen werden auf der Ebene der Tiefenstruktur von Zeichen organisiert und über Zeichengruppen zu sog. alltagsästhetischen Schemata zusammengefasst. Diese stellen ein Raster des Erlebens dar, die Zeichen aus verschiedenen Bereichen kollektiv homolog kodieren und somit die Komplexität einzelner Wahlakte reduzieren (GEORG 1998, S.80).
Unter „Erlebnisorientierung des Handelns“ ist in diesem Zusammenhang nun zu verstehen, dass sich die Akteure bestimmte Zeichen auswählen, um die gewünschte innere Bedeutung eines Erlebnisses herbeizuführen. In der Bundesrepublik Deutschland haben sich als alltagsästhetische Schemata drei kollektive Muster des Erlebens herauskristallisiert: ein Hochkulturschema, ein Trivialschema und ein Spannungsschema (KONIETZKA 1995, S.89). Innerhalb der einzelnen Schemata lassen sich jeweils die drei Bedeutungsebenen: Genuss, Distinktion und Lebensphilosophie unterscheiden (GEORG 1998, S.80).
Das Hochkulturschema hat eine lange Tradition. Zu seiner Zeichengruppe gehören z.B. klassische Musik, das Lesen „guter“ Bücher, Nachdenken, Theater-, Museen- und Ausstellungsbesuche. Kontemplation kann als Formel für das Muster von Genuss gewählt werden; die Distinktion ist antibarbarisch, man grenzt sich vom biertrinkenden Vielfernseher oder vom Massentouristen ab. Der allgemeinste Nenner der Lebensphilosophie ist das Streben nach Perfektion (SCHULZE 1992, S.142ff.).
Das Trivialschema kristallisiert sich gegen Mitte des 19.Jahrhunderts heraus (GEORG 1998, S.80). Typische Zeichen sind Blasmusik, deutsche Schlager, Heimatroman, Liebesfilm, der röhrende Hirsch und schunkelnde Bierseligkeit. Genuss wird über Gemütlichkeit hergestellt; die Distinktion ist antiexzentrisch, abgelehnt werden die Fremden, die Individualisten; die Lebensphilosophie ist vom Prinzip der Harmonie bestimmt (SCHULZE 1992, S.150ff.).
Das Spannungsschema hat seinen Ursprung in der entstehenden Jugendkultur der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts, dehnt sich aber mit der Diffusion jugendlicher Symbolisierung auf andere Altersgruppen aus (GEORG 1998, S.80). Rock-, Funk-, Popmusik, Ausgehen in Diskotheken und Kneipen bis spät in die Nacht, Science-Fiktion- oder Pop-Musik-Sendungen des Fernsehens, ein niemals still stehendes Telefon kennzeichnen dieses Schema. Das Genussprinzip lässt sich am besten mit dem Wort Action, dem Ausagieren von Spannung beschreiben; man grenzt sich vom Langweiler in allen Varianten ab, vom Spießer, vom konservativen Familienvater, vom langsam fahrenden Verkehrsteilnehmer. Unterhaltung und Selbstverwirklichung kennzeichnen eine Lebensphilosophie, für die sich die Bezeichnung „Narzissmus“ anbietet (SCHULZE 1992, S.154f.). Die einzelnen Schemata bilden aber keine Gegensätze, sondern bilden einen Raum der Alltagsästhetik aus. Der Akteur kann also zwischen den Schemata kombinieren. Solche sich ausprägende Kombinationsmuster bezeichnet Schulze dann als Stiltypen. Diese Stiltypen verdichten sich wiederum in milieuspezifischen Existenzformen (KONIETZKA 1995, S.89). Als Zeichen von Milieuzugehörigkeit treten vor allem Stil, Lebensalter und Bildung hervor (SCHULZE 1992, S.185).
[...]
[1] Jedoch ließen sich gewisse weltliche Freizeitaktivitäten wie z.B. Feste, Turniere und Spiele nie ganz beseitigen. Auch kam es in der italienischen Renaissance in einigen Bevölkerungskreisen zu einer Rückbesinnung auf antike Freizeit- und Mußetraditionen (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.32).
[2] So z.B. Beobachtung (verdeckte, offene, teilnehmende), Dokumentenanalyse, Spurensicherung, Befragung (VESTER 1988, S.58).
[3] Der Ökonom Andrea berechnete, dass die alten Römer bei 12 Arbeitsstunden pro Werkstag auf ca. 2000 Arbeitsstunden im Jahr kamen. Dem steht eine Zahl von ca. 2100 Arbeitsstunden gegenüber, die ein Durchschnittsbürger des Jahres 1968 bei einer 5-Tage- Woche mit neunstündiger Arbeitszeit pro Tag und einem Jahresurlaub von 21 Werkstagen unter Berücksichtigung der üblichen Feiertage, arbeitete (OPASCHOWSKI 1997, S.26).
[4] Zuerst auch nur auf das bürgerliche Milieu beschränkt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erfasste dieser Trend aber auch die Industriearbeiterschaft (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.102).
[5] 3275 Jugendliche und junge Erwachsene (13-29 Jahre) aus dem ganzen Bundesgebiet wurden mit Hilfe von standardisierten mündlichen Interviews befragt (WIESNER/PICKEL, S.369ff.).
[6] 1995/96 wurden mit Hilfe weitgehend standardisierter Interviews 548 Jugendliche (15-20 Jahre) aus Halle und Bielefeld befragt. (Näheres zur Stichprobe: LANGE 1996, S.31ff.)
[7] Bei einer Telefonumfrage wurden 769 Personen unterschiedlichstem Alter aus dem Ruhrgebiet befragt (AGRICOLA 1999, S.28).
[8] John Kelly ermittelte in einer amerikanischen Studie von 1982 als wichtigste Teilnahmemotive an verschiedenen Freizeitaktivitäten „Vergnügen“ „Pflege von Kontakten“, „persönliches Wachstum“, „Entspannung“ und „Abwechslung“ (KELLY 1982, S.165, nach LAMPRECHT/STAMM 1994, S.144f.) Eine Untersuchung der Stadt Zürich gelangt zu ähnlichen Resultaten (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.145).
[9] Beck bezeichnet diese neue Art der sozialen Einbindung als „Kontroll- bzw. Reintegrationsdimension“ (BECK 1986, S.206). Der einzelne wird zwar aus seinen traditionalen Bindungen herausgelöst, tauscht dafür aber die Zwänge des Arbeitsmarktes und der Konsumexistenz und der in ihnen enthaltenen Standarisierungen und Kontrollen ein (BECK 1986, S.211).
[10] Für Konietzka ist der Zusammenhang zwischen „Individualisierung der Lebenslagen“ und der „Pluralisierung von Lebensstilen“ eine fragwürdige Konstruktion. Für ihn erscheint die Individualisierungsthese als theoretische Grundlage für eine Analyse von differentiellen Lebensstilmustern im Ansatz unbrauchbar, und er zeigt sich erstaunt, wie selbstverstädlich Becks Individualisierungsthese von der Lebensstildiskussion vereinnahmt wird (KONIETZKA 1994, S.153ff.).
[11] Mit Hilfe dieses Begriffs versucht Bourdieu die soziale Welt in Form eines mehrdimensionalen Macht und Handlungsgefüges darzustellen (KRÄMER 1995, S.540).
[12] Hervorhebungen sind aus dem Original übernommen.
[13] Anzumerken ist, dass GEORG (1998, S.77) und KONIETZKA (1995, S.35) nicht ganz einsehen, warum die Ebene des privaten Haushaltes die angemessene Untersuchungseinheit ist.
- Arbeit zitieren
- Daniel Helwig (Autor:in), 2001, Freizeitwissenschaft als Lebensstilforschung: Über Jugendliche im ländlichen Raum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1196
Kostenlos Autor werden




















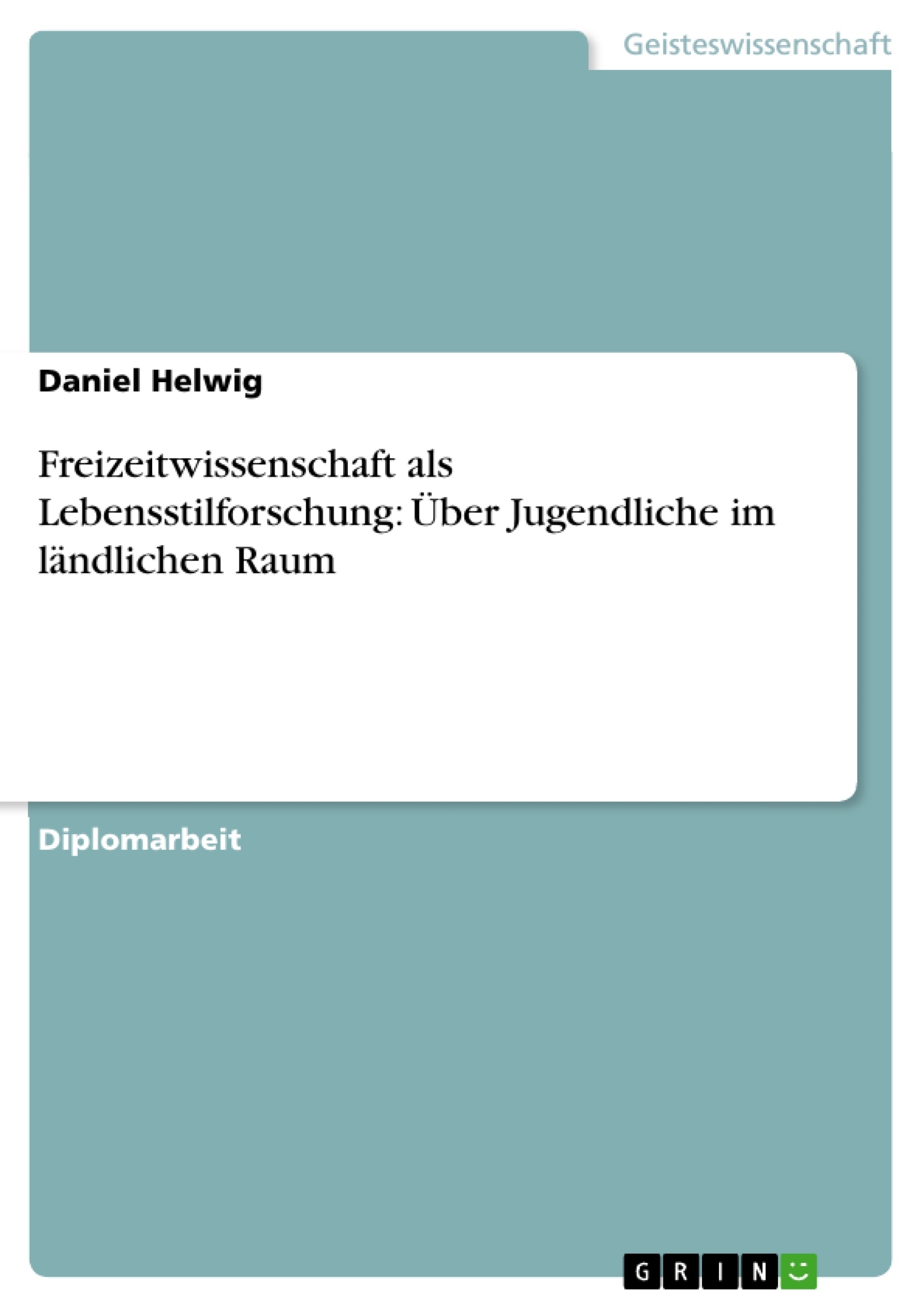

Kommentare
Freizeitwissenschaft als Lebensstilforschung ist einer von vielen möglichen Aspekten, die Freizeitwissenschaft zu sehen. Ergiebiger und erfolgversprechender sind allerdings Konzepte einer Freizeitwissenschaft, die auf einer integrativ-disziplinären Wissenschaftsauffassung beruhenDies und noch noch einiges mehr ist im Buch "Was ist Freizeitwissenschaft?" von Björn Gernig und Florian Carius nachzulesen:
http://www.shaker.de/shop/978-3-8322-8962-1
Dort ist auch der gesamte Vorspann inklusive Zusammenfassung, Inhalts- und Abbildungsverzeichnis, Geleitwort etc. kostenlos einzusehen.