Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Körpersoziologie und Extremsport
I. Einführung und Problemstellung
II. Aufbau der Arbeit
Teil A: Extremsport – Beschreibung des Gegenstandes
I. Definition von Extremsport
1. Was ist Extremsport? – Begriffliche Schwierigkeiten
2. Merkmale des Extremsports
3. Selbstkontrolle oder externalisierte Kontrolle beim Extremsport
4. Verletzungen und Tod: Die gefährlichsten Extremsportarten
II. Beschreibung von Extremsportlern
1. Allgemeine Merkmale, Typus
2. Extremsport – Eine Männerdomäne?
III. Entwicklung von Extremsport
1. Abenteuer und Risiko im Wandel der Zeit
2. Aufkommen und Verbreitung des Extremsports
3. Kommerzialisierung des Abenteuers: Der Extremsportler als Held
IV. Paradoxien und Ambivalenzen im Extremsport
1. Individualitätserhaltung versus Massenverbreitung des Extremsports
2. Autonomie versus Kooperation mit Marktwirtschaft und den Medien
3. Ablehnung von Erfindungen der Moderne versus Benutzung von modernen Hilfsmitteln und Sicherheiten
4. Gefahrensuche versus Sicherheitsbedürfnis
5. Respekt vor Natur versus Naturschädigung
Teil B: Extremsport in der Gesellschaft
I. Allgemeine gesellschaftliche Theorien im Zusammenhang mit Extremsport
1. Die Leistungsgesellschaft
2. Die Risikogesellschaft
3. Die Erlebnisgesellschaft
4. Die Regulationstheorie
II. Zusammenhang von Gesellschaft, Körper und der Entwicklung von Extremsport
1. Zivilisierung und Disziplinierung des Körpers
1.1 Erscheinungsbild des Sports
1.2 Die Rolle des Körpers
2. Neue Beachtung des Körpers: Sportvielfalt und Individualisierung
2.1 Erscheinungsbild des Sports
2.2 Paradoxie der gleichzeitigen Körperverdrängung und Körperaufwertung
2.3 Die Rolle des Körpers
3. Der Körper als soziales Gebilde, Sport und seine gesellschaftlichen Schranken
3.1 Traditioneller Sport im neuen Gewand?
3.2 Das „modern/anti-moderne Doppelgesicht“ des Extremsports
III. Gesellschaftliche Hintergründe und daraus resultierende Motive für das Betreiben von Extremsport
1. Untersuchungsgegenstand
1.1 Ziel und Hypothese
1.2 Durchführung
2. Theoretische und empirische Ergebnisse
2.1 Extremsport als Gegenpol zur Körperverdrängung im Alltag
2.1.1 Wiederentdeckung von Körpereinsatz und körperlichem Erleben
2.1.2 Wiederbelebung der Sinne
2.1.3 Empirische Befunde
2.2 Extremsport als Mittel gegen den Verlust von Eindeutigkeits- und Evidenz- erfahrungen
2.2.1 Evidenz durch die Intensität von Gefühlen
2.2.2 Evidenz durch das Erleben von natürlichen Größen und Kräften
2.2.3 Evidenz durch Flow
2.2.4 Empirische Befunde
2.3 Extremsport als Weg aus der eigenen Machtlosigkeit in der Gesellschaft
2.3.1 Erfahrung von Selbstermächtigung und Handlungswirksamkeit
2.3.2 Empirische Befunde
2.4 Extremsport als Kontrast zur heutigen Raum- und Gegenwartsverdrängung
2.4.1 Sinnliches Erleben von Räumen
2.4.2 Erleben von Zeit und Gegenwart
2.4.3 Empirische Befunde
2.5 Extremsport als Gegengewicht zur Alltagsroutine
2.5.1 Risikoerfahrungen gegen Reizarmut und Langeweile
2.5.2 Ungefährliches Ausleben von Aggression
2.5.3 Spaßorientierter Umgang mit Angst
2.5.4 Empirische Befunde
2.6 Extremsport als Unterstützung des heutigen Gebotes zur Distinktion
2.6.1 Selbstdarstellung durch die Gefährdung des Körpers
2.6.2 Dem Leben Stil verleihen
2.6.3 Empirische Befunde
2.7 Unterschiede in Theorie und Praxis und weitere Auffälligkeiten
3. Interpretation der Ergebnisse
Schluss: Zusammenfassung
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS
VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN
Einleitung: Körpersoziologie und Extremsport
I. Einführung und Problemstellung
„Natur Pur – Mit Freunden Abenteuerluft schnuppern“ wirbt das Prospekt einer Firma in Aschau im Chiemgau. Von Paragliding und Rafting über extremes Mountainbiking bis hin zu Canyoning und Erlebnistouren wie der „Patschnaßtour“, „Schlucht’In“ und „Outside Programmen“: Bei „Natur Pur“ kann sich jeder seinen individuellen Extremsportplan in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zusammenstellen. Für ein entsprechendes Entgelt kann man unter professioneller Anleitung den besonderen Kick erleben, den sich offenbar immer mehr Menschen wünschen.
Aber warum ist das so? Warum setzt ein Mensch in seiner Freizeit seinen Körper und sein ganzes Leben freiwillig aufs Spiel? Kann der Wunsch nach Aufregung nicht auch mit einem spannenden Film kompensiert werden? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich diese Arbeit. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht auf den persönlichen Gründen des Extremsportlers, die vor allem von der Psychologie erforscht werden, sondern auf den gesellschaftlichen Hintergründen. Sprich: Inwiefern ist die Gesellschaft und ihre Entwicklung dafür verantwortlich, dass der Extremsport entstehen konnte und nun so massenhaft von den Menschen betrieben wird? Zur Beantwortung dieser Frage werden modelltheoretische Ableitungen auf Grundlage gesellschaftstheoretischer Erkenntnisse vorgenommen. Der Extremsport wird in einen sozialen Kontext eingebettet. Dabei werden zur Erforschung des Entstehens und der Motive des Extremsports in hohem Maße die Erkenntnisse der Körpersoziologie herangezogen. Dieses relativ junge Teilgebiet der Soziologie[1] beschäftigt sich mit dem gesellschaftlich beeinflussten Körper bzw. mit der „wechselseitigen Durchdringung von Körper und Gesellschaft“ (Gugutzer, 2004, S. 7). „Was immer wir mit unserem Körper tun, wie wir mit ihm umgehen, wie wir ihn einsetzen, welche Einstellung wir zu ihm haben, wie wir ihn bewerten, empfinden und welche Bedeutung wir dem Körper zuschreiben, all das ist geprägt von der Gesellschaft und der Kultur, in der wir leben“, schreibt Robert Gugutzer in seinem Buch „Soziologie des Körpers“ (2004, S. 5).
Bezogen auf mein Thema heißt das also, dass sich mit Hilfe der Körpersoziologie eine Verbindung zwischen den aktuellen Werten und Vorstellungen der Gesellschaft und der spezifischen Art und Weise der Sportausübung herstellen lässt. Das Augenmerk der Magisterarbeit liegt somit zum einen auf der Deutung des Extremsports auf körpersoziologischer Ebene und zum anderen auf den Motiven des Extremsports. Das heißt, es wird herausgearbeitet, welche gesellschaftlichen Vorstellungen vom Körper und von dessen Nutzung im Extremsport zum Ausdruck kommen und weshalb der Einzelne bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen mit dem Riskieren seines Körpers begegnet bzw. welchen Vorteil er sich von der Ausübung von Extremsport verspricht.
II. Aufbau der Arbeit
Meine Arbeit gliedert sich in zwei größere Teile. Der erste Block beschäftigt sich mit dem Extremsport als solchen. Der zweite Block bringt in einem ersten Schritt die Entwicklung des Extremsports mit Entwicklungen in der Gesellschaft in Verbindung, während er in einem zweiten zeigt, wie die Gesellschaft speziell auf den Körper und somit auch auf die Nutzung des Körpers im (Extrem-) Sport einwirkt.
In Teil A der Arbeit verweist die Begriffsdefinition des ersten Kapitels auf ein grundsätzliches Problem in der Literatur. Es zeigte sich nämlich während der Recherche, dass es die eine Bedeutung für den inzwischen alltäglich gebrauchten Begriff „Extremsport“ nicht gibt. Anhand von Textauszügen und Zitaten verschiedener Autoren wird dieses Problem aufgezeigt. Anschließend werden die spezifischen Merkmale des Extremsports herausgearbeitet, um den Begriff für diese Arbeit „greifbarer“ zu machen.
Eine wichtige Rolle in der Definition von Extremsport spielt der Grad der Kontrollausübung während der extremsportlichen Aktivität. Hierbei wird zwischen Selbstkontrolle und externalisierter Kontrolle unterschieden. Da mit Extremsport häufig Begriffe wie Gefahr, Verletzung und Tod assoziiert werden, soll in diesem Kapitel ebenfalls auf die Zahl der tatsächlichen Unfälle eingegangen werden.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Menschen, die Extremsport betreiben. Dabei wird zunächst der „typische Extremsportler“ in Augenschein genommen. Da dieser immer als männlich beschrieben wird, will ich in diesem Kapitel auch darauf eingehen, warum offenbar mehr Männer als Frauen den Kick im Sport suchen. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Entstehung von Extremsport. Es wird gezeigt, dass riskantes Verhalten immer schon ein Teil des menschlichen Lebens war und auch die Suche nach Risiko und Abenteuer nichts Neues oder Außergewöhnliches ist. Wie der Extremsport – so wie wir ihn heute kennen – entstand und sich verbreitete, wird als Nächstes dargelegt. Da ein wichtiges Merkmal des heutigen Extremsports seine Kommerzialisierungsfähigkeit sowie die Hochstilisierung des Aktiven zum Helden ist, soll dies in diesem Kaptitel ebenso angesprochen werden.
Im Bereich des Extremsports finden sich in vielerlei Hinsicht Ambivalenzen, die wohl jede für sich genommen eine eigene Arbeit ergeben würde. Die m.E. auffälligsten Paradoxien sollen im vierten Kapitel kurz und bündig näher betrachtet werden.
Teil B bringt nun die Gesellschaft mit ins Spiel. So wird im ersten Kapitel der Extremsport anhand aktueller sozialwissenschaftlicher Theorien gedeutet. Im Einzelnen sind dies die Leistungsgesellschaft, die Risikogesellschaft, die Erlebnisgesellschaft sowie die Regulationstheorie.
Das zweite Kapitel rückt dann explizit den Körper in den Blickpunkt. Es wird gezeigt, wie sich das Bild des Körpers in der Gesellschaft und demzufolge auch der Sport im Laufe der Zeit verändert haben. Dabei wird zunächst auf die Zivilisierung und Disziplinierung des Körpers im Sport eingegangen, was vor allem zur Charakterisierung von älteren Körperprogrammen bedeutsam ist und dann auf die Pluralisierungs- und Individualisierungstendenzen, die in der heutigen Körperkultur und Sportlandschaft eine große Rolle spielen. Anschließend wird der Zusammenhang von gesellschaftlichen Wertmaßstäben, Körpersicht und Sport herausgearbeitet. Es wird diskutiert, ob der heutige Sport tatsächlich so frei und selbstbestimmt ausgeübt werden kann, wie in den Überlegungen zu Individualisierung und Pluralisierung angenommen, oder ob er nicht auch gewissen gesellschaftlichen Schranken unterliegt. Dabei wird speziell auch auf den Extremsport eingegangen.
Das dritte Kapitel in Teil B beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Hintergründen von Extremsport. Es soll verdeutlicht werden, welche gesellschaftlichen Faktoren die Ausübung von riskantem Sport beeinflussen und inwiefern der Einzelne von der Ausübung seines Extremsports profitiert. Dabei konzentriere ich mich auf körpersoziologische Motive, allerdings werden auch einige psychologische und pädagogische Erklärungen angesprochen. Die Motive werden auf theoretischer Basis untersucht, aber mit eigenen empirischen Befunden anhand von Experteninterviews mit sieben Extremsportlern ergänzt und erweitert.
Teil A: Extremsport – Beschreibung des Gegenstandes
I. Definition von Extremsport
1. Was ist Extremsport? – Begriffliche Schwierigkeiten
Extremsport, Risikosport, Abenteuersport, Trendsport, Funsport, Wagnissport, Outdoorsport, Soft Adventure,... In der Literatur stößt man auf viele verschiedene Begriffe, die nicht gründlich voneinander abgegrenzt werden. Oft wird in unterschiedlichen Büchern dasselbe Phänomen mit einem anderen Begriff benannt oder ein Begriff auf verschiedenste Sportarten angewendet. Viele Sportarten finden sich auch in mehreren Kategorien wieder. So hängt es offensichtlich vom jeweiligen Ansatz, von der wissenschaftlichen Fachrichtung und auch dem Autor selbst ab, welche Bezeichnung für welchen Sport verwendet wird.
„Was ist warum extrem?“ fragt sich zum Beispiel Neumann in Bezug auf den Extremsport-Begriff (2003, S. 26/27). Missverständlich und unscharf findet er ebenso andere gängige Bezeichnungen wie Risikosport und Erlebnissport. Frage man genauer nach, was riskant, was abenteuerlich, erlebnisreich usw. an diesem Sport sein soll, würden die Antworten diffus. Die Begründung für dieses „Durcheinander“ wird von Neumann anhand des häufig benutzten Ausdrucks Abenteuersport auf den Punkt gebracht: „Denn es gibt nicht die Bedeutung des ‚Abenteuersports’, sondern verschiedene pädagogische Programme oder Ansätze stützen sich in unterschiedlicher Weise auf den Abenteuerbegriff,...“ (Neumann, 2003, S. 26). M.E. kann dieses Zitat stellvertretend auch auf andere Begriffe und außerpädagogische Fachrichtungen angewandt werden. Neumann entscheidet sich jedenfalls für den Begriff Wagnissport. Das Wagnis definiert er als Entschluss, sich trotz bestehenden Unsicherheiten und Gefährdungen freiwillig sportlichen Herausforderungen zu stellen (vgl. Neumann, 1999, S. 5).
Wie das Beispiel Neumann zeigt, wird es in der Literatur üblicherweise so gehandhabt, dass der Autor „seinen“ Begriff wählt, erläutert, was er darunter versteht und ihn auf seine Erkenntnisse anwendet. Aufgrund der Fülle von spezifischen Definitionen, sollen an dieser Stelle nur einige beispielhaft herausgegriffen werden, um zu zeigen, welche Unterschiede zwischen den einzelnen Autoren zu finden sind.
Kuhn und Todt unterscheiden den Extrem-Risikosport, „bei dem es immer wieder zu Situationen kommen kann, in denen das Leben akut bedroht ist“ vom Risikosport als Breitenphänomen, bei dem das Verletzungsrisiko relativ gering ist (2003, S. 21). Was Semler (1994) hingegen zu den Risikosportarten zählt, bezeichnet Rupe (2000) als „ Soft Adventure Trend “. Darunter subsumiert sie, ebenso wie Semler, eine Palette sportlicher Aktivitäten, wie Varianten des Tauchens, Fliegens, Kletterns, Springens und verschiedene Ausprägungen der schnellen Fortbewegung, ebenso wie Expeditionen, Safaris und Höhlenforschungen (vgl. Semler, 1994, S. 21/22 und vgl. Rupe, 2000, S. 43).
Der Begriff Trendsport bezeichnet Sportarten, die Spielarten der Outdoor-, Abenteuer-, Risiko- und Funsport in sich vereinigen (Rupe, 2000, S. 44, zitiert nach Schwier, 1998, und Lamprecht et al, 1998). Trendsport wird (Rupe, 2000, S. 44, zitiert nach Dahlem, 1997) von „einer kleinen Gruppe von Meinungsbildnern betrieben [...], ohne Liga und starre Strukturen und ohne feste Trainingszeiten. Im Vordergrund stehen Spaß und Erlebnis, nicht Leistung und Wettkampf. Trendsport „ist emotional und drückt Weltanschauung aus“ (Rupe, 2000, S. 44, zitiert nach Dahlem, 1997). Er kann ebenfalls extrem und riskant sein, muss es aber nicht. Erfolgreichen Trendsportarten wird kurz- oder mittelfristig ein erhebliches Verbreitungspotential vorhergesagt (Rupe, 2000, S. 44, zitiert nach Schwier, 1998). Ähnlich charakterisiert wird der Funsport. Ihm werden insbesondere jugendspezifische Sportarten zugerechnet, allerdings fehlt hierbei vollkommen die Leistungskomponente (Rupe, 2000, S. 45 zitiert nach Lamprecht et al, 1998). Trendsport und Funsport sind im hohen Maße „Modesportarten“. Sie basieren auf technischen Neuheiten und erfordern nicht selten eine Spezialausrüstung oder ein spezielles Outfit (Rupe, 2000, zitiert nach Neuerburg, 1993). Hartmann (1996, S. 74) bezeichnet den Funsport als „kommerziell-angeheiztes jugendkulturelles Massenphänomen, bei dem ein anstrengungsloses Vergnügen dominiert, das in der Regel bald verfliegt oder zugunsten eines anderen aufgegeben wird“, während es beim extremen Risiko- und Ausdauersport um sportliche Höchstleistungen geht, die ein asketisches Leben einfordern. Allerdings erkennt er in allen drei Klassen dasselbe Grundphänomen und überlässt die Unterscheidung bzw. Nicht-Unterscheidung dem Leser selbst. Nach Hartmann scheint den kommerziellen Anbietern ein „[...] ‚Karrieremodell’ – vom Fun- zum Extremsport – vorzuschweben“. Hartmann benutzt für seine weiteren Ausführungen jedenfalls den übergreifenden Begriff „ Thrilling Fields “ (vgl. Hartmann, 1996).
Die so genannten Outdoor- oder Natursportarten legen ihren Schwerpunkt auf das Erlebnis in der freien Natur und das subjektive Erleben (Rupe, 2000, S. 47, zitiert nach Saibold, 1998, und Dahlem, 1997), während der Abenteuersport außergewöhnliche und einmalige Erlebnisse als Ziel hat (Rupe, 2000, S. 47, zitiert nach Opaschowski, 1996).
Im Mittelpunkt des Extremsports stehen hingegen nicht nur das Abenteuer, sondern explizit Grenzerlebnisse und neue Herausforderungen (Rupe, 2000, S. 48, zitiert nach Opaschowski, 1996). Die Extremsituation ist entweder in der Sportart selbst enthalten (wie z.B. im Bungee Jumping, House Running[2], Base Jumping[3], Sky Surfen[4], Fallschirmspringen, Paragliding[5], etc.), kann jedoch auch durch die Veränderung bzw. Steigerung anderer Sportarten auf verschiedene Weise erfolgen. Entweder wird dabei auf die üblichen Hilfsmittel verzichtet (z.B. beim Freeclimbing), die Sportart in ungünstigen Klimazonen (z.B. Trekking und Bike-Touren durch Wüsten oder Eiswüsten) ausgeübt oder die Belastungsdauer und -intensität massiv gesteigert (z.B. Triathlon, Schwimm-Marathon, Survival Touren, Apnoe-Tauchen[6], etc.) (vgl. Rupe, 2000, S. 48, zitiert nach Schildmacher, 1998, und vgl. Hartmann, 1996, S. 71). Ich möchte mich dieser Definition anschließen.
Auch wenn sich nun einige Parallelen zum Hochleistungssport andeuten: Extrem- und Spitzensport sind, insbesondere in ihrer Zielsetzung, zwei völlig unterschiedliche Bereiche. Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass die gefährlichen Aktivitäten nicht trotz der Risiken aufgesucht werden, sondern gerade weil sie entsprechende Wagnisse in sich bergen (vgl. Stern, 2003, S.38). „Nicht Wettkampf, Konkurrenz und mithin Millionen-Verträge wie im Spitzensport lassen die hohen Risiken nur billigend in Kauf nehmen“, so Stern (2003, S. 38), im Extremsport wird ein „Sich-aufs-Spiel-Setzen“ aktiv gesucht. Im Gegensatz zum Extremsport ist der Leistungssport - wie der Name schon sagt - an Leistung und Sieg orientiert, und stark auf die Zukunft ausgerichtet. Belohnungen für Mühen und Anstrengungen sind aufzuschieben und kommen in der Regel, wenn überhaupt, erst über lange Zeitdistanzen zustande (vgl. Bette, 1989, S. 165 ff). Nicht so im Extremsport, in dem die momentanen Fähigkeiten und Bedürfnisse des Sportlers im Hier und Jetzt zählen und seine Herausforderungen bestimmen (vgl. Stern, 2003, S. 38).
Da Extremsport für die körperliche Unversehrtheit und das eigene Leben oft sehr riskant ist, kann man bei vielen Extremsportarten auch von Risikosport [7] sprechen. Eines der wichtigsten Merkmale des Risikosports ist, dass eine Störung oder ein Fehler unmittelbare Folgen haben (vgl. Rupe, 2000, S. 48). Extremsport muss nicht zwangsläufig riskant sein, ist es aber dennoch meist, da „normale“ sportliche Aktivitäten eine außergewöhnliche und durchaus radikale Form annehmen. Die Konfrontation mit dem Todesrisiko ist jedoch kalkuliert, räumlich und zeitlich bestimmt sowie begrenzt und individuell abgestimmt. Das bedeutet, dass der Kampf mit den Risiken - und hierin liegt ein grundlegender Unterschied zu den Gefahren im Alltag - potentiell lösbar ist (vgl. Stern, 2003, S. 38).
In dieser Arbeit konzentriere ich mich nun also auf den Begriff Extremsport. An mehreren Stellen tauchen allerdings auch andere Wendungen auf, wenn sich diese in Bezug auf die Aussageabsicht besser eignen.
2. Merkmale des Extremsports
In Anlehnung an Ulrich Aufmuth (1989) stellt Henning Allmer (1995, S. 62/63) fünf Merkmale zusammen, die für Extrem- und Risikosport charakteristisch sind. Dabei besitzen nicht alle Kriterien für sämtliche Sportarten die gleiche Bedeutung. Schließlich sind diese sehr vielfältig und unterscheiden sich stark untereinander. Den Extremsport gibt es nicht. In unterschiedlicher Gewichtung treten folgende Eigenschaften in den einzelnen Sportarten aber auffällig oft auf:
Kennzeichnend für Risiko- und Extremsport sind erstens außerordentliche körperliche Strapazen. Blutige Hände, Erfrierungen an den Füßen, quälende Muskelschmerzen, ständiger Hunger und Durst werden von den Aktiven freiwillig in Kauf genommen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dem Körper wird das Letzte abverlangt und Anstrengungen münden häufig in totale Erschöpfung. Für viele Sportler besteht der Reiz der Ausübung einer Extremsportart darin, dass sie sich in ungewohnte Körperlagen und –zustände (Allmer, 1995, S. 62, zitiert nach Schneider&Rheinberg, 1995, S. 424) versetzen. Hierzu gehören der freie Fall, das beinahe schwerelose Schweben in Luft und Wasser, hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, schnelle Rotationsbewegungen und extreme Körperseitenlagen.
Ein besonders wichtiges Merkmal von Risikosport ist der ungewisse Handlungsausgang. Dabei sind Erfolg und Misserfolg bei der Bewältigung einer Situation gleich wahrscheinlich. Ob eine Aktivität gelingt oder misslingt, hängt auch von unvorhersehbaren Situationsbedingungen ab. Risikosport lässt sich nicht detailliert planen. Der Extremsportler weiß nie hundertprozentig, wie sich die Situation entwickelt, auf welche hilfreichen Gegebenheiten und Hindernisse er stößt. Der Grad der Vorhersehbarkeit hängt vom Ausmaß der Information ab, die der Sportler besitzt. Je weniger Information, desto unvorhersehbarer und damit auch unkontrollierbarer wird die Situation. Allmer (1995, S. 63) nennt zwei verschiedene Arten von unvorhersehbaren Situationsbedingungen. Erstens können so genannte erwartungswidrige Ereignisse auftreten. Diese Ereignisse sind aufgrund zurückliegender Erfahrungen von der Person zwar grundsätzlich vorhersehbar, treten aber zu einem unerwarteten Zeitpunkt auf, wie zum Beispiel ein Wetterumschwung während einer Bergtour. Zweitens ist die Vorhersehbarkeit für eine Person gering, wenn sie sich unbekannten Ereignissen gegenübersieht, für deren Bewältigung sie noch keine Erfahrungen gemacht hat. Dies ist nicht nur bei Anfängern einer bestimmten Risikosportart der Fall. „Unvorhersehbare Situationen, die eine planende Vorbereitung nicht möglich machen und einen Überraschungseffekt auslösen, erfordern sofortiges Handeln in der konkreten Konfrontation“, so Allmer (1995, S. 63).
Extrem- und Risikosportarten sind bis zu einem gewissen Grad immer lebensgefährliche Aktionen. So ist die Gefahr eines tödlichen Absturzes, einer Verschüttung durch Lawinen, eines Orientierungsverlustes unter Wasser oder eines Kontrollverlustes eines schnellen Fahrzeugs ständig vorhanden. Einerseits resultieren Gefährdungen aus Fehlern, Unachtsamkeiten oder aus dem Leichtsinn des Akteurs, andererseits kann auch eine plötzliche Verschlechterung der Situationsbedingungen dafür verantwortlich sein. Das Scheitern in der extremsportlichen Aktivität kann lebensbedrohliche Konsequenzen nach sich ziehen, während sich der Erfolg unmittelbar im Überleben widerspiegelt (vgl. Allmer, 1995, S. 63).
In Anlehnung an Hartmann (1996) und Schwier (1998) bündelt Rupe (2000, S. 46) jene Faktoren, die den Extremsport kennzeichnen, in drei Gruppen:
Gemeinsame und spezifische Faktoren von Extrem- und Riskoaktivitäten:
Körperbezogene Generalfaktoren:
- Körperbetonung, Exponierung des eigenen Körpers.
- Körperliche Fitness, Körperbeherrschung, Geschicklichkeit, „Technik“ als Voraussetzung.
- Motorische Bedürfnisse, Bewegungsdrang, Mobilität.
Psychische Generalfaktoren:
- Aufsuchen von unterschiedlich getönten Erregungszuständen wie Fun, Hoch-Gefühl, Angst, Nervenkitzel, Thrill, „Angstlust“.
- Aufsuchen von „Trance- und Rauschzuständen“.
- Voraussetzung und Herausforderung bestimmter Charaktereigenschaften: Mut, Wagemut, Tollkühnheit, Nervenstärke, Gelassenheit, Coolness, Diszipliniertheit, Umsicht, Konzentrationsfähigkeit, Geistesgegenwart, Flexibilität, Durchhaltevermögen, etc.
Spezifische Faktoren:
- Bedürfnis nach Geschwindigkeit, und (Quer-) Beschleunigung.
- Aufsuchen von Tiefen- und/oder Drehschwindel.
- Aufsuchen von körperlicher und/oder seelischer Belastungen, teilweise über längere Zeit mit extremen Anforderungen an Dauerleistungsfähigkeit.
- Aufsuchen von Risiken und Gefahren – vom einfachen Verletzungsrisiko bis hin zur akuten Todesgefahr.
Darstellung von Rupe, 2000, S. 46, in Anlehnung an Hartmann, 1996, und Schwier, 1998: Gemeinsame und spezifische Faktoren von Extrem- und Risikoaktivitäten.
Die körperbezogenen Generalfaktoren beziehen sich auf das Körpergefühl, das Empfinden des Körpers und die Bewegungsmöglichkeiten des Körpers. Die psychischen Generalfaktoren beschreiben hingegen das innere Erleben, das bei der Ausübung von Extremsport empfunden wird sowie die psychischen Herausforderungen, die teilweise vorausgesetzt und teilweise von den Aktiven „als Belohnung“ erwartet werden. Die spezifischen Faktoren charakterisieren die einzelnen Aktivitäten als (lebens-) gefährlich, als Ausdauerleistung oder als spielerisch-akrobatisch (vgl. Hartmann, 1996, S. 74). Sie sind alle durch eine gewisse grundlegende Gefahr gekennzeichnet, die mehr oder weniger kalkulierbar ist. Außerdem erfordern sie schnelle und dem Handlungsziel angepasste körperliche und psychische Fähigkeiten, wie etwa spontane Entscheidungen und bewegungsadäquates Reagieren (vgl. Rupe, 2000, S. 46).
3. Selbstkontrolle oder externalisierte Kontrolle beim Extremsport
Es ist sinnvoll, beim Extremsport zwei Kategorien zu unterscheiden, die die Kontrolle der riskanten Situation betreffen. Die erste Kategorie der Selbstkontrolle umfasst u.a. Sportarten wie Base Jumping, Down-Hill-Biking[8], Wildwasser-Kajak, Paragliding und Freeclimbing. Bei der Ausübung dieser Sportarten liegt die Kontrollinstanz beim Aktiven selbst. Fähigkeiten und Fertigkeiten und seine persönliche Einschätzung der Schwierigkeiten und Risiken sind dabei ausschlaggebend für das Gelingen oder Misslingen der Aktivität. Der Sportler kann und muss maßgeblich Einfluss auf den Verlauf der Aktivität nehmen. Er kann dabei zwar hochgradig eine technische Aufrüstung des Körpers in Anspruch nehmen, entscheidend ist jedoch, dass er nicht vollständig von der Technik beherrscht wird, sondern die Hilfsmittel selbstständig anwenden und kontrollieren muss (vgl. Stern, 2003, S. 38).
Zur zweiten Kategorie der externalisierten Kontrolle gehören Sportarten wie Bungee Jumping, Zorbing[9] oder Tandemspringen, in gradueller Abstufung auch kommerzielle Organisationen von Wildwasser-Rafting- oder Canyoning[10] -Touren. Der grundlegende Unterschied zur ersten Gruppe besteht darin, dass die Teilnehmer keinen direkten Einfluss auf das Geschehen nehmen können. Ob man es sich zutraut oder nicht beim Tandemsprung das „sichere“ Trittbrett zu verlassen oder sich beim Bungee-Sprung über die Brückenbrüstung zu stürzen, obliegt zwar der persönlichen Entscheidung. Danach jedoch verliert man jegliche Möglichkeit der Kontrolle über das weitere Geschehen. Dabei entfällt nicht die Kotrolle an sich, sie verlagert sich vielmehr weg vom Aktiven hin zu einer externen Kontrolle – entweder in Gestalt eines Betreuers oder in Form von ausschließlicher Technik-Wirksamkeit (vgl. Stern, 2003, S. 39, zitiert nach Koch, 1994)
4. Verletzungen und Tod: Die gefährlichsten Extremsportarten
Im Grunde birgt jede sportliche Betätigung die Gefahr einer Verletzung in sich, wie die Zahl von 1,3 bis 1,4 Millionen Sportunfällen im Jahr zeigt. Einige Sportarten beinhalten jedoch ein besonders hohes Verletzungs- und Todesrisiko, wie die amerikanische Studie „Reif, Risks and Gains“[11] verdeutlicht In dieser Studie wurden Statistiken von Versicherungen, Sportverbänden und Behörden zusammengetragen und ausgewertet, so dass ein Vergleich der Risiken verschiedener Sportarten möglich war. Dabei differenzierte man zwischen Todesfällen, schwerwiegenden Verletzungen und Dauerfolgen sowie kleineren Verletzungen, welche eine medizinische Versorgung erfordern. Außerdem wurden die Risiken auf der Grundlage einer jährlichen Teilnahme und einer lebenslänglichen Teilnahme an einer Sportart unterschieden (vgl. Hübner, 1991, S. 2).
Wie die Auswertung der Statistiken ergab, ist die Sportart mit dem höchsten Todesrisiko das Bergklettern. Besonders betroffen sind dabei die Experten. Legt man eine lebenslange Teilnahme an dieser Sportart zugrunde[12], so beträgt die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Unfalls bei Experten 1:7, bei allen anderen Bergkletterern 1:70. Zum Vergleich: Das Todesrisiko eines Skifahrers beträgt bei einer lebenslangen Ausübung lediglich 1:57000, wobei Skirennfahrer ein Todesrisiko von 1:4000 tragen. Neben der Bergkletterei sind als Sportarten mit einem besonders hohen Todesrisiko das Drachenfliegen (1:22 bei lebenslanger Teilnahme) und das Fallschirmspringen (1:23) zu nennen. Das Todesrisiko eines Tiefseetauchers beträgt 1:96, das eines Profiboxers 1:220. Ein geringes Todesrisiko hat neben dem Skifahren und dem Fußball das Surfen, wo eine Todeswahrscheinlichkeit statistisch nicht nachgewiesen ist. Eine ganz andere Risikoverteilung ergibt sich bei schweren und leichten Verletzungen. Dabei steht Fußball auf der Liste der „Risks and Gains“-Studie auf dem ersten Platz (vgl. Hübner, 1991, S. 2). Einige Sportarten bringen also ein hohes Todesrisiko, andere ein hohes Verletzungsrisiko mit sich.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass eine Extremsportart wie z.B. das Bergklettern kein besonders hohes Risiko darstellt, wenn ein Sportler gut trainiert ist, eine gute Ausrüstung benutzt und ein gesundes Urteilsvermögen besitzt. Allerdings ist es eine Tatsache, dass sich das Risiko mit zunehmender Übung steigert: Ein einziger schwerer Fehler, den ein Bergsteiger macht, kann zu seinem Verhängnis werden. Mit der Häufigkeit des Kletterns nimmt auch die Anzahl der unkontrollierbaren Risiken zu, wie Steinschläge, Lawinen, etc. Hinzu kommt, dass mit zunehmender Übung das Verlangen nach größeren Herausforderungen wächst. Hiermit wachsen aber auch die Risiken, die damit verbunden sind und mit den individuellen Fähigkeiten nichts zu tun haben (vgl. Hübner, S. 1991, S. 2/3). Dies bestätigt auch Aufmuth (1996, S. 122): „Von jenen Alpinisten, die jeweils zu den anerkannt besten ihrer Generation gehörten, starben vier von zehn am Berg. Betrachtet man diejenigen, die das Leben behielten beziehungsweise behalten, so stellt man fest, dass die Hälfte dieser „Überlebenden“ von schweren Verletzungen gekennzeichnet ist; meist handelt es sich um Erfrierungen, die zur Amputation von Gliedmaßen führten.“ Eine ähnliche Steigerung des Risikos mit zunehmender Übung wurde beim Drachenfliegen beobachtet. Dagegen teilen sich beim Fallschirmspringen die Experten das höchste Risiko mit den Anfängern. Denn während die Neulinge dazu tendieren, die Reißleine zu verfehlen, führen geübtere Springer gefährlichere Aktionen durch (vgl. Hübner, 1991, S. 2/3).
Zusammenfassend kann man sagen, dass mit dem Trend zu neuen extremen Sportarten die Verletzungsrisiken und die Zahl der tödlichen Unfälle zunehmen. Das Risiko etwa, beim Schwimmen zu ertrinken, ist sieben Mal kleiner als beim Paragliding tödlich abzustürzen (vgl. Opaschowski, 1997, S. 249).
II. Beschreibung von Extremsportlern
1. Allgemeine Merkmale, Typus
Wie ist er denn nun, der „typische Risikosucher“? Nach Gert Semler (S. 25) wird er in der wissenschaftlichen Literatur meist als relativ jung, männlich und aus der mittleren Einkommensschicht kommend, beschrieben. Obwohl er Interesse an Menschen hat und häufig einen Beruf mit viel Sozialkontakt ausübt, legt er Wert auf seine Unabhängigkeit und hat daher ein eher geringes Anschlussbedürfnis. Beruflich ist er nicht unbedingt erfolgreich, obwohl er eine durchschnittliche bis überdurchschnittliche Intelligenz besitzt. Er ist kreativ, phantasievoll und scheint mehr auf inhaltliche Aspekte seiner Tätigkeiten und auf ideelle Befriedigung Wert zu legen, als auf materiellen Erfolg und Statusgewinn. Man kann ihn - gemessen an gesellschaftliche Vorstellungen - als mutig bezeichnen. Diese Eigenschaft zeigt sich nicht nur in seinen kühnen sportlichen Aktivitäten, sondern auch in anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel in Form von Zivilcourage. Er gilt als unangepasst, unkonventionell, nonkonformistisch, mit einem gewissen Hang zur Anarchie. So kommt es durchaus vor, dass er Normen und Werte nicht beachtet und gesellschaftlich anerkannte Grenzen überschreitet. Der typische Extremsportler hat ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Anregung und ist deswegen für neue und ungewöhnliche Erfahrungen sehr aufgeschlossen. Er raucht, trinkt und ist auch Drogen nicht abgeneigt. Abwechslung sucht er nicht nur im „realen“ Leben, sondern auch vor dem Fernseher und im Kino (vgl. Semler, 1994, S. 25). Eine derartige Typologisierung darf natürlich nicht allzu ernst genommen werden.
Der Sozialwissenschaftler und Alpinist Ulrich Aufmuth (1996, S. 92ff) beschäftigte sich insbesondere mit der Psychologie von Extremsportlern. Er beschreibt sie als sensible, empfindsame Menschen, die häufig eine starke Leere und eine große Unrast erleben. Sie zeigen eine enorme Risikobereitschaft und eine tiefreichende Identitätsproblematik. Ihr Tatendrang besteht aus einer Kombination von hoher Sensibilität und starker Vitalität. Für Opaschowski (2000, S. 94) sind Extremsportler „offensichtlich hin- und hergerissen zwischen innerer Unruhe und äußerer Rastlosigkeit, zwischen der Suche nach Identität und der Bereitschaft, dafür Risiken einzugehen.“ Das Forschungsinstitut der British American Tobacco stellte in einer Repräsentativbefragung im März 2000 in Deutschland fest, dass Risikosportler zwar Grenzgänger, aber keine Aussteiger sein wollen (vgl. Opaschowski, 2000, S. 126).
2. Extremsport – Eine Männerdomäne?
Schon bei der Suche nach den Interviewpartnern fiel auf: Es war kein Problem, Männer ausfindig zu machen, die eine Risikosportart betreiben. Bei den Frauen hingegen war dies schon sehr viel schwieriger. Auch bei Interviews in verschiedensten Zeitschriften und in Fernsehsendungen fällt auf, dass hier fast nur Männer zu Wort kommen. Und in der Fachliteratur sind weibliche Erfahrungen im Extremsport kaum enthalten. Frauen sind in diesem Sportbereich offenbar stark unterrepräsentiert.
Historisch gesehen ist Sport allgemein immer schon eine Männerdomäne. Das liegt daran, dass die Thematiken des Sportbereichs überwiegend Männer faszinieren, was nicht heißen soll, dass Frauen sich nicht auch von derartigen Vorstellungen angezogen fühlen. Die wichtigsten Punkte nach Gebauer (2002, S. 168) sind dabei der Wettkampf, das Beherrschen von Gegnern und Meisterung des Zufalls sowie die Unterordnung zum Zweck des Siegs, dies alles verbunden mit körperlicher Stärke, Einmaligkeit und Phantasien von Unsterblichkeit (vgl. Gebauer, 2002, S. 168/169). Gerade für den Extremsport gelten diese Faktoren.
Seit jeher handeln Geschichten fast ausschließlich von dem Helden - und nicht der Heldin - der Wagemut, Pioniergeist und Entdeckerlust verspürt. Er kämpft gegen die Gefahr, ringt mit den Naturgewalten und erlebt Abenteuer. Heldinnen, wie z.B. Pippi Langstrumpf und die Rote Zora, sind seltene Ausnahmen. Und diese sind überwiegend auf das Kindesalter beschränkt, um ihnen einen gewissen kindlichen Spielraum zu gestatten. Hinzu kommt, dass sie durch ihre außergewöhnlichen Handlungen oftmals so dargestellt werden, dass man sie als Zuschauer kaum mehr als Mädchen wahrnimmt. In einer Studie durchsuchte die Sozialwissenschaftlerin Corinna Kehlenbeck moderne Mädchenbücher von 1970-1990 nach Abenteuerheldinnen. Dabei zeigte sich erwartungsgemäß, dass Abenteurerinnen nur sehr selten vorkommen. Dort, wo Heldinnen auftreten, sind sie auf den ersten Blick zwar agile und vitale Geschöpfe, bleiben bei genauerem Hinsehen jedoch den traditionellen Rollenmustern verhaftet (vgl. Rose, 1993, S. 26/27).
Wirft man einen Blick in die heutige Werbung findet man auch hier überwiegend risikobereite Männer, die sich mit nacktem Oberkörper für ein Duschgel von der Felsklippe stürzen oder ähnliche mutige Taten vollbringen. Einmal im Leben auch so ein toller Held sein und von allen bewundert werden: Davon träumen vor allem Männer, und setzen diesen Wunsch nicht selten in Wirklichkeit um. Anschließend erzählen sie mit Stolz vom Meistern ungewöhnlicher Situationen. Das „hart sein“ und „wie ein Mann alles durchstehen können“ spielt dabei eine große Rolle (vgl. Rupe, 2000, S. 112/113).
Nach Lotte Rose (1993, S. 93) „besteht ein grundsätzliches Spannungsverhältnis zwischen Abenteuer und Weiblichkeit im traditionellen Sinne. Beides reibt sich“. Während Jungen und Männer insbesondere durch Literatur und Medien zahlreiche Identifikationsobjekte angeboten bekommen, fehlen den Mädchen und Frauen wagemutige Vorbilder. Für sie bedeutet Grenzüberschreitung nicht nur Risikoübernahme im Sinne von lebensgefährlichen Aktivitäten, sondern auch die Überschreitung ihrer weiblichen Rollen- und Sozialisationsnormalität. Durch mangelnde Risikoerfahrungen fehlt es Mädchen und Frauen dann jedoch an der Chance, Selbstheilungskraft und die Elastizität und Zähigkeit des Körpers zu erleben (vgl. Rose, 1993, S. 27, zitiert nach Hagemann-White, 1984). Hieraus ergibt sich ein Teufelskreis: Weil die Frau ihre körperlichen und motorischen Fähigkeiten nicht im Spiel mit dem Risiko ausgetestet und vergrößert hat und weil sie nicht weiß was sie kann, meidet sie Gefahrensituationen. Es entwickelt sich Risikoscheu. Und dies eben auch in solchen Sportarten, in denen der Körper gefährdet ist. Ohne handfest erfahrene Stärke- und Schwächeerlebnisse bleibt das Körperbild jedoch labil und leicht verletzlich (vgl. Rose, 1993, S. 27/28).
Ein weiterer Grund kann sein, dass Frauen meist eine andere Beziehung zu ihrem Körper als Männer haben. So können sie spartanisch-einfache Lebensbedingungen, die bei der Ausübung von vielen Risikosportarten einfach notwendig sind, durchaus abschrecken. Was Rose über die Umstände in Ferien-Camps berichtet, kann auch für die Ausübung mancher Extremsportarten gelten, wie beispielsweise das Höhenbergsteigen oder Wüstendurchquerungen. Körperpflege und Rückzug ist in solchen Situationen nicht möglich. Stattdessen muss man sich in der Öffentlichkeit waschen und umziehen und seine Notdurft draußen verrichten. Man kann sich weder sorgfältig zurechtmachen noch Nacktheit und Menstruation vollkommen verstecken. Für viele Frauen stellen diese Faktoren eine Bedrohung dar, weil sie sich entblößt fühlen (vgl. Rose, 1993, S. 31.).
III. Entwicklung von Extremsport
1. Abenteuer und Risiko im Wandel der Zeit
Schon in der Vor- und Frühgeschichte gehörte riskantes Verhalten in Form von Jagd, Kampf, Erkundung von Neuen und Migration zum Leben. „Man denke an die Jagd und den Kampf Mann gegen Mann bei unseren Jäger-Urahnen, an die Exploration von Umweltgegebenheiten und die Aufbrüche prähistorischer Stämme ins Ungewisse, zu Zeiten der Völkerwanderungen, bei Entdeckungs- und Eroberungszügen [...] bis hin zu den massenhaften Emigrationen von Europäern nach Nordamerika“ (Hartmann, 1996, S.76). Natürliche und soziale Veränderungen zwangen die Menschen regelrecht zu riskantem Verhalten. Dabei kam extremes Risikoverhalten einzelner Stammesmitglieder der ganzen Gemeinschaft zu Gute, wenn bestimmte Individuen bereit waren, sich beispielsweise den Risiken der Erforschung neuer Umgebungen auszusetzen. Denn somit konnten die anderen sowohl aus den Erfolgen als auch aus den Misserfolgen des Vorreiters lernen (vgl. Hartmann, 1996, S. 76 und vgl. Apter, 1994, S. 220-222).
Bis in das 20. Jahrhundert hinein war das Leben von vielerlei Gefahren geprägt, da musste man nicht unbedingt als Entdecker in die „große weite Welt“ hinaus. Natur und wilde Tiere, feindliche Stämme, später dann feudalherrliche Willkür, Räuberbanden, Militär sowie körperliche Dauerbelastung und psychischer Existenzstress waren an der Tagesordnung. Und trotzdem waren die Menschen in früheren Zeiten um sonstige spannende Erlebnisse und Sensationen - als Täter oder Opfer, als Zuschauer oder Akteur - nicht verlegen. Es gab heilige Orgien, Menschenopfer, Gladiatorenkämpfe, Wagenrennen, Ritterturniere, öffentliche Gottesurteile und Hinrichtungen, derbe Jahrmarktsdarbietungen und Hexenverfolgungen (vgl. Hartmann, 1996, S. 76/77). Nach dem Mittelalter trat im Zuge der Aufklärung, des Liberalismus und der Industrialisierung eine zunehmende Beruhigung ein. Das Alltagsleben wurde für die Mehrheit der Menschen immer ungefährlicher aber auch erlebnisärmer und damit langweiliger. Unterbrochen wurde diese Ruhe durch die beiden Weltkriege, die von einem Großteil der Menschen als willkommener Ausbruch aus der Routine begrüßt wurden (vgl. Hartmann, 1996, S. 77).
In der westlichen Welt blicken wir heute auf eine 50-jährige Phase des Friedens zurück. Gefahren, die z.B. von Zigaretten, Autofahren, Atomkraft, Umweltverschmutzung, usw. ausgehen, werden nicht direkt, sondern nur in Ausschnitten wahrgenommen. Die Wohlstandsmenschen von heute kennen keine unmittelbare Not und Bedrohung mehr und interessieren sich gerade deshalb für Freizeitvergnügen, die ihnen Angst machen (vgl. Hartmann, 1996, S. 79).
Abenteuerlust und Risikoverhalten findet man in unterschiedlicher Ausprägung in fast jeder Epoche der Menschheit, was auch in der Literatur zu sehen ist: Von den Gebrüder Grimm das „Märchen von einem der auszog, das Fürchten zu lernen“ über Karl Mays „Winnetou“ bis hin zu den modernen Comic-Helden „Super-“ und „Spiderman“. Das Abenteuer erfasst auch die unterschiedlichsten Disziplinen: Lebensphilosophische Ansätze Simmels, Webers und Nietzsches, zentrale Thesen der Aufklärung von Horkheimer und Adorno sowie die psychoanalytischen Betrachtungen Freuds (Hartmann et al, 1996, S. 7ff). Schon vor 200 Jahren bezeichneten Gutsmuth, Rousseau und Herbart Abenteuer, das Wagen und das Bestehen als Grunderfordernis der Persönlichkeitsentwicklung (Rupe, 2000, S. 29). Und Georg Simmel schrieb Anfang dieses Jahrhunderts, dass wir ohne Todesangst unser Leben „bewusstlos verdämmern“ (vgl. Hartmann, 1996, S. 84).
Nach Michael Apter (1994, S. 222/223) ist die Suche nach Aufregung eine kontinuierlich motivierende Kraft für Veränderungen und Verbesserungen des Lebens. Sie hilft einer Gesellschaft nicht nur zu überleben, sondern auch zu wachsen, Fortschritte zu machen und zu Wohlstand zu gelangen sowie konservative, restriktive und stagnierende Tendenzen zu überwinden. Neuerer und Pioniere, so Apter, gehen immer Risiken ein. Dabei muss die Suche nach Aufregung nicht der einzige Grund für Tatendrang sein – auch die Aussicht auf Ehre, Ansehen, Geld, usw. können eine wesentliche Rolle spielen - aber im Normalfall sind genau diese Motive ebenfalls mit der Suche nach Erregung verknüpft (vgl. Apter, 1994, S. 222).
2. Aufkommen und Verbreitung des Extremsports
Schon seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden in Europa Entdeckungsreisen, Ballonfahrten, Meereserkundungen und wissenschaftliche Explorationen unternommen, um die Natur und naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu erforschen Später erfolgten diese Reisen aus sportivem und nationalem Ehrgeiz, das eine vollkommen neue Perspektive im Gegensatz zum Reisen als Mittel zum Zweck darstellte (vgl. Bette, 2004, S. 103, und vgl. Hartmann, 1996, S. 75ff).
Die extremeren Varianten des Sports, die nicht zwangsläufig etwas mit dem Reisen oder Erkunden von unentdeckten Gebieten zu tun haben mussten, entwickelten sich insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit dem wirtschaftlichen Wohlstandswachstum steigerte sich auch das Interesse am Sport und am Erleben von Abenteuern. Die gesellschaftliche Entwicklung, die veränderten Werthaltungen und Lebenseinstellungen sowie Materialverbesserungen machten im Laufe der Zeit aus dem traditionellen Sport einen neuen Trend. Die Sportarten begannen sich zu differenzieren und multiplizieren, wurden neu erfunden und weiterentwickelt. Hierbei spielt auch die technologische Entwicklung von Sportgeräten, die neu erfunden oder stark verbessert wurden, eine große Rolle. So wurde u.a. aus dem Fahrrad das Mountainbike, aus den Rollschuhen die Inlineskates und aus dem Schlauchboot das Raft. Einige neue Sportarten wurden erst durch Innovationen möglich, wie zum Beispiel die Entwicklung zuverlässiger und haltbarer Materialien wie dem Bungee-Seil (vgl. Rupe, 2000, S. 20/21, zitiert nach Dreyer, 1995).
Seit etwa 1970, rückte das Freizeiterlebnis immer mehr in den Vordergrund. Der Wunsch, Neues auszuprobieren, die Neigung zu stimulierenden Abenteuern, begrenzten Gefahren und kalkuliertem Risiko stieg kontinuierlich an (vgl. Rupe, 2000, S. 31 zitiert nach Kirstges, 1992). Durch den gesellschaftlichen Trend zum „Mehr-Erleben“ in der Freizeit, erweiterten sich auch die Grenzen des Freizeitsports. Der „Trend zum Thrill“ gehört zu einem der stärksten Trends in der heutigen Gesellschaft (vgl. Rupe, 2000, S. 31 zitiert nach Romeiß-Stracke, 1997). Selbst einfache sportliche Tätigkeiten bekommen einen neuen Erlebnischarakter, so wird z.B. das Radfahren zum Mountain- oder Off-Road-Biking. Es lässt sich außerdem eine Polarisierung der Sportarten feststellen. Ein Mittelmaß gibt es kaum mehr, dafür allerlei harte, sanfte, aggressive und ästhetische Sportarten (vgl. Le Breton, S. 11f und S. 112).
3. Kommerzialisierung des Abenteuers: Der Extremsportler als Held
Durch die Präsentation in den Medien wird die Suche nach Aufregung und Abenteuer gefördert und zu einem immer populäreren Thema gemacht. Ob Leitfäden, Handbücher, Zeitschriften, Fernsehreportagen, Werbespots oder Hollywood-Filme: Extremsport taucht überall auf und die Helden des Risikos sind die neuen Vorbilder der Gesellschaft (vgl. Le Breton, S. 11f und S. 112).
Verstärkt wird die Kommerzialisierung des Sportmarktes auch durch die Sportartikel- und Sportbekleidungsindustrie sowie durch Veranstaltungsanbieter und kommerzielle Vermarkter, die das extremsportspezifische Training bzw. die erforderliche Ausbildung zum Abenteuererlebnis zur Verfügung stellen (vgl. Hartmann, 1996, S. 70). Waren es früher noch „ein paar Verrückte“, die sich waghalsig an einem Gummiseil von einem Kran stürzten und in allen Wetterlagen hohe Berge erklommen, so ist dies heute keine Seltenheit mehr und hat vielmehr die breite Bevölkerung erfasst. Beispielsweise ist die Möglichkeit zu Bungee Jumping auf groß aufgezogenen Freiluft-Partys und Musikfestivals, wie z.B. „Rock im Park“, kein außergewöhnliches Ereignis mehr.
Die „echten Extremen“ sind hingegen immer auf der Suche nach neuen, noch nie da gewesenen Herausforderungen. So werden immer anstrengendere, gefährlichere, intensivere Situationen aufgesucht und somit das Abenteuer mehr und mehr gesteigert. Es gibt immer selbst erzielte oder von anderen aufgestellte Rekorde, die überboten werden müssen (Rupe, S. 35, zitiert nach Lutz, 1999). Auch die Veranstalter und Nutznießer von Sportereignissen sind an immer extremeren Leistungen und spektakuläreren Präsentationen interessiert (Hartmann, 1996, S. 70). Als Alternative zu den Olympischen Sportarten werden inzwischen jährlich die „X-Games“[13] in Kalifornien durchgeführt. Die Disziplinen reichen dabei von BMX und Barfuß-Wasserski über Skateboarding, Inlineskating und Sky Surfing bis hin zu X-venture-Race, eines der extremsten Rennen der Welt[14] (Rupe, S. 34, zitiert nach Siering et al, 1997). Die eher an den Wintersportarten ausgerichteten „Mad Masters“, die unter anderem Snowboard Freestyle und Extreme Skiing beinhalten, gibt es seit 1999 in Europa (vgl. Rupe, 2000, S. 34).
Die Figur des Helden übte immer schon eine hohe Faszinationskraft auf die Menschen aus. Dabei ist die Heldentat zwar eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung, um den Status eines Helden zu erlangen. Denn es gehört immer auch ein Publikum dazu, das von den außergewöhnlichen Taten erfährt. Erst eine spezifische Berichterstattung und die Anerkennung des Publikums verleihen dem Aktiven seine Heldenhaftigkeit. Der Extremsport ist ein Handlungsfeld, das die Aufmerksamkeit der Leser und Zuschauer auf besondere Weise bannt. Schon bei der Wahl der Extremsportart umgibt sich die Person – vorab und unabhängig von seiner konkreten individuellen Leistung – mit der Aura des Neuen, Extravaganten, Spektakulären und auch Verwegenem. Denn hier geht es nicht um „Sieg oder Niederlage“, sondern um „Leben oder Tod“. Für die Beobachter fordert der mutige Risikosportler die übermächtige Naturgewalt heraus (vgl. Stern, 2003. S. 37 und S. 40/41).
Im Kampf gegen die Naturgewalten zu unterliegen wäre nicht schändlich, sondern menschlich. Sie zu überstehen, macht den Risikosportler jedoch zur besonderen Person. Beim Extremsport wird der Aktive aus der Masse der Gewöhnlichkeit herausgehoben. Für die Beobachter scheint der Grund für das Bestehen in den individuellen und herausragenden Fähigkeiten des Aktiven zu liegen, der über-menschliche Kräfte und Nerven besitzt (vgl. Stern, 2003, S. 43). Extremsportler avancieren auf diese Art und Weise schnell zu Helden oder werden als solche inszeniert. Abenteuer und Risiko passen nämlich hervorragend in das Ereignisschema der Medien hinein, weil sie spektakuläre Handlungen bieten, die es ansonsten nicht zu sehen gibt. So reißen sich Sportartikel- und Werbewirtschaft um Menschen, die freiwillig Ausnahmesituationen aufsuchen, um damit Selbstverwirklichung anzupreisen und auf „dafür notwendige Produkte“ hinweisen (vgl. Bette, 2004, S. 35/36 und S. 38).
IV. Paradoxien und Ambivalenzen im Extremsport
1. Individualitätserhaltung versus Massenverbreitung des Extremsports
„Sport und Individualisierung besitzen eine hohe Affinität, weil es im und durch den Sport möglich ist, am und über dem Körper ‚feine Unterschiede’ (Bourdieu, 1984) zu demonstrieren“ (Bette, 2001, S. 94). Über Körperformung oder den extremen Einsatz des Körpers kann man sich sozial sichtbar machen und Einzigartigkeit vorführen. Dies stößt aber auf Grenzen, wenn der Versuch, einzigartig zu sein, mittels gesellschaftlicher Handlungsmuster und Reaktionsschablonen abläuft (vgl. Bette, 2001, S. 98).
Die Kultur- und Freizeitindustrie, vor allem der Sport- und Modebereich, arbeitet mit Fiktionen der Individualität. Die Besonderheit des Einzelnen wird gezielt suggeriert: Man soll die neueste Trendsportart ausüben, die modernste Kleidung tragen oder das aktuellste Trainingsgerät erwerben. Für kommerzielle Sportanbieter ist Extremsport somit eine „Ware“, die sich mit dieser Strategie überaus gut bewerben und verkaufen lässt. Da die Industrie allerdings immer am wirtschaftlichen Erfolg interessiert ist, richtet sie sich mit ihren Aussagen an die Masse. Sie ist darauf spezialisiert, Einzigartigkeit mit Standardisierung und Kollektivierung aufzuheben (vgl. Bette, 2001, S. 98).
Das Problem und die Paradoxie aller Individualitätsbestrebungen des Extremsportlers liegt nun darin, dass sich der individuelle Akteur in seinem Begehren, Einzigartigkeit mit außergewöhnlichen Taten darzustellen, schnell in der Gemeinschaft Gleichgesinnter wiederfindet. „Dort aber, wo viele abweichen, um Einzigartigkeit zu beweisen, ist Individualität nur als bewusste Konformität darstellbar – was wiederum dem Anspruch auf Individualität widerspricht.“ (Bette, 1992, S. 128/129). Ein Mensch, der in seiner Körperlichkeit Subjektivität beweisen will und sich deshalb vom Normalverhalten entfernt, kopiert und wird kopiert. Um diese widersprüchliche Situation für sich zu lösen, wird der einzelne distinktionsorientierte Akteur in eine Spirale der Abweichung hineingetrieben. Er versucht also, „der Paradoxie der Individualität durch Leistung, Risikosampling, Extremisierung, exaltierte Selbstdarstellung und Skurrilität zu entgehen“ (Bette, 2004, S. 132). Durch die Steigerung des Risikos wollen viele Extremsportler ihre Wiedererkennbarkeit sicherstellen und sich davor bewahren, durch ein Kopiertwerden ins Banale, Allgemeine und Durchschnittliche abzurutschen. Es hilft nur die Risikospirale weiter anzudrehen, um das Extreme durch das noch Extremere zu übertrumpfen. So kann sich der Aktive wieder kurzzeitig das Gefühl verschaffen, ein einzigartiges Individuum zu sein. Denn je mehr antreten, um Abenteurer und Extremsportler zu sein, desto schwieriger ist es, dauerhaft einer zu bleiben. Den „echten Grenzgängern“ fällt es unter diesen Bedingungen schwer, die Originale zu bleiben, die sie zu sein behaupten. Strategien der Selbstermächtigung und Individualisierung stoßen auch im Extremsport auf Grenzen, wenn Außeralltäglichkeit zum Alltag gehört, in Serienproduktion geht und einen ganzen Wirtschaftszweig beschäftigt (vgl. Bette, 2004, S. 132ff).
[...]
[1] Nach einigen Vorläufern, wie z.B. die in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts entstandenen Arbeiten von Norbert Elias, nahm die Soziologie des Körpers um 1970 ihren eigentlichen Anfang.
[2] mit einem Seil gesichert an Fassaden und Wänden herab laufen
[3] Sturz von nicht allzu hohen Objekten mit rasch zu öffnenden Fallschirm
[4] Sprung in die Tiefe mit Board und Fallschirm
[5] Gleitsegelfliegen/Gleitschirmfliegen
[6] Tauchen ohne Sauerstoffgerät
[7] im Sinne des Extrem-Risikosports von Kuhn und Todt, 2003
[8] Berg in möglichst kurzer Zeit herab fahren, über steile Hänge, Geröllfelder, enge Kurven, etc.
[9] Bergabwärts rollen in einem durchsichtigen Ultra Ball
[10] Begehen einer Schlucht von oben nach unten in den unterschiedlichsten Varianten des Tauchens, Springens, Rutschens, Kletterns, etc.
[11] in: Sports Injuries, 1986
[12] es wurde von 25 Jahren ausgegangen
[13] gilt als „Olympia Extrem“
[14] das Rennen umfasst 225 Meilen in fünf Tagen durch fünf verschiedene Klimazonen von Wüste bis Eis, Bergsteigen und klettern über 2000 Meter hohe Berge, laufend, auf dem Mountainbike und im Kajak
- Arbeit zitieren
- Silvia Obster (Autor:in), 2005, Extremsport aus Sicht der Soziologie des Körpers, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118634
Kostenlos Autor werden





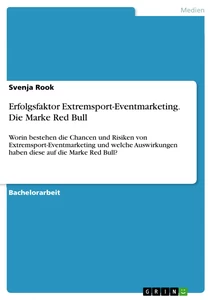





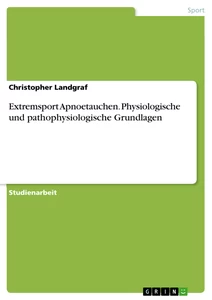





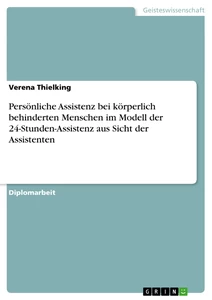

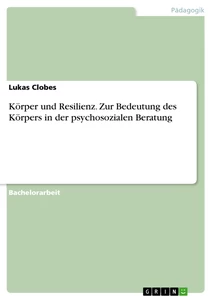
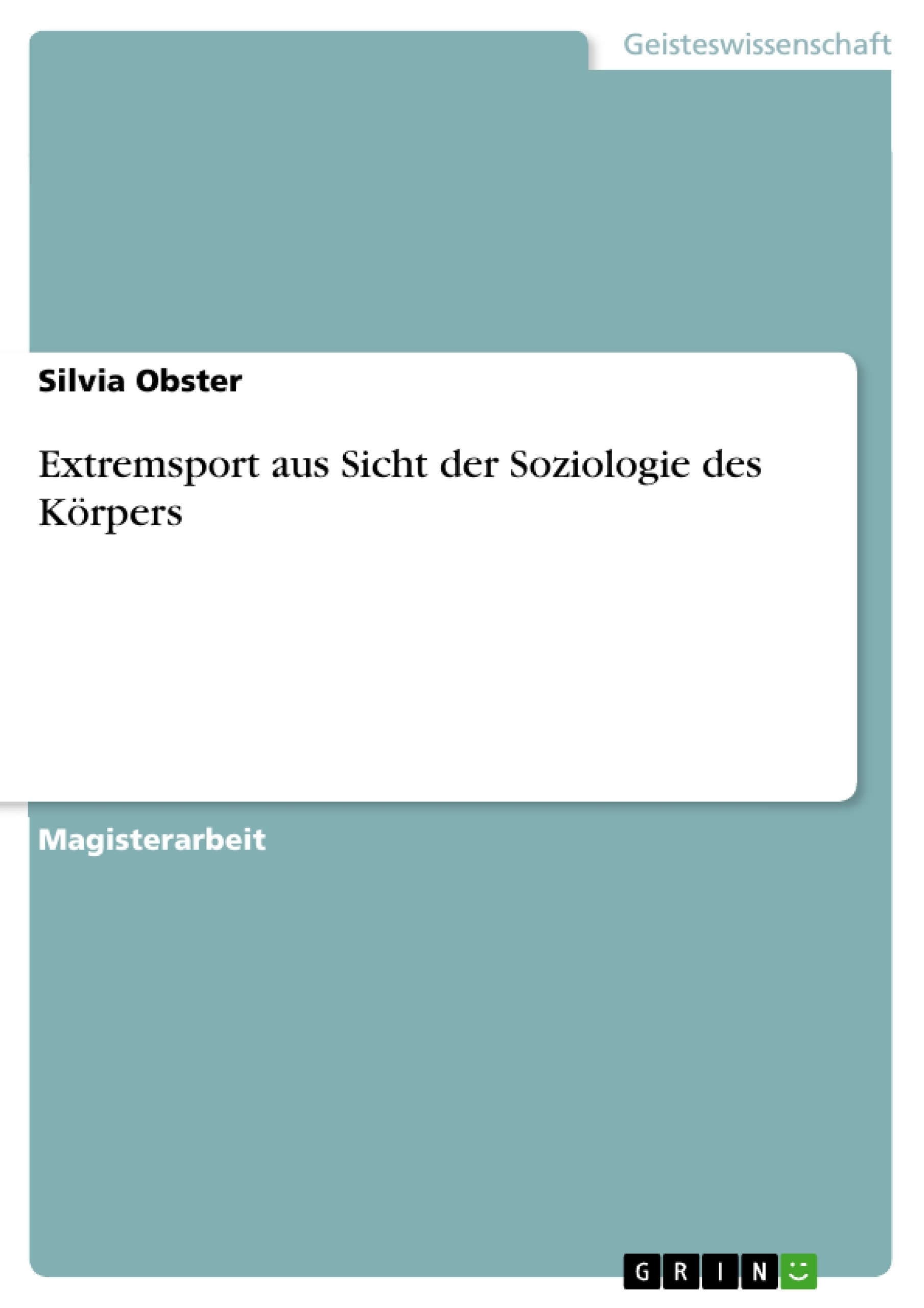

Kommentare