Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit
1.2 Aufbau der Arbeit
1.3 Methodik
2. Überblick über das Streitkräfteamt
2.1 Das Streitkräfteamt
2.1.1 Eingliederung in die Bundeswehr
2.1.2 Die Struktur des Streitkräfteamtes
2.1.3 Aufgaben des Streitkräfteamtes
3. Wissen, Wissenstransfer und Wissensmanagement
3.1 Der Wissensbegriff
3.2 Abgrenzung von Zeichen, Daten, Information und Wissen
3.2.1 Zeichen
3.2.2 Daten
3.2.3 Information
3.2.4 Wissen
3.3 Wissensarten
3.3.1 Individuelles und kollektives Wissen
3.3.1.1 Individuelles Wissen
3.3.1.2 Kollektives Wissen
3.3.2 Explizites und implizites Wissen
3.3.2.1 Explizites Wissen
3.3.2.2 Implizites Wissen
3.3.3 Transferierbares und nicht transferierbares Wissen
3.3.3.1 Transferierbares Wissen
3.3.3.2 Nicht transferierbares Wissen
3.4 Wissenstransfer
3.4.1 Begriffsbestimmung
3.4.2 Transferarten
3.4.3 Strategien und Prinzipien des Wissenstransfers
3.4.3.1 Kodifizierungsstrategie
3.4.3.2 Personalisierungsstrategie
3.4.3.3 Das Push- und Pull-Prinzip
3.4.3.4 Instrumente und Methoden des Wissenstransfers
3.4.3.4.1 Instrumente
3.4.3.4.2 Methoden
3.4.4 Prozessmodelle des Wissenstransfers
3.4.4.1 Wissenstransfer als Lernprozess
3.4.4.2 Wissenstransfer als Logistikprozess
3.4.5 Einflussfaktoren auf den Wissenstransfer
3.4.5.1 Barrieren beim Wissenstransfer
3.4.5.1.1 Individuelle Barrieren
3.4.5.1.2 Organisationsbedingte Barrieren
3.5 Wissensmanagement
3.5.1 Definition Wissensmanagement
3.5.2 Wissensmanagementkonzept nach Probst / Raub und Romhardt
3.6 Schlussbetrachtung der theoretischen Grundlagen
4. Analyse der Dienstpostenübergabe im Streitkräfteamt
4.1 Allgemeiner Ablauf einer Dienstpostenübergabe
4.1.1 Ablauf der beobachteten Dienstpostenübergaben
4.2 Einflussfaktoren auf die Dienstpostenübergabe
4.2.1 Äußere Einflussfaktoren
4.2.1.1 Organisation und Struktur der Bundeswehr
4.2.1.2 Das Personalamt der Bundeswehr
4.2.1.3 Weitere äußere Einflussfaktoren
4.2.2 Innere Einflussfaktoren
4.2.2.1 Eigenschaften
4.2.2.2 Unwissenheit über den Wissensbedarf
4.2.2.3 Die Einstellung der Transferpartner
4.2.2.4 Kommunikationsfähigkeit
4.2.2.5 Motivation der Transferpartner
4.2.2.6 Vorbereitung auf Dienstpostenübergabe
4.3 Vermitteltes Wissen während der Dienstpostenübergabe
4.3.1 Generelle Betrachtung
4.3.2 Explizites Wissen
4.3.3 Implizites Wissen
4.3.4 Individuelles und kollektives Wissen
4.3.5 Fazit aus der Analyse
5. Entwicklung des Referenzprozess der Dienstpostenübergabe
5.1 Mögliche Optimierungsansätze für den Wissenstransfer
5.2 Referenzprozess der wissenstransferorientierten Dienstpostenübergabe
5.2.1 Der erforderliche Rahmen
5.2.1.1 Die gezielte Personalplanung
5.2.1.2 Kontext beim Übernehmenden
5.2.1.3 Infrastruktur der Dienstpostenübergabe
5.2.2 Der Wissensmittler
5.2.3 Der Übergabeprozess
5.2.3.1 Vorbereitung der Dienstpostenübergabe
5.2.3.2 Das Kennenlernen
5.2.3.3 Einweisung in Projekte und Aufgaben
5.2.3.4 Einweisung in Arbeitsabläufe
5.2.3.5 Einweisung in Schnittstellen
5.2.3.6 Teilen von Erfahrungen
5.2.3.7 Gemeinsames Einarbeiten
5.3 Unterstützendes Tool für den Wissenstransfer
5.4 Fazit aus dem Referenzprozess
6. Schlussbetrachtung und Ausblick
6.1 Was konnte die Arbeit leisten?
6.2 Geltungsbereich der Ergebnisse
6.3 Ausblick
Anhang
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Eingliederung des SKA in die Bundeswehr
Abbildung 2: Gliederung des Streitkräfteamtes
Abbildung 3: Zusammenhang von Zeichen bis Wissen
Abbildung 4: Schematische Darstellung des quantitativen und qualitativen Zusammenhangs von Zeichen bis Wissen nach M. Krämer
Abbildung 5: Transferstrategien und Transfermethoden nach Thiel
Abbildung 6: Phasenmodell des Wissenstransfers in Anlehnung an Krogh / Köhne
Abbildung 7: Anytime / Anyplace – Ansatz
Abbildung 8: Bausteine des Wissensmanagement
Abbildung 9: Schematischer Ablauf eines Dienstpostenwechsels
Abbildung 10: Referenzprozess der Dienstpostenübergabe
1. Einleitung
Wissen ist eine Ressource. Wissen hat eine unumstrittene Bedeutung für unsere moderne Gesellschaft.[1] Auch im Berufsalltag ist Wissen als Produktionsfaktor nicht mehr wegzudenken. Darum beschäftigt sich auch die Wissenschaft seit geraumer Zeit mit der Thematik des Wissens. In diesem Zusammenhang ist die Idee des Wissensmanagements entstanden[2]. Ein Aspekt davon ist der Wissenstransfer, in dessen Mittelpunkt der Mensch steht.[3] Gerade im Zeitalter der Informations- und Kommunikationstechnologie, in der problemlos Informationen verteilt werden können, gewinnt das implizite Wissen der Wissensträger immer mehr an Bedeutung.[4] Deren Erfahrungen, Können und Einstellungen lassen sich nicht einfach mittels Datennetzwerk transferieren. Hierfür ist die persönliche Kommunikation zwischen Transferpartnern unerlässlich. Daraus entsteht die Notwendigkeit, die Kommunikationsprozesse, vor allem in Unternehmen und Organisationen, zu analysieren und verantwortungsvoll zu gestalten. Nur dadurch ist es möglich den Transfer von expliziten und impliziten Wissen effizient und optimal zu gestalten.
1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit
Vor allem in der Offizierslaufbahn der Bundeswehr kommt es zu starken Personalfluktuationen. Der Grund dafür liegt in den Stehzeiten der Offiziere, die im Durchschnitt nur ca. zwei Jahre beträgt. Das bedingt häufige Dienstpostenwechsel, bei denen viel Wissen vom Übergebenden an den Übernehmenden transferiert werden muss. Nicht immer werden diese Dienstpostenübergaben optimal durchgeführt bzw. kommt es überhaupt zu einer Überschneidung des alten und neuen Dienstposteninhabers. Hier kann gerade im Bereich der Ämter und höheren Kommandobehörden der Bundeswehr erhebliches Wissen verloren gehen.
Die Vielzahl der unterschiedlichsten und meist sehr speziellen Aufgaben der einzelnen Dienstposteninhaber fordert einen bestmöglichen Wissenstransfer bei einer Dienstpostenübergabe. Nur so kann auch die anspruchsvolle und wissensintensive Arbeit der Ämter nahtlos weitergeführt werden. Um diesen Wissensverlust zu minimieren oder sogar zu verhindern, steht der Wissenstransfer bei einer Dienstpostenübergabe im Mittelpunkt dieser Betrachtung.
Ziel der Arbeit ist es, einen Referenzprozess zu entwickeln, bei dem der Wissenstransfer während einer Dienstpostenübergabe möglichst optimal gestaltet und der Wissensverlust möglichst gering gehalten wird. Dabei soll sowohl der Fall einer persönlichen Übergabe, als auch der Fall einer Übergabe ohne Überschneidung des alten und des neuen Dienstposteninhabers berücksichtigt werden.
Um dieses Thema umfassend zu beleuchten wurden aus dem Ziel der Arbeit drei Forschungsfragen abgeleitet, die als Unterstützung bei der Bearbeitung der Problemstellung beantwortet werden sollen. Diese stellen sich im Einzelnen wie folgt dar,
1. Was ist eigentlich Wissenstransfer und welche Aspekte sind für die Dienstpostenübergabe bei der Bundeswehr von Interesse?
2. Wodurch kommt es zu Wissensverlusten bei einer Dienstpostenübergabe?
3. Wie kann der Wissenstransfer bei einer Dienstpostenübergabe auf Ämterebene optimiert
werden?
Daneben soll diese Arbeit auch Rückschlüsse auf mögliche Grenzen des Referenzprozesses erlauben und Anhaltspunkte für weitere Forschungen liefern.
1.2 Aufbau der Arbeit und Vorgehensweise
Die vorliegende Arbeit gliedert sich, neben der Einleitung, einem Portrait des Streitkräfteamts und der Schlussbetrachtung, in drei Hauptteile. Im ersten Hauptteil werden die theoretischen Grundlagen gelegt. Dazu wird, ausgehend vom Wissendbegriff, die Entstehung von Wissen geschildert. Darauf aufbauend wird der Wissenstransfer betrachtet und in den Kontext von Wissensmanagement eingeordnet. Hierbei ergibt sich ein Überblick über den aktuellen Stand der Forschung, wobei die Betrachtung nur, auf für das Thema, relevante Aspekte gelegt wird.
Nach den nötigen Grundlagen soll in Kapitel vier zunächst die Dienstpostenübergabe im Streitkräfteamt auf Grundlage der geführten Interviews analysiert werden. Dabei ist es das Ziel die Problemfelder des Wissenstransfers aus dem vorangegangenen Kapitel auf die Situation im Streitkräfteamt zu übertragen und mögliche Verbesserungsansätze herauszustellen.
Anschließend an die Analyse wird aus den Erkenntnissen und den theoretischen Grundlagen ein Referenzprozess für die wissenstransferorientierte Dienstpostenübergabe erstellt. Hierbei soll auch die Problematik einer Dienstpostenübergabe ohne Überscheidung der Übergebenden berücksichtigt werden.
In Kapitel sechs werden alle Erkenntnisse zusammengefasst und der Zweck der Arbeit kritisch hinterfragt. Anschließend wird noch ein Ausblick für die weitere Forschung gegeben.
1.3 Methodik
Der Wissenstransfer während einer Dienstpostenübergabe bei der Bundeswehr lässt sich nicht ohne entsprechende Praxispartner analysieren und anschließend optimieren. Deshalb wurde als exemplarisches Beispiel das Streitkräfteamt der Bundeswehr ausgewählt. Dieses Amt soll stellvertretend für die Ämter und die höheren Kommandobehörden der Bundeswehr stehen.
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurden Interviews geführt, um die Situation bei Dienstpostenübergabe im Bereich des Streitkräfteamtes aufzunehmen. Diese Interviews basierten auf standardisierten Fragebögen, die zum einen an die Übergebenden und zum anderen an die Übernehmenden gerichtet waren. Die Fragen wurden im Vorfeld der eigentlichen Analyse, auf Grund von eigenen Überlegungen, erstellt. Sie beziehen sich auf die Phasen vor, während und nach der Dienstpostenübergabe und sollen die persönlichen Eindrücke der am Übergabeprozess beteiligten Offiziere aufnehmen sowie wiedergeben. Diese Interviews bilden neben den theoretischen Betrachtungen die Grundlage für die Problemanalyse und die Lösungsfindung. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die geführten Interviews, wegen der geringen Anzahl, nicht statistisch verwertbar sind und somit keinen allgemeinen Schluss auf den Ablauf von Dienstpostenübergaben in der Bundeswehr zulassen. Diese Interviews zeigen lediglich einen kleinen Ausschnitt bzw. eine Momentaufnahme einer Dienststelle des Streitkräfteamts.
Weiterhin ist anzumerken, dass sich diese Ausarbeitung auf Dienstposten für Hauptleute und Stabsoffiziere bezieht. Die Generalsebene und vergleichbare Dienstposten wurden hier nicht berücksichtigt, da in diesen Fällen die Dienstpostenübergabe von einem Stab geplant und vorbereitet wird. Somit haben, in dieser Arbeit, getroffene Erkenntnisse kaum Relevanz.
Die zentrale Fragestellung dieser Ausarbeitung zielt auf den Wissenstransfer bei der Dienstpostenübergabe ab, dazu wird bei den Transferpartnern in Bezug auf Sprache, Bildungsstand und Wertevorstellung ein relativ einheitlicher Hintergrund vorausgesetzt. Nur so ist es überhaupt möglich den Wissenstransfer im Übergabeprozess näher zu untersuchen.
2. Überblick über das Streitkräfteamt
Um Dienstpostenübergaben zu analysieren und in Bezug auf den Wissenstransfer zu optimieren wurde das Streitkräfteamt der Bundeswehr als exemplarisches Beispiel gewählt. Im Vergleich zur „grünen Truppe“[5] bietet sich im Streitkräfteamt ein völlig anderes Bild der Struktur, der Aufgaben und täglichen Arbeitsabläufe. Das Streitkräfteamt soll exemplarisch die Arbeit der höheren Kommandobehörden der Bundeswehr darstellen, denn hier lassen sich die verschiedensten Aspekte von Wissen, von Wissenstransfer und die Probleme beim Wissenstransfer beobachten.
2.1 Das Streitkräfteamt
Das Streitkräfteamt wurde 1959 in Dienst gestellt und gehört zu den ältesten Dienststellen der Bundeswehr. Anfangs trug es noch den Namen Bundeswehramt, dieser wurde mit dessen 20. Jahrestag abgelegt und durch die Bezeichnung Streitkräfteamt ersetzt. Von Beginn an lag der Arbeitsschwerpunkt des Streitkräfteamtes bei der bundeswehr- und streitkräfteweiten Aufgabenwahrnehmung (siehe Kapitel 2.1.3). Mit dem Transformationsprozess der Bundeswehr[6] seit dem Jahr 2001 und der Einrichtung der Streitkräftebasis als neuen Organisationsbereich begann ein weiterer Abschnitt des Streitkräfteamtes. Zusätzlich nimmt es seitdem die Rolle des Fachamtes für die Streitkräftebasis wahr, um sie als zentralen Unterstützungsbereich der Streitkräfte inhaltlich und organisatorisch auszugestalten und die streitkräftegemeinsame Ausbildung sowie die Weiterentwicklung der Streitkräftebasis voranzutreiben.[7]
2.1.1 Eingliederung in die Bundeswehr
Die Bundeswehr gliedert sich in verschiedene Organisationbereiche, die alle dem Bundesministerium für Verteidigung unterstehen. Das Streitkräfteamt ist Teil der Streitkräftebasis. Sie gehört neben Heer, Luftwaffe, Marine, Sanitätsdienst, Verwaltung, Recht und Rüstung zu den Organisationsbereichen der Streitkräfte. In der Streitkräftebasis ist es neben dem Einsatzführungskommando, dem Personalamt der Bundeswehr, dem Streitkräfteunterstützungskommando und anderen Einrichtungen direkt dem Stellvertreter des Generalinspekteurs und dem Führungsstab der Streitkräfte unterstellt und gehört somit zu den höheren Kommandobehörden und zur Führungsorganisation der Streitkräftebasis[8] (siehe dazu Abbildung 1). In den nächsten Abschnitten werden die damit verbunden Aufgaben und Verantwortungen dargestellt und kurz erläutert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenAbb1. Eingliederung des SKA in die Bundeswehr (eigene Darstellung)
2.1.2 Die Struktur des Streitkräfteamtes
Das Streitkräfteamt führt ca. 12.000 zivile und militärische Mitarbeiter in über 160 nachgeordneten Dienststellen im In- und Ausland. Es untersteht mit seinen gesamten nachgeordneten Bereichen dem Amtschef des Streitkräfteamtes (vom Dienstgrad Generalmajor/Konteradmiral). Um eine truppendienstliche Führung sicherzustellen, ist zunächst ein Stab in klassischer Gliederung nötig. Daneben gibt es funktionale Kernbereiche die zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben nötig sind. Dazu gehören derzeit sieben Fachabteilungen, selbstständige Dezernate und Fachgruppen, sowie Schulen, Ämter, internationale Vertretungen und der Militärmusikdienst.[9] (siehe dazu Abbildung 2)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenAbb. 2 Gliederung des Streitkräfteamtes[10]
2.1.3 Aufgaben des Streitkräfteamtes
Der zentrale Auftrag des Streitkräfteamtes besteht in der Aus- und Weiterbildung der Streitkräftebasis, der Wahrnehmung von Fachaufgaben für die Streitkräfte sowie der truppendienstlichen Führung von Schulen und Akademien. Im Kernbereich werden Aufgaben wie Personalführung, Controlling, Einsatzplanung, Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit wahrgenommen. Die verschiedenen Fachabteilungen stellen beispielsweise zentrale Truppeninformation, Weiterentwicklung der Streitkräftebasis, Kostenrechnung, oder die Bereitstellung von Infrastruktur sicher. Dazu kommen Aufgaben der Forschung und internationalen Kooperation, die ebenfalls durch Teile des Streitkräfteamtes erfüllt werden.[11]
3. Wissen, Wissenstransfer und Wissensmanagement
„Wozu sollen wir wissen, was Wissen ist? Wie können wir wissen was Wissen ist? Was wissen wir vom Wissen?“[12]
Im folgenden Abschnitt sollen zu Beginn theoretische Grundlagen im Bereich Wissen gelegt werden, um anschließend den Wissenstransfer, als zentralen Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, genauer zu beleuchten und in den Kontext von Wissensmanagement einzuordnen.
3.1 Der Wissensbegriff
Die Diskussion des Wissensbegriffs reicht mindestens bis in die Zeit der antiken Philosophen zurück. Seit dem wird der Versuch unternommen, ihn zu definieren.[13] Er existiert in fast allen Kulturkreisen und den verschiedensten Bereichen. So haben die Wissenschaft, die Philosophie oder die Ökonomie teilweise völlig eigene Vorstellungen vom Wissensbegriff entwickelt.[14] Demzufolge gibt es auch eine Vielzahl von Definitionen, die zum Teil weit voneinander abweichen und zum anderen Teil von der Wortwahl bis zur Aussage nahezu identisch sind. So bezeichnen K. SVEIBY und H. WILLKE Wissen als eine Information mit der im Gedächtnis gespeicherten Erfahrung, während NONAKA und TAKEUCHI folgende Definition liefern: „Wissen ist ein dynamischer menschlicher Prozess der Erklärung persönlicher Vorstellungen über die „Wahrheit“.[15] DAVENPORT und PRUSAK lassen in ihre Vorstellung von Wissen noch weitere Aspekte einfließen und definieren es als „…eine fließende Mischung aus strukturierten Erfahrungen, Wertvorstellungen, Kontextinformationen und Fachkenntnissen, die in ihrer Gesamtheit einen Strukturrahmen zur Beurteilung und Eingliederung neuer Erfahrungen und Informationen bietet. Entstehung und Anwendung von Wissen vollzieht sich in Köpfen der Wissensträger. In Organisationen ist Wissen häufig nicht nur in Dokumenten oder Speichern.“[16]. Wenn man KONFUZIUS hinzuzieht, für den Wissen ist, zu wissen was man nicht weiß und zu wissen was man weiß[17] oder beispielsweise P. SCHÜTT der Wissen als Fähigkeit definiert, aus nutzlosen Daten, Informationen zu machen,[18] dann wird schnell deutlich, dass es wohl kaum eine einheitliche Definition von Wissen gibt. Wie Wissen definiert wird, hängt stark davon ab, in welchem Fachgebiet der Wissenschaft bzw. in welchem Zusammenhang die Definition benötigt wird.[19] Scheinbar genauso schwierig, wie eine einheitliche Definition von Wissen, fällt oft auch die Abgrenzung dessen zu Begriffen wie Know-How, Kompetenz oder Fähigkeit. Hier definieren sich die Begriffe meist gegenseitig oder werden synonym verwendet.[20]
Für den weiteren Verlauf der Arbeit soll die Interpretation des Wissensbegriffes von DAVENPORT und PRUSAK als Grundlage dienen, da sie die verschiedenen Bereiche des Wissens einbezieht. Zudem bindet sie Wissen an Dokumente und Personen, was eine wichtige Rolle beim Wissenstransfer im Rahmen der Dienstpostenübergabe beim SKA einnimmt.
3.2 Abgrenzung von Zeichen, Daten, Information und Wissen
Zwar gibt es in der Literatur und der Wissenschaft meist nur verschwimmende Grenzen zwischen den Begriffen Know-How, Kompetenz, Fähigkeit und Wissen, dafür sind sich aber nahezu alle Autoren über die Abgrenzung der Begrifflichkeiten Zeichen, Daten, Information und Wissen einig. Auch wenn diese im alltäglichen Sprachgebrauch oft gleichgesetzt werden, gibt die Wissenschaft hier klare Grenzen und Zusammenhänge vor.
3.2.1 Zeichen
Laut DIN 44300 handelt es sich bei einem Zeichen „… um ein Element (als Typ) aus einer zur Darstellung von Information vereinbarten endlichen Menge von verschiedenen Elementen oder jedes seiner Abbilder (als Exemplar). Die Menge wird Zeichenvorrat genannt…“[21]. Sie sind somit die kleinstmögliche Einheit um Daten und Informationen zu bilden. In der Philosophie und den Sprachwissenschaften wird Zeichen selbst jedoch mehr Komplexität zugeordnet. Der Mathematiker und Philosoph C.S. PEIRCE setzt drei Faktoren voraus. Ein Zeichen muss aus einem Zeichen selbst, dem was es bezeichnet und einem der es bezeichnet bestehen. Daher hat es immer einen physischen Charakter und ist von sich selbst (z.B. Zahlen, ein Tier, eine Erscheinung etc.) über die Bezeichnung (z.B. Preis, Nahrungsmittel, Geist, etc.) bis zur Wahrnehmung (z.B. sehen oder lesen) an eine subjektive Person gebunden.[22]
3.2.2 Daten
Laut DIN 44300 sind Daten „… Gebilde aus Zeichen oder kontinuierlichen Funktionen, die aufgrund von Bekannten oder unterstellten Abmachungen und vorrangig zum Zwecke der Verarbeitung Information darstellen…“.[23] Daraus lässt sich ableiten, dass Daten eine Folge von Zeichen sind. Beispielweise ergeben mehrere Buchstaben ein Wort oder viele Striche ein Bild. Sie allein geben allerdings noch keinen exakten Hinweis auf den Sinn und Zweck ihrer selbst und lassen ihre Bedeutung offen.[24]
3.2.3 Information
Daten bleiben Daten, bis sie auf ein System (z.B. Mensch oder Maschine) Einfluss ausüben und von ihm in einen systematischen Kontext gebracht werden. Üben sie keinen Einfluss aus, werden sie auch nicht zu Informationen verarbeitet. Nur durch Daten, die in einen Kontext bzw. eine Problemlösung einbezogen werden, entstehen Informationen. Die gleichen Daten können aber von verschiedenen Systemen unterschiedlich aufgefasst und interpretiert werden und somit einen völlig anderen Einfluss auf das System haben, woraus sich auch unterschiedliche Informationen ergeben.[25] Informationen haben demnach „… in erster Linie einen subjektiven Charakter…“.[26] Sie werden von den jeweiligen Systemen individuell verarbeitet und verwertet und können darum auch nicht als identische Information an ein anderes System übertragen werden. Der Empfänger der Information hat eine andere innere Struktur und wird diese anders in einen Kontext einordnen, wodurch eine neue Information entsteht.[27] So wird beispielsweise der Preis für ein Auto von einer Person als günstig und von einer anderen Person als teuer bewertet, obwohl es derselbe Preis für dasselbe Auto ist. Folgt man diesem Ansatz, lassen sich nur Daten vermitteln, die dann vom jeweiligen System zu neuen Informationen verarbeitet werden.[28] Hieraus ergibt sich unter Umständen schon ein zentrales Problem für den Transfer von Wissen und Informationen, auch in Bezug auf die Dienstpostenübergabe im Streitkräfteamt. Denn was eine Person vermittelt, ist nicht immer das, was bei einer anderen ankommt.
3.2.4 Wissen
Aus Zeichen werden in einer Reihenfolge Daten. Werden diese Daten in einen Zusammenhang gebracht, entstehen daraus Informationen und die Literatur ist sich darüber einig, dass Wissen entsteht, wenn Informationen aufgenommen, verarbeitet und mit Erfahrungen in Zusammenhang gebracht werden.[29] Weiterhin ist für Wissen die Zweckorientierung ein entscheidender Faktor.[30] Dies wird deutlich, wenn man es am Beispiel eines Unternehmens betrachtet, dass das Ziel hat, Gewinne zu erwirtschaften. Der Beitrag, den ein Mitarbeiter mit seinem Wissen dazu leisten kann, wird daran gemessen, welchen Anteil er an der Zielerreichung hat. Leistet das Wissen keinen Beitrag, bleibt es für das Unternehmen nur eine Information und wird nicht Teil dessen Wissensbasis.[31]
Mit Abbildung 3 soll noch einmal der Zusammenhang von Zeichen, Daten, Information und Wissen gezeigt werden. Weiterhin macht sie deutlich, dass für die Auswahl von Zeichen, Daten und Information wiederum vorhandenes und gesichertes Wissen, als Grundlage zur weiteren Wissensentstehung notwendig ist.[32] Jedoch wird bei diesem Zusammenhang und der Abgrenzung nicht deutlich, welche Information im Detail welches Wissen generiert.[33] Zudem lässt dieses Modell offen, wie man Emotionen, Fertigkeiten und Normen, die von vielen Wissenschaftlern auch zum Wissen gezählt werden, eingeordnet werden können. Aus der Kritik lässt sich der Schluss ziehen, dass es nicht alle Aspekte bei der Entstehung von Wissen klärt. Dennoch ist es gut geeignet, eine formale Abgrenzung der Begrifflichkeiten vorzunehmen und kann eine Antwort auf die Frage geben, was mit dem Wissen geschieht, wenn sein eigentlicher Zweck erfüllt oder der Kontext nicht mehr von Bedeutung ist.[34] Denn demnach wird dieses Wissen genutzt um aus Zeichen, Daten und Informationen neues Wissen zu generieren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Zusammenhang von Zeichen bis Wissen, (eigene Darstellung)[35]
M. KRÄMER gibt dazu eine weitere Sichtweise auf die Begriffe Zeichen, Daten, Information und Wissen. Er lehnt die Begriffspyramide von REHÄUSER und KRCMAR nicht ab, sondern setzt sie mit Quantität und Qualität in Verbindung. In Abbildung 4 wird deutlich, dass zwischen den beiden Betrachtungen ein umgekehrter Zusammenhang besteht. Während die Quantität im Verlauf der Hierarchie abnimmt, nimmt die Qualität zu. Die quantitative Abnahme ist mit der Zusammenfassung von Zeichen zu Daten, der Kontextualisierung bei Information und der Einbindung zu Wissen begründet. Aus einer großen Vielzahl an Zeichen wird im Verlauf ein kleiner Teil vom Wissen. Der qualitativen Zunahme liegt die Theorie zu Grunde, dass der Beitrag zur Problemlösung einer Aufgabe mit jedem Schritt größer wird. Also haben Zeichen allein den kleinsten und Wissen den größten Anteil.[36] Im Beispiel stehen die Zeichen 6, 8,3, 0 für sich. Werden sie in Beziehung zueinander gesetzt, entsteht daraus eine Nummer. Damit aus ihnen eine Information wird, müssen sie in einen Kontext gebracht werden. Hier die Nummer des Vorgesetzten. Um Wissen entstehen zu lassen, muss sie mit der persönlichen Erfahrung und Zielsetzung kombiniert und mit einer Handlung beobachtbar gemacht werden. Die Information „Interne Nummer des Vorgesetzten“ bedeutet für einen Soldaten die Wortwahl der formalen Meldung an seinen Chef (Erfahrung), die Aussicht seinen täglichen Dienst vorschriftsgemäß zu erfüllen (Ziel) und die Tätigkeit des Anrufens selbst (Handlung).[37]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenAbb. 4: Schematische Darstellung des quantitativen und qualitativen Zusammenhangs von Zeichen bis Wissen nach M. Krämer[38]
3.3 Wissensarten
Wie bei den Definitionen des Wissensbegriffs gibt es auch bei der Einteilung des Wissens in Wissensarten verschiedene Ansätze (Anhang 1 gibt eine Übersicht) Die Einteilung erfolgt entweder nach Wissensträgern, nach den Möglichkeiten der Verteilung, der Daseinsform oder der Herkunft. Die einzelnen unterscheidbaren Wissensarten lassen sich in ihren Ausprägungen auch kombinieren bzw. in einen Zusammenhang bringen.[39] (siehe Anhang 2) Im folgenden Abschnitt sollen einzelne Wissensarten herausgegriffen und in Bezug auf das weitere Vorgehen erläutert werden.
3.3.1 Individuelles und kollektives Wissen
Diese Einteilung ist möglich, wenn entweder Individuen oder Organisationen bzw. Gruppen betrachtet werden. Wobei für den weiteren Verlauf der Arbeit unter Organisation ein dauerhaftes, arbeitsteiliges System verstanden wird, in dem Menschen und Maschinen zur Erfüllung von Aufgaben und zur Zielerreichung miteinander verbunden sind.[40]
3.3.1.1 Individuelles Wissen
Jedes Individuum hat eine eigene Wissensbasis in der das Wissen über seine Umwelt gespeichert ist und die Gesamtheit dieses Wissens wird als individuelles Wissen bezeichnet.[41] Da es eng mit anderen Bereichen der menschlichen Psyche (z.B. Motivation oder Bedürfnisse) verbunden ist,[42] ergibt sich, dass es, genau wie der Erwerb neuen Wissens, immer an eine Person gebunden ist.[43] Individuelles Wissen kann mit anderen Individuen geteilt werden, um es so zu kollektiven Wissen zu machen. Das ist vor allem in Organisationen mit weit verzweigten, internen Netzwerken und in Arbeitsgruppen von großer Bedeutung. Denn auf Grund von Synergieeffekten ist die Summe allen individuellen Wissens kleiner als die Gesamtheit des kollektiven Wissens.[44]
3.3.1.2 Kollektives Wissen
Kollektives Wissen entsteht wenn eine Mehrzahl von Individuen den gleichen Wissensinhalt kooperierend gestaltet und bei ihrer Arbeit nutzt.[45] Hierbei wird aus der Vielzahl an individuellem Wissen eine Art Wissenspool, aus dem alle gemeinsam schöpfen können. Um aus individuellem Wissen kollektives Wissen zu machen, sind drei Voraussetzungen notwendig.
1. Das Wissen muss kommunizierbar, also transferierbar sein.
2. Das Wissen muss konsensfähig sein und somit bei anderen Individuen Akzeptanz finden und als nützlich betrachten werden.
3. Das kollektive Wissen muss das individuelle Wissen integrieren.[46]
Kollektives Wissen kann auch zur Grundlage für eine Unternehmenskultur werden, denn durch geteiltes Wissen und gemeinsame Erfahrungen entwickeln sich in vernetzten Strukturen gemeinsame Überzeugungen und Werte.[47] Wird dieser Gedanke weiter vertieft, so erlangt das kollektive Wissen gar die Bedeutung das Betriebsklima zu fördern, wobei in der Folge der unternehmensinterne Wissenstransfer gewinnbringend unterstützt wird.
3.3.2 Explizites und implizites Wissen
Die Einteilung in explizites und implizites Wissen geht auf M. POLANYI[48] zurück und gehört zu den am weitesten verbreiteten Wissensarten.[49] Hier wird unterschieden inwiefern Wissen darstellbar bzw. vermittelbar ist. Diese Einteilung soll auch in dieser Arbeit als Grundlage für weitere Überlegungen dienen, da sie den Transfer von Wissen voraussetzt und als Grundlage für andere Unterscheidungen dienen kann.[50]
3.3.2.1 Explizites Wissen
Explizites Wissen wird als Wissen verstanden, dass beim Wissensträger bewusst vorliegt und jederzeit abgerufen und wiedergegeben werden kann. Meist wird darunter auch jegliches Wissen verstanden, dass in Form von Zahlen und Fakten bzw. Dokumenten vorhanden ist. Es lässt sich daher auch leicht belegen und vervielfältigen.[51] Seine häufigsten Erscheinungsformen sind standardisierte Prozesse, Datenbanken, Technologien oder Bibliotheken.[52] Durch diese Standardisierung treten beim Transfer weniger Probleme auf, da der Sender und der Empfänger solch einer Information, im Regelfall, das gleiche Verständnis von ihr haben. Wenn man die Dienstpostenübergabe im SKA betrachtet, wissen der Übergebende und der Übernehmende beispielsweise welche Bedeutung der Dienstgrad des Vorgesetzten hat.
3.3.2.2 Implizites Wissen
Neben explizitem Wissen ist implizites Wissen die zweite Erscheinungsform von Wissen in dieser Einteilung. Sie ist schwieriger zu beschreiben, denn sie umfasst laut M. POLANYI all das, was sich nur schwer explizieren lässt.[53] Meist werden darunter Ideale, Werte, Gefühle und Intuitionen verstanden. Aber auch individuelle Fähigkeiten und Handlungsroutinen.[54] Implizites Wissen wird oft nicht direkt als Wissen wahrgenommen und liegt meist nicht beim Wissensträger zum sofortigen Abruf bereit.[55] Implizites Wissen ist eher subjektiv und beim Transfer anfällig für Probleme und Missverständnisse sowohl auf Seiten des Senders, als auch auf Seiten des Empfängers. Wenn beispielsweise der Dienstpostenübergebende von Eigenarten des Kollegen spricht, kann das vom Übernehmenden anders aufgefasst oder gar nicht, als das was gemeint war, verstanden werden.
3.3.3 Transferierbares und nicht transferierbares Wissen
Um die Organisation von Wissenstransfer zu beleuchten, ist es notwendig zu hinterfragen ob Wissen überhaupt transferierbar ist. Diese Einteilung steht im engen Zusammenhang zu expliziten und impliziten Wissen, denn oft geht die Frage der Transferierbarkeit einher mit der Frage, in welcher Form Wissen vorhanden ist.[56]
3.3.3.1 Transferierbares Wissen
Die Transferierbarkeit von Wissen bedeutet, dass es sich kommunizieren bzw. weiterleiten lässt.[57] Explizites Wissen ist laut Definition transferierbar. Implizites Wissen lässt sich in begrenztem Maße auch übertragen, dazu muss es aber expliziert, also in Form von Fakten oder Dokumenten gebracht bzw. mit anderen geeigneten Methoden (z.B. Demonstration und Nachahmung) vermittelt werden (beispielsweise das Einschlagen eines Nagels). Zudem ist die Transferierbarkeit von Wissen abhängig von den Transferpartnern. Beide benötigen dafür einen gleichen Hintergrund und dasselbe Verständnis von Sachverhalten und Begrifflichkeiten. Die Artikulierbarkeit spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Sie erleichtert den Transfer, aber es gilt zu beachten, dass sie gerade bei implizitem Wissen an Grenzen stößt. Beispielsweise kann bei einer Dienstpostenübergabe erklären werden, wie man seinen Kaffee mag, aber wie er dann genau schmecken muss lässt sich aber kaum in Worte fassen.[58]
3.3.3.2 Nicht transferierbares Wissen
Unter nicht transferierbaren Wissen wird Wissen verstanden, welches sich nicht oder nicht vollständig weitergeben lässt. Das liegt zum einen an der Artikulierbarkeit und zum anderen an der Wissensform. Wie schon erwähnt, lässt sich implizites Wissen nur zu einem Teil transferieren. Hier seien beispielsweise charismatische Eigenschaften einer Führungsperson erwähnt.[59] Daneben gibt es zum Beispiel intuitives oder auch natürliches Wissen. Dieses Wissen liegt oft nur im Unterbewusstsein des Menschen vor und zeigt sich in Form von Intuitionen oder Instinkten, die unser Überleben sichern.[60] So hält ein Neugeborenes automatisch die Luft an, wenn es unter Wasser kommt, ohne dass es ihm die Eltern hätten beibringen können.
Da es bei einer Dienstpostenübergabe auf den Transfer von Wissen ankommt, wird diese Wissensart nicht weiter berücksichtigt
3.4 Wissenstransfer
Das zentrale Thema dieser Betrachtung ist der Wissenstransfer und eine mögliche Optimierung im Zuge der Dienstpostenübergabe auf Ämterebene der Bundeswehr. Um mit der Analyse des Untersuchungsgegenstandes zu beginnen soll im Folgenden der Wissenstransfer mit seinen Grundlagen und Problemen betrachtet werden.
3.4.1 Begriffsbestimmung
Wissenstransfer wird in der Literatur und im alltäglichen Gebrauch meist synonym mit Begriffen wie Wissenskommunikation, Wissensteilung, Wissensverteilung oder Wissensvermittlung verwendet.[61] Genauso vielfältig wie die Begriffe sind auch die Ansichten verschiedener Autoren zum Verständnis von Wissenstransfer.[62] Diese vielen verschiedenen Ansätze zu beleuchten würde den Rahmen dieser Arbeit übersteigen. Deshalb wird für die weitere Betrachtung eine weitestgehend einheitliche Auffassung zu Grunde gelegt. M. EPPLER und R. REINHARDT formulieren es in diesem Zusammenhang treffend, „Unter Wissenskommunikation verstehen wir die (meist) absichtsvolle, interaktive Konstruktion und Vermittlung von Erkenntnis und Fertigkeit auf der verbalen und nonverbalen Ebene.“[63]. Damit beschreiben sie in prägnanter Form die wesentlichen Aspekte von Wissenstransfer. Zum einen, das dabei immer eine Interaktion stattfindet, das wiederum bedingt durch Personen oder Personengruppen. Weiterhin wird das ausgedehnte Feld von Wissen, durch die Begriffe Erkenntnis und Fertigkeit, einbezogen. Und sie bringen in ihrer Definition zum Ausdruck, dass Wissen sowohl durch Sprache, als auch durch andere Kommunikationsformen vermittelt werden kann. Kurzum geht es bei Wissenstransfer um den Austausch von Wissen zwischen Personen und Organisationen. Da diese Definition alle wichtigen Aspekte des Wissenstransfers in sich vereint, soll sie als Arbeitsdefinition für Wissenstransfer im weiteren Verlauf der Ausführungen dienen.
Zudem spielt er eine wichtige Rolle im Wissensmanagement,[64] auf die im Verlauf noch eingegangen wird.
3.4.2 Transferarten
Um den Wissenstransfer zu untersuchen, ist es vorher sinnvoll, ihn in Arten einzuteilen. Für den Prozess der Dienstpostenübergabe im Streitkräfteamt kommen zwei mögliche Einteilungen in Betracht.
Zum Ersten ist die Einteilung in externen und internen Wissenstransfer zu nennen. Sie bezieht sich auf die organisatorische Reichweite des Transfers und unterscheidet, ob Wissen nur in der Organisation (intern) oder auch über die Grenzen der Organisation hinaus (extern) transferiert wird.[65] In Bezug auf diese Ausarbeitung soll das Streitkräfteamt als Organisation betrachtet werden[66], wobei unter internen Wissenstransfer der horizontale Wissensfluss (zwischen einzelnen Mitarbeitern) und der vertikale Wissensfluss (zwischen Vorgesetzten und Untergebenen) im Bereich des Streitkräfteamtes verstanden werden kann. Daraus ergibt sich, dass unter externen Wissenstransfer jeder Wissensfluss verstanden wird, der aus dem Streitkräfteamt hinausgeht bzw. von außen in die Organisation hereinkommt. Hier lassen sich beispielsweise andere Dienststellen oder Behörden nennen, die mit dem Streitkräfteamt zusammenarbeiten, aber auch private Unternehmen, die für das Streitkräfteamt Aufträge wahrnehmen (z.B. Instandhaltung, Reinigung, IT-Ausstattung).
Zum Zweiten lässt sich der Wissenstransfer in direkten und indirekten Transfer unterteilen. Bei direktem Wissenstransfer wird die Übertragung von Wissensbeständen durch die Organisation gewollt und gesteuert. Hierbei soll durch entsprechende Instrumente (z.B. Weiterbildung, Informationsgespräche, Arbeitsgruppen oder Partnerschaften) bestimmtes Wissen direkt und meist in expliziter Form an die Mitarbeiter weitergegeben werden.[67] So kann man beispielweise neue Dezernenten im Amt in einer Weiterbildung mit den neuen Aufgaben vertraut machen oder bei Besprechungen wichtige Informationen zu laufenden Projekten verteilen. Im Gegensatz dazu steht der indirekte Wissenstransfer, der nicht explizit von der Organisation gewollt und auch nicht gesteuert wird. Er tritt meist als positiver Nebeneffekt, im Zuge anderer Maßnahmen auf. Hierbei wird vor allem implizites Wissen auf horizontaler Ebene vermittelt.[68] Unter den Maßnahmen, die solch einen Effekt erzielen, verstehen sich beispielsweise Umstrukturierung der Organisation, Dienstpostenwechsel, Job Rotation - Systematischer Arbeitsplatzwechsel mit den Zielen : Entfaltung und Vertiefung der Fachkenntnisse und Erfahrung en der Mitarbeiter , Vermeiden von Arbeitsmonotonie sowie Förderung des Führungsnachwuchses[69] - oder Neugestaltung des Dienstpostens. Hier werden Erfahrungen, Werte und Einstellungen weitergegeben und mit denen von anderen Mitarbeitern geteilt. Tritt zum Beispiel ein Dezernent aus dem Streitkräfteamt eine Stelle in einer anderen Abteilung an, vermittelt er seine gemachten Erfahrungen während des Arbeitsprozesses und nimmt die seiner Kollegen auf, wobei ein indirekter Wissenstransfer stattfindet.
3.4.3 Strategien und Prinzipien des Wissenstransfers
Nach den Wissenstransfers-Arten soll im Folgenden auf die beiden grundsätzlichen Strategien des Wissenstransfers eingegangen werden. Diese bilden die Grundlage für die möglichen Methoden und Instrumente um Wissen zu transferieren (siehe Abbildung 5). Zudem wird die Rolle der Initiierung, in Form von Push und Pull-Prinzip, in Bezug auf den Wissenstransfer erläutert.
3.4.3.1 Kodifizierungsstrategie
Der Kodifizierungsstrategie liegt die Kodifizierung zugrunde, die den dokumentenbasierten Wissensaustausch beschreibt.[70] Vorrangig zielt sie darauf ab, explizites Wissen in Worte zu fassen und in Form von Dokumenten und Datenbanken zu speichern und zu verteilen.[71] Um diese Strategie in einer Organisation effizient umzusetzen, bedarf es zweier entscheidender Faktoren. Zum einen benötigt es ein Dokumentensystem und die nötige Infrastruktur (heute meist in Form von IuK-Technologie) und zum anderen den Mitarbeiter, der bereit ist, Wissen zur Verfügung zu stellen und andererseits Wissen wieder zu verwenden.[72] Die Kodifizierungsstrategie ist heutzutage fast überall in Form von Akten, Bibliotheken und digitalen Datenbanken anzutreffen und bietet deutliche Vorteile. Die Verteilung von Wissen kann unabhängig von Zeit und Personen erfolgen, da das Wissen für den Empfänger jederzeit abrufbar ist. Zudem ist dieses Wissen formal und in seiner Darstellung standardisiert, so dass es meist ohne zusätzliche Erläuterung vom Empfänger verstanden wird.[73]
Als ein wesentlicher Vorteil kann die Möglichkeit zur Kostensenkung genannt werden. Betrachtet man die Möglichkeiten des Inter- bzw. Intranet, wird deutlich, dass sich Wissen ohne zusätzlichen Finanzaufwand verteilen lässt.[74] Jedoch hat die Kodifizierungsstrategie einen entscheidenden Nachteil. Mit ihr kann nur explizites Wissen transferiert werden. Oft ist dieses jedoch nur ein Teil des gesamten Wissens einer Person bzw. einer Organisation. Da die Kodifizierung von Wissen für den Mitarbeiter einen zusätzlichen Aufwand darstellt, kann hier schnell Wissen verloren gehen.[75] Darum ist die Kodifizierungsstrategie allein nicht ausreichend um den Wissenstransfer in komplexen Organisationen zu bewerkstelligen und kann nur in Verbindung mit der Personalisierungsstrategie zu einem optimalen Ergebnis führen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Abb. 5: Transferstrategien und Transfermethoden nach Thiel[76]
3.4.3.2 Personalisierungsstrategie
Die Personalisierungsstrategie beschäftigt sich mit dem direkten Wissenstransfer zwischen Personen. Hierbei wird Wissen nicht in Dokumenten festgehalten sondern verbal oder nonverbal zwischen den Transferierenden ausgetauscht.[77] Durch den direkten Kontakt von Personen kann neben explizitem Wissen auch implizites Wissen in Form von Fähigkeiten, Erfahrungen und Anschauungen vermittelt werden. Der Fokus liegt hier auf sozialer Interaktion, bei der Wissen durch Erzählen, Vormachen oder Zeigen transferiert werden kann.[78] Betrachtet man beispielsweise das Verhältnis von Lehrling und Meister wird die Rolle der Personalisierung schnell deutlich. Hier bekommt der Lehrling durch seinen Meister mehr als nur Fakten vermittelt. Er lernt durch Nachahmung und Beobachtung sowie durch Gespräche über Erfahrungen und Werte.[79] Dieser Strategie kommt auch bei der Dienstpostenübergabe eine tragende Rolle zu, denn auch hier lässt sich oft eine Art Meister-Lehrlings- bzw. Experten-Laien-Verhältnis[80] beobachten. Und zwar dann, wenn der Nachfolger mit einer für ihn völlig neuen Aufgabe betraut wird. Diese Strategie erlaubt einen weniger komplizierten Transfer von Wissen, der vom Mitarbeiter ohne erheblichen zusätzlichen Aufwand betrieben werden kann. Nachteil hierbei ist aber, dass das Wissen für jeden Vorgang erneut bereitgestellt werden muss.
Bei genauer Betrachtung der beiden Strategien, kann festgestellt werden, dass ein optimaler Wissenstransfer nur durch Anwendung beider Strategien erreicht werden kann. Denn oftmals nimmt ein Empfänger Wissen besser auf, indem er es hört, liest bzw. sieht und im Anschluss selbst ausprobieren kann.
3.4.3.3 Das Push- und Pull-Prinzip
Diese Prinzipien des Wissenstransfers beschreiben den Vorgang der Initiierung durch das Senden (Push-Prinzip) bzw. das Nachfragen (Pull-Prinzip) von Wissen,[81] wobei beachtet werden muss, dass diese Prinzipien im Verlauf des Transferprozesses nicht starr bleiben, sondern die Sender und Empfänger immer wieder wechseln. Durch Anregungen, Nachfragen und Feedback werden diese Rollen durch die Transferpartner ständig neu besetzt.[82]
Bei dem sogenannten Push-Prinzip oder auch Bring-Prinzip[83] geht es prinzipiell um die angebotsorientierte Verteilung von Wissen. Der Sender gibt sein Wissen an den Empfänger mit der Zielsetzung dieses zu nutzen weiter.[84] Dieses Prinzip eignet sich vor allem zur gezielten Verbreitung von Wissen zwischen Individuen und in Organisationen. Durch die Möglichkeiten der IuK-Technologie lässt es sich ohne hohen Aufwand leicht verteilen und weit streuen.[85] Doch dadurch besteht auch die Gefahr, dass der Empfänger von einer Flut von für ihn irrelevanten Daten überschwemmt wird. Das wiederum kann zur Verwirrung oder sogar zur Desensibilisierung gegenüber wichtigen Informationen führen.[86]
Dem steht das Pull- oder auch Hol-Prinzip[87] gegenüber. Hier wird das benötigte Wissen nachgefragt. Durch die Eigeninitiative ist ein gezielter Wissenstransfer möglich, dies bringt zugleich eine hohe Relevanz und Akzeptanz des transferierten Wissens mit sich, denn der Empfänger fragt nur das nach, was er auch benötigt.[88] Um dieses Prinzip jedoch erfolgreich umzusetzen ist es erforderlich, dass der Empfänger sein Wissensdefizit kennt und dass das nachgefragte Wissen auch vorhanden ist.[89]
3.4.3.4 Instrumente und Methoden des Wissenstransfers
Betrachtet man die Ausführungen von verschiedenen Autoren zur Beschreibung der Instrumente und Methoden wird deutlich, dass die Begriffe Methoden und Instrumente häufig synonym verwendet werden[90]. Im Folgenden soll ein Instrument als Werkzeug für den Wissenstransfer und die Methode als Vorgehensweise für den Wissenstransfer betrachtet werden, wobei nur auf die Instrumente und Methoden eingegangen wird, die in Relevanz zur Dienstpostenübergabe im Streitkräfteamt stehen.
3.4.3.4.1 Instrumente
Um Wissen zu transferieren steht eine Vielzahl an Instrumenten zur Verfügung. Sie reicht von einfachen Datenbanken über Training und Mentoring - Mentoring dient der Förderung einer unerfahrenen Person durch die langfristige und intensive Betreuung seitens eines Mentors indem er sein Wissen und seine Fähigkeiten vermittelt[91] - bis hin zu Kompetenzzentren.[92] Die wohl ältesten und am weitesten verbreiteten Instrumente um Wissen zu vermitteln, sind die verbale und nonverbale Kommunikation, wobei man hier einer anderen Person das was man weiß, sagt oder zeigt.[93]
Den Datenbanken, in Form von Ordnern, Büchern und digitalen Dokumenten, kommt vor allem in Organisationen eine große Bedeutung zu, wenn es um den Transfer von Wissen geht. Mit ihnen lässt es sich kodieren, speichern und verteilen. Daneben finden Instrumente wie Arbeitsgruppen, Projektteams oder Kompetenzzentren, in denen Einzelne auf das Wissen von mehreren Organisationsmitgliedern zurückgreifen kann, um ein Problem zu lösen, gerade in komplexen Organisationen immer mehr Anwendung.[94] Damit Wissen gezielt auf eine Person oder Personengruppe transferiert werden kann, kommen häufig Weiterbildungen und Schulungen zum Einsatz, wobei gerade hier auch neue Formen der Wissensvermittlung vermehrt Anwendung finden. Zu diesen gehören vor allem Mentoring, Coaching - Coaching beschreibt einen ähnlichen Prozess wie Mentoring, jedoch liegt der Schwerpunkt hier bei der Bewältigung von persönlichen Problemen. Beispielsweise in der Kommunikation, im Führungs- oder Arbeitsverhalten[95] - und das E-Learning - Unter E-Learning werden Lernangebote verstanden, die mit Hilfe von digitalen Medien präsentiert und verteilt werden. Hierbei unterscheidet man nach computerbasierten Programmen, bei denen CDs oder DVDs zum Einsatz kommen und netzwerkbasierten Programmen die über Inter- oder Intranet abgerufen werden[96].[97]
Mit dem Einsatz von Instrumenten des Wissenstransfers lässt sich dieser individuell steuern und an die jeweiligen Rahmenbedingungen einer Organisation oder einer Person anpassen (z.B. technische Ausstattung, Verteilung und Fähigkeiten der Mitarbeiter). Jedoch sollte auch Vorsicht im Umgang mit dem Push-Prinzip geboten und die Auswahl und Anzahl der Instrumente zweckmäßig gewählt werden.[98] Neben all diesen Instrumenten, die von der Organisation gewollt und gefördert werden, existiert im Hintergrund eines, das sich nur schwer steuern und gezielt einsetzen lässt. Als solches Instrument ist das informelle Netzwerk in einer Organisation zu betrachten, denn auch hier tauschen Personen auf gemeinschaftlicher Ebene Wissen aus. Diese Netzwerke sind oft stark durch soziale Kontakte geprägt und bergen ein ungenutztes oder unbewusstes Potential für den Bereich des Wissenstransfers in Organisationen.[99]
3.4.3.4.2 Methoden
Um die eben dargestellten Instrumente umzusetzen, kann man zwischen verschiedenen Methoden wählen. M. THIEL hat diese mit den möglichen Strategien des Wissenstransfers in Verbindung gesetzt und versucht sie diesen zuzuordnen (siehe Abbildung 4).[100] Dabei wird unterschieden, ob Wissen nur zwischen Personen transferiert oder zudem auch gespeichert wird. Wobei die Grenzen im Fall einer E-Mail oder eines aufgezeichneten Telefonats ineinander verlaufen, da hier zum einen ein persönlicher Kontakt hergestellt und auf den Wissensbedarf des Transferpartners eingegangen wird, aber zum anderen auch eine Kodifizierung des Wissens erfolgt.[101] Betrachtet man die Zuordnung zu Instrumenten genauer wird schnell deutlich, dass dies nur in bestimmten Fällen exakt möglich ist. Für Datenbanken eignen sich Methoden wie zum Beispiel Text-Dokumente, multimediale Dokumente, Infobretter, Checklisten oder andere Office-Anwendungen, während sich Coaching-Programme nur durch Face-to-Face-Besprechungen erfolgreich umsetzen lassen.[102] Dem Großteil der Instrumente kann jedoch nicht nur eine Methode zugeordnet werden. Für sie ist es notwendig, verschiedene Methoden der Personalisierungs- und Kodifizierungsstrategie zu kombinieren. So kommt beispielsweise eine Projektgruppe nicht ohne Berichte und Besprechungen, das E-Learning nicht ohne multimediale Dokumente, E-Mail oder Online-Konferenzen aus.
3.4.4 Prozessmodelle des Wissenstransfers
Die Betrachtung des Wissenstransfers kommt nicht ohne den Blick auf den Wissenstransfer als Prozess aus. Hier existieren in der Literatur zwei grundlegende Konzepte. Zum einen der Wissenstransfer als Lernprozess und zum anderen der Wissenstransfer als Logistikprozess.[103] Beide sind von einer Vielzahl an Parametern abhängig, deren ausführliche Beschreibung zu weit führen würde. Deshalb werden sie im Folgenden nur knapp erläutert. Zudem sollten diese Modelle nicht als Musterlösung gesehen werden, da sie, jedes für sich, nur einen Teilbereich des Wissenstransfers abdecken und aus verschiedenen Denkrichtungen des Wissenstransfers entspringen. Es sind theoretische Ansätze, die sich in der Praxis oft miteinander vermischen.[104]
3.4.4.1 Wissenstransfer als Lernprozess
Nach dieser Ansicht ist der Transfer von Wissen eng mit Lernen verbunden, wobei der Fokus auf der Aufnahme und Einarbeitung, des vermittelten Wissens in die Wissensbasis des Empfängers, liegt.[105] Der Vorgang des Lernens kann auf drei Arten erfolgen. Beim Erfahrungslernen werden eigene Erfahrungen auf etwas Beobachtetes reflektiert und anschließend daraus Schlüsse gezogen die zu eigenem Wissen werden.[106] Beim Beobachtungslernen werden Verhaltensweisen bei anderen Individuen oder Gruppen und deren Auswirkungen beobachtet und vom Lernenden übernommen und angewendet.[107] Beim Lernen durch Instruktion wird Wissen strukturiert und angeleitet vermittelt um die Wissensbasis von Individuen oder Gruppen gezielt aufzubauen.[108]
Man geht davon aus, dass sich der Prozess des Lernens, in Bezug auf die Transferpartner, in drei Ebenen untergliedern lässt. Unterschieden wird zwischen:
1. individueller Ebene,
2. Gruppenebene und
3. Organisationsebene.[109]
Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Optimierung des Wissenstransfers bei der Dienstpostenübergabe liegt, kann auf die Ausführungen der Organisationsebene verzichtet werden, da hier der Transfer zwischen Organisationen selbst betrachtet wird.
Auf der individuellen Ebene kommt es zum Austausch zwischen zwei Individuen, bei dem einer die Rolle des Senders und ein anderer die Rolle des Empfängers übernimmt. Der Erfolg dieses Prozesses hängt einerseits von der Fähigkeit des Senders ab sein Wissen zu artikulieren bzw. zu transferieren und zum anderen von der Fähigkeit des Empfängers dieses Wissen aufzunehmen. Entscheidend ist zudem die Kommunikationsfähigkeit beider Transferpartner. Durch gezielte Kommunikation lassen sich Wissenslücken leichter identifizieren, wodurch sich der Wissenstransferprozess effizienter gestalten lässt.[110]
Als Sozialisationsprozess wird der Lernprozess auf Gruppenebene beschrieben, bei dem ein Transfer zwischen einem Individuum und einer Gruppe oder umgekehrt erfolgt. Die „klassische“ Sozialisation findet hauptsächlich seitens der Einzelperson statt und kann als Anpassung an die gesellschaftlichen Normen und die Wissensbasis der Gruppe verstanden werden. Der Lernprozess der Gruppe wird auch als „erweiterte“ Sozialisation bezeichnet und basiert immer auf individuellen Transferprozessen, denn auch die Gruppe kann nur durch individuelle Prozesse lernen und sich artikulieren.[111]
3.4.4.2 Wissenstransfer als Logistikprozess
Bei diesem Ansatz stehen die Phasen des Wissenstransfers und die darin durchzuführenden Handlungen im Vordergrund wobei der Wissenstransfer primär als Problem der Wissenslogistik betrachtet wird.[112]
Dieses Modell des Wissenstransfers basiert auf der Überlegung, dass drei Phasen zur Vermittlung von Wissen nötig sind (siehe dazu Abbildung 6): die Initiierungsphase, die Wissensflussphase und die Integrationsphase, wobei das Erlernen von Wissen hier lediglich als ein Aspekt betrachtet wird.[113] Den Rahmen für einen Wissenstransfer bilden immer Sender und Empfänger in Form von Personen, Gruppen oder Organisationen zwischen denen Wissen ausgetauscht wird. Zudem ist der Transfer abhängig vom Kontext der Transferpartner[114] und wird durch Faktoren beeinflusst, die in Kapitel 3.4.5 beschrieben werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6: Phasenmodell des Wissenstransfers in Anlehnung an Krogh / Köhne[115]
Der eigentliche Transfer beginnt mit der Phase der Initiierung, in der der Sender den Entschluss trifft Wissen transferieren zu wollen. Damit geht auch die Überlegung einher, wie an wen und in welchem Umfang Wissen vermittelt werden soll.[116]
Daran schließt sich der Prozess des Wissensflusses an, bei dem explizites und implizites Wissen mittels geeigneter Instrumente und Methoden transferiert wird.[117] Hier werden zudem durch Nachfragen und Rückkopplung[118] Interpretationsbedürfnisse geklärt und Wissenslücken geschlossen.[119]
Den Abschluss bildet die Phase der Integration in der das transferierte Wissen aufgrund der Erfahrungen des Empfängers in dessen Wissensbasis aufgenommen soll, um im Anschluss angewendet und bei Personen, Gruppen und Organisationen in deren Wissensbasis integriert zu werden.[120]
3.4.5 Einflussfaktoren auf den Wissenstransfer
Wie die vorangegangenen Abschnitte zeigen, bedeutet Wissenstransfer nicht einfach nur einer anderen Person mitzuteilen was man selbst weiß. Eine Vielzahl an Faktoren kann den Transfer beeinflussen und hat somit direkte Wirkung auf dessen optimalen Ablauf. In der Literatur existieren die verschiedensten Ansätze, um die Probleme und Barrieren beim Wissenstransfer einzuteilen und zu beschreiben.[121] Für das weitere Vorgehen in dieser Arbeit sollen die Barrieren in individuelle und organisationsbedingte Barrieren unterteilt werden, wobei auch eine Betrachtung des Time-and-Place-Ansatzes nach O´HARA-DEVEREAUX und JOHANSEN[122] als Infrastruktur des Wissenstransfers vorgenommen wird. Hier wird die Grundlage für den Transfer von Wissen bei Dienstpostenübergaben gelegt.
3.4.5.1 Barrieren beim Wissenstransfer
Die folgenden Ausführungen sollen sich im Schwerpunkt auf die Dienstpostenübergabe und den damit verbundenen Wissenstransfer beziehen. Daraus ergibt sich, dass nicht alle Klassifizierungen und Arten der möglichen Barrieren beim Wissenstransfer Erwähnung finden. Die beschriebenen Faktoren bzw. Barrieren sollen aufzeigen, wie sie den Wissensfluss stören oder sogar verhindern und so am Ende des Prozesses kein oder nur ein ungenügender Wissenstransfer stattfindet
3.4.5.1.1 Individuelle Barrieren
Die individuellen Barrieren spielen bei beiden Strategien des Wissenstransfers und bei allen Methoden eine Rolle. Sie können sowohl beim Sender als auch beim Empfänger auftreten und die gemeinsame Kommunikation erheblich stören. Zur Systematisierung werden sie entlang des Wissenstransferprozesses abgearbeitet.
Die grundlegendste Barriere beim Wissenstransfer ist das Wissen im Kopf des Senders, von dem der Sender nicht weiß, dass er es hat oder wie er es transferieren soll. Meist ist es implizites Wissen und lässt sich vom Sender, wenn überhaupt nur schwer explizieren.[123]
Als weitere Barriere lässt sich die Unwissenheit über den Wissensbedarf nennen. Setzt man den Wissenstransfer mit dem Push- und Pull-Prinzip[124] in Verbindung wird die Auswirkung dieser Barriere deutlich. Aufseiten des Empfängers kann diese Unwissenheit des Senders zu einer Informationsflut oder zu einem Mangel an transferiertem Wissen führen. Andererseits kann der Empfänger nicht gezielt Wissen nachfragen.
Monopolisierung von Wissen bzw. Machtbewahrung stellt ein weiteres Problem für den optimalen Wissenstransfer dar. Hier ist wichtiges Wissen in einer Person gebunden und es fehlt der Wille dieses zu teilen, um persönliche Vorteile zu erhalten oder eine bestimmte Rolle in der Organisation zu bewahren.[125]
Eine weitere grundlegende Barriere beim Wissenstransfer ist zweifellos die mangelnde Kommunikationsfähigkeit. Ist der Sender nicht in der Lage sein Wissen zielgerichtet und verständlich zu kommunizieren,[126] kann der Empfänger dieses mit großer Wahrscheinlichkeit nicht aufnehmen oder gar nicht in seine Wissensbasis integrieren.[127] Die Kommunikationsfähigkeit kommt aber auch beim Empfänger zum tragen, falls im Transferprozess eine Rückkopplung nötig ist, um Defizite im Verständnis abzubauen, muss sich dieser ebenfalls verständlich ausdrücken können.[128]
Der persönliche Gefühlszustand des Transferpartners wirkt sich ebenfalls auf den Wissenstransfer aus und kann eine Barriere darstellen, wenn dadurch die Wissensweitergabe oder Wissensaufnahme behindert wird.[129] Das spielt vor allem bei privaten oder psychischen Problemen eine Rolle. Dann ist einer der beiden Transferpartner nicht in der Lage, sich in vollem Maße dem Übergabeprozess zu widmen.
Gerade bei Dienstpostenwechsel spielt zudem Veränderungsresistenz und die damit in Zusammenhang stehende Ablehnung fremden Wissens bei der Betrachtung der Barrieren eine wichtige Rolle. Diese Barriere tritt vor allem aufseiten des Empfängers auf und lässt sich nur durch Motivation und mitarbeiterorientierte Personalplanung seitens der Organisation beheben oder verhindern.[130]
Dazu kann die Problematik des unklaren Rollenverständnisses und des mangelnden Erfahrungshintergrundes (Kontext) kommen, bei der der Empfänger mit der neuen Situation nur schlecht umgehen und transferiertes Wissen, ohne das entsprechende Vorwissen, nicht verarbeiten kann.[131]
Mangelnde Sympathie bzw. Antipathie zwischen den beiden Transferpartnern kann ebenfalls eine Barriere beim Wissenstransfer darstellen. Das persönliche Verhältnis der Transferpartner hat einen Einfluss auf den Ablauf und die Intensität des Wissenstransfers.[132]
3.4.5.1.2 Organisationsbedingte Barrieren
Neben der Vielzahl an Störgrößen die von den Individuen ausgehen, gibt es, gerade in Organisationen, Einflussfaktoren, die den Wissenstransfer im Ablauf oder gar schon im Vorfeld beeinträchtigen und so den reibungslosen Ablauf von Wissenstransfer verhindern.
Oftmals spielt Zeit in einer Organisation eine entscheidende Rolle und wird als wichtiger Produktionsfaktor betrachtet.[133] So entsteht ein organisationsbedingter Zeitdruck, der sich negativ auf die Quantität und Qualität des Wissenstransfers auswirkt.[134]
Des Weiteren können Medienbrüche zu einem Hindernis beim Wissenstransfer werden.[135] Durch den ständigen Wechsel der Medien (z.B. Ausdrucke und digitale Dokumente oder der Wechsel des Dateityps) gehen, gerade bei wissensintensiven Prozessen Informationen und damit Wissen verloren.[136]
Ein Aspekt der in Bezug auf Wissenstransfer ebenfalls Bedeutung hat, sind bürokratische Barrieren[137] in einer Organisation. Sie verhindern den Fluss von Wissen im Transferprozess, durch Regelungen über die Weitergabe von Informationen, die damit verbunden Befugnisse und Kommunikationswege. Dürfen bei einer Dienstpostenübergabe beispielsweise aktuelle Projektdaten nur nach Erlaubnis mehrerer Vorgesetzter weitergegeben werden, erschwert dies einen reibungslosen und unmittelbaren Wissenstransfer.
Weiterhin liegt in der Organisation die Ausgestaltung der Infrastruktur für den Wissenstransfer bei einer Dienstpostenübergabe begründet. Neben der Bereitstellung von Räumlichkeiten und technischer Ausstattung um eine Dienstpostenübergabe durchzuführen, muss, im besten Fall, auch die Anwesenheit beider Transferpartner sichergestellt werden. Mit dem „Anytime-Anyplace“-Ansatz von O´HARA-DEVEREAUX und JOHANSEN[138] lassen sich die möglichen Situationen im Bezug auf Zeit und Ort der Dienstpostenwechselnden gut darstellen (siehe dazu Abbildung 7).
[...]
[1] Vgl. Mohr (1999), S. 1 und Geiger (2006), S. 1.
[2] Vgl. Krämer (2003), S. 13.
[3] Vgl. Krämer (2003), S. 13.
[4] Vgl. Mertins / Finke (2004), S. 45.
[5] Mit „grüner Truppe“ werden bundeswehrintern die Teile bezeichnet, die nicht in Ämtern oder Behörden oder vergleichbaren Einrichtungen ihren Dienst verrichten sondern Bataillonen, im Fliegerhorst oder auf See.
[6] Vgl. Berg (2006), S. 1, Prozess zur Neuausrichtung der Bundeswehr im Bezug auf das neue Einsatzspektrum und die neue Auftragslage.
[7] Vgl. SKA LdP (2008), S. 1.
[8] Vgl. SKA LdP (2007a), S. 1.
[9] Vgl. SKA LdP (2007b), S. 1.
[10] In Anlehnung an SKA LdP (2007c), S. 1.
[11] Vgl. SKA LdP (2007d), S. 1.
[12] Spelsiek (2004), S. 8.
[13] Vgl. Thiel (2002), S. 9.
[14] Vgl. Bodrow / Bergmann (2003), S. 35.
[15] Nonaka und Takeuchi (1997) in Bodrow / Bergmann (2003), S. 36.
[16] Davenport und Prusak (1998) in Bodrow / Bergmann (2003), S. 37.
[17] Vgl. o.V. (2008a), S.1.
[18] Schütt (1999), S. 11.
[19] Vgl. Schröder (2003), S. 14-15.
[20] Vgl. Schröder (2003), S. 14.
[21] Janas (2005), S. 25.
[22] Vgl. Krämer (2003), S. 59-60.
[23] Janas (2005), S. 21.
[24] Vgl. Rehäuser / Krcmar (1996), S. 4.
[25] Vgl. Krämer (2003), S. 60.
[26] Schröder (2003), S. 16.
[27] Vgl. Krämer (2003), S. 61.
[28] Vgl. Krämer, (2003), S. 61.
[29] Vgl. Strasser (2006), S. 54, Vgl. Krämer (2003), S. 61 und Schröder (2003), S. 29.
[30] Vgl. Bodrow / Bergmann (2003), S. 37 und Wahren (2000), S. 280.
[31] Vgl. Krämer (2003), S. 61.
[32] Vgl. Bodrow / Bergmann (2003), S. 38.
[33] Vgl. Kepke / Schuldes (2007), S. 8.
[34] Vgl. Geiger (2006), S. 30-31.
[35] In Anlehnung an Rehäuser / Krcmar (1996), S. 3 und Bodrow / Bergmann (2003), S. 38.
[36] Vgl. Krämer, (2003), S. 64.
[37] Vgl. Krämer, (2003), S. 64.
[38] In Anlehnung an Krämer( 2003), S. 63.
[39] Vgl. hierzu Thiel, (2002), S. 20,23 und Nonaka / Takeuchi (1997), S. 71.
[40] Vgl. o.V. (2007), S. 1.
[41] Vgl. Thiel (2002), S. 17.
[42] Vgl. Bodrow / Bergmann (2003), S. 39.
[43] Vgl. Nonaka / Takeuchi (1997), S. 97.
[44] Vgl. Schröder (2003), S. 22.
[45] Vgl. Bodrow / Bergmann (2003), S. 39.
[46] Vgl. Thiel (2002), S. 19.
[47] Vgl. Thiel (2002), S. 19.
[48] ungarisch-britischer Chemiker und Philosoph.
[49] Vgl. Thiel (2002), S. 20.
[50] Vgl. Thiel (2002), S. 21-22
[51] Vgl. Reinhardt / Eppler (2004), S. 36.
[52] Vgl. Bodrow / Bergmann (2003), S. 40.
[53] Vgl. Thiel (2002), S. 21.
[54] Vgl. Schröder (2003), S. 20.
[55] Vgl. Rehäuser / Krcmar (1996), S. 6.
[56] Vgl. Geiger (2006), S. 41.
[57] Vgl. Thiel (2002), S. 22.
[58] Vgl. Thiel (2002), S. 22-23.
[59] Vgl. Thiel (2002); S. 23.
[60] Vgl. Kübler (2005), S. 142.
[61] Vgl. Kepke / Schuldes (2007), S. 9.
[62] Vgl. Schröder (2003), S. 22.
[63] Reinhardt / Eppler (2004), S. 2.
[64] Vgl. Thiel (2002), S. 29 sowie Schröder (2003), S. 23 und Böhm (2000), S. 37.
[65] Vgl. Schröder (2003), S. 26 sowie Nyffenberger (2002), S.5.
[66] Dies soll das Streitkräfteamt als Organisation von der Bundeswehr als Organisation abgrenzen, um im Bezug auf internen und externen Transfer klare Grenzen zu ziehen.
[67] Vgl. Haun (2002), S. 214-215.
[68] Vgl. Haun (2002), S. 216-217.
[69] Vgl. o.V. (2008b), S. 1.
[70] Vgl. o.V. (2008c), S. 1.
[71] Vgl. Schröder 82003), S. 28.
[72] Vgl. Thiel (2002), S. 34.
[73] Vgl. Heppner (1997), S. 203-204.
[74] Vgl. Kersten / Schröder (2002), S. 153 sowie Schröder (2003), S.28.
[75] Vgl. Thiel (2002), S. 34.
[76] In Anlehnung an Thiel (2002), S. 37.
[77] Vgl. Thiel (2002), S. 34.
[78] Vgl. Krogh / Köhne (1998), S. 240.
[79] Vgl. Schröder (2003), S. 29.
[80] Vgl. Antos / Pfänder( 2002), S. 21.
[81] Vgl. North (1998), S. 237.
[82] Vgl. Rothe (2006), S.84.
[83] Vgl. o.V. (2008d), S.1.
[84] Vgl. Thiel (2002), S. 35 sowie Bodendorf (2005), S. 5.
[85] Vgl. Bodendorf (2005), S.5.
[86] Vgl. Kepke / Schuldes (2007), S. 19.
[87] Vgl. o.V. (2008e), S.1.
[88] Vgl. Thiel (2002), S. 35.
[89] Vgl. Probst (2000), S. 105.
[90] Vgl. Thiel (2002), Böhm (2000), Reinhardt / Eppler (2004).
[91] Vgl. o.V. (2008f), S. 1.
[92] Vgl. Böhm (2000), S. 96.
[93] Vgl. Meggle (2002), S. 11.
[94] Vgl. Böhm (2000), S. 97.
[95] Vgl. o.V. (2008h), S. 1.
[96] Vgl. Kerres (2008), S 1 und o.V. (2008i), S. 1.
[97] Vgl. Riekhof / Schüle (2002), S. 15.
[98] Vgl. Kapitel 3.4.3.3.
[99] Vgl. Böhm (2000), S. 97 und Zmija( 2002), S. 1.
[100] Vgl. Thiel (2002); S. 37.
[101] Vgl. Thiel (2002), S. 37.
[102] Vgl. Offermanns / Steinhübel (2006), S. 43.
[103] Vgl. Thiel (2002), S. 42 ff, sowie Heppner (1997), S. 187 ff, Schüppel (1996), S. 108 und Krogh / Köhne (1998), S. 238.
[104] Vgl. Thiel (2002), S. 59.
[105] Vgl. Wilkesmann (1999), S. 83.
[106] Vgl. o.V. (2008j), S. 1.
[107] Vgl. o.V. (2008k), S. 1.
[108] Vgl. Schreyögg / Steinmann (1997), S. 459.
[109] Vgl. Thiel (2002), S. 42-42.
[110] Vgl. Thiel (2002), S. 48.
[111] Vgl. Thiel (2002), S. 49 sowie Heppner (1997), S. 212-213.
[112] Vgl. Thiel (2002), S. 57.
[113] Vgl. Thiel (2002), S. 57.
[114] Vgl. Kapitel 3.2.4.
[115] in Anlehnung an Krogh / Köhne (1998), S. 238.
[116] Vgl. Krogh / Köhne (1998), S. 237.
[117] Vgl. Kapitel 3.4.3.4 und Thiel (2002), S. 58.
[118] Vgl. o.V. (2008l), S. 1, Rückkopplung ist eine wahrnehmbare Reaktion des Empfängers auf eine Kommunikation und bedeutet zugleich die Fortsetzung dieser.
[119] Vgl. Thiel (2002), S. 58.
[120] Vgl. Krogh / Köhne (1998), S. 241.
[121] Vgl. Heppner (1997), S. 203 ff sowie Rümler (2001), S. 24-27 und Kenning / Blut (2005), S. 20-28.
[122] Vgl. O´Hara-Deveraux / Johansen (1994), S. 199.
[123] Vgl. Rümler (2001), S. 24.
[124] Vgl. Kapitel 3.4.3.3.
[125] Vgl. Rümler (2001), S. 24.
[126] Kommunikation im Sinne von verbaler und nonverbaler Kommunikation, vgl. Kapitel 3.4.3.4.
[127] Vgl. Heppner (1997), S. 203.
[128] Vgl. Franken (2007), S. 142.
[129] Vgl. Strebel (2005), S. 84.
[130] Vgl. Rümler (2001), S. 24.
[131] Vgl. Heppner (1997), S. 211.
[132] Vgl. Schmidt (2006), S. 204 ff und Fasler (2002), S. 24.
[133] Vgl. Schenk / Gabriel (2003), S. 104.
[134] Vgl. Strebel (2005), S. 87.
[135] Vgl. Koch / Richter (2008), S. 44.
[136] Vgl. Hackenberg (2007), S. 1.
[137] Vgl. C. Burkard / R. Fischer / C. Freitag / T. Odebrett / J. Pleintinger / M. Wörsdörfer (2008), S. 23.
[138] Vgl. O´Hara-Deveraux / Johansen (1994), S. 199.
- Arbeit zitieren
- Christian Freitag (Autor:in), 2008, Wissenstransferorientierte Dienstpostenübergabe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118277
Kostenlos Autor werden











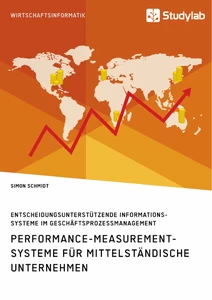

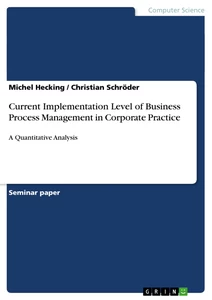






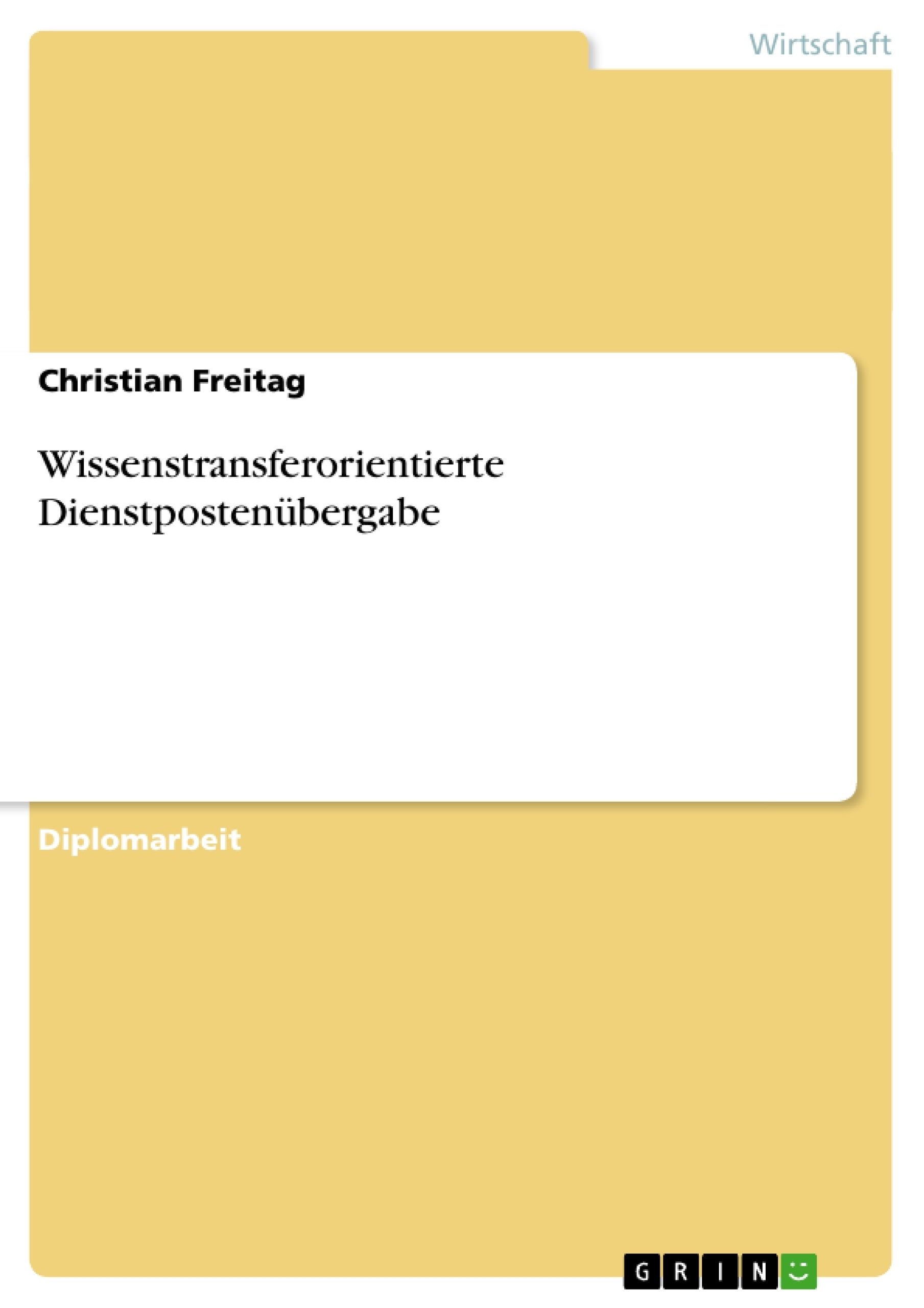

Kommentare