Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Management Summary
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Ziel der Arbeit und die zentrale Fragestellung
1.3 Forschungsmethodik
1.4 Aufbau der Arbeit
2 Stand der Forschung
2.1 Merkmale der Kooperation
2.2 Hindernisse bei Kooperationen
2.3 Theoretische Erklärungsansätze
2.4 Zusammenfassung der theoretischen Ansätze
2.5 Funktion des Vertrauens
3 Empirische Untersuchung
3.1 Untersuchungsdesign
3.2 Hypothesenmodell
3.3 Aufbau und Struktur der Untersuchung
4 Ergebnisse
4.1 KMU in Europa-
4.2 Strukturfaktoren
4.3 Anzahl Kooperationspartner
4.4 Zeitachse und Strategiebedeutung
4.5 Wettbewerbsfähigkeit
5 Konklusion
5.1 Gesamtfazit
5.2 Kritische Reflexion der Arbeit
5.3 Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang A
Anhang B
Anhang C
Anhang D
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Aufbau und Struktur der Arbeit (eigene Darstellung)
Abbildung 2 Morphologischer Kasten (Wiendahl, 2005)
Abbildung 3 empirisches Untersuchungsdesign (eigene Darstellung)
Abbildung 4 Nutzenmatrix für das Gefangenendilemma (Hofstadter, 1998)
Abbildung 5 Theoretisches Hypothesenmodell (eigene Darstellung)
Abbildung 6 Schichtenbildung für Stichprobenoptimierung (Quelle EIM)
Abbildung 7 Formalität von KMU-Kooperationen (Quelle ENSR)
Abbildung 8 Formalität nach Unternehmensgrösse (Quelle ENSR)
Abbildung 9 Formalität nach Sektoren (Quelle ENSR)
Abbildung 10 Anzahl der Partner nach Formalität (Quelle ENSR)
Abbildung 11 Kontakthäufigkeit in KMU-Kooperationen (Quelle ENSR)
Abbildung 12 Dauer von KMU-Kooperationen (Quelle ENSR)
Abbildung 13 Veränderung der Anzahl der Partner (Quelle ENSR)
Abbildung 14 Verbesserte Wettbewerbsfähigkeit (Quelle ENSR)
Abbildung 15 Die wichtigsten Kooperationshindernisse (Quelle ENSR)
Management Summary
Diese Arbeit über „Coopetition als KMU-Unternehmensstrategie“ unterstreicht die Faszination von Coopetition als komplexes und dynamisches Zusammenspiel von Konkurrenz und Kooperation. Der Versuch, das Phänomen der „Hassliebe“ zwischen direkten Konkurrenten mit hoher Ähnlichkeit in der Marktleistung für eine nutzenoptimierte Zusammenarbeit zur Sicherung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit zu erklären, führte zu einem ganzheitlichen Denkansatz. Ein Ansatz, der einen strategischen Entscheidungsrahmen bietet, um die Folgen eigener und fremder Entscheidungen systematisch abschätzen zu können. Die dynamische Betrachtungsweise dieses Ansatzes zeigt schliesslich, wie stark unser Entscheidungsverhalten von Vertrauen beeinflusst wird. Dieses Phänomen bildet die zentrale Fragestellung: „Warum ist das Vertrauen bei KMU- Kooperation mit hoher Ähnlichkeit der kritische Erfolgsfaktor?“
Die Konkurrenz auf globalen Märkten ist unerbittlich und ein weltumfassendes Spiel, das gerade Allianzen - wie z.B. Kooperationen - hervorbringt. Alte ideologische Polarisierungen über den Nutzen von Konkurrenz verlieren zunehmend an Plausibilität, gerade eben weil wir laufend lernen mit oligopolen Märkten als integrierte Gesellschaftseinheiten, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen globalen Finanzund Wirtschaftskrise, zu leben und zu beeinflussen. Den Wettbewerb versteht man am besten, wenn man ihn vor allem auch als einen Wettbewerb der Kooperationschancen deutet. Die Kooperation gründet auf der Chance des Wiedersehens, in dem die abdiskontierte Zukunft die Gegenwart strukturiert.
In dieser stringent angelegten Arbeit wird aus dem theoretischen Bezugsrahmen der Merkmale von KMU-Kooperationen und der Ansätze der Transaktionskostentheorie, Kontingenztheorie, Spieltheorie und der Funktion von Vertrauen ein Hypothesenmodell für die empirische Untersuchung zur Beantwortung der zentralen Fragestellung formuliert. Als Datenquelle diente eine europäische Umfrage über KMU-Kooperationen, bestehend aus 19 europäischen Ländern inklusive der Schweiz, mit 7'745 Interviews aus dem Jahr 2003 und zehn erfolgreichen Fallstudien von KMU-Kooperationen vom Deutschen Fraunhofer Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung in Karlsruhe ebenfalls aus dem Jahr 2003.
Die Ergebnisse zeigen generell, dass kooperierende Unternehmen erfolgreicher sind als nicht-kooperierende Unternehmen. Wobei der Unternehmenserfolg nicht ausschliesslich in der Kooperationstätigkeit liegt, jedoch durch die konsequente Marktorientierung und Marktbefähigung als Unternehmensphilosophie dies unterstellt. Organisatorische Gestaltungsmerkmale wie die Unternehmensgrösse, Formalisierungsgrad und Anzahl der Kooperationspartner beeinflussen den Kooperationserfolg. Kooperationen von grösseren Unternehmen mit hoher Formalisierung und wenigen Kooperationspartner sind erfolgreich als Unternehmensstrategie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Hierbei haben Länderund Sektorenunterschiede keine grosse Bedeutung. Als wichtigstes Kriterium bei KMUKooperationen agiert das Vertrauen und somit wurde die Relevanz der zentralen Fragestellung bestätigt.
Der wichtigste Grund von Vertrauen als der entscheidende Einflussfaktor für das Gelingen von KMU-Kooperationen ist aus ideologischer Sicht oft die subjektive Verhaltenseinstellung, dass Konkurrenten auch in einer Kooperationsbeziehung immer als Konkurrenten betrachtet werden. Trotz erfolgversprechendem Geschäftsmodell, offener transparenter Kommunikation und regelmässigen Kontakten auf allen Stufen, sind noch immer die soziökonomischen Verhaltenseigenschaften der Rationalität und Opportunität nicht vollständig über Verträge, gegenseitige Erfahrungen und Wertvorstellungen zu entschärfen und kontrollierbar. Als Fazit kann festgestellt werden, dass fehlendes Vertrauen als Vorleistung für eine Kooperation, im Kooperationsprozess nicht mehr im benötigten Umfang entwickelt werden kann, um ein erfolgreiches Kooperationsprojekt zu realisieren.
Hieraus ergibt sich der ganzheitliche Denkansatz, dass ein marktorientiertes Unternehmen seine Kooperationschancen als langfristige Strategieoptionen zur Sicherung seiner Wettbewerbsfähigkeit laufend evaluiert, plant und überwacht. Hierbei ist der Aufbau von Vertrauen durch gegenseitige Erfahrungen innerhalb einer positiven Konkurrenzkultur vor der eigentlichen Kooperationsanbahnung entscheidend. Diese kognitiven Erfahrungswerte respektive Reputationen können durch proaktive Massnahmen gezielt initiiert werden. Gleichzeitig soll die Kooperationsstrategie in die Vision der Unternehmen integriert, die eigenen Kernkompetenzen gestärkt und das betriebsinterne Know-how für Kooperationen auf allen Stufen geschult werden. Im konkreten Kooperationsgeschäft empfiehlt es sich hohe Investitionen in das gemeinsame Kooperationsprojekt einzufordern und gleichzeitig auf alle, ausserhalb der Kooperation liegende Marktleistung mit hoher Ähnlichkeit zur Kooperationsleistung, zu verzichten. In allerletzter Konsequenz bedeutet dies, dass eine dynamische Betrachtung dieses Denkansatzes immer mit dem Ziel der Verschmelzung der Unternehmen initiiert wird, weil in dieser Form die geringsten Transaktionskosten anfallen und die grössten Skaleneffekte realisiert werden können. Gleichzeitig stellt dieser Ansatz ein Paradoxon dar, weil einerseits der Erhalt der Eigenständigkeit die Grundvoraussetzung der Kooperation darstellt und andererseits nur die Verschmelzung der Unternehmen eine hochwertige Vertrauensdisposition beinhaltet.
Berechtigte Kritik über den langfristigen Nutzen von Kooperationen ist ebenfalls angebracht, weil Wettbewerbsverzerrungen durch Nischenmarktbeherrschungen und Preisabsprachen Nachteile über hohe Preise und Innovationsunterlassungen entstehen lassen könnten. Aus gesellschaftspolitischer Sicht sind Kooperationen vorteilhaft für die regionale Standortattraktivität, aus strukturpolitischer Sicht können Kooperationen jedoch Marktentwicklungen behindern.
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Die Konkurrenz steht heute als Gegenpol zur Kooperation im wirtschaftlichen Mittelpunkt. Die Konkurrenzsituation hat sich in den letzten Jahrzehnten exponentiell entwickelt. Hatte IBM 1965 noch 2’500 Wettbewerber in seinen Märkten, so waren es 1992 bereits 50'000. Gemäss einer amerikanischen Studie haben 75 Prozent von 531 Unternehmensleitern ausgesagt, dass der zunehmende ökonomische Druck von Konkurrenten das Hauptmotiv für eine Restrukturierung1 ist (Atkinson, 1994). Neue Studien und Trends aus der Weltwirtschaft zeigen, dass heute neue Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Unternehmen und der Geschäftsbedingungen bestehen (Malmberg, 2001). Diese Trends sind Globalisierung, New Economy, industrielle Revolution und 24/72 -Kommunikation. Die aktuelle Yahoo- Google-Kooperation in der Onlinewerbung und die zahlreichen Unternehmensfusionen der letzten Monate, wie z.B. Mittal-Arcelor zum weltgrössten Stahlproduzenten, sind nach wie vor im Aufwind und dies trotz der aktuellen Verunsicherung auf den Finanzmärkten wegen der US-amerikanischen Hypothekenkrise und den teilweise noch unbekannten Auswirkungen auf die Weltkonjunktur. Die M&A-Transaktionen zeigen eine Tendenz weg von den Konglomeraten hin zur Konzentration auf das Kerngeschäft und die Veräusserung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Sparten (Mathys, 2008). Auffällig sind die hohe Anzahl von horizontalen3 M&A-Transaktionen zur Sicherung von Marktanteilen und der Gewinnung von Umsatzwachstum. Die Globalisierung der Märkte drückt auf die Verlagerung der Wertschöpfungen nach Economy-of-Scope4 - und Economy-of-Scale5 –Entscheidungen und die Supermächte U.S.A, China und Russland zeigen öffentlich Ihre opportunistischen Ambitionen für geopolitische Ressourcensicherung. Im Gegenzug scheitern WTO- Verhandlungen für weniger Schutzzölle und den erleichterten Marktzugang zugunsten der Konsumenten aller Länder. Diese globalisierte Bündelung der Kräfte und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit scheint offensichtlich ein Privileg der Supermächte und der gut vernetzten multinationalen Konzerne zu sein. Kleine und mittlere Unernehmen (KMU) nutzen diese Chancen nicht wie die Grossunternehmen (GU) (Eggers, Kinkel 2005). Die Rahmenbedingungen für Produktion und Handel unterliegen im Zeitalter der Information schnellen Veränderungen in der Weltwirtschaft und immer härter werdenden Produktionsund Handelsbedingungen. „Know-how“, muss in Kombination mit einem ganzheitlichen Marktund Kundenverständnis auf „Know-what“ erweitert und mit einem langfristigen Denkansatz mit „Know-why“ kombiniert werden (Sternberg, 1993). Die Veränderungen in Produktion, Markt und Preis sind insbesondere durch die BRIC6 -Wachstumsmärkte beeinflusst und der produzierende Mittelpunkt Europas wurde nach Osten verschoben (Redley 2006). KMU mit wenig Innovationspotenzial und unklaren Alleinstellungsmerkmalen leiden unter diesen Marktveränderungen. Die Kundenforderungen nach individualisierten Serienprodukten und einer flexiblen Supply Chain verlangen eine leistungsstarke Unternehmensorganisation. Diese Organisationskosten werden durch erhöhte Beschaffungskosten für Rohmaterialien, kürzere Produktelebenszyklen und dem Zwang zu Technologieerschliessungen verstärkt. Als Konsequenz sind die Preise unter Druck, es fehlen Deckungsbeiträge und Liquiditätsengpässe sind ein Dauerzustand. Zudem sind KMU geprägt von strukturellen Nachteilen im Humanund Finanzkapital mit Folgen in der fehlenden strategischen Planung, Zeitengpässen, falschen Aufgaben/Verantwortungen/
Kompetenzen-Strukturen und einer reaktiven ad-hoc-Handlungsweise (Schulz, 2007). Viele dieser Faktoren stehen im direkten Zusammenhang mit der Grösse von KMU und limitieren so ihre Wettbewerbsfähigkeit (Kerste 1998). Aufgrund ihrer begrenzten Kapazitäten können sie keine grossen Aufträge übernehmen und grosse Mengen von standardisierten Produkten zu günstigen Kosten herstellen. In der Folge können die Marktchancen nicht ausgeschöpft werden. Des Weiteren verfügen sie nicht immer über alle notwendigen Spezialkompetenzen die notwendig sind, um neue Aufgaben zu erfüllen. Oder es fehlt das praktische Training für die effektive und effiziente Lösung von unregelmässigen Sonderaufgaben. Hierdurch wird ihre Fähigkeit reduziert, sich den verändernden Marktbedingungen anzupassen. Im Gegensatz zu GU, die über eingespielte und kontrollierte Verbundund Skalenvorteile verfügen. Andererseits haben KMU gegenüber GU Wettbewerbsvorteile wenn es darum geht, mit Flexibilität auf Nachfragebedürfnisse in kleinen Marktnischen zu reagieren (Storey, 1994). Über die Kooperation mit anderen selbstständigen Unternehmen besteht eine Möglichkeit, den Engpass der eigenen Ressourcen zu überwinden, ohne eine kapitalintensive M&A-Transaktion durchführen zu müssen. Mit der Kooperation können KMU externe Ressourcen nutzen und somit ähnliche Ausgangsbedingungen für ihre Wertschöpfung bereitstellen wie grosse GU. Allgemein ausgedrückt ist Kooperation eine Strategie, um die Entwicklung von Unternehmen zu fördern. Es ist bekannt, dass viele KMU keine Wachstumsabsichten haben (Wiklund, 2003) und mit der Grösse ihres Unternehmens und dem erwirtschafteten Einkommen zufrieden sind. Kooperation ist jedoch keine ausschliessliche Strategie für das Wachstum, sondern es können auch andere Arten der Entwicklung gefördert werden wie: Ausweitung der Märkte, Senkung der Risiken, Erhöhung der Gewinne, Einführung neuer Technologien. Wenig genutzt wird die Kooperation auffälligerweise bei konkurrierenden KMU mit hoher Ähnlichkeit im Angebot, Markt und der Organisation, die als direkte Konkurrenten im Wettbewerb stehen (Bouncken, 2007). Andererseits ist die Einschränkung der eigenen Unabhängigkeit ein wichtiger Grund nicht zu kooperieren. In vielen KMU ist es geläufige Praxis, dass eine absolut zentrale, auf den Inhaber fixierte Führungsund Organisationsstruktur beobachtet werden kann: Alle Wege führen zum Chef und der trifft alle Entscheidungen. Solche Strukturen sind nicht kooperationsgeeignet und mitverantwortlich dafür, dass 80 % der mittelständischen Kooperationsversuche scheitern, weil das entsprechende Fachwissen dafür fehlt. Es ist heute nicht ausreichend, zwischen kooperationsgeeignet und kooperationsfähig zu unterscheiden, vielmehr muss hinterfragt werden: Was muss oder kann ein Unternehmen tun, um sich erfolgreich für neue Zusammenarbeitsund Marktstrukturen zu qualifizieren? Wie kann sich ein Unternehmen zukunftsorientiert ausrichten? Welches Umdenken ist gefordert? Welche Hilfen werden benötigt (Harzer, 2006)? Im Gegensatz dazu haben Kooperationen auch Kosten und Risiken. Dazu gehören Transaktionskostennachteile wie: Anbahnungs-, Vereinbarungs-, Integrations-, Kontrollund Anpassungskosten. Dazu kommen Risiken mit Verlusten in der Flexibilität und der Eigenständigkeit oder das Risiko der Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen. Die Nutzung von starken Unternehmen als Partner als strategische Option ergänzt oder erweitert zwar den Handlungsspielraum, aber versetzt das Unternehmen in die Pflicht, ein leistungsstarker und wirtschaftlicher Partner zu sein, um für die Kooperationspartner attraktiv zu bleiben und nicht aus der Kooperation ausgestossen zu werden. Im Bericht der European Network for SME Research (ENSR) vom 2003 wird folgendes festgestellt: 99.8 % der Unternehmen in Europa-197 sind KMU, 69.7 % dieser Unternehmen beschäftigen weniger als 250 Mitarbeitende, sie stellen 69.7 % der Arbeitsplätze bereit und erwirtschaften 75.3 % des Umsatzes im Sektor der privaten Unternehmen (Havens, 2003). Im letzten Jahrzehnt haben sich diese Anteile kaum verändert und somit sind die KMU eine feste Grösse in der Wirtschaft. Grosse Unternehmen haben bei der Massenproduktion klare Vorteile gegenüber den KMU, welche dafür Vorteile in Nischenmärkten und bei geringen Produktionsmengen oder bei Sonderproduktionen haben. KMU können leichter auf Veränderungen in der Nachfrage und der Technologie reagieren, weil sie flexibler sind. In den letzten Jahrzehnten hat der Konkurrenzdruck in vielen sogenannten „sicheren“ Marktnischen von KMU zugenommen. Durch neue Technologien ist es den grossen Unternehmen gelungen, ihre Produkte und Services besser an die individuellen Marktund Kundenbedürfnisse anzupassen als KMU, bei gleichzeitigem Kostenvorteil durch die Massenproduktion. Signifikante Optimierungen in den Vertriebsund Kommunikationssystemen reduzieren die Bedeutung der Distanz als Wettbewerbsnachteil deutlich. In der Folge ist ein globaler Weltmarkt für viele Produkte und Services entstanden. Viele grössere KMU haben unter diesen Bedingungen den Vorteil von Ressourcenverbindungen erkannt und diese Konzepte umgesetzt. Für viele kleine KMU ist so ein Umfeld jedoch sehr verletzend. Trotzdem sind viele KMU in diesen Marktbedingungen sehr erfolgreich und versuchen ihre Unternehmen durch Kooperationen mit anderen Unternehmen zu verbessern (Armin, 1994). Die Partnerschaft mit anderen Unternehmen wird genutzt, um die eigenen, internen Ressourcen und Kompetenzen zu ergänzen oder auch zu addieren. Vor diesem Hintergrund der Entwicklung zeigt sich das Phänomen, dass KMU, insbesondere kleine KMU mit hoher Ähnlichkeit und ohne Möglichkeiten für eine M&A-Transaktion, die Vorteile der Bündelung der Kräfte zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit durch Zeit-, Kosten-, Risikound Ressourcenvorteile über die bekannte und in der Praxis vielfach bewährte Kooperation zuwenig nutzen (Eggers, Kinkel, 2005; Heger 2002; Zink 2002).
1.2 Ziel der Arbeit und die zentrale Fragestellung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Zielsetzung dieser Arbeit besteht darin, einen ganzheitlichen Denkansatz für die Gestaltung von KMU-Kooperationen mit hoher Ähnlichkeit nach dem Ansatz von Coopetition zu formulieren. Dieser Denkansatz soll Antworten zur zentralen Fragestellung liefern und als Handlungsanweisung für KMU dazu führen, dass die Kooperation vermehrt als Entwicklungschance für das eigene Unternehmen systematisch und strukturiert geprüft wird. Um das Thema des Zusammenspiels von Konkurrenz und Kooperation zu verdeutlichen, lassen sich als „warm-up“ vier generelle Hypothesen formulieren, bevor im Anschluss daran die zentrale Fragestellung formuliert wird (Ulrich, 2004). 1) Globalisierung der Märkte: Die Globalisierung hat zur Folge, dass neue internationale Konkurrenten auf die heimischen Arbeitsund Kapitalmärkte drängen, bei gleichzeitigen Chancen für nationale Unternehmungen auf ausländische Märkte zu expandieren. Die neue Konkurrenzfähigkeit zeichnet sich aus durch eine globale Marktpräsenz und eine schnelle Reaktionszeit. Das ist eine Chance mit Kooperationen auf allen Wertschöpfungsstufen auch kulturelle Engpässe und time-to-market8 -Anforderungen umzusetzen. 2) Liberalisierung der Märkte: Der Staat nutzt den Wettbewerb für seine Aufgabenbereiche. Staatliche Bereiche wie die Post, Telekommunikation und die Bundesbahnen sind liberalisiert und es besteht trotz der aktuellen Finanzkrise eine Tendenz zur Entstaatlichung von weiteren Sektoren wie der Bildung und dem Gesundheitswesen. Die Erschliessung dieser neuen Märkte bietet viele neue, bis heute nicht geahnte, Möglichkeiten für die Kooperation. 3) Flexibilisierung: Die Flexibilisierung ist ein strategischer Erfolgsfaktor für Unternehmungen. Die Arbeitswelten sind geprägt von Outsourcingentscheidungen bei einer flexiblen kundenund marktorientierten Massschneiderung von Produkten und Services just-in-time9. Grosse Aufwendungen sind notwendig für die Optimierung der Schnittstellen innerhalb der Unternehmen und extern zur Umwelt. In der Folge entstehen Kooperationen mit dem Ziel der Kostenaufteilung und des Risikosplittings. 4) Individualisierung: Die zunehmende Individualisierung der modernen Gesellschaften führt zu einer veränderten Werteeinstellung. Neu errungene Freiheiten wie Eigenverantwortung, Autonomie und Flexibilität führen zu mehr Selbstverwirklichung. Im Vordergrund steht die persönliche Entwicklung und Karriere, wobei die Unternehmungen als Mittel zum Zweck auf Kosten von weniger Verbindlichkeit und zunehmend zeitlich begrenzten Arbeitsverhältnissen herhalten müssen. Diese Unsicherheiten erschweren die Kooperationschancen in Unternehmen, weil die Mitarbeiter laufend ihre Arbeitsmarktund Beschäftigungsfähigkeit überprüfen. Folglich ist die neue Werteeinstellung ein Hindernis bei der Umsetzung von Kooperationsprojekten, welche oft personalisiert gesteuert werden. Für das weitere Vorgehen lässt sich aus der Zielsetzung dieser Arbeit die folgende zentrale Fragestellung formulieren: „Warum ist das Vertrauen bei KMU-Kooperation mit hoher Ähnlichkeit der kritische Erfolgsfaktor?“
1.3 Forschungsmethodik
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Autor ist ein Praktiker mit fundierten Marketingund Verkaufskompetenzen im Service- Sektor und im verarbeitenden Gewerbe. Seit sechs Jahren ist er als Geschäftsleitungsmitglied bei metallverarbeitenden KMU tätig. Die Thematik der Kooperation ist ein allgegenwärtiges Thema durch seine berufliche Laufbahn. Er hat als Projektleiter einerseits einen Leistungsausweis für erfolgreiche Firmenzusammenschlüsse, die seit vielen Jahren erfolgreich umgesetzt sind. Andererseits hat er negative Erfahrungen in Kooperationsprojekten gesammelt, die seit Jahren in Verhandlungen feststecken. Aufgrund dieser Voraussetzungen wird ein heuristisches10 Forschungsdesign mit der Methodik der empirischen11 Erfahrungswissenschaften angewendet. Die Hypothesenbildung zur Erfahrungsgewinnung wird aufgrund der bestehenden theoretischen Lehre, kombiniert mit den intersubjekten Erfahrungen des Autors, formuliert. Über die anschliessende Datengewinnung und Datenauswertung werden diese Hypothesen in Konfrontation mit den gewonnenen Daten verglichen, um so gesicherte allgemeine Aussagen über die Realität zu gewinnen. Diese Aussagen sollen zur Lösung von individuellen Problemen in der Praxis herhalten können. Als Messlatte für den wissenschaftlichen Fortschritt durch die Erweiterung von gesicherten Daten gilt hierbei nicht der Zuwachs in der Erkenntnissicherung als vielmehr der Zuwachs im Verständnis und der dadurch eventuellen Beherrschung der Realität (Kubicek, 1979).
1.4 Aufbau der Arbeit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im laufenden Kapital 1 wurden die Problematik der Globalisierung und der damit veränderten Produktionsund Handelsbedingungen zu neuen komplexeren Konkurrenzsituationen beschrieben. Als Folge dieser Marktanpassung im Informationszeitalter wurde die Relevanz der Faktoren wie Unternehmensgrösse, Innovationsstärke und Kapitalausstattung als zentrale Erfolgspositionen deklariert. M&A-Transaktionen und Kooperationen sind verbreitete Strategien für die langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmungen. Vor diesem Hintergrund wurde das Phänomen aufgezeigt, dass viele KMU, im Gegensatz zu den GU und trotz den vielen erfolgreichen Meldungen aus der Praxis, die Vorteile von Kooperationen für das Überleben ihrer Unternehmungen nicht in Betracht ziehen oder aber daran scheitern. Insbesondere scheint sich die Kooperationsbereitschaft bei Konkurrenten mit ähnlicher Marktleistung nur schwierig aufbauen zu lassen. In der Folge wurden die Ziele dieser Arbeit formuliert und als Einstimmung zur zentralen Fragestellung, vier generelle Hypothesen zu Konkurrenz und Kooperation dargelegt. Anschliessend wurde das empirische Forschungsdesign für ein Hypothesensystem zur Gewinnung von mehr Verständnis für die Realität deklariert. Im Laufe der Arbeit werden die einzelnen Kapitel gemäss Abbildung 1 behandelt.
Abbildung 1 Aufbau und Struktur der Arbeit (eigene Darstellung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zunächst werden in Kapital 2 der Stand der Forschung zu den Merkmalen von KMU- Kooperationen und den relevanten theoretischen Ansätzen erläutert und somit die Basis für die anschliessende Analyse gelegt. Hauptmerkmale bilden hierbei spieltheoretische, organisationstheoretische und sozi-ökonomische Ansätze. Dazu werden insbesondere die Aspekte für die horizontale Kooperation (Kooperation mit Konkurrenz), die Hindernisse bei Kooperationen und das Phänomen des Vertrauens beschrieben. In Kapital 3 werden mit den Erkenntnissen aus der Theorie und den untersubjektiven Erfahrungen in Auseinandersetzung mit der zentralen Fragestellung, Hypothesen für die nachfolgende empirische Datenerhebung formuliert. Anschliessend werden diese Hypothesen mit den empirischen Daten von einer Umfrage zum Thema KMU-Kooperation beurteilt. Im Mittelpunkt des Kapitels 4 stehen die Ergebnisse, die sich aus der empirischen Überprüfung der Hypothesen ergeben haben. Diese Resultate werden diskutiert und auf deren Wahrheit beurteilt. Den Abschluss der Arbeit im Kapitel 5 bildet eine kritische Auseinandersetzung der Ergebnisse und dieser Arbeit in deren Anwendbarkeit auf ein ganzheitliches Denkmuster in Bezug auf die zentrale Fragestellung.
2 Stand der Forschung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Es bedarf einer theoretischen Fundierung, um eine Diskussion zu formulieren, die es zum Ziel hat, ein ganzheitliches Denkmuster für KMU-Kooperationen zu erläutern. Als Zusammenfassung werden in diesem Kapitel die Merkmale als morphologischer12 Kasten der Merkmalausprägungen mit Gewichtung eines idealtypischen Charakteristikums für eine horizontale KMU-Kooperation dargestellt.
2.1 Merkmale der Kooperation
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Unter Kooperation wird die freiwillige, zwischenbetriebliche Zusammenarbeit von mindestens zwei Unternehmungen unter Wahrung ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Selbstständigkeit verstanden (Eggers, 2005). Die Kooperationsvereinbarung ist die Basis einer zweckorientierten Zusammenarbeit. Angestrebt ist das gemeinsame Erreichen eines oder mehreren übergeordneter und nur gemeinsam erreichbarer Ziele (Harzer, 2006). Eine gängige Definition der betrieblichen Zusammenarbeit in der deutschen Betriebswirtschaftslehre liefert Prof. Dr. Straube. „Zwischenbetriebliche Kooperation liegt vor, wenn zwei oder mehrere Unternehmen freiwillig nach schriftlicher oder mündlicher Vereinbarung innerhalb des von der Rechtsordnung gesetzten Rahmens unter der Voraussetzung zusammenwirken, dass keines von ihnen seine rechtliche und seine wirtschaftliche Selbstständigkeit – abgesehen von Beschränkungen der unternehmerischen Entscheidungsbefugnisse, wie sie für die zwischenbetriebliche Zusammenarbeit notwendig sind – aufgibt oder als Folge der Kooperation verliert und jedes dieses Verhältnis jederzeit sowie ohne ernstliche Gefahr für seine wirtschaftliche Selbstständigkeit lösen kann, und wenn dieses Zusammenwirken für die Unternehmen den Zweck hat, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, zu diesem Zweck eine oder mehrere Unternehmensfunktionen in mehr oder weniger loser Form gemeinsam auszuüben und auf diese Weise ihre Leistungen, Produktivität und Rentabilität zu steigern, damit jeder Teilnehmer für sich einen höheren Nutzen erzielt, als er ihn bei individuellen Vorgehen erreichen könnte“ (Straube, 1974).
Begriffe der Kooperation: Von der Begrifflichkeit her weist die Literatur zur Kooperation vielfältige Ausdrücke auf, die viele Überschneidungen aufweisen. Es sind dies z.B.: Franchising, Strategische Allianz, Konsortium, Interessengemeinschaft, Netzwerk, virtuelle Organisation, Supply-Chain-Network, Hub-and-Spoke-Network, Peer-to-peer-Network, Maschinenring, Value System etc. In dieser Arbeit beschränken wir uns zum Zweck der logischen Argumentation auf die begriffliche Trennung von Joint Ventures, Unternehmensnetzwerken und Kooperationen.
Das Unternehmensnetzwerk spezifiziert sich als eine statisch-strukturelle Verbindung zwischen Unternehmen als eigenständige Wirtschaftseinheiten. Die Arten der Verknüpfung und Schnittstellen zwischen den einzelnen Unternehmen können formeller oder informeller Natur sein. Aus der Sicht der Beziehung lassen sich nach Prof. Jörg Sydow zwei Ebenen unterscheiden: Langfristige, auftragsunabhängige Beziehungen und kurzfristige, auftragsabhängige Beziehungen. Langfristig wird in der Regel eine Vereinbarung getroffen, welche die Verteilung von Akquisitionsund Koordinationsaufgaben oder den Support durch Informationsund Kommunikationssysteme einschliesst. Diese langfristige Beziehung wird genutzt, um kurzfristig einen Auftrag abzuwickeln. Der neu zu konfigurierende, unternehmensübergreifende Wertschöpfungsprozess umfasst eine Menge von Teilprozessen, die intern über die Kooperationspartner oder extern über einen zentralen Akteur koordiniert und ausgeführt wird (Sydow, 2001).
Joint Venture ist ein Gemeinschaftsunternehmen von meistens zwei voneinander unabhängigen Unternehmen, die als neue, rechtlich eigenständige Einheit gegründet wird. Neben der Kapitalbeteiligung bringen die Gründungsfirmen auch Know-how, Schutzrechte, Betriebsanlagen etc. mit ein. Es ist eine Kooperation mit hohem Formalisierungsgrad durch die Zusammenlegung von Funktionen und der damit verbundenen Institutionalisierung. Dies impliziert, dass die Zusammenarbeit der Unternehmen sachlich und zeitlich auf Dauer ausgelegt ist (Hagenhoff, 2004). Joint Ventures haben meistens das Ziel der Erschliessung von Erfolgspotenzialen oder Auslandmärkten (Harzer, 2006). Solche Zusammenarbeiten sind durch das Verfolgen eines gemeinsamen Zieles charakterisiert, welche für die Partnerunternehmen zum Aufbau von Wettbewerbsvorteilen führt. Die Zusammenarbeit schliesst alle Interaktionen ein, die in der Schnittmenge der reinen Markttransaktion und der hierarchischen Koordination betrieblicher Aktivitäten liegen. Das Ziel der Zusammenarbeit ist die prozessorientierte Verknüpfung betrieblicher Aktivitäten zur effektiven Gestaltung der Geschäftsprozesse entlang der interorganisationalen Wertschöpfungskette, zur Erstellung eines am Markt verwertbaren Produktes oder einer am Markt verwertbaren Dienstleistung (Wegehaupt, 2004).
Die Kooperation ist oft auf einige Teilgebiete wie den gemeinsamen Marktauftritt, den Einkauf oder die gemeinsame Nutzung von Ressourcen beschränkt. Gemäss Jörg Sydow (Huber, 2005) ist eine Kooperation eine auf die Umsetzung von Wettbewerbsvorteilen durch ökonomische Aktivitäten zielende Organisationsform, die sich durch komplex-reziproke13 und mehrheitlich kooperative statt kompetitive und eine stabile Beziehung zwischen rechtlich selbstständigen, jedoch wirtschaftlich abhängigen Unternehmungen auszeichnet.
Markt und Hierarchie: Zwischenbetriebliche Kooperationen werden in der betriebswirtschaftlichen Literatur oft als intermediäre14 Koordinationsform auf der Basis zwischen Markt und Hierarchie charakterisiert (Powell, 1990). Von hierarchischen Transaktionsformen unterscheiden sie sich, einerseits aufgrund ihrer geringen Bindungsintensität, weil die in hierarchischen Strukturen eingesetzten Koordinationsinstrumente wie Weisungen, Aufträge und Pläne dominieren, wogegen andererseits in Kooperationen diese schwächer ausgeprägt sind. Die Zusammenarbeit bei zwischenbetrieblichen Kooperationen ist demzufolge weit weniger formalisiert. Des Weiteren unterscheiden sie sich von einer Marktverbindung, einem auf formalisierten Tauschbeziehungen beruhenden Handlungssystem, aufgrund ihrer höheren Bindungsintensität. Kooperationen sind erfolgreich, wenn die Art der zu kooperierenden Tätigkeit stark partnerspezifisch ist und gleichzeitig die Art der verlangten Fähigkeiten zur Erbringung der Leistung sich stark zu den im Unternehmen bereits vorhandenen Fähigkeiten unterscheidet (Weder, 1990). Für die Nutzung dieser gemeinsamen Fähigkeiten wäre eine Internalisierung15 erforderlich, die bei der Abwicklung über den Markt zu hohen Transaktionskosten führen würde. Oder aber eine vollständige Integration in die Unternehmenshierarchie, welche aber ebenfalls hohe Kosten für die Investition und die Integration verursachen würde. Aus diesem Grund bieten sich Kooperationen an, weil hier die niedrigsten Transaktionskosten anfallen. Dies bedeutet, dass für das Eingehen einer längerfristigen Kooperationsbeziehung nicht der Preismechanismus einer rein marktorientierten Koordination ausschlaggebend ist, sondern das Vertrauen zwischen den Beteiligten (Siebert, 1991). Daraus schliesst Prof. Klaus Semlinger, dass Kooperationen in der Lage sind, die Nachteile der marktlichen und hierarchischen Koordination zu überwinden und gleichzeitig Ihre Vorteile miteinander zu verknüpfen (Semlinger, 1993). Durch den Aufbau einer Vertrauensbeziehung werden die negativen Effekte des opportunistischen Verhaltens reduziert. Der Vorteil der hierarchischen Organisation wird genutzt, um die Nachteile von Informationsinseln aufzuheben, indem die externe und interne Kommunikation zentral diskutiert und verbreitet wird. Dieser Vorteil wird gepaart mit den Vorteilen der marktlichen Koordination, welche zwischen den Partnerunternehmen Wettbewerbsbedingungen erfordert und eine Spezialisierung auf ihre Kernkompetenzen erzwingt. Vom Grundprinzip her haben Kooperationen zum Ziel, dass die gemeinsame Leistungsfähigkeit grösser ist als die Summe der Einzelleistungen aller Kooperationspartner, indem Synergieeffekte analysiert und organisatorisch umgesetzt werden. Die Kooperationsbildung ist nur Mittel zum Zweck und nicht das zentrale Motiv für eine solche Entscheidung. Mögliche Gründe für das Eingehen von Kooperationen sind: Zeitvorteile durch schnelle Produkteoder Technologieeinführungen, Risikostreuung bei Investitionen in neue Anlagen, Märkte oder in die Forschung, Ertragssteigerungen durch eine grösse Marktmacht und einen gemeinsamen Marktauftritt, Know-howund Kompetenzgewinn durch gemeinsames Lernen und gemeinsame Innovationen, Kapazitätsauslastungen durch die Regorganisation der gemeinsamen Ressourcen und die Konzentration auf Kernkompetenzen, Verhandlungsdruck über die Kooperation zur Teilnahme von potenziellen Wunschkandidaten als neue Partner, Wettbewerbsfähigkeit steigern gegenüber Konkurrenten und Ressourcenzugang an lukrative Auftraggeber, Arbeit und Kapital. Die Gestaltungsformen der Kooperation können in drei wesentliche Kriterien differenziert werden (Knoblich, 1969): Die Richtung der Kooperation, die Kooperationsintensität respektive die Kooperationsintention und die Kooperationsbereiche.
Richtungen der Kooperation: Horizontale Kooperationen sind gekennzeichnet durch eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen auf der gleichen Wertschöpfungsstufe. Die Produkte oder Dienstleistungen dieser Unternehmen sind sich sehr ähnlich, wenn nicht gar identisch. Die Produktionstechnologie, das Herstellungsverfahren und die Grundfähigkeiten sind ebenfalls oft identisch. Ebenfalls sind solche Unternehmenskooperationen in der gleichen Branche und auch im gleichen Markt und stehen somit als direkte Konkurrenten im Wettbewerb zueinander. Die Zusammenarbeit ist geprägt von einer Bündelung der gemeinsamen Kernkompetenzen, im Sinne einer Addierung der Kräfte und nicht einer Ergänzung der Kräfte. Organisatorisch spezialisieren sich die einzelnen Partner, um das gemeinsame Leistungsspektrum zu erweitern oder die gemeinsamen Produktionsanlagen auszulasten (Hagenhoff, 2004).
Vertikale Kooperationen sind erkennbar durch eine Zusammenarbeit mit spezifischen aufeinander folgenden Einzelleistungen entlang einer bestimmten gemeinsamen Wertschöpfungskette. Die einzelnen Partner ergänzen sich gegenseitig mit Teilleistungen zum Erreichen eines gemeinsamen Zieles. Es besteht eine Zulieferer-Abnehmer- Beziehung.
Diagonale, komplementäre oder interdisziplinäre Kooperationen sind geprägt durch eine branchenübergreifende Zusammenarbeit, wobei sich die jeweiligen Einzeldisziplinen gegenseitig in unterschiedlichen Wertschöpfungsketten ergänzen. Das Ziel der einzelnen Partner ist es, neue Produkte, Dienstleistungen und Märkte gemeinsam zu entwickeln. Die Praxis kennt keine scharfen Grenzen zwischen den einzelnen Kooperationsrichtungen. Der Trend geht hin zu Mischformen der vertikalen und horizontalen Richtungsausprägung zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit (Harzer, 2006)
Die Kooperationsintensität und Kooperationsintention: Anhand der Bindungsintensität der Unternehmungen zueinander lässt sich auf die Bindungsstruktur der Kooperation und folglich auf die Kooperationsform schliessen. Je stärker der rechtliche Verbindungsgrad ausfällt, desto grösser ist die Bindungsintensität. Mit zunehmendem juristischen Verbindungsgrad erhöhen sich darüber hinaus auch der Eigenressourceneinsatz sowie der Partnerressourcenzugriff (Hillig, 1997). Die Intensität der Kooperation kann somit auch anhand der Kriterien Zeithorizont und Formalisierungsgrad beurteilt werden. Kooperationen können in kurzund langfristige Formen der Zusammenarbeit unterteilt werden. Kurzfristige Kooperationen sind zeitlich befristet und beenden meistens mit dem Erreichen eines gemeinsamen Zieles, z.B. gemeinsame Technologieerschliessung, F&E-Projekt, Abwicklung Grossauftrag etc. Langfristige Kooperationen die auf Dauer angelegt sind, können zu Verschmelzungen führen und zeichnen sich dadurch aus, dass die Partner mehrere Aufträge miteinander abwickeln und somit regelmässig in aufeinander abgestimmter Form am Markt agieren. Die Bindungsintensität kann wie folgt von hoch zu tief in vier Stufen unterteilt werden: Erstens, in Kapitalverflechtung durch die Konstitution eines gemeinsamen Unternehmens (Joint Venture), das sich aus herausgelösten Organisationseinheiten der Partner neu zusammensetzt oder eine Verschmelzung bestimmter Organisationseinheiten der Partner darstellt. Zweitens, in Kooperationsverträge die teilnehmenden Partner juristisch binden, ohne dass sie ihre rechtliche Eigenständigkeit aufgeben müssen. Bei langfristigen Verträgen ist die organisatorische Ausgestaltung der Partnerbeziehung zentral, wogegen über den Vertragsinhalt wenig Details definiert werden. Die Konkretisierung erfolgt im Laufe der Zusammenarbeit. Drittens, in kurzfristigen Verträgen ist der Vertragsgegenstand meistens ein Grossauftrag von begrenzter Dauer. Viertens, in nicht vertragliche Vereinbarungen werden meistens ohne Schriftlichkeit per Handschlag beschlossen und entbehren der Gestaltung einer Kooperationsstruktur. Sie können auch als Spielregeln deklariert werden. Diese Verbindungsform gilt als besonderer gegenseitiger Vertrauensbeweis (Wiendahl, 2005). Neben der formalen Bindungsintensität ist auch die inhaltliche Intensität von Bedeutung. Hierbei sind die vier folgenden Ausprägungen beschrieben: Erstens, der Erfahrungsund Informationsaustausch ist die schwächste Form der inhaltlichen Bindungsintensität, wobei dieser Austausch gegenüber einer unverbindlichen Zusammenarbeit, bei der je nach Bedarf gegenseitige Empfehlungen abgegeben werden, was jedoch für die Kooperation nicht konstitutiv ist, bereits einen institutionellen Charakter hat. Zweitens, mit Abstimmung von Aufgaben und Funktionen über regelmässige gemeinsame Workshops werden konkrete Kooperationsgeschäfte koordiniert, wobei jedes Partnerunternehmen seine Kompetenzen einbringt, ohne dass es jedoch zu Kapazitätsanpassungen kommt. Drittens, der Aufbau von neuen Funktionen bedeutet, dass die Unternehmen ihre Kompetenzen und Ressourcenkapazitäten aufeinander anpassen und Doppelspurigkeiten abbauen. Viertens, die Verschmelzung von Aufgaben und Funktionen ist die stärkste Form der inhaltlichen Bindungsintensität, bei der vorher getrennte Einheiten vereint werden, sodass eine spätere Trennung kaum mehr möglich ist. Die Bindungsintention zeigt den Formalisierungsgrad, wie die Partnerunternehmungen die
Beziehung über Aufgaben und Funktionen definieren und auf welche Art dieses miteinander vereinbart wird. Dieses Merkmal zeigt auf, wie schwer oder einfach es ist, die Kooperation wieder aufzulösen oder aus der Kooperation ausbzw. einzutreten (Hagenhoff, 2004).
Die Bereiche der Kooperation: Die Bereiche der Kooperation können einerseits nach der geografischen Verteilung der Kooperationspartner in regionale, nationale und globale Kooperationen erfolgen. Je grösser die Entfernung zwischen den Partnerunternehmen desto grösser werden die Kommunikationsund Transportkosten, während der Konkurrenzdruck, insbesondere bei horizontalen Kooperationen, aufgrund unterschiedlicher Absatzmärkten sinkt (Staudt, 1995). Andererseits zeigt die Unterscheidung durch die Anzahl der in der Kooperation teilnehmenden Unternehmungen, dass die zunehmende Gruppengrösse bei einigen Kooperationsfeldern notwendig ist, damit die kritische Masse zur Realisierung der Kooperationsziele erreicht wird. Nachteilig wirkt sich die grosse Anzahl von Kooperationspartner aber auf die erhöhten Transaktionskosten16 aus wegen steigendem Abstimmungsaufwand (Wiendahl, 2005). Zusätzlich können Kooperationen bezogen auf die gemeinschaftlich durchgeführten Funktionen, also nach der Wertschöpfungsstufe im Lebenszyklus eines Produktes oder Dienstleistung, in nahezu allen betrieblichen Funktionsbereichen17 auftreten.
Zusammenfassend scheinen sich die besprochenen Merkmale für horizontale KMU- Kooperationen als Paradox hinauszustellen. Einerseits ist die Überzeugung vorhanden, dass die benötigte Wettbewerbsfähigkeit über Skalenvorteile nur in einer Zusammenarbeit mit den direkten Konkurrenten erzeugt werden können, andererseits wird versucht über ein komplexes, organisatorisches Koordinationsregelwerk die unternehmerischen Handlungsfreiheit der Partner einzuschränken, um unliebsame Übervorteilungen zu verhindern, weil jegliches Vertrauen durch den jahrelangen Konkurrenzkampf vernichtet wurde und in der Regel keine Gelegenheit vorhanden war, gegenseitige Erfahrungen als Vorbereitung für die anstehende Zusammenarbeit zu sammeln. Die Definition von Kooperation durch Straube ist kritisch zu betrachten, weil einerseits der Ausstieg aus einer Kooperation je nach strategischer Bedeutung des Engagements nicht ohne finanzielle und imageseitige Nachteile erfolgen kann und andererseits die wenigsten Kooperationen in loser Form funktionieren, sondern ganz im Gegenteil durch formale Ausgestaltungen mit hoher Bindungskraft erst anfangen zu funktionieren. Die Risikoabsicherungen aufgrund des fehlenden Vertrauens wirken sich als Kostenfaktoren negativ auf die Kooperationserträge aus, welche zur Messung des Kooperationserfolgs herangezogen werden. Weder betont, dass die Art der verlangten Fähigkeiten zur Erbringung der Leistung stark unterschiedlich zu den im Unternehmen bereits vorhandenen Fähigkeiten sein sollte und impliziert damit, dass horizontale Kooperationen nicht funktionieren. Siebert und Semlinger betonen die Wichtigkeit von gegenseitigem Vertrauen in Kooperationen. Hiermit scheint sich abzuzeichnen, dass das Vertrauen ein kritischer Erfolgsfaktor bei KMU-Kooperationen zu sein scheint. Die Abbildung 2 zeigt die Koordinationsmerkmale zusammenfassend als morphologischer Kasten mit der idealtypischen Ausprägung18 einer horizontalen Kooperation.
Abbildung 2 Morphologischer Kasten (Wiendahl, 2005)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.2 Hindernisse bei Kooperationen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Fachliteratur zu Kooperationen hat sich bisher vor allem mit den Gründen und Faktoren befasst, die für Kooperationen vorteilhaft sind, während die Kooperationshindernisse bislang kaum beleuchtet wurden. Der Aufbau einer Vertrauensbasis zwischen den Unternehmen respektive zwischen den Menschen der Unternehmungen ist unerlässlich (Harzer, 2006). Africa Arino und Yves Doz haben grundlegende Faktoren, die zum Scheitern von Kooperationen führten, über exemplarische Ursachenforschung herausgefunden (Zentes, 2003). Es sind dies: Mangelndes Engagement ohne bindende Verpflichtungen, Wahrnehmungslücken zwischen zu hohen Erwartungen und den bisher erreichten Zielen, mangelhafte Planung und Absprachen, fehlerhafte Kommunikation mit daraus resultierenden Missverständnissen, Misstrauen und Überreaktionen auf Handlungen des Partners. Rolf Bergdoll beschreibt in seinem Handbuch „Baupartner 2000“ (Bergdoll, 2000), dass die gegenseitige offene Kommunikation und der Aufbau und die Pflege des persönlichen Kontakts zentral sind. Als Risiken nennt er: Keine gründliche Vorbereitung und Planung, hemdsärmliger Aktionismus, keine gemeinsame Zielvereinbarung, mangelndes Management der Schnittstellen, mangelnde Kommunikation, fehlende Organisation und Prozessverzögerung. Eine Untersuchung von Bing-Sheng Teng (Zentes, 2003) zeigte, dass viele Kooperationen vom Scheitern bedroht sind, nicht weil einzelne Ursachen alleine verantwortlich sind, sondern weil ein hoher Grad an Instabilität, durch Spannungen zwischen den widerstreitenden Interessen, nicht mit Kompromissen im Gleichgewicht gehalten werden kann. Einerseits hält ein Partner sein Engagement für die Kooperation auf dem Minimum und andererseits besteht die Gefahr bei zu offenem Verhalten, dass eine Ausbeutung stattfindet. Daher kann das Risiko mit Vertragsstrenge reduziert und der Kooperationserfolg gemessen werden. Ein weiteres Risiko sind zu offene hierarchielose Kooperationen, weil das Ziel von maximaler Flexibilität und Schnelligkeit in der Praxis durch absolute Gleichstellung der Partner nicht erfüllt wird, da sich oft unkontrollierte Hierarchien entwickeln. Ebenfalls wird ein häufiger Wechsel der Partnerunternehmen, aber auch des Managements, als Grund für Instabilität der Kooperation und somit als Scheiterungsgrund deklariert (Harzer, 2006).
Die Risiken können grundsätzlich in drei Risikogruppen unterteilt werden: Bei technischen Risiken ist vor allem die Arbeitsteilung problematisch, also die Organisation von Schnittstellen bei Prozessen z.B. bei einer gemeinsamen Wertschöpfungskette oder der Verrechnung von Ressourcen. Hierzu zählen auch eine ungenügende, technologische Kompetenz eines Partners oder Risiken in den Produkten, Prozessen oder Verfahren. Wirtschaftliche Risiken durch wenig transparente Kooperationsprozesse oder eingebrachte Leistungen der Partner sind vom Nutzen-, Kosten-, Zeitund Qualitätsseite her nicht wettbewerbsfähig. Oft ist der Markterfolg abhängig von dem schwächsten Partner in einer Kooperation. Ein weiterer Risikofaktor sind die Verhaltensstrukturen, also die Neigung der Partner, sich mit opportunistischem Verhalten oder mit Informationsasymmetrie zu übervorteilen. Weitere Risiken sind erhöhte Transaktionskosten für die Koordination, Unklarheiten bei der Beitragsund Ergebniszuordnung, die Preisgabe von
Geheimhaltungsfragen und strategischem Know-how, Kontrollverluste respektive erhöhtes Gruppencontrolling, Vernachlässigung der eigenen Strategieentwicklung und negative Einflussnahme durch Dritte. Soziale Risiken entstehen im Zusammenhang mit dem Verhalten aller Beteiligten auf den Stufen Eigentümer, Management und Mitarbeitende. Es besteht das Risiko von Gruppenbildungen innerhalb einer Kooperation, insbesondere bei einer grösseren Kooperation. Auch besteht das Risiko im Management aufgrund von Veränderungsängsten oder Konkurrenzdenken. Diese Führungsprobleme können in Mobbing und Sabotage ausmünden und das Kooperationsvorhaben gefährden. Auch die Mitarbeitenden auf allen Stufen können durch ein sogenanntes Zwei-Klassen-System die Integration des Kooperationspartners behindern und somit das Projekt zum Scheitern bringen. Eine Studie des Instituts19 für Informatik und Gesellschaft der Universität Freiburg D (Eggs, 2000) hat bei Deutschen KMU nach den Scheiterungsgründen in einer Kooperation nachgefragt. Als Hauptgrund wird ein tief verwurzeltes Konkurrenzdenken angeführt. Dies gilt insbesondere für horizontale Kooperationen, in denen letztendlich Konkurrenten miteinander arbeiten. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts20 für Systemund Innovationsforschung (ISI) in Karlsruhe D hat gezeigt, dass mehr als die Hälfte aller Kooperationen von KMU in Deutschland horizontal aufgestellt sind (Harzer, 2006). Des Weiteren wird die Angst vor Machtoder Kontrollverlust angeführt, insbesondere bei personengeführten Organisationen mit einer patriarchalischen Organisationsstruktur. Die Eingliederung und Integration vom Management in einen Kooperationsprozess kann organisatorische und personelle Führungsschwächen aufdecken. Des Weiteren werden interne Zusammenarbeitsprobleme wegen einer falschen überbetrieblichen Organisationsstruktur, ungenügend organisierte Schnittstellen bei den Prozessen sowie einer ungenügenden Information und unklaren Kommunikation deklariert. Ebenfalls wird der Versuch zu opportunistischem Verhalten wieder angeführt. Als weiteren dominanten Grund für das Scheitern von Kooperationen wird die Abhängigkeit von grossen Partnern angeführt. Ungleiche Grössenoder Kompetenzverhältnisse erhöhen die Angst, vom grösseren Partner dominiert zu werden. Die Offenlegung von internen Unternehmensdaten wird als weiteres Risiko deklariert. Klaus Harzer erläutert, dass ihm keine einzige horizontale Kooperation bekannt ist, in der die Partner so viel Vertrauen zueinander entwickelt haben, dass das Management im Sinne eines Benchmarking ihre Unternehmenszahlen austauschte. Dies zeigt, dass ein Risiko vorhanden ist, dass das gemeinsame Lernen und Lehren sowie der Aufbau von gemeinsamem Wissen auf grosse Widerstände stösst. Das Misstrauen der Partner wird ebenfalls erwähnt, weil sich heute die Frage stellt, wie potenzielle Partner zu einer kooperativen Zusammenarbeit zu befähigen sind. Des Weiteren Ängste und Widerstände der Mitarbeitenden wegen Veränderung und Verlust von Privilegien erwähnt. Ein weiteres Risiko ist der Zeitfaktor für die kulturelle Strukturanpassung der Unternehmen bis ein harmonisches und somit effizientes Zusammenleben im Unternehmen und der Auftritt nach aussen kongruent sind. In diesem Zusammenhang wird auch das Risiko des Identitätsverlustes genannt, insbesondere bei Unternehmungen welche bereits eine Markenstrategie betrieben haben und sich innerhalb der Kooperation einer neuen gemeinsamen Dachmarke unterordnen müssen, weil ein gemeinsamer Marktauftritt oft ein zentraler Kostenfaktor in Kooperationen darstellt. Der Verlust von Kernkompetenzen wird ebenfalls als Risiko erwähnt, wobei bei Kooperationen eine eigentliche Konzentration auf die Kernkompetenzen anstrebt. Vielmehr besteht die Angst, durch die neue Rolle als Komplementär und nicht mehr als Komplettanbieter eines verwertbaren Produktes oder Dienstleistung, an Handlungsfähigkeit einzubüssen respektive die Abhängigkeit von den Kooperationspartnern zu erhöhen (Harzer, 2006).
Zusammenfassend zeigen die beschriebenen Kooperationshindernisse, dass die Dominanz von Vertrauen, wie bei den Kooperationsmerkmalen in vorherigen Abschnitt, eine zentrale Rolle zum Gelingen einer Kooperation einnimmt. Neben den leistungsbezogenen und organisatorischen Voraussetzungen der kooperierenden Unternehmen, wie Alleinstellungsmerkmale, Kernkompetenzen, Führungsstrukturen und Managementkenntnisse und einem wirtschaftlichen Erfolgsausweis, müssen sie bereit sein, sich in ein wenig bis gar nicht messbares Abenteuer mit wenig Risikominimierung zu stürzen, dass nur eine Gewissheit hat, dass ein Misslingen finanzielle und imageseitige Nachteile für das eigene Unternehmen mit sich bringt. Vor diesem Hintergrund kann angenommen werden, dass die Anzahl von potenziellen, erfolgversprechenden Kandidaten für eine KMU-Kooperation sehr beschränkt ist. Insbesondere schwierig scheint die effektive Evaluation eines geeigneten Partners in der Praxis zu sein, weil für diese Geschäfte nur wenige Marktplätze existieren. Die Schwierigkeiten der Vertrauensdisposition zeigt sich darin, dass gemäss der Studie vom ISI bei mehr als der Hälfte aller KMU-Kooperationen in Deutschland, horizontale Kooperationen durchgeführt wurden und gleichzeitig stellt Harzer fest, dass ihm persönlich keine einzige horizontale KMU-Kooperation bekannt ist, welche das Vertrauen entwickeln konnte um eine „open-book-policy“ umzusetzen.
2.3 Theoretische Erklärungsansätze
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im vorangegangenen Abschnitt wurden die Merkmale von KMU-Kooperationen und die Kooperationshindernisse erläutert und kritisiert. Im Folgenden werden Theorieansätze zur Erklärung von KMU-Kooperationen vorgestellt und beurteilt. Der Erklärungsgehalt der theoretischen Ansätze wird dabei auf die Möglichkeit geprüft, Antworten zur zentralen Fragestellung zu erhalten.
Transaktionskostentheorie: Als Begründer der Transaktionskostentheorie gilt der Nobelpreisträger Ronald Coase21, der 1937 den Aufsatz „The Nature of the Firm“ veröffentlichte. In dem Aufsatz geht er der Frage nach, warum Unternehmen neben Märkten existieren, also warum nicht die gesamte Produktion von einer einzigen Unternehmung realisiert wird (Coase, 1937). Die Transaktionskostentheorie ist die Basis der neuen Institutionenökonomie22, die aus der neoklassischen Theorietradition hervorgegangen ist und sich mit den Kosten ökonomischer Koordination beschäftigt. Der Transaktionskostenansatz umschliesst die vielfältigen Austauschbeziehungen zwischen Wirtschaftssubjekten. Es geht jedoch nicht um den eigentlichen Warenoder Leistungsaustausch, sondern um die ihn begleitenden Übertragungen dieser Verfügungsrechte an Objekten, sogenannte Property Rights. Die Transaktionskosten sind somit die addierten Kosten, die bei der Bestimmung, dem Austausch, der Überwachung und der Übertragung von Property Rights entstehen (Wegehaupt, 2004). Der Wert eines Gutes bestimmt sich aus ökonomischer Sicht nämlich nicht nur aus dessen Substanz (was ist es), sondern vor allem daraus, was man mit dem Gut anfangen kann (was darf ich damit machen). Die Effizienz von Transaktionen ist ein wichtiger ökonomischer Treiber, weil der sparsame Einsatz von knappen Ressourcen im Vordergrund steht. Transaktionen entstehen nicht nur bei der Erstellung des Tauschgutes oder einer Dienstleistung, sondern auch für die Abwicklung und Organisation des Austauschs. Oliver Williamson23, nach dem Theoriegeber Ronald Coase, der wichtigste Vertreter der Transaktionskostentheorie differenziert noch weiter zwischen exante24 Transaktionskosten, wie etwa Informations-, Verhandlungsund Vertragskosten, also Kosten die vor dem Vertragsabschluss anfallen, und ex-post25 Transaktionskosten, die bei der Durchsetzung und nachträglichen Vertragsanpassungen anfallen können. Transaktionen gelten dann als effizient, wenn die Akteure eine Organisationsform wählen, die in der Summe die geringsten Produktionsund Transaktionskosten aufweisen (Richter, 2003). Die Transaktionskosten dienen als Beurteilungskriterium für die verschiedensten Transaktionsprobleme. Damit kann erklärt werden, warum ökonomische Leistungsbeziehungen durch unterschiedliche Koordinationsformen abgewickelt werden. Williamson erklärt die Koordinationsformen in einfacher Weise anhand des Markt- Hierarchie-Paradigmas. Im Zentrum der Betrachtungen stehen die Eigenschaften der Transaktionspartner, die Transaktionsobjekte und die Transaktionssituation. Hierbei werden personale und situative Transaktionsbedingungen gegenübergestellt und deren Wirkung auf die Höhe der Transaktionskosten beleuchtet. Zu den personalen Transaktionsbedingungen gehören die Verhaltensannahmen der begrenzten Rationalität und das opportunistische Verhalten von Individuen. Bei den situativen Transaktionsbedingungen werden dagegen die Umweltfaktoren, Unsicherheit, Komplexität und Spezifität beleuchtet. Die erste Annahme nimmt an, dass Wirtschaftssubjekte im Sinne von Herbert Simon26 durch begrenzte Rationalität gekennzeichnet sind. Der Akteur möchte zwar rational handeln, ist aber aufgrund seiner begrenzten Möglichkeiten zur Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung dazu nur teilweise in der Lage. Zusätzlich können kommunikative Schwierigkeiten entstehen, weil sich unzulängliche Beschreibungen von Sachverhalten in Sprache oder Text als Problem erweisen, wenn die Grenzen der menschlichen Rationalität erreicht werden. Diese begrenzte Rationalität führt dazu, dass nicht alle Einflussfaktoren und Lösungschancen eines Entscheidungsproblems berücksichtigt werden können. Dies trifft insbesondere zu, wenn die Umwelt als unsicher und komplex angesehen werden muss. Die zweite Annahme über das individuelle Verhalten von Akteuren beschreibt die Neigung des Akteurs, seinen eigenen Vorteil auch zu Lasten des Vertragspartners zu maximieren, auch wenn dabei der Vertragspartner vorsätzlich getäuscht wird oder gegen soziale Normen und die Moral verstossen wird. Dieses Verhalten wird als Opportunismus bezeichnet und unterscheidet sich in der Auffassung von der neoklassischen Theorie insofern, weil diese nur die Maximierung der Eigeninteressen unterstellt. Opportunistisches Verhalten führt zu erhöhten Transaktionskosten. Es spielt dabei keine Rolle, ob tatsächlich ein opportunistisches Verhalten vollzogen worden ist. Entscheidend ist, dass die Möglichkeit für opportunistisches Verhalten besteht. Weil das Verhalten des Transaktionspartners nicht eingeschätzt werden kann, ist grundsätzlich von dieser Möglichkeit auszugehen. Aus diesem Grund wird versucht, mit vor– und nachvertraglichen Regelungen, die potenzielle Gefahr opportunistischen Verhaltens auszuschalten. Diese Vorkehrungen verursachen wiederum Transaktionskosten. Opportunistisches Verhalten wird dann zum Problem, wenn gleichzeitig die Spezifität als Umweltfaktor gegeben ist. Falls keine transaktionsspezifischen Investitionen getätigt wurden oder die Anzahl der Transaktionspartner nicht beschränkt ist, kann bei opportunistischem Verhalten der Vertragspartner gewechselt werden (Williamson, 1975). Die beschriebenen „Human Factors“ Rationalität und Opportunismus sind die Voraussetzungen für das Entstehen von Transaktionskosten. In dem Konzept der begrenzten Rationalität nach Herbert Simon wird davon ausgegangen, dass Menschen nicht die Möglichkeiten besitzen, einen „perfekten“ Vertrag abzuschliessen, weil sie nur beschränkte kognitive Fähigkeiten besitzen, also nur unvollständig Informationen aufnehmen, speichern und verarbeiten können (Keller, 2004). Zusätzlich wird die begrenzte Rationalität durch die Schwierigkeit der kommunikativen Übermittlung von Wissen verstärkt. Williamson spricht in diesem Zusammenhang von „language limits“ (Williamson, 1975). Erst in Verbindung mit Umweltfaktoren führen sie zu einem Versagen der klassischen marktlichen Koordinationsmechanismen.
Es werden drei Formen von opportunistischem Verhalten unterschieden: Qualitätsunsicherheit (Cheating) ist eine ex-ante anfallende Informationsasymmetrie bei der Anbahnung eines Austauschverhältnisses von Leistung und Gegenleistung. Diese kann qualitativ als auch quantitativ sein. Die Leistungsverweigerung (Hold-up) resultiert entweder aus der zeitversetzten Leistungserbringung, sodass über die Leistungsabgabe neu verhandelt werden kann oder aus einer grundlegenden Interaktionsbedingungen wegen Umweltveränderungen. Im Unterschied zur Qualitätsunsicherheit haben die Akteure wegen Vorleistungen oder anderen Investitionen keine Wahl zu bestimmen, mit wem sie agieren. Es besteht eine einseitige Abhängigkeit. Die Angst vor der opportunistischen Ausnutzung einer Hold-up-Situation kann gegenseitig vorteilhafte Kooperationen bereits in der Anbahnung verhindern. Die Leistungszurückhaltung (Shirking, Moral Hazard) ist eine expost anfallende Informationsasymmetrie, die erst im Verlauf der Interaktionsbeziehung auftritt. Das Problem ist, dass das Anstrengungsniveau eines Akteurs nicht beurteilt werden kann, weil ein Verhandlungsspielraum besteht. Weder das Verhalten noch das Verhaltensergebnis lassen eindeutige Rückschlüsse zu. Shirking ist insbesondere für die Leistungsvergütung in der Hierarchie problematisch, weil hier oft der Input zur Leistungsbewertung führt und unbeobachtetes Verhalten, das den Output mindert, straffrei bleibt (Ripperger, 1998).
[...]
1 Restrukturierung, Umstrukturierung oder Turnaround ist ein Vorgang hauptsächlich in Wirtschaftsunternehmen oder Instutitionen, um die aktuellen Geschäftsprozesse und betrieblichen Strukturen neu zu gestalten, meistens mit dem Ziel, das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu verbessern, http://de.wikipedia.org/wiki/Restrukturierung, (Stand: 10.8.2008).
2 Die Abkürzung 24/7 bezeichnet die ständige Bereitschaft bzw. Verfügbarkeit einer Dienstleistung oder seltener die Fähigkeit zum Dauerbetrieb eines Gerätes oder einer Maschine. Die Abkürzung steht für 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche – schlicht immer um die Uhr. Der Begriff stammt aus den USA und ist mittlerweile in fast allen Ländern verbreitet, die der angloamerikanischen Kultur nahe stehen. http://de.wikipedia.org/wiki/24/7, (Stand: 10.8.2008).
3 Horizontale Kooperation steht für die Partnerschaft von Unternehmen auf der gleichen Wertschöpfungsstufe, die in der Regel im gleichen Markt mit einem ähnlichen Angebot im Wettbewerb stehen. Die Kräfte werden hierbei nicht ergänzt, sondern mehr addiert (Harzer, 2006). Wie sie gewinnbringend Kooperationen schmieden, S. 37.
4 Von Economies-of-Scope (deutsch „Verbundvorteile“) spricht man, wenn ein Unternehmen mehrere Güter günstiger zu produzieren vermag als andere Firmen, welche nur eines dieser Güter herstellen. Das heisst, es ist billiger diese Güter in derselben Firma zu produzieren, als sich auf nur eines dieser Güter zu spezialisieren. http://www.vernunftschweiz.ch/glossar/262/Economies+of+Scope+.html, (Stand: 10.8.2008).
5 Von Economies-of-Scale (deutsch "Skalenerträgen") spricht man, wenn die Produktionskosten pro hergestellte Einheit mit zunehmender Produktionsmenge abnehmen. Die tieferen Kosten werden durch Effizienzgewinne erzielt, welche sich erst durch grössere Mengen rentieren. So ist eine vollautomatische Produktion erst ab einer gewissen Menge rentabel, davor muss das Produkt z.B. von Hand gefertigt werden, was weniger effizient ist. Weiter hat der Hersteller mehr Marktmacht gegenüber seinen Zulieferern, wenn er mehr produziert und so zu günstigeren Preisen einkaufen kann. http://www.vernunftschweiz.ch/glossar/260/Economies+of+Scale+.html, (Stand: 10.8.2008).
6 Die Abkürzung BRIC steht für die Anfangsbuchstaben der vier Staaten: Brasilien, Russland, Indien und China. Sie wurde vom Goldman Sachs-Chefvolkswirt Jim O'Neill im Jahre 2003 geprägt. Von ihm stammt auch die Idee der Next Eleven als "Nachfolger" der BRIC-Staaten. Diese vier Staaten, drei von ihnen so genannte Schwellenländer, haben jährliche Zuwachsraten der Wirtschaftsleistung von 5 bis 10 % (zum Vergleich: EU etwa 2 %), weshalb einige Prognosen voraussagen, dass sie bis 2050 die G8-Staaten überflügeln könnten. Damit würde die 'westliche Welt', also Europa und Nordamerika, erstmals seit etwa fünf Jahrhunderten ihre dominierende Stellung in der Weltwirtschaft verlieren. http://de.wikipedia.org/wiki/BRIC-Staaten, (Stand: 11.10.2008).
7 Der Ausdruck Europa-19 stammt aus dem Bericht „Beobachtungsnetz der europäischen KMU“. KMU und Kooperationen. (2003), Nr 5. Es handelt sich um die 18 Länger im Europäischen Wirtschaftsraum mit zusätzlich der Schweiz. (Havnes, Per- Anders und Hauge E. (2003). Beobachtungsnetz der europäischen KMU. KMU und Kooperationen. Nr. 5, S. 9).
8 Unter dem Begriff time to market (TTM, Vorlaufzeit, Produkteinführungszeit) versteht man die Zeitdauer von der Produktentwicklung bis zur Platzierung des Produkts am Markt. In dieser Zeit entstehen für das Produkt Kosten, es erwirtschaftet aber keinen Umsatz. Eine sehr kurze Time-to-market ergibt insbesondere bei Produkten mit kurzem Produktlebenszyklus wie beispielsweise bei Produkten der Hochtechnologie einen Wettbewerbsvorteil, weil der Hersteller dann das Produkt als erster auf den Markt bringt und von den hohen Preisen profitiert, die Early Adopter zu zahlen bereit sind, und auch noch keine Mitbewerber den Preis unterbieten können. http://www.crmmanager.de/ressourcen/glossar_359_ttm_time_to_market.html, (Stand: 10.8.2008).
9 Just-in-time wurde erstmalig bei Toyota Motor Corp. zur Umlaufreduzierung und zum Ausschalten von Verschwendung eingesetzt. Das zugrundeliegende Prinzip heißt Anlieferung der im Fertigungsprozess benötigten Teile zur richtigen Zeit. Im engsten Sinn eine Ausführungsmethode, um ein Minimum an Bestand zu halten, indem man genau zu dem Zeitpunkt anliefern lässt, wenn ein Teil im Betriebsablauf benötigt wird. Im weiteren Sinn bezieht sie sich auf alle Aktivitäten der Fertigung und des Einkaufs, bei denen eine 'Just-in-time'-Materialbewegung möglich ist, wobei das Endziel auch eine Eliminierung von nicht werterhöhenden Arbeitsgängen/Handlungen ist. http://www.quality.de/lexikon/just-in-time.htm, (Stand: 10.8.2008).
10 Heuristik (griechisch, „finden“) die, Lehre von der methodischen Gewinnung neuer Erkenntnisse mithilfe von Denkmodellen, Analogien, Gedankenexperimenten; im Unterschied zur Logik, welche lehrt, sie zu begründen. http://lexikon.meyers.de/meyers/Heuristik, (Stand: 10.8.2008).
11 empirisch (griechisch-lateinisch, „erfahrungsgemäss“) aus der Erfahrung, Beobachtung (erwachsen); dem Experiment entnommen. http://lexikon.meyers.de/meyers/Empirisch, (Stand: 10.8.2008).
12 Die morphologische Methode ist eine systematische Strukturanalyse mit dem Ziel, neue Kombinationen zu finden. Die bekannteste morphologische Technik ist der von dem Schweizer Physiker F. Zwicky (1898 – 1974) entwickelte morphologische Kasten. In zweidimensionaler Verwendung spricht man von „Morphologischer Matrix“. http://www.ibim.de/techniken/3-3.htm, (Stand: 1.9.2008).
13 In der Soziologie bedeutet der Begriff Gegenseitigkeit, auch Prinzip der Gegenseitigkeit genannt, und stellt ein Grundprinzip menschlichen Handelns dar. Menschen sind voneinander gegenseitig abhängig, Reziprozität gehört sogar zu einer Bedingung
des Menschwerdens selbst. Durch Gegenseitigkeit entstehen Beziehungen und Vertrauen. http://de.wikipedia.org/wiki/Reziprozit%C3%A4t_%28Soziologie%29, (Stand: 12.8.2008).
14 Intermediär (lateinisch „der dazwischenliegende“) steht für in der Wirtschaft für ein Vermittler verschiedener Akteure. http://de.wikipedia.org/wiki/Intermedi%C3%A4r, (Stand: 11.8.2008).
15 Das Wort Internalisierung (lateinisch „innen befindlich“) steht für die Zurechnung externer Effekte (Kosten) auf den Verursacher. http://de.wikipedia.org/wiki/Internalisierung, (Stand: 11.8.2008).
16 Transaktionskosten sind diejenigen Kosten, die durch die Benutzung des Marktes (market transaction costs), also im Zusammenhang mit der Transaktion von Verfügungsrechten (z.B. Kauf, Verkauf, Miete), oder einer innerbetrieblichen Hierarchie (managerial transaction costs) entstehen. http://de.wikipedia.org/wiki/Transaktionskosten, (Stand: 1.9.2008).
17 Siehe Aufzählung der verschiedenen Teilbereiche im Anhang.
18 Siehe die Beschreibung der Merkmale im morphologischen Kasten im Anhang A.
19 Universität Freiburg: Die Motive für die zukunftsträchtige Gründung des IIF an einer der ältesten Universitäten Deutschlands waren vielfältig. Neben der Erweiterung des Fächerkanons, zielte sie auf die strukturelle Modernisierung von Forschung und Lehre innerhalb der Hochschule und auf die engere Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in der Region. http://www.informatik.uni-freiburg.de/institut, (Stand: 13.9.2008).
20 Die Fraunhofer-Gesellschaft ist die führende Organisation für angewandte Forschung in Europa. Mehr als 80 Forschungseinrichtungen, davon 56 Fraunhofer-Institute an 40 Standorten in ganz Deutschland; 13 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überwiegend mit naturoder ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung ; 1,3 Milliarden Euro Forschungsvolumen jährlich, davon mehr als 1 Mrd € im Leistungsbereich Vertragsforschung; 2/3 dieses Leistungsbereichs werden mit Aufträgen aus der Industrie und mit öffentlich finanzierten Forschungsprojekten erwirtschaftet; 1/3 wird von Bund und Ländern als Grundfinanzierung beigesteuert; Internationale Zusammenarbeit durch Niederlassungen in Europa, USA, Asien und im Nahen Osten. http://www.fraunhofer.de/ueberuns/index.jsp, (Stand: 13.9.2008).
21 Ronald Harry Coase ist ein britischer Wirtschaftswissenschaftler. Er erhielt 1991 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften für seine Entdeckung und Klärung der Bedeutung der sogenannten Transaktionskosten und der Verfügungsrechte für die institutionelle Struktur und das Funktionieren der Wirtschaft (Coase-Theorem). http://de.wikipedia.org/wiki/Ronald_Coase, (Stand: 1.9.2008).
22 Die neue Institutionenökonomik ist eine neuere Forschungsrichtung der Volkswirtschaftslehre, die eine Reihe unterschiedlicher Erklärungsansätze zur Entstehung, Funktionsweise, Wirkung und Wandlung von Institutionen (Gesamtgesellschaft, Unternehmen, Verbände, Märkte, aber auch rechtliche Normen, Gesetze oder Verträge) umfasst und im Gegensatz zum Institutionalismus auf das analytische Instrumentarium der Neoklassik zurückgreift. Zum Kern gehören drei Konzeptionen: die Theorie der Transaktionskosten, die Theorie der Eigentumsrechte und die Principal-Agent-Theorie. http://lexikon.meyers.de/meyers/Institutionen%C3%B6konomik, (Stand: 2.9.2008).
23 Oliver E. Williamson ist ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler. Bekannt wurde er als Institutionenökonom, der sich vor allem mit der Transaktionskostenökonomie beschäftigt. http://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_E._Williamson, (Stand: 1.9.2008).
24 Ex-ante (lateinisch „zuvor“ oder "aus früherer Sicht“). http://de.wikipedia.org/wiki/Ex_ante, (Stand: 1.9.2008).
25 Ex-post (lateinisch "hinterher" oder "aus späterer Sicht"). http://de.wikipedia.org/wiki/Ex_post, (Stand: 1.9.2008).
26 Herbert A. Simon war einer der einflussreichsten Sozialwissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 1978 erhielt er den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften „für seine bahnbrechende Erforschung der Entscheidungsprozesse in Wirtschaftsorganisationen“. http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Simon, (Stand: 3.9.2008).
- Arbeit zitieren
- Executive Master FH Roland S. Wagner (Autor:in), 2008, KMU-Kooperationen. Coopetition als Unternehmensstrategie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118239
Kostenlos Autor werden
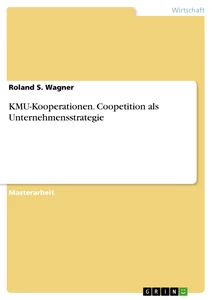

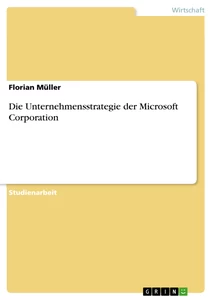


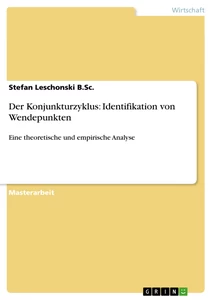
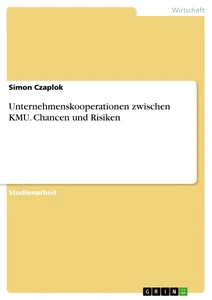





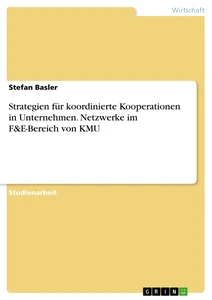







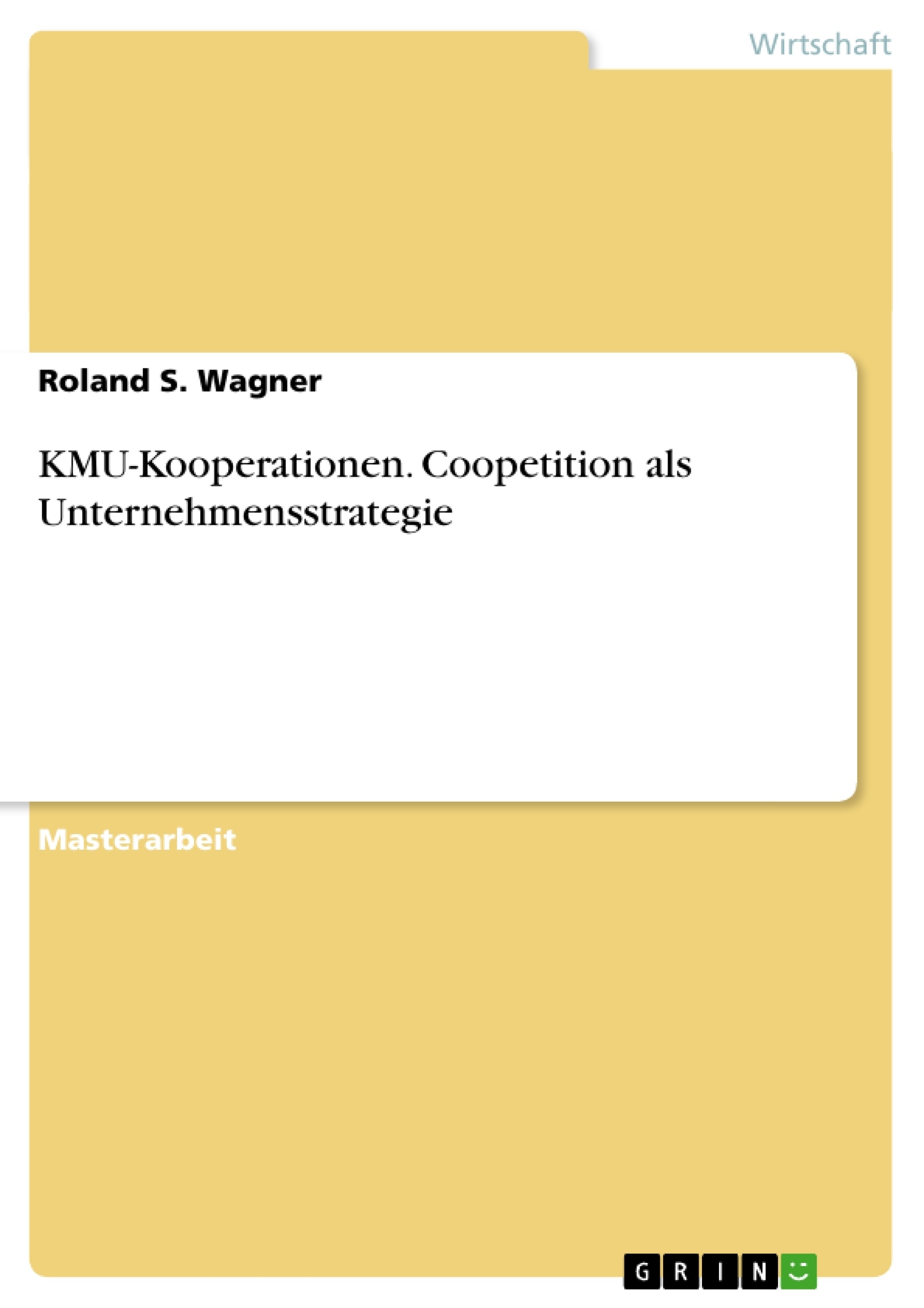

Kommentare