Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Theoretische Ansätze zum Kinderspiel
Vorüberlegungen zu den Ansätzen
1.1. Das Kinderspiel aus einer motivationspsychologischen Perspektive
1.2. Das Kinderspiel aus einer interaktionistischen Perspektive
1.3. Das Kinderspiel aus einer psychoanalytischen Perspektive
1.4. Das Kinderspiel aus einer ökopsychischen und sozialkulturellen
Perspektive
Zusammenfassung
2. Die Entwicklung des Kinderspiels
Die Klassifikation der Kinderspiele nach Einsiedler
2.1. Die psychomotorischen Spiele
2.1.1. Beschreibung und Definition der psychomotorischen Spiele
2.1.2. Entwicklung des Spielverhaltens von Kindern bei psychomotorischen Spielen
2.1.2. Funktionen der psychomotorischen Spiele
2.2. Die Phantasie – und Rollenspiele
2.2.1. Beschreibung und Definition der Phantasie – und Rollenspiele
2.2.2. Entwicklung des Spielverhaltens von Kindern bei Phantasie – und Rollenspielen
2.2.3. Funktionen der Phantasie – und Rollenspiele
2.3. Die Bauspiele
2.3.1. Beschreibung und Definition der Bauspiele
2.3.2. Entwicklung des Spielverhaltens von Kindern bei Bauspielen
2.3.3. Funktionen der Bauspiele
2.4. Die Regelspiele
2.4.1. Beschreibung und Definition der Regelspiele
2.4.2. Entwicklung des Spielverhaltens von Kindern bei Regelspielen
2.4.3. Funktionen der Regelspiele
Fazit : Bedeutung des Kinderspiels aus entwicklungspsychologischer und sozialisationstheoretischer Sicht und aus der Perspektive von Kindern
3. Spielen pädagogisch fördern und initiieren
Einführung in die Spielpädagogik
3.1. Aufgabenbereiche der Spielpädagogik
3.2. Voraussetzung für das Kinderspiel
3.2.1. Schaffung und Belebung von ökologischen Spielräumen
3.2.2. Beurteilung und Empfehlung von Spielmitteln
3.3. Spielpädagogische Planung, Durchführung und Reflexion von Regelspielen in Gruppen
3.3.1. Spieldidaktik und Spielmethodik
3.3.2. Geländespiel „Outback“ – ein Beispiel
3.3.3. Spielpraxisbezogene Prinzipien bei der Leitung von Spielgruppen
Schlussgedanken
Literaturverzeichnis
Outback Quiz – die Lösungen
Einleitung
In dieser Diplomarbeit beschäftige ich mich mit dem Kinderspiel. Mein Interesse dafür entstand zu Anfang meines Pädagogikstudiums im Oktober 1996. Damals sah ich kurz vor Beginn meines ersten Semesters in der philosophischen Fakultät einen Aushang der Jugendförderung Kirchhain, die eine Honorarkraft für ihren „Spielepool“ suchten. Da ich neben dem Studium pädagogisch tätig sein wollte und mich die Ausschreibung der Jugendförderung ansprach, erkundigte ich mich dort hinsichtlich der Mitarbeit als Spielpool – Betreuer. Ich vereinbarte telefonisch einen Termin mit dem Stadtjugendpfleger und wurde von ihm einige Wochen später zu einem Treffen ins Jugendkulturzentrum in Kirchhain eingeladen. Bei diesem Treffen zeigte er mir den „Spielepool“, der aus einer Sammlung von über 150 Tisch-, Brett- und Kartenspielen bestand. Er erklärte mir, dass die Aufgabe des künftigen, nebenamtlichen Mitarbeiters darin bestand, mit den im Stadtjugendring angeschlossenen Jugendgruppen und den Jugendklubs Spielnachmittage, bzw. Spielabende zu veranstalten, sowie die Ausleihe der Spiele zu verwalten. Ich zeigte Interesse an dieser Arbeit und bekam die Zusage für den Job. In den folgenden Monaten stellte sich jedoch heraus, dass das Spielangebot bei den Jugendgruppen nur geringe Resonanz fand. Daher beschloss die Jugendförderung, Spielnachmittage für Kinder im Jugendkulturzentrum anzubieten. Es entstand der „Spieleladen“, der Spielenachmittag für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Dieses Angebot hielt sich lange als Dauerprogramm des Spielepools, das ich insgesamt 3 ½ Jahre machte. Als Spielebetreuer führte ich im Laufe der Zeit auch verschiedene Sonderveranstaltungen durch, darunter die Siedler – Turniere und die Kirch-hainer Kinderspielejury – Testtage. Die Idee zur Kinderspielejury kam mir, als ich bemerkte, dass einige neue, von Erwachsenen empfohlene Gesellschaftsspiele, die wir jährlich für den Spielepool anschafften, unseren Kindern keinen Spaß bereiteten. Deshalb luden wir Kinder aus Kirchhain und den Stadtteilen ein, neue Brett – und Kartenspiele selbst auszuprobieren und anschließend zu bewerten. Die benötigten Spiele liehen wir zunächst von einem Spielwarengeschäft aus. Anschließend kauften wir die beliebtesten Spiele ein. Die Kinderspielejury war zugleich der Vorläufer der im Jahr 2000 entstandenen Kinderspielecrew, in der Kinder an verschiedenen Orten im deutschsprachigen Raum zusammenkommen, um Gesellschaftsspiele zu testen. Gemeinsam mit Freunden, die ich über das Internet kennen lernte und die sich beruflich und / oder privat mit dem Spielen von Kindern beschäftigten, entwickelte ich das Konzept der Kinderspielecrew.
Über das Internet fand ich darüber hinaus Kinder – und Jugendzentren, Vereine, Ludotheken und Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die bereit waren als Testgruppen mitzumachen. Zudem bekam ich Unterstützung von Spielverlagen, die einige Exemplare ihrer neuen Brett – und Kartenspiele sponserten (vgl. Abschnitt 3.2.2.). Seit Februar 1999 leite ich im Kirchhainer Jugendzentrum die Kindergruppe „@benteuer am Computer“, in deren Veranstaltungen Computerspiele angeboten werden, wie z.B. Fünf Freunde oder TKKG (vgl. Abschnitt 3.2.2.). Außerdem bin ich seit 1998 in den Sommerferien freier Mitarbeiter der Jugendförderung Marburg und wirke dort u.a. beim Spielmobil mit. Für die Spielmobilaktion entwickle ich jährlich ein Geländespiel (vgl. Abschnitt 3.3.2.).
Da ich neben dem Studium in Jugendeinrichtungen als Betreuer beschäftigt war, bzw. immer noch bin, ich die Kinderspielecrew leite und mir die (spiel)pädagogische Arbeit mit Kindern Spaß macht, entschloss ich mich, meine Diplomarbeit über das Kinderspiel zu schreiben.
Das Kinderspiel ist meiner Einschätzung nach ein sehr umfangreiches und komplexes Thema, das man in einer Diplomarbeit nicht erschöpfend behandeln kann. Daher überlegte ich mir diese Leitfrage für mein literarisches Werk :
Welche Funktionen hat das Kinderspiel, und wie kann es spielpädagogisch gefördert
und initiiert werden?
Hinsichtlich der Funktionen des Kinderspiels wollte ich herausfinden, welche Wirkungen das Kinderspiel aus entwicklungspsychologischer sowie aus sozialisationstheoretischer Sicht hat, und was Spielen für Kinder selbst bedeutet. Meines Erachtens warf die Betrachtung von Funktionen des Kinderspiels aber weitere zu berücksichtigende Fragen auf. Ich fand, dass ich auch erörtern müsste, welche Merkmale für das Kinderspiel charakteristisch sind, welche verschiedenen Typen von Kinderspiel existieren, welche Rahmenbedingungen das Kinderspiel ermöglichen, wie Kinder spielen, und wie sich ihr Spielverhalten verändert, wenn sie älter werden.
In Bezug auf spielpädagogische Förderung und Initiierung des Kinderspiels wollte ich untersuchen, wie man Voraussetzungen für das Kinderspiel schafft, und wie man Spiele didaktisch und methodisch organisiert und anleitet. Hierbei hielt ich es außerdem für wichtig zu ergründen, warum in Spielprozesse von Kindern überhaupt eingegriffen werden sollte, und was man unter Spielpädagogik allgemein versteht.
Anhand dieser Fragestellungen resultierte schließlich der nachfolgende inhaltliche Aufbau meiner Diplomarbeit. Ich musste allerdings in den einzelnen Kapiteln öfter vor – und zurückgreifen, weil die Themenbereiche des Kinderspiels ineinander „verzahnt“ sind.
Im ersten Kapitel betrachte ich ausgewählte, wissenschaftliche Ansätze zum Kinderspiel und stelle dar, wie darin das Kinderspiel beschrieben wird, darunter allgemeine Merkmale, Voraussetzungen und Funktionen.
Im zweiten Kapitel gehe ich auf verschiedene Typen des Kinderspiels ein, wobei ich mich am Klassifikationsmodell von Einsiedler (1999) orientiere, der die Kinderspiele in psychomotorische Spiele, Phantasie – und Rollenspiele, Bauspiele und Regelspiele einteilt. Ich erörtere zunächst, wie sich diese Spielformen jeweils definieren lassen. Danach beschreibe ich mit empirischen Untersuchungen, wie Kinder in den vier Spielformen spielen und wie sich ihr Spielverhalten im Laufe ihrer Entwicklung verändert. Anschließend vertiefe ich die Diskussion über Funktionen des Kinderspiels aus der Perspektive des Kindes sowie aus entwicklungspsychologischer und sozialisationstheoretischer Sicht.
Anstelle einer Schlussbilanz fasse ich bereits nach dem zweiten Kapitel das erarbeitete Wissen über das Kinderspiel in einem Fazit zusammen. Dies ist vermutlich eine unübliche Vorgehensweise in einer Diplomarbeit, aber ich glaube, dass ich dadurch spielerisch eine solide „Brücke“ von wissenschaftlichen Überlegungen und entwicklungspsycho-logischen Erkenntnissen zur pädagogischen Unterstützung des Spiels „baue“.
Im dritten Kapitel beschäftige ich mich mit Spielpädagogik und beziehe mich hauptsächlich auf Fritz (1993). Als erstes definiere ich Spielpädagogik und deren Aufgabenbereiche. Dann greife ich die zur Voraussetzung des Kinderspiels gehörenden Faktoren „ökologischer Spielraum“ und „Spielmittel“ wieder auf und diskutiere, warum sie für das Spielen von Kindern wichtig sind und warum man heute auf sie spielpädagogisch einwirken sollte. Anschließend schildere ich am Beispiel der Spielmobilarbeit, wie man konkret „Spielplätze“ mit Kindern schaffen und beleben kann. Ferner beschreibe ich pädagogische Kriterien für „gutes“ Spielzeug und stelle aus meiner Sicht geeignetes Kinderspielzeug vor. Am Beispiel der Kinderspielecrew zeige ich auf, wie Kinder bei der Bewertung von Gesellschaftsspielen direkt beteiligt werden. Zuletzt erläutere ich, wie man gruppen-
orientierte Regelspiele didaktisch und methodisch planen, durchführen und reflektieren kann. Dabei erörtere ich die dafür benötigten Handlungsprinzipien eines Spielpädagogen und illustriere das von mir entworfene „Outback“ Geländespiel.
Im Laufe meiner Diplomarbeit verwende ich die Begriffe „Entwicklung“, „Sozialisation“, „Spielraum“ und „Umwelt“ häufiger :
Entwicklung umfasst die Reifung (z.B. Wachstum) und die Lernprozesse (z.B. Motorik, Sprache und logische Operationen) des Individuums. Sie vollzieht sich in verschiedenen „Phasen“, bzw. „Stufen“. (Zimmermann 2000, S. 15 f.).
Sozialisation meint die Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der sozialen und materiellen Umwelt, wobei die Akzentuierung im „Mitglied – Werden“ in eine Gesellschaft liegt. Im Sozialisationsprozess setzen sich die Menschen, als aktive Individuen, handelnd mit ihrer Umwelt auseinander. Familie und soziale Institutionen (Kindergarten, Schule, Vereine, etc.) haben hierbei wichtige Funktionen, weil sie Kindern Werthaltungen und Kulturtechniken des gesellschaftlichen Lebens vermitteln (Zimmermann 2000, S. 16 ff.).
Spielraum im psychologischen Sinn sehe ich in Anlehnung an Fritz (1993, S. 17) und Baer (1999, S. 30) als eine vom Kind durch seine Projektionen, Vorstellungen oder Spielregeln erschaffene zweite Wirklichkeit (Spielwelt), in der individuelle und gesellschaftliche Einflüsse miteinander verschränkt werden. Damit eine Spielwelt entstehen kann, halte ich eine entspannte Atmosphäre für grundlegend, die z.B. durch eine Familiensituation ermöglicht wird, in der Kinder ein Gefühl von Geborgenheit und Verständnis erfahren.
Mit Spielraum im ökologischen Sinn meine ich real vorhandene Spielorte, die in der Wohnung oder in Institutionen existieren (z.B. das Wohnzimmer, das Kinderzimmer, das Badezimmer, die Sporthalle, der Toberaum eines Jugendzentrum) sowie solche, die draußen vorhanden sind (z.B. der Wald, der Hinterhof, die verkehrsberuhigte Straße).
Unter Umwelt verstehe ich die konkrete Lebenssituation von Kindern, z.B. die Personen, zu denen Kinder unmittelbaren Kontakt haben (Eltern, Verwandte, Nachbarkinder, etc.), das emotionale Klima in der Familie oder in einer sozialen Einrichtung, die Plätze im häuslich – familialen Milieu und in der Wohngegend, in denen sich Kinder aufhalten, oder die Spielmittel, die Kindern zur Verfügung stehen (vgl. Mogel 1994, S. 215).
1. Kapitel Theoretische Ansätze zum Kinderspiel
Vorüberlegungen zu den Ansätzen
In diesem Kapitel erörtere ich wissenschaftliche Ansätze zum Kinderspiel und stelle dar, wie das Kinderspiel jeweils beschrieben wird. Da es eine Vielzahl von Spieltheorien gibt, musste ich für meine Diplomarbeit auswählen und habe mich für vier Ansätze entschieden, die sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln vor allem auf das Kinderspiel beziehen, bzw. es mitberücksichtigen :
In Abschnitt 1.1. betrachte ich das Kinderspiel aus Heckhausens motivationspsychologischen Perspektive und ergründe, welche Faktoren Kinder zum Spielen anregen.
In Abschnitt 1.2. stelle ich den interaktionistischen Erklärungsansatz des Kinderspiels von Mead vor. Ich diskutiere, warum Kinder im Spiel wechselseitig aufeinander Bezug nehmen müssen, sowie welchen Stellenwert das (Regel-)Spiel im Rahmen des Sozialisationsprozesses einnimmt und inwieweit sich gemachte Sozialerfahrungen auf die Persön-lichkeitsbildung des Kindes auswirken.
In Abschnitt 1.3. behandle ich das Kinderspiel aus Winnicotts psychoanalytischer Sicht. Ich erläutere und interpretiere das Konzept des intermediären Raums, in dem sich Spiel entfaltet.
In Abschnitt 1.4. beschäftige ich mich mit Mogels ökopsychischem und sozialkulturellem Verständnis für das Kinderspiel. Ich führe aus und beziehe Stellung, inwiefern „Freiheit“ im Kinderspiel besteht und inwieweit es durch unterschiedliche Komponenten bedingt wird. Außerdem erörtere ich Funktionen des Kinderspiels aus individueller und gesellschaftlicher Perspektive.
Abschließend fasse ich die jeweils zentralen Gedanken dieser theoretischen Ansätze über das Kinderspiel zusammen.
1.1. Das Kinderspiel aus einer motivationspsychologischen Perspektive
Heckhausen ist ein Vertreter der Motivationsforschung und hat eine Psychologie des Spiels entwickelt, die motivationelle Aspekte des Spielverhaltens erklärt und Faktoren ergründet, die Spannung im Spiel erzeugen. Anhand von fünf Merkmalen charakterisiert er das Kinderspiel (Heckhausen 1976, S. 135 ff.) :
Erstens ist Zweckfreiheit für das (Kinder-)Spiel bezeichnend, weil Menschen ungezwungen und freiwillig spielen, wobei sie ein wohltuendes Gefühl erfahren.
Zweitens wird das (Kinder-)Spiel durch einen sogenannten Aktivierungszirkel ausgelöst. Menschen suchen im Spiel eine lustvolle, psychische Spannung auf, die nach einer bestimmten Zeit plötzlich absinkt, dann wieder aufsteigt und erneut abfällt. Mit der Bezeichnung „Aktivierungszirkel“ möchte Heckhausen deutlich machen, dass sich die Spannungsfolge permanent wiederholt und sich ihr Verlauf „zackenförmig, im Sinne einer Kippschwingung, mit langsamem Anstieg und schnellem Abfall oder auch mit schnellem Anstieg und langsamem Abfall (vorzustellen ist)“ (Heckhausen 1976, S. 136). Haupteigenschaften eines Aktivierungszirkels, die ein Spiel angenehm, unterhaltsam und erregend machen, sind ein mittlerer Spannungsgrad (zwischen Langeweile und überwältigendem Effekt) und ein baldiger Spannungsabfall, der Menschen Entspannung und Erleichterung bringt. Vier verschiedene Anregungskonstellationen in Form von Diskrepanzen bewirken Aktivierungszirkel, durch die Menschen zum Spielen motiviert werden . Diese anregenden Diskrepanzen bestehen zwischen gegenwärtigen und früheren Erwartungen (= Neuigkeitsgrad des Spiels), zwischen Wahrnehmungen und Erwartungen
(= Überraschungsgehalt des Spiels), innerhalb des gegenwärtigen Wahrnehmungsfeldes (= Verwickeltheit des Spiels) und zwischen verschiedenen Erwartungen (= Ungewissheit des Spielausgangs).
Drittens ist das (Kinder-)Spiel immer eine handelnde Auseinandersetzung mit einem Ausschnitt der real begegnenden Welt. Es setzt voraus, dass „etwas“ mit dem Menschen spielt.
Viertens sind die Spielziele undifferenziert und der Spielzeitraum relativ kurz bemessen.
Beides bewirkt eine rasche Zirkelfolge von Handlungen, ermöglicht Menschen unmittelbar erfahrbare Rückwirkungen und löst weitere Reaktionen aus.
Fünftens ist für das (Kinder-)Spiel die Entstehung einer „ Quasi – Realität“ kennzeichnend, „ein Zustand des Erlebens, der sich [...] vom sog. ,Ernst des Lebens’, d.h. der alltäglichen Lebensvollzüge zur Daseinsfristung, unterscheidet, ohne deshalb aber selbst unernst oder unwirklich zu sein“ (Heckhausen 1976, S. 147). Quasi – Realität ist aber nicht gleichzusetzen mit Irrealem, nur Erdachtem oder dem Phantasierten, weil Aspekte der Realität unter räumlicher und zeitlicher Ausgrenzung mit Hilfe von Vorstellung und Spielregeln handelnd abgebildet, nachgeschaffen oder erhöht werden. Das Merkmal Quasi – Realität trifft jedoch nur auf bestimmte Spielformen zu, zu denen das kindliche Rollenspiel und das Regelspiel zählen. Nicht zugehörig sind das materialprüfende, experimentierende Spiel und die Bewegungsspiele des Kleinkindes, weil hier Weltausschnitte erkundet und bewältigt werden.
Hinsichtlich dieser Merkmale des (Kinder-)Spiels bin ich folgender Auffassung :
Ich glaube ebenso wie Heckhausen, dass Kinder aktive Individuen sind, die sich im Spiel handelnd mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Spiel ist sicherlich, wie Heckhausen meint, ein freiwilliges Geschehen. Zweckfrei ist es meiner Meinung nach nur insofern, dass es relativ unabhängig von äußeren Zielsetzungen ist, weil Kinder im Spiel eigenständig ihre Handlungsschritte koordinieren, ohne dabei negative Konsequenzen im Alltagsleben befürchten zu müssen. In sich selbst ist das Spiel meiner Auffassung nach durchaus zweckvoll, denn Kinder verfolgen bestimmte Spielziele. Daher halte ich eine undifferenzierte Zielstruktur nicht für ein charakteristisches Merkmal des Spiels, denn dies würde in meinen Augen bedeuten, dass Kinder im Spiel wenig geistig tätig werden. Bezüglich des Freiheitsaspektes sollte man auch bedenken, dass die Spieltätigkeit nie absolut frei sein kann, weil sie von eingeräumten Spielzeiten, vorhandenen Spielorten, verfügbaren Spielsachen, Spielpartnern, den kindlichen Vorerfahrungen und Zukunftsbezügen abhängt (vgl. Abschnitte 1.4., 3.2.). In seinen Ausführungen zu spannungsauslösenden Momenten, merkt Heckhausen selbstkritisch an, dass der Neuigkeitsgrad und der Überraschungsgehalt nur sehr kurzzeitig auf die Spieler aktivierend wirken, weil nach mehrmaligem Praktizieren eines Spiels darin nichts Neues mehr vorhanden ist und der Spielablauf keine Überraschungen mehr bietet. Dem möchte ich mich anschließen ich mich anschließen,
wobei ich allerdings glaube, dass so manches Spiel (z.B. Fangen oder Kästchen hüpfen) Variationen zulässt, die ihm dadurch etwas Neuartiges wiedergeben, das stimulierend wirkt. In der Verwickeltheit des Spiels sieht Heckhausen die Motivationsgrundlage zu problemlösenden Denktätigkeiten, weil ungeordnete oder unzusammenhängende Elemente geistig / und oder körperlich zusammengeführt werden müssen. Ich finde, dass Verwickeltheit besonders auf Spiele zutrifft, die Rätsel aufgeben (z.B. Quiz, Memory) oder Bautätigkeiten beinhalten (z.B. Modellbau mit Baukästen, Puzzle, Hüttenbau). Ungewissheit gilt wahrscheinlich für alle Spiele, weil das Ende meistens offen bleibt, es von den Fähigkeiten und Interessen der jeweiligen Spieler abhängt. Im Unterschied zu Heckhausens Auffassung zur Quasi - Realität denke ich, dass sich das (Kinder-)Spiel nicht nur manchmal, sondern prinzipiell vom „Ernst des Lebens“ abhebt. Ich vermute, dass auch schon Kleinkinder bewusst zwischen Spiel und Alltagsernst unterscheiden und trennen, denn sie erfahren, dass es einerseits Tätigkeiten gibt, die sie freiwillig aus Vergnügen tun dürfen, und andererseits verpflichtende Tätigkeiten existieren (z.B. essen, schlafen, Zähne putzen, sich waschen). Außerdem finde ich den Begriff „Quasi – Realität“ missverständlich, weil er aus meiner Sicht nicht deutlich genug macht, dass damit eine andere Wirklichkeitsebene gemeint ist. Die Formulierung „Spielwelt“ oder „zweite Realität“ halte ich für präziser (vgl. Einleitung). In dieser Spielwelt stellen Kinder neben den auf Wirklichkeit beruhenden Situationen auch phantastische, irreale Ereignisse dar (vgl. Abschnitt 2.2.2.).
1.2. Das Kinderspiel aus einer interaktionistischen Perspektive
Mead vertritt eine handlungstheoretische Konzeption von Sozialisation, bei der die Interaktion (das wechselseitige Aufeinander – Bezugnehmen) von Menschen im Vordergrund der Betrachtung steht. Der Mensch wird in dieser interaktionistischen Theorie „als ein schöpferischer Interpret und Konstrukteur seiner sozialen Umwelt verstanden“ (Hurrelmann 2001, S. 51). Im Rahmen seiner Theorie beschäftigt sich Mead auch mit dem (Kinder-) Spiel, dessen Verständnis ich nun darstellen möchte.
Mead unterscheidet bei der Betrachtung des Spiels sowohl sprachlich als auch inhaltlich zwischen „spielen“ (to play) und „Spiel“ nach festen Regeln (game). Zunächst spielen (play) Kinder etwas Spezifisches, stellen spielerisch bestimmte Rollen dar, z.B. eine Mutter oder einen Polizisten. Dabei erschaffen sie sich oft einen imaginären Spielgefährten :
„Das Kind sagt etwas in einer Rolle und antwortet darauf in einer anderen Rolle, dies ist wiederum ein Reiz für seine erste Rolle.“ (Mead 1991, S. 113)
Neben imaginären Partnern spielen Kinder zudem schon miteinander, wie beispielsweise Indianer. Dennoch sieht Mead dieses „spielen“ (to play) noch als sehr unbeständig an, weil Kinder beliebig zwischen den Rollen wechseln :
„Das Kind spielt einmal dieses, einmal jenes; was es in einem Augenblick darstellt, ist nicht bestimmt für den nächsten Augenblick. [...] Man kann mit dem Kind nicht rechnen; man kann nicht annehmen, dass all seine gegenwärtigen Handlungen bestimmen werden, was es zu irgendeinem anderen Zeitpunkt tun wird.“ (Mead 1991, S. 119)
Nach Mead gibt es in diesem frühen Stadium des Kinderspiels noch keine festen Grundregeln. Als Beispiel erwähnt er ein einfaches Versteckspiel, wobei prinzipiell zwei Personen ausreichen : die eine, die sucht und die andere, die sich versteckt. Dahingegen muss ein Kind in einem „Spiel“ (game) imstande sein, „wenn es eine Rolle übernimmt, [...] auch die Rollen aller anderen zu übernehmen“ (Mead 1991, S. 113). Diese Rollen stehen in einer bestimmten Art und Weise zueinander, die Kinder kennen sollten :
„Im Spiel gibt es also eine Reihe von Reaktionen der Mitspieler. Sie sind so organisiert, dass die Haltung des einen die entsprechenden Haltungen der anderen provoziert.“ (Mead 1991, S. 114)
Am Beispiel des Baseballspiels verdeutlicht er dies :
„Wenn es sich an einem Baseballspiel beteiligt, muss es die Reaktionen aller anderen Positionen in seine eigene Position einbeziehen. Um selbst mitspielen zu können, muss es wissen, was jeder andere tun wird. Es muss diese Rollen ganz in sich aufnehmen. Nicht alle müssen gleichzeitig in seinem Bewusstsein gegenwärtig sein. Aber in manchen Augenblicken müssen in seiner eigenen Handlung drei oder vier Individuen gegenwärtig sein, eines, das den Ball wirft, eines, das ihn fangen will, usw. Diese Reaktionen müssen sich bis zu einem bestimmten Grad in der eigenen Haltung niederschlagen.“ (Mead 1991, S. 113 ff.)
Nur wenn ein Kind die Haltungen aller anderen Mitspieler verinnerlicht und in Beziehung zu seinem eigenen Handeln setzt, kann es erfolgreich am Spiel partizipieren. Das „Spiel“ (game) verläuft organisiert und koordiniert. Mead (1991) ist davon überzeugt, dass es durch seine Unmittelbarkeit eine integrative Funktion hat, denn es ist ein Beispiel dafür, wie ein Kind zu einer organisierten Persönlichkeit in der Gesellschaft heranwächst :
„Das Spiel ist also ein Beispiel für die Situation, aus welcher eine organisierte Persönlichkeit entsteht. In dem Maße, in dem das Kind tatsächlich die Haltung des anderen übernimmt und die Haltung der anderen darüber bestimmen lässt, was es auf ein gemeinsames Ziel, tun wird, wird es ein organisches Mitglied der Gesellschaft. Es übernimmt die sittlichen Normen dieser Gesellschaft und wird zu einem wirklichen Mitglied. [...] Was sich im Spiel ausdrückt, äußert sich natürlich unaufhörlich im sozialen Leben des Kindes.“ (Mead 1991, S. 119)
Meads Position des Kinderspiels schätze ich folgendermaßen ein :
Ich teile seine Auffassung, dass Kinder lernen müssen, sich in andere Spieler gedanklich hineinzuversetzen und ihr Handeln zu koordinieren, um so an einem Spielprozess erfolgreich partizipieren zu können. Das Regelspiel bietet sicherlich Gelegenheit, dies zu üben. Außerdem kann ich Mead folgen, dass Kinder im Regelspiel ein Bewusstsein für „Regeln“ in einer Gemeinschaft bekommen. Ich finde jedoch seine These einer gesellschaftsintegrativen und persönlichkeitsbildenden Wirkung des Regelspiels problematisch, weil Kinder meiner Meinung nach Spielerfahrungen nicht automatisch auf ihr Alltagshandeln übertragen. Meines Erachtens sammeln sie im Spiel eher „Potentialitäten“ des Denkens und Handelns, die ihnen für mögliche Situationen außerhalb des Spiels zur Verfügung stehen. Bietet sich Kindern eine Gelegenheit, die gewonnenen sozial - kognitiven Kenntnisse probeweise im Alltagsleben anzuwenden, so besteht gewiss die Chance, dass sie
sich auch zukünftig an diesen Verhaltensweisen orientieren. Ich bin aber überzeugt, dass
die Personen in der Umwelt darauf positiv reagieren müssen (vgl. Abschnitte 2.2.3. u. 2.4.3.). Hinsichtlich seines Vergleichs des einfachen Versteckspiels mit dem Baseballspiel bin ich anderer Auffassung, denn ich meine, dass es im einfachen Versteckspiel
ebenfalls Grundregeln gibt. Ich finde, dass hier beispielsweise vorgeschrieben wird, dass sich der Suchende die Augen zuhält und zählt, damit sich die anderen ungesehen verstecken können, oder dass festgelegt wird, wie sich die Versteckten „frei schlagen“ können. Suchender und Sich - Versteckende nehmen aufeinander Bezug, wenngleich diese Interaktion wahrscheinlich nicht so komplex wie im Baseballspiel ist. Kinder orientieren sich im Regelspiel aber nicht nur, wie Mead meint, an vorhandenen Regeln, sondern probieren auch Varianten und Alternativen aus (vgl. dazu meine Erörterungen zum Murmelspiel von Piaget (1986) und zum Hüpfspiel von Elkonin (1980) in Abschnitt 2.4.2.). In seinen Ausführungen zu den frühen Spielen des Kindes bezieht sich Mead auf das Rollenspiel mit fiktiven Partnern und anderen Kindern. Ich bin der selben Ansicht, dass Kinder in dieser Spielart in bestimmte Rollen schlüpfen, in denen sie sich selbst darstellen. Ich glaube allerdings, dass Kinder, wenn sie älter werden, ihr Handeln im gemeinsamen Rollenspiel ebenso wie im Regelspiel auf das der anderen abstimmen und lernen, dass Rollen in ganz bestimmten Beziehungen zueinander stehen (vgl. Abschnitt 2.2.2.).
1.3. Das Kinderspiel aus einer psychoanalytischen Perspektive
Der britische Kinderarzt und Psychoanalytiker Winnicott (1997, S. 124) sieht den Ausgangspunkt der Spielentwicklung im Spannungsfeld zwischen Kleinkind und Mutter. Dieses entsteht sobald ein Kind nach völliger Verschmelzung mit seiner Mutter zum ersten Mal die Mutter als „Nicht – Ich“ erfährt. Ab diesem Zeitpunkt fangen Kinder an, die Außenwelt (zunächst die Mutter, später andere Phänomene aus der Umwelt) von ihrem inneren Erleben zu unterscheiden. Den Trennungsprozess können Kinder jedoch nur vollziehen, weil zwischen äußerer und innerer, psychischer Realität ein potentieller Zwischenraum entsteht, den Winnicott (1997, S. 11) als „intermediären Bereich“ bezeichnet, der die beiden anderen Bereiche voneinander trennt und zugleich miteinander verbindet :
„Dieser dritte Bereich des menschlichen Lebens, den wir nicht außer Acht lassen dürfen, ist ein intermediärer Bereich von Erfahrungen, in den in gleicher Weise innere Realität und äußeres Leben einfließen.“ (Winnicott 1997, S. 11)
Dieser intermediäre Bereich beginnt sich zwischen dem vierten und dem zwölften Lebensmonat durch das Auftreten von Übergangsobjekten zu entfalten (Winnicott 1997, S. 13). Übergangsobjekte, sind der erste „Nicht – ich“ Besitz von Kindern, wozu z.B. der Zipfel einer Decke, eine Handvoll Wolle, ein Teddybär gehören. Sie sind gemäß Winnicott (1997, S. 63) von ihrer Herkunft Teil der äußeren Welt, aber Kinder gebrauchen sie aktiv für Vorstellungen aus ihrer inneren, persönlichen Realität. Übergangsobjekte dienen dazu, die kindlichen Ängste abzubauen und vermitteln Kindern ein Gefühl von Wärme und Sicherheit. Im Laufe der Entwicklung verlieren diese Übergangsobjekte allmählich an Bedeutung, und das Spiel nimmt dann die Funktion ein, zwischen innerer Welt (dem subjektiven Empfinden) und äußerer Welt (dem objektiv Vorhandenen) zu vermitteln :
„Hat das Kind in seiner frühen Entwicklung und in der Folgezeit durchschnittlich gute Erfahrung in diesem Bereich der Lebensbewältigung gemacht, so findet es jetzt tiefe, ja überwältigende Befriedigung im imaginativen Spiel. Es handelt sich nicht um geregeltes Spielen, sondern um kreative spielerische Entfaltung [...]“ (Winnicott 1997, S. 117)
„Das Wagnis des Spiels ergibt sich daraus, dass es stets an der theoretischen Grenze zwischen Subjektivem und objektiv Wahrgenommenem steht.“ (Winnicott 1997, S. 62)
Damit sich der intermediäre Raum entfalten kann und sich darin Spiel entwickelt, ist eine vertrauensvolle und verlässliche Mutter – Kind – Beziehung notwendig :
„Herrscht jedoch in einer Beziehung Vertrauen und Verlässlichkeit, so entsteht ein potentieller Raum, ein Raum, der zu einem unbegrenzten Bereich der Trennung werden kann, den das Kind, [...] kreativ mit Spiel erfüllen kann [...] Wird ein Kleinkind liebevoll umsorgt, so kann sich die Mutter von ihm lösen, und es entsteht ein riesiger Bereich für das Spiel. Macht ein Kleinkind in dieser Phase seiner Entwicklung ungünstige Erfahrungen, so hat es [...] nur geringe Entwicklungsmöglichkeiten.“ (Winnicott 1997, S. 126)
Für Winnicott (1997, S. 118) ist spielen eine schöpferische Tätigkeit, mit der Individuen kulturelle Erfahrungen sammeln, indem sie Dinge in ihr Spiel kreativ einbeziehen :
„Kulturelles Erleben ist lokalisiert in einem schöpferischen Spannungsbereich zwischen Individuum und Umwelt (anfangs : die Mutter). Dasselbe gilt für das Spielen. Kulturelles Erleben beginnt mit kreativem Leben, das sich zuerst als Spiel manifestiert.“ (Winnicott 1997, S. 116)
„In diesen Spielbereich bezieht das Kind Objekte und Phänomene aus der äußeren Realität ein und verwendet sie für Vorstellungen aus der inneren, persönlichen Realität.“ (Winnicott 1997, S. 63)
Damit ein Kind Zugang zu kulturellen Grundlagen bekommt, müssen die Bezugspersonen je nach augenblicklichem Entwicklungsstand des Kindes ihm geeignete Elemente des Kulturerbes vermitteln (Winnicott 1997, S. 127).
In Bezug auf diesen theoretischen Ansatz des Kinderspiels bin ich folgender Ansicht :
Ich teile Winnicotts Auffassung, dass Spiel von Erfahrungen mit der Umwelt abhängt und dass eine vertrauensvolle Mutter – Kind – Beziehung die Voraussetzung für das Kinderspiel bildet. Kinder spielen meiner Überzeugung nach nur, wenn eine entspannte Atmosphäre vorhanden ist. Wie Winnicott glaube ich, dass Spiel psychologisch gesehen in einem intermediären Raum stattfindet, der zwischen innerer und äußerer Wirklichkeit vermittelt (vgl. Einleitung). In diesem Bereich können Kinder spielerisch die äußere Realität subjektiv nachvollziehen. Im Spiel werden Kinder sicherlich kreativ tätig und machen kulturelle Erfahrungen. Allerdings finde ich, dass die kreative Entfaltungsmöglichkeit u.a. von den zur Verfügung stehenden Spielmitteln und ihrer Beschaffenheit, der eingeräumten Spielzeit und den für das Spiel zugänglichen Spielorten abhängt (vgl. Abschnitt 1.4.).
1.4. Das Kinderspiel aus einer ökopsychischen und sozialkulturellen Perspektive
Nach Mogel (1994, S. 34 f.) ist spielen ein relativ freies Geschehen, weil Kinder selbstentschlossen und spontan handeln, um Situationen nach eigenen Vorstellungen zu beeinflussen. Daher sieht Mogel (1994, S. 11) Kinder im Spielprozess als Akteure an, die sich eigens Spielziele setzen und sich selbst gestaltend mit der Umwelt auseinandersetzen, ohne Konsequenzen von der Alltagswelt befürchten zu müssen. Mit „gestalten“ meint er sowohl Selbstveränderung als auch Umweltveränderung und glaubt an eine wechselseitige Beziehung von Kind und Umwelt. Diese These veranschaulicht er an folgendem Beispiel :
„Ein vierjähriges Mädchen spielt mit einem gleichaltrigen Mädchen ,Kaufladen’. Es kauft 10 kg Waschpulver. Denn es ,muss’ alle Puppenkleider gründlich waschen. Nun holt es eine Schüssel Wasser, tut das Waschmittel dazu, zieht die drei Puppen aus, wäscht deren Kleider. Die Puppen ,frieren’, draußen regnet es, und das Mädchen kann die Kleider nicht zum Trocknen aufhängen. Da die Puppen dringend trockene Kleider benötigen, kommen diese in den mütterlichen Waschtrockner, usw.“ (Mogel 1994, S. 11)
Wechselseitig ist der Zusammenhang deshalb, weil Kinder durch ihr spielerisches Tun Situationen herstellen, die einen bisherigen Zustand bei ihnen selbst [in obigem Beispiel : Das Mädchen „wäscht“ die Puppenkleider.] sowie in ihrer Umwelt [in obigem Beispiel : Die Puppen „frieren“, weil das Mädchen ihnen ihre Kleider auszog.] verändern. Der weitere Spielverlauf ergibt sich aus immer neuen Modifikationen [in obigem Beispiel : Das Mädchen „trocknet“ die Puppenkleider, damit Puppen nicht mehr „frieren“ müssen.] (Mogel 1994, S. 12). Die Verknüpfung zwischen Individuum und Umwelt nennt Mogel (1994, S. 215) ökopsychisch.
Hinsichtlich des Freiheitsaspektes räumt Mogel (1994, S. 41 ff.) allerdings ein, dass das spielerische Handeln von Kindern nie absolut frei ist. Es hängt von der momentanen Motivation und den Vorerfahrungen (vorangegangene Erlebnisse und Ereignisse) der Kinder, den äußeren Rahmenbedingungen (ökologischer Spielraum, Spielzeug, Spielzeit, Spielpartner, usw.) sowie sozialen Kontexten (Familie, Verwandtschaft – und Freundschaftsverhältnisse, Wohnsituation, etc.) und kulturellen Zusammenhängen ab :
„Die subjektive Bedeutung des Spielens für das Kind ist weitgehend abhängig von den objektiv vorhandenen Bedingungen, die kindliches Spielen ermöglichen und fördern.“ (Mogel 1994, S. 15)
Ökologische Spielräume von Kindern sind identisch mit deren tatsächlichen Lebensräumen, die Kinder brauchen, damit sie sich spielerisch entfalten können und sie weitreichende Entwicklungschancen haben (Mogel 1994, S. 118 ff.). Darum findet Mogel, dass neben speziell eingerichteten Plätzen zum Spielen (z.B. Kinderzimmer und Spielplatz) ebenfalls in anderen alltäglichen Räumen Bereiche für das Kinderspiel integriert sein sollten, sowohl in Innenräumen (z.B. im eigenen Haus {Wohnzimmer, Küche, Flur, Bad}) als auch in Außenräumen (z.B. Sackgassen, Hinterhöfe, Scheunen, öffentliche Parks, Wiesen, Wälder, Bäche) (vgl. Abschnitt 3.2.1.).
Spielzeug benötigen Kinder, weil sie im Spiel immer etwas mit Dingen tun und dadurch ihren individuellen Bezug zur Wirklichkeit gestalten (Mogel 1994, S. 112 u. vgl. Abschnitt 3.2.2.) :
„Kindliches Spiel ist immer auf die Spielgegenstände gerichtet, auch wenn die Gegenstände, mit denen Kinder spielen, sehr unterschiedlich sind.“ (Mogel 1994, S. 27)
„Jedesmal, wenn das Kind aktiv wird, ist seine Aktivität gerichtet auf ein Etwas, ein Ding, auf bestimmtes ,Zeug’ “ (Mogel 1994, S. 46)
Mogel (1994, S. 111) meint, dass Spielzeug einen direkten Einfluss auf Inhalte und Formen des Kinderspiels hat, und glaubt, dass sich alle Dinge aus der Umwelt als brauchbar für Spielhandlungen von Kindern erweisen, wie z.B. Hölzer, Steine, Papier sowie das speziell zum Spielen hergestellte industrielle Spielzeug. Letzteres versteht er als ein Produkt einer kulturellen und sozialen Welt, das „von einem gesellschaftlichen Einfluss (zeugt), der auf die kulturelle und soziale, aber auch auf die technische und zivilisatorische Entwicklung der Gesellschaft zurückgeht“ (Mogel 1994, S. 46 f.) :
„Im Spielzeug spiegelt sich das gesellschaftliche Selbstverständnis von Generationen und Epochen.“ (Mogel 1994, S. 203)
Durch die spielerische Auseinandersetzung mit Spielzeug begreifen Kinder allmählich die Kultur, in der sie leben (Mogel 1994, S. 47). Wie Kinder ihr Spielgeschehen allerdings „aufziehen“, hängt von der Qualität des jeweiligen Spielzeugs ab (Mogel 1994, S. 112). Mogel (1994, S. 111) plädiert deshalb dafür, dass man Kindern Spielzeug zur Verfügung stellt, mit dem sie kreativ und frei ihre Vorstellung von Wirklichkeit mit ihrer Phantasie
verbinden können. Jedoch wäre absolut Kreativität - in dem Sinn, dass sie Spielhandlungen vollständig aus sich selbst heraus erzeugen - nur mit solchem Material möglich, das von der Gesellschaft noch keine bestimmte kulturelle Bedeutung zugesprochen bekommen hat, wie z.B. Knete, Holz oder Plastilin (Mogel 1994, S. 47 und siehe näheres zur Spielzeugbeurteilung in Abschnitt 3.2.2.).
Spielzeiten sollten Kindern eingeräumt werden, weil Kinder Zeit benötigen, um ihre Umwelt spielerisch kennenzulernen, zu erleben und zu gestalten :
„Spielzeit ist aufgrund dessen eine höchst wertvolle Zeit, eine Zeit des Wohlbefindens, des Erlebens und Erkennens, die Entwicklungschancen schafft, individuelle Begabungen und Potentiale freisetzt.“ (Mogel 1994, S. 121)
Die Familie1 ist das erste Beziehungssystem im Leben des Kindes. Deshalb ist das Kinderspiel von Anfang an in personale und soziale Beziehungen zu Familienmitgliedern eingebunden :
„Die meisten kindlichen Spiele, [...] wurzeln in der familialen Entwicklung des Kindes.“ (Mogel 1994, S. 146)
Mogel (1994, S. 44 ff.) meint, dass Eltern ihren Kindern das Spiel ermöglichen oder unterbinden können, weil sie äußere Bedingungen weitgehend festlegen :
Sie stellen Spielzeug bereit und haben dadurch indirekten Einfluss und Kontrolle darüber, was und womit Kinder spielen. Spielorte unterliegen ihnen, denn sie können beispielsweise ein Spielzimmer einrichten oder auch nicht, und sie gewähren oder untersagen den Aufenthalt zum Spielen im Garten (sofern vorhanden) oder auf dem Spielplatz. Eltern können darüber hinaus die Spieldauer begrenzen, z.B. durch gewohnte Abläufe (Mittagessen, Schlafengehen), und fungieren durch Mitspielen als Spielpartner.
Nach Mogels (1994, S. 143 ff.) Auffassung ist entwicklungsfördernd, wenn Eltern während des Spielens ihrer Kinder als Ansprechpartner erreichbar sind und sie das Kinderspiel wertschätzen, denn dadurch erlangen Kinder ein Sicherheitsgefühl. Eltern sollten ihren Kindern ausgiebige Spielzeit, ausreichenden ökologischen Spielraum und Spielzeug entsprechend deren Bedürfnislage und Entwicklungsstand gewähren, damit sich Kinder stressfrei spielerisch entfalten können.
Im Laufe der Kindheit kommen soziale Einrichtungen (z.B. Kindergarten, Kinderhort) hinzu, die die Spielmöglichkeiten von Kindern erweitern, insbesondere weil sie soziale Kontakte ermöglichen (Mogel 1994, S. 202 f.).
Mogel (1994, S. 27) glaubt, dass das Kinderspiel die gelebte Gegenwart des spielenden Kindes ist und aktuelles Erleben für Kinder bedeutet :
„Hauptmotiv eines jeden Spiels ist, das gegenwärtige Erleben durch die Spieltätigkeit zu erweitern, zu genießen, zu gestalten, zu optimieren. Dabei kann das Kind sehr wohl vergangene Erfahrungen reaktualisieren und zukunftsbezogene Wünsche wie Befürchtungen realisieren. Aber der Realitätsstatus vergangener und zukünftiger Zeit erhält den eigentlichen Sinn durch die Spielgegenwart.“ (Mogel 1994, S. 149 f.)
Nach Mogels Vorstellung trennen Kinder die Gegenwart nicht künstlich zwischen Spielwelt und Realität, weil für sie ihr Spiel eine echte, erfahrbare Wirklichkeit ist, die sich auf ihre Persönlichkeitsbildung in Form von Emotionen, Kognition, Motivation, Erleben, Verhalten, Handeln, individueller Verhaltensregulation und Handlungsplanung auswirkt. Die Umwelt bietet dem kindlichen Spielen jedoch eine Schutzzone, in der Kinder ungestört gestalten und sich entfalten können (Mogel 1994, S. 33).
Die verschiedenen Formen des Kinderspiels beeinflussen die Entwicklung und Sozialisation von Kindern folgendermaßen (Mogel 1994, S. 35, S. 55 ff., S. 125 ff.):
In Funktionsspielen [nachfolgend als „psychomotorische Spiele“ bezeichnet] machen Kinder grundlegende Erfahrungen über die Funktionen von Dingen aus ihrer Umwelt, z.B. Wasser ist „nass“ und „spritzt“, Papier ist „verformbar“ und „zerreißbar“ oder Topfdeckel sind „hart“ und „klappern“. Dies bereitet ihnen großes Vergnügen (vgl. Abschnitt 2.1.).
In Konstruktionsspielen [nachfolgend als „Bauspiele“ bezeichnet] stellen Kinder kreativ ein bestimmtes Gegenstandsgefüge (z.B. eine Burg oder ein Auto) mit unterschiedlichen
Materialien (u.a. Sand, Wasser, Knete, Papier oder Bauklötze) selbst her, das meist auf Kultur und Gesellschaft zurückzuführen ist. Beim Bauen lernen Kinder, auf die Besonderheiten der Materialien zu achten, sowie zu planen, zu kalkulieren und zu strukturieren, um ihr Bauziel zu erreichen. Sie erfahren, Ausdauer aufzubringen und „Barrieren“ zu überwinden. Je nach Resultat zeigen Kinder emotionale Reaktionen : ein Gefühl von Kompetenz und Freude beim Gelingen des Bauvorhabens und ein Gefühl der Wut oder Resignation beim Scheitern (vgl. Abschnitt 2.3).
In Rollenspielen [nachfolgend als „Phantasie – und Rollenspiele“ bezeichnet] schaffen sich Kinder unter Einsatz ihrer kognitiven, emotionalen und sensomotorischen Fähigkeiten ihre eigene Realität des Erwachsenseins. Sie schlüpfen (meistens) in Rollen von Erwachsenen und stellen unterschiedliche Alltagszenen symbolisch dar. Dadurch „leben“ sie ihre Wünsche aus der Welt der Erwachsenen kreativ aus, die ansonsten für sie unerfüllt blieben, wie z.B. als „Doktor“ dem „Patienten“ die Spritze zu geben oder als „Verkäufer“ dem „Kunden“ Ware zu verkaufen. Sie kompensieren so die nachteilige Diskrepanz ihres Kindseins gegenüber den sich im Vorteil befindenden Erwachsenen. Außerdem eignen sie sich Normen und Verhaltensregeln ihrer Kultur an, ohne dass Erwachsene eingreifen müssen, wodurch sie in die Gesellschaft hineinwachsen (vgl. Abschnitt 2.2.).
In Regelspielen lernen Kinder, dass sich alle Menschen in sozialen Situationen mit relativ festliegenden Interaktionsmöglichkeiten an die selben „Spielregeln“ halten müssen. Die besonders bewegungsorientierten Regelspiele (z.B. Fangen, Verstecken, Völkerball) fördern insgesamt die körperliche Elastizität. Andere steigern vor allem die Denkleistungen (z.B. Dame oder Schach), d.h. die kognitive Kombinationsfähigkeit und die Strukturierung der Handlungsplanung, und solche, die mehr auf Sieg durch Glück und Zufall ausgelegt sind (z.B. „Mensch – ärgere – dich – nicht“), das Erleben und Bewältigen von positiven und negativen Emotionen. Für Kinder besteht der Reiz beim Regelspiel in der Familie besonders darin, dass sie die Chance haben, die sonst überlegenen Erwachsenen zu besiegen, das mit Selbstwertsteigerung verbunden ist (vgl. Abschnitt 2.4.).
Im Spiel machen Kinder nach Mogels (1994, S. 48) Auffassung aber nicht nur Erfahrungen mit sozialen Normen, sondern dürfen zudem Alternativen entgegen vorherrschender Wertvorstellungen ausprobieren, denn das Spiel ist nach allen Seiten offen, nicht nur nach
der kulturell und sozial erwünschten.
Mogels Ausführungen kann ich darin folgen, dass Kinder aktive Personen sind, die sich beim Spielen handelnd mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Ich schließe mich ihm an, dass dies für sie aktuelles, gegenwärtiges Erleben bedeutet. Genau wie Mogel finde ich, dass das Kinderspiel ein relativ freies Geschehen ist, weil Kinder aus eigenem Antrieb den Spielverlauf steuern und eigene Spielziele verfolgen. Absolut frei ist Spielen, wie Mogel meint, wahrscheinlich nicht, denn es hängt von der momentanen Spielmotivation und den Vorerfahrungen von Kindern, den äußeren Rahmenbedingungen sowie sozialen und kulturellen Kontexten ab. Ich denke auch, dass Eltern (und später soziale Institutionen) einen großen Einfluss auf das Spielverhalten von Kindern haben, weil sie festlegen, wo, wie lange, mit wem und womit Kinder spielen können. Hinsichtlich des produzierten Spielzeugs glaube ich ebenfalls, dass Kinder mit dessen Umgang allmählich ihre Kultur begreifen lernen (vgl. Abschnitt 3.3.2.). Spielzeug wird zwar meistens zum Spielen benötigt, es gibt aber meines Wissens auch Spiele, wie beispielsweise Wettlaufsspiele oder Reigen, die gänzlich ohne Spielzeug auskommen. Mogels Position, dass Kinder die Gegenwart nicht zwischen Spielwelt und Realität trennen, teile ich nicht (vgl. dazu meine Position in der Einleitung u. in den Abschnitten 1.1., 1.3.). Ich vermute, dass durch Spielen, wie Fritz (1993, S. 17 u. S. 46) ausführt, ein Bereich zwischen der Innenwelt des Kindes und der Außenwelt entsteht, eine Spielwelt, die Fritz in Bezug auf die Wirklichkeit als eine um jene gelagerte „ lebendige Hüllschicht“ bezeichnet, die unverbindlicher, offener und freier als die Alltagsrealität ist. Aus meiner Sicht fließen in diese Spielwelt gesellschaftliche Elemente ein, die Kinder individuell verarbeiten. Dadurch erleben Kinder diese Spielwelt sicherlich als real. Ich möchte mich Mogels Erkenntnissen über die Funktionen der verschiedenen Spielformen überwiegend anschließen (vgl. dazu meine Erörterungen in den Abschnitten 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3., 2.4.3.). Ich finde jedoch, es sollte berücksichtigt werden, dass Kinder soziale Handlungsweisen des Spiels nicht automatisch auf ihr Alltagsleben übertragen. Sie sind meines Erachtens Potentialitäten, die Kindern für reale Situationen zur Verfügung stehen. Inwieweit soziale Prinzipien zu generellen Orientierungsmustern von Kindern werden, hängt wahrscheinlich davon ab, ob sie allgemein zu den kindlichen Interessen und Fähigkeiten passen. Ferner sollten die Personen der Umwelt diese Prinzipien wertschätzen, wenn Kinder in geeigneten Situationen probeweise danach handeln.
Zusammenfassung
Abschließend möchte ich die mir zentral erscheinenden Aussagen der vorgestellten wissenschaftlichen Ansätze zum Kinderspiel in einem kurzen Fazit zusammenfassen :
Heckhausen bezieht das Kinderspiel aus motivationspsychologischer Perspektive auf Kinder als Individuen, die sich im Spiel zweckfrei und handelnd mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Damit Kinder spielen, bedarf es seiner Auffassung nach der Anregung durch sogenannte „Aktivierungszirkel“, die durch den Neuigkeitsgrad, den Überra-schungsgehalt und der Verwickeltheit des Spiels sowie der Ungewissheit des Spielausgangs ausgelöst werden. In den meisten Spielformen (besonders beim kindlichen Rollenspiel) entsteht ihm zufolge eine „Quasi-Realität“, eine Spielwelt, die sich vom „Ernst des Lebens“ unterscheidet, in der die Individuen aber Realität nacherschaffen oder erhöhen.
Mead unterscheidet im Rahmen seiner interaktionistischen Theorie zwei Formen des Spiels : das „spielen“ (to play) von jüngeren Kindern und das „Spiel“ (game) nach festen Regeln. Dabei stehen bei ihm die sozialen Beziehungen im Vordergrund seiner Betrachtung. Beim „spielen“ schlüpfen Kinder in verschiedene Rollen oder erschaffen sich imaginäre Spielgefährten. Jedoch ist diese Art des Spielens seines Erachtens noch unbeständig und ungeregelt, weil Kinder hier zwischen den Rollen wechseln, und man nicht weiß, wie sie im Laufe des Spiels handeln werden. Im „Spiel“ (game) müssen die Individuen dahingegen gemäß Mead hinsichtlich eines gemeinsamen Ziels aufeinander Bezug nehmen und die Rolle des anderen bei der eigenen Handlung einkalkulieren (Perspek-tivenübernahme), um so erfolgreich am Spiel teilzuhaben. Durch das Praktizieren des „Spiels“ (game) glaubt Mead, werden Kinder zu organisierten Persönlichkeiten der Gesellschaft sozialisiert, weil sie die Normen der jeweiligen Spielgruppe annehmen und sich dieses Verhalten auch in anderen Bereichen des sozialen Lebens bei Kindern zeigt.
Winnicott sieht den Beginn der Spielentwicklung aus psychoanalytischer Perspektive ab etwa vier Monaten, sobald sich ein Kind von seiner Mutter psychisch trennt. Dieser Trennungsprozess wird seiner Meinung nach dadurch ermöglicht, dass zwischen Mutter und Kind ein „intermediärer Bereich“ entsteht, der die innere Realität eines Kindes von der Außenwelt (zunächst die Mutter, später andere Bereiche der Umwelt) spaltet und zugleich
miteinander verbindet. Damit sich dieser „intermediäre Bereich“ entfalten kann, ist nach Winnicotts Überzeugung eine vertrauensvolle Mutter – Kind – Beziehung grundlegend. Zunächst gebrauchen Kinder in diesem Bereich Übergangsobjekte (z.B. einen Kissenzipfel oder einen Teddy), die als Vermittler zwischen innerer Realität und der Außenwelt fungieren. Diese Übergangsobjekte verlieren nach dem ersten Lebensjahr allmählich an Bedeutung, und das Spiel übernimmt deren Funktion. Spielen gilt Winnicott zufolge als eine kreative, schöpferische Tätigkeit, mit der Kinder durch das Einbeziehen von Dingen, kulturelle Erfahrungen sammeln.
Mogel hält das Spielen von Kindern für ein relativ freies, gegenwärtig erlebendes Geschehen, in dem sich Kinder selbst gestaltend mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Er glaubt dabei an eine wechselseitige, ökopsychische Beziehung zwischen Individuum und Umwelt. Spielen ist seiner Auffassung nach nicht absolut frei, weil es durch die momentane Spielmotivation und die Vorerfahrungen von Kindern, die äußeren Rahmenbedingungen (Spielzeit, ökologischer Spielraum, Spielzeug, Spielpartner,...) sowie durch die sozialen Zusammenhänge (z.B. Familie, Wohnsituation) und die kulturellen Kontexte (z.B. produziertes Spielzeug) bedingt wird. Mogel meint, dass Eltern (und später soziale Institutionen) einen hohen Einfluss auf das Spielverhalten von Kindern haben, denn sie bestimmen, wo, wie lange, mit wem und womit Kinder spielen können. Seiner Meinung nach hat das Kinderspiel verschiedene Funktionen :
Es werden emotionale, kognitive, soziale und sensomotorische Fähigkeiten von Kindern gefördert. Kinder machen im Spiel Erfahrung im Umgang mit Dingen und setzen diese kreativ ein. Sie lernen sich an (Spiel-)Regeln zu halten und dürfen Alternativen ausprobieren. Außerdem erfüllen sich Kinder Wünsche, indem sie Personen und Situationen aus der Erwachsenenwelt szenisch nach eigenem Belieben darstellen, wodurch sie zugleich in die Erwachsenwelt sozialisiert werden.
2. Kapitel Die Entwicklung des Kinderspiels
Die Klassifikation der Kinderspiele nach Einsiedler
In diesem Kapitel beschäftige ich mich mit dem Spielverhalten von Kindern und möchte darstellen, was und wie Kinder im Laufe ihrer Entwicklung spielen. Dabei orientiere ich mich am Klassifikationsmodell des Kinderspiels von Einsiedler (1999), der folgende Spielformen von Kindern unterscheidet : psychomotorische Spiele, Phantasie – und Rollenspiele, Bauspiele, Regelspiele.
Ich entschloss mich, Einsiedlers Modell auszuwählen, weil er meiner Meinung nach sehr ausführlich und anschaulich die Spielformen von Kindern beschreibt und mit einer Vielzahl von empirischen Untersuchungen aufzeigt, wie Kinder ihr Spiel gestalten und wie sich ihr Spielverhalten verändert, wenn sie älter werden. Außerdem konnte ich seine Begründungen, warum Spiel für Kinder wichtig ist und es die kindliche Entwicklung und Sozialisation fördert, meistens nachvollziehen. Durch Einsiedler (1999) bekam ich einen ersten wissenschaftlichen Eindruck vom Kinderspiel und war inspiriert, einige Untersuchungen aus seinem Werk „ Das Kinderspiel“ auszuwählen und selbst im Original durchzuarbeiten.
Darüber hinaus habe ich weitere Forschungen zum Kinderspiel berücksichtigt, auf die ich durch die Literatur von Fritz (1993) und Oerter (1999) aufmerksam wurde.
Um mir letztlich einen Gesamteindruck von der Entwicklung und den Funktionen des Kinderspiels zu verschaffen, war mir neben den verschiedenen empirischen Untersuchungen und den Werken von Einsiedler (1999), Fritz (1993), Oerter (1999) auch die Spieleliteratur von Sutton – Smith (1978 u. 1986) und Mogel (1994) hilfreich.
Daraus resultierend bildete ich mir eine eigene Auffassung über das Kinderspiel. Den Schwerpunkt habe ich in diesem Kapitel auf die Phantasie – und Rollenspiele und die Regelspiele gelegt, weil ich sie als die interessanteren Spielformen erachte, und ich in meiner bisherigen pädagogischen Tätigkeit mit Kindern Brett – und Kartenspiele, Computerspiele, Geschicklichkeitsspiele, Geländespiele und gelegentlich Theater spielte (vgl. Einleitung).
Die nachfolgenden vier Abschnitte dieses Kapitels : psychomotorische Spiele (2.1.), Phantasie – und Rollenspiele (2.2.), Bauspiele (2.3.) und Regelspiele (2.4.) habe ich nochmals in drei Abschnitte untergliedert, in denen diese Fragestellungen leitend sind :
- 1. Unterabschnitt : Beschreibung und Definition :
Was sind die zentralen Merkmale dieser Spielform?
Wie ist sie begrifflich zu umschreiben?
- 2. Unterabschnitt : Entwicklung des Spielverhaltens von Kindern :
Wie spielen Kinder in dieser Spielform?
Wie verändert sich das Spielen von Kindern in dieser Spielform im Laufe der kindlichen Entwicklung?
- 3. Unterabschnitt : Funktionen :
Welche Funktionen hat diese Spielform aus entwicklungspsychologischer und sozialisationstheoretischer Sicht?
Welche Fähigkeiten von Kindern werden in dieser Spielform gefördert?
Warum spielen Kinder in dieser Spielform?
2.1. Die psychomotorischen Spiele
2.1.1. Beschreibung und Definition der psychomotorischen Spiele
Zunächst möchte ich auf die Spiele eingehen, die am Anfang der kindlichen Entwicklung in den ersten zwei Lebensjahren in Erscheinung treten. Darunter fallen Betätigungen mit dem eigenen Körper, sowie das Hantieren mit verschiedenen Objekten.
Piaget (1996, S. 152) bezeichnet diese Spiele als „sensomotorische Übungsspiele“, die noch keine Denkprozesse in Gang setzen und möchte damit ausdrücken, dass die spielerischen Betätigungen aus reinem Vergnügen heraus ausgeführt werden. Diese Verhaltensweisen sind geprägt „von einer Freude, Ursache zu sein, oder einem Gefühl der Leistungsfähigkeit (Piaget 1996, S. 151). Einsiedler (1999, S. 58) bemängelt Piagets Auffassung des fehlenden Denkens anhand von vier Punkten, um zu verdeutlichen, dass Kinder auch schon in frühen Spielen kognitiv tätig sind :
1. Kinder bauen schon im ersten Lebensjahr Erwartungen auf. Dies könnte beispielsweise ein Höhepunkt in Eltern - Kind Spielen, wie das „Fallen“ im „Hoppe, Hoppe, Reiter“ Spiel sein.
2. Kinder wissen schon sehr früh, dass sie Verursacher sein können, z.B. eine Rassel bewegen und fallen lassen.
3. Kinder kombinieren gegen Ende des ersten Lebensjahres Gegenstände, z.B. einen Deckel auf einen Topf legen.
4. Kinder zeigen bereits emotionale Äußerungen, wie z.B. Freude und Lust, aber auch
Anspannung und Missvergnügen, das man ab dem 4. Lebensmonat beobachten kann. Sie wiederholen diejenigen Spiele, die ihnen Spaß machen und wissen daher schon etwas über die Wirkung des Spiels.
Aus diesen Gründen bezeichnet Einsiedler (1999, S. 58) diese Spiele als „psychomotorische Spiele“ und definiert sie folgendermaßen :
„Die Freude am Spiel, das Erleben von Spannung und Entspannung, das Empfinden, Handlungsträger zu sein, scheint schon als Hauptmovens des Spiels zu wirken. Wir sprechen deshalb übergreifend von psychomotorischen Spielen und verstehen darunter alle Spiele, in denen eine Bewegung mit dem Körper ausge- führt, eine Körperfunktion betätigt oder ein Gegenstand bewegt wird, wobei die Freude an der Betätigung selbst Hauptziel ist (emotionale Komponente) und Erfahrung über Ursache - Wirkungszusammenhänge beteiligt sind (kognitive Komponente).“ (Einsiedler 1999, S. 60)
Nach Auffassung von Einsiedler (1999, S. 62), die ich auch teile, hat Piaget (1996) aufgrund der zahlreichen und detaillierten Beobachtungen seiner eigenen Kinder, diese Spielform sehr anschaulich dargestellt. Allerdings muss man einräumen, dass man in seinen Beobachtungen wenig über den sozialen Kontext der Spiele erfährt, denn bei Piaget stand die Individuum – Sachwelt Beziehung im Mittelpunkt seines Forschungsinteresses (Einsiedler 1999, S. 62). Meine nachfolgenden Ausführungen zu Piaget (1996) erläutern daher in erster Linie „Objektspiele“, wie Einsiedler (1996, S. 68) den einen Bereich der psychomotorischen Spiele bezeichnet.
2.1.2. Entwicklung des Spielverhaltens von Kindern bei psychomotorischen Spielen
Kinder führen ab ihrer Geburt zunächst einfache Bewegungsvorgänge mit ihren Körperteilen (Kopf, Arme, Beine) durch und spielen mit ihrer Stimme (Lalllaute); werden sie älter, beziehen sie zunehmend Objekte in ihr spielerisches Handeln mit ein (Piaget 1996, S. 120 ff.). Voraussetzung für den Umgang mit Dingen ist, dass Kinder etwa mit 4 ½ Monaten gelernt haben, „sehen“ und „greifen“ zu koordinieren (Piaget 2000, S. 20). Kinder greifen nach all den Dingen, die sie in ihrer Umwelt sehen, und probieren sie aus. Dadurch erfahren sie, selbst Versucher zu sein (Piaget 1996, S. 122).
Piaget (1996, S. 152 ff.) teilte in seiner Beobachtungsstudie die sensomotorischen Spiele in drei Kategorien ein : „einfache sensomotorische Spiele“, „sensomotorische Kombinationen ohne Zweck“ und „sensomotorische Kombinationen mit Ziel“ :
Die „einfachen sensomotorischen Spiele“ bezeichnete Piaget (1996, S. 152) als Übungsspiele, die kontextbezogen und mit Freude verbunden auf ein normalerweise nützliches Ziel hin, rituell wiederholt wurden :
In Beobachtung 59 (S. 122) spielte sein Sohn im Alter von 2 Monaten nicht aus phonetischem Interesse, sondern aus reiner Freude mit seiner Stimme. An einem anderen Tag bewegte er seinen Kopf „unernst“, mehrmals lachend nach hinten, nachdem er zuvor diese Handlung vollzogen hatte, um sich Bilder aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen.
In Beobachtung 61 (S. 124) stößt er mit 7 Monaten ein Hindernis mit der Hand weg, um einen Gegenstand greifen zu können. Dieser Bewegungsablauf wiederholte sich auch dann, als Piaget ein Papier oder seine Hand zwischen das Spielzeug und die Hand seines Sohnes schob.
In Beobachtung 66 (S. 152) hob eine seiner Töchter im Alter von 2 Jahren und 2 Monaten einen Kieselstein
auf und warf ihn in eine Lache. Mit 2 Jahren und 8 Monaten füllte sie einen Eimer mit Sand, stülpte ihn um, zerstörte den so entstandenen Sandkuchen mit der Schaufel und begann dieses Spiel wieder von vorne. Im Alter von 3 Jahren und 8 Monaten schnürte sie ihre Schuhe permanent auf und wieder zu, nachdem sie es zuvor gelernt hatte.
Die zweite Klasse der sensomotorischen Spiele, die als „sensomotorische Kombinationen“ bezeichnet wurden, unterschied sich von der ersten Kategorie dadurch, dass Kinder sich nicht mehr damit begnügten, erworbene Fähigkeiten zu üben, sondern dass sie von Anfang an neue Kombinationen konstruierten, die gänzlich spielerischer Natur waren (Piaget 1996, S. 153). Diese Formen zeichneten sich durch „Bewegung um der Bewegung willen oder in Manipulation um der Manipulation willen (aus)“ (Piaget 1996, S. 154). Sie konnten rein zufällig oder bewusst zustande kommen :
In Beobachtung 63 (S. 125), bei der eine seiner Töchter im Alter von 10 Monaten ihre Nase an die Wange der Mutter presste, fand sie plötzlich Gefallen an diesem Vorgang und wiederholte ihn mit größer werdendem Abstand zur Wange ihrer Mutter. Diese Handlung beobachtete Piaget mindestens einmal täglich über einen Monat lang. Mit 12 Monaten glitt ihre Hand, mit der sie beim Baden ihre Haare hielt, aufs Wasser. Sie wiederholte dies dann mehrfach, wobei sie die Höhe und Position der Hand variierte. Im Alter von 13 Monaten vergnügte sie sich damit, eine, auf dem Tisch liegende, Orangenschale zum Schaukeln zu bringen. Dies wiederholte sie mindestens zwanzigmal.
In Beobachtung 68 (S. 153) berührte eine von Piagets Töchtern im Vorbeigehen die Stäbe einer Balustrade und wiederholte dies im gleichen Rhythmus bei den Scheiben einer Tür.
Piaget (1996, S. 154) unterschied als letzte Klasse von Übungsspielen die „sensomotorischen Spiele mit Ziel“, wobei sich der Zielaspekt auf ein rein spielerisches Ziel bezog :
In Beobachtung 70 (S. 155) hüpften zwei Jungen vom Boden auf eine Bank und wiederholten dies, indem sie den Abstand zur Bank immer weiter vergrößerten. Danach sprangen sie mehrmals gleichzeitig von den beiden gegenüberliegenden Enden auf die Bank.
Piagets Beobachtungen des Kinderspiels fanden in der entwicklungspsychologischen Wissenschaft starke Verbreitung, und es ist insbesondere für die psychomotorischen Spiele, als auch für das von Piaget beschriebene Symbolspiel (vgl. Abschnitt 2.2.) gelungen,
Mikrostrukturen zu entwickeln (Einsiedler 1999, S. 23). Anzumerken ist aber nach Einsiedler, dass man sich aus praktischen Gründen meistens auf Untersuchungen des manipulativen Spiels mit vorgegebenem Spielzeug bei Kindern ab 7 Monate beschränkt hat. Man erfährt dadurch nicht, was, wie und womit Kinder im freien Spiel spielen. Dafür kann man Aussagen über den Umgang mit Spielzeug und über die geistigen Fähigkeiten von Kindern machen. Nachfolgend stelle ich zwei neuere Forschungen zum psychomotorischen Spiel dar :
Rosenblatt (1977, S. 34 ff.) gab Kindern in einer häuslichen Umgebung Spielzeugsets und erfasste mit einem Beobachtungsbogen deren Spielverhalten.
Dabei fand sie heraus, dass Kinder mit 9 Monaten fast zu 100 % „sensomotorisches Spiel mit einem Spielzeug“ (z.B. Berühren, Drehen, Schwenken, Stoßen, usw.) spielten, das aber ab dem 15. Monat rapide absank und mit 24 Monaten nur noch etwa 20 % des gesamten Spielverhaltens der Kinder ausmachte. „Sensomotorische Kombinationen“ (z.B. Klötze aufeinander oder Becher ineinander stellen) kamen in allen Altersklassen so gut wie nie vor. „Repräsentationales Spiel mit einem Spielzeug“ (z.B. mit dem Spielzeugtelefon wählen, Haare bürsten oder mit dem Löffel essen) lag bei den Kindern bis 12 Monate fast bei 0 %, stieg dann bis zum 18. Monat auf 70 % an und sank danach bis zum 24. Monat leicht um 10 %. „Repräsentationale Kombinationen“ (z.B. Puppe bürsten, Tee in Tasse gießen oder Teddy baden) spielten Kinder erst mit 15 Monaten und stiegen dann bis zum 24. Monate auf 30 % an.
Aus diesen Ergebnissen folgerte sie, dass sich das Spielverhalten von Kindern vom sensomotorischen zum repräsentationalen Spielen wandelt. Durch ihre weiteren qualitativen Beobachtungskategorien ergab sich, dass Kinder ab 12 Monate weniger willkürlich mit den Dingen umgingen (z.B. Autos in den Mund stecken, mit Bürste Lärm erzeugen) und dass sie stattdessen durchdachter im Spiel agierten (z.B. Auto schieben, Ball rollen) sowie dass sie zeitlich länger spielten (Rosenblatt 1977, S. 35 ff.).
Einsiedler (1999, S, 63) meint, dass „sensomotorische Kombinationen“ deshalb weniger gespielt wurden, weil andere Spielsachen attraktiver waren, z.B. Puppe oder Auto.
Fenson u.a. (1976, S. 234 ff.) hatten ebenso wie Rosenblatt (1977) festgestellt, dass Kinder im 7. Monat eher als ältere Kinder die Spielobjekte visuell und taktil untersuchten und
diese in den Mund steckten oder damit Lärm erzeugten. „Einfaches relationales Spiel“ (Gegenstände zueinander bringen, wie z.B. einen Löffel an eine Kanne stoßen) nahm vom 7. bis 9. Monat leicht zu und sank danach wieder ab, und „passendes relationales Spiel“ (sachrichtiger Gebrauch von Gegenständen, z.B. Löffel in Tasse stellen) nahm vom 9. bis zum 20. Monat zu.
Anhand dieser Ergebnisse vermute ich wie Einsiedler (1999, S. 71), dass sich Kinder zunächst physikalisches Wissen aneignen2, dazu gehören Eigenschaftsbegriffe (wie z.B. hart, weich, rund, eckig), einfaches Statik – und Mechanikwissen (wie z.B. Standfestigkeit, schaukeln, fallen, kippen, rollen) und Zweck – Mittel Wissen (wie z.B. etwas in Bewegung zu bringen), danach erst relationales, bzw. repräsentatives Wissen (z.B. Puppe bürsten, Löffel in Tasse geben). Welche Faktoren das relationale Wissen konkret erzielten, wurde in den Untersuchungen von Rosenblatt (1977) und Fenson u.a. (1976) jedoch nicht geklärt. Meiner Meinung nach könnte es dadurch zustande kommen, dass sich Kinder Verhaltensweisen von Erwachsenen im Umgang mit Dingen abschauen und kognitiv speichern, um sie später selbst nachzuahmen. Sicherlich führen auch Erkenntnisse durch aktives Ausprobieren und Experimentieren zu einem funktionsgerechten Gebrauch des Spielzeugs. Eine empirische Untersuchung, die die Ursachen für den Wandel des Spielzeuggebrauchs näher erhellt, liegt meiner Erkenntnis nach noch nicht vor.
Einsiedler (1999, S. 69) meint, dass Spielzeug variabel und reagibel sein sollte, dem ich mich anschließe : Durch Variabilität werden immer wieder neue Impulse zur Erkundung von Objekt – und Umweltgegebenheiten geschaffen. Reagibilität ermöglicht die Erfahrung des Kausalschemas (Tätigkeit à Effekt), das durch akustische, visuelle / mechanische oder kombinierte Signale des Spielzeugs erreicht wird.
Bislang habe ich den Blick auf psychomotorische Spiele gerichtet, die die Subjekt – Objekt Beziehung in den Mittelpunkt stellten. Manchmal ist aber der Erwachsene auch Interaktionspartner im Spiel des Kindes. Einsiedler bezeichnet diese psychomotorischen Spiele als „Sozialspiele“. Es darf allerdings nicht die falsche Vorstellung entstehen, dass eine scharfe Trennung zwischen Objekt - und Sozialspielen besteht, denn bei Sozialspielen werden oft Objekte miteinbezogen (Einsiedler 1999, S. 65).
Sutton – Smith (1986) sieht die psychomotorischen Spiele vor allem im sozialen Kontext.
Seiner Auffassung nach ist die Kontaktaufnahme mit dem Säugling die Voraussetzung für Spielen. Eine Kommunikationsbasis muss geschaffen werden, und eine Grundregel, die dies ermöglicht, ist, die Säuglinge nachzuahmen, wann immer es eine Gelegenheit dazu gibt (Sutton - Smith 1986, S. 21). Unter dieser Bedingung findet man in den ersten drei Monaten Nachahmungsspiele, wie z.B. Glucksen, Zunge rausstrecken und Schubsen (Sutton - Smith 1986, S. 25).
[...]
1 Unter Familie versteht Mogel alle familialen Lebensformen (z.B. die traditionelle Kleinfamilie oder die Ein –Eltern – Familie).
2 Diese Materialerfahrungen sind auch für das Bauspiel nützlich (vgl. Abschnitt 2.3.).
- Arbeit zitieren
- Sascha Lock (Autor:in), 2002, Kinderspiel als Sozialisationsfaktor und Lernfeld, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11793
Kostenlos Autor werden





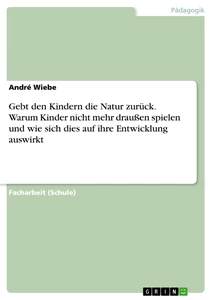


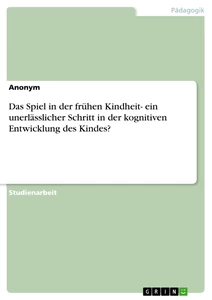











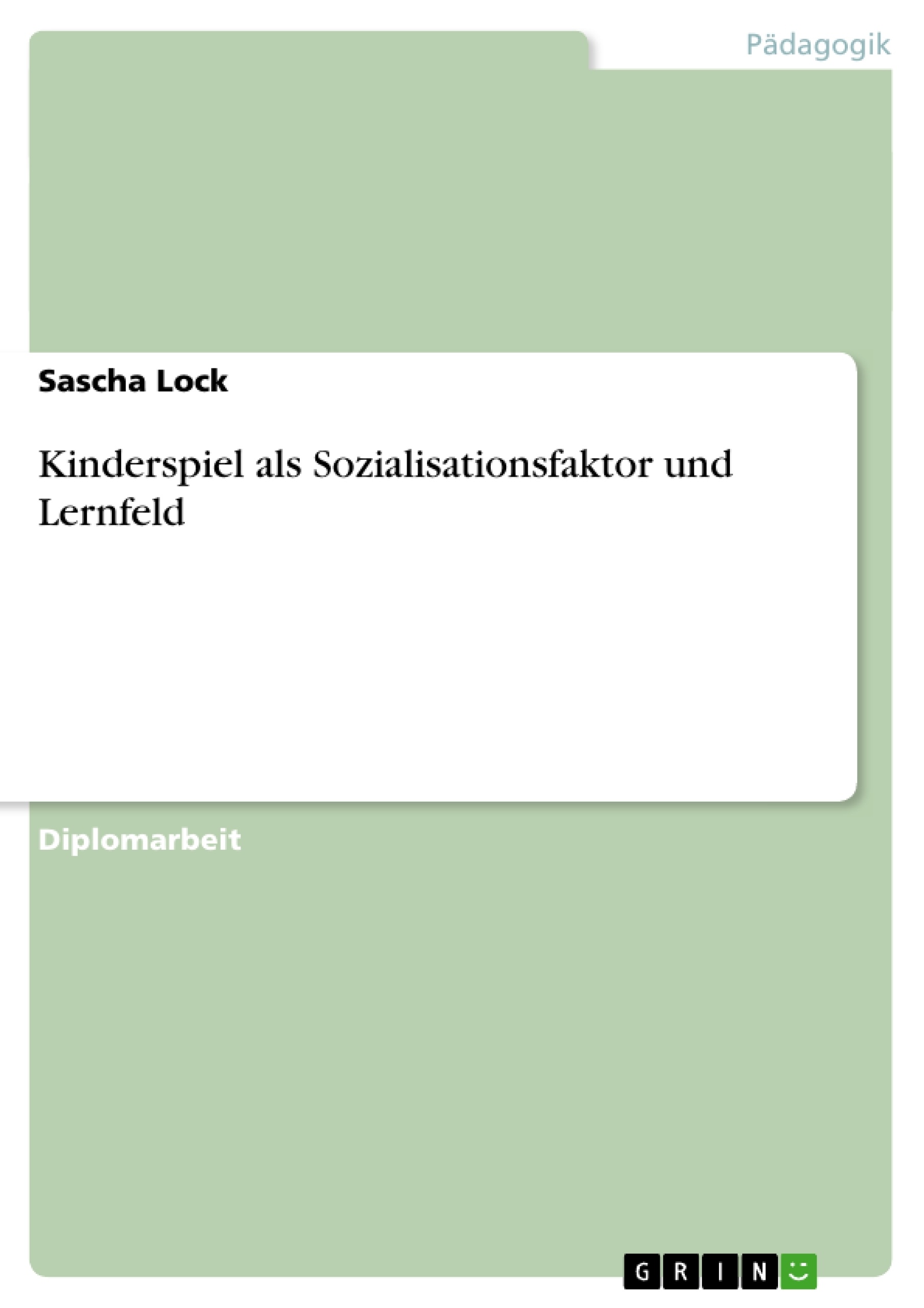

Kommentare