Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel 1 - Die Fürsorge
1.1 Armut und Fürsorge im Spätmittelalter
1.2 Die Spitäler im deutschen Sprachraum
1.3 Die Stadt
1.4 Das Umland
1.5 Die Staatsausgaben
1.6 Das Spital
1.7 Die Agrarprodukte
1.8 Die Ausgaben
1.9 Die Reformation
Kapitel 2 Disziplinierung von Körper und Seele
2.1 Die Alphabetisierung
2.2 Das Schulwesen in Zürich vom Mittelalter bis zur Neuzeit
2.3 Die Traktate über die Erziehung
2.4 Gehorsam und Disziplin
2.5 Verordnungen und Verurteilungen in Zürich während der Reformation
2.6 Das Tribunal für Ehefragen
Kapitel 3 - Die reformierte Stadt
3.1 Fürsorge und Disziplinierung
3.2 Die Tessiner Glaubensflüchtlinge
3.3 Die Werdmüller
3.4 Andere aufstrebende Sektoren
3.5 Die Gebäude des 17. Jahrhunderts
3.6 Der Niedergang der Zünfte
Schlussfolgerung
Anhang
Einleitung
Einhundert Jahre sind es nun her, seit ein junger deutscher Wissenschaftler namens Max Weber eine Studie mit dem doch eher provokativen Titel Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904/1905) in der renommierten soziologischen Zeitschrift Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik publizierte. Sicherlich war es nicht das erste Mal, dass ein Forscher evangelischer Konfession den Versuch unternahm, die soziale Realität seines eigenen Landes im Lichte der Wertvorstellungen zu erklären, die in seiner religiösen Herkunft fussten. Illustre Beispiele lassen sich in Europa da und dort finden, nicht etwa nur in der deutschen Essayistik, sondern auch in anderen Ländern, wie etwa die Schriften von William Perkins und Emile de Laveleye beweisen.1 Dennoch war es das Traktat von Max Weber, das in nur wenigen Jahrzehnten zu einem noch nie zuvor da gewesenen Bekanntheitsgrad und Erfolg gelangte, und zwar in einem solchen Mass, dass wir bis heute schwerlich behaupten können, seine Bedeutung sei schon verblasst.2 Woher aber kommt die unter gewissen Aspekten so unwiderstehliche Faszination gegenüber einem Werk, das doch schon etwas in die Jahre gekommen ist und das in einem ganz anderen historischen Kontext als dem heutigen entstand? Kritiker aus aller Welt haben sich bemüht, eine Antwort auf diese Frage zu geben, und nicht wenige von ihnen haben in den Texten von Max Weber eine Bestätigung ihrer eigenen Ansichten gefunden, seien sie politischer, historischer oder sozialer Natur.3
Gewiss haben nicht alle die Protestantische Ethik enthusiastisch aufgenommen. Nicht wenige Einwände kamen aus den Reihen der Ökonomiewissenschaftler, die beim Stichwort „Geist des Kapitalismus“ das Gefühl hatten, den Boden unter den Füssen zu verlieren. So war beispielsweise der Schwede Kurt Samuelsson keineswegs verlegen, die Protestantische Ethik als ein nebulöses, ungenaues und willkürliches Werk zu definieren: Webers Methode sei untragbar, und zwar gerade darum, weil sie einzelne Faktoren isolieren wolle, die in einem komplexen Entwicklungsprozess stünden, wie es eben im westlichen Kapitalismus der Fall war.4 In neuerer Zeit ist die These von Max Weber, die eine direkte Beziehung zwischen Ausbreitung des Protestantismus und Durchsetzung des Kapitalismus festzustellen versucht, aufgrund von offensichtlichen empirischen Daten widerlegt worden. Diese weisen nach, dass es im Europa des 19. Jahrhunderts eine deutliche Diskrepanz zwischen industrieller Entwicklung und religiöser Konfession gab.5 In Wirklichkeit können das Werk und die Figur von Max Weber nur schwerlich verstanden werden, wenn der historische und soziale Kontext, in dem der Forscher arbeitete, ausgeklammert wird, sei es in seiner Eigenschaft als Abkömmling einer Familie von Unternehmern oder in jener als auffallender Vertreter der pussischen Intelligenzija des Zweiten Reichs. Nachdem Max Weber 1892 die Lehrbefugnis an der Universität erteilt worden war, hatte er im Laufe seiner glänzenden Karriere die Gelegenheit, mit einigen angesehenen Persönlichkeiten aus der damaligen Kultur zu verkehren. Zu seinen wichtigsten Bekanntschaften zählten etwa der Historiker Theodor Mommsen, der Theologe Otto Baumgarten und der Ökonom Walter Lotz. Was diese Forscher trotz unterschiedlicher Interessen und Meinungen vereinte, war in Wirklichkeit die Zustimmung zu drei fundamentalen Prinzipien des sozialen Zusammenlebens: der Glaube an den Protestantismus, die Verherrlichung der Nation und das Vertrauen in den Liberalismus. Max Weber wird diese Prinzipien nicht einmal in den letzten Jahren seines Lebens verleugnen, er bleibt trotz der katastrophalen Folgen des Ersten Weltkriegs weiterhin in der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) aktiv, um an der „geistigen Arbeit als Beruf“ festzuhalten und sich mit seinen Interventionen auf die Ehre des Vaterlandes, Reichswehr und die Nation zu berufen.6 Korrekterweise muss Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus also in einem Klima des politischen Kampfs gesehen werden, der in Deutschland unter dem Begriff Kulturkampf in die Geschichte eingegangen ist. Dieser wird als ein kultureller Kampf verstanden, der geführt wird gegen jene katholische Weltanschauung, die in einem erklärten Widerspruch zu den vom protestantischen und liberalen Bürgertum des Landes gemeinsam vertretenen Idealen steht. Von 1871 bis 1887 reagierte Bismarcks Deutschland mit einer ganzen Reihe von repssiven Massnahmen auf den Syllabus von Pius IX. und auf das vom Ersten Vatikanischen Konzil verkündete Prinzip der Unfehlbarkeit des Papstes. Diese Massnahmen reichten weit: Ausweisung der Jesuiten, Einführung der obligatorischen Zivilehe im ganzen Reichsterritorium, staatliche Aufsicht über die katholischen Schulen, Überwachung der Ausbildung und Berufung der Geistlichen. Die Protestantische Ethik entsteht in diesem Klima der Konfrontation und wird fortan zur bedeutendsten Waffe, mit der die protestantische Intelligenzija jene sozialen Kräfte unterwerfen will, die unter der Obhut des Papstes stehen. Die Protestantische Ethik wird so ein ideales Vorbild für diejenigen, die sich vorgenommen hatten, die zersetzenden Kräfte des Katholizismus einzudämmen, da diese ihrer Ansicht nach vor dem Ersten Weltkrieg zur Krise des Zweiten Reiches und zum Fall der Monarchie geführt hätten. Dieses ideale Modell wird wegen der militärischen Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg vorübergehend einen Riss bekommen, es wird jedoch, Ironie des Schicksals, stärker als je zuvor in den USA wieder aufleben, und dies vor allem ab den dreissiger Jahren, als die Protestantische Ethik dank der von Talcott Parsons erfolgten englischen Übersetzung einen ersten grossen Erfolg zeitigen wird.7
Was also war das Faszinierende, das das weisse, protestantische und angelsächsische Amerika nun in dieser Studie entdeckt hatte, die im Europa der dreissiger Jahre weiterhin Tadel, Kritik und Einwände erntete? Ohne dem Fehler eines übertriebenen Schematismus zu verfallen, behaupte ich, dass das Amerika jener Jahre in der Protestantischen Ethik drei Faktoren einer umfassenden nationalen Kohäsion gefunden hatte: erstens den Glauben an den Kapitalismus, nicht nur als wirtschaftliches System, sondern auch als rationales Phänomen, das im Verbund mit einem asketischen und arbeitsamen Lebensstil Überbringer von Wohlstand und Glück bedeutete; zweitens der Glaube an den Protestantismus, der sich auf der höchsten Stufe der Rationalität im Bereich einer universellen Konzeption der Religionen äusserte, auf deren unterste Stufe laut Max Weber der Hinduismus und der Judaismus standen8; drittens den Glauben an den Parlamentarismus als bestes politisches System, und dies in Anbetracht der Diktaturen, die sich in jenen Jahren auf dem europäischen Kontinent formierten.9 Es war im Namen dieser Prinzipien, womit die USA ihren dann später siegreichen Kampf gegen den Nationalsozialismus und Faschismus führten. Diese triftigen Gründe wurden vorerst kaum in Frage gestellt und galten bis in die sechziger Jahre. Erst im Vorfeld der 68er-Bewegung wurden die erwähnten Prinzipien vor allem in Europa von einigen namhaften Intellektuellen, wie den der Frankfurter Schule angehörenden Jürgen Habermas und Herbert Marcuse, zur Diskussion gestellt.10
Die Vorstellung, dass sich die Menschheit einzig auf dem Weg der Vernunft weiterentwickeln kann – im Gegensatz zu Marcuse unterscheidet Weber eine rein instrumentelle nicht von einer den Menschen befreiende Rationalität verbreitete sich in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Werken von Norbert Elias über die Psychogenese und die Soziogenese des Staates. Im Vorwort zu seiner Studie Über den Prozess der Zivilisation von 193611 bezog sich Elias wörtlich auf den Teil der Wirtschaft und Gesellschaft, in der Max Weber die Frage nach der Entstehung des Staates gestellt hatte.12 Wie Weber schrieb, basiert jede Form eines „rationalen“ Staates in erster Linie auf dem rechtmässigen Gewaltmonopol: Ohne Gewalt würde dasselbe Konzept des Staates in sich zusammenbrechen. Für Elias jedoch setzte sich ein solches Monopol Schritt für Schritt mit dem Entstehen von Formen des psychischen Zwangs durch, die mit dem Erscheinen des modernen Individuums dessen Verhalten, seine Vorlieben und seine Gefühle tiefgreifend verändern und es so von der mittelalterlichen Anarchie zu einem höheren Grad der Zivilisation führen würden. Die wachsende Komplexität der sozialen Beziehungen würde unter den Menschen eine stärkere Abhängigkeit verursachen, die somit ein voraussehbares und vertrautes Verhalten erforderlich machte. Die Kontrolle über die eigenen Handlungen – die im Mittelalter einem engen Kreis von Wohlhabenden vorbehalten war – würde sich mit der Zeit auf die ganze Gesellschaft ausdehnen und ihre psychischen Strukturen tiefgreifend verändern: Was vorerst als ein bloss äusserliches Verbot angesehen wurde, würde in Folge sozusagen in einem grossen kollektiven Unterbewusstsein verinnerlicht werden. Die während des Ersten und Zweiten Weltkriegs begangenen Gräueltaten schienen den Vermutungen von Elias keineswegs Recht zu geben, und doch fanden seine Ideen einen breiten Konsens unter den Sozialwissenschaftlern der Nachkriegszeit, zumindest weil sie in irgendeiner Weise die in zwei Einflusssphären erfolgte Teilung der Welt, den Kalten Krieg und das Prinzip des Gleichgewichts des Schreckens, legitimierten. Ein anderer deutscher Soziologe, Gerhard Oestreich, prägte in jenen Jahren den Begriff Sozialdisziplinierung, um das Phänomen zu erklären, das seit dem Beginn der Moderne ganze Massen dazu bewegte, zu einfachen Vollstreckern des staatlichen Willens zu werden. Wenn aber laut Elias der Prozess der Zivilisation – für ihn grundsätzlich psychischer Natur – von Zeit zu Zeit von unten nach oben verlief, so war es laut Oestreich ohne jeglichen Zweifel, dass dieser Prozess – für ihn grundsätzlich autoritärer Natur – ausschliesslich von oben stammte und so nach eigenem Gutdünken den Alltag ganzer Bevölkerungen bestimmte. Oestreich schrieb, dass ein solcher Prozess, der anfänglich vor allem im militärischen und administrativen Bereich vorzufinden war, in der Folge andere Sektoren des Zusammenlebens erfassen würde und so in einer absoluten Weise dieselben Strukturen des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens der europäischen Länder verändern müsste. Die Reglemente der Schulen, der reformierten Kirchen und auch der Polizei seien da, um den Willen der Institutionen unter Beweis zu stellen, die tief in das private Leben der Bürger eingreifen, um sie zu höheren Formen der Rationalität und des zivilen Zusammenlebens zu führen. Nach seiner Ansicht würde sich also die Demokratisierung im 19. Jahrhundert ohne die vom vorangehenden Staatsabsolutismus geförderte und durchgesetzte Disziplinierung als undenkbar erweisen.13
In historiografischer Hinsicht sind die Überlegungen von Max Weber noch heute viel aktueller als je zuvor, wenn man die zahlreichen, nicht nur im deutschen Sprach- und Kulturraum erscheinenden Beiträge berücksichtigt, die sich mit dem Phänomen der Konfessionalisierung beschäftigen. Dieser als Prozess der sozialen Kontrolle, Korrektion und Indoktrinierung definierte Begriff ist seit dem Beginn der Moderne von den verschiedenen religiösen Konfessionen praktiziert worden. Während aber für Max Weber die Disziplin ein charakteristisches Merkmal des unternehmenden, asketischen und rationalen Subjekts war, das er wohl im Puritaner seiner Zeitepoche wahrgenommen hatte, was gleichsam ein Aspekt seiner moralischen Haltung war, beinhaltete die Disziplin für die Theoretiker der Konfessionalisierung ein von der Kirche von oben herab aufgezwungenes regelrechtes methodologisches Programm, das auf die Einordnung und Verhaltensweise der Gläubigen einwirkte.14 Wie wir sehen, sind wir ziemlich weit entfernt von Gerhard Oestreichs im Jahre 1969 beschriebenen Begriff der Sozialdisziplinierung. Betrachtet wurde diese weniger als Ursache, sondern vielmehr als Folge der von den absolutistischen Monarchien unternommenen Bemühungen, die religiösen Konflikte einzudämmen und das zivile Leben zu säkularisieren.
Von 1970 bis heute haben nicht wenige Studien die Stichhaltigkeit der Konfessionalisierung zu beweisen versucht: Bruce Gordon hat die Disziplinierung in Zürich zu Beginn der Reformation untersucht15, Hans-Juergen Goertz hat ihre Bedeutung bei den Baptisten nachgewiesen16, Klaus Ganzer hat ihre theologische Dimension in den katholischen Ländern veranschaulicht17, Louis Châtellier hat sie im Elsass aufgespürt18, Elena Fasano Guarini im Grossherzogtum Toskana19. Tatsächlich ist all diesen Studien gemeinsam, dass sie einen viel zu normativen Zugang zum wesentlichen Problem suchen. Das Vorhandensein von besonders repssiven Gesetzen, Dekreten und Beschlüssen beweist indes an und für sich nicht, dass diese auch real angewandt wurden. Zwischen der Norm und ihrer Anwendung besteht immer eine Diskrepanz, der wir Rechnung tragen sollten, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen, das von den Institutionen zu ihrem eigenen Vorteil verbreitete propagandistische Gerede wiederzugeben. Von diesem Standpunkt aus gesehen wäre es von Nutzen, sich bei Beginn jeder Forschung die Frage zu stellen, mit welchen Mitteln bestimmte Institutionen ihre eigenen Normen durchzusetzen vermögen. Wann werden diese nicht angewandt? Warum? Bestehen bedenkenswerte historische Bedingungen für ihren Aufschub? Welche Rolle spielen Verhandlungen zwischen Individuen, Gemeinschaften und Institutionen? Andere Forscher haben die oftmals viel zu staatsfixierte Annäherung an die Frage der sozialen Disziplinierung kritisiert. In einem vor wenigen Jahren erschienenen Artikel wies Heinrich Richard Schmidt darauf hin, dass einige Historiker immer noch den Fehler eines masslos übertriebenen Etatismus begehen. In den konfessionellen Prozessen, schreibt Schmidt, ist der staatliche Aspekt ganz und gar zufällig, und der Versuch, die Konfessionalisierung auf eine Art Sozialdisziplinierung zu reduzieren, führt auf einen Irrweg20. Eine Frage, die schliesslich eine genauere Antwort verdiente, ist die, die sich um die Beziehungen zwischen Gemeinschaften und kirchlichen Autoritäten dreht. Aus einer kommunalistischen Perspektive ist es nicht verständlich, aus welchem Motiv die dörflichen Gemeinden ihre Programme der sozialen Disziplinierung den lokalen Kirchen anvertrauten, da sie doch in der Lage waren, diese selber durchzuführen. Peter Blickle hat in seiner Habilitationsschrift nachgewiesen, wie in einigen Gegenden Norddeutschlands Handwerker und Bauern mit ihren Forderungen den Entscheidungsprozess beeinflussten, der die Billigung ihrer Satzungen betraf. Nicht wenige Male hätten die Untertanen gegen die lokalen Gewohnheiten verstossen, indem sie sich auf unabhängige Art und Weise selbst disziplinierten21.
Die Bedeutung der Lehre Max Webers ist so gross gewesen, dass auch heute noch, und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, die Vorstellung, zwischen Disziplinierung und Konsolidierung des Sozialstaates gäbe es mehr Ähnlichkeiten als Verschiedenheiten, fast wie ein Widerspruch angesehen wird. Für Gerhard A. Ritter, einen der bekanntesten Fachspezialisten, geht die Entstehung des Sozialstaats in Deutschland auf die Zeit des Zweiten Reichs zurück, als auf Geheiss von Bismarck ein System von Sozialversicherungen geschaffen wurde. In der Theorie diente es dem Schutz der Arbeiter, in Wirklichkeit aber verfolgte es die Absicht, die von der Sozialdemokratie erlangten Erfolge einzudämmen. In seiner Studie über Entstehung und Entwicklung des Sozialstaats sind lediglich zwei Seiten der frühen Neuzeit gewidmet22. Die vorerst von den protestantischen Ländern realisierte Säkularisierung der kirchlichen Güter hätte seiner Ansicht nach das Ziel gehabt, die Landstreicherei zu regeln, und sei keineswegs auf das Auftauchen neuer Formen von Armut und sozialer Ausbeutung zurückzuführen. Die Armut sei damals als ein moralischer Mangel verstanden worden, der mit Arbeit behoben werden konnte, und gegen welche die fürsorgerischen Bemühungen der ersten Reformatoren gar nichts genützt hätten. In Ritters Schrift gewinnt die von Weber geprägte Arbeitsethik die Oberhand über die von Gerhard Oestreich bezeichnete Disziplinierung und realisiert so ein Konstrukt, das nicht frei von Widersprüchen ist, aus dem aber schwer zu entrinnen ist: Arbeit und Fürsorge hätten der edleren Absicht der sozialen Disziplinierung gedient, die fundamentales Merkmal des Absolutismus der Neuzeit sei. Auch wenn wir nun annehmen, dass die Disziplinierungsmassnahmen, von denen die Quellen spchen, ganz real angewendet worden und nicht Teil eines weitläufigen Diskurses über Disziplin sind, und zwar nicht als ein von den Institutionen verbreitetes propagandistisches Bild, mit dem Zweck, sich selbst zu erhalten oder seinen Einflussbereich auszudehnen, muss man sich fragen, ob der oben genannte Zusammenhang in Wirklichkeit nicht vertauscht werden müsste, indem man die für die Fürsorge unabdingbaren Voraussetzungen, Arbeit und soziale Disziplinierung, hinter die Fürsorge stellte. Eine solche Operation hätte den Vorteil, die Fürsorge als eigentliche Dimension des kapitalistischen Geistes wieder ins Zentrum der sozialen Verhältnisse zu stellen. Die Arbeit, befreit von ihrem disziplinarischen Ursprung, würde somit mit der Fürsorgepolitik zusammenhängen, auch wenn diese nur einem engen Kreis von Individuen vorenthalten wäre. Die unbekannte Grösse in der Gleichung von Ritter ergibt sich aus der Variable des Reichtums. Tatsächlich spielt aber die Arbeit, obschon auf Disziplinierung ausgerichtet, seit der Neuzeit eine zentrale Rolle in der Gesellschaft: Es ist darum schwer nachvollziehbar, wohin der durch die Arbeit produzierte Reichtum floss, ausser es hätte sich um unproduktive Arbeit gehandelt, was aber ziemlich unwahrscheinlich ist.
Auch den zahlreichen Studien, die sich seit dem Beginn der achtziger Jahre das Ziel setzten, der Armut des Ancien Régime ein neues Gesicht zu geben, ist es trotz ihrer guten Absichten nicht gelungen, sich vom weberschen Paradigma der Disziplin zu befreien. Diese ist stärker denn je zuvor als Orientierungsmassstab wieder vorgeschlagen worden, um die vollständige Treue der katholischen Länder gegenüber der ‚Modernität’ zu bezeugen. Robert Jütte, einer der bedeutendsten Verfechter dieser These, hält die Vorstellung, die Reformation habe mit ihrer Abneigung gegen die guten Werke in irgendeiner Weise zur Säkularisation der Gesellschaft beigetragen, für veraltet und lehnt sie deshalb ab23. Der Autor ist der Meinung, dass einige in jüngster Zeit erschienene Studien den Mythos der Reformation, der sich die Linderung der Leiden anderer zur Aufgabe gemacht habe, zerstörten; schade nur, dass er uns keine Hinweise dazu gibt. Seine Studie, die sich mit der Armut und der Devianz in der frühen Neuzeit befasst, nimmt sich im siebten Kapitel der Reorganisation der Armenfürsorge an und analysiert so die Bilder, Gründe, Formen und die Ausbreitung der Armut, sowohl in den katholischen wie auch in den protestantischen Ländern. Von Nord- nach Südeuropa, von England nach Italien, von Deutschland nach Spanien schweifend versucht Jütte, Realitäten zu vermischen, die aus historischen und kulturellen Gründen eigentlich inkommensurabel sind. Auch seine Vorstellung der self-help assistance, dass die Armen sich problemlos gegenseitig hätten helfen können, bleibt alles in allem zwar eine hervorragende theoretische Eingebung. Sie lässt uns aber von einem heuristischen Gesichtspunkt aus unbefriedigt, gerade darum, weil sie vermeidet, dem Problem auf den Grund zu gehen, das heisst sich mit dem Phänomen des historischen Wandels zu befassen. Die Tatsache, dass einige Normen, die aus verschiedenen Ländern stammen, einen gemeinsamen Diskurs über die Armut beinhalten, indem sie die authentischen von den scheinbaren Armen unterscheiden, beweist ziemlich wenig im Hinblick auf die Ebene der sozialen Schichtung und die institutionellen Strategien. Was wir hingegen mit grösserer Sicherheit sagen können, ist, dass die Reform der Fürsorgepolitik in Europa in erster Linie von den protestantischen Ländern gefördert wurde. Wie Robert Jütte schreibt, waren Wittenberg, Leisnig, Nürnberg, Strassburg und Augusta die ersten Städte, welche ab 1520 den eigenen Sozialstaat zu reorganisieren begannen24. Mit Ausnahme von Yps und Bruges sind in den katholischen Ländern ähnliche Reformen ab 1530 in Gang gesetzt worden. In Wirklichkeit aber behaupteten sie sich erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, als nicht wenige katholische Städte sich neue Regelungen auf medizinischem und fürsorgerischem Gebiet auferlegten.
Kapitel 1 - Die Fürsorge
1.1 Armut und Fürsorge im Spätmittelalter
Mit dieser Arbeit habe ich mir vorgenommen, eine Geschichte der Fürsorgepolitik zu schreiben, die dem historischen Wandel Rechnung trägt. Keinesfalls geht es mir indessen darum, alte Polemiken wieder aufzuwärmen, die ihrerseits übrigens schon vor geraumer Zeit beschwichtigt worden sind. Es handelt sich letztlich darum, mit Hilfe einer zusätzlichen Quellenanalyse der These von Ole Peter Grell Rechenschaft zu geben, der da schreibt, dass die Reformation einen essenziellen Beitrag zur Reorganisation der Fürsorge in den Städten des Ancien Régime geleistet hat25. Andere Studien scheinen sich in diese Richtung zu bewegen, nicht zuletzt diejenige von Thomas Fischer, der, von den Fällen Basel, Freiburg im Breisgau und Strassburg ausgehend, anerkennt, dass die Reformation in diesen Städten tatsächlich eine regelrechte Wende in der Sozialpolitik herbeigeführt hat26. Der Begriff „Sozialpolitik“ ist zwar, wie Fischer schreibt, in vorindustrialisierten Gesellschaften mit Vorsicht zu gebrauchen. In den erwähnten Fällen ist er aber legitim, berührte doch in diesem Zusammenhang das Problem der Armut die politischen Interessen der Magistrate, die sich mit ihren Massnahmen nicht nur die Zustimmung ihrer Untertanen sicherten – vielleicht behaupteten sie auch ihr Prestige mit einer gleichmässigeren Verteilung des Reichtums –, sondern auch die Randständigen in das produktive Gefüge ihrer Gemeinden einzugliedern versuchten.27 Diese These scheint umso plausibler, wenn man in Betracht zieht, dass die Armut im 16. Jahrhundert in Europa – wie wir aus den diesbezüglichen Studien kennen28 – mit grosser Wahrscheinlichkeit zunahm. Die Preissteigerungen – insbesondere jene von Getreide – und die Stagnation der Löhne, schreibt Wilhelm Abel, hatten zahlreiche Familien in tiefe Armut gestürzt, während das Bevölkerungswachstum noch nicht jenen konstanten Zuwachs des Reichtums gewährte, das es erst 200 Jahre später im Laufe des 18. Jahrhunderts zu erzeugen vermochte. Es ist anzunehmen, dass die Anzahl der Bettler im 16. Jahrhundert konstant zugenommen haben dürfte, was sicherlich die städtischen Autoritäten alarmierte, wie zahlreiche politische und gerichtliche Quellen jener Epoche belegen. Dieser Prozess führte mit grosser Wahrscheinlichkeit zu einer Verschärfung der sozialen Konflikte und zu einer Radikalisierung der Kämpfe der Bauern, die zumindest in einer ersten Phase ihren gewissermassen „natürlichen“ Ausweg zu den von den Reformatoren erhobenen Forderungen und Prinzipien gefunden hatten. Wie anders kann die Wut von Thomas Münzer und dessen Hass gegen Mönche und Prälaten erklärt werden, als mit der Tatsache, dass die Kirche jener Epoche zusammen mit der Landaristokratie eine der tragenden Säulen des Feudalsystems war?29 Wie könnten wir vergessen, dass unter den von den Bauern Oberschwabens im Jahre 1525 verfassten Forderungen die Aufhebung des Zehnten oder zumindest dessen Einsatz zugunsten der Armen und der Bewohner der ländlichen Gemeinden an erster Stelle stand? Wie könnte die Tatsache unbeachtet bleiben, dass unter ihren Forderungen, nebst der Abschaffung der Leibeigenschaft stärker als je zuvor das unbegrenzte Recht auf Jagd und Fischerei figurierte, und zwar nicht als aristokratischer Zeitvertreib, sondern als Sicherung der Lebensmittelversorgung? Die freie Wahl des Pfarrers ist meiner Ansicht nach auf diese Art Forderungen zurückzuführen: Der Pfarrer war nicht nur religiöser Diener, sondern auch eine äusserst wichtige politische Person, von deren Entscheidungen Wohl und Übel der wirtschaftlichen Angelegenheiten der Gemeinde abhing. Die Pfarreien waren neben ihrer Versehung von sozialen Diensten auch Zentrum einer wohlverstanden lukrativen Tätigkeit, die von Nachfrage und Angebot von landwirtschaftlichen und handwerklichen Produkten gespeist wurde. Den einen Pfarrer lieber als den anderen zu wählen, war also vor allem eine relevante politische Wahl, die sowohl auf öffentlicher wie privater Ebene spürbare Auswirkungen haben konnte.
Es sind also nicht wenige Gründe, die zur Annahme führen, dass von der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts an eine starke Zunahme der Armut das wenige, das von der mittelalterlichen Barmherzigkeit übrig geblieben war, zuschüttete und so der politischen und religiösen Welt neue Formen der sozialen Fürsorge aufdrängte. Die Wende ist meiner Ansicht nach um 1525 anzusetzen, als es den protestantischen Fürsten nach der Unterdrückung der Bauernaufstände in den südwestlichen deutschen Gebieten bewusst wurde, dass die sozialen Fragen letztlich nicht manu militari gelöst werden konnten.
In seiner Studie über die Armut nennt Wolfram Fischer drei während des Mittelalters im Kampf gegen das Elend engagierte Institutionen: die Pfarrei, das Kloster und das Spital.30 Zu diesen kamen andere wie die Zünfte, die Bruderschaften, die Waisenhäuser, die Siechenhäuser, die Hospize für Invalide, Bettler und Blinde hinzu. Eine wichtige Unterstützung leisteten zweifellos Verwandte und die Nachbarschaft, auch wenn ich in diesem Punkt der Ansicht bin, dass wir uns dazu nicht allzu grosse Illusionen machen müssen: Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung war mit der harten Feldarbeit beschäftigt, und die Ressourcen, die den Bedürftigsten ein würdiges Leben ermöglicht hätten, waren oft begrenzt und von kurzer Dauer. Seit ihrer fernsten Vergangenheit hatten Kirchen und Klöster eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf all jene ausgeübt, die sich, wenn auch nur zeitweilig, in einem Zustand des Unglücks und der Verzweiflung befanden: die Fürsorge für die Armen, Alten, Invaliden, Waisen und Bettler war eine der tragenden Säulen, auf der die christliche caritas schon immer stand. Über ihre Absichten gibt es keine Zweifel, doch sollte ihre Rolle einer Linderung verspchenden Instanz der durch die Armut verursachten Schmerzen keineswegs überschätzt werden, insbesondere wenn man in Betracht zieht, dass nur ein Teil des von der Kirche eingetriebenen Zehnten zu einem fürsorgerischen Zweck eingesetzt wurde.31 Andererseits lebten Kirchen und Klöster auch von Zuwendungen und Schenkungen, die von frommen und vermögenden Personen stammten: diesbezügliche Studien neuesten Datums haben jetzt nachgewiesen, dass diese karitative Disposition im Lauf der Zeit nicht immer konstant geblieben ist und dass den von einer hervorragenden Grosszügigkeit gekennzeichneten Zeiten auch Perioden tiefsten Geizes nachfolgten: so im Fall der Schenkungen an Köln Ende des Mittelalters. Bei der Lektüre kann man hierzu entnehmen, wie die Grosszügigkeit der Einwohner im Laufe des 16. Jahrhunderts unerbittlich tief einbrach.32
1.2 Die Spitäler im deutschen Sprachraum
Im Laufe der Jahrhunderte erlangte das Spital im Kampf gegen das Elend tatsächlich ein wachsendes Ansehen: Entstanden zur Aufnahme bedürftiger Pilger an einem bestimmten Ort – von dort der mittelalterliche Begriff xenodochium – war das Spital im Lauf der Jahrhunderte zu einem im Wesentlichen säkularisierten Ort geworden, der von der Gemeinde geführt wurde und sich um die Einsammlung und die Verteilung des in erster Linie auf dem Land produzierten Reichtums kümmerte. Wie Marino Beregno schreibt, war das Spital in vielen europäischen Städten der grösste Immobilienbesitzer. Im Jahre 1318 bedeckten die Landgüter des Spitals von Santa Maria della Scala eine Fläche von 489 Hektaren: das Institut war zur selben Zeit auch einer der grössten Kreditgeber der Gemeinde Siena.33 Diese Zahlen erscheinen umso interessanter, wenn man bedenkt, dass in der vorindustriellen Gesellschaft das Grundeigentum eine der bedeutendsten Einnahmequellen war. Von ihm stammte der Grossteil der Rohstoffe und der Nahrungsmittel, die zum kommerziellen Handel oder zur Versorgung der Städte bestimmt waren. In den Städten waren die Besitzer von Immobiliengütern rar, bestanden doch drei Viertel der Bevölkerung aus Handwerkern, Tagelöhnern, Dienern und Bettlern. Wir müssen uns darum nicht wundern, dass wir sehr oft eine unternehmerische Mentalität in der Führung eines Spitals vorfinden. Es ist bekannt, dass tatsächlich nur jene Bürger in die Direktion eines Spitals gewählt werden konnten, die mit ihrem Eigentum im Falle eines Verlusts die Begleichung der Schulden garantieren konnten. Diese zumindest in den Statuten des Magdalenenhospitals von Münster, des Heilig-Geist-Hospitals von Nürnberg und des Heilig-Geist-Hospitals von Frankfurt stehende Vorschrift verlangte vom Leiter eines Spitals eine rigorose Führung der Rechnungsbücher, die regelmässig vom Bürgermeister, den Rechnungsprüfern und den kommunalen Schatzmeistern kontrolliert wurden.34 Von den Spitalleitern wurde nebst grundlegenden linguistischen Kenntnissen wie Lesen und Schreiben auch vertieftes Wissen auf dem Gebiet des Rechts, der Finanzen und der Oekonomie verlangt. Ihnen wurde die vollumfängliche Aufsicht über die Internierten wie auch die Einstellung des Personals anvertraut. Ihr Amt wurde mit Bargeld wie auch mit Naturalien entlöhnt: Oftmals wurde ihnen eine Wohnung im Innern des Spitalgebäudes gewährt. Schon seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts war das Spital im deutschen Sprachraum nicht mehr ein Ort, in dem ausschliesslich die Kranken gepflegt wurden. Vielmehr hatte es Funktionen übernommen, die früher anderen fürsorgerischen Stätten gehörten, und wurde gleichzeitig Herberge für Wandersleute, Hospiz für Alte, Geburtshaus für schwangere Frauen und zum Waisenhaus: alles in allem ein Ort also – wie es die Quellen bezeugen „ in quo pauperes, peregrini transeuntes, mulieres in partu egentes, parvuli a patribus et matribus derelicti, debiles et claudi, generaliter omnes, recipi consueverint“.35 Wie Siegfried Reicke schreibt, wurde das Spital zu einem Instrument einer in den Händen des Bürgertums liegenden Wohlfahrtspolitik.36 Dieser Wandel wurde von einer zunehmenden Säkularisierung des Personals wie auch von einer wachsenden Verbreitung des Pfründewesens begleitet. In Anbetracht der abnehmenden Schenkungen – ein Phänomen das mit grosser Wahrscheinlichkeit der wachsenden Säkularisierung der Zivilgesellschaft zuzuordnen ist – sahen sich viele Spitäler dazu gezwungen wenigstens teilweise auf das Prinzip der kostenlosen Aufnahme zu verzichten und ihre Dienste für garantierte, nunmehr lebenslängliche Erträge zu leisten, die, wie oben erwähnt, Pfründe genannt wurden. Die Anzahl der Pfründner wird also zu einer wichtigen, wenn auch nicht einzigen Einnahmequelle der Finanzen des Spitals führen, ohne aber sich auf die Fürsorgepolitik der Städte auszuwirken, die, wie wir sehen werden, von ebenso vielen anderen Formen von Altruismus und Grosszügigkeit charakterisiert sind. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die gesunden Pfründner – wie auch alle anderen gesunden Insassen - statutengemäss gezwungen waren, irgendeine ihnen von der Direktion anvertraute amtliche Aufgabe auszuführen, was eine zusätzliche Einnahmequelle für die Kassen der Institution bedeutete37.
Das Funktionieren, die Struktur und die Organisation der Spitäler des Mittelalters und der Neuzeit sind in einer langen Serie von Studien gut dokumentiert, die sich insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg die Aufgabe stellten, sich Klarheit über die Methoden und Instrumente zu verschaffen, die dazu bestimmt waren, die Armut in der Gesellschaft des Ancien Régime zu bekämpfen. Was das deutsche Sprachgebiet betrifft, sei an die Studie von Rudolf Kleiminger über das Spital von Wismar erinnert38, an jene von Werner Haug über das Spital Sankt Katharinen in Esslingen39, die Pionierarbeiten von Karl Wellschmied über die Spitäler von Göttingen, die Forschungen von Rudolf Seigel über das Spital von Altwürttemberg und die von Hannes Lambacher über die Stadt Memmingen40. Dank der Durchsicht, der Transkription und der Studie von Buchhaltungsdokumenten, Protokollen, Reglementen, Chroniken und Gebäudegrundrissen sind wir heute in der Lage, ein ziemlich genaues Bild des Lebens zu zeichnen, das sich zu jener Zeit im Innern eines Spitals abgespielt haben dürfte. Wir wissen beispielsweise, dass die Insassen eine grosse Menge Wein, Bier, Fleisch, Fisch, Geflügel und Gewürze konsumierten und dass sie gewöhnlicherweise Brot aus Roggenmehl assen. Rudolf Kleiminger hat berechnet, dass im Spital von Wismar im 16. Jahrhundert jährlich um die 27'200 Liter Bier getrunken worden sei, das heisst täglich durchschnittlich 3 Liter Bier pro Person. Der durchschnittliche tägliche Konsum von Fleisch war in derselben Periode um die 200-300 Gramm pro Person, jene von Fisch um die 50-100 Gramm. Im Jahre 1474 erhielten die Insassen täglich im Durchschnitt 2,5 Pfund Roggenmehl, das heisst etwas mehr als ein Kilo Brot pro Kopf.41 Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurden im Spital von Sankt Georg in Hamburg jedes Jahr um die 12'600 Kilo Fleisch konsumiert: wenn man also bedenkt – wie es die Studie von Wolfgang Berger behauptet – dass das Spital in derselben Zeit im Ganzen 60 Insassen beherbergte, resultiert daraus deutlich, dass jedem von ihnen durchschnittlich um die 560 Gramm Fleisch zur Verfügung stand. Im gleichen Spital gab es zu Beginn des 16. Jahrhunderts einen jährlichen Konsum von 20 Tonnen Roggenmehl, das heisst einen täglichen Durchschnitt von etwas weniger als einem Kilo Roggenmehl pro Person42. Barbara Krug-Richter hat berechnet, dass in den Jahren 1569/1570 der durchschnittliche tägliche Konsum von Fleisch um 280 Gramm, von Fisch um 30 Gramm, von Roggen um 900 Gramm und der von Butter und Käse um die 160 Gramm war: im selben Zeitraum lag der durchschnittliche tägliche Konsum von Bier um 2 Liter pro Person.43 Daten ähnlicher Art tauchen auch in den wenigen ökonomischen Studien, die sich mit den schweizerischen Spitälern der frühen Neuzeit befassen, auf: Stefan Sonderegger ist im Spital von Sankt Gallen auf eine ausgeprägte Diskrepanz zwischen den Ressourcen an Lebensmitteln und ihrem Konsum gestossen. Tatsächlich scheint es, dass in den Jahren 1442-1443 die Menge von Getreide den Bedarf an Nahrungsmitteln von gegen 400 Personen abgedeckt hat, während die effektive Anzahl der Insassen laut Sonderegger nicht mehr als 100-200 Personen betragen haben dürfte44. Von diesem Bild ausgehend können wir uns nicht viele Szenarien vorstellen, die um das Verhältnis zwischen allgemeinem Lebensmittelkonsum und individuellen Verbrauch kreisen. Einer ersten Hypothese folgend könnten wir tatsächlich annehmen, dass die Insassen alle zusammen überernährt, wenn nicht sogar fettleibig gewesen wären, und somit könnten wir aufhören, uns Fragen über die Glaubwürdigkeit der Quellen zu stellen und sie allesamt als zuverlässig anerkennen. Wenn wir diese erste Hypothese ablehnen, weil wir sie als unwahrscheinlich erachten, könnten wir annehmen, dass nur ein Teil der Insassen wirklich überernährt gewesen sei, da der Rest nur genügend ernährt wurde. Tatsächlich wäre es möglich, dass die uns zur Verfügung stehenden Quellen nur die Spitze des Eisbergs zeigen: in diesem Fall wäre die Anzahl der vom Spital zur Beherbergung aufgenommenen und ernährten Personen weit grösser als jene, die wir bei einer klassischen Interptation der Quellen üblicherweise annehmen würden. Dies ist die Hypothese, die ich im Laufe dieser Abhandlung zu stützen beabsichtige mit dem Ziel aufzuzeigen, dass die Spitäler der Frühzeit sozusagen die Transmissionsriemen der von den Städten geförderten und durchgeführten Sozialpolitik waren.
1.3 Die Stadt
Bevor wir dazu übergehen, das Netz der Interessen und Beziehungen zu beschreiben, die das Spital mit seinem Territorium vereinten, ist es von Nutzen, einen Schritt zurückzugehen und zu betrachten, wie die Stadt in den Augen eines hypothetischen Reisenden des 15. Jahrhunderts ausgesehen haben mag. Zürich war am Ende des Mittelalters eine Provinzhauptstadt mit circa 6000 Einwohnern, die vorwiegend von Frauen bewohnt war und aus eher kleinen Familienhaushalten mit normalerweise nicht mehr als zwei bis vier Personen bestand. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts hatte eine lange Serie von Konflikten – zuerst mit Österreich und dann mit den Kantonen der Innerschweiz – die Stadt verarmen lassen und so das Überleben des Handels und des Handwerks auf eine harte Probe gestellt: die im 14. Jahrhundert noch florierende Seidenfabrikation war fast von der Bildfläche verschwunden und liess eine nicht mehr zu füllende Lücke in der Wirtschaft der Stadt zurück. Zu den kriegsbedingten Schäden kamen sehr bald jene der Pest hinzu, die zwischen 1439 und 1450 mehrmals wütete und die Bevölkerung dezimierte. Zählte Zürich im Jahre 1410 noch 1345 Häuser, so war dessen Anzahl im Jahre 1467 auf 1206 gesunken: von diesen waren 73 leer stehend und 103 von Klerikern bewohnt.45 Die zum Teil gepflasterten Strassen besassen noch keine Kanalisation: Abfälle und Fäkalien wurden neben den Wohnhäusern in übel riechenden Latrinen oder Faulgruben entsorgt. Ganze Herden von Schweinen, Gänsen, Enten und anderen Haustieren liefen durch die mittelalterlichen Gassen; zudem trugen auch der Ausschuss der Gerbereien und die Abfälle der verschiedenen Märkte zu einer fast unerträglichen Atemluft bei. Eine Verfügung aus dem Jahre 1403 verbot, unter Androhung einer Busse von 5 Schilling pro Tier, den Stadtbewohnern, ihre Schweine auf den Strassen umherziehen zu lassen.46 Eine andere Verfügung aus dem gleichen Jahr verbot den Händlern, ihre Kisten auf den Brücken oder noch schlimmer vor dem Rathaus zurückzulassen.47 Die Anlagen der Wasserleitungen stammten grösstenteils noch aus dem 13. Jahrhundert, und das Wasser, das nicht von Hand gepumpt wurde, wurde von einem Heer von Tagelöhnern in der Limmat geholt und auf den Schultern weitertransportiert. Die Behausungen waren fast alle aus Kalk und Holz. An der Fassade des Rathauses und um die Türme des Grossmünsters rankten sich unzählige Baugerüste. Die Wasserkirche wurde erst später gebaut und 1484 eingeweiht. Im Jahre 1467 lag ein Viertel des steuerpflichtigen Kapitals in den Händen der fünfzehn reichsten Familien der Stadt: von 1969 potenzielle Steuerzahlern waren 679 von den Steuern befreit, 880 zahlten weniger als einen Gulden, 304 zwischen einem und fünf Gulden, 58 zwischen fünf und zehn Gulden und 48 über zehn Gulden. Der grösste Teil der Einwohner lebte demzufolge in bescheidenen Verhältnissen, weit entfernt vom Prunk vieler anderer europäischer Metropolen.48 Zürich war aber auch eine Stadt, in der die Macht des Klerus deutlich zu spüren war. Seine Bettelorden, wie auch seine zahlreichen Pfarreien, Abteien und Klöster hatten einen schwerwiegenden Einfluss auf die politischen Entscheidungen der Stadtbürger. In Zürich zählte man vier grosse Klöster, zwei Dominikaner – eines männlich, das andere weiblich – eines der Franziskaner und eines der Augustiner. Bruderschaften wie das Grossmünster und das Fraumünster besassen Vermögen im Wert von 6000 bis 9000 Silbertaler, das heisst den Gegenwert von etwa 300 bis 500 Landgütern.49 Seit der Zeit von Rudolf Brun (1300-1360) lag das Schicksal der Stadt in den Händen einer kleinen Oligarchie von bürgerlichen Familien, den Constaffeln, die im Einvernehmen mit den Zünften sich die institutionellen Ämter untereinander aufteilten und sich vehement gegen jeden von unten kommenden Versuch einer Reform wehrten. Demzufolge wurden die wenigen Angriffe des nicht in den Zünften organisierten städtischen Bürgertums – wie jene im Jahre 1350 – rechtzeitig blutig unterdrückt. In Wirklichkeit lastete ein grosser Teil der politischen Macht, auf der die Überlegenheit von Klerus und Adel basierte, auf den ländlichen Gebieten, die mit ihren Abgaben einen wesentlichen und unersetzlichen Beitrag zum Erhalt der staatlichen Institutionen leisteten.
1.4 Das Umland
Es ist einleuchtend, dass diese Abgaben nicht immer willkommen waren, vor allem wenn wegen schlechten Wetters die Preise der Lebensmittel – insbesondere die des Getreides, dem zu jener Zeit wichtigsten Nahrungsmittel - ins Unermessliche stiegen und die Bauern auf den Kauf von Fertigwaren verzichten oder sich verschulden mussten. Die Zeitperiode von 1450 bis 1550 ist unter Meteorologen für ihr besonders warm-feuchtes Klima bekannt. Die in den letzten Jahrzehnten erfolgten Studien über das Wachstum der Lärchenrinde im alpinen Raum haben für diese Zeitperiode einen überdurchschnittlichen Anstieg der Sommertemperaturen festgestellt. Es ist somit wahrscheinlich, dass in Zusammenhang mit diesem Phänomen die Sommergewitter wegen der höheren Luftfeuchtigkeit zugenommen haben.50 Diese Tatsache scheint ihre Bestätigung in einigen Zeitchroniken zu finden, wie in jener von Laurencius Bosshart aus Winterthur, der über die Jahre von 1511 bis 1522 von kalten Wintern, heissen Sommern, starken Winden und ungewöhnlichen Niederschlägen berichtet.51 Es scheint sogar, dass es im Jahre 1515 vom 25. Mai bis 28. August ununterbrochen geregnet hat, und zwar in einem solchen Ausmass, dass viele Eidgenossen wegen des Hochwassers und den Überschwemmungen im Herzogtum Mailand Zuflucht finden mussten.52 Am 15. Juli 1516 zerstörte ein heftiger Hagelsturm in Zürich Fenster und Rebberge.53 Ereignisse dieser Art waren im Stande, sämtliche landwirtschaftliche Produktion der Region zu schädigen, deren Folgen in den Klöstern und Patrizierhäusern zu spüren waren. Ein anderes bekanntes Zeugnis ist jenes des Berner Chronisten Diebold Schilling, der uns berichtet, dass es im Juli des Jahres 1480 so viel regnete, dass einige Häuser überschwemmt wurden und ihre Bewohner sie verlassen mussten, um sich zu retten. Das Hochwasser zerstörte Brücken, riss Mühlen mit sich fort, entwurzelte Bäume und drang in Warenlager- und Kaufhäuser ein.54 Ein Jahr später riss im Berner Umland ein Sturm Häuser, Bäume, Wach- und Kirchentürme fort.55 Im Jahre 1489 gelang es dem Rat von Zürich, die Wut der ländlichen Gebiete zu besänftigen, indem er den Bürgermeister Hans Waldmann zum Tode verurteilen liess, der für die Misere, in der die armen Leute seit Jahren lebten, verantwortlich gemacht wurde.56 Es war dies nicht das erste Mal, dass sich die ländlichen Gebiete gegen die verfassungsmässige Ordnung erhoben: bäuerliche Aufstände hatte es im ganzen Verlauf des 15. Jahrhunderts gegeben. Im Jahre 1441 drohten die Einwohner von Grüningen sich mit dem Rivalen Schwyz zu vereinigen, falls Zürich deren Forderungen bezüglich des freien Anbaus der Rebberge und der Steuerbefreiung nicht nachkomme. 1468 waren es die Einwohner von Wädenswil und Richterswil, die sich gegen die Steuerpolitik der Stadt erhoben.57 Der Konflikt zwischen Stadt und Umland hatte sich allem Anschein nach schon in den sechziger Jahren des 15. Jahrhunderts verschärft, als Zürich zur üblichen Grundsteuer, die in der Regel fünf Promille pro Person betrug, eine weitere von fünf Schilling hinzufügte, das heisst von vier Plappart, woher der abschätzige Begriff Plappartgeld stammt.58 Die Bauern beschwerten sich darüber, dass die Abgaben ungerecht seien, da „der arm so vil geben muss als der rich“, und hielten die vielen erlassenen Vorschriften für unverhältnismässig und willkürlich, wie das Nichtzulassen des Holzschlags junger Tannen, das Jagd- und Fischverbot, die wegen angeblicher Wildschäden erlassene Verordnung, die eigenen Hunde abzutun, oder das Verbieten der Pflanzung neuer Rebstöcke oder der Festlegung eines fixen Erntedatums. Sie beklagten sich auch darüber, dass der Rat die Versetzung der Grenzsteine auf den Feldern veranlasst habe und die Prozesskosten viel zu hoch seien.59 Diese Beschwerden – von denen die ältesten bis in das ausgehende 14. Jahrhundert zurückreichen -,60 beweisen in Wirklichkeit, dass sich die Sorgen der Bauern hauptsächlich auf Überlebens- und nicht wie beim Adel auf Genussfragen bezogen, und häufen sich insbesondere in den Jahren von 1482 bis 1490, als Zürich von einer plötzlichen unerwarteten Preiserhöhung der Nahrungsmittel betroffen war.
[...]
[1] Für eine ausgedehntere Vertiefung siehe Hartmut Lehman und Gunther Roth (Hrsg.), Weber’s Protestant Ethic. Origins, Evidence, Contexts, Washington D.C., German Historical Institute, 1993, S. 55 und die Anthologie von Philippe Besnard, Protestantisme et Capitalisme. La Controverse post-weberienne, Paris, Armand Colin, 1970, S. 7.
[2] Neben der monumentalen Biografie von Michael Sukale, Max Weber – Leidenschaft und Disziplin. Leben, Werk, Zeitgenossen, Tübingen, Mohr Siebeck, 2002, sei unter vielen anderen an die Untersuchung von Michael H. Lessnoff, The Spirit of Capitalism and the Protestant Ethic. An Enquiry into the Weber Thesis. Vermont, Edward Elgar, 1994 und an das Essay von Annette Disselkamp, L’éthique protestante de Max Weber, Paris, Presses Universitaires de France, 1994, erinnert.
[3] Zur Rezeption des Werkes von Max Weber in der angelsächsischen Welt siehe Agnes Erdelyi, Max Weber in Amerika. Wirkungsgeschichte und Rezeptionsgeschichte Webers in der anglo-amerikanischen Philosophie und Sozialwissenschaft, Wien, Passagen Verlag, 1992. Zur Rezeption von Max Weber in Italien siehe den Band von Gabriele Cappai, Modernisierung, Wissenschaft, Demokratie. Untersuchungen zur italienischen Rezeption des Werkes von Max Weber, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1994.
[4] Kurt Samuelsson, Religion and Economic Action, New York, Basic Books, 1961, S. 137-150.
[5] Jacques Delacroix und François Nielsen, The Beloved Myth: Protestantism and the Rise of Industrial Capitalism in Nineteenth-Century Europe, in Social Forces, December 2001, 80 (2), S. 509-553.
[6] Michael Sukale, a.a.O., S. 560-561.
[7] Agnes Erdelyi, a.a.O. S. 99 ff.
[8] Über den Antisemitismus von Max Weber und seiner Definition der Juden als Paria-Volk verweise ich auf die Studien von Michael Spöttel, Max Weber und die jüdische Ethik. Die Beziehung zwischen politischer Philosophie und Interptation der jüdischen Kultur, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1997 und von Gary. A. Abraham, Max Weber and the Jewish Question: A Study, of the Social Outlook of His Sociology, University of Illinois Press, 1992.
[9] Über die Beziehungen, die Max Weber mit den Begriffen des Parlamentarismus und der Demokratie unterhält, siehe Paragraph 6 des Kapitels IX.8 von Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie, hrsg. von Johannes Winckelmann, Tübingen, Mohr, 1956.
[10] Herbert Marcuse, Industrialisierung und Kapitalismus, in Otto Stammer (Hrsg.), Max Weber und die Soziologie heute, Tübingen, 1965, S. 161-180 und Jürgen Habermas, Technology and Science as Ideology, in Toward a Rational Society, Boston, Beacon Press, 1971, S. 81-122 wie auch Aspects of Rationality of Action, in Rationality To-Day, Ottawa, University of Ottowa Press, 1979, S. 185-205. Siehe auch Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1981.
[11] Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1976, S. lxxviii.
[12] Max Weber, Der rationale Staat als anstaltsmässiger Herrschaftsverband mit dem Monopol legitimer Gewaltsamkeit, in Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie, a.a.O., Paragraph 2, Kap. IX.8 .
[13] Gerhard Oestreich, Strukturprobleme des europäischen Absolutismus, in Geist und Gestalt des frühmodernen Staates, Berlin, Duncker & Humblot, 1969, S. 179-197.
[14] Max Weber, Die Disziplinierung und die Versachlichung der Herrschaftsformen, in Wirtschaft und Gesellschaft, a.a.O., S. 690-695.
[15] Bruce Gordon, Die Entwicklung der Kirchenzucht in Zürich am Beginn der Reformation, in Heinz Schilling (Hrsg.), Kirchenzucht und Sozialdisziplinierung im frühneuzeitlichen Europa, Berlin, Duncker & Humblot, 1994, S. 65-90.
[16] Hans-Juergen Goertz, Kleruskritik, Kirchenzucht und Sozialdisziplinierung in der täuferischen Bewegung der frühen Neuzeit in Ebd. S. 183-198.
[17] Klaus Ganzer, Das Konzil von Trient und die theologische Dimension der katholischen Konfessionalisierung , in Wolfgang Reinhard und Heinz Schilling, (Hrsg), Die katholische Konfessionalisierung, Heidelberg, Gütersloher, 1995, S. 50-69.
[18] Louis Châtellier, Die Einführung des tridentinischen Katholizismus und die Konfessionalisierung in Elsass und Lothringen 1500-1650, in Ebd., S. 384-393.
[19] Elena Fasano Guarini, Produzione di leggi e disciplinamento nella Toscana granducale tra Cinque e seicento. Spunti di ricerca, in Romano Prodi (Hrsg.), Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo e età moderna, Bologna, il Mulino, 1993, S. 115-153.
[20] Heinrich Richard Schmidt, Sozialdisziplinierung? Ein Plädoyer für das Ende des Etatismus in der Konfessionalisierungsforschung, in Historische Zeitschrift, 265 (1997), S. 640-681.
[21] Ebd., S. 668-669. Diesbezüglich siehe auch die Studie von Peter Blickle, Steven Ellis und Eva Österberg in The Commons and the State: Repsentation, Influence and the Legislative Process, in Peter Bickle (Hrsg.), Resistance, Repsentation, and Community, Clarendon Press, 1997, S. 115-153.
[22] Gerhard A. Ritter, Der Sozialstaat. Entstehung und Entwicklung im internationalen Vergleich, München, R. Oldenbourg, 1991, S. 34-35.
[23] Robert Jütte, The Poor helping themselves, in Poverty and Deviance in Early Modern Europe, Cambridge University Press, 1994, S. 83-99.
[24] Ebd., S. 105-107
[25] Peter Grell und Andrew Cunningham (Hrsg.), Health Care and Poor Relief in Protestant Europe 1500-1700, London, Routledge, 1997, S. 60: „Let me conclude by emphasising that by seeking to re-insert the Reformation into the story about early modern innovations in poor relief and health care provision, I am not arguing that Protestantism alone brought about these changes, or that social and economic factors were of little or no consequence, but only that the Reformation was responsible for the speed and to some extent for the nature of these changes.“
[26] Thomas Fischer, Städtische Armut und Armenfürsorge im 15. und 16. Jahrhundert, Göttingen, Otto Schwartz, 1979, S. 265: „Das macht deutlich, dass die Reformation, auch wenn sie nur mit Einschränkungen auf der Ebene der Ideen zur Unterstützungsreform wegbereitend war, was die Praxis angeht, in den hier behandelten Städten den entscheidenden Wandel herbeiführte. Denn nur dort (Beispiel Strassburg und Basel) konnten die Obrigkeiten wirksame und traditionelle Normen aufhebende Veränderungen durchführen, wo durch die Reformation die letztlich entscheidende Frage der Finanzierung des gemeinen Almosens – eine allgemeine Armensteuer gab es nicht – rasch gelöst werden konnte.“ Die Absichten der Reformatoren im fürsorgerischen Bereich sind sehr gut beleuchtet worden in der Studie von Arnold Werner So zialgeschichte Süddeutschlands unter besonderer Berücksichtigung der sozialen und karitativen Arbeit vom späten Mittelalter bis zur Gegenwart, Stuttgart, Konrad Theiss, 1979.
[27] Ebd., S. 162: „Denn die Ziele der Magistrate gingen über eine blosse Steuerung der gewohnten Almonsenvergabe hinaus. Neben die Versorgung trat die Regelung von Arbeit und Musse der Armen und damit der Versuch, sozial Entwurzelte an die gesellschaftliche Ordnung des Bürgertums anzupassen.“
[28] Wilhelm Abel, Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Deutschland, Göttingen, Kleine Vandenhoeck-Reihe, 1972, S. 24. Die Revolution der Preise im 16. Jahrhundert - schreibt Wilhelm Abel - „hatte für den Lohn- und Gehaltsempfänger aller Art, vom ungelernten Arbeiter bis zum Handwerksmeister und vom einfachen Schreiber bis zum Gelehrten, sehr üble Folgen. Die Kaufkraft ihrer Einkommen sank.“ Die Thesen von Wilhelm Abel stimmen grösstenteils überein mit den von Erich Maschke und Jürgen Sydow vorgetragenen Thesen in ihrer Studie G esellschaftliche Unterschichten in den südwestdeutschen Städten, Stuttgart, W. Kohlhammer, 1967, S. 1-74.
[29] Zu Thomas Müntzer siehe vor allem Emidio Campi (Hrsg.) Scritti politici, Torino, Editrice Claudiana, 1972.
[30] Wolfram Fischer, Armut in der Geschichte: Erscheinungsformen und Lösungsversuche der „Sozialen Frage” in Europa seit dem Mittelalter, Göttingen, Vandenhoeck & Rupcht, 1982, S. 29.
[31] Ebd. S. 30.
[32] Martin Dinges, Neues in der Forschung zur spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Armut?, in Hans-Jörg Gilomen, Sébastien Guex, Brigitte Studer (Hrsg.) Von der Barmherzigkeit zur Sozialversicherung. Umbrüche und Kontinuitäten vom Spätmittelalter bis zum 20. Jahrhundert, Zürich, Chronos, 2002, S. 31. Der Autor bezieht sich auf die Studie von Brigitte Klosterberg , Zur Ehre Gottes und zum Wohl der Familie. Kölner Testamente von Laien und Klerikern im Spätmittelalter, Köln, 1995, S. 160 ff.
[33] Marino Berengo, L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna, Torino, Einaudi, 1999, S. 617.
[34] Barbara Krug-Richter, Zwischen Fasten und Festmahl. Hospitalverpflegung in Münster 1540 bis 1650, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1994, S. 45-46; Ulrich Knefelkamp, Das Heilig-Geist-Spital in Nürnberg vom 14-17. Jahrhundert. Geschichte, Struktur, Alltag, Nürnberg, Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg, 1989, S. 62-63; Werner Moritz, Die bürgerlichen Fürsorgeanstalten der Reichsstadt Frankfurt a.M. im späten Mittelalter, Frankfurt am Main, Verlag Waldemar Kramer, 1981, S. 125-127.
[35] Siegfried Reicke, Das deutsche Spital und sein Recht im Mittelalter, Erster Teil, Stuttgart, Ferdinand Enke, 1932, S. 281.
[36] Ebd. S. 282: „Das Spital wurde ein Faktor rein bürgerlicher Wohlfahrtspolitik. Seine Leistungen in erster Linie den eigenen Bürgern zugute kommen zu lassen, ihre Sicherstellung und Unterbringung bei Krankheit und Alter, Schwäche und Hilfsbedürftigkeit zu gewährleisten, wurde das sozialpolitische Ziel des vom bürgerlichen Gemeinschaftsgeist getragenen Spitalregiments.“
[37] Siegfried Reicke, Das Deutsche Spital und sein Recht im Mittelalter, Zweiter Teil, Stuttgart, Ferdinand Enke, 1932, S. 231.
[38] Rudolf Kleiminger, Das Heiligengeisthospital von Wismar in sieben Jahrhunderten. Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte der Stadt, ihrer Höfe und Dörfer, Weimar, Hermann Böhlaus, 1962.
[39] Werner Haug, Das St.-Katharinen-Hospital der Reichsstadt Esslingen. Geschichte, Organisation und Bedeutung, Esslingen am Neckar, Stadtarchiv, 1965.
[40] Hannes Lambacher, Das Spital der Reichsstadt Memmingen. Geschichte einer Fürsorgeanstalt, eines Herrschaftsträgers und wirtschaftlichen Großbetriebes und dessen Beitrag zur Entwicklung von Stadt und Umland, Verlag für Heimatpflege Kempten, 1991.
[41] Rudolf Kleiminger, Das Heiligengeisthospital von Wismar, a.a.O., S. 33-43.
[42] Wolfgang Berger, Das St.-Georgs-Hospital zu Hamburg. Die Wirtschaftsführung eines mittelalterlichen Großhaushalts, Hamburg, Christians Verlag, 1972, S. 82-86.
[43] Barbara Krug-Richter, Zwischen Fasten und Festmahl, a.a.O., S. 130-235.
[44] Stefan Sonderegger, Landwirtschaftliche Entwicklung in der spätmittelalterlichen Nordostschweiz. Eine Untersuchung ausgehend von den wirtschaftlichen Aktivitäten des Heiliggeist-Spitals St. Gallen, St. Gallen, Staatsarchiv und Stiftsarchiv, 1994, S. 221-222. Diesbezüglich siehe auch die Dissertation von Michaela von Tscharner-Aue, Die Wirtschaftsführung des Basler Spital bis zum Jahre 1500. Ein Beitrag zur Geschichte der Löhne und Preise, Basel 1983.
[45] Karl Dändliker, Geschichte der Stadt und des Kantons Zürich, vol. 2, Zürich, Schulthess & Co., 1910, S. 140-142.
[46] „[…] in der statt nieman kein swin haben sol, dann in sinem hus in sta(e)allen, also dz man si nicht us an die strass sol lassen gan. Wol mag jederman sine swin zů dem tag zwirent trenken ob dem wasser, da sin bott sy. Wo(e)lt o(u)ch einer sin stall misten, so mag er die sine swin uslassen, das er sinen botten da bi hab; und sol man o(ua)ch die swin nach der trenki und dem misten fu(׀)rderlich wider jn triben ungefarlich. Wurd aber dar u(׀)ber dehein swin an dien strassen funden, da sol man von jeklichem swin V ß d. ze bůss geben, als dik dz beschicht, und sol man die bůss jngewinnen von dem, des die swin sint.“: Die Zürcher Stadtbücher des XIV. und XV. Jahrhunderts, H. Zeller-Werdmüller (Hrsg.), vol. 1, Leipzig, S. Hirzel, 1899, S. 344.
[47] „Und sol man o(u)ch weder stu(e)l, kisten, kasten noch so(e)lichen plunder uff der bruggen nicht lassen, won wenn dehein veiltrager plunder uff der pruggen veil will haben, dz sol er tůn, als dz von alter her ist komen. Wz aber nicht verko(u)ft mo(e)cht werden, den plunder sol man gehalten und ab der pruggen tragen bi der tagzit, als bald der margt zer gat ungefarlich. Es ensol o(u)ch nieman uff der pruggen zwischent dem rathus und des kamermeisters hus keiner leỷ dings nicht veil haben und do sitzen […]“ : Ebd.
[48] Dokumente zur Geschichte des Bürgermeisters Hans Waldmann, Ernst Gagliardi (Hrsg), vol. 1, Basel, Adolf Geering, 1911, S. lvii-lx.
[49] Erwin Eugster, Die Bedeutung der geistlichen Herrschaften, in Geschichte des Kantons Zürich, Band 1, Zürich, Werd Verlag, 1995, S. 230.
[50] Bundesamt für Statistik, Klima, n. 7, 1997, S. 5.
[51] Die Chronik des Laurencius Bosshart von Winterthur 1485-1532, Kaspar Hauser (Hrsg.), Basel, Adolf Geering, 1905, S. 58-59, 74-79, 80-93.
[52] Ebd. S. 82.
[53] Ebd. S. 85.
[54] Die Berner Chronik des Diebold Schilling 1468-1484, Gustav Tobler (Hrsg.), Bern, K. J. Wyss, 1901, S. 234-240.
[55] Ebd. S. 245.
[56] Zu diesem Fall siehe Dokumente zur Geschichte des Bürgermeisters Hans Waldmann, a.a.O.
[57] Karl Dändliker, Bausteine zur politischen Geschichte Hans Waldmanns und seiner Zeit, Staatsarchiv Zürich, Da 2120.21, S. 59-60.
[58] Karl Dändliker, Geschichte der Stadt und des Kantons Zürich, a.a.O., S. 154.
[59] Erwin Eugster, Die Entwicklung zum kommunalen Territorialstaat, in Geschichte des Kantons Zürich, vol. 1, a.a.O., S. 330-331.
[60] «Um 1460 ergingen Verfügungen über die Landwirtschaft und das Forstwesen, wie z. B. Verbote, durch die Reben zu gehen, Bestimmungen über „Wümmen“ (Weinlese), Winzerlohn etc., über Bewirtschaftung der Güter, Schonung der jungen Tannen („Särlen“) usw. »: Karl Dändliker, Geschichte der Stadt und des Kantons Zürich, a.a.O., S. 153.
[61] Paul Kläui, Die Spitalpolitik der Zürcher Regierung vom Mittelalter bis heute, in Zürcher Spitalgeschichte, a.a.O., S. 141-142.
[62] «Des ersten, daz man an allen ämptern kein zerung mer tüge, weder win, brot noch ander ding besende, denn schlechtenklich by den ämptern sitze und der statt nûtz inziehe. [...] Fûrbass habend wir uňs ouch bekennt, daz jederman sine kind und gesind daheim lassen soll, und daz man keinem kind, sy syend joch wes sy sellind, noch niemand anderm, wer joch der ist, nûtz geben sol. [...] Man sol ouch mit den knechten, so ritend, reden, daz sy sich mit zerung, halfftern, sattel, zöinen und andern dingen ze machen, daz sy als hinuss sparend, bescheidenlich haltind und nitals gûdig sigind, als bisher. [...] Es sol ouch fûrbass keiner des ra(u)tz, er sige burgermeister oder anders, mit mer knechten riten, denn als min herren daz vormâlen geordnet hand...»: in Verordnung zur Verminderung der städtischen Ausgaben, in Die Zürcher Stadtbücher des XIV. und XV. Jahrhunderts, Hans Nabholz (Hrsg.), vol. 3, Leipzig, Von S. Hirzel, 1906, S. 81-86.
[63] «Des ersten, das man die wacht, so uff gemein statt gesetzt was, der statt abnemen und das fûrbass jederman wachensol in Consta(u)feln und zûnfften und wo vil lûtz in zûnfften sind, daz ouch die vil wachen söllemd- Und sol man also die sachen gelich ansehen, umb daz jederman richen und armen billichs widerfare, denn wir vil frömds volks in der statt hand; des gelich, hand frömd lût hûser by uňs, die mit uňs weder stûrend, dienent, wachend, alle die wile die sachen sta(u)nd, als bisher, die suss alle sûllend wachen und dienen na(u)ch dem und die ordnung angesehen ist.»: Ebd., S. 81.
[64] B. Milt, Geschichte des Zürcher Spitals, in Zürcher Spitalgeschichte, Band I, Zürich, Regierungsrat des Kantons Zürich, 1951, S. 11-71. Siehe auch die Dissertation von E. Wyder-Leemann, Das alte Spital in Zürich, seine Organisation und Entwicklung, 1952.
[65] Das Mus war eine Art Getreidebrei, das wegen seines tiefen Preises (tiefen Kosten) und seinem hohen Kaloriengehalt sich besser zur Ernährung von Wandersleuten und Pilgern eignete als andere Speisen. Tatsächlich ist die Praxis des Zürcher Spitals, die Notleidenden mit Esswaren und Getränke zu unterstützen, bis in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts nachgewiesen. Staatsarchiv Zürich (StAZ) C II 18 Nr. 417. Siehe dazu auch Urkundenregesten des Staatsarchivs des Kantons Zürich, 1336-1369, n.1849, Zürich, Staatsarchiv, 1987, S. 375.
[66] Salomon Vögelin, Das alte Zürich, vol. 1, Zürich, Orell Füssli, 1878, S. 440-441.
[67] B. Milt, Zürcher Spitalgeschichte, a.a.O., S. 13-22.
[68] Staatsarchiv Zürich (StAZ) C II 18 Nr. 466. Siehe auch Urkundenregesten des Staatsarchivs des Kantons Zürich, 1370-1384, 2588, Zürich, Staatsarchiv, 1991, S. 146. Der Rechtsstreit dauert bis in den März des Jahres 1379 fort. Ebd., S. 147-159.
[69] Ebd., S. 27-28.
[70] Die oben erwähnten Daten habe ich den von Johannes Müller im Jahre 1784 gezeichneten Grundrissen des Spitals entnommen. Sie sind aufbewahrt im Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich. Für zusätzliche Informationen über die Geschichte des Klosters verweise ich auf die Studie von Martina Wehrli-Johns, Geschichte des Zürcher Predigerkonvents (1230-1524). Mendikantentum zwischen Kirche, Adel und Stadt, Zürich, Hans Rohr, 1980.
[71] Dölf Wild, Zur Baugeschichte des Zürcher Predigerkonvents, in Bettelorden, Bruderschaften und Beginen in Zürich, Barbara Helbling, Magdalen Bless-Grabher, Ines Buhofer, Zürich, (Hrsg.), Neue Zürcher Zeitung, 2002, S. 91-105.
[72] B. Milt, Zürcher Spitalgeschichte, a.a.O., S. 29-31.
[73] Oscar Walser, Das Große Spital-Urbar aus dem 16. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Gütergeschichte des Kantons Zürich im Reformationszeitalter, in 165. Neujahrsblatt der Hülfsgesellschaft in Zürich, Zürich, Beer & Co., 1965, S. 13.
[74] Ebd., S. 13-14.
[75] Ebd., S. 22.
[76] Die Serie besteht für das 16. Jahrhundert aus etwa 10 Registern, in denen die Namen des Grundstückes, der Zensus und die Transaktioen erscheinen: siehe Staatsarchiv Zürich, serie H I 1-10.
[77] Staatsarchiv Zürich, serie H I 629.
[78] Hans Schinz, Aus dem Leben des Untervogtes Jacob Schinz von Horgen, in Anzeiger des Bezirkes Horgen, 9. August 1967, Staatsarchiv Zürich Da 2072.
[79] Staatsarchiv Zürich, H I 407 und H I 424.
[80] Brief von Hans Berger vom 14.12.1524 an den Bürgermeister und den Rat von Zürich, Zentralbibliothek Zürich, Ms S 12 Nr. 12.
[81] Brief des Bürgermeisters und des Rats von Zürich an Ochsner Hans vom 19.10.1524, Zentralbibliothek Zürich, Ms S 11. N. 115 über den Überfall im Freiamt.
[82] Markus Stromer, Die ländliche Wirtschaft, in Geschichte des Kantons Zürich, a.a.O., S. 292. Der Plan über die Anbauflächen des Dorfes Uitikon, auf die sich Stromer bezieht, ist aufbewahrt im Staatsarchiv Zürich coll. Plan Q 273a.
[83] Stefan Sonderegger, Landwirtschaftliche Entwicklung, a.a.O., S. 310-316.
[84] Zum Verlauf des Getreidepises im Kanton Zürich siehe Alfred Zangger, Die ländliche Wirtschaft, in Geschichte des Kantons Zürich, vol. 1, a.a.O., S. 397. Zum Verlauf des Weinpises im Kanton St. Gallen siehe Stefan Sonderegger, Ebd., S. 239.
[85] «Zwischen dem Spital und dem Großmünster bestanden wahrscheinlich von Anfang an recht enge Beziehungen. Es war dem Stift grundzinspflichtig, weil es auf Stiftsgrund erbaut war. Seine Gründung muß diesem seinerzeit offenbar erwünscht gewesen sein; es spielt auch in der Folge oft eine Patenrolle. Kirchlich gehörte es zum Großmünster, weil es in dessen Parochie gelegen war.»: B. Milt, Geschichte des Zürcher Spitals, in Zürcher Spitalgeschichte, vol. 1, a.a.O., S. 12.
[86] Salomon Vögelin, Das alte Zürich historisch und antiquarisch dargestellt, vol.1, Zürich, 1878, S. 262-326.
[87] Judith Steinmann , Die Benediktinerinnenabtei zum Fraumünster und ihr Verhältnis zur Stadt Zürich, Eos Verlag Erzabtei St. Ottilien, 1980, 83 (Judith Steinmann, Fraumünster und ihr Verhältnis zur Stadt 853-1524. Studien und Mitteilungsband Ergänzungsband Bd. 23).
[88] Christa Köppel, Von der Äbtissin zu den gnädigen Herren. Untersuchung zu Wirtschaft und Verwaltung der Fraumünsterabtei und des Fraumünsteramts in Zürich 1418-1549, Chronos, Zürich, 1991.
[89] Helfenstein Ulrich - Sommer-Ramer Cécile, SS. Felix und Regula (Grossmünster) in Zürich, in Helvetia Sacra, vol. II/2, Die weltlichen Kollegiatstifte der deutsch- und französischsprachigen Schweiz, Bern, 1977, S. 565-596. Gemäss Judith Steinmann überstieg die Anzahl der Nonnen im Fraumünster nie die sechs Einheiten (Zahl Sechs, sechs Frauen).
[90] Judith Steinmann, a.a.O., S. 86-87.
[91] Über das Leben von Katharina von Zimmern siehe Zürichs letzte Äbtissin. Katharina von Zimmern 1478-1547, Herausgegeben von Irene Gysel und Barbara Helbling, Zürich, NZZ Verlag, 1993.
[92] Ebd. S. 97-98.
[93] Stefan Sonderegger, a.a.O., S. 221-222.
[94] Johannes Stumpf, Johannes Stumpfs Schweizer- und Reformationschronik, Bd. 1, hrsg. von Ernst Gagliardi, Hans Müller und Fritz Büsser, Basel, Birkhäuser, 1952-1955, S. 139.
[95] «Alls man so klặglich heim kam von der schlachtk, wolt der gmein man ettlich ze Zửrich fửr verra(e)ter han und ward ein wild geschreÿ unnder den pǔren, dermassen, das die am Zǔrichsee und uß aller landtschaft fǔr die statt Zǔrich fielend. [Man ließ die pǔren in die stat, die assend und trunckend; ouch fieng man ettlich; die strackt man.»: in Die Chronik des Laurencius Bosshart von Winterthur 1485-1532, hrsg. von Kaspar Hauser, Basel, Basler Buch- und Antiquaritatshandlung, 1905, S. 83-84.
[96] «ob die gfangnen in solcher ubertrettung erfunden wurdind, das sy lyb und gůt der statt verfallen we(a)rind, so sollte alsdann der halb teyl ihres verwürckten gůts der statt und der ander halb teyl den gmeinden von der landschafft an iren desselben erlittnen kosten gevolgen»: in Johannes Stumpf, Johannes Stumpfs Schweizer- und Reformationschronik, Bd. 1, a.a.O., S. 142.
[97] Ulrich Gäbler, Huldrych Zwingli: eine Einführung in sein Leben und Werk, Theologischer Verlag Zürich, Zürich, 2004, S. 44.
[98] «Daraus geht klar hervor, dass die Zehnten von jeder Kirchengemeinde zum Unterhalt ihrer Armen zusammengelegt wurden, woraus man zuerst den Priestern den angemessenen Lebensunterhalt zumaß […] und darnach das Übrige den Armen zuteilte»: in Huldrych Zwingli, Schriften, hrsg. von Thomas Brunnschweiler und Samuel Lutz, Bd. 1, Zürich, Theologischer Verlag, 1995, S. 353.
[99] «Sorgt dafür, dass die Klöster zu Herbergen der Armen gemacht werden. Man verwalte sie in der Weise, dass die Güter den Armen und den öffentlichen Bedürfnissen dienen. [Reiche und bettelnde Mönche, ja den gesamten Klerus soll man ganz und gar aussterben lassen, mit Ausnahme jener, die zur Verkündung des Gotteswortes benötigt werden»: in Huldrych Zwingli, Schriften, a.a.O., S. 406.
[100] Die Chronik des Bernhard Wyss 1519-1530, hrsg. von Georg Finsler, Basel, Basler Buch- und Antiquariats-Handlung, 1901, Fussnote 1, S. 38-39.
[101] Heinrich Bullinger, Reformationsgeschichte, hrsg.von J. J. Hottinger und H. H. Vögeli, Bd. 1, Frauenfeld, Beyel, 1838, S. 228-230.
[102] «In der reformation, ward dieses kloster dem Spittal u(e)berga(e)ben, und der Spittal daryn gelegt, ward hiemitt gewytteret. Die Kylch underschlagen, das underteyl behallten zur kylchen. Der oberteyl (wie dann die kylch fast hoch ist) zu(e) kornschu(e)ttinen, durch M. Jo(e)rgen Mu(e)llern, dr hernach Burgermeister ward, gebuwen»: in Heinrich Bullinger, Reformationsgeschichte, a.a.O., S. 229-230.
[103] «[…] Und damit man dieselben husarmen lüt erkenne, söllend si ein gestempft oder (ge)gossen zeichen haben und offenlich tragen, und so eins gsund oder hablich wirt, dass es disers almuosens nit mer notdurftig wäre und sölichs nit mer nehmen wellte, dass es dann dasselbig zeichen den pflegern widerumb antwurten sölle […]»: Ordnung und artikel antreffend das almuosen, in Emil Egli, Aktenssammlung zur Geschichte der Zürcher Reformation in den Jahren 1519-1533, Zürich, J. Schabelitz, 1879, N. 619, S. 272.
[104] Roger Chartier, Dominique Julia, Marie-Madeleine Compère, L’éducation en France du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Société d’édition d’enseignement supérieur, 1976. Zum Thema siehe auch die neueste Forschungsarbeit von Michel Rouche, Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation en France, Des origines à la Renaissance, volume 1, Paris, Perrin, 2003.
[105] Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung, hrsg. von Elke Kleinau, Claudia Opitz, Band I, Vom Mittelalter bis zur Aufklärung, Frankfurt, Campus Verlag, 1996.
[106] Ulrich Ernst, Geschichte des zürcherischen Schulwesen bis gegen das Ende des sechzehnten Jahrhunderts, Winterthur, Bleuler-Hausheer, 1879, S. 19.
[107] Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung, a.a.O., S. 79.
[108] «Um 1320 galt das Grossmünster als vornehmste Kirche im Bistum Konstanz, die nur von der Kathedrale selbst übertroffen wurde. Das Kapitel verlieh nicht nur 24 Chorherrenstellen, sondern ebenso viele Kaplaneien, 21 Kirchenpatronate und drei weitere Kirchenämter. [...] Im Fraumünster lebten im 13. Jahrhundert gegen zwölf meist hochfreie Nonnen. Das Kloster verlieh neben den sieben Chorherrenpfründen vier klösterliche Ämter, zehn Kaplaneien und neun Kirchenpatronate.»: zit. in Erwin Eugster, Klöster und Kirchen, in Geschichte des Kantons Zürich, Band 1, a.a.O., S. 227.
[109] «Um 1300 lebten in Töss und Oetenbach bereits rund 100 beziehungsweise 120 Nonnen. Die Anzahl der Schwestern musste beschränkt werden, obschon beide Klöster zu diesem Zeitpunkt bereits über umfangreichen Streubesitz verfügten.»: zit. in ebda., S. 224.
[110] Mario König, Der Bildungsboom und die Muster sozialer Ungleichheit, in Geschichte des Kantons Zürich, Band 3, a.a.O., S. 396. Es scheint, dass es im Reich zu Beginn der Reformation 10-30% der städtischen Bevölkerung lesen konnte. Siehe dazu Alfred Wendehorst, Wer konnte im Mittelalter lesen und schreiben?, in Schulen und Studium im sozialen Wandel des hohen und späten Mittelalters, hrsg. von Johannes Fied, Sigmaringen, Jan Thorbecke Verlag, 1986, S. 32.
[111] Ulrich Ernst, Geschichte des Zürcherischen Schulwesens bis gegen das Ende des sechzehnten Jahrhunderts, a.a.O., S. 8.
[112] Ebda., S. 11.
[113] Julius Brunner, Die Ordnungen der Schulen der Propstei und der Abtei Zürich im Mittelalter, in Sonderabdruck aus den Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte, hrsg. von K. Kerhbach, Jahrg. IX, 1899, Heft 4, S. 6.
[114] Ebda., S.26: «De octo scolaribus in bucellis. [...] est laudabiliter ordinatum et racionabiliter constitutum, quod per dotorem puerorum scole nostre, qui pro tempore fuerit, octo scolares clerici vel accolliti pauperes et honesti, qui conpetenter sciant legere et cantare, debent eligi et ad subscripta ministeria deputari […]». La bucella era un frustulum alicuius escae in primis panis.
[115] Ebda., Ulrich Ernst, a.a.O., S. 13-14.
[116] Ebda., S. 24.
[117] Ebda., S. 25-33.
[118] Thomas Platter, La mia vita, a cura di Giulio Orazio Bravi, Bergamo, Pierluigi Lubrina, 1988, p. 43. (Deutsch: Thomas Platter, Lebenserinnerungen, Basel, G S Verlag, 1999).
[119] Eugenio Garin, L’educazione in Europa 1400-1600: problemi e programmi, Bari, Laterza, 1966. (Deutsch: Erziehung, Anspruch, Wirklichkeit : Geschichte u. Dokumente abendländischer Pädagogik. Der Humanismus. Starnberg, Raith, 1971)
[120] Balthasar Reber, Felix Hemmerlin von Zürich, Zürich, Meyer und Zeller, 1846.
[121] Christian Gottlieb Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon, Bd. 3, Leipzig, 1751, S. 787. Hier wird das Traktat über die Kindererziehung Myconius Oswald zugewiesen. Für weitergehende Vertiefungen siehe die Biographie von Karl Rud. Hagenbach , Johann Oekolampad und Oswald Myconius die Reformatoren Basels. Leben und ausgewählte Schriften, Elberfeld, R. L. Friderichs, 1859.
[122] Ebd. S. 33-38.
[123] Rolf Köhn, Schulbildung und Trivium im lateinischen Hochmittelalter und ihr möglicher praktischer Nutzen, in Schulen und Studium im sozialen Wandeln des hohen und späten Mittelalters, a.a.O., S. 226.
[124] Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung, a.a.O., S. 82.
[125] Leo Weisz, Die „teutschen“ Schulen des alten Zürich, in NZZ, 17 Juni 1944.
[126] Ulrich Ernst, a.a.O., S. 37.
[127] Das Jahrhundert der Reformation kennt eine regelrechte Verbreitung von pädagogischen Schriften (Flut von weitverbreiteten pädagogischen Schriften). Man denke da nur schon an die Regula puerorum fundamentalis et peroptima, Johann Froschauer, [1500?]; an Die “Kinderzucht” von Hieronimus Schenck von Siemau (1502), hrsg. von Marc Pinther, Hamburg, Krämer, 1996; an Konrad Klauser, De educatione puerorum, Basileae, Johannes Oporinus, [1554?]; an Otto Brunfels, De disciplina et institutione puerorum, Coloniae, Servatius Cruphtanus, [1525?] ; an Jacques Sadoleti, De liberis recte instituendis liber, Parisiis, Simon Colinaeus, 1534; an Juan Luis Vives, De ratione studii puerilis, 1536; a Roscius L. Vitruvius, De docenti studendique modo ac de claris puerorum moribus libellus, Basileae, 1541; Kinderzucht von gu(o)ten züchtigen und zierlichen Sitten, Zürich, Eustachin Froschouer, 1545; an Petrus Bloccius, Praecepta formandis puerorum moribus perutilia, Anversa, 1569, [neu hrsg. von A. M. Coebergh-Van den Braak, 1991]; an Joan. Fungerus, De puerorum disciplina et recta educatione, Antverpiae, 1584.
[128] Huldrych Zwingli, Wie man die jugendt in gůten sitten und Christenlicher zucht uferziehen unnd leeren sölle, in Sammlung selten gewordener pädagogischer Schriften des 16. und 17. Jahrhunderts, hrsg. von August Israel, Zschopau, F. A. Raschke, 1897. Die Schrift ist in Neudeutsch reeditiert worden unter dem Titel: Wie Jugendlichen aus gutem Haus zu erziehen sind, erschienen in Huldrych Zwingli, Schriften, hrsg. von Thomas Brunnschweiler und Samuel Lutz, Bd. 1, Zürich, Theologischer Verlag, 1995.
[129] Martin Luther, An die Radherrn aller stedte deutsches lands: das sie Christliche schulen auffrichten und hallten sollen, Wittemberg, 1524.
[130] Martin Luther, An die Radherrn aller stedte deutsches lands: das sie Christliche schulen auffrichten und hallten sollen, in Sammlung selten gewordener pädagogischer Schriften des 16. und 17. Jahrhunderts, a.a.O., S. 3-24.
[131] «Prima cura est amri, paulatim succedit non terror, sed liberalis quaedam reverentia, quae plus habet ponderis quam metus»: Erasme, Declamatio de pueris statim ac liberaliter instituendis, hrsg. von Jean-Claude Margolin, Genève, Droz, 1966, S. 425.
[132] «Nec ulli crudelius excarnificant pueros, quam qui nihil habent quod illos doceant.» : Erasme, Declamatio de pueris statim ac liberaliter instituendis, ebd., S. 428.
[133] [Die Jugendt] wirt von im [Cristo] reden und schwygen lernen / eyn yetliches zů siner zyt. […] Dann glych als der wyber höchste zierd stillschwigen ist / also stadt einem jüngling nüts baß an / dann ein bestimpte zyt sich flyssen zeschwigen / biß das nit allein der verstand / sunder ouch die zung ein yedes in sunders und sy beyde mit einander bericht werdind / unnd vol zůsamen stimmind. […] Man hat wargenommen dass die helffand etwan / so sy allein sind gwesen / sich ernstlich geu(e)bt habend zelernen die ding / umb deren willen sy geschlagen wurdend.»: Huldrych Zwingli, Wie man die jugendt in gůten sitten und Christenlicher zucht uferziehen unnd leeren sölle, in Sammlung selten gewordener pädagogischer Schriften des 16. und 17. Jahrhunderts, a.a.O., S. 10-11.
[134] Aktensammlung zur Geschichte der Zürcher Reformation in den Jahren 1519-1533, hrsg. von Emil Egli, n. 426, Zürich, J. Schabelitz, 1879, S. 169 ff.
[135] 1896. * Oct. ff. Ordination und ansehen, wie man sich fürohin mit den schuoleren, letzgen und anderen dingen halten soll in der schuol zum Münster (ze) Zürich 1532, in Aktensammlung zur Geschichte der Zürcher Reformation in den Jahren 1519-1533, Ebd., S. 821-824.
[136] Staatsarchiv Zürich, E I 16 6.
[137] Ebd. p. 822.
[138] Ulrich Ernst, Geschichte des Zürcherischen Schulwesens bis gegen das Ende des sechzehnten Jahrhunderts, a.a.O., S. 121-147. Siehe Diagramm 2, S. 42.
[139] Schola Tigurina. Die Zürcher Hohe Schule und ihre Gelehrten um 1550. Katalog zur Ausstellung vom 25. Mai bis 10. Juli 1999 in der Zentralbibliothek Zürich, Zürich, Pano Verlag, S. 23-25.
[140] «Wenn man auch annehmen will, es sei durch die Reformation das sittliche Bewusstsein geschärft und durch die humanistischen Studien veredelt worden, so ist auf der andern Seite nicht zu vergessen, dass man an die Leute gerade in diesem Bewusstsein grössere sittliche Anforderungen stellte und gegen Übertretung eben kein anderes Mittel kannte als strenge Strafe»: Ulrich Ernst, Geschichte des Zürcherischen Schulwesens, a.a.O., S. 69.
[141] Hans Nabholz, Zürichs Höhere Schulen von der Reformation bis zur Gründung der Universität 1525-1833, in Die Universität Zürich 1833-1933 und ihre Vorläufer, hrsg. von E. Gagliardi, H. Nabholz e J. Strohl, Zürich, Verlag der Erziehungsdirektoren, 1938, S. 15-16.
[142] Ulrich Ernst, Geschichte des Zürcherischen Schulwesens, a.a.O., S. 62-63.
[143] Ebd., S. 61. In seiner Reformationsgeschichte schreibt Heinrich Bullinger: «Es ward och die libery ersůcht und wenig (was man vermeint gůt sin) behallten, das ander alles, als sophistery, scholastery, fabelbu(e)cher etc. hinab under das Hälmhuss getragen, zerrissen und den krämeren apoteckern zů bulverhüsslinen, den bůchbindern ynzůbinden und den schůlern und wer kouffen wolt umm ein spott verkoufft», In Martin Germann, Die Reformierte Stiftsbibliothek am Grossmünster Zürich im 16. Jahrhundert und die Anfänge der neuzeitlichen Bibliographie, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1994, S. 106.
[144] Martin Germann, Die reformierte Stiftsbibliothek am Grossmünster Zürich im 16. Jahrhundert, a.a.O., S. 196-201.
[145] Bruce Gordon, Clerical Discipline and the Rural Reformation. The Synod in Zürich, 1532-1580, Bern, Peter Lang, 1992, S. 51.
[146] Ebd. S. 64.
[147] Ebd. S. 70-71.
[148] Heinrich Bullinger, Studiorum Ratio – Studienanleitung, in Werke, hrsg. von Peter Stotz, Zürich, Theologischer Verlag, 1987.
[149] Johannes Rhellicanus, Epistole et Epigrammatis, in quibus ratio studii literarii Bernensis indicatur, 1533; Andreas Hyperius, De theologo, seu de ratione studii theologicii libri IIII, Basiliae, Ioannem Oporinum, 1559; Melanchthon, Modus et ratio studiorum in Opera quae supersunt omnia. Edidit Carolus Gottlieb Bretschneider, Bd. 4, S. 934-936 und Ratio studiorum, Ebd., Bd. 10, S. 99 e ff.
[150] Emidio Campi , Streifzug durch Vermiglis Biographie, in Petrus Martyr Vermigli. Humanismus, Republikanismus, Reformation, hrsg. von Emidio Campi, Genève, Droz, 2002, S. 32-35.
[151] «Est igitur correptio actio ad dsciplinam pertinens, qua cûm lapsis de peccatis eorum expostulamus ex charitate, monentes eos ut resipiscant, iuxta modum & formam à Cristo expositam, quô malum de medio auferatur.» Petri Martyris Vermilii, Loci communes, Tiguri, Christophorus Froschouerus, 1580, S. 411.
[152] «Efficiens causa est charitas, quia non est iusta correctio, si ex odio, ira, vel iniura proficiscatur. Materia verò circa quam versatur, peccata sunt, eaq; gravia, cùm leviora errata nó pertineant ad correctionem. Forma verò, est modus à Domino praescriptus. Finis, ut malum de medio fidelium auferatur, quod pio cuique in Ecclesia curandum est, quoad eius fieri potest.», Ebd.
[153] «Quare pater filium peccantem, si vitam non emendavit, & magistratus civem contumacem, acerbius quàm monitionibus punire debent: pastor fratrem pergentem inordinaté vivere, graviori disciplina coercebit.» Ebd.
[154] «Neque genus hoc actionis ab hominibus est inventum, sed ipsius Dei lege sancitum.» Ebd.
[155] «Ex Evangelio facilè cognoscimus, quàm necessariò haberi debeat in Ecclesia. […] Deinde, Israelitae vetabantur attingere impura: & si fortasse attingissent illa, sic immundi fiebant, ut ab aliorum consortio separarentur. […] Et Deus ex horto delitiarum, primos parentes, cùm peccassent, expulit. Cain quoque post admissum parricidium, à conspectu parentum profugus abijt.», Ebd.
[156] Christoph Wehrli, Die Reformationskammer. Das Zürcher Sittengericht des 17. und 18. Jahrhunderts, Winterthur, P. G. Keller, 1963, S. 5-42.
[157] Staatsarchiv Zürich, III AAb I Nr. XV.
[158] Ebd.
[159] «[…] manig mandat, gebott und verbott usgon lassen, der zuoversicht die mit byloufender gnaden gottes etwas mer frucht bracht hettind»: in StAZ III AAb I Nr. XV.
[160] Erich Wettstein, Die Geschichte der Todesstrafe im Kanton Zürich, Winterthur, Hans Schellenberg, 1958, S. 90-91.
[161] Ebd., S. 80-83.
[162] Ebd., S. 84-87.
[163] Walther Köhler, Das Zürcher Ehegericht und seine Auswirkung in der deutschen Schweiz zur Zeit Zwinglis, in Quellen und Abhandlung zur schweizerischen Reformationsgeschichte, hrsg. vom Zwingliverein in Zürich, Bd. VII, Leipzig, M. Heinsius Nachfolger, 1932, S. 142-145.
[164] Zu dieser Schlussfolgerung gelangt auch Susanna Burghartz, die in ihrer Studie über das Basler Gericht für Fragen der Ehe eine insbesonders in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zunehmende Verschärfung der wegen Ehebruchs und anderer Straftaten sexuellen Hintergrunds ausgesprochenen Verurteilungen feststellt. Susanne Burghartz, Zeiten der Reinheit – Orte der Unzucht. Ehe und Sexualität in Basel während der Frühen Neuzeit, Paderborn, Ferdinand Schöhningh, 1999, S. 111-131.
[165] Geschichte des Kantons Zürich, Band 2, Frühe Neuzeit – 16. bis 18. Jahrhundert, Wird Verlag, 1996, S. 130-132.
[166] L. Weisz, Die wirtschaftliche Bedeutung der Tessiner Glaubensflüchtlinge für die deutsche Schweiz, in Zwingliana, Band X, S. 229. Siehe auch F. Meyer, Die Evangelische Gemeinde in Locarno, ihre Auswanderung nach Zürich und ihre weiteren Schicksale, 2, Zürich, 1936, S. 313-354.
[167] Bernardino Ochino. Italienischer Reformator, 1487 in Siena geboren im Stadtviertel der Gans (oca, von daher der Übername ochino=Gänschen) und 1564 in Slavkov gestorben. Er gehörte dem Orden der Kapuziner an und floh 1542 in die Schweiz, weil er Anhänger der Glaubensrichtung von Calvin war.
[168] L. Weisz, a.a.O., S. 233-236.
[169] W. Bodmer, Der Einfluss der Refugianteneinwanderung von 1550-1700 auf die schweizerische Wirtschaft, Zürich, G Leemann, 1946, Anmerkung 87, S. 24.
[170] W. Bodmer, a.a.O., S. 28-29.
[171] Werner Schnyder, Quellen zur Zürcher Zunftgeschichte, Band I, n. 395, 18. Juni 1558, Zürich, Berichthaus, 1936, S. 296.
[172] Ebd.., S. 329.
[173] Geschichte des Kantons Zürich, a.a.O., Band 2, S. 138-148.
[174] L. Weisz, a.a.O., S. 376-377 und S. 428-429.
[175] R. A. De Muralt, Notices sur la famille de Muralt, Paris, 1879 und H. Schulthess, Bilder aus der Vergangenheit der Familie Muralt in Zürich, 1944.
[176] C. Brunner, Das Leben eines berühmten Schweizer Arztes im siebzehnten Jahrhundert, Hamburg, J. F. Richter, 1888, S. 23.
[177] H. Schulthess, Die von Orelli von Locarno und Zürich. Ihre Geschichte und Genealogie. Siehe zudem auch A. von Orelli, Geschichte der Familie von Orelli, Zürich, 1955.
[178] Stefan G. Schmid, David Werdmüller (1548-1612) Heinrich Werdmüller (1554-1627). Gründer der Zürcher Seidenindustrie, a.a.O., S. 74-75.
[179] Ebd.
[180] Stefan G. Schmid, David Werdmüller (1548-1612) Heinrich Werdmüller (1554-1627). Gründer der Zürcher Seidenindustrie, Verein für wirtschaftshistorische Studien, Meilen, 2001, S. 14 und ff.
[181] Geschichte des Kantons Zürich, a.a.O., S. 354-355.
[182] Leo Weisz, Die Werdmüller. Schicksale eines alten Zürcher Geschlechts, Zürich, 1949.
[183] Anton Pestalozzi, Auf den Spuren von General Johann Rudolf Werdmüller in der Ägäis 1664-1667, Zürich, Berichthaus, 1973, S. 13-15.
[184] J.H. Graf, Die Karte von Gyger und Haller, Bern, Haller’sche Buchdruckerei, 1893 und Rudolf Wolf, Hans Konrad Gyger. Ein Beitrag zur Zürcherischen Culturgeschichte, Bern, Haller’sche Buchdruckerei, 1846.
[185] Oskar Pfister, Michael Zingg (1599-1676), eine Lichtgestalt im dunklern Zürich, in Zwingliana, Band VIII, Heft 1, S. 7-24.
[186] Hermann Bleuler, Die Hirschgartner von Zürich, Zürich, Robert Hurlimann, 1944.
[187] Geschichte des Kantons Zürich, a.a.O., S. 410-411.
[188] Roger Sablonier, Wasser und Wasserversorgung in der Stadt Zürich vom 14. zum 18. Jahrhundert, in Zürcher Taschenbuch, 1985, S. 5
[189] Martin Illi, Von der Schîssgroub zur modernen Stadtentwässerung, Zürich, 1987 und Wasserentsorgung in spätmittelalterlichen Städten. Die alte Stadt, Stuttgart, 1993. Zum gleichen Thema siehe auch Elisabeth Suter, Wasser und Brunnen im alten Zürich. Zur Geschichte der Wasserversorgung der Stadt vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhunde rt, Wasserversorgung Zürich, Zürich, 1981 und Roger Sablonier, Wasser und Wasserversorgung im Stadt Zürich vom 14. zum 18. Jahrhundert, in ZTB, 1985, S. 1-28.
[190] Ernst Bodmer, Die Zünfte Zürichs 1336-1936, in Schweiz. Gewerbe-Zeitung, Zürich, 1936, S. 4-5.
[191] Hans Schulthess, Die politische Bedeutung der Zünfte im Zürcherischen Staatswesen (1336-1866), Zürich, 1926, S. 6.
[192] Zu den Bräuchen und Sitten der Handwerker in Franken siehe die Studie von Kurt Wesoly, Studien zur Frankfurter Geschichte. Lehrlinge und Handwerksgesellen am Mittelrhein. Ihre soziale Lage und ihre Organisation vom 14. bis ins 17. Jahrhundert, Frankfurt am Main, Waldemar Kramer, 1985.
[193] Markus Brühlmeier/Beat Frei, Das Züricher Zunftwesen, Bd. 1, Zürich, Verlag NZZ, 2005, S. 119-129. Zum Thema siehe auch die Dissertation von Peter Stänger, Das Arbeitsrecht der zürcherischen Zünfte, Zürich, 1948.
[194] Otto Sigg, Die Entwicklung des Finanzwesens und der Verwaltung Zürichs im ausgehenden 16. und im 17. Jahrhundert, Bern und Frankfurt/M, Herbert Lang, 1971, S. 175-176.
- Arbeit zitieren
- Giacomo Francini (Autor:in), 2008, Die Fürsorge im Geist des Kapitalismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117529
Kostenlos Autor werden

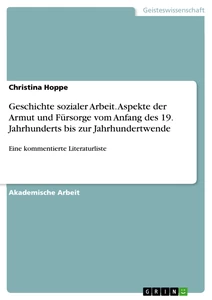
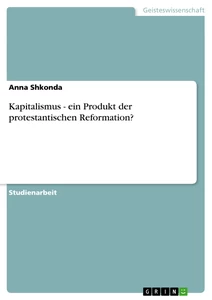
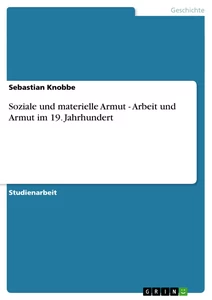

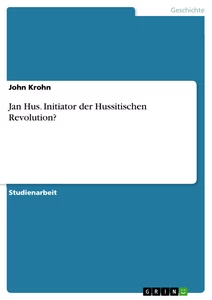






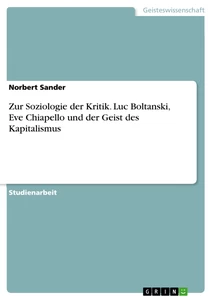




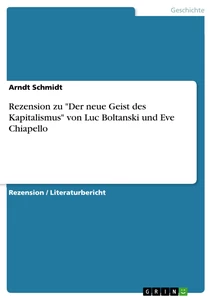




Kommentare