Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. Erklärungsansätze zur Entstehung von Suizidalität
1. Begriffliche Abgrenzungen
1.1 Selbstmord
1.2 Freitod
1.3 Suizidgedanken, Suizidversuch und Parasuizid
1.4 Suizid, Selbsttötung und Selbsttötungsabsichten
1.5 Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Suizid und Suizidversuch
1.6 Erweiterter Suizid, Doppelsuizid und Massensuizid
2. Epidemiologie und Suizidmethoden
2.1 Epidemiologie
2.2 Methodische Probleme der Erfassung von Suizid und Suizidversuch
2.3 Forschungsstrategien
2.4 Häufigkeiten von Suiziden und Suizidversuchen
2.4.1 Europäische Daten
2.4.2 Bundesdeutsche Daten (alte und neue Bundesländer)
2.5 Suizidmethoden
3. Suizidsignale
3.1 Risikofaktoren
3.2 Risikogruppen
3.3 Die suizidale Entwicklung
3.4 Motive für den Suizid
4. Diagnostik von Suizidalität
4.1 Das Erkennen und Einschätzen des Suizidrisikos
4.1.1 Allgemeine Aspekte
4.1.2 Suizidanamnese
4.1.3 Hinweise auf erhöhtes Suizidrisiko
4.2 Arten von Suizidalität
4.2.1 Manipulative Suizidalität
4.2.2 Resignative Suizidalität
4.2.3 Fusionäre Suizidalität
4.2.4 Antifusionäre Suizidalität
5. Erklärungsansätze zur Entstehung von Suizidalität
5.1 Soziologische Erklärungsversuche
5.1.1 Der Ansatz von Durkheim
5.1.2 Weitere soziologische Ansätze
5.2 Psychodynamische Erklärungsversuche
5.2.1 Einleitung
5.2.2 Die Aggressionstheorie von Freud und Abraham
5.2.2.1 Allgemeine Aspekte
5.2.2.2 Kritische Betrachtung des Depressionsmodells von Freud und Abraham
5.2.3 Die Narzißmustheorie von Henseler
5.2.3.1 Allgemeine Aspekte
5.2.3.2 Kritische Betrachtung der Narzißmustheorie Henselers
5.2.4 Objektbeziehungstheorie
5.2.4.1 Allgemeine Aspekte
5.2.4.2 Suizidalität im Rahmen des objektbeziehungstheoretischen Entwicklungsmodells
5.3 Der psychopathologische Ansatz von Ringel
5.3.1 Allgemeine Aspekte
5.3.2 Kritische Betrachtung des präsuizidalen Syndroms
II. Therapeutische Ansätze bei Suizidalität
6. Krisenintervention
6.1 Allgemeine Charakteristika von Krisen und Krisenintervention
6.1.1 Definition
6.1.2 Krisenverläufe
6.1.3 Aspekte von Krisen
6.1.4 Ziel der Krisenintervention
6.2 Interventionskonzept
7. Die Arche – eine Einrichtung der Krisenintervention
7.1 Grundkonzept
7.2 Das Team und die Zusammenarbeit
7.3 Die Klienten
7.4 Angebote und Arbeitsbereiche
7.5 Leitlinien der Arche
III. Reflektion
Literaturverzeichnis
Einleitung
In der vorliegenden Arbeit befasse ich mich mit dem Thema „Erklärungsansätze zur Entstehung von Suizidalität und therapeutischer Umgang mit suizidalen Klienten“. Dabei sollen nicht nur spezielle soziologische, psychodynamische und medizinische Suizidtheorien näher untersucht und kritisch betrachtet werden, sondern vielmehr in einem umfassenderen Sinne auch die theoretischen Grundlagen und das notwendige Hintergrundwissen zum Verständnis der Entstehung von Suizidalität vermittelt werden. Mit therapeutischem Umgang ist die Art und Weise der Beziehungsgestaltung zwischen professionellen Helfern wie z.B. Sozialarbeitern und suizidalen Klienten zu verstehen, wobei in diesem Zusammenhang insbesondere die Krisenintervention von praktischer Bedeutung ist. Ich werde u.a. untersuchen, welche Bedingungen die Entstehung von Suizidalität begünstigen, wie sich Suizidalität äußert und wie das Suizidrisiko erkannt und eingeschätzt werden kann. Desweiteren sind die Fragen von Interesse, wie man mit Suizidalen und Menschen in Krisen adäquat umgeht, welche Konzepte der Krisenintervention es gibt und wie sie in der Praxis realisiert werden. Mit dieser Arbeit möchte ich dazu beitragen, dass das in weiten Teilen der Gesellschaft immer noch tabuisierte und mit Vorurteilen behaftete Thema Suizid nicht länger ignoriert, verdrängt und an den Rand des öffentlichen Interesses geschoben wird, sondern dass ihm generell eine größere Aufmerksamkeit und eine verstärkte Bereitschaft entgegengebracht wird, sich mit ihm kritisch auseinanderzusetzen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die theoretischen Grundlagen zum Verständnis von Suizidalität und insbesondere ihrer Entstehung zu vermitteln und die gewonnen theoretischen Erkenntnisse für einen adäquaten therapeutischen Umgang mit suizidalen Menschen nutzbar zu machen und in der Krisenintervention praktisch anzuwenden. Ich denke, dass man als Helfer in der Sozialen Arbeit unumgänglich früher oder später mit dem Thema Suizidalität konfrontiert werden wird und so vor die große Herausforderung gestellt wird, sich mit suizidgefährdeten Klienten oder Menschen in Krisen auseinanderzusetzen. Um der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, sind deshalb meiner Ansicht nach die entsprechenden Kenntnisse, die ich in dieser Arbeit vermitteln möchte, unabdingbare Voraussetzung. Im Rahmen eines Praktikums im Sozialpsychiatrischen Dienst in Ottobrunn musste ich leider die Erfahrung machen, dass diese Kenntnisse im Umgang mit psychisch kranken Menschen, die häufig von Suizidalität oder Krisen betroffen sind, oft gerade auch auf Seiten der professionellen Helfer fehlen. So konnte ich weiter die Beobachtung machen, dass die therapeutische Beziehung zu Betroffenen häufig von Unsicherheiten und Ängsten gekennzeichnet ist, was zum einen an der angedeuteten Unwissenheit liegen mag, zum anderen aber vielleicht auch daran, dass die Helfer sich vielleicht oft scheuen, eine solch bedeutende Verantwortung zu übernehmen. Denkbar wäre auch, dass sich die Therapeuten in Bezug auf ihre eigene Suizidalität und den eigenen Tod unsicher sind und sich noch nicht im ausreichenden Maße damit auseinandergesetzt haben. Außerdem konnte ich feststellen, dass auch in der praktischen sozialen Arbeit nicht gerne über das Thema Suizid gesprochen wird, wie es überhaupt auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen immer noch weitgehend tabuisiert ist. Es bleibt zu wünschen, dass sich gerade auch professionelle Helfer intensiver mit ihren Wissensdefiziten, Unsicherheiten und Ängsten im Hinblick auf das Thema Suizidalität auseinandersetzen und Betroffenen mit einer größeren Bereitschaft und Offenheit, sich auf sie einzulassen, begegnen. Leider herrschen ihnen gegenüber immer noch gesellschaftlich bestehende Vorurteile, die bis hin zur Stigmatisierung reichen können. Deshalb möchte ich durch die Vermittlung entsprechenden Hintergrundwissens einen Beitrag dazu leisten, dass der oft unzureichende Umgang mit Betroffenen seitens professioneller Helfer verbessert wird und vorhandene Vorurteile und Tabus abgebaut werden. Mit ein Grund, warum ich mich für dieses Thema entschieden habe, ist auch die moralische Verpflichtung jedes Einzelnen, sich für das Wohlergehen seiner Mitmenschen zu interessieren und einzusetzen, insbesondere vor dem Hintergrund christlicher Nächstenliebe. Deshalb kann es mir nicht gleichgültig sein, wenn ein anderer Mensch sich mit Suizidgedanken trägt. Meiner Ansicht nach ist jeder Mensch dafür verantwortlich, Suiziden in seiner individuellen Lebenswelt vorzubeugen. Deswegen begreife ich aus sozialpädagogischer Sicht Krisenintervention immer auch als praktische Suizidprävention. Schließlich beruhen meine Überlegungen nicht nur auf Empathie, sondern auch auf Introspektion, da ich vor dem Hintergrund eigener Betroffenheit schreibe. Aufgrund dessen, dass ich selbst mehrere suizidale Krisen durchzustehen hatte und infolgedessen diverse Einrichtungen der Krisenintervention, u.a. Klinken und Beratungsstellen (insbesondere die Arche) in Anspruch genommen habe, betrete ich mit diesem Thema kein Neuland. Auch psychiatrische und psychotherapeutische Behandlungen haben mit zu meinem grundsätzlichen Interesse an der Thematik beigetragen. Der Aufbau dieser Arbeit gliedert sich in einen theoretisch strukturierten ersten Teil mit dem Schwerpunkt auf der Darstellung der bekanntesten Entstehungstheorien und in einem eher praktisch ausgerichteten zweiten Teil, in dem ich auf den gewonnenen Erkenntnissen aufbauend den angemessenen Umgang mit suizidalen Menschen bzw. Menschen in Krisen beschreibe. Dabei stelle ich in den ersten vier Kapiteln in aufeinander aufbauender Reihenfolge die theoretischen Grundlagen zum Verständnis der Entstehung von Suizidalität dar. Im ersten Kapitel nehme ich eine begriffliche Abgrenzung vor, in der die verwendeten Fachbegriffe definiert und erklärt werden. Im folgenden zweiten Kapitel stelle ich u.a. epidemiologische Forschungsergebnisse vor, insbesondere zur Häufigkeitsverteilung von Suiziden, das durch die Erläuterung der Suizidmethoden abgeschlossen wird. Das dritte Kapitel befasst sich mit Entstehungsbedingungen von Suizidalität wie Risikofaktoren und Risikogruppen. Von grundlegender Bedeutung ist des weiteren die suizidale Entwicklung, auf die ich detailliert eingehen werde. Schließlich schildere ich die Motive, aus denen heraus Menschen suizidal werden. Im darauf folgenden vierten Kapitel zur Diagnostik beschreibe ich, wie sich das Suizidrisiko erkennen und einschätzen lässt. Anschließend gehe ich auf die bekanntesten Erscheinungsformen der Suizidalität ein, wobei ich diese insbesondere aus tiefenpsychologischer Sicht betrachten werde. Dabei ist das in den ersten vier Kapiteln vermittelte Hintergrundwissen meiner Ansicht nach Voraussetzung für ein besseres Verständnis der im fünften Kapitel dargestellten Suizidtheorien. Diese umfassen dabei die bekanntesten soziologischen, psychodynamischen und medizinischen Ansätze, die sich in den letzten zwei Jahrhunderten in der einschlägigen Fachliteratur etabliert haben. An die Darstellung des jeweiligen theoretischen Ansatzes schließt sich eine kritische Betrachtung vor dem Hintergrund der aktuellen Suizidforschung an. Darauf folgend betrachte ich im sechsten Kapitel zunächst die allgemeinen Charakteristika von Krisen und Krisenintervention. Anschließend versuche ich unter Berücksichtigung der bislang gewonnenen theoretischen Erkenntnisse ein Interventionskonzept zu entwickeln, das sich praktisch umsetzen lässt. Mit der Beschreibung einer Einrichtung der Krisenintervention schließe ich den therapeutischen Teil ab, wobei ich am Beispiel der Arche die wesentlichen Merkmale einer Kriseninterventionseinrichtung schildern werde. Im abschließenden Reflektionsteil versuche ich ein Resümee der Arbeit zu ziehen sowie die wichtigsten Ergebnisse und Konsequenzen festzuhalten.
I. Erklärungsansätze zur Entstehung von Suizidalität
1. Begriffliche Abgrenzungen
Ich möchte mich eingangs kritisch mit den Begriffen Selbstmord, Freitod, Suizid und Suizidversuch, Parasuizid, Selbsttötung, Selbsttötungsabsichten sowie Mitnahmesuizid, Doppelsuizid und Massensuizid auseinandersetzen, da meiner Ansicht nach das umgangssprachliche und wissenschaftliche Begriffsverständnis nicht immer übereinstimmen.
1.1 Selbstmord
Der Begriff „Selbstmord“ suggeriert meiner Meinung nach, dass es sich hierbei um einen strafrechtlich relevanten Tatbestand handelt es drängt sich die Frage auf, ob diese Auffassung auch wissenschaftlich haltbar ist. Laut Seyfried werden Suizidhandlungen im deutschen Sprachgebrauch erst seit Mitte des 17. Jahrhunderts als Selbstmorde bezeichnet, seit der Zeit also, in der Suizide am rigorosesten verurteilt wurden (vgl. Seyfried, 1995, S. 10). Das liegt meiner Meinung auch daran, dass zu dieser Zeit die Suizidanten von der christlich geprägten Gesellschaft allseits geächtet worden sind und deshalb als „Mörder“, bzw. als Selbstmörder stigmatisiert wurden, denen als gerechte Strafe ein christliches Begräbnis verweigert werden musste. Bei genauerer Betrachtung stellt man allerdings fest, dass sich der Selbstmordbegriff in sich selbst widerspricht, auch wenn er heute noch nach wie vor gebräuchlich ist.
Nach §211 StGB ist Mörder nämlich nur, „wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niederen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.“ (§211StGB, in: Seyfried, 1995, S. 10). Zieht man diese strafrechtliche Definition von Mord heran, so wird deutlich, dass der Suizid wohl kaum als Straftat, und damit nicht als Mord im eigentlichen Sinne aufgefasst werden kann; zum einen scheiden Mordlust, sexuelle Begierde, oder Habgier als Beweggründe für Suizid aus. Ob jemand aus niederen Beweggründen heraus sich das Leben nimmt, muß jeder für sich mit seinen sittlich-moralischen Maßstäben beurteilen. Zum anderen ist es unmöglich, sich heimtückisch zu töten. Allerdings muß ich einräumen, dass auch grausame Suizide gelegentlich vorkommen ebenso wie gemeingefährliche Mittel durchaus mit im Spiel sein können, wenn man nur an die Verkehrsunfälle denkt, mit denen Selbsttötungen herbeigeführt werden und bei denen Unbeteiligte zu Schaden kommen. Inzwischen ist die Zahl derer, die sich auf diese Weise töten und dabei andere gefährden, wohl auch keine Randerscheinung mehr. Schließlich erscheint es auch nicht plausibel, mittels Suiziden Straftaten zu ermöglichen oder zu verdecken.
Es hat sich also gezeigt, dass es sich beim Selbstmord um keinen strafrechtlichen Tatbestand handelt. Vielmehr wird er auch heute noch umgangssprachlich, aber fälschlicherweise als Synonym für den Akt der Selbsttötung gebraucht. Oder aber, mit Selbstmord soll ganz einfach eine subjektiv für unsittlich bzw. unmoralisch gehaltene Tat bezeichnet werden, wobei dem Suizidanten Unrecht getan wird, da seine Tat als Mord verurteilt wird. Es besteht hier die Gefahr, dass unterschiedliche Sachkategorien unter ein und demselben Begriff zusammengefasst werden, was dazu führen kann, dass Zusammenhänge verkannt werden und wissenschaftliche Widersprüche entstehen.
Dennoch stellt sich mir die Frage, warum der Begriff des Selbstmordes heute nach wie vor verwendet wird, um eine Selbsttötung zu bezeichnen. Dies hängt möglicherweise damit zusammen, dass ein Mord von vorneherein vom Mörder geplant wird und schließlich nach diesem Plan durchgeführt wird. Ähnlich verhält es sich mit der Selbsttötung. Auch der „Selbstmörder“ hat seiner Tat einen Plan zugrunde gelegt, den er schließlich ausführt. Möglicherweise mag dieser Zusammenhang mit ein Grund für die synonyme Verwendung der beiden Begriffe „Suizid“ und „Selbstmord“ sein.
1.2 Freitod
Jean Améry hat sich intensiv mit dem Phänomen des Freitodes auseinandergesetzt und die Ergebnisse in seinem Diskurs „Hand an sich legen“ festgehalten. Ich möchte seine wichtigsten Aussagen an dieser Stelle kurz zusammengefasst wiedergeben. Seine Darstellung ist dabei nihilistisch und stark biographisch geprägt; Jean Améry musste nämlich eine zweijährige Gefangenschaft in einem Konzentrationslager der Nazis erdulden. Er suizidierte sich zwei Jahre nach dem Erscheinen seines Diskurses. Nach Ansicht Amérys ist der Suizid eines Menschen seine freie Willensent-scheidung. Deswegen spricht er auch nicht von „Selbstmord“ oder „Suizid“, sondern von Freitod. Unabhängig von den gängigen Lehrmeinungen der Psychologie und Psychiatrie sei die Situation vor dem Absprung für alle Suizidenten gleich. Améry meint weiter, dass der Suizidversuch aus den Betroffenen andere Menschen macht, was aber nicht bedeuten muß, dass sie bessere, würdigere geworden sind (vgl. Améry, 1976, S. 26, in: Bronisch, 1995, S. 87). „Jeder zeitliche Abschnitt unserer Existenz, ja de facto jeder Moment hat seine eigene Logik und eigene Ehre“ (a.a.O., S. 22/23).Seiner Ansicht nach steht der Mensch „vor dem Absprung gleichsam noch mit einem Bein in der Logik des Lebens, mit dem anderen aber in der widerlogischen Logik des Todes. Die Logik ist aber die Logik des Lebens, während der Suizid die Fesseln reiner wie praktischer Vernunft sprengt“ (a.a.O., S. 30). Améry zweifelt die Unterscheidung zwischen natürlichem und un- bis widernatürlichen Tod an, wobei der Tod niemals natürlich sei, und somit auch der Freitod nicht (vgl. Améry, 1976, S.46, in: Bronisch, 1995, S. 88). Améry beruft sich in seinem Buch auf Jean Baechler, wonach im Freitod die Dignität, also Würde, des Menschen zum Ausdruck kommt, auch, wenn die Gesellschaft den Suizid aus verschiedenen Gründen ablehnt. Er moniert des weiteren, dass dem Suizidanten die Freiheit genommen wird, wenn er zum kranken Menschen erklärt wird und „dass die Grenzen von psychischer und körperlicher Gesundheit gegen den Bereich der Krankheit stets willkürlich und nach dem jeweils in Geltung stehenden Bezugssystem der Gesellschaft gezogen werden“ (a.a.O., S. 64). Jeder Mensch könne sein Leben selbst beenden, weil er irgendwann nicht mehr leben muß, sondern nicht mehr leben darf. Im Moment des Suizides verwirkliche sich der Mensch zum ersten Mal total, wobei sich ein nie gekanntes Glücksgefühl und großer Friede einstelle (a.a.O., S. 78/79). Améry betont weiter, dass der Suizid als „freier Tod“ anerkannt werden solle, über das einzig und alleine das Individuum zu entscheiden hätte und die Gesellschaft sich zurückhalten müsse (a.a.O., S. 102/103). Allerdings relativiert er diese Aussage, indem er den Suizid als Botschaft auffasst, nach der der Suizidant, der mit seinem Leben abgeschlossen hat, bis zum letzten Moment mit dem anderen zu tun hat (a.a.O., S. 112). Améry sieht den Suizid als Akt der Befreiung: „Aber der Freitod ist da und nimmt uns heraus, erlöst uns vom Sein, das hart ward, und vom ex-sistere, dass nur noch Angst ist“ (Améry, 1976, S. 131/132), in: Bronisch, 1995, S. 90). So lassen sich aus Amérys Diskurs über den Freitod folgende Thesen ableiten:
1. Der Mensch hat grundsätzlich die Möglichkeit, sein Leben zu beenden, wobei diese Möglichkeit nur dem Menschen eigen ist.
2. Suizid bedeutet ein Höchstmaß an menschlicher Freiheit.
3. Suizid ist immer ein Ausdruck von Humanität, Würde und Freiheit und schützt den Menschen vor einem inhumanen, unwürdigen und unfreien Leben.
4. Im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung von Psychologie und Psychiatrie ist die Entscheidung zum Suizid eine freie Entscheidung. Allerdings definieren die Vertreter von Psychologie und Psychiatrie, wo die Grenze zwischen psychischer Gesundheit und Krankheit zu ziehen sind.
5. Im Moment des Suizides gibt es zwischen den Suizidanten keine Unterschiede mehr, unabhängig von ihrer Biographie.
6. Auch wenn sich der Suizidant nach erfolgreicher Therapie wieder dem leben zugewandt hat, ist er doch ein anderer Mensch geworden als vor seinem Suizidversuch.
7. Améry meint, dass das Leben nicht das höchste Gut darstellt, sondern dass Leben und Tod vielmehr denselben Wert besitzen.
8. Im Suizid verwirklicht der Mensch seine absolute Individualität und Identität (vgl. Bronisch, 1995, S. 91).
1.3 Suizidgedanken, Suizidversuch und Parasuizid
Unter Suizidgedanken bzw. –ideen versteht Bronisch das Nachdenken über den Tod im allgemeinen, den eigenen Tod sowie Todeswünsche (vgl. Bronisch, 1995, S. 11). Als Beispiel für Todeswünsche denke ich an passive, unwillkürlich auftretende Gedanken wie: „Wenn mich jetzt ein Auto überfahren würde, würde es mir auch nichts machen“. Mit suizidalen Ideen im engeren Sinne sind direkte Vorstellungen von einer Suizidhandlung gemeint, d.h. „Ich möchte mich umbringen“ und „Wie kann ich mich umbringen“. Mit einer weiteren, einfachen, aber dennoch sehr präzisen Definition fasst Stengel suizidale Verhaltensweisen zusammen: „Eine auf einen kurzen Zeitraum begrenzte absichtliche Selbstschädigung, von der der Betreffende, der diese Handlung begeht, nicht wissen konnte, ob er sie überleben wird oder nicht“ (Stengel, 1970, in: Bronisch, 1995, S. 11).
Als Suizid- bzw. Selbsttötungsversuche werden Handlungen oder Unterlassungen eines Menschen bezeichnet, die zwar den eigenen Tod direkt oder indirekt bezwecken oder auf ihn verweisen, diesen jedoch nicht herbeiführen (vgl. Seyfried, 1995, S. 11). Mit Unterlassung ist gemeint, dass der Betreffende beispielsweise lebensnotwendige Medikamente nicht einnimmt. In der wissenschaftlichen Literatur hat man sich inzwischen weitgehend auf die Definition von Kreitman geeinigt, nach der unter Suizidversuch ein „selbstinitiiertes, gewolltes Verhalten eines Patienten“ zu verstehen ist, „der sich verletzt oder eine Substanz in einer Menge nimmt, die die therapeutische Dosis oder ein gewöhnliches Konsumniveau übersteigt und von welcher er glaubt, sie sei pharmakologisch wirksam“ (Kreitman, 1980, in: Bronisch, 1995, S. 11). Die Gegenüberstellung zweier Beispiele soll diese etwas abstrakt erscheinende Definition veranschaulichen: Ein Drogenabhängiger, der sich selbst mit einer Überdosis Halluzinogenen vergiftet hat und dabei zu Tode gekommen ist, ohne dass er dies beabsichtigt hätte, begeht nach obiger Definition keinen Suizidversuch, da keine aktive Intention zur Beendigung des eigenen Lebens vorliegt. Ein anderer Patient dagegen, der sich umbringen will, nimmt eine Substanz ein, die aber nachweislich pharmakologisch unwirksam ist; er hat demnach einen Suizidversuch begangen, da es seine Absicht war, zu sterben. Das heißt, laut Definition von Kreitman muß eine aktive Intention vorhanden sein, damit ein Suizidversuch vorliegt.
Ein bewußtes oder unbewußtes Verhalten dagegen, das weder direkt noch indirekt den eigenen Tod bezweckt und der auch nicht realisiert wird, bezeichnet Dorrmann als Parasuizid (vgl. Dorrmann, 1991, in: Seyfried, 1995, S. 13). Allerdings können parasuizidale Auswirkungen durchaus lebensgefährlich oder autodestruktiv sein. Anhaltendes parasuizidales Verhalten nennt Tölle chronischen Suizid (vgl. Tölle, 1991, S. 125, in: a.a.O.) bzw. wird nach Feuerlein als protrahierter Suizid bezeichnet (vgl. Feuerlein, 1979, S. 105, in: a.a.O.).
Um Suizidversuche besser beschreiben zu können, hat Feuerlein eine Unterteilung nach den Motiven des Suizidanten vorgenommen:
- Parasuizidale Pause mit dem Motiv der Zäsur
- Parasuizidale Geste mit dem Motiv des Appells
- Parasuizidale Handlung mit dem Motiv der Autoaggression.
Parasuizidale Pause:
Die Betroffenen wünschen sich, aus einer Realität, die sie nicht mehr ertragen können, einfach kurzzeitig zu flüchten, was sie meist mittels Tabletten oder Alkoholintoxikationen zu erreichen versuchen. Sie sehnen sich nach einer Pause, wollen einfach mal abschalten und ihre Ruhe haben. Der eigene Tod wird in den meisten Fällen nicht beabsichtigt. Es fällt die Diskrepanz auf, dass die Betroffenen selbst nicht den Wunsch zu sterben formulieren, aber gleichzeitig sind die Kriterien der obigen Definition des Suizidversuchs erfüllt, nämlich das selbstinitiierte, gewollte Verhalten des Betroffenen, der eine Überdosis einer Substanz einnimmt, die die therapeutische Dosis oder ein gewöhnliches Konsumniveau übersteigt und von der er glaubt, dass sie pharmakologisch wirksam sei (vgl. Bronisch, 1995, S. 13).
Nach Ergebnissen der empirischen Forschung ist es richtig, die parasuizidale Pause zu den Suizidversuchen zu zählen, da viele der Betroffenen später erneut eindeutige Suizidversuche unternehmen und sich in dieser Hinsicht nicht von Klienten mit parasuizidaler Geste oder parasuizidaler Handlung unterscheiden, auf die ich im folgenden eingehen werde.
Parasuizidale Geste:
Die Betroffenen wollen mit ihrer parasuizidalen Geste an ihre Mitmenschen appellieren, wobei sie den Suizidversuch so planen und durchführen, dass sie noch rechtzeitig von der Person, an die sich der Appell richtet, gefunden werden, z.B. nach Tablettenintoxikationen. Hintergrund von parasuizidalen Gesten sind oft Beziehungs- bzw. Partnerschaftskrisen, weshalb der Suizidversuch oft in der Wohnung der betreffenden Person, an die appelliert wird, durchgeführt wird, z.B. um eine drohende Trennung zu verhindern. Auch hier besteht für die Suizidenten die große Gefahr von späteren Wiederholungshandlungen von sämtlichen Arten parasuizidaler Verhaltensmuster (vgl.a.a.O.).
Parasuizidale Handlung mit ausgesprochener Autoaggression:
Diese Form von Suizidversuch ist charakterisiert durch das hohe Maß an Autoaggression und einem missglückten Suizid. Die parasuizidale Handlung unterscheidet sich in dreierlei Hinsicht von der parasuizidalen Pause und dem parasuizidalen Appell: der Betroffene beabsichtigt ernsthaft zu sterben im Gegensatz zur parasuizidalen Pause. Der Suizidversuch ist so angelegt, dass rechtzeitige Hilfe von dritter Seite mit großer Wahrscheinlichkeit nicht möglich ist, im Gegensatz zur parasuizidalen Geste. Außerdem wendet der Betroffene Suizidmethoden an, die einen erfolgreichen Suizid sehr wahrscheinlich machen, wie z.B. hochdosierte, hochwirksame pharmakologische Substanzen, oder sich erhängen, sich erschießen etc. Diese Suizidmethoden werden als „harte“ Methoden bezeichnet, zu denen auch der Sprung aus großer Höhe, der Eisenbahnsuizid usw. zählt. Die Einnahme einer Überdosis Tabletten oder oberflächliches Ritzen an den Handgelenken fallen dagegen in die Kategorie der sogenannten „weichen“ Suizidmethoden (vgl. Bronisch, 1995, S. 14).
Infolge dieser Einteilung der Suizidversuche in parasuizidale Pause, Geste und Handlung stellt sich die Frage, wie ernsthaft ein Suizidversuch einzuschätzen ist. Diese Einschätzung erfordert folgende drei Charakteristika: die Suizidabsicht, d.h. das Maß, mit dem sich der Betroffene nach dem Tod sehnt; das Suizidarrangement, d.h. wie wahrscheinlich bzw. unwahrscheinlich ein noch rechtzeitiges Auffinden nach erfolgtem Suizidversuch ist; und schließlich die Art der Suizidmethode, die entscheidend für die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Ausgangs des Suizidversuches ist. Dabei sind harte und weiche Methoden nicht unbedingt gleichbedeutend mit eher tödlich bzw. eher weniger tödlich, d.h. sie sind nicht unbedingt deckungsgleich. Z.B. gilt die Vergiftung mit einer hochdosierten toxischen Substanz wie Arsen als weiche Methode. Dagegen wird das Werfen eines Föns in die Badewanne als harte Methode aufgefasst, wobei dies Methode wegen der elektrischen Sicherungen heute keinen tödlichen Ausgang mehr hat. (vgl. a.a.O.).
1.4 Suizid, Selbsttötung und Selbsttötungsabsichten
Der Autor Bronisch leitet aus der Definition des Suizidversuches die Definition des Suizides ab, der nach seiner Ansicht ein zum Tode führender Suizidversuch ist. Er betont, dass diese beiden Definitionen bestimmte selbstschädigende Verhaltensweisen ausschließen, die von Menninger (1938) als verzögerte Selbsttötung beschrieben werden: Hierzu zählen Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängigkeit, Magersucht, aber auch riskante sportliche Aktivitäten, die das Leben des Betroffenen gefährden, wie z.B. riskante Formen von Bergsteigen, Drachenfliegen, Skifahren, Autofahren etc. Menninger geht davon aus, dass einem solchen selbstgefährdenden Verhalten ein unbewusster Todeswunsch zugrunde liegt. Dieses Verhalten kann aber nicht als Suizidversuch gedeutet werden, weil die bewusste, aktive Absicht zu sterben nicht vorhanden ist, ebenso wenig wie die auf einen kurzen Zeitraum begrenzte absichtliche Selbstschädigung. Der Vollständigkeit halber sei noch auf weitere autodestruktive Phänomene hingewiesen, die ebenfalls nicht zur Kategorie Suizidversuch bzw. Suizid zu zählen sind wie z.B. der Opfertod. Hier opfert sich der Betroffene für einen anderen Menschen, für eine Gemeinschaft, Idee, Ideologie oder einen Glaubensinhalt. Gleiches gilt auch für Askese und Märtyrertum. Charakteristisch hingegen ist für den Suizid, dass der Betroffene diese Handlung für sich selbst tut als letzten oder besten Ausweg aus einer Situation, die für ihn unerträglich geworden ist (vgl. Bronisch, 1995, S. 12).
Ich möchte noch auf die Definitionen von Suizid der Soziologen Durkheim und Hömmen eingehen, die Suizid als jede Handlung oder Unterlassung eines Menschen bezeichnen, die direkt oder indirekt seinen eigenen Tod bezweckt und herbeiführt. Durkheim versteht unter Suizid „jeden Todesfall, der direkt oder indirekt auf eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen ist, die vom Opfer selbst begangen wurde, wobei es das Ergebnis im voraus kannte“ (Durkheim, 1987, S. 27, in: Seyfried, 1995, S. 11). An dieser Stelle muß der aktive Charakter einer Suizidhandlung betont werden, d.h. der Ausdruck „Suizid begehen“ meint eine Handlung, und nicht deren Resultat. Deshalb muß ich Durkheim wiedersprechen, der Suizid als Todesfall abhandelt, wobei ja das Resultat im Vordergrund steht. Auch meine ich, dass der Suizidant das Ergebnis nicht im voraus kennen kann, da ja nicht alle Suizidhandlungen zum Tode führen, auch wenn sie diesen bezwecken.
Beim Begriff der Selbsttötung handelt es sich um die einzige wertfreie deutschsprachige Umschreibung für Suizid. Hömmen definiert Selbsttötung als „eine gegen das eigene Leben gerichtete Handlung mit tödlichem Ausgang“, d.h. er betont ausdrücklich den Prozesscharakter des Suizids (vgl. Hömmen, 1989, S. 16, in: Seyfried, 1995, S. 11). Allerdings berücksichtigt er hierbei nicht, dass der eigene Tod auch durch Nicht-Handeln, also durch Unterlassungen wie z.B. durch die Verweigerung der Nahrungsaufnahme herbeigeführt werden kann. Dorrmann ergänzt diese Definition von Hömmen noch durch den Zusatz „es ist nicht entscheidend, ob der Tod beabsichtigt wurde oder nicht“ (Dorrmann, 1998, S. 29). Es gibt Beispiele, die diese Definition veranschaulichen und bei denen eine Selbsttötung nicht beabsichtigt, jedoch fahrlässig in Kauf genommen wird. So bezieht diese Definition der Selbsttötung auch Menschen mit ein, die nicht den Wunsch zu sterben haben, aber dennoch mit ihrem Leben spielen wie z.B. Jugendliche, die bei einer Mutprobe ihr Leben aufs Spiel setzen, weil sie bei einem herannahenden Zug den Kopf auf die Schiene legen und darum konkurrieren, wer dies am längsten aushält.
Um die Problematik der Selbsttötung genauer zu definieren und auch autode-struktives Verhalten mit einzubeziehen, hat Dorrman die folgende Definition von Selbsttötungsabsichten eingeführt: „Von Selbsttötungsabsichten einer Person spricht man, wenn diese Person Verhaltensweisen zeigt oder auch gedankliche Prozesse berichtet, welche Handlungen oder auch Unterlassungen darstellen bzw. solche Planungen zum Inhalt haben, die aus der Sicht der Person zwangsläufig kurz- oder auch langfristig zum Tod führen oder die eigene Gesundheit in existentieller Weise gefährden“ (Dorrmann, 1998, S. 30).
In der Interpretation dieser komplexen Definition hebt der Autor hervor, dass sowohl die intendierten Selbsttötungsversuche und unbewussten Todessehnsüchte enthalten sind, als auch die Selbsttötung als langfristige Konsequenz eines wiederholten selbstzerstörerischen Verhaltens wie z.B. Drogenkonsum. Außerdem können mittels dieser Definition Selbsttötungsabsichten als Kontinuum begriffen werden, die von passiven Selbsttötungsgedanken bis hin zu akuter Suizidalität reichen können. In letzterem Fall erscheine eine stationäre Einweisung als das einzige Mittel der Wahl.
1.5 Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Suizid und Suizidversuch
Stengel arbeitete präzise die Unterschiede zwischen Betroffenen von Suizid und Suizidversuch heraus:
1. Die beiden Gruppen unterscheiden sich in ihrer Größe, d.h. die der Suizidversuche ist deutlich größer als die der Suizide.
2. Es gibt erhebliche Unterschiede bezüglich Geschlecht und Alter. So überwiegen bei der Gruppe der Suizide die Männer, bei der der Suizidversuche die Frauen. In höherem alter kommt es zu mehr Suiziden, in jüngerem Alter überwiegen die Suizidversuche.
3. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Betroffenen der Suizidversuche in die andere Gruppe übergehen, d.h. Suizid verüben, ist eher gering.
4. Mit einem „gelungenen“ Suizidversuch beendet ein Mensch sein Leben, ein „gescheiterter“ Suizidversuch dagegen kann für den Betroffenen ein kritisches, bedeutungsvolles Lebensereignis darstellen, das zu einschneidenden Veränderungen seiner Lebenssituation führen kann, vor allem hinsichtlich der Beziehung zu den Mitmenschen (vgl. Stengel, 1964, in: Bronisch, 1995, S. 16).
Die Untersuchungen Stengels machen also deutlich, dass es sich bei Betroffenen von Suizidversuch und Suizid um zwei unterschiedliche Gruppen handelt. Aus folgenden empirischen Untersuchungen geht aber hervor, dass es auch erhebliche Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Gruppen gibt.
1. Mit zunehmender Häufigkeit von Suizidversuchen steigt auch die Wahrscheinlichkeit eines vollendeten Suizids (vgl. Bronisch 1992a, in. Bronisch, 1995, S. 17).
2. Auch wenn die Zahl der Suizidversuche bei Frauen die der Männer um ein Vielfaches übersteigt, ist die Zahl der Suizidversuche auch bei Männern nicht unerheblich. Umgekehrt gilt, dass sich auch nicht wenige Frauen umbringen, auch wenn die Zahl vollendeter Suizide bei Männern deutlich höher liegt. In den 1970er und 1980er Jahren ist außerdem ein deutlicher Anstieg der Suizide bei Jüngeren zwischen 15 und 35 Jahren zu verzeichnen gewesen (vgl. Klerman, 1988, in: a.a.O.).
3. Pokorny hat in einer Untersuchung festgestellt, dass es bis heute noch nicht vollständig möglich ist, anhand von Eigenschaften von Personen eine Vorhersage zu treffen, wer von ihnen später einen erfolgreichen Suizid unternehmen wird. Diese Persönlichkeitseigenschaften werden auch als sogenannte „Prädiktoren“ bezeichnet. Das Problem besteht darin, dass die Eigenschaften, die Hinweise auf einen späteren Suizid erlauben, in einem beträchtlichen Maße auch für Personen gelten, die sich nicht suizidieren (vgl. Pokorny, 1983, in. a.a.O.).
4. Der “mißglückte” Suizidversuch stellt zwar für den Betroffenen ein kritisches Lebensereignis dar, das sein weiteres Leben entscheidend beeinflussen kann. Allerdings ist nicht garantiert, dass sich diese Veränderungen positiv auswirken; es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass der Betroffene im weiteren Verlauf seines Lebens doch durch einen vollendeten Suizid zu Tode kommt.
1.6 Erweiterter Suizid, Doppelsuizid und Massensuizid
Pollack definiert den erweiterten Suizid bzw. Suizidversuch als Mitnahmesuizid, bei dem andere Personen in das eigene suizidale Geschehen mitgenommen werden (vgl. Pollack, 1978, in: Welz, 1992, S. 13). Auf die Tötungshandlung der mitgenommenen Person folgt der eigene Suizid, wobei die Entscheidung, das eigene Leben aufzugeben, die Hauptmotivation in dem gesamten Geschehen darstellt. Charakteristisch für den erweiterten Suizid ist die altruistische Grundeinstellung des Suizidanten. So kommt es häufig vor, dass eine wahnhaft depressive Mutter ihre eigenen Kinder in den Tod mitnimmt. Die Mutter zieht aufgrund ihrer fürsorglichen Empfindungen pseudologische und pseudoaltruistische Konsequenzen, indem sie die eigenen Kinder tötet, um ihnen Untergang, Schuld, Versündigung und Verarmung zu ersparen. Typisch für die Mitnahme bei den Frauen ist die Einbeziehung der Kinder, typisch für die Männer ist die Mitnahme der Intimpartnerin.
Man unterscheidet bei den erweiterten Suiziden ähnlich wie bei Suiziden und Suizidversuchen, vollendete und unvollendete erweiterte Suizide. Aus den in der Literatur berichteten Fällen geht hervor, dass bei den unvollendeten erweiterten Suiziden die Frauen die Männer im Verhältnis 4:1 überwiegen. Männer begehen im Vergleich mit den Frauen dagegen vollendete erweiterte Suizide im Verhältnis von 2:1 (vgl. Welz, 1992, S. 13).
Unter Doppelsuiziden bzw. Suizidpakten versteht man Suizide, bei denen auf der Basis einer freiwilligen Übereinkunft zwei bzw. mehrere Menschen nach reiflicher Überlegung und sorgfältiger Planung beschließen, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden. Als Beispiele können der Doppelsuizid von Heinrich Kleist und seiner Lebensgefährtin oder auch der gemeinsame Suizid von Petra Kelly und ihrem Lebenspartner in der jüngeren Vergangenheit genannt werden.
Massensuizid liegt vor, wenn innerhalb kürzester Zeit in einem lokal abgrenzbaren Gebiet eine Anhäufung von Suiziden stattfindet, die die normale Schwankungsbreite überschreitet. So ereigneten sich beispielsweise am Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland infolge der Vertreibung durch sowjetische Truppen zahlreiche Massensuizide. Als weiteres Beispiel ist der Massensuizid der Bewohner Massadas , einer Festung in der Antike, zu nennen, als sich alle 960 Bewohner unter der Belagerung durch römische Truppen gegenseitig das Leben nahmen. In der jüngeren Vergangenheit kam es im Urwald von Guayana im Jahr 1978 ebenfalls zu einem kollektiven Suizid, dem die Anhänger des Volkstempelordens zum Opfer fielen.
Massensuizide, wie in den obigen Beispielen dargestellt, sind durch soziale Normen und Sanktionen geprägt. Solche kollektiven Suizide sind nur aufgrund von Gefolgschaftstreue, Pflichtergebenheit und Altruismus möglich. Durch soziale Normen soll die persönliche Ehrhaftigkeit (wie bei den Samurai) widererlangt werden bzw. kommt es zu den durch den Führer befohlenen und auch überwachten Kollektivsuiziden, wobei allerdings erhebliche Zweifel an der Freiwilligkeit bestehen (vgl. Singer, 1980, in: Welz, 1992, S. 14).
2. Epidemiologie und Suizidmethoden
2.1 Epidemiologie
„Epidemiologie ist die Lehre von der Verteilung von Krankheiten, Störungen, Symptomen in Raum und Zeit und ihrer Beziehung (Korrelation) zu anderen Merkmalen, vornehmlich soziodemographischen wie Alter, Geschlecht, soziale Schicht etc. Dabei wird unterschieden zwischen Inzidenz und Prävalenz. Unter Inzidenz versteht man die Neu-Erkrankungsrate in einem definierten Zeitintervall (z.B. ein Jahr). Unter Prävalenz versteht man den Prozentsatz der Erkrankten in einem definierten Zeitintervall (meistens im Sinne einer Lebenszeitprävalenz, d.h. die Zahl der Personen, die bis zum Untersuchungszeitpunkt jemals eine Erkrankung hatte).“ (Bronisch, 1995, S. 18)
In diesem Kapitel sollen die wichtigsten methodischen Probleme bei der Erfassung von Suizid und Suizidversuch dargestellt, die Forschungsstrategien erläutert und schließlich die wichtigsten Ergebnisse festgehalten werden. Außerdem werde ich auf die angewandten Suizidmethoden eingehen.
2.2 Methodische Probleme der Erfassung von Suizid und Suizidversuch
Das generelle Problem besteht darin, Suizide und Suizidversuche zuverlässig zu erfassen. Der Suizid wird seit dem 19. Jahrhundert in den meisten europäischen Ländern durch die Ermittlung der Todesursache durch einen Arzt oder Leichenbeschauer etc. festgestellt. Gerade in der früheren Vergangenheit, als Suizid noch als gesellschaftliches und religiöses Tabu galt, wurde ein Suizid als Todesursache oft vertuscht. Es kommt aber auch oft vor, dass der Suizid aus rein wirtschaftlichen Gründen vertuscht wird, damit eine Versicherungsgesellschaft, mit der beispielsweise eine Lebensversicherung abgeschlossen wurde, dazu verpflichtet wird, zu zahlen. Jedoch betrachten die meisten Versicherungsgesellschaften Suizid als ein natürliches Risiko und sichern sich mit einer Klausel ab, nach der sie die Prämien zurückzahlen, falls der Versicherte innerhalb von zwei Jahren nach Versicherungsabschluß Suizid begehen sollte. Damit soll verhindert werden, dass Personen nur in der Absicht, nach Abschluß des Vertrages Suizid zu begehen, eine Lebensversicherung abschließen. Dabei trägt die Versicherungsgesellschaft die Beweislast dafür, dass der Betroffene durch Suizid starb. Allerdings ist es bis jetzt nicht zu einer Suizidwelle nach Ablauf der Zweijahresfrist gekommen, sodaß man diesen Einfluß auf die Suizidstatistiken vernachlässigen kann (vgl. Bronisch, 1995, S. 19)
Eine weitere Schwierigkeit in der Erfassung von Suizidfällen tritt bei potentiellen Suizidanten auf, die schon ein höheres Lebensalter haben. Da alte Menschen bekanntlich eine Prädisposition für verschiedenste Krankheiten haben, die zum Tode führen können, ist es oft sehr schwierig, festzustellen, ob ein Suizidversuch zum Tode geführt hat oder ob ein natürlicher Tod vorliegt. Oft verbirgt sich hinter dem Weglassen eines lebensnotwendigen Medikamentes ebenfalls ein Suizidversuch, der aber nicht erkannt wird (vgl. Wedler, 1989, in: Bronisch, 1995, S. 19). In diesem Fall ist es allerdings fraglich, ob hier noch die Voraussetzungen für einen Suizidversuch gegeben sind, bei dem ja ein aktives Handeln notwendig ist.
Laut Kreitman brauchen die Rechtsorgane einen eindeutigen Beweis einer solchen (Suizid)absicht, bevor sie einen Todesfall als Suizid klassifizieren. Dabei werden in den einzelnen Ländern unterschiedliche juristische Akzente gesetzt. Ähnliches gilt auch für die rechtliche bzw. medizinische Sicht, wenn Todesursachen beurteilt werden sollen. Dabei sind die Maßstäbe, die für eine gerichtliche Beurteilung gelten, strenger, als die für medizinische (vgl. Kreitman, 1986, in: Bronisch, 1995, S. 19)
Es lassen sich Rückschlüsse auf die „wahre“ Suizidrate ziehen, indem man die Todesursachen-Statistiken auf die Zu- oder Abnahme von unklaren Todesursachen hin überprüft. So lässt sich feststellen, dass die Zahl der Suizide abnimmt, wenn gleichzeitig die der unklaren Todesursachen zunimmt. (vgl. Schmidtke, 1992, in: Bronisch, 1995, S. 20)
Als besonders problematisch hat sich eine repräsentative Erfassung von Suizidversuchen herausgestellt, zum einen, weil hier die Vertuschungsrate besonders hoch ist, zum anderen, weil es aufgrund der zum Teil kontroversen Definition von Suizidversuchen äußerst schwierig ist, Suizidversuchsraten zu erheben (vgl. Kreitman, 1986, in: Bronisch, 1995, S. 20).
2.3 Forschungsstrategien
Die zentrale Forschungsstrategie der Epidemiologie des Suizides und Suizidversuches besteht darin, Suizide und Suizidversuche in der Normalbevölkerung möglichst repräsentativ zu erfassen; trotz der oben gemachten Einschränkungen ist dies bei Suiziden mittels der Todesursachen-Feststellung in einem guten Maße möglich. Schwieriger gestaltet sich die Erfassung von Suizidversuchen, da hierzu Angaben von Probanden oder objektive Befunde nötig sind. Um die Zahl und Art von Suizidversuchen objektiv zu erfassen, werden Suizidenten, die wegen eines Suizidversuches in einer Klinik untersucht bzw. aufgenommen worden sind, registriert. Dies ist allerdings nur möglich, wenn alle Suizidenten nach einem Suizidversuch aufgenommen werden und die Suizidversuche konsequent dokumentiert werden. An dieser Stelle muß auf die Schwierigkeit verwiesen werden, dass sich eine beträchtliche Zahl an Suizidanten nach einem Suizidversuch nicht in stationäre Behandlung begeben und somit auch nicht erfasst werden können. Dies trifft auf ca. 20-30 % aller Suizidanten zu (vgl. Kennedy und Kreitman, 1973, in: Bronisch, 1995, S. 20). Um subjektive Ergebnisse von Personen aus der Normalbevölkerung oder Risikogruppen zu erhalten, werden diese anhand von Fragebogen oder Interviews befragt, wobei die Voraussetzung Aufrichtigkeit der befragten Personen ist.
Suizid- und Suizidversuchsraten werden auch über längere Zeiträume, d.h. Jahrzehnte bis ein Jahrhundert verfolgt, wobei gleichzeitig gesellschaftliche Veränderungen wie z.B. Wechsel von einer bäuerlichen zu einer Industriegesellschaft oder historischen Ereignissen (z.B. Kriege) berücksichtigt werden. Man erhofft sich auf diese Weise Rückschlüsse über Ursachen und Entstehungsbedingungen von Suizidalität. Außerdem ist für die Forschung von Interesse, wie sich die Suizid- bzw. Suizidversuchsziffern in anderen Ländern, Gesellschaften und Kulturen entwickeln. Speziell sind hier die Migrationsstudien zu nennen, wobei bestimmte Bevölkerungsgruppen, die in eine andere Gesellschaft oder Kultur gewechselt sind, über mehrere Generationen weiterverfolgt. Auf diese Weise erhält man ein besseres Bild von sozialen Einflüssen auf die Suizid- bzw. Suizidversuchsziffern. (vgl. Bronisch, 1995, S. 21)
Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen die Häufigkeiten von Suiziden und Suizidversuchen in Europa und Deutschland, auf die ich im folgenden näher eingehen werde.
2.4 Häufigkeiten von Suiziden und Suizidversuchen
2.4.1 Europäische Daten
Vergleicht man die Suizidziffern der europäischen Länder von 1960 und 1986, so lassen sich gewisse Trends ablesen. Die südeuropäischen Länder haben im Vergleich zu den nord- und mitteleuropäischen Staaten verhältnismäßig niedrige Suizidraten. An oberster Stelle stehen Ungarn und Österreich, zusammen mit den nordeuropäischen Staaten, der Schweiz und Deutschland (hier besonders die ehemalige DDR). Ein Vergleich der Suizidziffern von 1960 und 1986 zeigt weiter, dass es in den gut 25 Jahren zu keinen nennenswerten Änderungen in den einzelnen Ländern gekommen ist, allerdings ist eine eindeutig zunehmende Tendenz für die meisten Länder zu verzeichnen. Ausgenommen von diesem Trend sind die mediterranen Länder sowie die tschechische Republik (vgl. Bronisch, 1995, S. 21-22). Desweiteren zeigt sich, dass in allen europäischen Ländern die Suizidraten der Männer höher sind als die der Frauen; gleiches gilt auch für die einzelnen Altersstufen. Pfeiffer berichtet, dass außerhalb Europas nur in Indien die Suizidziffern der Frauen höher sind als die der Männer, wobei dieses Überwiegen der Frauen über alle Altersgruppen hinweg konstant bleibt (vgl. Pfeiffer, 1994, in: Bronisch, 1995, S. 22-23). Außerdem ist ein Anstieg der Suizidraten mit steigendem Alter zu verzeichnen, unabhängig vom Geschlecht, wobei sich die Suizidraten von Mann und Frau einander annähern (vgl. Kreitman, 1986, in: Bronisch, 1995, S. 23). Weiterhin hat die Suizidrate in der Altersgruppe der 15-35jährigen in den letzten zwei Jahrzehnten in den meisten europäischen Staaten ebenfalls zugenommen (vgl. Klerman, 1988, in: Bronisch, 1995, S. 23)
Die Suizidversuchsraten wurden mittels Kliniken, die Suizidanten nach einem Suizidversuch aufgenommen hatten und die ein repräsentatives Einzugsgebiet medizinisch versorgten, erfasst (vgl. Kreitman, 1986, in: Bronisch, 1995, S. 24). Die Suizidversuchsziffern liegen dabei um das 10- bis 15fache über denen für Suizide. Dabei liegen die Ziffern für das weibliche Geschlecht um ein Vielfaches, in der Altersgruppe der 15- bis 24Jährigen über denen der Männer. Sie gleichen sich dann allmählich an, bis ab dem 50. Lebensjahr kein Unterschied unter den Geschlechtern mehr feststellbar ist. Bis 1980 nahmen die Suizidversuchsziffern dramatisch zu, was an den Patientenzahlen der Krankenhäuser zu erkennen war, bis es schließlich um 1980 zu einem Stillstand der Zunahme gekommen ist, was auch als Plateauphase bezeichnet wird. Seitdem ist eine leichte Abnahme zu verzeichnen gewesen (vgl. Platt et al., 1988, in: Bronisch, 1995, S. 24)
2.4.2 Bundesdeutsche Daten (alte und neue Bundesländer)
Die Suizidziffer in den alten Bundesländern lag zwischen 1951 und 1977 bei 9159 bzw. 13926 pro Jahr. 1992 betrug die Suizidziffer für die alten Bundesländer 10087 Personen, davon 7019 Männer und 3086 Frauen. Die Suizidziffer (Zahl der Suizide pro 100.000 Einwohner) für das Jahr 1992 betrug für Männer 22,28, für Frauen 9,20 (vgl. Schmidtke und Weinacker, 1994, in: Bronisch, 1995, S. 24). In den neuen Bundesländern, der früheren DDR, begingen 1992 3342 Personen Suizid, davon 2290 Männer und 1052 Frauen, d.h. die Suizidziffer für Männer lag somit bei 30,4, die für Frauen bei 12,9. Im Vergleich mit europäischen Daten liegen die Suizidziffern der alten Bundesländer im mittleren, die der neuen Bundesländer im oberen Bereich (vgl. Bronisch, 1995, S. 24).
Betrachtet man die Suizidraten des Deutschen Reiches und der Bundesrepublik im Verlauf der letzten einhundert Jahre, so fällt auf, daß diese durchwegs konstant geblieben sind (vgl. Wedler, 1992, in: Bronisch, 1995, S. 25). Ein Nord-Süd- bzw. Ost-Westvergleich der Suizidziffern der einzelnen Bundesländer macht deutlich, dass sich diese zwischen norddeutschen und süddeutschen Bundesländern kaum unterscheiden, während die der ostdeutschen deutlich über denen der westdeutschen Bundesländer liegen (vgl. Schmidtke und Weinacker, 1994, in: Bronisch, 1995, S. 25).
Im Vergleich zu den 1950er Jahren sind die Suizidziffern für die Gesamtbevölkerung zurückgegangen. Allerdings gibt es in den einzelnen Altersgruppen sich stark unterscheidende Trends. Insbesondere für die männliche Altersgruppe zwischen 25 und 34 Jahren ist eine langfristige Zunahme zu verzeichnen. Außerdem fällt der überproportionale Anstieg der Frauen im Alter über 60 Jahren von 30% der Gesamtzahl der Suizide in den 1950er Jahren auf 45% zu Beginn der 90er Jahre auf.
Bei den Suizidversuchsraten liegen die Frauen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren an der Spitze, d.h. diese altersbedingte Entwicklung ist der der Suizide genau entgegengesetzt. Sie betragen für Männer 225 im Jahr 1972 und 80 pro 100.000 im Jahr 1990. Bei den Frauen liegen sie zwischen 250 (1972) und 95 pro 100.000 im Jahre 1990. D.h. bei beiden Geschlechtern ist im Verlauf der letzten 20 Jahre ein deutlicher Rückgang an Suizidversuchen zu verzeichnen.
Abschließend möchte ich noch auf die Suizid- und Suizidversuchsraten von Kindern, d.h. vom 4. bis 14. Lebensjahr, eingehen. So berichtet Pfeffer, dass es eindeutige Befunde gäbe, wonach bereits Kinder ab dem 4. Lebensjahr Suizidabsichten haben, die sie auch in die Tat umsetzen (vgl. Pfeffer, 1986, in: Bronisch, 1995, S. 26). Allerdings sind Suizide bei unter 10Jährigen etwas sehr Seltenes. So haben sich laut Todesursachenstatistik in den Jahren von 1988 bis 1991 jeweils nur ein bis zwei Jungen bzw. Mädchen das Leben genommen. Ab dem 10. Lebensjahr allerdings sind es bereits deutlich mehr: für das Jahr 1991 17 Jungen und 13 Mädchen (vgl. Schmidtke et al. im Druck, in: Bronisch, 1995, S. 27). Auch bei Kindern und Jugendlichen dominieren „harte“ Suizidmethoden, auf die ich im folgenden gesondert eingehen werde.
2.5 Suizidmethoden
Suizidmethoden sind u.a. auch abhängig von kulturellen Einflüssen und regionalen Faktoren. So ist beispielsweise in den USA, wo der Zugang zu Schusswaffen sehr leicht ist, das Erschießen bei den Männern die häufigste Suizidmethode. Die Häufigkeit dieser Suizidmethode wird von der regionalen Verteilung des Schusswaffenbesitzes mitbestimmt (vgl. Lester, 1988, in: Welz, 1992, S. 15). Als weitere Beispiele für regionale Faktoren sind die Sprünge von der Golden Gate Bridge in San Francisco sowie die Stürze in den Yahama Vulkan in Japan zu nennen. Mit höherem Lebensalter nehmen auch die sogenannten harten Methoden wie Erschießen, Erhängen, Ertränken oder Sprung aus großer Höhe, wie in den meisten Ländern, so auch in der Bundesrepublik zu. Klienten mit Psychosen entscheiden sich oft für besonders grausame und teilweise bizarr erscheinende Methoden, die meist zu Tode führen, wie das Verbrennen, Tod durch Strom oder Anbohren des Schädels.
In England und Wales in den 1960er und 1970er Jahren kam es zu einem Rückgang der Suizidziffern, im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ländern, wo die Zahl der Suizide angestiegen ist, weil bestimmte Suizidmethoden nicht mehr verfügbar waren (vgl. Kreitman, 1976, in: Welz, 1992, S. 15). So wurde nämlich zur gleichen Zeit die Gasversorgung umgestellt, was mit einer Detoxifikation des Hausgases in allen Landesteilen verbunden war. Außerdem wurden in den vergangenen Jahren Barbiturate durch die kaum noch letal wirksamen Benzodiazepine ersetzt, sodaß die Zahl der Suizide durch Vergiftungen etwas zurückgegangen ist. Allerdings stehen Medikamentenintoxikationen nach wie vor an erster Stelle bei den Suizidversuchen und werden vor allem von jüngeren Frauen als Suizidmethode gewählt. Am häufigsten nehmen sich betroffene Menschen durch Erhängen das Leben, gefolgt von Vergiftungen mit festen und flüssigen Stoffen (westdeutsche Bundesländer) und Vergiftungen durch Gase (ostdeutsche Bundesländer).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Die häufigsten Suizidmethoden in Deutschland (Bezugsjahr 1989),
aus: Welz, 1992, S. 16
Aus der Tabelle sind zum einen Unterschiede in den beiden Formen der Vergiftungen durch feste und flüssige Stoffe und durch Gase ersichtlich, zum anderen auch Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland sowie zwischen Männern und Frauen. In Ostdeutschland stellt das Erhängen mit 70% die häufigste Suizidmethode bei den Männern dar und kommt damit noch häufiger vor als in westdeutschland. In Ost- wie in Westdeutschland haben hier die Männer ein deutliches Übergewicht, während beim Sturz aus großer Höhe und dem Ertrinken die Frauen überwiegen. Bei den Männern stellt Erschießen die dritthäufigste Suizidmethode dar, wobei für Ostdeutschland keine exakten Zahlen für den Schusswaffen gebrauch vorliegen. Im übrigen sind Tod durch Schusswaffen sowie Erstechen und Schnitte in einer Kategorie zusammengefasst (vgl. Welz, 1992, S. 16).
3. Suizidsignale
3.1 Risikofaktoren
Die Ermittlung von Risikofaktoren erfolgt anhand verschiedener epidemiologischer Methoden, auf die ich aber aus Zeitgründen nicht näher eingehen werde. Man konnte inzwischen in mehreren Ländern eine Vielzahl von Risikofaktoren für Suizid feststellen. Als wichtigster Risikofaktor für Suizid ist das Vorliegen einer psychischen Erkrankung zu nennen. Die häufigsten psychiatrischen Störungen bei Suizidopfern sind affektive Störungen, eine Störung durch Konsum psychotroper Substanzen oder Schizophrenie. Daher lässt sich daraus schließen, dass eine psychische Erkrankung möglicherweise eine notwendige Bedingung für einen vollendeten Suizid ist (vgl. Schneider, 2003, S. 9). Außerdem wurden als Risikofaktoren Persönlichkeitsstörungen, insbesondere die emotional instabile Persönlichkeit, sowie bestimmte körperliche Erkrankungen wie HIV-Infektion und Krebserkrankungen ermittelt. Darüberhinaus dürfen nicht die sozialen Risikofaktoren wie mangelndes soziales Netzwerk und mangelnde soziale Unterstützung sowie Alleineleben vergessen werden. Aber auch Arbeitslosigkeit, eine fehlende Berufsausbildung, Einwanderung und Zugehörigkeit zu bestimmten Kulturen und Religionen stellen Faktoren für ein erhöhtes suizidales Risiko dar. Hervorzuheben sind vor allem auch negative Lebensereignisse wie der Verlust wichtiger Bezugspersonen durch Tod oder Trennung, Beziehungskonflikte, finanzielle Verluste und Konflikte mit dem Gesetz. Weitere Untersuchungsergebnisse zeigten, dass Traumen, männliches Geschlecht, höheres Lebensalter und frühere Suizidversuche mit einem erhöhten Suizidrisiko verbunden sind. Das Suizidrisiko wird stark erhöht, wenn mehrere Risikofaktoren gleichzeitig vorliegen, z.B. eine Komorbidität mehrerer psychiatrischer Störungen, wobei sich jedoch bestimmte Risikokon-stellationen in verschiedenen Populationen unterscheiden (vgl. a.a.O.).
Zusammenfassend sollen nun die verschiedenen Risikofaktoren, die die Ergebnisse epidemiologischer Studien wiederspiegeln, dargestellt und erläutert werden.
- Geschlecht: Vollendete Suizide werden am häufigsten von Männern durchgeführt, Suizidversuche dagegen verstärkt von Frauen. Die Dominanz des männlichen Geschlechts bei Suiziden lässt sich möglicherweise durch deren Rollenverständnis erklären, nachdem es Männern nicht erlaubt ist, „weich“ zu sein und sie deshalb verstärkt auf härtere Suizidmethoden wie Erhängen, Erschießen etc. zurückgreifen, so dass ihnen von vornherein nur eine geringere Überlebenschance bleibt, als den Frauen, die ja wie bereits erwähnt, größtenteils weichere Methoden bevorzugen.
- Alter: Erfolgreiche Suizide werden am häufigsten jenseits des 50. Lebensjahres durchgeführt, manchmal bis ins hohe Alter; Suizidversuche dagegen vor allem von jüngeren Menschen zwischen 15 und 34 Jahren. Dies lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass die älteren Menschen den Zenit ihres Lebens bereits überschritten haben, während die Jüngeren ihr Leben noch vor sich haben und daher leichter davor zurückschrecken, einen endgültigen Schlussstrich unter ihr Leben zu ziehen, da sie ja meistens noch Träume und Erwartungen an ihr Leben haben. Alte bzw. ältere Menschen dagegen mussten oftmals miterleben, wie sich ihre Träume, die sie früher hatten, nicht erfüllt haben bzw. nicht mehr erfüllen werden. Sie mussten möglicherweise Verluste verschiedenster Art hinnehmen, z.B. den Tod oder die Trennung des Partners oder einer anderen wichtigen Bezugsperson. Viele haben finanzielle Schwierigkeiten, mussten vielleicht einen sozialen Abstieg miterleben und leiden vor allem unter sozialer Isolation. Deshalb ziehen es viele ältere Menschen vor, lieber freiwillig aus dem leben zu scheiden, anstatt ein leben weiterzuführen, das sie als quälend empfinden und von dem sie sich nichts mehr erwarten.
- Familienstand: Besonders suizidgefährdet sind Geschiedene, hier vor allem auch wieder Männer, gleiches gilt auch für Suizidversuche. Am zweithäufigsten nehmen sich Verwitwete das Leben, gefolgt von den Ledigen. Verheiratete dagegen weisen die niedrigsten Suizid- und Suizidversuchsraten auf. Daraus lässt sich schließen, dass die Ehe nach wie vor einen protektiven Einfluß bezüglich Suizidalität aufweist. Geschiedene dagegen verschmerzen oft den Verlust des Ehepartners nicht, vielleicht, weil es für sie unerwartet zur Scheidung gekommen ist und sie nicht darauf vorbereitet waren. Der Suizid erfolgt dann häufig als Kurzschlussreaktion; der oder die Betreffende kann sich in dieser extremen Situation nicht vorstellen, ohne den anderen weiterzuleben, oder ist vielleicht auch nicht dazu bereit. Sie erleben die Scheidung so, als breche eine Welt für sie zusammen und machen sich vielleicht selbst verantwortlich für das Scheitern der Ehe, sie suchen den Fehler, ja die Schuld bei sich selbst und geraten auf diese Weise aus dem seelischen Gleichgewicht. Möglicherweise empfinden sie die Scheidung auch als persönliches Versagen, das sie nicht länger ertragen können oder wollen und sehen dann im Suizid einen Ausweg, um aus der für sie unerträglich gewordenen Realität zu flüchten. Verwitwete und auch Ledige werden oft mit dem Alleineleben nicht fertig, sie ertragen die Einsamkeit nicht mehr und ziehen den Trugschluß, dass sich ihre unerträgliche Lebenssituation nie mehr ändern wird. Auch hier erscheint der Suizid als mögliche Problemlösung, um aus der nicht mehr aushaltbaren Einsamkeit zu flüchten. Manche Verwitwete glauben auch, dass sie mit dem verstorbenen Lebenspartner wieder vereint werden könnten, wenn sie ihm in den Tod folgen. Umgekehrt dagegen lässt sich die niedrige Suizidrate unter Verheirateten dadurch erklären, dass diese zumindest größtenteils sich nicht einsam fühlen, sondern deren Situation vielmehr durch stetige zwischenmenschliche Nähe und Geborgenheit geprägt ist, was ganz offensichtlich eine suizidprotektive Wirkung hat.
- Soziale Schicht: Hollingshead und Redlich unterscheiden fünf verschiedene soziale Schichten: Oberschicht, obere und untere Mittelschicht, obere und untere Unterschicht. Die vier letzten bilden jeweils die Mittelschicht und die Unterschicht. Dabei machen Hollingshead und Redlich die Schichtzugehörigkeit abhängig vom Prestige der Berufe, das weltweit eine erstaunliche Einheitlichkeit aufweist, sowie vom Ausbildungsstand der Betroffenen. Es gibt eindeutige Hinweise, dass die Angehörigen der unterschicht in verstärktem Maße zu Suizidversuchen neigen, für einen Zusammenhang zwischen den anderen Schichten und Suizidalität gibt es nach Bronisch keine weiteren Belege (vgl. Bronisch, 2002, S. 6). Auch in Verlaufsuntersuchungen über 20 Jahre (Lewis und Sloggett, 1998, in: Schneider, 2003, S. 108) konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen sozialer Klasse und Mortalität durch Suizid festgestellt werden. Leider gibt es nur wenige Studien zum Einfluß des Berufes auf das Suizidrisiko. Allerdings liefern Querschnittsstudien Hinweise auf den Zusammenhang zwischen beruflicher Position bzw. Berufsgruppe und Suizidrisiko: so hat sich gezeigt, dass männliche Arbeiter, wie bereits erwähnt, erhöhte und Männer in gehobenen sozialen Positionen erniedrigte Suizidraten aufweisen (Kreitman et al., 1991, Andrian, 1996, in: Schneider, 2003, S. 109). Verschiedene Berufsgruppen, vor allem Angehörige medizinischer Berufe, im Handel Tätige, Bauern und Soldaten, zeigten hohe Suizidraten bzw. ein erhöhtes Suizidrisiko (Kelly et al., 1995, Kelly und Bunting, 1998, in: Schneider, 2003, S. 109). Das erhöhte Suizidrisiko männlicher Arbeiter lässt sich meiner Ansicht nach dadurch erklären, dass es sich bei der Arbeit oft um minderwertige, anspruchslose, schmutzige und schlecht bezahlte, vor allen Dingen aber oft um körperlich sehr anstrengende Tätigkeiten handelt, denen es also oft an Attraktivität in vielerlei Hinsicht fehlt. Die Folge ist, dass sich die betreffenden Arbeiter in ihrem Beruf nicht wohl fühlen, dass sie zunehmend frustriert und unzufrieden werden, sie allerdings gleichzeitig keine großen Chancen haben, diese Situation zu verbessern. Diese fortwährenden Frustrationen führen dann schließlich zu einer allgemeinen Lebensunzufriedenheit, die durch das fehlende Ansehen ihres Berufes noch zusätzlich verstärkt wird. Auch hier erscheint den Betreffenden der Suizid oftmals als letzter und geeigneter Ausweg, aus der unerträglich gewordenen Lebenswirklichkeit zu flüchten. Umgekehrt haben Männer in gehobenen beruflichen und sozialen Positionen niedrigere Suizidraten, weil sie mit ihren Arbeitsbedingungen, dem Einkommen und beruflichen Ansehen zufrieden sind und sich dem vorhin beschriebenen, berufsbedingten Druck, der auf den Arbeitern lastet, nicht ausgesetzt sehen. Die hohen Suizidraten unter medizinisch Tätigen, insbesondere Ärzten lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass sie das ständige Leid schwerstkranker Patienten nicht ertragen können und die fortwährende Konfrontation mit Sterben und Tod bei ihnen unbewußte Todesphantasien und –wünsche aktiviert, die sich in latent vorhandenen Suizidgedanken äußern. Ähnlich stellt sich die Situation bei Soldaten dar, die für das Töten von Menschen ausgebildet werden und durch diese belastende Lebenssituation verstärkt in die Nähe des Todes rücken, was wiederum die Aktivierung unbewußter Todeswünsche bzw. Suizidphantasien zur Folge haben kann.
- Arbeitsstand: Laut Bronisch besteht ein sicherer Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Suizid bzw. Suizidversuch (vgl. Bronisch, 2002, S. 6). Von den zahlreichen Studien, die diesen Zusammenhang belegen, sei nur auf die Studie von Hawton et al. (1993) verwiesen, die 15 bis 24 Jahre alte Männer bis zu 17 Jahre lang nachuntersuchten, die wegen selbstverletzenden Verhaltens stationär behandelt worden waren. Sie fanden ein 2,8fach erhöhtes Risiko für Arbeitslose, sich das Leben zu nehmen (vgl. Hawton et al., 1993, in: Schneider, 2003, S. 102). Gründe für das erhöhte Suizidrisiko Arbeitsloser sind meiner Meinung nach zum einen das Fehlen einer Lebensaufgabe verbunden mit den sich daraus ergebenden finanziellen Schwierigkeiten. Diese führen zum anderen dazu, dass sich die Betreffenden in vielerlei Hinsicht, von der Lebensgestaltung bis zum Lebensstandard, einschränken müssen. Außerdem empfinden viele Arbeitslose ihre Situation, die sie zur Untätigkeit verdammt, häufig als regelrechtes Trauma. Dieses wiederum zieht psychische Probleme nach sich, bis hin zu Depressionen, welche durch, gerade bei langandauernder Arbeitslosigkeit, fehlende Zukunftsperspektiven noch verstärkt werden. Nicht zu vergessen sind die entstehenden Zukunftsängste und gesellschaftlichen Stigmatisierungen, unter denen viele Arbeitslose zu leiden haben. Gerade wenn die Betroffenen eine Familie zu versorgen haben, stellen sich leicht Versagens- und Insuffizienzgefühle ein. Depressionen wiederum gehen bekanntermaßen oft mit Suizidgedanken und –handlungen einher.
- Jahreszeitliche Schwankungen: Es ist seit längerer Zeit bekannt, dass Suizide gehäuft im Frühjahr und Sommer auftreten. Diese saisonale Schwankung tritt sowohl in den Ländern der nördlichen wie auch der südlichen Hemisphäre auf (vgl. Bronisch, 2002, S. 6). Da sich diese jahreszeitlichen Schwankungen auch bei Depressionen finden lassen, liegt hierin möglicherweise die Erklärung für dieses Phänomen.
- Stadt-Land-Unterschiede: In den meisten Ländern finden sich hohe Suizidraten in den Städten, während sie in ländlichen Gebieten niedriger liegen. Hingegen sind in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion die Suizidraten auf dem Land wesentlich höher als in städtischen Gebieten. (a.a.O., S. 6). Eine mögliche Erklärung für die hohen Suizidraten in den Städten liegt vielleicht darin, dass der einzelne dort in weitgehender Anonymität lebt, d.h. in der Masse der städtischen Bevölkerung nahezu untergeht und daher nur schwer soziale Kontakte knüpfen kann. Dies kann zu sozialer Isolation führen, die wiederum bekanntermaßen ja suizidfördernd ist. Auf dem Land dagegen fällt es dem einzelnen wesentlich leichter, soziale Kontakte herzustellen, da dort kaum Anonymität vorherrscht und bekanntlich „jeder jeden kennt“, wobei diese bessere soziale Integration eine deutliche suizidprotektive Wirkung hat, sodaß dort Suizide seltener vorkommen als in der Stadt.
- Religionszugehörigkeit: Besonders in den katholischen Ländern treten wesentlich niedrigere Suizid- und Suizidversuchsraten auf, als in den protestantischen. In Europa weisen die Länder des protestantischen Nordens höhere Suizidraten auf als die des stärker katholischen Südens, in den Grenzen des ehemaligen deutschen Reiches findet man im katholischen Westen höhere Suizidraten als im protestantischen Osten. Die Analyse von Daten ergab, unter angemessener Berücksichtigung des Grades der Verstädterung und der sozialen Schichtung, dass tatsächlich nur geringfügige Unterschiede zwischen katholischen und protestantischen Gegenden übrig bleiben. Diese kommen im allgemeinen dadurch zustande, weil in den katholischen Gemeinden ein stärkerer sozialer Zusammenhalt vorherrscht (vgl. a.a.O.). Außerdem sei noch angemerkt, dass in den vorwiegend atheistisch geprägten Ländern wie z.B. der ehemaligen DDR, die Suizidraten weltweit am höchsten sind, während sie in den muslimischen Staaten in der Regel äußerst niedrig sind. Der Koran verurteilt Suizid ausdrücklich als Todsünde, genau wie der christliche Glaube. Es ist bekannt, dass die Moslems ihren Glauben sehr ernst nehmen, was beispielsweise durch ihre regelmäßigen, täglich mehrmaligen Gebetszeiten zum Ausdruck kommt. Daraus lässt sich schließen, dass der Glaube und Religion eine nicht zu vernachlässigende protektive Funktion im Hinblick auf Suizidalität haben.
Eine noch größere Rolle als soziodemographische Charakteristika für Risikofaktoren spielen psychiatrische Störungen. In diesem Zusammenhang sind vor allem depressive Störungen und Suchterkrankungen, besonders Alkoholismus, zu nennen. Laut Bronisch gibt es Hinweise dafür, dass ca. 15% der stationär behandelten Depressiven und Suchtkranken sich suizidieren (vgl. Bronisch, 2002, S. 14). Bei suizidgefährdeten Depressiven haben sich eine Reihe charakteristischer Symptome und Syndrombilder gezeigt wie z.B. ängstlich-agitiertes Gepräge, langdauernde Schlafstörungen, Affekt- und Aggressionsstauungen, der Beginn oder das Abklingen depressiver Phasen sowie Mischzustände. Außerdem liegen oft biologische Krisenzeiten vor wie Pubertät, Gravidität (Schwangerschaft), Puerperium (Wochenbett) oder Klimakterium (Wechseljahre). Zudem treten oft schwere Schuld- und Insuffizienzgefühle auf sowie ein Krankheitswahn oder es werden tatsächlich unheilbare Krankheiten diagnostiziert. Depressionen gehen des weiteren häufig mit Alkoholismus und Toxikomanie (Medikamentenabhängigkeit) einher (vgl. Kielholz, 1974, in: Sonneck, 1995, S. 157). Bei stationär in psychiatrischen Krankenhäusern behandelten Klienten ist vor allem auf schizophrene Störungen hinzuweisen. Auch bei Panikattacken bzw. Panikstörungen, die oftmals zusammen mit Depression, Sucht und Persönlichkeitsstörungen, sowie Persönlichkeitsstörungen allein auftreten, kommt es sehr häufig zu Suizidversuchen und Suiziden (vgl. Bronisch, 1995, S. 50). Dies lässt sich meiner Meinung so erklären, dass psychisch Kranken früher oder später die Folgen ihrer Erkrankung bewusst werden, was insbesondere für die schizophrenen Störungen gilt, und welche Auswirkungen diese auf ihr weiteres leben haben. Viele können oder wollen nicht mit einer solchen schwerwiegenden Erkrankung weiterleben, sie wollen sich nicht damit abfinden, dass sich all die Hoffnungen und Erwartungen an ihr Leben, die sie früher hatten, nun nicht mehr erfüllen sollten. Besonders dann, wenn sie realisieren, dass sich die ehemals gesteckten beruflichen Ziele nun krankheitsbedingt nicht mehr verwirklichen lassen werden, neigt so mancher psychisch Kranke dazu, suizidal zu reagieren, anstatt den eigenen sozialen Abstieg miterleben zu wollen. Oftmals spielt aber auch der mit der psychischen Erkrankung verbundene Leidensdruck eine entscheidende Rolle. Ich denke hier vor allem an Menschen, die an einer Panikstörung leiden. Die oft regelmäßig, vielleicht sogar mehrmals wöchentlich auftretenden Attacken erzeugen nicht nur eine quälende Erwartungsangst vor der nächsten Attacke, sondern schränken den Betroffenen auch in seiner persönlichen Lebensgestaltung massiv ein, besonders dann, wenn davon die berufliche Tätigkeit beeinträchtigt wird. Viele Betroffene, die einem solchen quälenden Leidensdruck ausgesetzt sind, können diesem irgendwann nicht mehr standhalten und sind extrem gefährdet, diesem durch Suizid ein Ende zu bereiten. Außerdem sind bei bestimmten körperlichen Erkrankungen wie Krebs oder Aids leicht erhöhte Suizidraten festzustellen (vgl. Bronisch, 2002, S. 14).
Eine wichtige Rolle als Risikofaktoren spielen desweiteren ein bereits stattgefundener Suizidversuch sowie die Suizidmethode (vgl. Bronisch, 1995, S. 51). Jemand, der bereits einmal oder mehrmals während einer schweren Krise auf Suizid als vermeintliche Problemlösungsmethode zurückgegriffen hat, läuft besonders Gefahr, bei einer erneuten Krise dies wieder zu tun, da er bereits einmal oder mehrmals die Hemmschwelle vor einem Suizidversuch überschritten hat. Die Wahrscheinlichkeit eines Suizides wird umso größer, je mehr Suizidversuche in der Vorgeschichte erfolgt sind (vgl. Bronisch, 2002, S. 14). Wenn sich dabei in der Folge mehrerer Suizidversuche bei der Wahl der Suizidmethode eine Verschärfung in Richtung härterer Methoden feststellen lässt, besteht eine relativ hohe Suizidgefährdung. Desweiteren betreffen die eigentliche Suizidthematik direkte oder indirekte Suiziddrohungen. Hier besteht für den Helfer oder Therapeuten häufig die Gefahr, dass man den Betreffenden und das Maß seiner augenblicklichen Gefährdung nicht ernst (genug) nimmt, weil man denkt, jemand, der Suiziddrohungen ausspricht, wird sich schon nichts antun, da ja bekanntlich „bellende Hunde“ nicht beißen. Deshalb empfiehlt es sich dringend, jede Suiziddrohung auch ernst zu nehmen, da es sich um einen nachgewiesenen Risikofaktor handelt. Jemand, der Suiziddrohungen gegenüber seinen Mitmenschen äußert, sei es nun in Form direkter oder indirekter Äußerungen, befindet sich meist in einer sehr prekären seelischen bzw. psychosozialen Notlage, auf die er seine Mitmenschen aufmerksam machen will, weil er sich anders nicht mehr zu helfen weiß und sich vielleicht unbewußt Hoffnungen macht, dass der andere ihm in welcher Form auch immer, Hilfe geben kann bzw. zumindest Hilfsmöglichkeiten aufzeigen kann. Der Betroffene wird sich dabei in den meisten Fällen zunächst an seine besonders nahe stehenden Mitmenschen, sprich seinen Lebenspartner, seine Eltern oder bei alten Menschen an seine Kinder wenden. Dabei weiß der Betreffende meiner Ansicht nach aber oftmals genau, dass auch die anderen ihm in seiner verzweifelten Notlage auch nicht derart helfen können, so dass seine Probleme, die den Anlaß für seine Suizidalität darstellen, nun einfach verschwinden werden. Dennoch kann das Aussprechen von Suiziddrohungen, das meist als Hilfeschrei bzw. Appell an seine Mitmenschen zu verstehen ist, eine deutlich entlastende Funktion für den Betroffenen haben. Von daher sollte man als derjenige, an den sich der Suizidgefährdete wendet, mit Zeit und Geduld begegnen und ihm Gelegenheit geben, sich in Ruhe auszusprechen, bis sich im gemeinsamen Gespräch neue Hilfsmöglichkeiten und Auswege ergeben, die er alleine nicht gesehen hat. In jedem Fall muß vermieden werden, dass der hilfesuchende Klient infolge seiner Suiziddrohungen nicht ernstgenommen und abgewiesen wird. Gerade bei indirekten Suiziddrohungen gegenüber weniger nahe stehenden Mitmenschen, z.B. den Kollegen am Arbeitsplatz, muß man genau hinhören und sensibel sein und bei Verdacht auf eine Suizidgefährdung diese konkret ansprechen. Als Beispiel für eine solche indirekte Suiziddrohung kann die Äußerung eines Betreffenden genannt werden, er sei an einem bestimmten Datum bereits nicht mehr da, er sei zu diesem Zeitpunkt bereits weg. In einem solchen Fall sollte man sich als Helfer nicht scheuen, die vermeintliche Suizidgefährdung offen anzusprechen, ohne Angst haben zu müssen, dass der Betreffende dann erst recht suizidal reagieren könnte. Dabei ist das Gegenteil der Fall: die meisten Suizidgefährdeten reagieren mit Erleichterung darauf und sind froh, sich über ihre Suizidgedanken aussprechen zu können.
Ein weiterer Risikofaktor für Suizidalität liegt vor, wenn der Betreffende konkrete Vorstellungen äußert, wie er einen geplanten Suizid durchführen wird oder wenn er sogar bereits konkrete Vorbereitungshandlungen getroffen hat, wie z.B. das Horten von Schlaftabletten oder der Kauf eines Strickes. Äußert jemand gegenüber seinen Mitmenschen, Angehörigen oder Bekannten, unaufgefordert von sich aus, er habe sich bereits konkret überlegt, wie er sich umbringen werden, so kann das zunächst bedeuten, dass er sich tatsächlich in einer akuten seelischen, psychischen oder psychosozialen Notlage befindet und seine Mitmenschen darauf aufmerksam machen möchte. Er tut dies vielleicht auch deshalb, um die anderen von der Ernsthaftigkeit seiner Notlage und seines geplanten Vorhabens zu überzeugen. Sein Verhalten kann ähnlich wie bei den Suziddrohungen als Hilfeschrei interpretiert werden, er erhofft sich unbewußt Hilfe von seinen Mitmenschen in einer vielleicht für ihn hoffnungslosen, verzweifelten Situation. Er kann aber auf diese Weise versuchen, seine Mitmenschen unter Druck zu setzen, um sie für seine Zwecke gefügig zu machen oder um seinen Willen durchzusetzen beispielsweise bei einer anstehenden Trennung von einem geliebten Menschen oder um ähnliche Verlusterlebnisse zu verhindern. Man spricht hier von manipulativer bzw. erpresserischer Suizidalität, auf die ich in einem späteren Kapitel noch genauer eingehen werde. Wird der Betreffende von einem Helfer oder Therapeuten nach solchen konkreten Vorstellungen über die Durchführung suizidaler Handlungen gefragt, die er auch bejaht, so muß man damit rechnen, dass der Klient tatsächlich akut suizidgefährdet ist, und das suizidale Risiko höher einzuschätzen ist, als wenn eine manipulative oder erpresserische Form von Suizidalität vorliegt. Hat der Betreffende bereits konkrete Vorbereitungshandlungen vorgenommen, muß ebenfalls zunächst davon ausgegangen werden, dass hier eine akute Suizidalität vorliegt. Dieses Vorliegen muß durch gezieltes Nachfragen von Seiten des Helfers überprüft werden. Allerdings muß einschränkend angemerkt werden, dass betroffene Klienten häufig Schlaftabletten bei sich zu Hause horten oder sich einen Strick kaufen, um jederzeit das Gefühl und die Gewissheit zu haben, wann immer sie wollen aus dem Leben scheiden zu können, insbesondere dann, wenn sich ihre psychosoziale Situation dramatisch verschlechtern sollte. Sie müssen nicht mit ansehen, wie sie von ihren Problemen überwältigt werden, sondern sie selbst können aktiv dagegen etwas tun, und wenn es zunächst einmal nur der Kauf von Schlaftabletten oder eines Strickes ist. Diesen Suizidgefährdeten erscheint der Tod oftmals als Erlösung ihrer Probleme, als letzte Freiheit, die sie sich jederzeit glauben nehmen zu dürfen.
Als weiterer Risikofaktor ist nach Kielholz eine „unheimliche Ruhe“ nach vorheriger Suizidthematik und Unruhe zu nennen (Kielholz, 1974, in: Sonneck, 1995, S. 157). Dem Helfer oder Therapeuten muß meiner Ansicht nach diese sogenannte „Ruhe vor dem Sturm“ verdächtig vorkommen, zumal sich der Klient bis vor kurzem noch ganz anders verhalten hat, er unruhig und aufgewühlt erschienen ist und das Thema Suizid immer wieder angesprochen worden ist oder sogar im Mittelpunkt gestanden hat. Ist der Klient nun aber plötzlich auffallend ruhig und entspannt, so dass man denkt, es gehe ihm nun ganz objektiv besser, so ist größte Vorsicht geboten: möglicherweise besteht nämlich akute Suizidgefahr, da der Betreffende insgeheim bereits den Entschluß gefasst hat, sich zu suizidieren. Die quälende Unruhe, die Angst vor seinen Problemen ist vollständig verschwunden, er hat diese zwar nach wie vor nicht gelöst, aber sie scheinen ihn nun nicht mehr zu bedrängen, er hat mit ihnen abgeschlossen, jetzt, da er weiß, was er zu tun hat, welchen letzten Schritt er noch gehen muß. Diese äußere ruhe darf vom Helfer bzw. Therapeuten auf keinen Fall übersehen werden oder fehlinterpretiert werden. Es besteht nämlich in der Tat die Gefahr, dass man sich als Therapeut zusammen mit dem Klienten freut, dass es ihm scheinbar besser geht, ohne zu begreifen, wie es wirklich in ihm aussieht und dabei die akute Suizidgefährdung zu übersehen. In diesem Fall muß der Therapeut wachsam bleiben und spätestens im gemeinsamen Gespräch über die Gründe dieser scheinbaren Besserung des Zustandes des Klienten Verdacht schöpfen und die Suizidgefährdung erkennen. Er muß den Klienten offen auf dessen Suizidalität hin ansprechen und das maß der Suizidgefährdung einschätzen, worauf ich aber später noch genauer eingehen werde.
Schließlich sind noch die Selbstvernichtungs-, Sturz- und Katastrophenträume als Risikofaktoren zu erwähnen, die die eigentliche Suizidthematik betreffen. Treten wiederholt solche Albträume auf, in denen der Klient lebhaft und eindringlich die Vorwegnahme seines eigenen Todes erlebt, kann dies ein unbewußtes Anzeichen einer bestehenden Suizdgefährdung sein. Diese aus dem Unbewußten stammenden Suizidhinweise sollten vom Klienten in jedem Fall ernst genommen und gegenüber dem Helfer oder Therapeuten angesprochen werden, damit diese mittels Deutung einen Zusammenhang zu der aktuellen Lebenssituation des Klienten herstellen können und gegenbenenfalls auf Veränderungen in dessen Leben hinwirken können. Auch der Therapeut sollte sich dazu angehalten fühlen, aktiv und konkret nach solchen möglichen selbstdestruktiven Träumen des Klienten zu fragen.
Suizidale Risikofaktoren lassen sich des weiteren auch im psychosozialen Umfeld des Klienten finden. So kann das Vorkommen von Suiziden in seiner Familie oder Umgebung eine Suggestivwirkung haben (vgl. Kielholz, 1974, in: Sonneck, 1995, S. 157). Das bedeutet meiner Meinung nach, dass die Tat eines nahen Angehörigen, Verwandten, Freundes oder Bekannten zu einer derart gedanklichen Fixierung im Bewusstsein des Klienten geführt hat und er unter den gegebenen Voraussetzungen, beispielsweise einer schwierigen Lebenssituation in Versuchung gerät, diese Tat nachzuahmen. Dieser nachahmungs- oder Imitationseffekt wird gemeinhin als „Werther-Effekt“ bezeichnet (nach dem Drama Goethes „Die leiden des jungen Werther“). Dabei ist die Gefahr eines derartigen Nachahmungssuizides meiner Ansicht nach umso größer, je näher der Klient und der Suizidant aus dessen Umfeld sich gestanden haben, d.h. ob sie sich nur flüchtig gekannt haben und einander nichts bedeutet haben oder aber die Verbindung so intensiv gewesen ist, dass man von einer seelischen Bindung sprechen kann. Im letzteren Fall kann es durchaus sein, dass mit dem Tod des nahe stehenden Menschen ein Teil des eigenen Ichs des Klienten unwiederbringlich verloren gegangen sein mag, vor allem dann, wenn der Suizid völlig überraschend passiert ist und der Klient, wie in den allermeisten Fällen, nicht darauf vorbereitet gewesen ist. In jedem Fall hinterlässt die Tat beim Klienten einen bleibenden Eindruck und es hängt von seiner Fähigkeit, die Trauer so gut wie möglich zu verarbeiten ab, ob er den Verlust bewältigt und damit weiterleben kann oder ob er ihn nicht verarbeiten kann und sich möglicherweise sogar psychische, d.h. traumatische Symptome zeigen z.B. in Form einer posttraumatischen Belastungs-störung. In diesem Fall des nicht adäquat verarbeiteten Verlustes des
nahestehenden Menschen ist damit auch die Gefahr gegeben, dass der Klient in schwierigen Lebenssituationen, die ihm ausweglos erscheinen, sich an den Suizid des anderen erinnert und ebenfalls den Suizid als Problemlösung in Betracht zieht. Auf die Bedeutung und psychische Verarbeitung von Verlusterlebnissen werde ich weiter unten noch detaillierter eingehen.
Kielholz erwähnt in seiner Auflistung als weiteren Risikofaktor aus dem psycho-sozialen Bereich eine familiäre Zerrüttung in der Kindheit, insbesondere das sogenannte broken home und sexuellen Missbrauch (vgl. a.a.O.). Wächst ein Kind in einer zerrütteten Familie auf, in der die Eltern sich ständig streiten oder in Scheidung leben oder in der es immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen zwischen den Eltern oder den Eltern und den Kindern kommt bzw. die Eltern drogen- oder alkoholabhängig sind, so ist es für das Kind meiner Ansicht nach fast unmöglich, sich zu einer psychisch gesunden und stabilen Persönlichkeit zu entwickeln. Gleiches gilt auch für sexuellen Missbrauch seitens der Eltern. Dem Kind gelingt es nicht, ein gesundes Vertrauen zu seinen Eltern und in dessen Folge auch nicht zu anderen Mitmenschen, hier vor allem nicht zu Erwachsenen, aufzubauen. Infolge dieses fehlenden Urvertrauens muß das Kind in seiner weitern psychosozialen Entwicklung mit massiven Störungen in seinen sozialen Beziehungen fertig werden, die es ohne geeignete psychotherapeutische Hilfe alleine nicht mehr bewältigen kann. Ohne solche professionelle Hilfe wird das Kind gerade auch im Erwachsenenalter erhebliche Schwierigkeiten in der Kontaktaufnahme und Beziehungsgestaltung zum anderen Geschlecht haben, da es aufgrund der schlimmen Kindheitserfahrungen nicht gelernt hat, sich einem anderen anzuvertrauen. Gerade auch bei Mißbrauchsopfern besteht die Gefahr, dass sich der oder die Betreffende selbst als minderwertig oder schmutzig erlebt und unter massiven Schuldgefühlen zu leiden hat. So kann bei einem jungen Menschen, der sich selbst nicht lieben und annehmen gelernt hat, ja, der sich selbst ablehnt und niemand findet, dem er sich anvertrauen kann, leicht der Wunsch entstehen, Schluß zu machen mit diesem Leben, da er nicht länger ertragen kann.
Als weiteren psychosozialen Risikofaktor weist Kielholz auf das Fehlen oder den Verlust mitmenschlicher Kontakte infolge von Vereinsamung, Entwurzelung oder einer Liebesenttäuschung hin (vgl. a.a.O.). Dabei konnte in mehreren Unter-suchungen (wie z.B. Cheng et al., 2000, in: Schneider, 2003, S. 118) eindeutig nachgewiesen werden, dass soziale Isolation bzw. der Verlust eines nahestehenden Menschen zu einem erhöhten Suizidrisiko beitragen. Ebenso ist der Zusammenhang zwischen sozialer Isolation und Depression gesichert. Ich denke, eine Person, die niemanden hat, mit dem sie reden kann, mit dem sie ihre Sorgen und Nöte, aber auch Freuden teilen kann, fragt sich zwangsläufig irgendwann nach dem Sinn des Lebens, wofür sie denn eigentlich lebe. Es ist evident, dass der Mensch um glücklich zu sein, tragfähige soziale Kontakte braucht. Ist der Betreffende dagegen über lange Zeit vereinsamt oder fühlt sich entwurzelt, weil es niemand gibt, der ihn braucht, so besteht in einem beträchtlichen maße die Gefahr, dass er eine Depression entwickelt. Gleiches gilt auch, wenn der Betreffende eine schwere Liebesenttäuschung hinnehmen musste und dabei überfordert ist, diese adäquat zu verarbeiten. Schließlich ist der Zusammenhang zwischen Depression und Suizid ebenfalls gesichert, worauf ich später noch genauer eingehen werde.
Desweiteren sind besonders suizidgefährdet diejenigen, die berufliche und finanzielle Schwierigkeiten haben (Kielholz, 1974, in: Sonneck, 1995, S. 157). Dies liegt meiner Meinung nach daran, dass jemand, dessen Arbeitsplatz gefährdet ist bzw. der seinen Arbeitsplatz verloren hat, zunächst einmal mit einer ungeheueren Frustration fertig werden muß, bei dessen Bewältigung der ein oder andere aber bereits überfordert ist und infolgedessen in einer Art Kurzschlussreaktion an Suizid denken muß. Lebt der Betreffende alleine, ist die Gefahr eines Suizidversuches wahrscheinlich größer als in einer Partnerschaft, wo ihm der Partner bzw. die Partnerin in seiner Notlage zur Seite stehen kann und verhindern kann, dass er die Hoffnung vorschnell aufgibt. Der Alleinlebende ist demnach also eher gefährdet, Suizid zu begehen, da er das Trauma Arbeitslosigkeit bzw. seinen sozialen Abstieg nicht miterleben möchte. Hat der Betreffende eine Familie, besteht allerdings die Gefahr, dass er sich im Falle seines beruflichen Scheiterns als Versager fühlt, der seine Familie enttäuscht und seinen fürsorglichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann und sich infolgedessen durch Suizid seiner Verantwortung, der er nicht mehr gerecht werden kann, entziehen möchte. Auch Studenten, die in ihrem Studium Schwierigkeiten haben oder scheitern, sind nachweislich besonders suizidgefährdet. Dies liegt in erster Linie wohl daran, dass viele der betreffenden Studenten die mit dem Scheitern verbundene Enttäuschung nicht überwinden können und sich gleichzeitig nicht mit einer ihrer Meinung nach minderwertigen bzw. minderqualifizierten beruflichen Tätigkeit abfinden wollen. Auch kommen viele nicht damit zurecht, dass all die Mühen und Anstrengungen ihres bisherigen beruflichen Aufstiegs in Schule und Studium nun plötzlich umsonst gewesen sein sollen. So sind viele Studenten, die sich in der beschriebenen schwierigen Situation befinden, extrem gefährdet, oftmals in einer Kurzschlussreaktion, ihrem Leben freiwillig ein Ende zu setzen. Ähnliche Überlegungen gelten auch für Personen, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden. Auch hier zieht es der Suizidant vor, sich den sozialen Abstieg zu ersparen. Jemand, der vielleicht hohe Schulden gemacht hat und nicht mehr in der Lage ist, diese zurückzuzahlen, kann leicht von der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, die seine Situation bedingen, überwältigt und überfordert werden und im Suizid den einzigen noch möglich erscheinenden Ausweg sehen.
Kielholz führt als weiteren Risikofaktor das Fehlen eines Aufgabenbereiches und Lebenszieles an (vgl. a.a.O.). Hier denke ich zunächst an die Lebenssituation alter und behinderter sowie psychisch kranker, erwerbsunfähiger Menschen. Alte Menschen, die aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, fällt es oft nicht leicht, sich an ein Leben ohne Beschäftigung zu gewöhnen, zumal, wenn der Ehepartner gestorben ist. Sie wissen nichts mit der neu gewonnenen Fülle an Zeit anzufangen, haben oft das Gefühl, wertlos zu sein und nicht gebraucht zu werden. Ich werde im Kapitel über die Risikogruppen noch ausführlicher auf die Situation alter Menschen eingehen. Ähnlich stellt sich die Lebenssituation behinderter und psychisch kranker Menschen dar, die krankheitsbedingt keiner Beschäftigung mehr nachgehen können. Behinderte Menschen finden oft keinen Arbeitsplatz, in den heilpädagogischen Einrichtungen lässt das Beschäftigungsangebot oft zu wünschen übrig, sodaß auch hier ähnlich wie bei alten Menschen die Eintönigkeit und Tristesse den Alltag dominiert. Auch die Lebenssituation psychisch kranker Menschen, die Erwerbsun-fähigkeitsrente beziehen, ist häufig gekennzeichnet durch Langeweile und eine fehlende Lebensaufgabe, die ihren Alltag zeitweise nahezu unerträglich machen. Durch die fehlende berufliche Tätigkeit gehen auch wichtige soziale Kontakte verloren, die Betreffenden werden vor die schwierige Frage gestellt, welchen Sinn ihr Dasein eigentlich noch haben soll. Laut Dörner/Plog haben all diese beschriebenen Bedingungen „als Gemeinsames die Sinnentleerung der Beziehung zu sich, zu anderen und zur eigenen Tätigkeit, sowie die Vereinsamung“ (Dörner/Plog, 2002, S. 334). Unter diesen Bedingungen sind die Betreffenden daher besonders gefährdet, depressiv oder eben sogar suizidal zu werden.
Als letzten Risikofaktor weist Kielholz schließlich noch auf das Fehlen oder Verlust tragfähiger religiöser Bindungen hin (Kielholz, 1974, In: Sonneck, 1995, S. 157). Ein starker Glaube gibt gerade in schwierigen Zeiten Rückhalt und Hoffnung, Lebenssinn und fördert durch aktive Beteiligung am Gemeindeleben sogar soziale Kontakte. Demnach neigt jemand, den diese religiösen Bindungen fehlen oder abhanden gekommen sind, in schwierigen Lebenssituationen eher dazu, aufzugeben, vielleicht sogar an den widrigen umständen zu verzweifeln und suizidal zu werden.
Giernalczyk fügt ergänzend als weitere psychosoziale Risikofaktoren noch politische, religiöse und rassistische Verfolgung an sowie Flüchtlingsstatus. Diese Risikofaktoren belegen, dass Ausgrenzung in engem Zusammenhang mit Suizid steht. (vgl. Giernalczyk, 2003, S. 77). Ich denke, dass Menschen, die aus welchen Gründen auch immer verfolgt werden, in ihrer persönlichen Freiheit dermaßen eingeschränkt sind und unter einem solchen Druck seitens der Verfolger leiden, dass ihnen der Tod oft als einziger noch verbliebener Ausweg erscheinen muß, und sie deshalb den Tod in Form des Suizides in Kauf nehmen, nur um dieses belastende Leben nicht mehr weiterführen zu müssen. Sie ziehen es vor, freiwillig aus dem Leben, das keine Lebensqualität mehr hat, zu scheiden. Giernalczyk betont des weiteren, dass auch Menschen mit einer allgemeinen schlechten gesundheitlichen Verfassung ein erhöhtes Suizidrisiko aufweisen; denn wenn das Leben seine Lebensqualität verloren hat, und der Leidensdruck krankheitsbedingt immer mehr an Intensität zunimmt und keine Hoffnung auf Besserung der gesundheitlichen Verfassung mehr besteht, sind für viele Betroffene Suizidgedanken sehr nahe liegend bzw. drängen sich geradezu auf. Wolfersdorf und Purucker gehen noch genauer auf diesen Aspekt ein: „Menschen mit schmerzhaften, lebenseinschränkenden körperlichen Erkrankungen weisen ebenfalls ein erhöhtes suizidales Risiko auf, dabei insbesondere im Zusammenhang mit der Diagnosestellung Tumorerkrankung oder erneutes Tumorrezidiv bei onkologischen Patienten; in Endzuständen eines Tumorleidens kann das Auftreten von Schmerzen ebenfalls suizidfördernd wirken“ (Wolfersdof & Purucker, in: Giernalczyk, 2003, S. 165). Außerdem heben die Autoren hervor, dass Menschen in traumatischen und Veränderungskrisen, die häufig Belastungs- oder Anpassungsreaktionen zeigen, ein erhöhtes Suizidrisiko aufweisen. Inhaltlich geht es diesen Betroffenen dabei häufig um Beziehungsprobleme, Kränkung, Verlust, Trennung und Trennungsdrohung, aber auch um Selbstwert- und Identitätskrisen (vgl. a.a.O.).
Verlusterlebnisse
Wie bereits angedeutet, können Verlusterlebnisse, also der kurz zurückliegende Tod des Partners oder eines anderen nahe stehenden Menschen die Suizidgefährdung eines betroffenen Menschen erheblich erhöhen. Daher möchte ich an dieser Stelle noch der Frage nachgehen, welche Bedeutung Verlusterlebnisse wie Tod, Suizid oder Trennung eines nahe stehenden Menschen für die Zurückgebliebenen haben können und wie sie von ihnen verarbeitet werden. Verluste sind laut Pohlmeier keine notwendigen Vorbedingungen für eine Suizidhandlung, aber sie lassen Todes-wünsche und Todesgedanken auftauchen. Suizid kann eine von mehreren Problem-löseversuchen bei Verlusten sein. Im Hinblick auf die Suizidverhütung ist es deshalb notwendig, sich mit der Dynamik von Verlusten auseinanderzusetzen, nicht zuletzt deshalb, weil es immerhin gefährliche Situationen sind (vgl. Pohlmeier, 1983, S. 113).
Wie mehrere Untersuchungen gezeigt haben, können Verlusterlebnisse gravierende psychische und körperliche Auswirkungen nach sich ziehen. So zeigte die sogenannte Krankenblatt-Studie, bei der die Kranken zweier psychiatrischer Abteilungen untersucht worden sind, „dass bei 30 der 94 Patienten mit Verlust die psychische Erkrankung sechs Monate nach dem Tod der Bezugsperson aufgetreten war, was der Wahrscheinlichkeit nach nur in fünf Fällen zu erwarten gewesen wäre. Weiter zeigte sich, dass bei 28% der verwitweten psychiatrischen Patienten die Diagnose reaktive oder neurotische Depression gestellt wurde, bei den Verheirateten aber nur bei 15%. Die Studie zeigte schließlich, dass bei vielen die seelische Erkrankung in der Unfähigkeit zur Überwindung des Verlustes bestand“ (Pohlmeier, 1983, S. 109). Weitere Studien ergaben, dass Verwitwete besonders anfällig sind für Depressionen, emotionale Störungen, Unruhe, Schlaflosigkeit, Unsicherheit und verstärkt auf Betäubungsmittel, Alkohol und Nikotin zurückgreifen im deutlichen Unterschied zum Zustand vor dem Verlust und im Unterschied zu verheirateten Kontrollpersonen. Einige Studien ergaben auch, dass körperliche Beschwerden wie etwa Kopfschmerzen ebenfalls zugenommen haben. Außerdem benötigten die Verwitweten viermal mehr als die Verheirateten einen Krankenhausaufenthalt innnerhalb von 14 Monaten nach dem Tod des Partners oder ließen sich von Pfarrern, Psychiatern oder Sozialarbeitern beraten (vgl. a.a.O.). Eine weitere Untersuchung an verwitweten Männern ergab beispielsweise, dass die Sterblich-keitsrate während der ersten sechs Monate nach Verlust der Frau um 40% höher lag als bei verheirateten Männern der gleichen Altersgruppe; die Frequenz von Herzinfarkt lag bei den Verwitweten mit 67% noch höher (vgl. a.a.O., S. 110).
Die hier dargestellten Untersuchungsergebnisse verdeutlichen, welchen gravierenden Einfluß Verlusterlebnisse auf den Gesundheitszustand, das seelische Befinden, auf Krankheitsauslösung und sogar vorzeitigen Tod haben können. Es ist dabei nahe liegend, dass ein gewisser Anteil der Betroffenen nach Verlust oder Trennung des Lebenspartners nicht nur mit Depression, sondern sogar mit Suizid reagieren. Auf die Studie von Cheng et al. (2000) habe ich bereits hingewiesen, nach der Suizidopfer signifikant häufiger als Kontrollpersonen innerhalb der letzten zwölf Monate vor ihrem Suizid eine nahe stehende Person verloren haben (vgl. Cheng et al., 2000, in: Schneider, 2003, S. 118). Nach der Untersuchung von Foster et al. (1999) war das Zerbrechen einer Beziehung in den letzten vier Wochen das entscheidende Lebensereignis, das mit einem signifikant erhöhten Suizidrisiko einherging (vgl. Foster et al., 1999, in: Schneider, 2003, S. 118).
Die Verarbeitung von Verlusten erfolgt nach Parks in mehreren aufeinanderfolgenden Stadien. Die erste Phase unmittelbar nach Verlust des Ehepartners wird von Parks als „Alarm“ bezeichnet, womit die unspezifischen Körperreaktionen der Unruhe gemeint sind, die einem allgemeinen Erregungszustand als Reaktion auf Streß folgen. Die Verwitweten erleben den Verlust als Gefahr, weil sie in ihrer Lebenswelt zunächst keine Sicherheit und Geborgenheit mehr finden. Sie vermissen den Gesprächspartner, den Intimpartner, es fehlt der Ernährer, womit nur einige bedeutsame Bereiche genannt sind. Es folgt eine alarmierende Erregung, die sich in ständiger Ruhelosigkeit, in der Irritation des vegetativen Nervensystems, in Störungen der Körperfunktionen, wie Appetit, Schlaf, Herztätigkeit, Atmung und in starken Affekten wie Angst und Wut äußert. Mit dem Begriff „Alarm“ wollte der Untersucher Parks betonen, was unter spezifisch-menschlichem Streß zu verstehen ist. Er untersuchte Situationen, in denen die Betreffenden nicht auf gewohnte Erfahrungen und Handlungsmuster zurückgreifen konnten, sondern neue Lösungen suchen mussten. Solche Situationen, in denen sich auch die untersuchten Witwen befanden, werden oft als Herausforderung und Gefahr empfunden. Die Reaktionen darauf sind oft unspezifische Spannungszustände sowie Zweifel, ob sie schnell die neue Situation akzeptieren oder an der alten festhalten sollen. An dieser Stelle tritt oft eine Unentschlossenheit auf zwischen Annäherung und Rückzug, die lange eine Entscheidung hinauszögern kann. Diese Unentschlossenheit hängt wiederum von der Dauer und Intensität der Krise ab, in der sich die Betreffenden gerade befinden, sowie der persönlichen Belastbarkeit (Caplan, 1964, in: Pohlmeier, 1983, S. 111). Parks hat bei seinen Untersuchungen an Witwen im Stadium „Alarm“ genau auch diesen Zweifel gefunden. Er ist die Voraussetzung für die nächste Stufe der Verlustverarbeitung, die „Suche“ genannt wird. Sie tritt wenig später nach Verlust und „Alarm“ auf und ist gekennzeichnet durch „Anfälle von Gram“ (vgl. Pohlmeier, 1983, S. 111). Das bedeutet, dass immer wieder Erinnerungen an den toten aufsteigen, durch die der Hinterbliebene den Toten herbeiholen möchte und gleichzeitig jegliches Interesse an anderen Menschen unmöglich machen. Die Hinterbliebenen werden fast vollständig von der Beschäftigung mit dem Toten beherrscht und erwecken ihn mittels Sinnestäuschungen sogar wieder zum Leben. Viele schaffen es in dieser Phase nicht, den Tod des anderen zu realisieren und phantasierten sich immer wieder mit dem Verstorbenen zusammen. Manche zogen eben auch den eigenen Suizid in Erwägung, um sich auf diese Weise wieder mit dem toten zu vereinigen. In dieser Phase leiden die untersuchten Witwen ungeheuer, weil sich der Tod des anderen nun einmal nicht revidieren lässt. Das nächste Stadium wird als „Milderung“ bezeichnet, weil hier eine wirkliche Nähe zu den Toten entstehen kann, was durch die psychoanalytische Verinnerlichung verlorener Objekte ermöglicht wird. Die Hinterbliebenen beschäftigen sich im Traum intensiv mit dem Toten, wobei diese träumende Verlustarbeit zu einer Linderung der seelischen und psychischen Schmerzen führt. Manche Betroffene erreichen eine allerdings nur scheinbare Milderung auch dadurch, dass sie gewisse Abwehrmechanismen wie Verleugnung des Todes, Abgrenzung des Gefühls von Gedanken oder Hineinstürzen in Arbeit anwenden, um abzulenken oder sich zu betäuben. Durch diese vorüber-gehenden Abwehrstrategien soll Zeit gewonnen werden, bis man in der Lage ist, sich mit der veränderten Wirklichkeit auseinanderzusetzen. Das folgende Stadium der Verlustverarbeitung wird von Parks als der Wechsel zwischen „Zorn und Schuld“ bezeichnet und umfasst den Zeitraum des ersten Jahres nach dem Verlust. Der Zorn richtet sich gegen die Realität des Todes, die man nicht wahrhaben will, er kann sich aber auch leicht gegen die eigene Person richten. Dieser Zorn wechselt sich ab mit einem depressiven Rückzugsverhalten, bei dem Schuldgefühle wegen der gezeigten Aggressivität oder früher verweigerter Liebe dem toten Partner gegenüber im Vordergrund stehen. Diese depressiven Phasen sind oftmals sogar ärztlich behand-lungsbedürftig und kommen häufiger vor als die Zornesausbrüche. Grund für die Ambivalenz von Aggression und Depression, von Annäherung oder Rückzug ist oft eine frühere ambivalente Beziehung dem Verstorbenen gegenüber. Im Endstadium der Verlustarbeit versucht der Hinterbliebene, wieder er selbst zu sein und sein Leben neu zu ordnen (vgl. Pohlmeier, 1983, S. 112). Der Tote lebt in dem Betref-fenden in Form einer verinnerlichten Existenz weiter; er wird nicht vergessen. Der Hinterbliebene hat sich inzwischen von früheren Identifikationen mit dem verlorenen Geliebten losgesagt und sich eine neue, eigene Identität angeeignet. Er hat gelernt, den Tod zu akzeptieren und ist nicht mehr darauf angewiesen, auf Identifikationen mit dem anderen zurückzugreifen; er weiß nun, dass sein Leben auch ohne den Toten weitergeht.
Ich habe die Untersuchungen zur Bedeutung und der Verarbeitung von Verlusterlebnissen hier deshalb ausführlicher dargestellt, weil „Verluste kritische Situationen sind, die verschiedene Problemlösungsversuche ermöglichen, eben auch den des Suizides oder Suizidversuchs“ (a.a.O.). Zudem bleibt bei Verlustsituationen eine gewisse Gefährlichkeit bestehen, weil sie nicht so schnell zu überwinden sind. Oft wird Trauerarbeit auch nicht abgeschlossen, sodaß die Betroffenen mit einer Reihe psychiatrischer Symptome, darunter eben auch zunehmend Suizidgedanken, einer psychiatrischen Behandlung bedürfen. „Dabei ist vor allem wichtig, nicht zu generalisieren, sondern von Fall zu Fall daran zu denken, dass hier eine Suizidgefahr gegeben sein kann, aber nicht vorhanden sein muß“ (a.a.O.).
3.2 Risikogruppen
Suizidideen, Wünsche nach einer Pause, einer Unterbrechung in einem belastenden Leben, nach Ruhe sind in der Bevölkerung weit verbreitet und treten, zumindest zeitweise, bei vielen Menschen im Laufe ihres Lebens auf. Allerdings sind die Kriterien, nach denen aus Suizidideen Suizidabsichten werden, größtenteils unbekannt. Gleiches gilt für Faktoren, die aus Suizidideen suizidales Handeln entstehen lassen. Dennoch ist es weitgehend unbestritten, dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein deutlich erhöhtes Suizidrisiko aufweisen. Personengruppen werden nach Haenel und Pöldinger als Hochrisikogruppen bezeichnet, wenn die Suizidrate (bezogen auf 100.000 dieser Population pro Zeiteinheit) zwischen 100 und 10.000 liegt (vgl. Haenel und Pöldinger, 1986, in: Wolfersdorf, Wedler, Welz, 1992, S. 29). Anhand dieses Kriteriums sowie der klinisch-psychiatrischen Erfahrung können eine Reihe von Populationen benannt werden, bei denen eine erhöhte suizidale Gefährdung besteht. Dies gilt auch unabhängig davon, ob die Individuen im Einzelfall offensichtlich suizidgefährdet sind. Von den heute bekannten Risikogruppen können drei Gruppen unterschieden werden:
1. Menschen mit offensichtlicher Suizidalität
2. Menschen mit psychischen Erkrankungen im engeren Sinne und
3. Menschen in Krisen, die auch mit Suizidalität einhergehen können (vgl. Wolfersdorf, Wedler, Welz, 1992, S. 29).
Es liegt auf der Hand, dass Menschen mit offensichtlicher Suizidalität, die bereits direkte oder indirekte Suizidankündigungen gemacht haben, grundsätzlich ein erhöhtes suizidales Risiko aufweisen. Zu dieser Kategorie zählen auch Personen, die bereits einen Suizidversuch unternommen haben, vor allem, wenn dieser in der unmittelbaren Vorgeschichte stattgefunden hat, „wenn bei mehreren Versuchen ein Methodenwechsel stattgefunden hat, die Methodik in Richtung zunehmender Härte und abnehmender Rettungswahrscheinlichkeit verändert wird“ (a.a.O.).
Werden Suizidankündigungen gemacht, so bedeuten diese meist, daß Suizidalität mit erhöhtem Handlungsdruck vorliegt, bei der in verstärktem Maße Hilfe bzw. Handlungsbereitschaft von therapeutisch-helfender Seite notwendig ist. Ich muß darauf hinweisen, dass gerade hier das Sprichwort, dass bellende Hunde nicht beißen, nicht gilt. Das Verdienst Pöldingers ist, dass er die Entwicklung suizidalen Verhaltens, auf die ich später noch genauer eingehen werde, in drei Stadien eingeteilt hat, nämlich Erwägung, Abwägung (Ambivalenz) und Entschluß. So kann die Suizidankündigung dem Stadium der Ambivalenz zugeordnet werden, wobei diese als ein Hin- und Herschwanken zwischen zwei gegensätzlichen Tendenzen, nämlich tot sein und leben zu wollen, interpretiert werden. Farberow und Shneidman haben diese Suizidankündigungen als „cry for help“ bezeichnet.
Zum Suizidversuch ist ergänzend zu sagen, dass mit beträchtlicher Wahrscheinlichkeit weiterhin suizidales Verhalten in der Zukunft folgen wird bzw. dass bei zwei Drittel der psychisch kranken, die später durch Suizid verstarben, ein Suizidversuch vorgelegen hat (vgl. Wolfersdorf, 1989, in: Wolfersdorf, Wedler, Welz, 1992, S. 30). Dabei ist das Vorliegen eines Suizidversuches in der Vorgeschichte noch kein hinreichender Grund, um den Betroffenen gegen seinen Willen nach dem Unterbringungsgesetz in eine psychiatrische Klinik einzuweisen. Dazu muß akute Suizidalität, d.h. in Form eines jetzt angekündigten Suizidversuches, jetziger konkreter Suizidabsichten bei gleichzeitigem hohem Handlungsdruck vorhanden sein. Allerdings muß der Suizidversuch in der Vorgeschichte in der Beurteilung aktueller Suizidalität mit berücksichtigt werden, da der Betroffene bereits ein- oder mehrmals auf diese vermeintliche Problemlösestrategie zurückgegriffen hat und damit gefährdeter ist, dies in zukünftigen Krisen wieder zu tun.
Desweiteren gehören zur Risikogruppe der Personen mit offensichtlicher Suizidalität alte oder chronisch körperlich kranke Menschen, bei denen in den letzten Jahren sogenanntes heimliches suizidales Verhalten bzw. „stille Suizidalität“ beobachtet worden ist. Darunter versteht man auch das Unterlassen medizinischer Hilfsmöglichkeiten, von Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme bis zur bewussten, gefährlichen Störung einer Stoffwechsellage z.B. durch eiweißreiche Nahrung bei einem dialysepflichtigen niereninsuffizienten Patienten (vgl. Wolfersdorf, Wedler, Welz, 1992, S. 30).
Bei chronisch suizidalen Klienten besteht die Gefahr, dass sie sich mit zunehmender zahl von Suizidversuchen immer weiter der letztendlich tödlich verlaufenden Selbstschädigung nähern. Das Problem besteht darin, dass sie Suizidversuche wiederholt als Konfliktlösungsstrategie in letztlich ungelösten Lebensentwicklungen einsetzen, die teilweise manipulativ-instrumentellen Charakter angenommen haben, um auf diese Weise Personen oder Umweltsituationen zu beeinflussen. Oftmals leiden diese Menschen an neurotischen und/oder Persönlichkeitsstörungen, die verhindern, andere Möglichkeiten der Konfliktlösung zu finden.
Die zweite Kategorie der Risikogruppen ist die der psychisch Kranken. Ich werde an dieser Stelle kurz auf die depressiven und suchtkranken Menschen eingehen, wobei ich diese hier nur streifen werde, da ich im Kapitel sieben noch genauer und ausführlicher die besonderen Entstehungsbedingungen von Suizidalität bei psychisch Kranken behandeln werde.
Der Anteil der depressiv Kranken an Suiziden in der Allgemeinbevölkerung liegt im wesentlichen bei 40-60%, während bei Menschen nach Suizidversuchen die zahl der Depressionen niedriger liegt. Grund dafür ist möglicherweise der kathartische Effekt bzw. sind die vielfach positiven ersten Reaktionen der Umwelt nach einem Suizidversuch (vgl. Wolfersdorf et al., 1991, in: Wolfersdorf, Wedler, Welz, 1992, S. 31). Depressionen stellen bezüglich der Suizidmortalität die tödlichste psychische Erkrankung dar, infolge derer auch heute noch bis zu 15% der schwer depressiv Kranken durch Suizid sterben. Dabei kann ein depressives Zustandsbild auch unabhängig von affektiven Störungen vorkommen, z.B. im Zusammenhang mit körperlichen Erkrankungen, wobei für diese Erekrankungen ebenfalls ein erhöhtes Suizidrisiko besteht. Sowohl den affektiven wie auch nicht-affektiven depressiven Zustandsbildern sind charakteristische Symptome gemeinsam, wie z.B. Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Antizipation von Bedrohung, Schuldgefühle, Wertlosigkeitsgefühle, qualvolle Lebenseinschränkung und chronische Schmerzen, sowie Abhängigkeit und Angewiesensein auf andere.
Bei der zweitgrößten Gruppe, den Suchtkranken, handelt es sich neben der Randgruppe der Drogensuizide vor allem um Alkoholkranke. Ihr Anteil an Suiziden in der Allgemeinbevölkerung beträgt ca. 20 bis 30%, bei den Suizidversuchen liegt ihr Anteil etwa in gleicher Höhe. Bei alkoholkranken Menschen, wie auch bei Schizophrenen mit Suizid wiesen ca. 60% ein ausgeprägtes depressives Zustandsbild auf, die sogenannte sekundäre Depressivität.
Außerdem umfasst die Hochrisikogruppe für Suizid Menschen, die sich in stationärer psychiatrischer Behandlung befinden, wobei die Suizidraten hier im Bereich von 150 bis 250 auf 100.000 stationär aufgenommenen Klienten liegt (vgl. Wolfersdorf, 1991, in: Wolfersdorf, Wedler, Welz, 1992, S. 31)
Als dritte Gruppe von Menschen, für die ein erhöhtes suizidales Risiko besteht, sind solche in Krisen zu nennen, für die grundsätzlich auch Suizidalität bezeichnend sein kann. Ich möchte das Phänomen der Krise an dieser Stelle nur am Rande streifen, weil ich im zweiten Teil meiner Diplomarbeit darauf noch ausführlicher eingehen werde. Der Begriff der Krise umfasst Situationen, die von dem Betroffenen nicht oder nicht mehr sinnvoll bewältigt werden können, da die notwendigen Bewältigungsstrategien nicht oder nicht mehr zur Verfügung stehen. Für solche Situationen besteht damit u.a. auch die Gefahr suizidaler Reaktionen. Ich muß darauf hinweisen, dass aus jeder Krise auch bestimmte andere Aspekte entstehen können, wie z.B. psychosomatische Erkrankungen, die Entwicklung einer körperlichen oder psychischen Erkrankung, Suchtverhalten oder aber auch, bei gelungener Lösung und Reifung, eine Weiterentwicklung der Persönlichkeit (vgl. Wolfersdorf, Wedler, Welz, 1992, S. 31). Sonneck betont immer wieder, dass Suizidalität sowohl bei traumatischen als auch bei Veränderungskrisen entstehen kann, hier vor allem während des Schockes bzw. des Rückzuges, zum Zeitpunkt der Reaktion bzw. im Vollbild der Krise (vgl. Sonneck, 1982, in: Wolfersdorf, Wedler, Welz, 1992, S. 32). Ein Mensch in einer Krise benötigt in den allermeisten Fällen Hilfe von dritten Personen, wie Freunde, Bekannte, Partner, soziales Netz, semi- und professionelle Helfer, Begleitung, Behandlung im engeren Sinne, sowohl medizinisch-psychiatrische wie auch psychologische. Grund dafür sind zum einen die verminderte Verfügbarkeit von Ressourcen und zum anderen die Herausforderung, mit lebensverändernden und traumatischen Aspekten zurecht zu kommen. Am häufigsten haben mit Menschen in psychosozialen Krisen der niedergelassene Arzt, Einrichtungen wie Telefonseelsorge oder Beratungsstellen, Kriseninterventionseinrichtungen u.ä. zu tun, während Psychiater im ambulanten oder stationären Setting nur verhältnismäßig selten mit der suizidgefährdeten Klientel befasst sind. Dieses Klientel setzt sich vor allem aus jungen Erwachsenen und alten Menschen zusammen, oft mit der Suizidförderlichen Kombination von Depressivität, süchtiges Verhalten, somatische, psychische und soziale Faktoren. Die Problematik der jungen Menschen ist häufig gekennzeichnet durch Entwicklungs- und Beziehungsprobleme, manchmal mit Drogenproblematik, sowie mit Belastungen am Ausbildungs- und Arbeitsplatz.
Zusammenfassend lässt sich ein erhöhtes suizidales Risiko bei Menschen in krisenhaften Lebenssituationen aufgrund folgender Aspekte festhalten:
„1. Entwicklungsnotwendigkeiten:
Ablösung vom Elternhaus/Autonomie; biologische Entwicklungen (Menarche, Schwangerschaft, Klimakterium) und psychologische Reifungsprozesse; berufliche Veränderungsnotwendigkeiten u.ä.
2. schicksalhafter Lebensereignisse und Belastungen:
Verlust, Trennung, Tod von signifikanten Bezugspersonen; Verlust von Existenz, Lebenskonzept, Lebensraum durch äußere, nicht beeinflußbare Bedingungen; Verlust von religiöser, völkischer, kultureller Einbettung, Entwurzelung; drohende Vernichtung, Massenvernichtung
3. narzisstischer Krisen:
d.h. Störungen und Bedrohungen des Selbstwertgefühles (Sonderform der Krise) bei in ihrem Selbstwertgefühl kränkbaren Menschen
4. Bedrohung und Beeinträchtigung durch alters- und/oder krankheitsbedingte Veränderungen im körperlichen, im psychischen und sozialen Bereich
5. psychischer oder/und körperlicher Krankheit und deren Folgen“ (Wolfersdorf, 1992, in: Wolfersdorf, Wedler, Welz, 1992, S. 40).
Der Vollständigkeit halber sei noch auf die Einteilung der Risikogruppen nach der Weltgesundheitsbehörde (WHO) hingewiesen:
1. Depressive
2. Suchtkranke Menschen
3. Alte und vereinsamte Menschen
4. Personen mit Suizidankündigungen
5. Solche, die bereits einen Suizidversuch als Problemlösungsstrategie in ihrer Lebensgeschichte aufweisen.
Mit Ausnahme der Kategorie 3., also alte und vereinsamte Menschen, habe ich die restlichen Risikogruppen bereits kurz erläutert. Im folgenden möchte ich nun die Risikogruppe der alten Menschen und ihre psychosoziale Situation näher beleuchten.
Am Phänomen der Alterssuizide wird die Vielschichtigkeit der Suizidproblematik deutlich, die zwar primär durch körperliche Veränderungen verursacht sind, wo aber ebenso soziogene und psychogene Einflussfaktoren wirksam werden. Die körperlichen Veränderungen gehen mit zunehmendem Alter einher und bestimmen sowohl soziale Entwicklungen wie auch psychische Phänomene. Die körperliche Funktionsfähigkeit alter Menschen nimmt ab, die Krankheitshäufigkeit nimmt dagegen zu: so sind 80% aller allgemeinärztlichen Patienten über 55 Jahre alt, ihre zahl beträgt in Deutschland ca. 800.000 bis 960.000, wobei, typisch für das Alter, die Krankheitszeiten länger oder Krankheiten chronisch werden (vgl. Glaeske, 1992, S. 6, in : Seyfried, 1995, S. 24). Die gesellschaftliche Stellung alter Menschen ändert sich dahingehend, als ältere Menschen nicht mehr berufstätig sind, was dazu führt, dass soziale Kontakte abnehmen und Minderwertigkeitsgefühle aufkommen können, wenn nämlich Selbstwert durch Leistung definiert wird. Darüberhinaus können viele alte Menschen dem rapiden gesellschaftlichen Wandel nicht mehr folgen, infolgedessen überlieferte Werte in Frage gestellt und ehemals gültige normen erschüttert werden. Traditionelle, beständige Werte sind hinfällig geworden und die heutige Zeit ist für eine große Zahl alter Menschen zu schnelllebig, so dass sie kaum noch an gesellschaftlichen Veränderungen teilnehmen können; dies wiederum führt zu gesellschaftlicher Desintegration. Alte Menschen werden aber auch zunehmend in ihrem Familien- und Freundeskreis isoliert, da es immer weniger generationenübergreifende Familien gibt, in denen Großeltern und Enkelkinder unter einem Dach wohnen; dies ist nicht zuletzt auf eine gewinnorientierte Wohnungsbaupolitik zurückzuführen. Im Stadtbild findet man zunehmend Wohngegenden, die fast ausschließlich von alten Menschen bewohnt sind, und auch ein Leben im Altenwohnheim, das zunehmend zur Regel wird, lässt nur noch sporadische Kontakte zu den Kindern und Enkelkindern zu. So lassen sich psychische Krisen kaum vermeiden, vor allem dann, wenn zwischenmenschliche Kontakte durch den Tod von Freunden, Verwandten und Bekannten wegfallen. Stirbt schließlich der Lebenspartner, so wird dem alten Menschen nicht nur die eigene Sterblichkeit bewusst, sondern kann zur traumatischen Situation des Alters schlechthin führen. Dies wird auch durch die Tatsache untermauert, dass das Suizidrisiko in den ersten vier Jahren nach dem Tod des Partners besonders hoch ist und die Suizide gehäuft auf dessen Todestag fallen (vgl. Phillips, 1981, S. 111, in: Seyfried, 1995, S. 24). Bei den 51- bis 55jährigen läßt sich eine erste ausgeprägte Häufung von Suiziden feststellen, die als “Klimakteriumsgipfel” bezeichnet wird und auf biologische bzw. somatogene Ursachen zurückzuführen sind. Bei den über 70jährigen wurde ein sogenannter „Altersgipfel“ gefunden (vgl. Dotzauer/Goebels/Legewie, 1965, S. 115 f., in: Seyfried, 1995, S. 24). Die bundesdeutsche Suizidziffer beträgt für die 75- bis 80jährigen 1988 38, für die 90- bis 95jährigen 44 (vgl. Heuft, 1991, S. 235, in: Seyfried, 1995, S. 24). Mit zunehmendem Alter nehmen Härte und Zuverlässigkeit der Suizidmethoden zu, ebenso die Wahrscheinlichkeit eines vollendeten Suizids. Bei den über 65jährigen liegt die Zahl der Suizide inzwischen gleich auf mit der der Suizidversuche der jüngeren Menschen (vgl. Fischer/Neher, 1991, S. 150, in: Seyfried, 1995, S. 25).
„Besonders Hochbetagte erleben das Alter als Last, die zunehmenden Verluste machen einsam, sie erleben sich als überflüssig und als Belastung der Angehörigen, ihrer Umgebung allgemein. Es kann Lebensüberdruß entstehen...“ (Fischer/Neher, 1991, S. 149, in: Seyfried, 1995, S. 25), „Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung stellen sich ein, das Leben wird zur `Krankheit zum Tode.“ (Kierkegaard, 1985, in: Seyfried, 1995, S. 25)
Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, weisen über die Betrachtungsweisen von Soziologie und somatischer Medizin hinaus und hin auf das Gebiet der Psychologie. „Der Alterungsprozeß verändert nicht nur den Körper des Menschen und seine Stellung in der Gesellschaft, sondern auch seine Psyche“ (Seyfried, 1995, S. 25).
Im folgenden stelle ich eine Übersicht der Risikogruppen dar, ohne diese jedoch näher zu erläutern, weil dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
1. Menschen mit psychischen Erkrankungen:
- Depressive (primäre Depression, depressive Zustände, reaktive Depression)
- Suchtkranke (Alkoholkrankheit, illegale Drogen)
- Schizophrenie (in stationärer Behandlung, Rehabilitation)
- Angststörungen
- Persönlichkeitsstörungen (insbesondere vom emotional instabilen Typus)
2. Menschen mit bereits vorliegender Suizidalität:
- Suizidankündigungen (Appell in der Ambivalenz); suizidale Krise
- nach Suizidversuch (10% Rezidiv mit Suizid)
3. Alte Menschen:
- mit Vereinsamung, mit schmerzhaften, chronisch einschränkenden Krankheiten, nach Tod des Partners
- mit psychischer und körperlicher Erkrankung (Komorbidität)
4. Jugendliche bzw. junge Erwachsene:
- mit familiären Problemen, Ausbildungsproblemen
- mit Entwicklungskrisen, Beziehungskrisen (innere Vereinsamung)
- mit Drogenproblemen
5. Menschen in traumatisierten Situationen und Veränderungskrisen:
-Beziehungskrisen, Partnerverlust, Kränkungen
-Verlust des sozialen, kulturellen, politischen Lebensraumes
-Identitätskrisen
-chronische Arbeitslosigkeit
-Kriminalität, z.B. Verkehrsdelikt (z.B. mit Verletzung, Tötung eines anderen)
6. Menschen
- mit schmerzhaften, chronischen, lebenseinschränkenden, verstümmelnden, körperlichen Erkrankungen, insbesondere des Bewegungs- und zentralnervösen Systems
- in Krankheitszuständen mit extremer Pflegebedürftigkeit
Die Übersicht ist Giernalczyk, 1997, S. 166, entnommen.
[...]
- Arbeit zitieren
- Thomas Berger (Autor:in), 2006, Suizidalität - Erklärungsansätze und therapeutischer Umgang mit suizidalen Klienten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116852
Kostenlos Autor werden


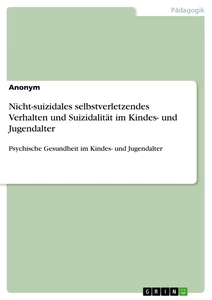


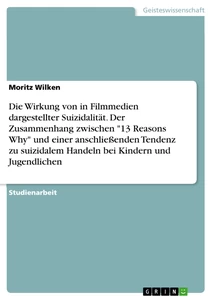



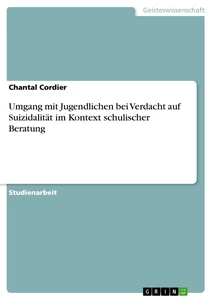












Kommentare