Leseprobe
Inhalt
1. Einleitung
2. Die Kritik Gustav Heinemanns an Konrad Adenauers Deutschlandpolitik
2.1 Die Kontroverse um Wiederbewaffnung, Westbindung und Deutsche Einheit
2.2 Gustav Heinemann: Biographisches I (1899-1950)
2.3 Gustav Heinemanns Deutschlandkonzeption
2.4 Gustav Heinemann: Biographisches II (1950-1976)
2.5 Wiederbewaffnung, Westbindung und Deutsche Einheit: Die Kontroverse aus historischer Perspektive
3. Fazit
4. Literatur
4.1 Reden und Aufsätze
4.2 Monographien und Gesamtdarstellungen
1. Einleitung
„Und doch ist es nicht leicht, dem Menschen und Politiker Gustav Heinemann gerecht zu werden. Seine christliche Überzeugung, sein demokratisches Grundverständnis, seine Lebenspraxis, seine Berufserfahrung, und vor allem sein konsequentes Eintreten für seine Überzeugungen, für das sein Rücktritt als Innenminister des ersten Kabinetts Adenauer ein bezeichnendes, aber keineswegs einmaliges Beispiel ist, lassen das Bild einer komplexen Persönlichkeit erkennen. Nur so läßt sich erklären, daß Gustav Heinemann einerseits den ‚Ernstfall Frieden’ zum Ausgangspunkt seines politischen Handelns machte und von der Bundeswehr verlangte, sich selbst in Frage zu stellen, andererseits aber ebenso nachdrücklich die Bereitschaft einforderte, die demokratische Gesellschaft gegen alle Angriffe von innen und außen zu verteidigen ...“
(Johannes Rau, 1993)
Das Zitat stammt aus einem Vorwort, das der NRW-Ministerpräsident für die von Uwe Schütz verfaßte Dissertation „Gustav Heinemann und das Problem des Friedens im Nachkriegsdeutschland“ schrieb. Der Sozialdemokrat Rau wurde durch die Bundesversammlung am 23. Mai 1999 – dem 50. Jubiläum des Grundgesetzes – im Berliner Reichstag zum 8. Präsidenten der bundesrepublikanischen Geschichte gewählt und steht nicht allein deshalb in der Tradition des „Bürgerpräsidenten“ Gustav Heinemann, der dieses Amt als erster SPD-Politiker bekleidete. Für Johannes Rau war Heinemann väterlicher Freund und politisches Vorbild, an dessen Seite die politische Karriere des jungen Wuppertalers in der ersten Hälfte der 50er Jahre ihren Anfang nahm; damals in der von Heinemann gegründeten Gesamtdeutschen Volkspartei (GVP), die ein Sammelbecken für Oppositionelle gegen die Deutschlandpolitik von Kanzler Adenauer sein wollte.[1]
Die vorliegende Bachelor-Arbeit[2] beschäftigt sich nicht in erster Linie mit Gustav Heinemann während seiner Amtszeit als Bundespräsident von 1969-1974, sondern mit Heinemann als einem der wichtigsten Gegenspieler Konrad Adenauers in der Debatte um Wiederbewaffnung, Westbindung und Deutsche Einheit, die zwischen 1949 und 1955, dem Zeitraum zwischen der Unterzeichnung des „Petersberger Abkommens“ und dem Beitritt der Bundesrepublik zum Nordatlantischen Verteidigungsbündnis, besonders kontrovers geführt wurde und erst 1961 mit dem Bau der Berliner Mauer, der die deutsche Teilung zum Status quo werden ließ, beendet sein sollte.[3]
Ziel soll es sein, die Deutschlandkonzeptionen Gustav Heinemanns und Konrad Adenauers gegenüberzustellen und einen Blick auf die sicherheitspolitischen Positionen der außerdem relevanten Parteien und die Haltung wichtiger gesellschaftlicher Gruppen zu werfen. Weiterhin soll aufgezeigt werden, wieso die westdeutsche Bevölkerung sich trotz ausgeprägter Skepsis zu Beginn der Kontroverse schließlich doch für die von Adenauer (und den Westmächten) propagierte Prioritäten-Reihenfolge „Freiheit-Frieden-Einheit“ entschied, statt das von Heinemann (und seiner Gesamtdeutschen Volkspartei) eingeforderte Primat der Wiedervereinigung als politisch vorrangiges Ziel zu betrachten. Heinemanns Rolle während der Wiederbewaffnungsdiskussion soll in die Gesamtbiographie des späteren Bundespräsidenten eingebettet werden.[4]
Grundlage der Arbeit sind in erster Linie die von Uwe Schütz verfaßte Biographie „Gustav Heinemann und das Problem des Friedens im Nachkriegsdeutschland“ (1993); Helmut Lindemanns Heinemann-Biographie „Ein Leben für die Demokratie“ (1978); die 1982 herausgegebene Studie „Die Bundesrepublik zwischen Westintegration und Stalin Noten“ von Peter März; Diether Kochs Aufsatz „Heinemanns Kritik an Adenauers Deutschlandpolitik“ (in: „Adenauer und die Deutsche Frage“, von 1988); Heinrich Albertz Beitrag „Das Spiel mit dem Zumutbaren – Gustav Heinemann und die deutsche Ostpolitik“, veröffentlicht 1974 in der Aufsatzsammlung „Anstoß und Ermutigung – Gustav W. Heinemann Bundespräsident 1969-1974“; sowie die Aufsätze von Christian Hacke, Rainer Zitelmann und Ingolf Doler in „Westbindung: Chancen und Risiken für Deutschland“ (1993).[5]
Darüber hinaus greift die Arbeit auf Standardwerke zur Nachkriegsgeschichte zurück, darunter die Studien von Adolf M. Birke („Nation ohne Haus – Deutschland 1945-61“), Christoph Kleßmann („Die doppelte Staatsgründung – Deutsche Geschichte 1945-1955“) und Helmut Kistlers „Die Bundesrepublik Deutschland – Vorgeschichte und Geschichte 1945-1983“. Bezüglich seiner „Deutschlandkonzeption“ bot es sich an, Aufsätze und Reden Heinemanns aus den Jahren 1950 bis 1954 heranzuziehen.[6]
2.1 Die Kontroverse um Wiederbewaffnung, Westbindung und Deutsche Einheit
„Wenn ich nach Dresden oder Rostock will, steige ich nicht in einen Zug nach Paris oder Rom ein. Wenn gegenwärtig kein Zug nach Berlin fährt, so muß ich halt warten. Es ist gar nichts gewonnen, wenn ich in entgegengesetzte Richtung abfahre, nur um zu fahren. Weder in Paris, noch in Rom oder Brüssel treffen wir Leute, die Wert darauf legen, uns nach Berlin zu bringen.“
(Gustav Heinemann am 21. November 1952 im Rahmen der ersten, in Düsseldorf abgehaltenen Kundgebung der „Notgemeinschaft für den Frieden in Europa“.)[7]
Als Anfang Mai 1955 der „Deutschlandvertrag“ und mit den „Pariser Verträgen“ die Mitgliedschaft der Bundesrepublik in der NATO sowie der WEU in Kraft traten, hatte Bundeskanzler Adenauer seine wichtigsten außenpolitischen Zielsetzungen realisiert: Die westdeutsche Republik hatte zehn Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches ihre politische Souveränität weitgehend wiedererlangt, war in der Gemeinschaft der westeuropäischen Demokratien integriert und konnte sich im Fall einer sowjetischen Aggression des Beistands der neuen Partner sicher sein. Die sicherheitspolitische Komponente ging einher mit der ökonomischen Integration Westeuropas: Mit den „Römischen Verträgen“ zwei Jahre später wurde ein kaum umkehrbarer Prozeß in Gang gesetzt.[8]
Die Ratifizierung der Verträge besiegelte gleichzeitig eine Diskussion, die spätestens mit dem Ausbruch des Korea-Krieges im Juni 1950 zu der beherrschenden innenpolitischen Debatte geworden war: Es ging um die Frage, ob die junge deutsche Demokratie angesichts eines möglichen Angriffs des kommunistischen Ostens (inklusive der DDR) einen Verteidigungsbeitrag im Rahmen einer europäischen Streitmacht leisten müsse.[9]
Wenngleich zwischen dem geteilten Korea (ohne Besatzungsmächte) und dem geteilten Deutschland (mit Besatzungsmächten) mehr Unterschiede als Ähnlichkeiten bestanden, reichte die Invasion durch Nordkorea fraglos aus, um in der Bundesrepublik und ganz Westeuropa Angst vor einem ähnlichen Szenario aufkommen zu lassen. Die Frage nach einer westdeutschen Wiederaufrüstung wurde in den USA und Westeuropa zusehends enttabuisiert. Korea wurde als Anschauungsunterricht dafür interpretiert, daß eine sowjetische Generaloffensive bevorstehe, die es notwendig mache, einen Wehrbeitrag der Bundesrepublik – wenige Jahre nach Zusammenbruch des Dritten Reiches – in Kauf zu nehmen, obwohl in England und Frankreich erhebliche Vorbehalte gegen eine deutsche Remilitarisierung bestanden, die von den Amerikanern nur mühsam abgebaut werden konnten.[10]
In der westdeutschen Öffentlichkeit kristallisierte sich ein Gegensatz heraus, der die Debatte um eine Wiederaufrüstung in der Folge bestimmen sollte:[11]
- Würde die Bundesrepublik als Teil eines militärisch und ökonomisch starken Westens auf das sozialistische Ostdeutschland wie ein Magnet wirken, der die verlorenen Gebiete früher oder später anziehen würde,
- oder würde die Westintegration dauerhaft die deutsche Wiedervereinigung ausschließen, weil die Sowjetunion unmöglich die ostdeutschen Gebiete in den Machtbereich der USA entlassen würde.
Adenauer, der die deutsche Teilung angesichts des sich zuspitzenden Ost-West-Gegensatzes sehr früh als ein – zumindest mittelfristiges – Faktum akzeptierte, entschied sich für die erste Variante. Den Antikommunisten trieb vor allem die Sorge um, daß die Sowjetunion durch militärischen Druck, kombiniert mit einer ideologischen Unterwanderung Einfluß in Westeuropa gewinnen könnte. Für ihn war die Westintegration das Gebot der Stunde, eine „Schaukelpolitik“, wie sie Stresemann als Außenminister der Weimarer Republik betrieben hatte, undenkbar, nicht zuletzt weil er so kurz nach der nationalsozialistischen Erfahrung an der politischen Reife der Deutschen erhebliche Zweifel hatte. Die Westintegration würde die noch orientierungslosen Westdeutschen nicht nur vor einer Aggression aus dem Osten schützen, sondern auch vor sich selbst, so seine Argumentation. Christian Hacke kommt daher zu dem Ergebnis, daß man Adenauers Ziel zu Recht „in der Reihenfolge und Trias Freiheit-Frieden-Einheit dargestellt“ habe.[12]
Unterstützung fand Adenauer von Beginn an mehrheitlich in der CDU/CSU (Bundestagswahl 1949: 31 %, 1953 dann 45,2 %) und seinen Koalitionspartnern FDP, DP sowie ab 1953 BHE. Daraus ist nicht abzuleiten, daß nicht auch im Regierungslager angesichts dieser existentiellen Grundfrage deutscher Politik unterschiedliche Strömungen vorhanden gewesen wären. Prominentestes Beispiel war Jacob Kaiser, Adenauers Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen von 1949-1957, für den eine aktive Wiedervereinigungspolitik zunächst Priorität hatte („Einheit in Frieden und Freiheit“). Ähnlich wie Kaiser vollzogen eine ganze Reihe von Koalitionspolitikern den Prioritätenwechsel („Freiheit-Frieden-Einheit“) nur widerwillig, um schließlich – in Anerkennung einer quälenden Realität – auf Adenauers Kurs einzuschwenken. Bis auf einige Ausnahmen (z.B. der FDP-Abgeordnete Karl Georg Pfleiderer, zunehmend auch Thomas Dehler) standen die Koalitionsparteien bei leicht unterschiedlichen Akzentuierungen (der FDP lag z.B. die im Bündnis gleichberechtigte Stellung einer demokratisierten deutschen Armee besonders am Herzen) jedoch letztlich geschlossen hinter Adenauer. Kritiker beugten sich der Fraktionsdisziplin.[13]
Besonders sicher konnte sich der Bundeskanzler der Unterstützung der Katholischen Kirche sein, während die Protestanten sich – nach langem innerkirchlichen Diskurs mit der pazifistischen Strömung um Martin Niemöller – nie zu einer uneingeschränkten Befürwortung der Remilitarisierung durchringen konnte, ohne sie jedoch offiziell explizit abzulehnen, da diese Frage nach Ansicht des Rates der EKD im Glauben unterschiedlich beantwortbar sei. Unterschiedlich definierten auch die einzelnen evangelischen Kirchen ihre Haltung: Im Februar 1952 erklärten die Kirchen Bayerns, Badens, Hannovers und Schleswig Holstein in einer Resolution („Wehrbeitrag und christliches Gewissen“), daß der Aufbau einer defensiv ausgerichteten Armee verantwortbar sei, während Lippe, Westfalen und Rheinland der Remilitarisierung weiterhin ablehnend gegenüber standen.[14]
Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften zeigten sich eher zurückhaltend gegenüber der Wiederaufrüstung. Insbesondere die Position der Gewerkschaften ist als wenig stringent zu bezeichnen: Während die DGB-Führung den Regierungskurs anfänglich stützte, da sie sich als Gegenleistung Adenauers Unterstützung bei Auseinandersetzungen mit den Arbeitgebern erhoffte, war die Basis von Beginn an mehrheitlich antimilitaristisch eingestellt, was nach Protestwellen gegen die Politik der DGB-Spitzen Ende 1952 zu einer Revision der Gewerkschaftspolitik führte. Ähnlich wie die SPD forderten die Arbeitnehmervertreter nun, zuerst alle Möglichkeiten zur Wiedererlangung der staatlichen Einheit auszuschöpfen. Auch die Wirtschaftsverbände legten eine differenzierte Haltung an den Tag und „gaben ihre Zurückhaltung erst Mitte der fünfziger Jahre auf, als der Aufbau der Bundeswehr beschlossene Sache war“, so Jacobsen.[15]
Die Soldatenverbände formulierten mehrheitlich ihre Zustimmung bei Erfüllung von Vorbedingungen, unter denen die gewichtigste eine gleichberechtigte Stellung gegenüber den Bündnispartnern war. Die Rolle des „Kanonenfutters“ wollte man unter keinen Umständen übernehmen.[16]
Weitgehend uneingeschränkte Unterstützung fand Adenauer also während der Wehrdebatte in seiner eigenen Regierungskoalition sowie in der Katholischen Kirche. Mehrheiten in der Bevölkerung mußte sich der Kanzler mühsam erarbeiten: „Faßt man das Ergebnis der Umfragen und Wahlen in den Jahren 1950 bis 1955 zusammen, läßt sich sagen, daß sich in diesem Zeitraum ein langsamer, aber stetiger Prozeß der Einstellungs- und Bewußtseinsveränderung innerhalb der westdeutschen Bevölkerung von einer überwiegenden Ablehnung einer Wiederbewaffnung zur Tolerierung und schließlich bis zur wachsenden Zustimmung zum Regierungskurs und damit zum Aufbau von Streitkräften vollzogen hat“, bilanziert Jacobsen. In seinen Augen hatten eher die wachsende Prosperität, der erweiterte Handlungsspielraum und die fehlenden überzeugenden Alternativen angesichts des Ost-West-Konfliktes Ausschlag gegeben als die vertiefte Einsicht in die Notwendigkeit einer Landesverteidigung.[17]
Die SPD verfolgte zwischen 1950 und 1955 keinen klaren Kurs: So lehnten die Sozialdemokraten die Remilitarisierung zunächst vehement ab, da Westdeutschland sich nach Ansicht von Kurt Schumacher, damals Vorsitzender und Führungsautorität, sich nicht zu weitgehend an die Westmächte binden sollte, solange diese der Bundesrepublik nicht die Wiedergewinnung der vollen Souveränität einräumten. Schumacher argumentierte jedoch nicht pazifistisch, sondern nationalistisch: Ein grundsätzlicher Gegner einer Wiederaufrüstung (und der Westbindung) war er nicht. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich eine ambivalente Haltung der SPD, die die in der Bevölkerung ausgeprägte „Ohne-mich“-Stimmung unterstützte (teilweise bei Landtagswahlen auch von ihr profitierte), aber andererseits die Wehrpolitik mittrug und in Person ihrer Sicherheitspolitiker Fritz Erler und Carlo Schmid das Konzept der „Armee in der Demokratie“ maßgeblich mitkonzipierte.[18]
Einen Kurswechsel vollzog die Partei im Sommer 1952 vor dem Hintergrund der Stalin-Noten und spätestens mit Kurt Schumachers Tod, der seine Haltung Ende 1951 seinerseits geändert hatte: Nachdem er bis dahin auf den Weststaat mit „gesamtdeutschem Vorbehalt“ gesetzt hatte, erlangte die Wiedervereinigung nun auch für Schumacher eindeutig Priorität vor der Westintegration, zumal die „Magnettheorie“ keinen kurzfristigen Erfolg zu bescheren schien. Die Sozialdemokraten setzten nun anstelle der Präferenz für die Westbindung auf ein System kollektiver Sicherheit, indem ein wiedervereinigtes und neutrales Deutschland Schutz finden sollte. Programm und Prioritäten lauteten nun: Wiedervereinigung, Europäisches Sicherheitssystem im Rahmen der UN, kündbare Verträge, falls sie ein Hindernis für die Wiedervereinigung bedeuteten, Gleichberechtigung aller Teilnehmer und parlamentarisch-demokratische Kontrolle der Streitkräfte. Das Konzept der SPD „sollte die Ziele militärischer Sicherheit und Wiedervereinigung verklammern, war aber eher eine ‚regulative Idee’ als ein realisierbares Programm, solange sich die Großmächte darauf nicht einigen konnten und die SPD kaum Einfluß auf die Außenpolitik hatte“, betont Kleßmann.[19]
Die Sozialdemokraten, nun in fundamentaler Opposition zu Adenauers Politik, fanden Unterstützung bei den Gewerkschaften, deren Spitze eine vergleichbare Kehrtwende vollzogen hatte, in Teilen der wenig „soldatenbegeisterten“ Jugendorganisationen sowie der Publizistik mit ihren prominenten Wortführern Paul Sethe (Mitherausgeber der FAZ) und Rudolf Augstein (Spiegel -Herausgeber), die das Ziel der Wiedervereinigung (eines dann neutralen Gesamtdeutschlands) nicht aufgeben und die eventuellen diplomatischen Möglichkeiten im Zuge der Stalin-Noten ausloten wollten.[20]
Damit zogen die Sozialdemokraten sowie die genannten gesellschaftlichen Gruppen an einem Strang mit den vielleicht wichtigsten, zumindest aber hartnäckigsten Gegnern der Wiederbewaffnung: vor allem dem pazifistisch-neutralistischen Lager der Evangelischen Kirche um den populären hessen-nassauischen Kirchenpräsidenten Martin Niemöller und dem Bundesinnenminister a.D. und Präses der Synode der EKD, Gustav Heinemann.[21]
2.2 Gustav Heinemann: Biographisches I (1899-1950)
„... auch an uns selbst ist die Frage gestellt, was Deutschland sei. Wissen wir selbst eine Antwort darauf? Vieles spricht dafür, daß wir es nicht wissen. Unser deutsches Volk weiß heute kein nationales Lied zu singen, so wie andere Völker ihre nationalen Hymnen haben und auch wir sie hatten. Unser deutsches Volk kann heute unter den Völkern der Erde keine Fahne zeigen, unter der es sich repräsentiert sehen würde. Unser deutsches Volk bleibt stumm im Gespräch der Völker und im letzten Grunde auch gegen sich selbst, weil es keine nationale Regierung hat. Unser Volk ist zerteilt in Zonen, die sich in einer schier unerträglichen Weise auseinanderzuleben drohen. Ich sehe nur eines noch, indem wir als deutsches Volk uns als Einheit empfinden und symbolhaft ausgedrückt wissen, und das ist diese so bitter umkämpfte Stadt Berlin.“
(Gustav Heinemann am 11. August 1948 in einer Rede vor dem Schöneberger Rathaus anläßlich der Berlin-Blockade.)[22]
Daß Gustav Heinemann einmal eine exponierte Rolle in der deutschen Nachkriegspolitik spielen würde, hatte sich bis 1945 nicht unbedingt abgezeichnet. Geboren am 23. Juli 1899 in Schwelm, verbrachte Heinemann seine Jugend in Essen, um dann nach Ende des Ersten Weltkrieges in Münster, Marburg, München, Göttingen und Berlin Rechtswissenschaften, Volkswirtschaft und Geschichte zu studieren. Während seines Studiums zeigten sich erste Ansätze politischen Engagements: Heinemann stand in Opposition zu Republikgegnern radikaler Studentenverbindungen.[23]
Nach Examen und Promotion ließ er sich zunächst in Essen als Rechtsanwalt nieder und wurde wenig später bei den Rheinischen Stahlwerken Justitiar und Prokurist. Dort folgte der Aufstieg zum Bergwerksdirektor und Vorstandsmitglied sowie schließlich zum Chef der Hauptverwaltung. Parallel lehrte er zwischen 1933 und 1939 an der Universität Köln Wirtschafts- und Bergrecht.[24]
Gustav Heinemann fand – unter dem Einfluß seiner Frau Hilda – zum Christentum und setzte sich im Umfeld der Bekennenden Kirche insbesondere mit Hitlers Kirchenpolitik kritisch auseinander.[25]
Gerade auch die folgende Kriegskatastrophe dürfte es gewesen sein, die ihm die Notwendigkeit politischen Engagements in der Demokratie vor Augen geführt hat: 1945 gehörte er zu den Mitbegründern der CDU, wurde Ratsvertreter und bald Oberbürgermeister der Stadt Essen (wo er das Amt bereits zu friedenspolitischen Initiativen nutze), dann für ein Jahr (1947/48) Justizminister im Kabinett des NRW-Ministerpräsidenten Arnold. Und er engagierte sich in der EKD, deren Präses der Synode er wurde.[26]
Im September 1949 der vorläufige Höhepunkt der politischen Laufbahn: Adenauer berief Heinemann als Innenminister in sein Kabinett, nicht zuletzt weil Adenauer mit Heinemann „einen prominenten Protestanten mit in die Ministerrunde aufnehmen (wollte), und er legte in der Vorbesprechung Wert darauf, daß Heinemann ‚diese Ämter beibehalten würde, um wirklich die Verbundenheit mit den Evangelischen zu halten’“, zitiert Diether Koch Adenauer und interpretiert Heinemanns Berufung zu Recht auch als einen strategischen Zug des Kanzlers.[27]
Eine Einschätzung, die Gustav Heinemann seinerzeit bereits selber zum Ausdruck gebracht hatte: „Ich war ihm als Person oder als Fachmann für das Innenministerium längst nicht so wichtig wie als Stimmenfänger für den evangelischen Teil,“ so Heinemanns nüchternde Analyse besagter Konstellation.[28]
Am 31. August 1950 erklärte er, nicht mal ein Jahr im Amt, seinen Rücktritt, nachdem der Bundeskanzler – ohne eine für Heinemann ausreichende Diskussion mit dem Kabinett – dem Hohen Kommissar McCloy ein Memorandum überreicht hatte, in dem er den Westalliierten einen deutschen Wehrbeitrag im Rahmen einer westeuropäischen Streitmacht anbot.[29]
Heinemanns Rücktritt bedeutete nicht nur den politischen, sondern auch den endgültigen persönlichen Bruch mit Adenauer: „Nach seinem Rücktritt riß der persönliche Kontakt ab“, so Koch.[30]
[...]
[1] Zitiert nach Schütz, 1993, S. 5.
[2] Die B.A.-Arbeit wurde am 23. Juli 1999 bei der Fakultät für Geschichtswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum eingereicht und mit der Note 2,3 bewertet. Die vorliegende Fassung wurde vom Autor nachträglich marginal gekürzt und mit Blick auf formale Aspekte überarbeitet. Darüber hinausgehende Veränderungen am Text oder Ergänzungen wurden nicht vorgenommen.
[3] Kleßmann, 1991, S. 226-235.
[4] Ebenda.
[5] Siehe Literaturverzeichnis (Abschnitte 4.1 und 4.2 der vorliegenden Arbeit).
[6] Ebenda.
[7] Heinemann, 1952, S. 37.
[8] Vgl. Birke, 1989, S. 32; Meyer, 1986, S. 44; Kleßmann, 1988, S. 79f.
[9] Vgl. Kistler, 1985, S. 130.
[10] Vgl. Kleßmann, 1991, S. 231; Birke, 1989, S. 183; Lindemann, 1978, S. 89.
[11] Vgl. Kistler, 1985, S. 120.
[12] Hacke, 1993, S. 133.
[13] Vgl. Jacobsen, 1975, S. 68f.
[14] Vgl. Doering-Manteuffel, 1983, S. 73ff.; März, 1982, S. 339.
[15] Jacobsen, 1975, S. 76, 83.
[16] Ebenda, S. 85-87.
[17] Ebenda, S. 67.
[18] Vgl. Doering-Manteuffel, 1983, S. 73ff.
[19] Vgl. Doering-Manteuffel, 1983, S. 73ff.; Jacobsen, 1975, S. 73; Kleßmann, 1991, S. 226-232 (Zitat: S. 232). Eine ausführliche Darstellung bei Hrbek, 1972.
[20] Vgl. Doering-Manteuffel, 1983, S. 73ff.; Birke, 1989, S. 290; Doler, 1993, S. 195ff.; Schubert, 1970, S. 88, 128, 142, 167-182; Kleßmann, 1991, S. 226-234; vgl. auch Jacobsen, 1975, S. 74-84; Hacke, 1993, S. 134-144.
[21] Vgl. Doering-Manteuffel, 1983, S. 73ff.; Koch, 1988, S. 209f.; Lindemann, 1978, S. 89-130; Kleßmann, 1991, S. 226-234.
[22] Zitiert nach Lindemann, 1978, S. 102.
[23] Vgl. Lindemann, 1978, S. 13-37, S. 287.
[24] Ebenda.
[25] Ebenda, S. 38-63, S. 287.
[26] Vgl. Koch, 1988, S. 207f.; Lindemann, 1978, S. 64-88, S. 287.
[27] Koch, 1988, S. 207.
[28] Lindemann, 1978, S. 94, 96.
[29] Vgl. Lindemann, 1978, S. 106f.; Koch, 1988, S. 209ff.
[30] Koch, 1988, S. 214.
- Arbeit zitieren
- Christian Chmel (Autor:in), 1999, Die Kritik Gustav Heinemanns an Konrad Adenauers Deutschlandpolitik 1949-1961, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116843
Kostenlos Autor werden


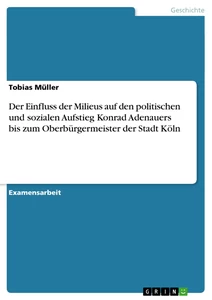









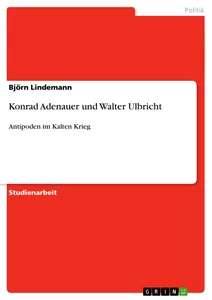

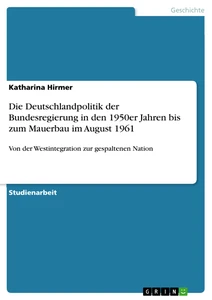

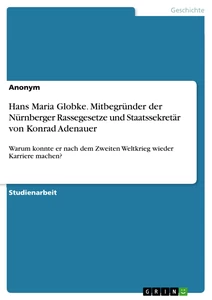

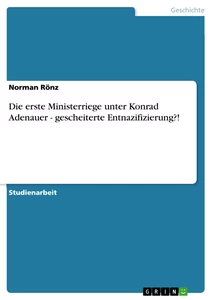



Kommentare