Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Protest- oder Reformpartei
2.1 ökologisch – Ökologie
2.2 sozial – Selbstbestimmung
2.3 basisdemokratisch – Demokratie
2.4 gewaltfrei – Gerechtigkeit
2.5 programmatische Entwicklung
3. Bewegungs- oder Wählerpartei
3.1 Herausbildung und Verfestigung der Parteielite
3.2 Veränderung der Parteielite
3.3 Parteiveränderung durch ihre Elite
3.4 Kritik
4. Oppositions- oder Koalitionspartei
4.1 retrospective voting
4.2 programmatische Umsetzung(sprobleme)
4.3 Korrektiv statt Alternative
5. Fazit
Literatur
1. Einleitung
Nachdem sie als Gegenmodell zu den etablierten Parteien angetreten waren,[1] zogen die Grünen 1983 mit Blumen und einer übergroßen Weltkugel in den deutschen Bundestag ein.[2] Während sich die Medien interessiert an der neuen Partei zeigten,[3] behandelten die im Bundestag vertretenen Parteien die Grünen zunächst als illegitime Eindringlinge; gleiche parlamentarische Rechte in Ausschüssen und anderen Gremien des Parlaments sollten ihnen verwehrt werden.[4] Was sollte man auch schon von Parteivertretern halten, die im Plenarsaal Pullover strickten und sich untereinander stritten bis Tränen flossen?[5]
Rückblickend setzte der Erfolg der westdeutschen Grünen, Ende der 1970er Jahre, der Phase des „hyperstabilen“ deutschen Drei- Parteiensystems ein Ende.[6] Kurz zuvor erreichte der außerparlamentarische Protest um den Ausbau der Kernenergie seinen ersten Höhepunkt. Im Frühjahr 1977 verschärften sich die Proteste durch die gewaltsamen Auseinandersetzungen in Brokdorf und Grohnde sowie durch die Entscheidung der niedersächsischen Landesregierung, ein überregionales Entsorgungszentrum zu bauen. Im gleichen Jahr sprach sich die Regierung für den Ausbau der Kernenergie aus.[7]
Für viele Aktivisten waren diese Entwicklungen Anlass dafür, den Erfolg des außerparlamentarischen Protestes in Frage zu stellen „und den Schritt in die Parteipolitik zu wagen.“[8] In den einzelnen Bundesländern traten ab 1977 grüne und bunte Listen zu Kommunal- und Landtagswahlen an; insgesamt schien es möglich, die 5 Prozent Hürde zu schaffen. Voraussetzung dafür war allerdings, dass sich die unterschiedlichen Gruppen zu einer Partei zusammenschlossen. Der Vorläufer der Grünen war, die 1979 anlässlich der Europawahl gegründete, „Sonstige Politische Vereinigung“ (SPV).[9] Nach dem Wahlerfolg (3,2%) und der damit einhergehenden Wahlkampfkostenerstattung[10] von rund 4,5 Millionen DM wurden die ersten Schritte zur Gründung einer Partei unternommen.[11]
Bei ihrer Gründung rekrutierten sich die Grünen hauptsächlich aus drei Strömungen. Es gab die Reste der Außerparlamentarischen Opposition (APO) aus der Zeit der großen Koalition sowie der Studentenbewegung. Des Weiteren schloss sich den Grünen auch ein Teil der Unterstützer der Bürgerinitiativbewegungen der 1970er Jahre an, wozu die Anti- Atom- Kraft- Bewegung sowie die Bildungs-, Frauen, Kultur-, Friedens- und Alternativökonomie- Bewegungen zählten.[12]
Die 1980er Jahre der Grünen waren vornehmlich durch den innerparteilichen Konflikt zwischen den Fundamentalisten (Fundis) und dem realpolitisch- reformorientierten Flügel (Realos) geprägt.[13] Kernpunkt des Streits war die grundsätzliche, strategische Orientierung der Partei. Die Ökolibertären und die Realpolitiker sprachen sich für Koalitionen mit der SPD aus, während die Ökosozialisten und die Radikalökologen einer Regierungsbeteiligung insgesamt ablehnend gegenüberstanden.[14]
Als die Grünen Ende der 1980er Jahre, nach anfänglichem Widerwillen, die deutsche Einigung akzeptiert hatten und deutlich wurde, dass sie nicht zu einem Bündnis mit der PDS bereit waren, verließen viele der Ökosozialisten die Partei. Ein Jahr später verabschiedete sich auch die Mehrheit der Radikalökologen.[15]
Auch in Ostdeutschland reichen die Anfänge der Friedens-, Ökologie- und Menschenrechtsbewegung bis in die 1970er Jahre zurück. Aus diesen Bewegungen gingen Ende 1989 die Grüne Partei und verschiedene Bürgerbewegungen[16] hervor, von letzteren schloss sich ein Teil zum „Bündnis 90“ zusammen.[17]
Direkt nach der Wende traten zunächst die ostdeutschen Grünen den westdeutschen Grünen bei. Nach langem Hin und Her schlossen sich die Grünen 1993 auch mit dem Bündnis 90 zum „Bündnis 90/Die Grünen“[18] bundesweit zusammen.[19]
Von 1998 bis 2005 übernahmen die Grünen erstmals Regierungsverantwortung auf Bundesebene, gemeinsam mit der SPD.[20]
Mittlerweile sind 28 Jahre seit der Parteigründung der Grünen vergangen. Bei ihrer Gründung betonten die Grünen, dass sie sich von den anderen Parteien absetzen und gemäß ihrem Gründungsprogramm „[…] die Alternative zu den herkömmlichen Parteien“[21] darstellen wollten. Ihr vornehmliches Ziel war es, anders als die etablierten Parteien zu sein; die sog. Anti- Parteien- Partei.[22] Die Partei sollte „nur das parlamentarische Spielbein, die außerparlamentarischen Bewegungen dagegen das Standbein sein.“[23]
Seit Jahren allerdings vermehren sich die Stimmen in der Fachwelt, die die Grünen zu den etablierten Parteien zählen.[24] Weichold stellt sogar darauf ab, dass sie zu einer „stinknormalen Partei“[25] geworden seien. Wie ist die Aussage der Grünen, die Alternative zu den etablierten Parteien darzustellen, mit den wissenschaftlichen Gegenfeststellungen vereinbar? Was ist aus der einstigen Anti- Parteien- Partei geworden? Um diesem Widerspruch auf die Spur zu kommen, soll folgender Frage nachgegangen werden: Haben sich die Grünen zu einer ganz normalen Partei entwickelt?
Zur Untersuchung dieser Frage wird Raschke gefolgt, demzufolge die typisch sozialwissenschaftliche Beschreibung der Grünen: „Anpassung, Oligarchisierung, Institutionalisierung, Entradikalisierung“[26] lautet. Zunächst soll die Entwicklung der Grünen von einer Protest- hin zu einer Reformpartei anhand der Grundwerte des Gründungsprogramms, des Assoziationsvertrages und dem heute gültigen Grundsatzprogramm nachgezeichnet werden. Im nächsten Punkt wird der Etablierungsprozess der Grünen untersucht und Michels These der Oligarchisierung auf die Entwicklung der Grünen anzuwenden versucht. Kritische Einwände zu der Übertragbarkeit von Michels Theorie beschließen diesen Punkt. Anschließend geht es vornehmlich um die Situation kleiner Parteien in der Regierung, die anhand der Grünen beleuchtet wird. Im letzten Punkt soll mit einem Resümee auf die Fragestellung geantwortet werden.
2. Protest- oder Reformpartei
Hoffmann zufolge, hatten die Grünen im Vergleich zu den anderen, im Bundestag vertretenen, Parteien bis März 2002 das älteste Programm. Dem neuen Grundsatzprogramm von 2002 sind das Bundesprogramm von 1980 und der Assoziationsvertrag von 1993, der im Zuge der Vereinigung mit dem Bündnis 90 formuliert wurde, vorangegangen.[27]
Tabelle 1: Grundwerteübersicht
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Hoffmann, 2002, S. 121
Das Bundesprogramm von 1980 bestand im Wesentlichen aus den vier Säulen: „ökologisch“, „sozial“, „basisdemokratisch“ und „gewaltfrei“.[28] Des Weiteren definierten sich die Grünen auch als „feministisch“[29] (siehe Tabelle 1, Spalte 1).
Nach der Vereinigung von Bündnis 90 und den Grünen, sollte mit dem Assoziationsvertrag dem Bündnis 90 der Beitritt erleichtert werden.[30] Wie aus Tabelle 1 ersichtlich wird, wurde mit dem Beitritt des Bündnis 90 der Grundwertekatalog von 1980 modifiziert und erweitert.[31] (siehe Tabelle 1, Spalte 3). Durch das neue Grundsatzprogramm von 2002 lösten nun die vier Grundwerte: „Ökologie“, „Selbstbestimmung“, „Gerechtigkeit“ und „Demokratie“ die Grundwerte von 1980 und 1993 ab (siehe Tabelle 1, Spalte 4).[32]
Während sich die Grünen 1980 in der Präambel ihres Bundesprogramms noch als „Alternative zu den herkömmlichen Parteien“[33] und damit auch zum System definierten, bezeichnen sie sich im Grundsatzprogramm 2002 „nicht mehr [als] die ‚Anti- Parteien- Partei’, sondern als die Alternative im Parteiensystem“[34]. Die Grünen konstatieren, dass sich seit ihrem Bundesprogramm von 1980 nicht nur die Welt um sie herum, sondern sie sich auch selbst deutlich verändert haben.[35]
Da Grundsatzprogramme das Selbstverständnis einer Partei widerspiegeln[36] und in deren Mittelpunkt die Grundwerte, für die eine Partei eintritt, stehen, soll ein Vergleich der Grundwerte von 1980, 1993 und 2002 aufzeigen, in welchem Umfang sich die Grünen programmatisch verändert haben.
2.1 ökologisch – Ökologie
Der Grundwert „ökologisch“ steht an erster Stelle der Grundwerte im Bundesprogramm von 1980 (siehe Tabelle 1, Spalte 1). Der Umweltaspekt wurde 1980 insgesamt in ein Konzept der grundsätzlichen Systemveränderung eingeordnet:
„Ausgehend von […] der Erkenntnis, daß in einem begrenzten System kein unbegrenztes Wachstum möglich ist, heißt ökologische Politik, uns selbst und unsere Umwelt als Teil der Natur zu begreifen.“[37]
Von zentraler Bedeutung im Ökologiekonzept der Grünen war (und ist) die Forderung nach umweltverträglichen Formen der Energiegewinnung. In diesem Zusammenhang wurde im Programm von 1980 die sofortige Abschaltung der Atomkraftwerke gefordert.[38]
Bereits im Grundkonsens von 1993 war von Systemveränderung, laut Hoffmann, keine Rede mehr, stattdessen begriff sich die Partei nun als „stärker wertkonservativ ausgerichtet.“[39] Ihre Funktion sahen die Grünen fortan darin, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. So heißt es im Assoziationsvertrag:
„Aufgabe und Pflicht des wirtschaftlichen Handelns bestehen […] darin, dringend Strukturen zu schaffen, in denen sich Selbsterhaltung und Sorge für sich selbst mit Fürsorge für andere und Rücksicht auf das gemeinsame Leben und die Natur verbinden.“[40]
Im Grundkonsens des Assoziationsvertrages gaben die Grünen dem Sozialismus eine Mitschuld an der weltweiten ökologischen Krise. Zentral gelenkte Planwirtschaften hätten sich ihrer Ansicht nach als untauglich erwiesen, „ökologisch zu produzieren und strukturelle Armut zu verhindern.“[41] Eine generelle Befürwortung marktwirtschaftlicher Strukturen blieb indes aus; vielmehr war der Grundkonsens in diesen Fragen unentschlossen.[42]
Auch im Grundsatzprogramm von 2002 steht der Grundwert „Ökologie“ im Zentrum grüner Politik. „Ökologie“ bedeutet bei den Grünen ähnlich wie bereits 1993 eine nachhaltige „Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen.“[43] Nach Hoffmann haben sich die Grünen 2002 endgültig von ihrer pauschalen Technik- und Wachstumskritik abgewandt.[44] Ökologie und Marktwirtschaft werden fortan nicht mehr als Gegensätze betrachtet, so heißt es:
„Bewahren können wir nicht durch ein Zurück, sondern indem wir die heutigen Industriegesellschaften nachhaltig verändern.“[45]
Betont wird auch, dass der Staat die Aufgabe hat, den Markt zu regulieren und zu überwachen.[46]
2.2 sozial – Selbstbestimmung
Die soziale Frage im Bundesprogramm von 1980 wurde, Klein und Falter[47] zufolge, zu einer Frage nach dem richtigen Wirtschaftssystem:
„[…] >Sozial< hat vor allem eine ökonomische Komponente. […] Sowohl aus der Wettbewerbssituation als auch aus der Konzentration wirtschaftlicher Macht […] gehen jene ausbeuterischen Wachstumszwänge hervor, in deren Folge die völlige Verseuchung und Verwüstung der menschlichen Lebensbasis droht. Hier genau verbinden sich die Umweltschutz- und Ökologiebewegung mit der Gewerkschaftsbewegung.“[48]
Die Grünen sprachen sich gegen ein Wirtschaftssystem aus, in dem wenige Privilegierte die Entscheidungen trafen. Aus diesem Grund forderten sie die Entflechtung von Großkonzernen in einzelne Betriebe, letztere sollten dann demokratisch von den Arbeitern selbst verwaltet werden. Des Weiteren forderten sie eine Verkürzung der Arbeitszeit u.v.m. Wie all diese Forderungen finanziert werden sollten, blieb im Bundesprogramm jedoch offen, so hieß es in Punkt 5 ‚Steuern, Währung und Finanzen’: „Dieser Programmteil wird noch überarbeitet.“[49]
Im Grundsatzprogramm 2002 existiert der Grundwert „sozial“ nicht mehr, stattdessen setzen die Grünen auf Selbstbestimmung und Subsidiarität.[50] Als zweiter Grundwert schließt „Selbstbestimmung“ 2002 im Gegensatz zu 1980 „ökologische und soziale Verantwortung ein.“[51] Die Selbstbestimmung des einzelnen, wird durch die Selbstbestimmung und Freiheit des anderen eingeschränkt.[52] Die Aufgabe des Menschen ist es demnach, mit der Freiheit verantwortungsvoll umzugehen.[53] Es wird betont, dass der Begriff der Freiheit nicht auf die reine Marktwirtschaft verengt werden darf. Freiheit ist vielmehr „die Chance zur Emanzipation und Selbstbestimmung über soziale und ethnische Grenzen oder Unterschiede der Geschlechter hinweg.“[54]
2.3 basisdemokratisch – Demokratie
Im Bundesprogramm von 1980 betonten die Grünen die Wichtigkeit der Basisdemokratie sowohl in der innerorganisatorischen Gestaltung der Partei als auch in der bundesdeutschen Demokratie[55]:
„Wir gehen davon aus, daß der Entscheidung der Basis prinzipiell Vorrang eingeräumt werden muss […] Kerngedanke ist dabei die ständige Kontrolle aller Amts- und Mandatsinhaber und Institutionen durch die Basis (Öffentlichkeit, zeitliche Begrenzung) und die jederzeitige Ablösbarkeit, um Organisation und Politik für alle durchschaubar zu machen und um der Loslösung einzelner von ihrer Basis entgegen zu wirken.“[56]
Das Prinzip der Basisdemokratie wollten die Grünen, durch eine Änderung des Parteiengesetzes, für alle Parteien verbindlich festlegen.[57]
Die Basisdemokratie, die 1980 noch einen Grundpfeiler der grünen Politik ausmachte und als Grundwert an dritter Stelle genannt wurde, spielte bereits im Assoziationsvertrag von 1993 keine Rolle mehr.[58] Nach Hoffmann[59] hatten die Grünen schon 1992 das Scheitern ihres Versuchs eingestanden,
„[…]mit Hilfe offener Parteistrukturen und dem Prinzip radikaler Öffentlichkeit unserer Beratungen Gedanken der partizipatorischen Demokratie zu institutionalisieren.“[60]
Während die Grünen ihre basisdemokratischen Vorstellungen zu den Akten gelegt hatten, wollen sie 2002 mit dem neuen Grundwert „Demokratie“ vorrangig den Parlamentarismus stärken und den Bürgern neue Beteiligungsformen eröffnen.[61] Für die bündnisgrüne Politik ist 2002 auch die „Transparenz und Klarheit bei der Erarbeitung von Entscheidungsalternativen […] entscheidend.“[62]
2.4 gewaltfrei – Gerechtigkeit
Der Grundwert „gewaltfrei“ löste, im Vergleich zu den anderen Grundwerten, die heftigsten Diskussionen innerhalb der Partei aus.
Mit dem Bundesprogramm von 1980 erteilten die Grünen dem Gewaltmonopol des Staates eine Absage, indem sie festhielten:
„Gewaltfreiheit gilt uneingeschränkt und ohne Ausnahme zwischen allen Menschen, also ebenso innerhalb sozialer Gruppen und der Gesellschaft als Ganzem als auch zwischen Volksgruppen und Völkern. Das Prinzip der Gewaltfreiheit berührt nicht das fundamentale Recht auf Notwehr und schließt sozialen Widerstand in seinen mannigfachen Varianten ein.“[63]
Sie forderten in diesem Zusammenhang auch ein allgemeines Widerstandsrecht gegen staatliches Handeln, dass
„[…] zur Verteidigung lebenserhaltender Interessen von Menschen gegenüber einer sich verselbständigenden Herrschaftsordnung nicht nur legitim, sondern auch erforderlich sein kann (z.B. Sitzstreiks, Wegesperren, Behinderung von Fahrzeugen).“[64]
Gegen diese Entgrenzung des Gewaltbegriffs wandten sich die Fürsprecher der repräsentativen Demokratie innerhalb der Grünen, die das staatliche Gewaltmonopol nicht antasten wollten. Für den realpolitischen Flügel stand der Staat als Ordnungsmacht nicht im Widerspruch zum Grundsatz der Gewaltfreiheit. Diese Haltung verdeutlichte Schily in einem Interview von 1990:
„Wenn es in der Gesellschaft Konflikte gibt, die nicht anders als mit Sanktionen zu lösen sind – etwa wenn es darum geht, Körperverletzung, Vergewaltigung oder gar Mord zu verhindern -, dann geht das nur mit einem rechtsstaatlich verbürgten Verfahren, und dann darf niemand anders als der Staat aufgrund der institutionellen Garantien das Recht haben, Sanktionen zu verhängen.“[65]
Ein verändertes Gewaltverständnis kam, nach Hoffmann, auch 1991 in der „Erklärung von Neumünster“ zum Ausdruck. In dieser erkannten die Grünen an, „dass das Volk im innenpolitischen Verhältnis die notwendige Exekutivgewalt an den Staat delegiere.“[66] Der Staat bleibe allerdings an den Volkswillen gebunden und könne deshalb nicht von sich aus das Gewaltmonopol definieren.[67] Im Assoziationsvertrag mit dem Bündnis 90 wurde diese Position weiterentwickelt. Die Grünen befürworteten nun:
„[…] die Gewaltenteilung im demokratischen Rechtsstatt einschließlich des Monopols polizeilicher Macht in der Hand des Staates […].“[68]
Zum Grundwert „gewaltfrei“ zählte auch eine aktive Friedenspolitik.[69] Ende der 1990er Jahre kam es auch deshalb zu erheblichen Diskussionen, denn in Bosnien, im Kosovo, in Mazedonien und in Afghanistan „leistet[e] die deutsche Bundeswehr Auslandseinsätze mit der parlamentarischen Unterstützung der Grünen.“[70]
In ihrem Grundsatzprogramm von 1980 sprachen sich die Grünen noch klar für eine uneingeschränkte Gewaltfreiheit aus. Nach Alemann beendeten die Grünen diese Diskrepanz endgültig, indem sie im Jahr 2002 ihr neues Grundsatzprogramm verabschiedeten.[71]
Der Grundwert „gewaltfrei“ wurde 2002 aufgrund der gemachten Erfahrungen[72] aufgegeben und galt fortan „nur“ noch als Grundprinzip,[73] so heißt es 2002:
„Gewalt darf Politik nicht ersetzen. […] Wir wissen aber auch, dass sich die Anwendung rechtsstaatlich und völkerrechtlich legitimierter Gewalt nicht immer ausschließen lässt. Wir stellen uns diesem Konflikt, in den gewaltfreie Politik gerät, wenn völkermörderische oder terroristische Gewalt Politik verneint.“[74]
Während 2002 „Gewaltfreiheit“ nur noch als Grundprinzip definiert wurde, steht der Grundwert „Gerechtigkeit“ an dritter Stelle der Grundwerte. Er darf allerdings nicht ausschließlich im Sinne von Verteilungsgerechtigkeit verstanden werden, denn es heißt:
„Bündnisgrüne Politik steht für Teilhabegerechtigkeit, für Generationengerechtigkeit, für Geschlechtergerechtigkeit und für internationale Gerechtigkeit.[…] Gerechtigkeit verlangt Solidarität und bürgerschaftliches Engagement.“[75]
2.5 programmatische Entwicklung
Das Grundsatzprogramm von 1980 war, Klein und Falter zufolge, deutlich von dem Enthusiasmus und Aktivismus der ‚Neuen Sozialen Bewegungen’ geprägt. So konstatieren beide: die Ziele und Forderungen stellten „streckenweise nicht mehr […] als eine Art programmatischer Wunschzettel [dar].“[76] Der Grundkonsens 1993 wirkte sich dagegen, nach Egle, mäßigend auf die Programmatik der Grünen aus.[77] Im Vergleich dazu steht das neue Grundsatzprogramm von 2002 für die Erfahrungen einer Regierungspartei.[78] Es sind weniger provokative Forderungen zu finden, dafür aber inhaltlich detailliertere Aussagen. Schon der Umfang des neuen Grundsatzprogramms[79] steht, nach Poguntke, für die Anpassung der Grünen „an die Mechanismen und Rituale des Parteienwettbewerbs.“[80]
Wenn eine Partei mehr als die Funktion „eines Auffangbeckens der ewig Unzufriedenen“[81] darstellen und nicht nur politische Ideen entwickeln will, sondern diese auch um- und durchsetzen möchte, wird ihr das, nach Jun und Kreikenbom, als reine Protestpartei nicht gelingen.[82] Die entscheidende Veränderung von 1980 zu 2002 war deshalb, dass die Grünen sich von einer Protest-[83] „zu einer Reformpartei entwickeln wollten und mussten, um erfolgreich zu bleiben.“[84]
[...]
[1] Kuhn, 2007, S. 144.
[2] Alemann, 2003, S. 63.
[3] Dittberner, 2004a, S. 223.
[4] Alemann, 2003, S. 63.
[5] Dittberner, 2004a, S. 223.
[6] Seinen Höhenpunkt erreichte das Dreiparteiensystem 1976, als 99,1% der Wähler den drei vertretenen Parteien im Bundestag ihre Stimme gaben.
[7] Poguntke, 2002, S. 57.
[8] Poguntke, 2002, S. 57.
[9] Die Grünen, 1990, S. 3.
[10] Eine Wahlkampfkostenerstattung wird bei Europawahlen ab 0,5 Prozent der Stimmen gewährt (Boom, 1999, S. 216).
[11] Poguntke, 2002, S. 57f.
[12] Alemann, 2003, S. 64.
[13] Bei diesem Konflikt handelte es sich nicht um zwei Strömungen, wie die von den Medien oft propagierte Etikettierung vorgab, sondern insgesamt um vier.
[14] Poguntke, 2002, S. 59; Alemann, 2003, S. 64.
[15] Beyme, 2004, S. 184; Poguntke, 2002, S. 59.
[16] Hierzu zählten: Initiative Frieden u. Menschenrechte, Neues Forum, Demokratie Jetzt.
[17] Poguntke, 2002, S. 59.
[18] Im Folgenden wird die Kurzbezeichnung „Die Grünen“ verwandt.
[19] Alemann, 2003, S. 67.
[20] Poguntke, 2003, S. 94.
[21] Die Grünen, 1980, S. 4.
[22] Rebenstorf, 1995, S. 182; Hellmann, 2002, S. 34; Heinrich, 1999, S. 130.
[23] Hoffmann, 1998, S. 63.
[24] Langguth, 2004, S. 158; Weichold, 2002, S. 499; Hoffmann, 2002, S. 113; Egle, 2003, S. 95; Pappi, 1993, S. 310.
[25] Weichold, 2002, S. 499.
[26] Raschke, 1993, S. 12.
[27] Hoffmann, 2002, S. 118.
[28] Die Grünen, 1980, S. 4f. Anzumerken ist, dass die Bedeutung dieser vier Eckpunkte bei den Grünen höchst umstritten war. Während sie für Hasenclever nichts weiter als einen „rein formale[n] Minimalkonsens“ (Hasenclever, 1990, S. 140) darstellten, waren sie für Vollmer „die Brücke, über die die beiden Teile des Gründungsparteitages – der ökologisch- wertkonservative und der linkssozialistisch- großstädtische – zueinander kommen konnten.“ (Vollmer, 1991, S. 11).
[29] An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass „feministisch“ laut dem Bundesprogramm von 1980 keinen Grundwert darstellte, wohl aber ein wichtiges Prinzip.
[30] Hoffmann, 1998, S. 219.
[31] Niclauß, 2002, S. 112.
[32] Hoffmann, 2002, S. 119.
[33] Die Grünen, 1980, S. 3.
[34] Die Grünen, 2002, S. 21.
[35] Die Grünen, 2002, S. 21f.
[36] Oberreuter/ Kranenpohl/ Olzog/ Liese, 2000, S. 12.
[37] Die Grünen, 1980, S.4.
[38] Die Grünen, 1980, S. 4ff; Müller- Rommel/Poguntke, 1992, S. 335.
[39] Hoffmann, 1998, S. 222.
[40] Die Grünen, 1993, Ziffer 13.
[41] Die Grünen, 1993, Ziffer 14.
[42] Insgesamt wird, nach Hoffmann, die ‚Kompromisshaftigkeit’ des Assoziationsvertrages deutlich, da er sowohl die kapitalismuskritischen Positionen der Grünen und die eher marktwirtschaftlich orientierten Einstellungen des Bündnis 90 wiedergeben soll (Hoffmann, 1998, S. 223).
[43] Die Grünen, 2002, S. 10.
[44] An einigen Stellen scheint Kleinert zufolge allerdings noch der alte antimarktwirtschaftliche Reflex durch, nachdem die ökologische Krise das Resultat der kapitalistischen Wirtschaftsweise ist (Kleinert, 2004, S. 59).
[45] Die Grünen, 1980, S. 10.
[46] Hoffmann, 2004, S. 131f.
[47] Klein/Falter, 2003, S. 73.
[48] Die Grünen, 1980, S. 5.
[49] Die Grünen, 1980, S. 10.
[50] Hoffmann, 2002, S. 120ff.
[51] Die Grünen, 2002, S. 11.
[52] Die Grünen, 2002, S. 11.
[53] Hoffmann, 2004, S. 132.
[54] Die Grünen, 2002, S. 11.
[55] Klein/Falter, 2003, S. 74.
[56] Die Grünen, 1980, S. 5.
[57] Klein/Falter, 2003, S. 75.
[58] Hoffmann, 1998, S. 225.
[59] Hoffmann, 2004, S. 132.
[60] Die Grünen, 1992.
[61] Die Grünen, 2002, S. 13; Weichold, 2002, S. 492.
[62] Die Grünen, 2002, S. 14.
[63] Die Grünen, 1980, S. 5.
[64] Die Grünen, 1980, S. 5.
[65] Schily, 1990, S. 195.
[66] Hoffmann, 2002, S. 120.
[67] Hoffmann, 2002, S. 120.
[68] Die Grünen, 1993, Ziffer 45.
[69] Die Grünen, 1980, S. 5.
[70] Alemann, 2003, S. 65.
[71] Alemann, 2003, S. 64f.
[72] Nach Egle stimmten die Grünen den Kampfeinsätzen aus zwei Gründen zu. Erstens war aufgrund der internationalen Einbindung Deutschlands eine andere Entscheidung nahezu ausgeschlossen. Außerdem machte die SPD deutlich, dass die Weigerung der Grünen, nicht die Meinung der Bundesregierung, sondern nur die der Koalition ändern würde. Als zweiten Grund führt Egle an, dass ein Lernprozess stattgefunden habe, indem die in der grünen Programmatik schon lange bestehende Spannung zwischen Gewaltfreiheit und dem Einsetzen für Menschenrechte aufbrach und die Mehrheitsverhältnisse zu ungunsten der Gewaltfreiheit verschob. Die Zustimmung der Grünen zu Kriegseinsätzen ist deshalb nach Prantl nicht als radikale Umorientierung zu begreifen, sondern vielmehr als Fortführung eines bereits begonnenen Prozesses, der durch die Regierungsbeteiligung beschleunigt wurde (Egle, 2003, S. 100f; Prantl, 1999, S. 88, Rüdig, 2002, S. 95).
[73] Alemann, 2003, S. 64f.
[74] Die Grünen, 2002, S. 15.
[75] Die Grünen, 2002, S. 12.
[76] Klein/Falter, 2003, S. 72.
[77] Egle, 2003, S. 95.
[78] Die Debatte um das neue Grundsatzprogramm 2002 verlief nicht zuletzt deshalb relativ reibungslos, weil die Radikalökologen und Fundamentalisten die Partei schon Anfang der 1990er Jahre verlassen hatten und grundlegende Fragen bereits in aktuellen Entscheidungen geklärt werden mussten (Poguntke, 2003, S. 94).
[79] Während das Bundesprogramm von 1980 noch 47 Seiten (inkl. 2 Seiten Präambel) umfasste, zählt das Grundsatzprogramm von 2002 bereits 181 Seiten (inkl. 13 Seiten Präambel).
[80] Poguntke, 2003, S. 95.
[81] Boom, 1999, S. 264.
[82] Jun/ Kreikenbom, 2006, S. 26.
[83] Weichold, 2002, S. 491; Weichold, 2005, S. 39.
[84] Die Grünen, 2002, S. 21.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Nina Eger (Autor:in), 2008, Die Grünen - Haben sich die Grünen zu einer ganz normalen Partei entwickelt?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116790
Kostenlos Autor werden











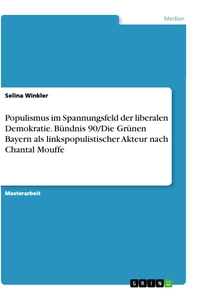






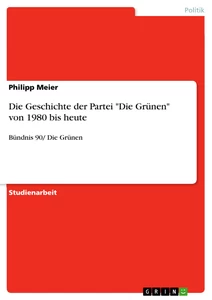



Kommentare