Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1) Einleitung
2) Zur Theorie der Autobiographie
2.1) Georges Gusdorf und Philippe Lejeune, oder die Erfolgsstory des weißen männlichen Autobiographen
2.2) Zur Kritik am traditionellen Modell nach Gusdorf und Lejeune
2.3) Erinnerung, Gedächtnis und die subjektive Wirklichkeit des autobiographischen Subjekts
2.4) “Our need for story“: Gründe für das Bedürfnis nach Autobiographie
3) Rebecca Walker: Black, White and Jewish. Autobiography of a Shifting Self
3.1) Identitätssuche des hybriden autobiographischen Subjekts
3.2) Erinnerung und Gedächtnis bei Rebecca Walker
3.3) Zur narrativen Struktur in Black, White and Jewish
4) Yvette Melanson: Looking for Lost Bird. A Jewish Woman Discovers Her Navajo Roots
4.1) Identitätssuche des hybriden autobiographischen Subjekts
4.2) Erinnerung und Gedächtnis bei Yvette Melanson
4.3) Zur narrativen Struktur in Looking for Lost Bird
5) Schlussbemerkung
6) Literaturverzeichnis
1) Einleitung
Der Titel dieser Arbeit drängt zu Beginn bereits eine Frage auf: Was ist ein hybrides Subjekt bzw. was macht ein hybrides Subjekt aus? Der Begriff „Hybridität“ kann, neben seiner biologischen und technischen Bedeutung1, auch auf die kulturelle Ebene transferiert werden. Reckwitz spricht in diesem Zusammenhang von „einer kulturellen Logik der Hybridität “2, die er allen Subjektkulturen zuspricht. Damit meint er „eine Kopplung und Kombination unterschiedlicher Codes verschiedener kultureller Herkunft in einer Ordnung des Subjekts“ (Ebd.). „Hybridität“ suggeriert somit generell die Vorstellung von „Zwitterhaftigkeit“, aber auch von Pluralität.
Entscheidend für den Hybriditäts-Begriff ist, dass immer zwei oder mehrere verschiedene Merkmale in eine Person oder einen Gegenstand münden. Inwiefern es sich bei den Protagonistinnen der zu behandelnden Autobiographien Rebecca Walkers3 und Yvette Melansons4 um hybride autobiographische Subjekte handelt und wie sie ihrer Hybridität begegnen, wird in dieser Arbeit zu klären sein. Um aber überhaupt das autobiographische Subjekt, aber auch die narrative Struktur jener Texte untersuchen zu können, muss ihre Entwicklung in der Autobiographie- Tradition berücksichtigt werden. Im ersten Teil soll deshalb zunächst die Theorieforschung der Autobiographie betrachtet werden. Dabei steht zunächst ein Modell der männlichen Autobiographie im Vordergrund, das bis heute die gattungstheoretische Diskussion beeinflusst. Welches sind die Merkmale männlichen Schreibens? Inwiefern wurde dieses männliche Modell kritisiert? Welche Rolle ist dem Gedächtnis des Autobiographen zuzuordnen? Worin liegen die Beweggründe eines Menschen, seine Lebensgeschichte niederzuschreiben? Dies sind Fragen, die im theoretischen Teil beantwortet werden sollen.
2) Zur Theorie der Autobiographie
2.1) George Gusdorf und Philippe Lejeune, oder die Erfolgsstory des weißen männlichen Autobiographen
Each man matters to the world, each life and each death; the witnessing of each about himself enriches the common cultural heritage.
(George Gusdorf) Das Interesse an Autobiographien ist heutzutage bemerkenswert groß. Der Anreiz diese zu lesen, liegt oftmals in der Tatsache begründet, in „autobiographischen Zeugnissen authentischer Lebenserfahrung zu begegnen“.5 Die gattungstheoretische Forschung der Autobiographie ist jedoch erst ein Phänomen des beginnenden 20. Jahrhunderts. An dieser Stelle ist vor allem der Hermeneutiker Wilhelm Dilthey zu nennen, der die wissenschaftliche Erforschung und die Aufwertung dieser Gattung bewirkte, wenn er sie „zur höchsten Form der Lebensdeutung, ja zur Grundlage des geschichtlichen Sehens überhaupt erklärte“.6 Weitere Höhepunkte in der gattungstheoretischen Forschung gab es in den fünfziger und siebziger Jahren zu verzeichnen, in denen primär formale Aspekte der Autobiographie-Gattung in den Vordergrund rückten, zu dem Zwecke sie von anderen Selbsterzeugnissen, wie Memoiren, Biographien oder Tagebüchern, abzugrenzen. Für diese Jahrzehnte repräsentativ sollen hier nun zwei theoretische Abhandlungen betrachtet werden, die bis heute die Gattung der Autobiographie prägen: Zum einen wird der Essay des Franzosen George Gusdorfs „Conditions and Limits of Autobiography“ aus dem Jahre 1956 behandelt, zum anderen soll Philippe Lejeunes Aufsatz „Der autobiographische Pakt“ von 1975 untersucht werden. Beide haben sich dabei einem männlichen Modell der Autobiographie gewidmet. Für Gusdorf ist die Autobiographie eine fest etablierte Gattung, deren Existenz er keinesfalls in Frage stellt. Gleichwohl schränkt er ihr Dasein ein, wenn er behauptet, dass diese Gattung temporal und lokal begrenzt sei: “Moreover, it would seem that autobiography is not to be found outside of our cultural area; one would say that it expresses a concern peculiar to Western man, a concern that has been a good use in his systematic conquest of the universe and that he has communicated to men of other cultures”.7
Für Gusdorf ist die Autobiographie demnach ein kultur- und epochenspezifisches Phänomen, d.h. sie existiert weder überall auf der Welt, noch hat es sie immer gegeben. Das Bedürfnis, sein Leben niederzuschreiben, ist folglich eine Erscheinung „in recent centuries and only on a small part of the map of the world“ (Ebd.). Wenn Gusdorf die Autobiographie also als ein Charakteristikum der westlichen Gesellschaft begreift, so impliziert dies gleichsam, dass primitive Gesellschaften von seiner Vorstellung von Autobiographie ausgeschlossen werden, da hier, aber auch in höher entwickelten Gesellschaften, die sich mythischen Lebensvorstellungen verschrieben haben, keine Autonomie des Selbst existieren kann. Vielmehr rangiert in solchen Gesellschaften die Gemeinschaft vor dem Individuum. Zudem, so Gusdorf, hätte der „Primitive“ Angst vor seinem Spiegelbild und würde insofern nicht das Verlangen verspüren, sein dahinter verborgenes Wesen zu erforschen. Der westliche Autobiograph dagegen „masters this anxiety by submitting to it; beyond all the images, he follows unceasingly the call of his own being“ (Ebd., S. 33). Eine wichtige Voraussetzung zum Schreiben einer Autobiographie ist demnach das Interesse des Menschen an sich selbst, seiner Individualität. Gusdorf spricht hier von metaphysischen Voraussetzungen, die nötig sind, um eine Autobiographie zu verfassen: Zunächst müsse sich der autobiographische Mann von mythischen Vorstellungen freimachen und einsehen, dass Gegenwart und Vergangenheit divergieren und sich in der Zukunft nicht wiederholen:
“…humanity must have emerged from the mythic framework of traditional teachings and must have entered into the perilous domain of history. The man who takes the trouble to tell of himself knows that the present differs from the past and that it will not be repeated in the future” (Ebd., S.30).
Durch diesen stetigen Zeitenwandel, der konstante Veränderungen impliziert, fühlt sich das Subjekt der Ungewissheit der Ereignisse ausgeliefert und empfindet gleichsam das Bedürfnis „to fix his own image so that he can be certain it will not disappear like all things in this world“ (Ebd.). Der autobiographische Mann, so Gusdorf, der sein Leben niederschreibt, intendiere demzufolge im Gedächtnis der nachfolgenden Generationen fortzuleben, dadurch gar eine Art Unsterblichkeit zubewirken. Er sehe sich selbst als bedeutende Person, ungeachtet dessen, ob er eine unbedeutende Rolle in der Gesellschaft einnehme: “(…) he considers himself a great person, worthy of men’s remembrance even though in fact he is only a more or less obscure intellectual” (Ebd., S. 31). Der bedeutsame Mann, der (s)eine Autobiographie verfasst, ist, laut Gusdorf, an bestimmte Bedingungen gebunden. Er habe die Aufgabe, sein Leben chrono logisch , linear in seiner Gesamtheit zu erzählen (“(…) autobiography claims to retrace a period, a development in time (…)“8 ), ein Faktum, welches sich gleichermaßen auf das autobiographische Ich auswirkt. Ist die narrative Struktur durch Kohärenz und Einheit charakterisiert, so begreift sich auch das dazugehörige Subjekt als kohärent, autonom, zentriert und handlungsmächtig. Gusdorf suggeriert mit seiner Vorstellung, die zeitlich divergierenden Elemente des Lebens eines Mannes geordnet darlegen zu können, eine Mimesis von Lebenswirklichkeiten, die jede Autobiographie innehat. Er betont dies, wenn er diese Gattung als Spiegel versteht “in which the individual reflects his own image“ (Ebd. S. 33). Dies bedeutet wiederum, dass das Abbild des Mannes wahrheitsgemäß porträtiert wird, die ‚reale’ Wahrheit gar übersteigt:
“ My individual unity, the mysterious essence of my being- this is the law of gathering in and of understanding in all the acts that have been mine, all the faces and all the places where I have recognized signs and witness of my destiny. In other words, autobiography is a second reading of experience, and it is truer than the first because it adds to experience itself consciousness of it. […] Autobiography appears as the mirror image of a life, its double more clearly drawn (…)” (Ebd. , S. 38 u. 40).
Authentizität spielt somit bei Gusdorf eine zentrale Rolle. Gleichzeitig wird diese Betrachtung auf die Gattung der Autobiographie relativiert, wenn Gusdorf sie ebenfalls als Kunstwerk beschreibt, bedingt durch den künstlerischen Schaffensprozess, den der Autobiograph bei der Re konstruktion seiner Lebensgeschichte durchläuft:
“There is, then, a considerable gap between the avoided plan of autobiography, which is simply to retrace the history of life, and its deepest intentions, which are directed toward a kind of apologetics or theodicy of the individual being. This gap explains the puzzlement and the ambivalence of the literary genre” (Ebd., S. 39).
Jeder Autobiograph unterliegt somit einem Spannungsverhältnis von Wahrheit und Kunst, dem er sich nicht zu entziehen vermag. Bei Gusdorf besitzt der Begriff der Autobiographie folglich eine Doppeldeutigkeit, wenn sich der autobiographische Mann einerseits dem Anspruch einer linear- kausalen Dokumentation seines gesamten Lebens beugen muss, anderseits ihm zugleich eine schöpferische Leistung der Rekonstruktion (“He wrestles with his shadow, certain only of never laying hold of it“9 ) zugeschrieben wird. Auch Philippe Lejeune hat sich einem männlich-bürgerlichen Modell der Autobiographie gewidmet. In seinem Aufsatz versucht er, diese Gattung in Anlehnung an seinen Vorgänger George Gusdorf zu definieren und sie von anderen Genres abzugrenzen. Analog zu Gusdorf „will diese Definition nicht mehr als einen Zeitraum von zwei Jahrhunderten abdecken und bezieht sich nur auf die europäische Literatur“.10 Freilich leugnet Lejeune nicht die Existenz von Selbstzeugnissen vor diesem Zeitraum oder außerhalb des europäischen Kontinentes, er betont jedoch, dass diese, mit Blick auf die moderne Autobiographieforschung, altmodisch und irrelevant seien. Lejeunes Definitionsversuch der Autobiographie lautet:
„Rückblickende Prosaerzählung einer tatsächlichen Person über ihre eigene Existenz, wenn sie den Nachdruck auf ihr persönliches Leben und insbesondere auf die Geschichte ihrer Persönlichkeit legt“ (Ebd., S. 14). Ein Werk sei folglich eine Autobiographie, wenn es bestimmte Bedingungen erfülle: Es müsse eine (1) Prosaerzählung sein, die ein (2) „individuelles Leben“ behandelt. Des Weiteren sollen (3) Autor, Erzähler und Protagonist, die eine (4) retrospektive Erzählperspektive einnehmen, identisch sein. Die von Lejeune aufgestellten Kriterien einer Autobiographie werden aber gleichsam relativiert, wenn er bemerkt, dass diese ungleich verpflichtend seien. So genüge es beispielsweise, wenn ein Text „hauptsächlich eine Erzählung“, die „Perspektive […] hauptsächlich rückblickend“ sei und „das Thema […] hauptsächlich das individuelle Leben, die Herausbildung der Persönlichkeit“ umfasse (Ebd., S. 15). Entscheidend für den Autobiographie-Begriff hingegen sei die Identität zwischen Autor, Erzähler und Hauptfigur. Lejeune ist bei seinem Definitionsversuch vor allem bemüht die Autobiographie von ihren „Nachbargattungen“ abzugrenzen. So könne man bei Memoiren, Biographien, personalen Romanen (Ich- Romane), autobiographischen Gedichten, Tagebüchern und Selbstporträts oder Essays nicht von autobiographischen Genres sprechen, da diese jeweils eines der oben genannten Kriterien nicht erfüllen.11 Gleichwohl spricht Lejeune von „natürlichen Übergängen“, die der Gattungsbestimmung einen „gewisse[n] Spielraum“ gewähren (Ebd.). Sieht Lejeune zwar „die Möglichkeit einer autobiographischen Erzählung ‚in der dritten Person’“ (Ebd., S. 17) oder gar in der zweiten Person (Singular), so betrachtet er deren Verwendung eher als vereinzelte Erscheinung, die man keineswegs als Identitätschaos missverstehen dürfe. Ihm zufolge wird die Identität zwischen Erzähler und Hauptfigur am deutlichsten, wenn sich der Autobiograph der ersten Person Singular, auch „autodiegetische Narration“ genannt, bedient. Lejeune betont in diesem Zusammenhang die Signifikanz des „ Eigennamens“ :
„Person und Rede verknüpfen sich im Eigennamen, noch bevor sie sich in der ersten Person verknüpfen, wie bereits aus der Abfolge des Spracherwerbs bei den Kindern ersichtlich ist. Das Kind spricht in der dritten Person von sich und nennt sich mit seinem Vornamen, bevor es begreift, dass es ebenfalls die erste Person verwenden kann. Später nennt sich jeder beim Sprechen „ich“; dieses „ich“ verweist dann jedoch für jeden einzelnen auf einen einmaligen Namen, den man immer äußern kann. Alle vorhin erwähnten […] Identifizierungen aufgrund mündlicher Situationen führen zwangsläufig dazu, dass die erste Person zu einem Eigennamen umgemünzt wird“ (Ebd., S. 23).
Das Phänomen der ersten Person, das seinen Ursprung im Eigennamen hat, überträgt Lejeune gleichermaßen auf die Gattung der Autobiographie, wenn er bemerkt, dass „[i]n den gedruckten Texten […] jede Äußerung von einer Person getragen [wird], die gewöhnlich ihren Namen auf den Umschlag des Buches, das Vorsatzblatt oder über oder unter den Titel setzt. In diesem Namen ist die ganze Existenz des sogenannten Autors enthalten: Er ist im Text die einzige unzweifelhafte außertextuelle Markierung, die auf eine tatsächliche Person verweist (….)“ (Ebd.). Die zwingende Voraussetzung, nach Lejeune, um überhaupt von Autobiographie sprechen zu können, ist folglich die Namenidentität zwischen „dem Autor (wie er namentlich auf dem Umschlag steht), dem Erzähler und dem Protagonisten der Erzählung (…)“ (Ebd., S. 25). Dieses charakteristische Merkmal fasst er mit dem Terminus „autobiographischer Pakt“ zusammen, der „die Behauptung dieser Identität im Text [darstellt], die letztlich auf den Namen des Autors auf dem Umschlag verweist“ (Ebd., S. 27). Analog zu Gusdorf spielen bei Lejeune die Aspekte der Authentizität und Individualität also eine entscheidende Rolle. Dies wird ebenso deutlich, wenn er der Autobiographie einen „Referenzpakt“12 zuschreibt, der vom autobiographischen Subjekt verlangt, sein Leben wahrheitsgemäß zu schildern: „Die Formel würde nun nicht mehr lauten ‚Ich, der Unterzeichnende’, sondern ‚Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit’“ (Ebd., S. 40). Wichtige Elemente der Autobiographie sind, laut Lejeune, demnach Ehrlichkeit und Wahrheit, die sich desgleichen in dem Gebrauch des Eigennamens manifestieren. Die Bedeutsamkeit des Eigennamens, in seinem Modell der Autobiographie, wird besonders hervorgehoben, wenn er behauptet, dass „der Erwerb des Eigennamens vermutlich eine ebenso wichtige Phase wie das Spiegelstadium“ sei, (Ebd., S. 37) und wenn er den Eigennamen als „[d]as tiefe Thema der Autobiographie“ (Ebd., S. 36) beschreibt. Der Erwerb des Namens des Vaters und des eigenen Vornamens, so Lejeune weiter, seien die wohl fundamentalsten Ereignisse in der Geschichte des Ichs. Der eigene Name sei einem Menschen niemals völlig gleichgültig, ob man ihn nun liebe oder hasse, da er ein grundlegendes Charakteristikum der eigenen Identität darstelle. Das Konzept des Eigennamens steht in Lejeunes Definitionsversuch der Autobiographie folglich im Vordergrund. Dieser ist Teil des „Lektürevertrages“ oder des „autobiographischen Paktes“ zwischen Leser und Autor, welcher sich auf die Namensidentität (Autor-Erzähler- Protagonist) bezieht und somit die Autobiographie zu einer „vertragliche [n] Gattung“ (Ebd., S. 49) macht. Würde man die Modelle der Autobiographie nach Gusdorf und Lejeune zusammenfassen, so müsste man sagen, dass die Autobiographie eine Erfolgsstory des weißen männlich-bürgerlichen Subjekts darstellt, das sein Leben als in sich geschlossene Ganzheit überblickt und es als repräsentativ wertet. Die narrative Form ist fortlaufend linear-progressiv und bildet somit eine kausal verknüpfte Einheit. Wie aber hat sich die Kritik an solch einem Modell gestaltet? Gab es überhaupt kritische Perspektiven? Diesen Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden.
2.2) Zur Kritik am traditionellen Modell nach Gusdorf und Lejeune
Folgt man Gusdorfs und Lejeunes Vorstellung, wie eine Autobiographie aussehen sollte, so wird an dieser Stelle deutlich, dass nicht nur außereuropäische Kulturen von dieser Gattung ausgegrenzt werden, sondern auch die autobiographische Frau. Generell bleiben mögliche Differenzen gänzlich unbeachtet. So bleibt der rationale, autonome autobiographische Mann, der Autor, Erzähler und Hauptfigur verkörpert, laut Gusdorf und Lejeune, die einzige Autorität des Textes. Weder eine Mann-Frau-Differenz, noch ethnische Ungleichartigkeiten innerhalb der Frauenwelt, finden Beachtung in der Gusdorf-Lejeuneschen Tradition. Dies führte dazu, dass sich vor allem eine Kritik der Frauen an diesem Modell entwickelte, die sich dem Sexismus-Vorwurf stellte und ihre eigenen Theorien hinsichtlich der Autobiographie hervorbrachte. Repräsentativ sollen hier besonders zwei Frauen namentlich genannt werden, die die weibliche Autobiographik vorangetrieben haben: Estelle Jelinek und Mary Mason, die in ihren Essays “Introduction: Women’s Autobiography and the Male Tradition“ und “The Other Voice: Autobiographies of Women Writers“ die weibliche von der männlichen Autobiographie-Tradition zu trennen suchen. Jelinek weist darauf hin, dass sich die weibliche Autobiographie von der männlichen sowohl vom Gegenstand, als auch vom Stil und Selbstbild unterscheidet. Während der autobiographische Mann, stellvertretend werden hier Augustinus Confessiones (400), Rousseaus Confessions (1781) und Goethes Dichtung und Wahrheit (1812-1831) genannt, sein Leben als repräsentativ werte und es folglich auf Erfolgsstories reduziere, konzentriere sich die Frau auf ihr Privatleben:
“(…) women’s autobiographies rarely mirror the establishment history of their times. They emphasize to a much lesser extent the public aspects of their lives, the affairs of the world, or even their careers, and concentrate instead on their personal lives- domestic details, family difficulties, close friends and especially people who influenced them”. 13
Jelinek betont an dieser Stelle, dass das autobiographische Subjekt, auf Grund seiner Beziehungsorientiertheit, ein relationales sei und stellt sich somit gegen das autonome Subjekt à la Gusdorf/Lejeune. Impliziere die männliche Tradition, die das Leben eines Mannes in seiner Heldenhaftigkeit offenbart, ein Selbstbild der Überzeugung und Selbsterkenntnis, so müsse die Frau sich und dem Leser zunächst Selbstwert erweisen:
“What their live stories reveal is a self-consciousness and a need to sift through their lives for explanation and understanding. The autobiographical intention is often powered by the motive to convince readers of their self-worth, to clarify, to affirm, and to authenticate their self-image” (Ebd., S. 15).
Während in Gusdorfs und Lejeunes Konzeption der Autobiographie der weiße Mann sein Leben vordergründig idealisiere, verfolge die Frau nachstehende Intention: “self-empowerment by writing“14. Des Weiteren sieht Jelinek einen gravierenden Unterschied zwischen der männlichen narrativen Form und dem weiblichen Schreibstil. Sind Augustinus, Rousseaus und Goethes Autobiographien, die paradigmatisch die männliche Tradition vertreten, chronologisch und linear-progressiv geschrieben, so ist in der weiblichen Tradition das Gegenteil zu verzeichnen:
“On the other hand, irregularity rather than orderliness informs the self-portraits by women. The narratives of their lives are often not chronological and progressive but disconnected, fragmentary, or organized into self-sustained units rather than connecting chapters. The multidimensionality of women’s socially conditioned roles seems to have established a pattern of diffusion and diversity when they write their autobiographies as well, and so by established critical standards, their life studies are excluded from the genre and cast into the non-artistic categories of memoir, reminiscence, and other disjunctive forms” (Ebd., S. 17).
Frauen schreiben ihrer Meinung nach fragmentarisch, episodisch und teilweise nicht zusammenhängend. Diese Tatsache sieht sie in der sozialen Rolle begründet, die jede Frau innehat: Das Leben einer Frau sei bereits zu vielfältig und komplex, um es linear-kausal schildern zu können. Diese Mannigfaltigkeit sei dafür verantwortlich, dass Frauen aus der Gattung der Autobiographie ausgeschlossen werden. Schildert Jelinek die Mann-Frau- Differenzen des autobiographischen Schreibens bezüglich Inhalt, Selbstbild und Schreibstil, so erkennt sie auch Elemente, die sich die weibliche und männliche Tradition teilen:
“Another criterion of the autobiographical canon that is contrary to the evidence constitutes an autobiographical fallacy of the first order and applies equally to women’s and men’s autobiographies. This is the stipulation that the autobiographical mode is an introspective and intimate one and that autobiographers write about their inner or emotional life. […] [N]either women nor men are likely to explore or to reveal painful and intimate memories in their autobiographies” (Ebd., S. 10).
Auch wenn Jelinek der männlichen und weiblichen Art zu Schreiben einzelne Gemeinsamkeiten zuschreibt, in diesem Falle, dass die Autobiographie “of a nonconfessional nature“ (Ebd., S. 13) ist, so intendiert ihr Modell der Autobiographie letzten Endes nichts anderes als eine apodiktische Trennung beider Traditionen. Ihr Modell der Autobiographie ist somit, wie jenes von Gusdorf und Lejeune, normativ und universalistisch. Auch Mary Mason ist eine Kritikerin der männlichen Autobiographie-Konzeption. Ihr Aufsatz stellt, wie der Estelle Jelineks, einen Versuch dar, einer Vernachlässigung der Geschlechter-Differenz gerecht zu werden. Auch in ihrem Ansatz stehen Augustinus und Rousseau paradigmatisch für die männliche Autobiographie-Tradition, deren autonome Lebensdarstellungen der Selbsterforschung, in Widerspruch zu der weiblichen Tradition stehen:
“(…) the disclosure of female self is linked to the identification of some ’other’. This recognition of another consciousness- and I emphasize recognition rather than deference- this grounding of identity through relation to the chosen other, seems […] to enable women to write openly about themselves”. 15
Diese Äußerung belegt, dass Mason, genau wie Jelinek, Frauen als relationale Subjekte sieht, die ihre Identitäten nicht aus sich selbst heraus, sondern vor allem aus der Relation zu einer anderen Person beziehen. Sie nennt dieses Phänomen, das die weibliche Autobiographik durchzieht, auch “duo pattern“, welches besonders in der Autobiographie Margaret Cavendishs zu Tage trete, wenn sie ihr Selbstbild mit einem anderen, gleichartigen Bild (in diesem Falle ihren Mann) identifiziert. Mason plädiert in ihrem Aufsatz für eine Erweiterung der männlichen Tradition der Autobiographie durch die weibliche, wenn sie kundtut: “(…) then brings female and male autobiographical types back into proximity in order that they throw light (at times by sheer contrast) on one another“ (Ebd.). Letzten Endes bleibt jedoch die Dichotomisierung von weiblicher und männlicher Autobiographie ihr Grundgedanke, denn “nowhere in women’s autobiographies do we find the patterns established by the two prototypical male autobiographers, Augustine and Rousseau; and conversely male writers never take up the archetypal model of Julian, Margery Kempe, Margaret Cavendish, and Anne Bradstreet“16 (Ebd.). Auch ihr Ansatz bleibt somit am Ende normativ. Sind die Theorien Estelle Jelineks und Mary Masons ein Versuch sich der Missachtung von Differenzen zu stellen, so zeichnen sich doch beide durch diese Nichtbeachtung aus, sparen sie mögliche Ungleichheiten innerhalb der Frauenwelt aus. Dies wiederum führte zur Kritik schwarzer Frauen, die sich ethnischer Differenzen widmeten und sich zugleich dem Rassismus-Vorwurf stellten. Prominente Beispiele hierfür sind Joanne Braxton und Nellie McKay. Braxton hat sich in ihrem Buch Black Women Writing Autobiography. A Tradition Within a Tradition für eine “redefinition of the genre of black American autobiography”17, durch den Einbezug der Texte schwarz-amerikanischer Frauen, eingesetzt. Ihrer Meinung nach seien alle schwarz-amerikanischen Frauen durch eine „mystische Schwesternschaft“ verbunden, die sich in einem „’magic circle’ of the black and female ’world of love and ritual’“ (Ebd., S. 6) manifestiere. Der Schreibimpuls für eine Afra-amerikanische Autobiographie, so Braxton, liege in der Mutterschaft begründet, die sich durch die, im Zentrum einer ethnischen Autobiographie stehende, Figur der “outraged mother“ offenbare. Diese angestammte Gestalt sei, für die gegenwärtige Generation, eine Trägerin der Traditionen, durch ihre “values of care, concern, nurturance, protection, and, most important, the survival of the race“ (Ebd., S. 3). Der Stil und die Form der Autobiographien schwarz- amerikanischer Frauen, wurzeln demnach in oraler Tradition der Mütter und Großmütter: “There began my fascination with autobiography, at my grandmother’s knee where I sat completely enthralled by her stories“ (Ebd., S. 4). Laut Braxton, sei die Verbindung mündlicher und literarischer Formen der Grund, dass die Afra-amerikanische Autobiographie eine “linguistic vitality“ (Ebd., S. 5) erlange. Ihren einmaligen Charakter erreiche sie ebenso durch die Integration von “communal values“ (Ebd.). Wie die Ansätze Jelineks und Masons bereits gezeigt haben, sind weibliche autobiographische Subjekte stark beziehungsorientiert. Diese Perspektive spiegelt sich auch hier wider, wenn Braxton dem Leser verdeutlicht: „Black women’s autobiography is also an occasion for viewing the individual in relation to those others with whom she shares emotional, philosophical, and spiritual affinities (…)“ (Ebd., S. 9). Das autobiographische Subjekt der Afra-amerikanischen Autobiographie ist folglich ein “communal self” und widersetzt sich ebenfalls der autonomen Subjektvorstellung Gusdorfs und Lejeunes. Desgleichen attestiert Nellie McKay “the importance of group identification“18 in Autobiographien schwarzer Frauen und ethnischer Minderheiten. Sie betont zwar, dass sich die Schreibeweise schwarzer Männer und Frauen nach dem Bürgerkrieg im Sinne eines “Negro Uplift[s]“ einander angenähert haben19 (“united by group efforts against discrimination and racism (…)“20), bleibt aber dennoch davon überzeugt, dass beide Geschlechter hinsichtlich ihrer inhaltlichen Darstellung weitgehend divergieren. Ähnlich wie in Braxtons Konzeption, seien schwarze Frauen auf ein kollektives Zusammenleben angewiesen, um auf diese Weise ein kulturelles Gedächtnis aufrecht zu erhalten: “(…) memory preserves the sense of a past culture“ (Ebd., S. 184). Auch Poststrukturalisten, wie Sidonie Smith, hegten Kritik an dem autonomen, rationalen Subjekt à la Gusdorf/Lejeune. In ihrem Essay “Performativity, Autobiographical Practice, Resistance“ erteilt sie jenem männlichen Modell eine Absage, wenn sie erklärt: “There is no essential, original coherent autobiographical self before the moment of self-narrating“.21 Für sie beginne autobiographisches Schreiben/Erzählen mit dem Vergessen, was auf die fragmentarische Natur der Subjektivität zurückzuführen sei. Das autobiographische Subjekt sei folglich ein “performative subject“, das bedeutet es zeichnet sich durch seine Selbst-Inszenierung aus. Konsequenterweise sei dieses Subjekt “amnesiac, incoherent, heterogeneous, interactive“ (Ebd., S. 110). Die Postmodernisten sehen die Autobiographie somit als Konstruktion von Wirklichkeit und stellen sich so gegen die Theorie Gudorfs und Lejeunes. Erstere vertreten gar eine Extremposition der Kritik, wenn sie behaupten, dass die Autobiographie nur ein literarischer Text sei, der weder Wahrheit, noch Authentizität, sondern Fiktion vermittle. Das autobiographische Subjekt sei hierbei ein Produkt des Textes, ein Effekt der Sprache, d.h. es geht dem Schreibprozess nicht voraus, was dem Gusdorf/Lejeune Modell ganz und gar widerspricht. Letztlich betrieben Poststrukturalismus und Postmoderne die Auflösung von Identität. Das Feindbild poststrukturalistischer Subjektvorstellung ist demnach das rationale Subjekt der Aufklärung (cogito, ergo sum)22 nach Gusdorf und Lejeune, das sich als kohärent, zentriert, autonom, unkörperlich und handlungsmächtig begreift. Wenn nun aber die Poststrukturalisten die Autobiographie als pure Konstruktion von Wirklichkeit sehen, so muss dies gleichzeitig belegt werden. Gibt es überhaupt die Wahrheit in der Autobiographie? Inwiefern kann unser Gedächtnis die Authentizität von Erinnerungen gewährleisten? Dies sind Fragen, die im Folgenden beantwortet werden sollen.
2.3) Erinnerung, Gedächtnis und die subjektive Wirklichkeit des autobiographischen Subjekts
Und ich fragte mich, ob Erinnerung etwas ist, das man hat, oder etwas, das man verloren hat.
(Woody Allen) Die notwendige und unumgängliche Voraussetzung zum Verfassen einer Autobiographie, ist die Fähigkeit, sich an vergangene Ereignisse bewusst erinnern zu können. Dies führt zu der Frage nach dem Aufbau unseres Gedächtnissystems bzw. nach der Arbeitsweise unseres Gedächtnisses, denn „die Erinnerung an komplexe Erlebnisse in der Vergangenheit läuft nicht in der Weise ab, als ob diese Erlebnisse in ihrer Komplexität an einem Ort des Gehirns gewissermaßen als Gesamtpaket abspeichert und dann im Wege der Erinnerung aus dieser ‚Schublade’ wieder herausgeholt würden“.23 Der Kulturwissenschaftler Harald Welzer, der sich auf neurowissenschaftliche Ansätze der Gedächtnisforschung bezieht, unterteilt das autobiographische Gedächtnis in vier verschiedene Langzeitgedächtnis-Systeme: Das prozedurale Gedächtnis, Priming, das Wissenssystem/semantisches Gedächtnis und das episodische Gedächtnis.24 Letzteres ist für das autobiographische Erinnern von besonderer Relevanz, da es einzigartige Erinnerungen, die für das Subjekt mit identitätsgeladenen, affektiven Augenblicken verbunden sind, beinhaltet. Nach Welzer ist das autobiographische Gedächtnis aus diesem Grund gleichsam ein emotionales. Diese, mit Affektivität gekoppelten Ereignisse, erleichtern dem autobiographischen Subjekt, sich auf eine „mentale Zeitreise“ durch die subjektive Zeit von der Gegenwart in die Vergangenheit zu begeben, um somit ein Wieder-Erfahren durch „autonoetisches“ Bewusstsein zu ermöglichen, d.h. durch ein das Selbst erkennendes, durch ein auf das eigene Selbst sich beziehendes Bewusstsein.25 Das episodische Gedächtnis, welches ein speziell menschliches Gedächtnis ist, entwickelt sich erst etwa zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr, auch wenn „[e]rste Anzeichen autobiographischen Erinnerns - die Verwendung von Personalpronomen und ein erstes Selbst-Erkennen im Spiegel – […] sich […] schon in einem Lebensalter von etwa zwei Jahren [zeigen]“ (Ebd., S. 14).26 Dass der Mensch erst nach dem dritten Lebensjahr über bewusste, autobiographische Erinnerungen verfügt, wird vor allem deutlich, wenn man das Phänomen der „Kindheitsamnesie“ berücksichtigt. Damit bezeichnet man die Unfähigkeit eines Erwachsenen, sich an weit zurückliegende Ereignisse aus der Kindheit, vor dem dritten Lebensjahr, zu erinnern:
“When an adult does remember something that is earlier than age three, it is usually a fragment or a brief scene, not a full meaningful episode. Overall, few memories from the preschool years are retained into adulthood; more begin to accumulate around age five or six years”.27
Was aber verursacht die Entwicklung des episodischen Gedächtnisses gerade in diesem Zeitraum? Folgt man der Entwicklungspsychologin Katherine Nelson, so liegt dies in Gesprächen mit den Eltern begründet. Mittels “memory talk“ erlernt das Kind autobiographisches Erinnern in Form des Narrativen. Gleichzeitig lernt es, wichtige Erinnerungen von weniger wichtigen zu trennen und so ein narratives Selbstverstehen zu entwickeln:
“(…) children learn what to tell and how to tell it in discussions with their parents about past experience. The thoughts and intentions of the individuals involved are as crucial to the unfolding narrative as the sequences and causes of the actions. It is relevant, therefore, to note that children who lack conversational experiences of this kind, for example […] deaf children of hearing parents who do not share a symbolic system, are delayed in autobiographical memory (…)” (Ebd. 196).
Autobiographisches Erinnern ist demzufolge eine erlernte Fähigkeit, oder, um es mit den Worten Welzers auszudrücken: Es ist eine „bio-psycho- sozio-kulturelle Kompetenz“, denn man hat es „bei der Gehirn- und Gedächtnisentwicklung prinzipiell nicht mit einem autonom ablaufenden biologischen Vorgang zu tun, sondern mit einem biologischen Prozess, der nach Maßgabe sozialer und kultureller Determinanten geformt und in sozialer Interaktion gestaltet wird“.28 Das autobiographische Gedächtnis ist somit nicht nur ein emotionales, sondern auch ein kommunikatives. Aber genau diese Kommunikativität bewirke, so Welzer, besondere Barrieren zum Gestern. So käme es beispielsweise häufig zur sogenannten „Quellenamnsie“, „womit das weit verbreitete Phänomen bezeichnet wird, dass ein Ereigniszusammenhang zwar korrekt erzählt wird, der Erzähler sich aber in der Quelle vertan hat, aus der er die Erinnerung geschöpft hat (…)“.29 Auf diese Weise verschmelzen häufig unsere Erinnerungen mit jenen aus medialen Quellen (Fernseher, Bücher), aber auch mit denen „unserer Eltern und Großeltern – wir glauben uns an das zu erinnern, was sie uns erzählt haben“.30 Ein ähnliches Phänomen bezüglich Erinnerungseinschränkungen, so Welzer, sei die „Konfabulation“, „also des Nachdichtens und Ausschmückens von Geschichten im Zuge ihres wiederholten Erzählens (…)“.31 All diese „falschen“ Erinnerungen im autobiographischen Gedächtnis haben jedoch eines gemeinsam: Der Erzähler hegt keinen Zweifel an ihrem Realitätsgehalt, ist folglich überzeugt von der Authentizität seiner Erinnerungen. In Wirklichkeit jedoch formen sie sich immerfort neu, weshalb Welzer mit Recht sagen kann, dass unser Gedächtnis ein „Wandlungskontinuum“ (Ebd., S. 21) ist. Es ist ein konstruktives System, das ungeheuer viel Raum lässt für Imagination und Phantasie, die wiederum Erinnerungslücken zu füllen suchen.
Dementsprechend spricht Wagner-Egelhaaf auch von einem „Kunstcharakter“32, den jede Autobiographie innehat. Dass ein Mensch nicht nur historische Tatsachen in seiner Autobiographie wiedergeben kann, wird auch von Roy Pascal bestätigt. Er sieht gerade jene Blindheit, Voreingenommenheit und Vergesslichkeit eines Autobiographen als wesentliche Elemente des Schreibens: „Ich möchte jedoch nahelegen, daß diese sogenannten Unzulänglichkeiten die Mittel sind, durch die eine Autobiographie zur Würde der Kunst aufsteigt, die die poetische im Gegensatz zur historischen Wahrheit verkörpert“.33 Die in diesem Kapitel herausgearbeiteten Feststellungen liefern uns jedenfalls ein Ergebnis: Der Autobiograph kann niemals den von George Gusdorf geforderten Wahrheitsanspruch geltend machen, denn „(…) jede neue Erinnerung kann durch vorangegangene Erinnerungen beeinflußt werden und bestehende Erinnerungen verändern“.34
[...]
1 In der Biologie bezieht man diesen Begriff auf Tiere oder Pflanzen, die durch Kreuzung zweier verschiedener Arten entstanden sind (auch Bastarde genannt). Im technischen Bereich ist der Begriff Hybrid beispielsweise in der Automobilindustrie anzusiedeln (vgl. Hybrid-Antrieb, der die Kombination aus Elektroantrieb und Verbrennungsmotor beinhaltet).
2 Reckwitz, Andreas, Das hybride Subjekt. Eine Theorie der Subjektkulturen von der bürgerlichen Moderne zur Postmoderne , Göttingen 2006, 19
3 Walker, Rebecca, Black, White and Jewish. Autobiography of a shifting self , New York 2001
4 Melanson, Yvette with Safran, Claire, Looking for Lost Bird. A Jewish Woman discovers her Navajo Roots , New York 2003
5 Wagner-Egelhaaf, Martina, Autobiographie , Stuttgart/Weimar 2000, 1
6 Niggl, Günther, „Einleitung“, in: Niggl, Günther (Hrsg.), Die Autobiographie. Zur Form und Geschichte einer literarischen Gattung , Darmstadt 1989, 2
7 Gusdorf, George, „Conditions and Limits of Autobiography“, in: Olney, James (Hrsg.), Autobiography: Essays Theoretical and Critical , Princeton 1980, 29
8 Ebd., 35
9 Ebd., 48
10 Lejeune, Philippe, Der autobiographische Pakt , Frankfurt am Main 1994, 13
11 So kann die Biographie beispielsweise keine Identität zwischen Erzähler und Hauptfigur aufweisen.
12 Lejeune leitet diesen Begriff von der Biographie und Autobiographie ab, weil es sich bei diesen Gattungen um referentielle Texte handelt, die einem Wahrheitsanspruch unterliegen.
13 Jelinek, Estelle: “Introduction: Women’s Autobiography and the Male Tradition“, in: Jelinek, Women’s Autobiography: Essays in Criticism , Bloomington 1980, 8
14 Dieser Terminus geht auf Frau Prof. Dr. Weber zurück.
15 Mason, Mary: “The Other Voice: Autobiographies of Women Writers”, in: Smith, Sidonie; Watson, Julia (Hrsg.), Women, Autobiography, Theory. A Reader , Madison 1998, 321
16 Dies sind, für Mason, die vier Paradigmen der weiblichen Autobiographie
17 Braxton, Joanne M., Black Women Writing Autobiography. A Tradition Within a Tradition , Philadelphia 1989, 9
18 McKay, Nellie Y., “Race, Gender, and Cultural Context in Zora Neale Hurston’s Dust Tracks on the Road ”, in: Brodzki, Bella/Schenk, Celeste (Hrsg.), Life/Lines. Theorizing Women’s Autobiography , London 1988, 175
19 So schrieben nun auch schwarze Frauen über ihre heroischen politischen Aktivitäten.
20 Ebd., 178
21 Smith Sidonie: “Performativity, Autobiographical Practice, Resistance”, in: Smith, Sidonie; Watson, Julia (Hrsg.), Women, Autobiography, Theory. A Reader, a.a.O., 108
22 Der Ausdruck „Ich denke, also bin ich“, geht auf René Descartes zurück.
23 Brandt, Harm-Hinrich: „Vom Nutzen und Nachteil der Erinnerung für die Geschichtswissenschaft“, in: Bittner, Günther (Hrsg.), Ich bin mein Erinnern. Über autobiographisches und kollektives Gedächtnis , Würzburg 2006, 130
24 In der Neurowissenschaft werden episodisches und autobiographisches Gedächtnis oftmals gleichgesetzt (episodisch-autobiographisches Gedächtnis). Welzer hat hingegen ein Modell erstellt, in dem das autobiographische Gedächtnis allen anderen Gedächtnissystemen übergeordnet ist und in dem es funktional synthetisiert, d.h. das autobiographische Gedächtnis entwickelt sich, laut Welzer, erst im Wechselspiel von episodischen, semantischen und prozeduralen Gedächtnis und Priming.
25 Markowitsch, Hans J./Welzer, Harald, Das autobiographische Gedächtnis. Hirnorganische Grundlagen und biosoziale Entwicklung , Stuttgart 2005, 11
26 Die Wissenschaftler sind generell der Meinung, dass die notwendige Voraussetzung des autobiographischen Erinnerns in der Selbst-Erkenntnis des Kindes wurzelt: Wenn Kinder sich selbst mit den Personalpronomen „Ich“ beschreiben und sich im Raum-Zeit- Kontinuum verorten können (d.h. über Ereignisse in der Vergangenheit, die das Ich betreffen, zu sprechen) , dann haben sie die Fähigkeit des autobiographischen Erinnerns erlangt.
27 Nelson, Katherine, Young minds in social worlds. Experience, Meaning, and Memory , London 2007, 185
28 Markowitsch, Hans J./Welzer, Harald, Das autobiographische Gedächtnis. Hirnorganische Grundlagen und biosoziale Entwicklung , a.a.O., S. 22
29 Welzer, Harald, Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung , München 2005, 43
30 Wagner-Egelhaaf, Autobiographie , a.a.O., 42
31 Welzer, Harald, Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung , a.a.O., 43
32 Wagner-Egelhaaf, Autobiographie , a.a.O., 45
33 Pascal, Roy: „Die Autobiographie als Kunstform”, in: Niggl, Günther (Hrsg.), Die Autobiographie. Zur Form und Geschichte einer literarischen Gattung , Darmstadt 1989, 155
34 Welzer, Harald, Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung, a.a.O., 45
- Arbeit zitieren
- Sabine Kandziora (Autor:in), 2008, Das hybride autobiographische Subjekt - Rebecca Walker und Yvette Melanson, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116712
Kostenlos Autor werden











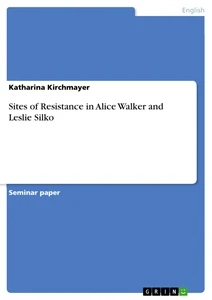


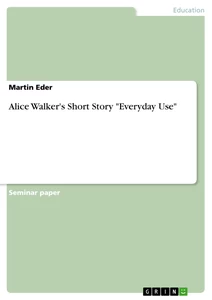
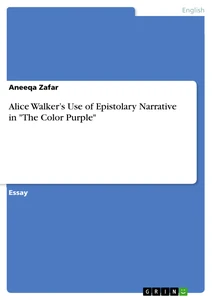
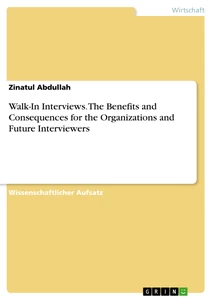
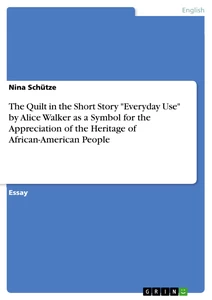

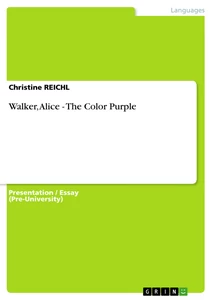
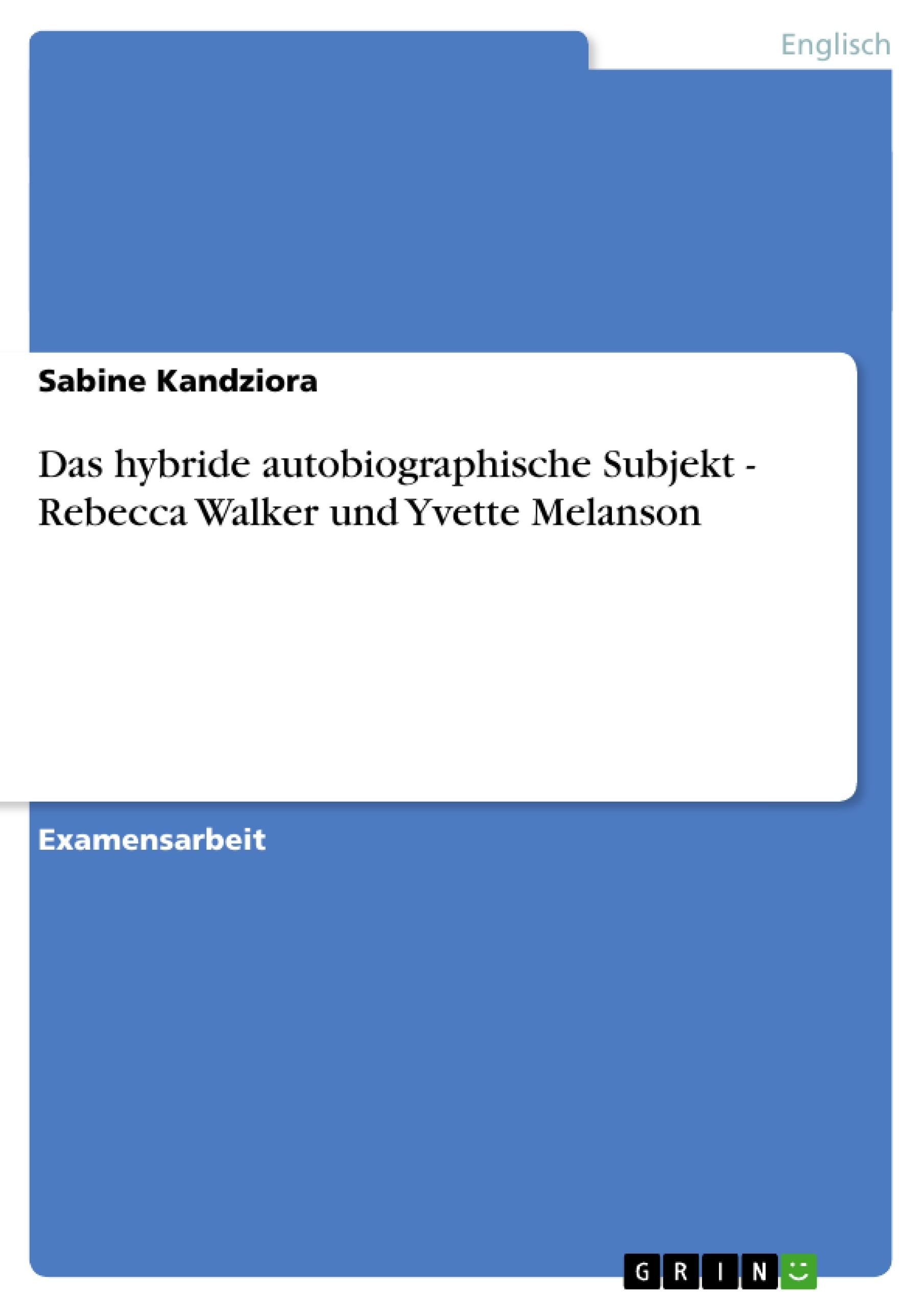

Kommentare