Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung
1.1 Fragestellung und theoretischer Rahmen
1.2 Aufbau der Arbeit und Argumentation
1.3 Zum Begriff der humanitären Intervention
2 Grundlagen und Eckpunkte der Debatte
2.1 Die Debatte um humanitäre Interventionen
2.2 Die (traditionelle) Lehre vom gerechten Krieg
2.2.1 Historischer Abriss: Kein homogenes Gebilde
2.2.2 Struktureller Kern: Kriterien des gerechten Krieges
2.2.3 Anwendbarkeit auf humanitäre Interventionen
2.3 Menschenrechte als gerechter Grund
2.3.1 Die universale Gültigkeit der Menschenrechte
2.3.2 Was ein Menschenrecht grundlegend macht
2.4 Staatssouveränität als gewichtiger Gegengrund
2.4.1 Souveränität durch innere Legitimität
2.4.2 Souveränität als Bedingung internationaler Stabilität
3 Moralphilosophische Analyse
3.1 Methode: Abstrakte Moralphilosophie
3.2 Interventionen nach dem Konzept der Nothilfe
3.2.1 Das Recht zur Hilfe (Ius ad bellum)
3.2.2 Restriktionen der legitimen Hilfe (Ius in bello)
3.3 Das Dilemma der Tötung Unschuldiger
3.3.1 Erste These: Die Abwägungsbedingung genügt schon
3.3.2 Zweite These: Die Morallehre vom Doppeleffekt
3.3.3 Dritte These: (Rechtsethische) Umkehr der Beweislast
3.4 Das anti-interventionistische Argument vom Staat als Person
3.4.1 Die (falsche) Analogie von Person und Staat
3.4.2 Moralphilosophische Kritik: Menschenrecht vor Staatsrecht
3.4.3 Moralphilosophische Begründung staatlicher Souveränität
3.5 Zwischenresümee
4 Walzer: Der pragmatische Neuansatz
4.1 Methode: Analyse der Alltagsmoral
4.1.1 Angewandte Ethik und die Struktur der moralischen Welt
4.1.2 Quelle und Universalität moralischer Urteile
4.2 Ius ad bellum: Schutz der Gemeinschaft
4.2.1 Menschenrechte, Gemeinschaft und Souveränität
4.2.2 Gerechter Grund und Recht zur Intervention
4.3 Ein neues Dilemma: Siegen und gut kämpfen
4.3.1 Die Grenze der Lehre des Doppeleffektes
4.3.2 Das Recht nicht beugen, sondern übergehen
4.4 Kritik des ’Utilitarismus der extremen Situation‘
4.4.1 Tertium Non Datur? – Kritik der Prämissen
4.4.2 Schuld und Sühne: Das Konzept der Dirty Hands“
4.4.3 Utilitarismus: Vorwurf der doppelten Inkonsistenz
4.4.4 Anmerkung: Grenzen der Kritik
4.5 Zwischenresümee
5 Moral und die Zwischenebene politischer Institutionen
5.1 Recht und Moral
5.1.1 Recht braucht eine moralische Grundlage
5.1.2 Recht verbietet nicht das moralisch Gute
5.1.3 Die Moral löst den Widerspruch im Völkerrecht
5.2 Legitime Autorität und Interventionssubjekt
5.2.1 Sicherheitsrat: Hochwürdige, unzulängliche Autorität
5.2.2 Staaten(koalitionen): Genuin moralische Autorität
5.3 Der Vorwurf des moralischen Exzeptionalismus
5.3.1 Intervention ja, positiv-rechtliche Kodifizierung nein
5.3.2 Kritik des moralischen Exzeptionalismus
5.3.3 Ausweg gewohnheitsrechtliche Legalisierung‘?
5.4 Zwischenresümee
6 Testfall K oso v oin t erven t ion ( 1999)
6.1 Vorbemerkungen zum methodischen Vorgehen
6.2 Ius ad bellum: Intervention gerechtfertigt
6.2.1 Kriterium gerechter Grund: Erfüllt (Konsens)
6.2.2 Kriterium Notwendigkeit (I): Plausibel erfüllt
6.2.3 Kriterium legitime Autorität: Klar erfüllt
6.2.4 Kriterium rechte Absicht: Ja, soweit erkennbar
6.3 Ius in bello: Zweifelhafte Durchführung
6.3.1 Kriterium Notwendigkeit (II): Nicht erfüllt
6.3.2 Kriterium Proportionalität: Fraglich
6.3.3 Kriterium Non-Kombattanten-Schutz: Ungenügend erfüllt
6.4 Zusammenfassende Bewertung
7 Ergebnisse und Resümee
7.1 Inhaltliche Ergebnisse und Argumentation
7.2 Lösungsvorschlag: Ein globaler Ethikund Interventionsrat?
8 Literaturv erzeichnis 93
Abbildungsverzeichnis
1 A ufbau der Arbeit
2 (Humanitäre) Interventionen seit 1970
3 Tr ennlinien der ethischen Argumentation
4 Exkurs: Das Analogieargument bei Kant und Rawls
5 Ar gumentation zum Utilitarismus der extremen Situation
6 De r Krieg im Völkerrecht
7 Bewertung der Kosovointervention
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einführung
Das Eingreifen der NATO in Jugoslawien (1999) hat grelles Licht auf das immer wieder aktuelle Problem der Rechtfertigung gewaltsamer humanitärer Interventionen geworfen. Während die einen darin das gleichermaßen moralisch wie völkerrechtlich gebotene Einschreiten sahen, um Verbrechen, die das Gewissen der Menschheit schockieren“ (Walzer) zu verhindern, sprachen andere mit Verweis auf das Nichteinmischungsprinzip und wegen der Übergehung des UN-Sicherheitsrates von einem klaren Völkerrechtsverstoß; zudem sei wegen der angeblich leichtfertigen Inkaufnahme ziviler Schäden die Intervention auch moralisch verwerflich gewesen. – Die Einschätzungen könnten also kontroverser nicht sein, und dabei gilt vielen die Kosovointervention noch als Paradebeispiel für humanitäre Interventionen der gegenwärtigen Zeit. Kennzeichen der breiten Debatte über die Zulässigkeit der NATO-Operation und humanitärer Interventionen im Allgemeinen sind die Bezugnahme auf völkerrechtliche Normen auf der einen und moralische Pflichten und Ansprüche auf der anderen Seite. Dabei erweisen sich freilich beide, das Recht wie die Moral, oft als vieldeutig und mehr oder weniger widersprüchlich. Einigermaßen Konsens besteht nur darin, dass das strikte Interventionsund Gewaltverbot der UN nicht das letzte Wort sein kann, wenn der Schutz grundlegender Menschenrechte irgendetwas gilt.
1.1 Fragestellung und theoretischer Rahmen
Thema der Arbeit ist die Legitimität humanitärer Interventionen. Es soll untersucht werden, ob Interventionen im Namen der Menschenrechte grundsätzlich rechtfertigbar sind und was die weiteren Bedingungen sind. Dabei ist die (moralische) Legitimität, um die es geht, von der völkerrechtlichen Legalität zu unterscheiden. Zwischen beiden besteht aber ein Zusammenhang: Es mag sein, dass sich positive Normen und moralisch begründete Forderungen widersprechen, und dann stellt sich sich die Frage, warum das geltende Recht zu befolgen ist und wann es vielleicht auch gebrochen werden darf. Gerade in der internationalen Politik hat die Begründung und Befolgung grundlegender Rechtsnormen meist auch moralischen Wert. Mit einem verkürzten Moralbegriff, der von völkerrechtlichen Normen absehen würde, kann man die Legitimität humanitärer Interventionen daher nicht untersuchen. – Wird aber positives Recht übergangen, gelten die moralischen Ansprüche umso schärfer, denn sie allein können dann noch Halt geben.
Die These lautet, dass humanitäre Interventionen grundsätzlich legitim sein können, sofern ihre Durchführung bestimmten moralischen Anforderungen genügt. Weil wir einen Moralbegriff zu Grunde legen, der auch völkerrechtliche Normen (insbesondere das Gewaltund Interventionsverbot) bzw. deren Verletzung berücksichtigt, ist die These so zu erweitern, dass im Zweifelsfall die Forderungen der Moral den Vorrang haben. Humanitäre Interventionen können also auch dann legitim sein, wenn sie gegen geltendes Völkerrecht verstoßen. Demnach könnten auch von einzelnen Staaten und ohne die Autorisierung durch den UN-Sicherheitsrat durchgeführte Interventionen Anspruch auf Legitimität erheben.
Die Untersuchung ist indessen noch von einem anderen Interesse getragen. Kontrovers wie das Thema sowohl auf der moralischen wie der rechtlichen Ebene ist (die außerdem miteinander verschränkt sind), wäre ein klares Votum am Ende als ein Zeichen schlechter Argumentation zu werten bzw. als Verkennung der inhärenten Widersprüche, die das Problem der humanitären Intervention in sich birgt. Deshalb muss das Erkenntnisinteresse die Frage einschließen, wie überhaupt zu argumentieren ist, um zu begründeten Urteilen zu kommen, die mit einem gewissen Anspruch auf Verbindlichkeit auftreten können. Es geht daher nicht nur um sachliche Resultate, sondern es geht auf der theoretischen Metaebene um geeignete Kriterien und überzeugende Argumentationsformen. Diese zusätzliche Fragestellung wird die Arbeit implizit leiten.
Als theoretischen Rahmen ziehe ich die Lehre vom gerechten Krieg heran. Legitimität ist – im Gegensatz zur Legitimation, die mit einem Legitimierungsvorgang zu tun hat – vor allem eine ethische Kategorie, und ebenso die Gerechtigkeit. Die Lehre vom gerechten Krieg, die ihren Geltungsbereich im Politischen und ihre Wurzeln in der Theologie und der Moralphilosophie hat, ist daher eine geeignete Grundlage für die Analyse moralischer Gewaltprobleme. Sie liegt in verschiedenen Formen vor. In der Regel ist damit die traditionelle, naturrechtliche Lehre mit ihren diversen Kriterien für die Anwendung militärischer Gewalt gemeint. Sie gründet auf der Überzeugung, dass es im Krieg moralische Beschränkungen dessen gibt, was erlaubt ist und steht damit in deutlichem Gegensatz zu (realistischen) Ansätzen, wonach ” conduct of war is inherently unlimited“ (Mapel 1996: 65). Gerade bei humanitären Interventionen, die dem Schutz von Menschen vor Gewalt gelten, muss die Gewaltvermeidung oberste Priorität haben. Als eine neue Variante ziehe ich die moderne Theorie des gerechten Krieges von Michael Walzer heran, wie sie in Just and Unjust Wars[1] (1979) vorgestellt wird. Dieses Buch ist zu einem modernen Klassiker geworden, an dem eine halbwegs ganzheitliche Untersuchung schlechterdings nicht vorbeikommt. Das gilt vor allem deswegen, weil sie sowohl inhaltlich als auch in der argumentativen Vorgehensweise neue Aspekte in die Problematik einbringt.
Um Missverständnissen vorzubeugen, ist das Thema abzugrenzen. Die Lehre vom gerechten Krieg beurteilt Handlungen, nicht Ordnungen. Es soll nicht nach einem (zukünftigen) Weltordnungskonzept, nach den Möglichkeiten eines UN-Interventionsregimes und dessen Umsetzungschancen oder anderweitiger politischer Voraussetzungen für humanitäre Interventionen gefragt werden. Jenseits von Zukunftsentwürfen und Wünschbarkeiten geht es einzig um das Legitimitätsproblem, vor das sich jeder hilfsbereite Staat oder jedes Staatenbündnis angesichts einer humanitären Notlage gestellt sieht, und zwar unter den gegenwärtigen Bedingungen der Staatenwelt. Das schließt die Annahme mit ein, dass humanitäre Interventionen Ausnahmefälle sind und bleiben.
1.2 Aufbau der Arbeit und Argumentation
Abbildung (1) zeigt den groben Aufbau der Arbeit. In der Einführung (Kapitel 2) sollen der politisch-öffentliche Kontext des Themas beleuchtet und die theoretische Grundlage in knapper Weise dargestellt werden, d.h. nur so ausführlich, wie es zum Verständnis und zur Vorbereitung der Untersuchung erforderlich ist. Die vier folgenden Kapitel bilden den Kern der Arbeit. Sie haben weitestgehend denselben Aufbau und behandeln jeweils zwei Aspekte des Legitimitätsproblems, ihre prinzipielle Zulässigkeit (Ius ad bellum) und ihre moralisch vertretbare Durchführung (Ius in bello). Sie stehen ferner in einer Ordnung abnehmender Abstraktion bezüglich der ethischen Argumentation. Dies bedeutet zwar jeweils einen Verlust an theoretischer Kohärenz von Kapitel zu Kapitel, dem allerdings ein Gewinn an Konkretion gegenübersteht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: A ufbau der Arbeit
Kapitel (3) behandelt das Thema in enger Anlehnung an die klassische Lehre vom gerechten Krieg. Die zentralen Legitimitätsprobleme werden in der naturrechtlichen Argumentationsform, d.h. im Rückgriff auf fundamentale ethische Prinzipien analysiert. Es versteht sich, dass bei dieser philosophischabstrakten Form des Argumentierens keine konkreten Ergebnisse herausspringen; das Kapitel ist daher vor allem Fundament für das Folgende. In Kapitel (4) erfährt die Untersuchung mit Walzers moderner Theorie des gerechten Krieges eine pragmatische Wende. Walzers Mehrwert liegt vor allem in der Argumentationsform: Nicht mehr die abstrakten ethischen Prinzipien, sondern die moralischen Überzeugungen einer Alltagsmoral – der common sense – sind bei Walzer Grundlage seiner realitätsnahen Theorie. So erschließt sich mit Walzer ein neues Dilemma, nämlich die Unvereinbarkeit von gutem Kämpfen auf der einen und der Notwendigkeit des Siegens auf der anderen Seite. Walzer wird daran zu prüfen sein, wie sich seine Thesen mit den naturrechtlichen Prinzipien verbinden lassen. Insgesamt verlässt Walzer den Raum des ethischen Diskurses nicht.
Erst in Kapitel (5) rücken in einem Zwischenschritt hin zur praktischen Bewertung humanitärer Interventionen neben den genuin ethischen Prinzipien die politischen Institutionen in das Blickfeld; auch deren Verletzung oder Übergehung ist rechtfertigungsbedürftig. Es geht allgemein um den zweiten Teil der These, nämlich den Vorrang der Moral vor dem Recht. Konkret betrifft dies auch die wichtige Frage, wer (neben dem UN-Sicherheitsrat) legitime Autorität sein kann, um eine humanitäre Intervention autorisieren oder selbst durchführen zu dürfen. Die Fragen in Kapitel (5) gehen der Bewertung empirischer Fälle voraus, sie stellen quasi ein Bewertungsraster dar, das einer vorgängigen Klärung bedarf. In Kapitel (6) kommt die Arbeit mit der exemplarischen Bewertung der Kosovointervention der NATO von 1999 in ihr Ziel.
1.3 Zum Begriff der humanitären Intervention
Im weitesten Sinne bezeichnet der Begriff der Intervention jede äußere Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates. So mögen nicht nur wirtschaftliche, diplomatische und politische Sanktionen, sondern auch schon die bloße Androhung von Sanktionen als Intervention begriffen werden. Das Thema der Arbeit legt aber einen engen, idealtypischen Interventionsbegriff nahe, der auf die Legitimitätsproblematik zugeschnitten ist und nicht so sehr auf die empirische Analyse oder andere Fragestellungen.
Die in der Literatur zur Ethik humanitärer Interventionen vorgestellten Definitionen stimmen daher in den wesentlichen Elementen weitestgehend überein, nämlich der unvermeidlichen Souveränitätsverletzung, der militärischen Durchführung und der humanitären Zielsetzung. Wir übernehmen die folgende Definition der NATO-Staaten von 1999; andere Autoren definieren den Terminus ganz ähnlich (vgl. etwa Boyle 2006: 32; Coady 2004: 275; ausführlich Hasenclever 2000: 27-42):
Eine humanitäre Intervention ist eine bewaffnete Intervention in einen ” anderen Staat, ohne die Zustimmung dieses Staates, um (der Bedrohung) einer humanitären Katastrophe zu begegnen, die durch schwerwiegende und flächendeckende Verletzungen der fundamentalen Menschenrechte verursacht wurde.“ (Folscheid 2005: 24)
Wegen ihres militärischen Zwangscharakters sind humanitäre Interventionen eine Form von Krieg und darum prima facie der Begrifflichkeit der Lehre vom gerechten Krieg zugänglich. Sie unterscheiden sich von klassischen militärischen Interventionen dadurch, dass sie eine humanitäre Zielsetzung haben und darin zumindest nicht primär dem Interesse des Interventen gelten (vgl. Hinsch 2005: 211). Nicht unter den Begriff der humanitären Intervention
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: (Humanitäre) Interventionen seit 1970 fallen die bloße Androhung von Gewalt, die militärische Blockade, die Intervention zur Rettung eigener Staatsbürger aus einem fremden Land, nicht-robuste Peacekeeping-Missionen sowie rein humanitäre Hilfslieferungen.
Der enge Definitionsbegriff verstellt die Sicht auf die empirische Basis des Themas. Nur wenige Interventionen, wenn überhaupt, qualifizieren sich so als humanitäre Intervention. Dazu kommt, dass Interventionen in der Politik kaum mit humanitären Missständen und einer korrespondierenden moralischen Pflicht, sondern vorwiegend in sicherheitspolitischer Rhetorik gerechtfertigt werden (vgl. Seybolt 2007: 10). In aller Regel spielen deshalb auch andere Motive als lediglich die Verhinderung schwerer Menschenrechtsverletzungen eine Rolle bei den Beweggründen für eine humanitäre Intervention (vgl. Walzer 1982: 157). Trotzdem gibt es, auch über die Fälle Somalia, Ruanda und Kosovo hinaus, die dem hier vertretenen Begriff einer humanitären Intervention wohl am nähesten kommen, weitere Beispiele. Abbildung (2) gibt eine Übersicht von in der einschlägigen Literatur häufig angeführten Interventionen, die zumindest humanitäre Komponenten hatten. Dahinter steht keine systematische Analyse.
2 Grundlagen und Eckpunkte der Debatte
Die ganze Fachdebatte über die Kosovointervention, die Ausgangspunkt der Untersuchung sein soll, war bzw. ist nicht nur der Sensation eines Krieges auf europäischem Boden geschuldet, sie zieht ihre Kraft aus tieferen Wurzeln: Dem Geltungsanspruch zweier konfligierender Prinzipien des gegenwärtigen Staatensystems, dem sakrosanten Interventionsverbot und dem Menschenrechtsschutz, hinter dem ein zunehmendes globales Menschenrechtsbewusstsein steht.
2.1 Die Debatte um humanitäre Interventionen
Weder war die Kosovointervention 1999 die erste noch war es seither die letzte Intervention im Zusammenhang mit Menschenrechten, aber sie hat die einschlägige Debatte doch nachhaltig aktualisiert. Die Standpunkte waren (und sind immer noch) kontrovers, quer durch alle Denkrichtungen. Madeleine Albright bekräftigte die Pflicht zum Eingreifen: When a clearly recognizable injustice is in progress, and when we as international bystanders are in a position to intervene and prevent it, then it follows that we are under a prima facie obligation to do so“ (Albright, zit. nach Lucas 2003: 75), und es wurde auch bestätigt, dass die Intervention vergleichsweise most successfull“ war (vgl. Fisher 2007). Andere sahen, geschichtsphilosophisch inspiriert, in der Kosovointervention einen entscheidenden Schritt hin zu einer neuen Ordnung, so z.B. aus philosophischer Perspektive der Heidelberger Philosoph Bubner, nach dem dies der erste Krieg der Geschichte war, der im Namen der Durchsetzung von international beglaubigten Rechtsprinzipien erfolgte“ (Bubner 2001: 47) und ähnlich Habermas, der, trotz völkerrechtlicher Bedenken, vom Vorgriff auf eine neue Weltordnung sprach. Gegner der Intervention argumentierten mit völkerrechtlichen Einwänden, warnten vor einer gefährlichen Unterwanderung des bewährten, friedensichernden UN-Systems und hielten, allen voran Noam Chomsky, die Intervention in der Begründung für lügenhaft und in der Sache für einen Fehlschlag mit schrecklichen Folgen“ für die Kosovo-Albaner (Chomsky 2002: 127). Die Kritik wird uns noch kümmern.
Der treffliche Streit war kein Strohfeuer, sondern rührte an die Prinzipien des gegenwärtigen Staatensystems und hält daher an. Auf höchster politischer Ebene artikulierte Kofi Annan wiederholt den Konflikt von Menschenrechtsschutz und Souveränität bzw. Interventionsverbot und stellte die unbedingte Geltung des letzteren in Frage (vgl. Hinsch 2006: 230; Miller 2003: 223). Kanada rief daraufhin die International Commission on Intervention and State
Sovereignty (ICISS) ins Leben, die den maßgeblichen Bericht The Responsibility to Protect“ (2001) herausgab. Darin wird empfohlen, souveräne Rechte an bestimmte Anforderungen an das Verhalten der staatlichen Autoritäten zu binden“ (Hinsch 2006: 231) und es werden Kriterien für die Durchführung humanitärer Interventionen skizziert, die eng an der Lehre des gerechten Krieges liegen.
Als Konsenswerk mit praktischer Stoßrichtung spiegelt der Bericht der ICISS freilich nicht die volle Breite und den Tiefgang der wissenschaftlichen Debatte wieder, die sich zwischen legalistischen, moralisch-philosophischen und politisch-pragmatischen Überlegungen bewegt und in allen Richtungen, wie es scheint, auch die extremen Standpunkte ausreizt. Der Bericht bringt aber die Begriffe auf den Punkt, um die fast jede Untersuchung kreist: Souveränität, Menschenrechte, Völkerrecht und häufig als Analyseraster Jus t War, der gerechte Krieg. – Denn welcher Krieg sollte gerecht sein, wenn nicht die humanitäre Intervention. Die Konfliktvorund vor allem die Nachsorge (Ius post bellum) sind in aller Regel nicht Bestandteil der Debatte um humanitäre Interventionen, auch wenn sie untrennbar damit verbunden sind (vgl. Merkel 2006: 10).
2.2 Die (traditionelle) Lehre vom gerechten Krieg
2.2.1 Historischer Abriss: Kein homogenes Gebilde
Die traditionelle Lehre vom gerechten Krieg ist ein Dauerbrenner abendländischer Kriegsrechtfertigung. Es handelt sich dabei allerdings um kein einheitliches Theoriegebilde, eher um eine Denkrichtung, die Raum gelassen hat für unterschiedliche und sich teils sogar widersprechende Argumentationslinien. Diese verdanken sich den über die Jahrhunderte oft gewandelten Zeitkontexten, divergierender Weltanschauungen und das heißt vor allem der unterschiedlichen Gewichtung von naturrechtlichen, juristischen und theologischen Argumentationen. Im Folgenden sollen – es kann sich dabei nur um einen eiligen Durchlauf handeln – die wichtigsten Stationen bzw. Vertreter der Lehre vom gerechten Krieg angerissen werden. Wir werden darauf noch in der einen oder anderen Weise zurückgreifen.
Erste Formen der Rechtfertigung von Krieg bestanden darin, die Zustimmung der Götter zu erfragen, in der griechischen Antike etwa durch das Orakel zu Delphi (vlg. Janssen 2004: 180). Platon (428-347 v.Chr.) und andere griechische Philosophen haben Ansätze einer ethischen Theorie der Gerechtigkeit von Kriegen“ (ebd.) entworfen. Im Anschluss daran und auf der Grundlage römischen Rechtsdenkens formulierte Cicero (106-43 v.Chr.) die erste zusammenhängende Theorie des gerechten Krieges – Iustum Bellum – und gilt damit als deren eigentlicher Urheber (vgl. Hinsch & Janssen 2006: 52)[2]. Die von ihm begründeten Prinzipien der Notwendigkeit eines gerechten Grundes (justa causa), der legitimen Autorität (auctoritas principas) und die Auffassung, dass Krieg das letzte Mittel (ultima ratio) sein müsse, sind bis heute grundlegend. Mit Augustinus (354-430) wurde die Lehre vor dem Hintergrund eines christlichen Pazifismus weiterentwickelt. Gewalt wurde legitimiert als die Strafmaß- nahme eines fürsorgenden Vaters, womit Augustinus, von der Sorge um das Seelenheil geleitet, die gerechte Gesinnung (intentio recta) der Kriegführenden zur Bedingung für gerechte Kriege einführt (vgl. ebd. 54). Thomas von Aquin (1225-1274) schrieb im frühen Mittelalter die einflussreichste Theorie des gerechten Krieges in der christlichen Tradition“ (ebd.). Unter anderem sieht er nur Fürsten in der Rolle der legitimen Autorität, da diese oberste Wächter der Gerechtigkeit im Gemeinwesen“ (ebd. 54) seien und darin einen durch Gott sanktionierten Auftrag“ (Janssen 2004: 202) ausführen würden.
In der frühen Neuzeit argumentierte der Spanier Francisco de Vitoria (ca. 1490-1546) erstmals konsequent naturrechtlich; Unglaube ist bei ihm kein Grund zur Strafe mehr (vgl. ebd. 210). So seien Interventionen in fremdes Gebiet konkret: Indianergebiete – nur dann zulässig, wenn dort Menschen zu Unrecht an Leib und Leben bedroht“ würden (Hinsch 2006: 55). Endgültig überwunden wurden mittelalterliche Vorstellungen zu Beginn der Neuzeit mit Hugo Grotius (1583-1645). Sein Hauptwerk De Jure Bell i ac Pacis[3] gilt als Grundstein ” des modernen Völkerrechts“ (ebd. 56). Wichtig ist vor allem seine erhellende Unterscheidung moralischer und positiver Rechtsnormen“ (Janssen 2004: 216)
– beide seien bei der Beurteilung eines Krieges zu berücksichtigen. Das ist im Wesentlichen die Ausgangslage für die Untersuchung hier. In der folgenden Zeit wurde das Ius in bello juristisch weiterentwickelt, während moralische Fragen in der Zeit der Kabinettskriege in den Hintergrund traten (vgl. Krause 1998: 41). Kant, der nicht in die Tradition des gerechten Krieges gehört, wird unten noch Erwähnung finden und Michael Walzer ohnehin.
2.2.2 Struktureller Kern: Kriterien des gerechten Krieges
Die lange und mannigfaltig beeinflusste Genese der Theorie legt es nahe, von einer Iustum Bellum-Tradition zu sprechen und den Begriff Lehre vom gerechten Krieg‘, der eine kohärente Theorie suggeriert, für die wenigen Krite- rien legitimer Gewaltanwendung zu reservieren. Diese bilden gewissermaßen den strukturellen Kern, in dem die verschiedenen Überlegungen dieser Denktradition zusammenlaufen. Folgende fünf, hier möglichst allgemein dargestellte Kriterien machen den Kern der Lehre vom gerechten Krieg aus:[4]
1. Gerechter Grund (iusta causa): Die Anlässe, für die mit militärischen Mitteln gestritten werden darf, werden auf schwerwiegende Rechtsverletzungen eingegrenzt.
2. L e gitime Autorität (auctoritas principas): Der Kreis derer, die prinzipiell zur Gewalt bemächtigt sind, wird auf relativ wenige, verantwortungsfähige Akteure eingeschränkt; das Kriterium ist auch ein Ordnungsprinzip.
3. Gerechte Intention (intentio recta): Nur eine Handlung, die aus moralisch achtbaren Motiven erfolgt, ist moralisch gut. Das Kriterium verpflichtet zur Gerechtigkeit und schließt andere Motive, wie Rache oder strategische Zwecke, aus.
4. Notwendigkeit (ultima ratio): Krieg und einzelne Kriegshandlungen sind Mittel, um die gerechte Ordnung wiederherzustellen und können daher, weil sie diese grundsätzlich stören, nur das äußerste Mittel sein.
5. Proportionalität: Die Kriegsmaßnahmen müssen in ihren negativen Folgen in einem angemessenen Verhältnis zum gerechten Grund stehen. Die positiven Folgen müssen die negativen deutlich überwiegen.
Die ersten vier Kriterien beziehen sich vor allem auf das Recht zum Krieg (Ius ad bellum), die beiden letzten auf das Recht im Krieg (Ius in bello). Manche Autoren schließen in die Liste noch andere Kriterien ein, wie etwa die Non- Kombattanten-Immunität und die berechtigte Aussicht auf Erfolg, die sich aber aus den aufgeführten Kriterien explizieren lassen.
Inhaltlich wurden diese Kriterien über die Zeit unterschiedlich begründet und ausgelegt, wie eine kurze Betrachtung zeigen mag. Als legitime Autorität etwa galt, gerade im Investiturstreit im 11. und 12. Jahrhundert, für die klerikalen Gelehrten nur der Papst als oberster Hüter des Glaubens, für das Gegenlager nur der Kaiser, der für die politische Ordnung die Verantwortung trug (vgl. Janssen 2004: 193). Gratian (ca. 1090-1155) wiederum sprach nur den Fürsten legitime Autorität zu. Er betrachtete Kriege als einen Ersatz für Gerichtsprozesse“ (Janssen 2004: 194), und die Fürsten waren dabei Richter und Vollstrecker in einem, was freilich, so Janssen, eine fragwürdige Ansicht“ und nur dadurch denkbar sei, dass der Fürst aufgrund seiner offziellen Position“ (ebd. 194) zu unparteiischen Entscheidungen fähig sei.
Ähnlich bei Grotius, wo die legitime Autorität nurmehr eine durch die Souveränität bereits eingelöste Vorbedingung ist, die mit keiner besonderen Richterqualität einhergehen muss.[5] Damit hatte auch eine Verschiebung in der Bedeutung der Kriterien für die Legitimität eines Krieges stattgefunden. Das für die christlichen und Augustinus verpflichteten Gelehrten hinsichtlich der Heilserwartung so wichtige Kriterium der gerechten Absicht oder der rechten Gesinnung“ (Hinsch 2006: 57) wurde von Grotius endgültig in den Bereich des persönlichen Gewissens“ (ebd.) verbannt, da juristisch nicht überprüfbar ” und deswegen nicht relevant. Zentrale Bedeutung erhielt dagegen die Existenz eines gerechten Grundes, der einerseits schon immer in der schweren Verletzung eines Rechts oder der Abwehr eines Unrechts gesehen wurde, andererseits aber konzeptionell nie richtig klargestellt wurde (vgl. ebd. 68).
2.2.3 Anwendbarkeit auf humanitäre Interventionen
Humanitäre Interventionen treten in der Iustum Bellum-Tradition nicht explizit auf, und daher ist die Frage, inwiefern die Lehre des gerechten Krieges ein geeignetes Analyseraster für die Untersuchung deren Legitimität sein kann. Offensichtlich können die konkreten, teils widersprüchlichen Inhalte nicht das Entscheidende sein. Dass die Lehre so lange überlebt hat – das frühe Christentum, den westfälischen Frieden, das UN-System – deutet vielmehr darauf hin, dass ihre Stärke in der formalen Struktur und der moralischen Argumentationsweise liegt. Hier ergeben sich m. E. vier fruchtbare Anknüpfungspunkte für die Untersuchung der Legitimität humanitärer Interventionen.
Erstens finden sich in der Iustum Bellum-Tradition durchaus Ansätze humanitärer Interventionen. Bei den antiken Griechen galt die Hilfe für Bundes genossen und Verwandte“ als gerechter Grund zum Krieg (Janssen 2004: 180), bei Vitoria rechtfertigt die grobe Verletzung von Naturrechten bei Indianern gewaltsame Hilfe (vgl. Janssen 2004: 210). Mehr oder weniger ausdrücklich ist auch bei Grotius die Rede von einem Recht auf humanitäre Intervention. In De Jure Bell i ac Pacis argumentiert er, dass eine Intervention da erlaubt sei, wo ein Tyrann so schweres Unleid über seine Untertanen bringe as no one is warranted in inflicting“ (Grotius, zitiert nach Holzgrefe 2003: 26). Ein zweiter
Anknüpfungspunkt hängt unmittelbar damit zusammen und liegt darin, dass die Iustum Bellum-Tradition neben ihrem analytischen Kern eine Fundgrube von Ideen über die Rechtfertigung von Gewalt bietet.
Wichtiger ist aber, dass, drittens, humanitäre Interventionen und die Lehre vom gerechten Krieg ein gemeinsames Anliegen haben: Die Vermeidung menschenrechtsverletzender Gewalt. Die Lehre vom gerechten Krieg als Wegbereiter von Gewalt zu verstehen, hieße ihren Sinn zu verkennen, denn seit dem Mittelalter ging es in dieser Doktrin darum, extrem zugespitzte Kriterien zu formulieren, die, sollten sie erfüllt sein, den Griff zum Krieg gerade noch erlaubten“ (Senghaas 2000: 99). Ähnlich auch Coady:
The ethic of the ” just war is restrictive“ (Coady 2004: 279). Bei humanitären Interventionen ist die Gewaltminimierung unabdingbar, besteht doch im Schutz grundlegender Menschenrechte ihr gerechter Grund. Damit ist unmittelbar ein vierter Anknüpfungspunkt angesprochen, nämlich die Orientierung am Naturrecht, die einen Vorrang der moralisch-naturrechtlichen vor politischen und juristischen Argumentationsformen nahelegt. Andere Bezugspunkte wie positives und Gewohnheitsrecht werden dabei nicht ignoriert, sondern in Verhältnis zu den moralischen Forderungen gesetzt. Gerade Grotius bringt diesen Aspekt der Lehre vom gerechten Krieg deutlich zur Geltung mit der Auffassung, dass neben den positiven Rechtsnormen, die durch Gewohnheit und Übereinkunft ” entstehen [...], ein moralischer unveränderlicher Rechtsbereich bestehen bleiben“ muss (vgl. ebd. 216, 217). Damit kommt auch die Argumentation dieser Arbeit auf ihre Schiene.
In der gegenwärtigen Fachliteratur erfreut sich die Lehre des gerechten Krieges einer regen Rezeption. Das gilt besonders für die US-amerikanische Diskussion, da die Vorstellung des gerechten Krieges in der Form der gerechten Intervention [...] maßgeblich zum außenpolitischen Selbstverständnis der >USA“ gehörte (Krause 1998: 42), und dann aber allgemein auch für die Zeit seit Ende des Kalten Krieges, als die Durchsetzung der Menschenrechte ins Bewusstsein einer kritischen Weltöffentlichkeit gelangte. Neuere Beispiele für Autoren, die sich explizit auf die Lehre vom gerechten Krieg berufen, sind etwa Haspel (2002), Coady (2003), McMahan (2005), Seybolt (2007), Weigel (2007) und die ICISS (2001).
2.3 Menschenrechte als gerechter Grund
Der gerechte Grund für eine humanitäre Intervention kann nur in schweren Menschenrechtsverletzungen liegen. Dabei sind zwei Forderungen zu stellen und nachzuweisen: Diese Menschenrechte müssen universal und verbindlich gelten, um eine belastbare Rechtfertigungsgrundlage abzugeben und es muss sich um Rechte handeln, die so grundlegend sind, dass ihre Verletzung moralisch schwerwiegt.
2.3.1 Die universale Gültigkeit der Menschenrechte
Historisch betrachtet ist die Herausbildung der Menschenrechte [...] unauflös- ” lich mit der Entwicklung des modernen Staates verknüpft“ (vgl. Hasenclever geschrieben sind. Aber dieses 2000: 125). Es handelt sich um Abwehr-, Teilhabeund Anspruchsrechte, die dem absolutistischen Staat abgerungen wurden. Insofern haben wir sie heute als positive Rechte, die ihre Wirkung in der Beziehung von Bürger und Staat entfalten und die durch verschiedene Konventionen auch im Völkerrecht festwesentlich positiv-rechtliche Verständnis von ” Menschenrechten“ (Hinsch 2006: 71) kann hier nicht maßgebend sein, denn es würde erstens die Menschenrechte auf eine Stufe mit anderen positiven Rechten stellen und zweitens Zweifel an deren Allgemeingültigkeit hervorrufen. Menschenrechte sollen jeden Menschen schützen und das heißt auch jeden Staat verpflichten, unabhängig davon, ob der Staat sie anerkennt oder nicht. Andererseits kann auch der Konsens über die Gültigkeit von bedrock standards“ (vgl. Martin 2005: 448) wie das allgemeine Wohl oder persönliche Autonomie nicht die Grundlage sein, weil ein Konsens immer anfechtbar ist und weil daraus alle möglichen Rechte folgen mögen. Der entscheidende Punkt ist, dass Menschenrechte begründungstheoretisch und rechtsdogma tisch“ (Hasenclever 2000: 125) als unhintergehbare Rechte zu betrachten sind, die zeit-, konsensund kontextunabhängig gelten. Das können nur moralische Rechte leisten, die universal, egalitär und unveräußerlich gelten. Wie holt man diesen Anspruch ein?
Begründungstheoretisch liegt die Universalisierung im Begriff des Menschen, also in Bestimmungen, die dem Menschen als Menschen und darum jedem Menschen zukommen“[6] (Anzenbacher 2002: 330). Der Grund liegt in der unveräußerlichen Würde des Menschen, und daraus folgt mehr oder weniger direkt alles Weitere. Mit der Würde sind bestimmte Rechte verbunden, die ein menschenwürdiges Dasein“ (ebd. 349) garantieren sollen und die ” unter normalen Umständen keinem menschlichen Leben vorenthalten werden dürfen“ (Hinsch 2006: 76). Zu diesen fundamentalen Bedingungen gehören im Kern das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit (ebd. 72). Unter Berücksichtigung der politischen Verfasstheit menschlichen Zusammenlebens muss man dazu wohl auch die Grundkategorien“ Gleichheit und Teilhabe hinzufügen ” (Delbrück 1996: 24); ein Recht auf Leben und Freiheit haben ja auch Affen.
Natürlich sind die Menschenrechte im Allgemeinen konsensfähig, denn hinter ihnen stehen Werte wie Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde (vgl. Brugger 1998: 189). Die Rede von Werten darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Menschenrechte ihrem Kern nach Anspruchsrechte‘ (cl- ’ aim-rights)“ sind (Hinsch 2006: 74), denen notwendigerweise Pflichten gleichen Inhalts korrespondieren“ (ebd. 75). Das Recht auf persönliche Freiheit etwa hat sein logisches Pendant im Verbot der Sklaverei, das Recht auf Leben verbietet das Töten und so weiter. Prinzipiell konstituieren sich aus diesen negativen und positiven Pflichten die Regeln einer Gesellschaft (vgl. Hinsch 2006: 73-75). Menschenrechte können daher durch gesellschaftlichen Ausschluss verletzt werden, selbst wenn die physische Integrität noch garantiert ist.
2.3.2 Was ein Menschenrecht grundlegend macht
In Anbetracht des großen Bestandes positiver Menschenrechtskodifizierungen ist offensichtlich, dass nicht jedes Menschenrecht so grundlegend und moralisch schwerwiegend ist, um sich als Anlass einer gewaltsamen Intervention qualifizieren zu können. Hinsch nennt drei Kriterien, die jedes für sich ein Menschenrecht als grundlegend erscheinen lassen (Hinsch 2006: 78-80): (1) Die Verletzung des Menschenrechts bedeutet ein besonders schlimmes und für die Betroffenen unmittelbar mit großem Leid verbundenes Übel.“ (2) Der Verlust dieses Menschenrechts bedeutet, dass mit ihm auch alle anderen Rechte ihren Wert verlieren; wessen körperliche Unversehrtheit beispielsweise nicht gesichert ist, der kann aus Angst vor Einschüchterung auch keine Meinungsfreiheit und kein Wahlrecht ausüben. (3) Die Geltung des Menschenrechtes ist Voraussetzung dafür, um mit Rawls von einer minimalen achtbaren Ordnung“ in einer konkreten Gesellschaft sprechen zu können.
Schon Kriterium (1) lässt eigentlich nur das Menschenrecht auf Leben, Freiheit und Sicherheit übrig, das durch Mord, Vertreibung und Vergewaltigung verletzt wird. Rechte, die Kriterium (1) erfüllen würde, nicht aber Kriterium (2), wären insbesondere einige Menschenrechte aus dem sozialen Bereich, etwa das Recht auf Arbeit, Wohnung und Unterhalt. Ihr Verlust bedeutet nicht zwangsläufig den totalen Verlust der Freiheitsrechte; so sind etwa Bettler auch dann noch vor Gewalt geschützt, wenn es kein Sozialsystem gibt. Soziale Grundrechte scheiden daher aus. Kriterium (3) meint zunächst einmal die Augenfälligkeit einer Menschenrechtsverletzung, rührt ansonsten aber an die Legitimität eines Staates und wird daher unten noch aufgegriffen werden.
2.4 Staatssouveränität als gewichtiger Gegengrund
Humanitäre Interventionen verletzen qua Definition staatliche Souveränität. Ihre Legitimitätsproblematik kann also nicht verstanden werden, ohne ein Bild von der moralischen Bedeutung innerer und äußerer staatlicher Souveränität (der das Interventionsverbot korrespondiert) zu haben.
2.4.1 Souveränität durch innere Legitimität
Etymologisch deutet der Begriff Souveränität auf eine Hoheit und Würde hin, die unantastbar sind und keine Verletzung dulden. Doch schon Bodin, auf den das Konzept der Souveränität maßgeblich zurückgeht, unterwirft [...] den Souverän rechtsmoralischen Verbindlichkeiten, nämlich göttlichen Geboten und Naturrecht“ (Höffe 2000: 174). In den neuzeitlichen Staatsbegründungen wird der Zweck des Staates überwiegend vom Volk her bestimmt. Seine Legitimität, auf die sich die Souveränität stützt, ist entweder in some way derived from the will of the people“ (Mehta 2006: 264), sie ergibt sich aus dem großen Wert politischer Selbstbestimmung“ (Hinsch 2006: 82) bzw. deren Qualität oder aus der staatlichen Fürsorge. Daher scheint das Resümee von Höffe zumindest in theoretischer Hinsicht zutreffend, Souveränität sei nie eine absolute, uneingeschränkte Hoheitsgewalt“ (Höffe 2000: 174) gewesen. Wichtig für diese Untersuchung ist, dass in diesen Begründungen moralische Argumente mitschwingen, die auch moralisch verhandelt werden müssen.
2.4.2 Souveränität als Bedingung internationaler Stabilität
Anders liegt die Sache bei der äußeren Souveränität. Sie hat vor allem ” pragmatisch-politischen Gründen“ (Hinsch 2006: 82) eine große Bedeutung für die Stabilität und den Frieden in den Internationalen Beziehungen. Ihre Manifestation im Nicht-Interventionsprinzip ist ein Eckpfeiler des geltenden UN- Staatensystems. Die Pointe ist, dass die äußere Souveränität in dieser Funktion vollkommen unabhängig von ihrem inneren moralischen Wert ihren friedensichernden Zweck erfüllt; ihre Begründung kann, wie wünschenswert dies für die Menschenrechte wäre, nicht auf die innere Legitimität gestützt werden (wie etwa bei Teson 1997: 98). Auch diese Argumentationslinie ist alt, es ließen sich unter anderem Wolff, Grotius und Vattel anführen. Der Sache nach geht es beim Interventionsverbot um eine Schutzvorrichtung, die schwache Staaten vor stärkeren schützt (vgl. Mehta 2006: 263). Das geschieht nun freilich in precisely for the sake of the peace and security of its in- ” habitants“ (Lucas 2003: 81). Darum hat das Interventionsverbot zu Recht den principial axioms of the international community“ (Mehta 2006: ” 262), an dessen Wünschbarkeit keine Zweifel haften und das mithin deutlich weniger verrückbar ist als die innere Souveränität. Durch den indirekten Bezug auf die Menschenrechte hat es auch moralischen Wert. Summa summarum entspricht es der gegenwärtig geltenden rechtlichen und politischen Auffassung, den Wert des Interventionsverbots sehr hoch anzusetzen. Verstöße dagegen sind ohne schweren Anlass und ohne belastbare Rechtfertigung nicht denkbar.
3 Moralphilosophische Analyse
Die Lehre des gerechten Krieges enthält Kriterien, die das Recht zum Krieg (Ius ad bellum) und solche, welche die gerechte Durchführung (Ius in bello) betreffen. Beide müssen erfüllt sein. Ausgangspunkt der moralphilosophischen Analyse, die zunächst selbst Gegenstand einer knappen Vorbetrachtung ist, soll ein häufiges Rechtfertigungsszenario humanitärer Interventionen sein, nämlich die Nothilfe als logische Erweiterung der Notwehr. Am Nothilfeszenario werden die Kriterien der legitimen Gewaltanwendung in ihrer allgemeinen Form gezeigt. Im Anschluss daran werden mit dem Dilemma der Tötung Unschuldiger (Non-Kombattanten-Schutz) und anhand des anti-interventionistischen Arguments vom Staat als Person die zentralen ethischen Probleme des Ius in bello respektive des Ius ad bellum entfaltet. Es mag verkehrt erscheinen, das Ius ad bellum nach dem Ius in bello zu betrachten, aber eine von den naturrechtlichen und genuin ethischen Prinzipien zu mehr rechtsphilosophischen Konzeptionen fortschreitende Argumentation legt diese Ordnung nahe.
3.1 Methode: Abstrakte Moralphilosophie
Die Wahl der moralphilosophischen Methode ist begründungsbedürftig. Ob eine humanitäre Intervention legitim ist oder nicht, lässt sich schwerlich allein in genuin ethischen Kategorien fassen. Rechtliche und politische Überlegungen spielen ebenso eine wichtige Rolle, und in der praktischen Konzeption und Durchführung einer humanitären Intervention bilden sie vermutlich die leitenden Gesichtspunkte. Trotzdem führt an der ethischen Rechtfertigung kein Weg vorbei: Humanitäre Interventionen sind gewaltsame Aktionen, welche Staatsund vor allem Menschenrechte verletzen. Sie verstoßen gegen das allgemeine, rechtlich wie ethisch anerkannte Gewaltverbot. Sie gelten dem Schutz menschlichen Lebens, und sie bedrohen dieses gleichzeitig in ihrem Vollzug. Sie bergen daher einen Widerspruch fundamentaler ethischer Prinzipien in sich. Es ist evident, dass militärische Interventionsmaßnahmen daher besonders rechtfertigungsbedürftig sind, nämlich im moralphilosophischen Rückgriff auf eben jene Prinzipien, die jedem positiven Recht vorausgehen.
Die moralphilosophische Methode, jedenfalls wie wir sie hier verstehen wollen, zeichnet sich durch einen hohen Grad an Abstraktion und die Bezugnahme auf fundamentale und nicht hintergehbare ethische Normen und Prinzipien
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Tr ennlinien der ethischen Argumentation aus. Sie ist in diesem Sinne dogmatisch. Mit den ethischen Normen sind die grundlegenden Menschenrechte, also das Recht auf Leben, Sicherheit und Freiheit gemeint. Die moralphilosophischen Prinzipien sind: Kants Zweck-an-sich- Formel; allgemeiner das Prinzip, dass ein guter Zweck keine schlechte Handlung erlaubt (vgl. Finnis 1996: 29); das Prinzip der Wechselseitigkeit; das allgemeine Wohl; die Gleichheit aller Menschen; und damit verbunden Gerechtigkeit. Sie alle haben transzendentalen Charakter und bilden die Grundlage für die folgende Analyse. So abstrakt diese Prinzipien sind, so situationsunabhängig ist auch die Argumentation. Die moralischen Konflikte werden in idealtypischer Form verhandelt, d.h. als Konflikt ethischer Grundsätze, denn nur so ist es möglich, direkt auf den Kern der Problematik durchzugreifen ohne sich im Wirbel nebenrangiger Detailund Anwendungsfragen zu verheddern. Weil die Grundsätze für sich genommen unhintergehbar sind, stellen die Probleme Dilemmata dar und können deswegen nur schwerlich restlos aufgelöst werden. So geht es im Folgenden mehr um begriffiche Klarheit und eine Annäherung an vertretbare Argumente, als um definitive Lösungen. Alles andere wäre ein Zeichen für schlechte Philosophie. Der moralphilosophische Ansatz schließt die Reflexion auf seine Grenzen mit ein und ist insofern nicht nur Mittel, sondern auch, wenngleich in abgestufter Bedeutung, Gegenstand der Untersuchung.
Innerhalb der philosophischen Argumentationsweise sind wiederum diverse Ansätze zu unterscheiden. Abbildung (3)[7] gibt einen Überblick über eine mögliche dichotomische Systematisierung der gängigsten und wohl auch wichtigsten Trennlinien. Es würde hier den Rahmen sprengen, allen Kategorien im Einzelnen nachzugehen. Wir beschränken uns daher auf eine bestimmte Perspektive und gewinnen dafür an theoretischer Stringenz. Die Wahl ist nicht beliebig: Ausgehend von einer Perspektive grundlegender und naturrechtlich begründeter Menschenrechte, bleibt uns fast nichts anderes mehr übrig, als uns auf einen Standpunkt zu stellen, der durch alle links genannten Bestimmungen charakterisiert ist. Diesen Standpunkt könnte man als die naturrechtliche Argumentationsform bezeichnen. Andere ethische Argumentationsformen, die sich aus verschiedenen Kombinationen der aufgeführten Attribute ergeben und die im Folgenden allenfalls als Kontrast herangezogen werden sollen, wären etwa die vertragstheoretische (etwa Rousseau, Hobbes), die gerechtigkeitstheoretische (Rawls), die utilitaristische (Mill, Bentham) und die legalistisch-positivistische Argumentationsform.
Die naturrechtliche Argumentationsform greift auf universale und egalitäre Naturrechtsnormen zurück. Das sind die grundlegenden Menschenrechte. So wie die naturrechtliche Argumentationsform in diesen Normen verankert ist, so tritt sie mit dem Anspruch auf, dass auch ihre Schlussfolgerungen universal gelten, wobei allerdings denkbar ist, dass am Ende nicht nur Individuen, sondern als rechtliches Derivat auch einer Gruppe von Menschen, etwa dem Staat, gewisse Rechte zugesprochen werden. Die naturrechtliche Argumentationsform trägt zudem rechtsethischen Charakter, d.h. sie zielt auf wechselseitig verbindliche Forderungen (was schulden wir uns gegenseitig?) und nicht auf die unverbindliche Frage nach dem guten, tugendhaften Leben, die eine rein persönliche Angelegenheit ist (was ist vorbildlich? was macht glücklich?).
3.2 Interventionen nach dem Konzept der Nothilfe
Zur ethischen Begründung humanitärer Interventionen und der Rechtfertigung militärischer Gewalt wird der Sachverhalt in der Literatur häufig auf das Szenario der Nothilfe reduziert.[8] An ihm lassen sich die Kriterien des gerechten Krie ges plausibel machen und begründen. Coady bezeichnet das Nothilfeszenario als eine powerful moral intuition“ (Coady 2004: 280), was eine konsensualisti sche Begründung impliziert. So wird das Nothilfeszenario auch häufig gehandhabt: als Appell an die unmittelbare moralische Einsicht in das Richtige. Dies funktioniert meist und trägt sicherlich zur Popularität des Konzepts bei. Doch das Prinzip der legitimen gewaltsamen Verteidigung hilfsbedürftiger Menschen gegenüber Aggressoren ist dessen ungeachtet well established in traditional rights theory, going back to the times of Hobbes and Locke“ (Martin 2005: 444). Es handelt sich also, und das soll gezeigt werden, um mehr als eine moralische Intuition. In einem Satz ausgedrückt, besagt das Prinzip der Nothilfe, dass die Anwendung von Gewalt zum Schutz von Leben unter bestimmten Umständen legitim ist, und zwar auch dann, wenn dabei an sich unhintergehbare Rechte des Aggressors verletzt werden.
Das Nothilfeszenario ist gleichwohl nur eine Ausgangslage für die Begründung humanitärer Interventionen. Seine Kriterien sind zunächst lediglich die Dimensionen, in denen der moralische Sachverhalt abgesteckt und vermessen wird. Es handelt sich um eine der Praxis vorgängige, schablonenhafte Rechtfertigung. Zweitens setzt das Nothilfeszenario auf der Ebene der Individuen an, und die an der persönlichen Nothilfe gewonnenen Einsichten werden dann mittels – meist impliziter – Analogie auf die staatliche Ebene übertragen. Das ist natürlich nicht dasselbe. Menschenrechte und Staatsrechte sind auf eine Weise miteinander verwoben, die vom Nothilfeszenario nicht eingefangen wird. Die Analogie von Person und Staat führt begrifflich sogar in ein Paradoxon und sachlich auf ein anti-interventionistisches Argument (Staat als Person), das uns zuletzt noch kümmern wird.
3.2.1 Das Recht zur Hilfe (Ius ad bellum)
Nothilfe bezeichnet stets eine gewaltsame Hilfsleistung, welche die leibliche Integrität anderer Menschen verletzt. Was kann zur Nothilfe verpflichten bzw. berechtigen, wenn diese so offensichtlich dem allgemeinen Gewaltverbot wider spricht? Zunächst einmal kann Nothilfe als ” 2006: 44) der Goldenen Regel und des zweiten alttestamentlichen Gebotes von der Nachbarliebe verstanden werden, beides durchaus anerkannte Prinzipien. Die Goldene Regel bringt das Prinzip der Wechselseitigkeit zum Ausdruck, das Gebot der Nächstenliebe erinnert zumindest an das allgemeine Wohl und ist deshalb naturrechtlich nicht ganz unplausibel. Doch diese Prinzipien sind noch nicht tragfähig, denn sie erklären nicht, ob man (a) für die Hilfe auch Gewalt anwenden darf (vgl. Boyle 2006: 44) und (b) ob man nicht nur den Bruder oder allgemein Schutzbefohlene, sondern auch fremde Menschen und deren ” Rechte“ (Höffe 2000: 169) mit Gewalt verteidigen darf, sprich ob das Recht oder die Pflicht universal gilt. Darin liegt in naturrechtlicher Perspektive das Problem dieser prima facie akzeptablen Prinzipien.
Boyle hat darauf mit einem negativen Argument geantwortet. Die (naturrechtliche) Theorie des gerechten Krieges betrachte nicht Menschen einer bestimmten Gemeinschaft, sondern human beings welfare and interests“ (Boyle 2006: 44) allgemein, ziele also auf die universal gültigen Menschenrechte, und any reasonable limitation“ (ebd. 45) auf bloße Selbstverteidigung könne sich ” daher nur aus einem Defizit an legitimer Autorität oder gerechter Absicht ergeben. Der Verweis auf die universal gültigen Menschenrechte ist richtig, und auch das allgemeine Wohl klingt hier als Argument an, aber die Rechtmäßigkeit der universalen Gewaltanwendung, d.h. das Recht, Gewalt als Mittel einzusetzen, ist damit noch nicht gezeigt. Die Kriterien der gerechten Absicht und der legitimen Autorität können hier nichts beitragen, denn es sind keine grundlegenden, sondern sekundäre und hochgradig klärungsbedürftige Prinzipien.
Das Recht zur Nothilfe kann daher nur als ” wehr“ (Höffe 2000: 169) schlüssig begründet werden, d.h. durch den Schluss von der Rechtmäßigkeit der gewaltsamen Selbstverteidigung auf die gewaltsame Fremdverteidigung. Dabei spielt das rechtsethische Prinzip der Wechselseitigkeit und der Bezug auf die Gleichheit aller Menschen eine wichtige Rolle. Wenn Gewalt in Notwehr legitim ist, dann auch in Nothilfe, weil naturrechtlich zwischen Ich und Du eine strenge wechselseitige Gleichheit bzw. einfacher gesagt, kein Unterschied besteht. Die Lebensrechte eines anderen wie des eigenen Lebens hängen nicht an subjektiver Wertschätzung wie bei der Goldenen Regel (ich möchte [nicht] leben, also verteidige ich auch dich [nicht]), sie verpflichten gegenüber jedem qua ihrer universalen Gültigkeit (dein Recht auf Leben, meine Pflicht zur Hilfe). Damit ist die Pflicht und vor allem das Recht zur Nothilfe begründet.
[...]
[1] Die deutsche Ausgabe (1982) trägt den Titel ” es den gerechten Krieg?“, was insofern irreführend ist, als es den gerechten bzw. den rechtfertigbaren Krieg für Walzer durchaus gibt; der Zweite Weltkrieg war für Walzer das Paradebeispiel für einen gerechten Krieg (aus Sicht der Alliierten).
[2] Im Folgenden der Kürze halber nur noch Hinsch.
[3] Dieses Buch wurde schon zu Grotius’ Lebzeiten ein ” erk für Fragen des Standardw Von dem Schwedenkönig Gustav wird be Kriegsrechts“ unter den Völkerrechtsjuristen. ” richtet, dass er stets eine Kopie dieses Werkes bei seinen Feldzügen mit sich führte“ (Janssen 2004: 176).
[4] Einen Überblick mit Ausführungen zu den einzelnen Kriterien geben u.a. Coady (2003: 279), Boyle (2006: 35 ff) und Hinsch (2006: 67 ff).
[5] Grotius hatte erkannt, dass das Problem der kriegführenden Autorität nicht so sehr über ” Gerechtigkeit des Kampfes als über seinen Status entschied“ (Janssen 2004: 216). Indem nur ein Souverän Krieg erklären und führen durfte, waren Kriegsformen wie der Piraten-, der Rebellenoder Bürgerkrieg prinzipiell illegitim.
[6] Ob die Menschenrechte klassisch wie bei Thomas durch das anthropologische oder in der neuzeitlichen Tradition von Locke, Rousseau und Kant durch das vertragstheoretische Naturrechtsdenken begründet werden, ist dabei nebenrangig (vgl. Anzenbacher 2002: 355).
[7] Quelle: Holzgrefe (2003: 18 ff); die Unterscheidung nach dem Ziel der Moral ist eine eigene Ergänzung.
[8] Vgl. Meggle (2000: 140), Höffe (2000: 170), Senghaas (2000: 99 ff), um nur einige zu nennen. Daneben sind auch andere argumentative Zugriffe auf die humanitäre Intervention möglich, etwa über friedenspolitische Überlegungen oder, in neuerer Zeit, direkt über einen minimalistischen Menschenrechtsbegriff (vgl. Kersting 2000: 237-240). Der ethische Kern erschließt sich m. E. aber am klarsten über die Nothilfe und die Lehre des gerechten Krieges, an der die anderen Argumentation nicht wirklich vorbeikommen.
- Arbeit zitieren
- Torben Büngelmann (Autor:in), 2007, Die Legitimität humanitärer Interventionen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115942
Kostenlos Autor werden



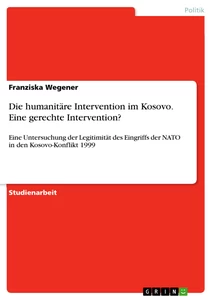







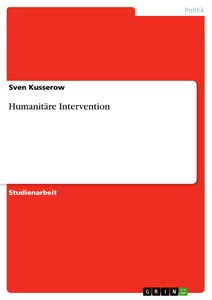










Kommentare