Leseprobe
GLIEDERUNG
I Einleitung
II Merkmale der beiden Sprachen
II.1 Lautsprache
II.1.1 Phonologie
II.1.2 Morphologie
II.1.3 Syntax
II.1.4 Semantik
II.1.5 Pragmatik
II.2 Gebärdensprache
II.2.1 Die Phonologie
II.2.2 Morphologie
II.2.3 Syntax
II.2.4 Semantik
II.2.5 Pragmatik
III Lokalisierung der Sprachzentren
IV Die kognitiven Verarbeitungsprozesse im Vergleich
V Sprachstörungen bei Verletzungen der Hemisphären
VI Schlussbemerkung
VII Literaturverzeichnis
VIII Abbildungsverzeichnis
I Einleitung
In dieser Arbeit möchten wir auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufgrund der unterschiedlichen Modalität von Laut- und Gebärdensprachen eingehen, indem wir zuerst die Merkmale der verschiedenen Sprachsysteme erläutern und anschließend auf die kognitiven Verarbeitungsprozesse eingehen. Hierzu ist es sicherlich hilfreich, wenn kurz darauf eingegangen wird, wo sich das Sprachzentrum im Gehirn befindet und ob es dort zwischen den beiden Sprachen Unterschiede gibt.
Als weiteren interessanten Punkt wollen wir die unterschiedlichen Sprachstörungen ansprechen, die sich bei Schädigungen des Gehirns sowohl auf die Gebärden- als auch auf die Lautsprache auswirken. Hierbei scheint es wichtig zu sein, zu unterscheiden, welche Sprachfehler aufgrund welcher verletzten Region auftreten. Abschließend wollen wir kurz auf einige Punkte aufmerksam machen, die in der Literatur nicht eindeutig zu sein scheinen und eine zusammenfassende Stellungs-nahme ergänzen.
II Merkmale der beiden Sprachen
In dem ersten Abschnitt unserer Arbeit wollen wir die Grundstrukturen von Laut- und Gebärdensprache skizzieren, um einen Einblick in diese beiden Sprachsysteme zu geben.
Allgemein soll Sprache hierbei „als konventionelles Zeichensystem definiert werden, dessen Elemente eine bestimmte Struktur aufweisen, nach bestimmten Regeln miteinander verknüpft werden und im Sinne der symbolischen Interaktion der zwischenmenschlichen und intrapersonellen Verständigung dienen“ (Wisch 1990: 21).
II.1 Lautsprache
Als erstes werden nun die strukturellen Grundlagen der Lautsprache erläutert, um diese dann auch bei der Gebärdensprache zu untersuchen.
II.1.1 Phonologie
Wenn die Phonologie der Lautsprache betrachtet werden soll, muss streng genommen auch die Phonetik berücksichtigt werden, da diese beiden Teilgebiete sehr häufig miteinander verflochten sind. Die Phonologie betrachtet die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten, aus denen sich Sprache zusammensetzt. In der Phonetik geht es um die Umsetzung dieser abstrakten Einheiten in die Form von konkreten Äußerungen. Hier soll kurz erwähnt werden, dass die Phonetik in drei Teilgebiete unterteilt werden kann: 1. die auditive Phonetik, die sich „mit der Rezeption und Analyse sprachlicher Zeichen durch Ohr, Nervenbahnen und Gehirn“ befasst (Wisch: 22), also mit der Wahrnehmung von Lautsprache. 2. die akustische Phonetik, für die „die Laute in ihren physikalischen Eigenschaften wie Intensität, Frequenz und Dauer im Vordergrund“ stehen (Wisch: 22), d.h. das erzeugte Produkt des Sprechapparats. Und 3. die artikulatorische Phonetik, die „die physiologischen und aerodynamischen Gegebenheiten, die bei der Produktion von Lautsprache eine Rolle spielen“, untersucht (Willi in Linke 2001: 402).
Die Phonologie beschäftigt sich hingegen mit den Lauten, die von einem Sprecher einer bestimmten Sprache geäußert werden, und untersucht diese als Elemente des Lautsystems. Das Phoneminventar besteht aus Phonemen von Konsonanten und Vokalphonemen. Die klassifizierende Darstellung der Vokale wird in der Form des Vokalvierecks (Abb.1) realisiert:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1
Hierbei sind folgende Anordnungsmerkmale gegeben: Die Stellung und die Höhe der Zunge, die Rundung der Lippen und die Länge des Vokals, wobei die Höhe der Zunge mit der Mundöffnung korrespondiert (geöffneter Mund – tiefe Zunge, z.B. bei [a]; „geschlossener“ Mund – hohe Zunge, z.B. bei [i]). Generell wurde festgestellt, dass bei Vokalen der Mundraum eigentlich immer offen ist, so dass die Luft ungehindert durch den Kanal des Ansatzrohrs strömen und so einen „satten“ Laut hervorbringen kann. Vorn, zentral und hinten zeigt, an, wo im Mundraum der jeweilige Vokal artikuliert wird; das [i] wird als höchster und geschlossener Vokal bezeichnet, das [a] als tiefster und offener Vokal bezeichnet.
Die klassifizierende Darstellung der Konsonanten geschieht durch Artikulationsort und Artikulatoren. Die anatomisch bedingte Grundstruktur soll kurz durch die folgende Abbildung 2 gezeigt werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2
Wichtig ist also, wo der konsonantische Laut erzeugt wird und welche Artikulatoren an der Produktion beteiligt sind. So ist zum Beispiel der Konsonant [p] ein bilabialer Laut (1), der von der Unterlippe (dem Artikulator) an der Oberlippe (der Artikulations-stelle) erzeugt wird. Hingegen wäre der Laut [k] ein velarer Laut (8), der vom Zungenrücken, dem Dorsum (Artikulator) am weichen Gaumen (Artikulationstelle) produziert wird. Allgemein müssen die Artikulatoren bei der Produktion von Konsonanten eine Enge oder einen Verschluss im Ansatzrohr bewerkstelligen.
Das Phoneminventar wird „durch Segmentierung von Äußerungen“ bestimmt (Wisch: 22, Willi: 427), wobei die Funktion der kleinsten bedeutungsunterscheidenden Laute besonders bei Minimalpaaranalysen zur Geltung kommt. Durch Veränderung jeweils nur eines Lauts wechselt dadurch zugleich die Wortbedeutung (vgl. Wisch: 25). Zum Beispiel die Wortreihe Band – Hand – Wand – Land – Sand, bei der sich immer nur ein Konsonant ändert oder, auf Vokalphoneme bezogen, die Wortreihe Tür – Tor – Tier – Teer.
Wisch weist nun darauf hin, dass Sprache eigentlich erst beginnt, wenn sich Laute mit Bedeutung verbinden (Wisch: 25). Dieser Gesichtspunkt der Bedeutung wird in dem Bereich der Morphologie deutlicher.
II.1.2 Morphologie
Aus dem Phoneminventar des Deutschen (ca. 40 Phoneme) lassen sich nahezu unendlich viele Kombinationen bilden. „Für das Funktionieren einer Sprache sind also in erster Linie die Phonemkombinationen wichtig, die eine bestimmte Bedeutung transportieren (Morpheme)“ (Wisch: 26). Die so genannten Morpheme bestehen demnach aus einem oder mehreren Phonemen und haben eine bedeutungstragende Funktion. Um die Morpheme zu analysieren, werden Segmentierung und Gegenüberstellung von Minimalpaaren genutzt. Nach Wisch wird zwischen freien und gebundenen Morphemen unterschieden (vgl. Wisch: 26): Freie Morpheme sind zum einen lexikalische Morpheme mit einer eigenen Referenz wie z.B. „rot“ oder „Streit“. Zum anderen sind es deiktische Morpheme, die eine mittelbare Referenz aufweisen wie z.B. „dein“, „dies“ oder „hier“. Die gebundenen Morpheme sind im Gegensatz zu den freien Morphemen unselbständig und haben eine kategoriale Bedeutung. Dies sind auf der einen Seite die Flexionsmorpheme wie in „sag-en“ oder „sag-ten“, auf der anderen Seite die Wortbildungsmorpheme wie in „end-lich“ oder „be-halten“.
„Die gebundenen Morpheme ermöglichen durch vielfache Kombinationen mit freien Morphemen die Erzeugung […] unendlich vieler neuer Bedeutungen“ (Wisch: 27). So kann auch formuliert werden, dass sich die Wortbildung im Deutschen durch Verknüpfung der verschiedenen Morpheme vollzieht. Nach Wisch kann als weiterer Aspekt der Morphologie die Klassifizierung von Wortarten (wie Verben, Substantiven, Adjektiven) angesehen werden. Hierbei ist zu beachten, dass „die verschiedenen Wortarten […] im Rahmen einer systematischen Wortbildung auch ineinander überführt werden“ können (Wisch: 28). Beispiel für eine Umsetzung von Adjektiv zu Substantiv wäre „hoch → das Hoch“ oder für eine syntaktische Konversion „neues Denken → etwas Neues“. Außer diesen beiden Fällen gibt es weitere Strukturtypen der Wortbildung wie z.B. die Neuprägungen („Autobus“ → „Bus“), die Kompositionen („blitz-schnell“) oder auch die Ableitungen („Er-zieh-ung“, „Er-zieh-er“). So beschreibt Wisch den kreativen Aspekt von Sprache folgendermaßen: „Eine jede Sprache lebt davon, daß sie mit Hilfe endlicher Mittel immer wieder neue Sprachzeichen erzeugen kann“ (Wisch: 28).
Dies zeigt sich besonders auch, wie oben bereits dargestellt, in der Flexionsmorphologie. Die Flexion (Beugung) beschreibt die formale Veränderung von Wörtern zum Ausdruck grammatischer Kategorien und lässt sich in drei Flexionstypen gliedern (vgl. Wisch: 28): 1. die Konjugation von Verben (sag-e, sag-en, sag-te…), 2. die Deklination von Nomen (die Bäu-me, den Bäu-men, den Bäu-men…) und 3. die Komparation von Adjektiven (Positiv: schön, Komparativ: schön-er, Superlativ: am schön-sten). Bei diesen Beispielen lässt sich gut erkennen, dass Bedeutungen aufgrund kleinster Änderungen – hier im Ablaut – wechseln können.
Um nun die unendlich vielen Kombinationen für die Kommunikation zu nutzen, muss die nächste höhere Ebene in der Grammatik betrachtet werden – der Satz. Hiermit beschäftigt sich der Syntaxbereich, „der in hohem Maße durch morphologische Prozesse, insbesondere das Mittel der Flexion, gesteuert wird“ (Wisch: 29).
II.1.3 Syntax
Nachdem man aus Phonemen Morpheme gebildet hat, waren die Morpheme Grundlage für die Wörter. Der Satz, als komplexe syntaktische Einheit, wird nun aus Wörtern gebildet. Nach Wisch ist er „als kleinste[r] selbständige[r] und vollständige[r] Teil sprachlicher Äußerungen“ anzusehen (Wisch: 30). Als Zwischengröße zwischen Wort und Satz lassen sich die Satzglieder ansiedeln: Dies sind das Subjekt (der Handlungsträger), das Objekt (das Handlungsziel), das Prädikat (der Handlungsvorgang, der verbale Satzkern), das Präpositionalobjekt (die adverbiale Bestimmung) und das Attribut (die Beifügung) (vgl. Wisch: 30). So kann ein Satz z.B. auf folgende Arten analysiert werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In der Konstituentengrammatik oder auch der Generativen Transformations-grammatik kann der Satz in einer Stammbaumform dargestellt und zerlegt werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Hierbei bedeutet DET: Determinator (Artikel), N: Nomen (Substantiv), NP: Nominal-phrase, PP: Präpositionalphrase, PREP: Präposition, S: Satz, V: Verb und VP: Ver-balphrase.
„Neben den strukturalistischen Schulen wären, insbesondere die inhaltsbezogene, die funktionale Grammatik, die Kasusgrammatik und die Dependenz- oder Abhängigkeitsgrammatik zu nennen, die das Verb mit seinen unterschiedlichen Wertigkeiten (Valenzen) in den Mittelpunkt stellt“ (Wisch: 31). Da die Erklärung dieser Grammatiken jedoch den Rahmen dieses Unterpunktes sprengen würde, wird hier nur kurz auf die Generative Transformationsgrammatik eingegangen, bei der die Unterscheidung von Oberflächen- und Tiefenstruktur zu beachten ist, „wobei die Oberflächenstruktur durch ganz bestimmte Transformationen aus der Tiefenstruktur generiert wird“ (Wisch: 34). Zu den vier Transformationsoperationen gehören Addition, Tilgung, Umstellung und Ersetzung von Konstituenten.
Die syntaktische Komponente beinhaltet die kategoriale Komponente und ein Lexikon, die die Tiefenstruktur erzeugen. Außerdem beinhaltet sie die Transformationskomponente, die mit Transformationsregeln die Tiefenstruktur in die Oberflächenstruktur überführt. Während die semantische Komponente die Tiefenstruktur durch Zuordnung von Bedeutungsstrukturen interpretiert, befasst sich die phonologische Komponente mit der Oberflächenstruktur, d.h. wie die Äußerungen lautlich realisiert werden (vgl. Wisch: 33).
Bei der weiteren Betrachtung von Sätzen lassen sich verschiedene Satzarten unterscheiden. Mit Beispielen soll das kurz verdeutlicht werden: Man kann eine Unterscheidung von vier verschiedenen Sätzen vornehmen: Der Aussagesatz (Du lernst schreiben.), der Fragesatz (Lernst du schreiben?), der Befehls- oder Aufforderungssatz (Lerne schreiben!) und der Ausrufesatz (Wie schnell du schreiben lernst!). Diese Sätze können alle als Hauptsätze angesehen werden, da sie unabhängig von anderen Sätzen stehen können und keinem anderen Satz untergeordnet sind (vgl. Wisch: 35). Im Gegensatz dazu sind Nebensätze (Gliedsätze) von einem anderen Satz syntaktisch abhängig. Hier sind besonders die Adverbialsätze zu nennen, die „durch Konjunktionen eingeleitet [werden], die den verschiedenen Präpositionen der Adverbialen Bestimmungen entsprechen“ (Wisch: 35). Als Beispiel sollen hier drei genannt werden: Der Lokalsatz (Der Sänger stand dort, wo ihn alle gut sehen konnten.), der Konditionalsatz (Wenn du klingelst, mache ich dir die Tür auf.) oder z.B. der Finalsatz (Du musst gut spielen können, um das Turnier zu gewinnen.).
„[A]n der syntaktischen Generierung sprachlicher Äußerungen im Deutschen [ist] eine Vielzahl unterschiedlicher morphologischer und syntaktischer Prozesse und Regelabläufe beteiligt“ (Wisch: 35). Nun soll verdeutlicht werden, dass diese syntaktischen Regelprozesse fast immer auf zugrunde liegende semantische Bezüge zurückgehen.
II.1.4 Semantik
Die Semantik beschäftigt sich mit dem Bedeutungsaspekt von Sprache. „Sie ist eng mit der Morphologie und Syntax verbunden, da es in jeder Grammatik einer Sprache primär um die formale Umsetzung inhaltlicher Aussagen geht“ (Wisch: 36). Grammatik und Lexikon, wie oben beschrieben, sind also ohne Semantik nicht denkbar. Der zentrale Begriff der Semantik ist die Bedeutung. „[D]ie Referenz – die Beziehung zwischen sprachlichen Zeichen und ihren Referenten in der außersprachlichen Wirklichkeit – ist ein zentraler Aspekt bei der Bestimmung von Bedeutung“ (Wisch: 36). Da dieser Inhaltsbezug verschieden sein kann, lassen sich nach Wisch verschiedene Bedeutungsarten unterscheiden: die denotative Bedeutung, die einen begrifflich-logischen Inhalt eines Zeichens darstellt und sich demnach primär an dem realen Bezugsobjekt orientiert. Die konnotative Bedeutung, die eine assoziative, oft wertende Nebenbedeutung beschreibt, die ein bestimmtes Wort hervorruft. Und die kollokative Bedeutung, die auf die Kontextabhängigkeit von Bedeutungen Bezug nimmt und wiederkehrende, meist assoziative Wortverbindungen kennzeichnet, die häufig gemeinsam in Redewendungen auftreten. So, wie man die Bedeutungsbeziehungen zwischen Zeichen und ihren Referenzen betrachten muss, müssen auch die Bedeutungsbeziehungen zwischen einzelnen Wörtern bezeichnet werden. Lyons grenzt diese Bedeutung als lexikalische Bedeutung (Bedeutung von Lexemen) von der Satzbedeutung ab (vgl. Lyons 1983: 131).
Unter den Punkt der lexikalischen Bedeutung fallen Homonymie, Synonymie und Polysemie. Die Homonymie beschreibt nach Wisch den Zustand, dass in Lautbild oder Schriftbild identische sprachliche Zeichen eine unterschiedliche Bedeutung haben (vgl. Wisch: 37): z.B. im Schriftbild „Kiefer“ → der Knochen und „Kiefer“ → der Baum; im Lautbild „Lehre“ → Unterrichtung und „Leere“ → die Inhaltslosigkeit. „Homonyme werden traditionell als Wörter (d.h. Lexeme) definiert, die dieselbe Form haben“ (Lyons: 137). Die Synonymie wird als „Gleichheit der Bedeutung“ (Lyons: 139) definiert, d.h. eine inhaltliche Übereinstimmung mehrerer sprachlicher Zeichen bei verschiedener Lautform: z.B. „anfangen“ – „beginnen“ oder „Kopf“ – „Haupt“. Die Polysemie (oder Mehrdeutigkeit) bezieht sich auf einzelne „Lexeme mit verschiedenen unterscheidbaren Bedeutungen“ (Lyons: 138): z.B. das Lexem „Zug“ kann zum einen „Verkehrmittel“ und zum anderen „stetige Luftbewegung“ bedeuten. Homonymien und Synonymen geht es darum, „inwieweit unterschiedliche Bedeutungen durch eine Zeichengestalt, bzw. dieselbe Bedeutung durch unterschiedliche Zeichen zum Ausdruck gebracht wird“ (Wisch: 37).
Die Autonymie und Hyponymie befassen sich dem gegenüber mit der Verwobenheit der Einzelbedeutungen. Die Autonymie (oder Gegensätzlichkeit des Sinns, Lyons: 145) beschreibt nach Wisch Bedeutungsgegensätze, sie sich kontradiktorisch ausschließen (männlich – weiblich, Leben – Tod), die einander konträr als Pole einer Skala gegenüberstehen (lang – kurz, heiß – kalt) oder die konvers, oft als Paare, aufeinander bezogen sind (Bruder – Schwester, geben – bekommen) (vgl. Wisch: 37). Die Hyponymie beschreibt „die Relation, die zwischen einem spezielleren und einem allgemeineren Lexem besteht“ (Lyons: 146). Hierbei geht es um die Zuordnung von Unterbegriffen (Hyponymen) zu einem Oberbegriff (Hyperonym), z.B. die Kette Tier → Vogel → Huhn → Küken, wobei der folgende Begriff immer ein Unterbegriff des vorausgegangenen ist. „Begriffsfamilien, die mehr dem Bereich der Synonyme zuzuordnen sind, werden in sog. Wortfeldern zusammengefaßt“ (Wisch: 38). In einem Wortfeld befinden sich demnach inhaltlich zusammengehörige Wörter, die einen Sinnbezirk bilden und somit wird die Bedeutung des Einzelwortes von seinen Feldnachbarn mitbestimmt (vgl. Wisch: 38).
Im Gegensatz zur Syntax fällt im semantischen Bereich auf, dass die Bedeutung sprachlicher Zeichen von außersprachlichen und subjektiven Komponenten beeinflusst wird. „Diese Gesichtspunkte verweisen auf den übergreifenden Bezug von Sprache als praktisches, interaktives Handlungsmittel lebendiger Menschen, dem pragmalinguistischen Aspekt von Sprache“ (Wisch: 42).
II.1.5 Pragmatik
Um den Inhalt des letzten Satzes noch einmal aufzugreifen: „Unter Pragmatik im Sinne sprachlichen Handelns kann man [die Sprechakttheorie und die kommunikative Kompetenz als] pragmalinguistische Perspektiven in den Vordergrund stellen“ (Wisch: 42). Nach Austin werden dabei Akte vollzogen, wenn man eine Äußerung hervorbringt. Die „gesamte Handlung, »etwas zu sagen«, [nennt er] den Vollzug eines lokutionären Aktes“ (Austin 2002: 112). Die Lokution besteht aus drei weiteren Akten: dem phonetischen Akt, der in der Handlung besteht, gewisse Geräusche zu äußern; dem phatischen Akt, der in der Handlung besteht, gewisse Vokabeln, also Wörter – in einer bestimmten Grammatik – zu äußern; und dem rhetischen Akt, der darin besteht, dass man „diese Vokabeln dazu benutzt, über etwas mehr oder weniger genau Festgelegtes zu reden und darüber etwas mehr oder weniger genau Bestimmtes zu sagen“ (Austin: 113). Der lokutionäre Akt ist also die lautliche Realisierung einer Äußerung sowohl auf der artikulatorischen, als auch auf der grammatischen Ebene. „Einen lokutionären Akt vollziehen heißt im allgemeinen auch und eo ipso einen illokutionären Akt vollziehen“ (Austin: 116). Wisch bezeichnet den illokutionären Akt als den eigentlichen Sprechhandlungsakt, „in dem die Intention des Sprechers zum Ausdruck kommt“ (Wisch: 42). Somit bringt der Sprecher in diesem Akt direkt oder indirekt zum Ausdruck, was er mit seiner Äußerung beabsichtigt. Hierunter fallen Sprechakte wie Frage, Aufforderung, Versprechen, Ermahnen usw., „die durch ihre Teilhaber sowie den situativen und thematischen Kontext bestimmt sind“ (Wisch: 42). Austin setzt seinen Gedankengang nun fort und schreibt, „[w]er einen lokutionären und damit einen illokutionären Akt vollzieht, kann in einem dritten Sinne auch noch eine weitere Handlung vollziehen“ – den perlokutionären Akt (Austin: 118). Hier spielen nun die Wirkungen eine Rolle, die mit dem Vollzug eines Sprechaktes erzielt werden und ob sie vom Sprecher beabsichtigt sind. Wenn man, wie Austin es formuliert hat, den Sprecher als Täter einer Handlung (mit erzielter Wirkung) ansieht, kann das Vollziehen einer solchen Handlung als Vollziehen eines perlokutionären Aktes angesehen werden. Die Perlokution bezieht sich also auf die Konsequenzen einer Sprechhandlung. Um dies alles zu verdeutlichen, ein allgemeines Beispiel von Austin (Austin: 119):
Lokution: Er hat zu mir gesagt, dass…
Illokution: Er hat mich gedrängt / hat mir geraten…
Perlokution: Er hat mich überredet…
„Mit jedem Sprechakt sind ganz spezielle Voraussetzungen, Bedingungen und Regeln verbunden, ohne deren Einhaltung sprachliche Handlungen nicht funktionieren könnten“ (Wisch: 43). So kann zum Beispiel nichts Vergangenes versprochen werden, man kann sich nichts wünschen, was man schon hat, man kann niemanden in einer Sache beraten, die man nicht versteht… Wenn dies von einem Sprecher verstanden ist, verfügt er über eine gewisse sprachliche Handlungskompetenz, die ihm die Möglichkeit gibt, (meist) ohne Missverständnisse zu kommunizieren.
„Diese wenigen Hinweise sollen genügen, um deutlich zu machen, daß »über Sprache verfügen« mehr heißt, als nur die Fähigkeit zum Sprechen, zur grammatisch korrekten Konstruktion von Sätzen und zur inhaltlich richtigen Verwendung der Zeichen-Bedeutungsrelationen zu besitzen“ (Wisch: 43).
II.2 Gebärdensprache
II.2.1 Die Phonologie
Die Gebärdensprache besteht, wie die Lautsprache, aus kleinsten Spracheinheiten. Diese Spracheinheiten sind nun Gegenstand dieses Kapitels.
Die Gebärdenzeichen sind nicht unbedingt ganzheitliche Abbildungen, von dem was sie bezeichnen (vgl. Wisch: 157). Selbst wenn Gebärdenzeichen sehr ikonisch sind, tritt oft eine starke Abstraktion auf (vgl. Wisch: 157). Gebärden lassen sich „aus einer endlichen Menge von Einzelmerkmalen“ (Wisch: 158) zusammensetzen. Diese sind auf die vier grundlegenden Parameter „Handform, Handstellung, Ausführungsstelle und Bewegung“ (Wisch: 158) zurückzuführen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.3
Hinzu kommen auch die nonmanuellen Komponenten, die „die Bewegung des Kopfes und des Oberkörpers, der Blickrichtung, einige Lippenbewegungen sowie den Geschichtsausdruck“ (Becker 1997: 28) umfassen. Auch das „Mundbild“ ist nach Jäger ein grundlegender Parameter der Gebärdensprache, der eine bedeutungsunterscheidende Spracheinheit darstellt (vgl. Jäger 1996: 312). „Für die deutsche Gebärdensprache werden aus einer weitaus größeren Anzahl möglicher Handformen gut 30 Handformen als distinktive Formmerkmale mit bedeutungs-unterscheidender Funktion angenommen, die sich wiederum nach bestimmten Grundformen klassifizieren lassen (Prillwitz 1989b): 1. Faust, 2. Flachhand, 3. Einzelfinger, 4. Daumen-verbindungen (vgl. Abb.3). Wobei sich die Daumenverbindungen nach Prillwitz noch in weiteren sechs Untergruppen ableiten (vgl. Abb.4).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diese gehen von den Formen der Faust, Flachhand und Einzelfinger aus und sind entweder geschlossen oder offen (vgl. Wisch: 158). So bilden sich aus den Grundformen, unter den Geschichtspunkten der Daumenstellung des Abwinkens, Biegens und Krümmens der Finger, alle erforderlichen Zeichen für alle Gebärdensprachen (vgl. Wisch: 159). „Die bedeutungsunterscheidende Funktion bestimmter Handformen wird deutlich, wenn allein durch Wechsel der Handform ein völlig neues Gebärdenzeichen entsteht wie z.B. bei ich-GEBEN-du und ich-FRAGEN-du.“ (Wisch: 159). Bei diesem Beispiel sind Handstellung, Ausführungsstelle und Bewegung identisch, doch die Handform der beiden Gebärden unterscheidet sich, sie ist bei der Gebärde „GEBEN“ flach und bei der Gebärde „FRAGEN“ zu einer Daumen – Zeigefingerverbindung geformt (vgl. Wisch: 160).
[...]
- Arbeit zitieren
- Wafa Sturmann - Ben Omrane (Autor:in)Lotte Marie Feiser (Autor:in), 2006, Der Einfluss der Modalität linguistischer Systeme auf kognitive Verarbeitungsprozesse - Lautsprache und Gebärdensprache im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115830
Kostenlos Autor werden










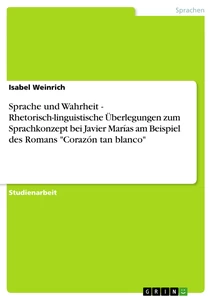
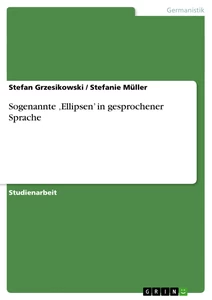








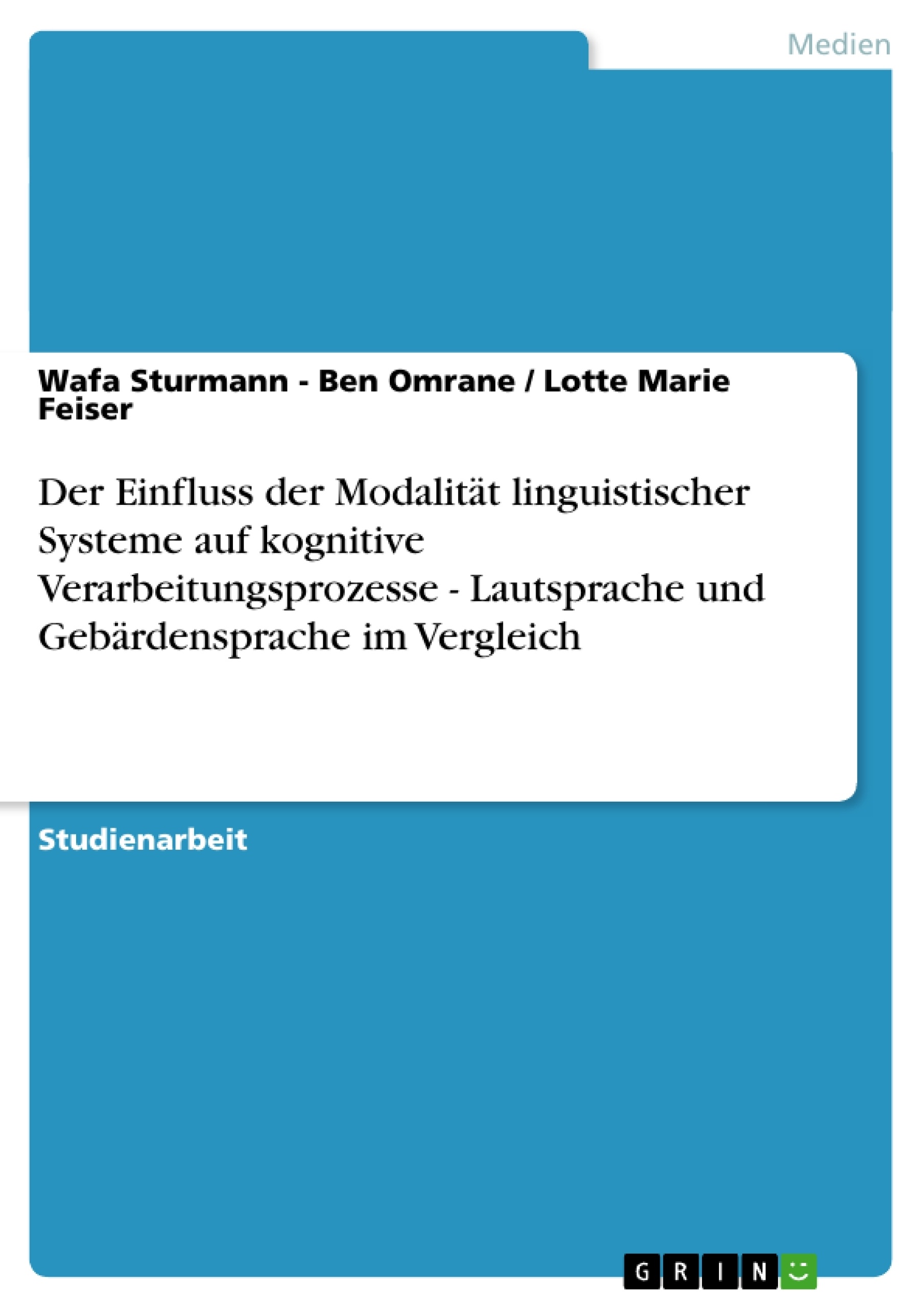

Kommentare