Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
A. Verzeichnisse
B. Einleitung
Die wissenschaftliche Fragestellung
Vorgehensweise
Der gegenwärtige Forschungsstand
Begriffsdefinitionen
C. Hauptteil
2.1 Die Vorgeschichte
2.1.1 Die Siedlungsgebiete der Deutschen im Osten
2.1.2 Die Potsdamer Konferenz
2.1.3 Der Aufbruch zu Flucht und Vertreibung
2.1.4 Das Gesetz der Flucht
2.1.5 Die Anzahl der Vertriebenen
2.1.6 Die Verteilung der Vertriebenen
2.1.7 Der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes
2.2 Die Voraussetzungen auf dem Weg zur Integration
2.2.1 Der Wille zur Rückkehr in die Heimat
2.2.2 Der Heimatbegriff
2.2.3 Die Bedeutung der Stammesgemeinschaft
2.2.4 Die Ankunft im Westen
2.2.5 Die Konfrontation mit den Einheimischen
2.2.6 Die Bedeutung des Besitzes
2.2.7 Die Kapitalarten (nach Bourdieu)
2.2.8 Die psychologischen Barrieren
2.3 Die Rolle der Kirchen und die religiöse Integration
2.3.1 Das Selbstverständnis der Kirchen im Nachkriegsdeutschland
2.3.2 Die Katholische Kirche
2.3.2.1 Die Aufgaben der Vertriebenenseelsorge
2.3.2.2 Der Vertriebenenseelsorger Pater Paul Sladek
2.3.2.3 Die Forderung nach einem Lastenausgleich
2.3.2.4 Die Einteilung der Vertriebenenseelsorge in drei Phasen
2.3.3 Die Evangelische Kirche
2.3.3.1 Die Auslandshilfe
2.3.3.2 Die Hilfe zur Selbsthilfe
2.3.4 Der pädagogische Auftrag beider Kirchen
2.3.5 Die religiöse Integration
2.3.5.1 Die Vertriebenen in der Diaspora
2.3.5.2 Die Vertriebenen in Regionen gleicher Konfession
2.3.5.3 Die Ostpfarrer /-priester
2.3.5.4 Der Prozess der Entkirchlichung
2.3.6 Die Selbstkritik der Kirchen
2.4 Das System der sozialen Sicherung
2.4.1 Der Aufbau des sozialen Netzes
2.4.2 Die Notwendigkeit zur Schaffung einer klaren Rechtslage
2.4.3 Die Arbeitskraft als einziges Kapital
2.5 Die politische und rechtliche Integration der Vertriebenen
2.5.1 Das Soforthilfegesetz und das Feststellungsgesetz
2.5.2 Das Lastenausgleichsgesetz
2.5.3 Die Wohnungsvergabe
2.5.4 Das Bundesvertriebenengesetz
2.6 Die wirtschaftliche Integration der Vertriebenen
2.6.1 Die regionalen Unterschiede der wirtschaftlichen Integration
2.6.2 Die Auswirkungen der Währungsreform
2.6.3 Die Eingliederung der Vertriebenen in den Arbeitsmarkt
2.6.4 Die Berufsstellung der Vertriebenen
2.6.5 Die alters- und geschlechtsspezifischen Schwierigkeiten
2.6.6 Die Bildungschancen und intergenerative Mobilität
2.7 Die Selbstorganisation der Vertriebenen
2.7.1 Die ersten Vertriebenenvereinigungen
2.7.2 Die Charta der deutschen Heimatvertriebenen
2.7.3 Die Landsmannschaften
2.7.4 Der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
2.7.5 Der Bund der Vertriebenen
2.7.6 Die gegenwärtigen Aktivitäten des Bundes der Vertriebenen
2.8 Die gesellschaftliche Integration der Vertriebenen
2.8.1 Die Differenzierung der Vertriebenen
2.8.2 Die Flüchtlingskinder
2.8.3 Die „zweite Generation“
2.8.4 Die Verschwägerung
2.8.5 Der Patenschaftsgedanke am Beispiel der Stadt Münster
2.9 Der Wandel in der Wahrnehmung der Vertriebenen
2.9.1 Die Evangelische Kirche
2.9.1.1 Die Zäsur in der Arbeit der evangelischen Kirche
2.9.1.2 Die Ostdenkschrift der EKD
2.9.1.3 Die Reaktionen auf die Denkschrift
2.9.2 Die Katholische Kirche
2.9.2.1 Der Bischofsdialog 1965
2.9.2.2 Die Einrichtung von Visitaturen
2.9.3 Die Neue Ostpolitik unter Brandt / Scheel
2.9.4 Die Vertreibung aus der Erinnerungskultur
2.9.5 Die psychologischen Spätfolgen von Flucht und Vertreibung
D. Zusammenfassung
E. Literaturverzeichnis
F. Anhang
A. Verzeichnisse
Tabellenverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anhangverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
B. Einleitung
1.1 Die wissenschaftliche Fragestellung
Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Einbindung der deutschen Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges in Westdeutschland wird immer als Musterbeispiel für eine gelungene Integration bezeichnet. Es stellt sich die Forschungsfrage, ob sich die Vertriebenen wirklich integriert oder nur assimiliert haben? Was geschah mit den Menschen nach ihrer Vertreibung? Fanden sie im Westen tatsächlich eine neue Heimat oder versiegte irgendwann ihre Hoffnung auf Rückkehr in die alte?
Im Jahre 2005 jährte sich das Kriegsende zum 50. Mal. Seitdem beginnen auch die Deutschen ihre eigenen Opfer und das Schicksal ihrer Großelterngeneration zu hinterfragen. Zahlreiche Veröffentlichungen, Ausstellungen und Dokumentationen greifen das Thema Flucht und Vertreibung auf. Auch die Diskussion um ein Zentrum gegen Vertreibungen in Berlin zeigt, dass dieses Thema gegenwärtig ist und die Menschen bewegt.
Ziel der Magisterarbeit ist die Darstellung der tabuisierten Probleme der Integration in den Bereichen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sowie ihrer Bewältigung. Es wird die Arbeitshypothese aufgestellt, dass die Integration der Vertriebenen erst in der zweiten Generation gelingen konnte. Sie ist indifferent und erfolgte in mehreren, sich zeitlich überlappenden Phasen.
1.2 Vorgehensweise
Aus der bewussten Sicht eines Nichtbetroffenen wird das Thema Integration der Vertriebenen ab dem Jahr 1945 bis in die Gegenwart erforscht und dargestellt. Die Arbeit soll eine Übersicht geben, da es nicht möglich ist, das ganze Problem der Integration umfassend darzustellen. Dabei wird das Thema weitgehend historisch aufgearbeitet. Es wird hauptsächlich wissenschaftliche Literatur verwendet, die einzelne interdisziplinäre Phasen und Bereiche umfasst. Sie wird nach einer analytisch-hermeneutischen Arbeitsweise objektiv ausgelegt und gedeutet.
Neben der Literaturanalyse stützt sich die vorliegende Arbeit auf eine Reihe nicht-wissenschaftlicher, leitfadengestützter Experteninterviews mit Zeitzeugen. Jedem Befragten wurden, je nach Spezifika, individuelle Fragen gestellt. Die Fragenkataloge unterschieden sich nach Einheimischen, Vertriebenen, Geistlichen und Verbands-mitgliedern. Ausgewählte Zitate der acht geführten Gespräche dienen der Bekräftigung der getroffenen Aussagen. Im Hinblick auf die Sensibilität des Themas, hat sich der Verfasser um eine vorurteils- und wertfreie Darstellung bemüht.
1.3 Der gegenwärtige Forschungsstand
Beschäftigt man sich mit der Problematik von Flucht und Vertreibung, stellt man fest, dass es eine Vielzahl an Literatur gibt. Zur nicht-wissenschaftlichen Literatur gehören Heimatromane und Biographien, bis hin zu veröffentlichten Briefen, die das persönliche Leid der Verfasser beschreiben. Diese Quellen geben zwar ein ungefähres Bild der Flucht und Vertreibung und der Nachkriegszeit wieder, sind jedoch oftmals ideologisch verzerrt und durch das individuelle Schicksal des Betroffenen geprägt. Der Großteil dieser Literatur stammt von den Vertriebenen selbst. Sie wollten durch Veröffentlichungen entweder Einfluss nehmen, auf ihre Lage aufmerksam machen, den Schicksalsgenossen helfen, oder versuchten durch das Niederschreiben ihre Flucht- und Vertreibungserlebnisse zu bewältigen. Ihr Adressat war demnach nur selten die wissenschaftliche Gemeinschaft, sondern Behörden, die breite Öffentlichkeit und die Gruppe der Vertriebenen selbst.
Auffällig bei der wissenschaftlichen Literatur ist die unterschiedliche Gewichtung einzelner Themen. Aspekte der wirtschaftlichen Integration werden stärker betont, psychologische Probleme jedoch fast gar nicht thematisiert. Man kann die wissenschaftliche Flüchtlingsliteratur in zwei Kategorien aufteilen. Zum einen die allgemeinen Übersichten, die Statistiken und Wanderungsbewegungen beinhalten und das Problem der Integration der Vertriebenen in seiner Gesamtheit erörtern. Zum anderen die spezielle Flüchtlingsliteratur, die entweder auf eine Region beschränkt ist oder nur einen Wissenschaftsbereich tangiert. Einzelne Disziplinen, wie die Bevölkerungsgeographie, Politikwissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften bearbeiteten nur die für ihren Fachbereich wichtigen Aspekte der Flüchtlingsfrage. Zur Soziologie gibt es, nach Aussage von Jolles, kaum weitere Autoren, die sich allein mit der Soziologie der Vertriebenen beschäftigt hätten. (vgl. Jolles 1965: 11) Seinen Recherchen zu Folge, könne man in bestimmten „Fachkreisen, z.B. der Soziologie, sogar ein gewisses Nicht-Beachten, eine gewisse Abneigung diesem Problem gegenüber beobachten“. (Jolles 1965: 33) Eine Ausnahme bildet hierbei Elisabeth Pfeil, die schon sehr früh damit anfing, empirische Studien zu betreiben. In ihren Werken Der Flüchtling und Flüchtlingskinder in neuer Heimat beschreibt sie eingehend die Problematik aus soziologischer Sicht.
Die Flüchtlingsliteratur weist eine gewisse Chronologie auf, die parallel zu den in den jeweiligen Jahren relevanten Problemen verlief. Standen bis 1949 Themen wie Notversorgung und Wohnraumbeschaffung im Vordergrund, beschäftigte sich die Literatur ab den 1950er Jahren mit tiefer gehenden Problemen der gesellschaftlichen Integration oder der Deutung des Vertreibungsschicksals. Die Flüchtlingsliteratur hielt der dynamischen Entwicklung des Vertriebenenproblems stand und orientierte sich an den Phasen der Eingliederung. Seit den 1970er Jahren nahm die Anzahl der Werke, die sich mit der Vertriebenenfrage beschäftigt, deutlich ab. Zum einen ließ die Bedeutung der Vertriebenen in der öffentlichen Diskussion nach, zum anderen glaubten viele Wissenschaftler und Politiker die Herausforderung der Integration sei bereits gelöst. Entsprechend orientiert sich die vorliegende Arbeit an der Literatur, die zwischen 1945 und 1970 geschrieben wurde. Jedoch ist die Verwendung neuerer und neuester Literatur dann notwendig, wenn – wie bei Langzeitstudien – sich der Erkenntnisgewinn erst durch die Retrospektive einstellt.
Durch die Menschenrechtsverletzungen infolge des Jugoslawienkrieges in den 1990er Jahren gelangte das Thema Flucht und Vertreibung wieder in die deutsche Öffentlichkeit. Zudem veränderte sich seit 2000 die Sichtweise auf den Zweiten Weltkrieg. In Jörg Friedrichs Der Brand wurden Deutsche nicht mehr nur als Täter, sondern auch als Opfer dargestellt. In vielen Ausstellungen, wie Flucht, Vertreibung, Integration des Hauses der Deutschen Geschichte in Bonn und der Wanderausstellung Erzwungene Wege der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen, wurde auf das Problem der Zwangsmigration aufmerksam gemacht. Hinzu kamen die zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen, beispielsweise des Historikers Guido Knopp und der ARD-Zweiteiler „Die Flucht“, die das Thema Flucht und Vertreibung einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich machten. Weitere Filme, etwa zum Schicksal der Flüchtlinge auf der, von russischen U-Booten torpedierten, Wilhelm-Gustloff strahlt das ZDF Anfang März 2008 aus. Auch die BILD-Zeitung startete 2007 eine Serie, in der Leser und Prominente ihre Flucht- und Vertreibungsgeschichten erzählen durften. Die zunehmende Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema Flucht und Vertreibung, und der sich anschließenden Frage nach der Integration, beeinflusst auch die Forschung. Seitdem werden diese Inhalte in wissenschaftlichen Arbeiten verstärkt aufgearbeitet. Auch in der Soziologie werden anhand von Lebensläufen Generationsunterschiede erforscht. Die Kriegszeit spielt daher immer wieder eine Rolle.
1.4 Begriffsdefinitionen
Die Bezeichnung der Menschen, die während und nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat im Osten verlassen mussten, war uneinheitlich. Sie umfasst die Begriffe Vertriebene, Heimatvertriebene, Flüchtlinge und der, in der Sowjetischen Besatzungszone (im Folgenden „SBZ“ abgekürzt) gebräuchliche Ausdruck Umsiedler. Auch englischsprachige Quellen und Dokumente der Besatzungsmächte verwendeten die Begriffe refugee, displaced person, immigrant, new inhabitant und expellee praktisch wahllos.
Zum einen ist die quasi freie und ungenaue Verwendung der Bezeichnungen auf die fehlende staatliche Ordnung und damit auf die fehlenden juristischen Definitionen zurückzuführen. Zum anderen wandelten sie sich im Laufe der Zeit. Im Potsdamer Protokoll vom 02.08.1945 wurde in Artikel XIII lediglich von einer „ordnungsmäßigen Überführung deutscher Bevölkerungsteile“ gesprochen. Vertriebene gab es im amtlichen Sprachgebrauch nicht.
Die während des Krieges geflohenen Menschen wurden als Flüchtlinge bezeichnet. Die Landesflüchtlingsgesetze, zwischen 1947 und 1950 erlassen, nahmen auch Evakuierte, Ausgebombte und SBZ-Flüchtlinge in ihre Bestimmungen auf. Sie unterschieden jedoch zwischen „echten Flüchtlingen“, die nicht in ihre Heimat zurückgehen konnten, und „unechten Flüchtlingen“, die den Erstgenannten im Hinblick auf Ansprüche auf Sozialleistungen gleichgestellt wurden. Der Ausdruck Vertriebene etablierte sich erst ab 1948, da man nun die Bezeichnung Flüchtlinge fast ausschließlich für die Sowjetzonenflüchtlinge oder Flüchtlinge aus der DDR verwendete. (vgl. Jolles 1965: 77ff.)
Klarheit schaffte das Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz, im Folgenden „BVFG“ abgekürzt) von 1953, das in § 1 definiert:
Vertriebener ist, wer als deutscher Staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehöriger seinen Wohnsitz in den ehemals unter fremder Verwaltung stehenden deutschen Ostgebieten oder in den Gebieten außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches nach dem Gebietsstande vom 31. Dezember 1937 hatte und diesen im Zusammenhang mit den Ereignissen des zweiten Weltkrieges infolge Vertreibung, insbesondere durch Ausweisung oder Flucht, verloren hat.
Demnach galten als Vertriebene auch Menschen, die geflohen sind, evakuiert wurden, offiziell ausgewiesen wurden, oder nach ihrer Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft nicht mehr in die alte Heimat zurückkehren konnten. Man musste nicht, im eigentlichen Sinne des Wortes vertrieben worden sein. Die entscheidenden Merkmale waren der Vertreibungsdruck, der Ausschluss einer Rückkehr in die Heimat, der ehemalige Wohnsitz in den (damaligen) deutschen Ostgebieten und die Staats- bzw. Volkszugehörigkeit. Das BVFG kam auch bei SBZ-Flüchtlingen und Spätaussiedlern zur Anwendung, unterschied diese aber definitorisch von den Vertriebenen.
Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung werden die Begriffe Flüchtling und Vertriebener in dieser Arbeit synonym verwendet. Die Menschen erlebten zwar unterschiedliche Schicksale, wurden jedoch juristisch gleichgestellt. Im Hinblick auf die Integration weisen beide Gruppen die gleichen soziologischen Merkmale auf, wie Heimatverlust, Überlebenskampf, Notwendigkeit der Integration usw. Im Hinblick auf die Forschungsfrage ist eine Differenzierung der Begriffe nicht notwendig, auch wenn andere Quellen, und die Betroffenen selbst, genauer unterscheiden.
Das Wort Integration ist aus dem lateinischen abgeleitet und bedeutet Wiederherstellung, Vervollständigung. Das Wörterbuch der Soziologie definiert Integration in Anlehnung an T. Parsons:
Die Einheit des sozialen Systems und sein Gleichgewicht sind dann gegeben, wenn ‚die einzelnen Handelnden sich im Einklang mit ihren individuellen Bedürfnissen und mit den Erwartungen ihrer Interaktionspartner verhalten’, und wenn weiter ‚Erwartungen und Bedürfnisse durch die Verinnerlichung von gemeinsamen Wertmustern und Verhaltensorientierungen gesteuert werden. (Bernsdorf 2001: 470)
Der Integrationsprozess ist in Gesellschaften viel schwieriger zu verwirklichen als in kleinen Gruppen. Nach R. Dahrendorf bräuchte es Werte und Normen, die ein Zusammengehörigkeitsgefühl vermitteln. Die Integration erfolgt auf verschiedenen Kultursektoren wie Wirtschaft, Recht, Religion, Wissenschaften und Familie. (vgl. Bernsdorf 1969: 470f.) Damit die Integration gewährleistet ist, muss ein breiter Konsens über die berufliche Stellung und die damit verbundenen Gratifikationen (Geld, Prestige, Macht) bestehen. „Die Identifikation mit der Gesellschaft erfolgt in komplexen Industriegesellschaften über die Symbolidentifikation, wobei die Massenmedien als Integrationsfaktor eine herausragende Rolle spielen.“ (Schäfers 2001: 153)
Integration ist der Prozess der physischen und psychischen Eingliederung und Anpassung an ein soziales System, dass zwar durch den Krieg zerrüttet ist, aber von den Einheimischen energisch gegen die Eindringlinge verteidigt wird. Sie hat erst stattgefunden, wenn keine Spannungen, Abwehrverhalten und Fremdheitsempfindungen mehr artikuliert werden, wenn es gelingt, seelischen Ballast abzuwerfen und auf Grundlage von Kompromissen etwas Neues zu schaffen.
Bis zu dem Punkt, ab dem eine Unterscheidung in Einheimische und Vertriebene nicht mehr nötig oder überhaupt möglich ist, gibt es Zwischenziele auf dem Weg der Integration.
a) Die soziale Gleichheit: Dabei entspricht der Anteil an Einkommen, Bildung, Arbeitslosigkeit, Wohnverhältnissen usw. dem Anteil der Vertriebenen an der Gesamtbevölkerung.
b) Die Gleichberechtigung: Die rechtliche und politischen Gleichstellung der Vertriebenen.
c) Die Eigenständigkeit: Die berufliche Selbstständigkeit und die freie Entfaltung der Lebensformen, wozu auch die Bewahrung der heimatlichen und landsmannschaftlichen Sitten gehören.
d) Die Restauration: Die Wiedererlangung der alten Stellung in der Gesellschaft.
(vgl. Jolles 1965: 328)
Die Integrationsleistung besteht darin, das Problem der Verteilung von Ressourcen zu lösen und sicherzustellen, dass diese Verteilung von der überwiegenden Mehrheit der Gesellschaftsmitglieder akzeptiert wird. (vgl. Lüttinger 1989: 36) Die Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen an der allgemeinen Wohlstandssteigerung ist daher ein entscheidender Indikator zur Beurteilung der Integration. Diese Integrationsdefinition ähnelt dem Begriff der Chancengleichheit. Wenn die Vertriebenen die Chance haben, die Statuspositionen zu erreichen, die sich vor der Vertreibung hatten, und statistisch keine Unterschiede zu den Einheimischen mehr feststellbar sind, sind sie integriert.
C. Hauptteil
2.1 Die Vorgeschichte
2.1.1 Die Siedlungsgebiete der Deutschen im Osten
Die deutsche Besiedlung Osteuropas reicht bis ins Spätmittelalter zurück. Nach dem Ende der Kreuzzüge wurde der Deutsche Orden von Herzog Konrad von Masowien im Kampf gegen die heidnischen Pruzzen zu Hilfe gerufen. In der Goldenen Bulle von Rimini 1226 wurde der Ordensstaat durch Kaiser und Papst gesichert. Stadtgründungen, Lehen und Landschenkungen festigten die deutsche Ostkolonisation.
Dieser Vorgang ist keineswegs […] als ein deutscher ‚Raub- und Eroberungs-feldzug’ anzusehen, sondern als eine von nichtdeutschen Landesherren veranlasste friedliche Ostwanderung deutscher Geistlicher, Bürger und Bauern, die fortschrittliche Wirtschafts- und Lebensformen vermitteln. (Neumeyer 1993: 75)
Im Machtbereich des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen, des Deutschen Ordensstaates und später der österreichisch-ungarischen Monarchie verbreitete sich das Deutschtum vom Baltikum bis auf den Balkan. (siehe Karte im Anhang Nr. 1) Städte (Königsberg, Breslau und Danzig), Landschaften (Riesengebirge, Rominter Heide und Kurische Nehrung) und Volksstämme (Schlesier, Ostpreußen, Pommern) waren untrennbar mit dem Deutschtum verbunden und brachten über Jahrhunderte große Wissenschaftler, Künstler und Denker hervor. (Immanuel Kant, Nikolaus Kopernikus, Johann Gottfried Herder, Gerhart Hauptmann, Käthe Kollwitz, Agnes Miegel, Andreas Gryphius)
2.1.2 Die Potsdamer Konferenz
Nach der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen Wehrmacht am 08.05.1945 übernahmen die Siegermächte die Staatsgewalt in Deutschland. Bereits auf den Konferenzen in Teheran (1943) und Jalta (1945) beschäftigte man sich mit einer Nachkriegsordnung, die vorsah, Deutschland in Besatzungszonen aufzuteilen.
Vom 17.07.1945 bis 02.08.1945 trafen sich die Großen Drei, Churchill, Truman und Stalin in Potsdam. Am 28.07.1945 musste Churchill als britischer Premierminister zurücktreten, sodass sein Nachfolger Attlee das Potsdamer Abkommen unterzeichnete. Darin heißt es in Artikel IX zur Westgrenze Polens:
Die Häupter der drei Regierungen stimmen darin überein, dass bis zur endgültigen Festlegung der Westgrenze Polens, die früher deutschen Gebiete […] unter die Verwaltung des polnischen Staates kommen und in dieser Hinsicht nicht als Teil der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland betrachtet werden sollen. (de Zayas 1977: 255)
Bis zu einem endgültigen Friedensvertrag sollten die deutschen Ostgebiete lediglich unter polnischer Verwaltung bleiben, jedoch nicht Teil des polnischen Staates werden. Daraus leitete sich für viele Vertriebene der Wille zur Rückkehr in die Heimat ab und bestimmte die deutsche Außenpolitik der Nachkriegszeit.
Nach Artikel XIII des Potsdamer Abkommens sollte die „Überführung deutscher Bevölkerungsteile […], die in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben sind […], in ordnungsgemäßer und humaner Weise erfolgen“. (de Zayas 1977: 255) De Zayas machte auf Interpretationsprobleme im Zusammenspiel von Artikel XIII und IX aufmerksam und urteilte, dass man hätte sorgfältiger formulieren müssen. Da nach Artikel XIII nur die in Polen lebenden Deutschen umgesiedelt werden sollten und sich nach Artikel IX das polnische Staatsgebiet nicht auf die früher deutschen Gebiete ausdehnen sollte, sei die Vertreibung der Deutschen aus Ostpreußen, Pommern, dem östlichen Brandenburg und Schlesien gar nicht vom Potsdamer Abkommen gedeckt gewesen, auch wenn sie von den Alliierten vielleicht so gemeint war. (de Zayas 1977: 181)
Dass sich die Führungen der westlichen Demokratien zum Grundsatz der Bevölkerungsumsiedlung bekannten, lag für de Zayas an einer zu optimistischen Beurteilung des Lausanner Vertrages von 1923.[1] Bevölkerungsumsiedlungen wurden in der damaligen Politik als „Allheilmittel“ zur Friedenssicherung und endgültige Lösung von Minderheitenproblemen angesehen. Die Alliierten waren erst bestürzt, als sie nicht mehr im Stande waren, die Vertreibung zu kontrollieren. Nach Ansicht von de Zayas hätten sie „[…] niemals der Ausweisung der Deutschen zugestimmt, wenn sie das Chaos, das sich dann vor ihren Augen entfaltete, vorausgesehen hätten“. (de Zayas 1977: 34f.)
Sie hatten sich selbst mit dem tröstlichen Gedanken an eine international überwachte Umsiedlung beruhigt, die glatt wie eine geschäftlichte Transaktion vonstatten gehen werde. Es war leicht, geregelte Umsiedlungen auf dem Papier zu entwerfen, doch später, als sie in schreckliche Vertreibungen ausarteten, war es zu spät, sie noch aufzuhalten. (de Zayas 1977: 35)
Zwar wollten die Westmächte eine Endschädigung für Polen auf Kosten Deutschlands und hatten den Wunsch einer kollektiven Bestrafung der Deutschen, jedoch wurden „[…] viele dieser ‚Umsiedlungen’ tatsächlich ohne Zustimmung oder sogar im Gegensatz zu den Richtlinien der Westalliierten vorgenommen“. (de Zayas 1977: 143) Die Regierungen von Polen und später die der Tschechoslowakei hätten es jedoch vorgezogen, das Potsdamer Abkommen „als grünes Licht für wahllose Vertreibungen auszulegen“. (de Zayas 1977: 98) So wichen die vorgesehene Zahl der Umsiedler, der Zeitplan und die Art und Weise der Umsiedlung stark von den Vereinbarungen ab. Der Prozess der Vertreibung verselbstständigte sich und stellte die Westalliierten vor vollendete Tatsachen. Die unplanmäßige Durchführung und das unvorhersehbare Ausmaß der Vertreibung spiegelten sich auch in der Besatzungspolitik wieder. Die Westmächte wollten weder, noch konnten sie so viele Vertriebene aufnehmen, was ein großes Hindernis für die Integration darstellte.
Als Beispiel für das eigenmächtige Handeln der osteuropäischen Völker seien die so genannten Benesch-Dekrete genannt. Bereits im Exil verfasste der tschechische Politiker Edvard Benesch zahlreiche Dekrete darüber, wie man mit den Deutschen nach der Niederlage der Wehrmacht umzugehen hätte. Sie bildeten die Grundlage für die Ermordung, Vertreibung, Zwangsarbeit und Enteignung der deutschen Bevölkerung in der Tschechoslowakei und dem Sudentenland.[2] Sie haben bis heute juristischen Bestand. Im Zehn-Punkte-Plan von 1944 gab Benesch Richtlinien für die Ausweisung der deutschen Bevölkerung aus der wiedererrichteten Tschechoslowakei heraus. Das Gros des „Transfers“ der deutschen Bevölkerung sollte innerhalb von zwei Jahren durchgeführt werden. Das verbleibende Eigentum wurde als Reparationen angesehen. (vgl. Bundesvertriebenenministerium (im Folgenden „BMV“ abgekürzt) 1957: 181f.)
2.1.3 Der Aufbruch zu Flucht und Vertreibung
Alle vorausschauenden Vorschläge zur Evakuierung der Zivilbevölkerung wurden von der Nazi-Führung abgelehnt. Stattdessen wurden viele ostdeutsche Städte, wie Königsberg und Breslau, zu Festungen erklärt. In einem Kampf bis zum letzten Mann sollten sie, ohne strategische Notwendigkeit, unbedingt gehalten werden. Es gab nur vereinzelt geordnete Evakuierungen seitens der Wehrmacht, deren Befehlshaber für diesen Verrat, meistens in Abwesenheit, zum Tode verurteilt wurden. Millionen Menschen machten sich daher selbst auf den Weg, entsprechend chaotisch verlief ihre Flucht. Der Flucht ging die Entscheidung voraus, ob man bleiben oder weggehen sollte. Diese Alternative hatten die Vertriebenen später nicht mehr. Ihre Auswahl beschränkte sich darauf, in der Heimat zu sterben, oder in der Fremde zu leben. Die Flüchtlinge konnten zwar wählen, die öffentliche Meinung lautete aber, dass es unmöglich sei, dazubleiben, wenn der Russe komme. So beluden sie eilig ihre Wagen, schlossen sich zu Treckgemeinschaften zusammen und brachen auf, zu einer ungewissen Flucht Richtung Westen. Oftmals war es nicht der Einzelne, der floh, sondern ein Dorf, eine Gutsgemeinschaft oder ein Stadtviertel. (vgl. Pfeil 1948: 22ff.) Der Entschluss zur Flucht wurde seltener gefasst, wenn man Verwandte und Freunde zurücklassen musste oder bereits das Elend der durchziehenden Flüchtlinge gesehen hatte. Die Bevölkerung der weiter westlich gelegenen Provinzen, Westpreußen und Niederschlesien, denen die Evakuierung verboten wurde und die sich ihrerseits noch nicht zur Flucht entschlossen hatten, begleitete immer die Hoffnung, dass es ihnen nicht so ergehen würde. Viele entzogen sich der Entscheidung durch Suizid. Es waren zum einen Alte und Kranke, die sich den Strapazen einer Flucht nicht gewachsen sahen, zum anderen Männer mit einem starren Ehrgefühl und der Vorstellung, dass es fern der Heimat kein Leben mehr wäre. Frauen hätten sich seltener das Leben genommen, da ihr Mutterinstinkt einfach zu groß gewesen sei. (vgl. Pfeil 1948: 26ff.)
In Ostpreußen strömten die Menschen über das gefrorene Frische Haff zur See, in der Hoffnung, von einem Marinetransportschiff mitgenommen zu werden. In eisiger Kälte und unter Beschuss von russischen Jagdfliegern überlebten viele diese Flucht nicht. Doch auch an der Küste gab es nicht genug geeignete Schiffe, um alle Flüchtlinge mitzunehmen. Nicht jeder der fliehen wollte, konnte auch fliehen. Allein in der Festung Königsberg waren deshalb über 100.000 Menschen eingeschlossen. Am Tag der Besetzung Königsbergs schrieb von Lehndorff in sein Tagebuch:
Was ist das eigentlich, so frage ich mich, was wir hier erleben? Hat das noch etwas mit natürlicher Wildheit zu tun oder mit Rache? [...] Welch ein Bemühen, das Chaos zur Schau zu tragen! [...] Das hat nichts mit Russland zu tun, nichts mit einem bestimmten Volk oder einer Rasse – das ist der Mensch ohne Gott, die Fratze des Menschen. (von Lehndorff 1975: 67)
Es begann eine „apokalyptische Zeit“ mit Raub, Mord, Plünderung, Brandstiftung, Hunger und massenhafter Vergewaltigung.
Die Frauen wimmern oder schimpfen und werden unter Zuhilfenahme der Polen mitgeschleppt. Diese Teufelei wird wohl nie mehr aufhören. ‚Davai suda! Frau komm!’ Mir klingt es noch schrecklicher im Ohr als alle Flüche der Welt. Es stört sie gar nicht, daß sie halbe Leichen vor sich haben. Achtzigjährige Frauen sind vor ihnen ebenso wenig sicher wie bewußtlose. (von Lehndorff 1975: 82) Aber hier, wo kein Gesetz mehr hinreicht, kommen alle Eigenschaften kraß zum Vorschein. Von Menschenaugen gesehen zu werden ist kein Grund mehr, etwas zu unterlassen, was man im Sinn hat. Alles ist erlaubt, weil niemand mehr da ist, der es verbieten könnte. Und man fragt sich ernstlich, ob denn Erziehung und Sitte nichts weiter seien als ein Luxus für ruhige Zeiten. (von Lehndorff 1975: 135)
Es herrschte Anarchie. Selbst die russischen Kommandeure wollten und konnten keine Ordnung herstellen, bis man nach zwei Wochen anfing, sich mit der Zivilbevölkerung zu beschäftigen. Die Menschen wurden in Lager gesteckt und der NKWD, das Volkskommissariat für innere Angelegenheiten, führte immer wieder Vernehmungen durch.
Bei diesen Verhören kommt es nicht darauf an, aus den Leuten das herauszuholen, was sie wissen, sondern bestimmte Aussagen von ihnen zu erzwingen. Die dabei angewandten Methoden sind sehr primitiv. Es wird so lange auf den Menschen herumgeprügelt, bis sie zugeben, daß sie in der Partei waren. (von Lehndorff 1975: 113)
Viele Menschen starben bei und nach solchen Verhören oder gingen an den elenden Zuständen im Lager zugrunde. Diejenigen, die Kälte, Krankheiten und Hunger überlebten, hofften auf eine schnelle Ausweisung. In Viehtransporten, in denen unsägliche hygienische Zustände herrschten, wurden sie Richtung Westen deportiert. Mehrmals unterwegs ausgeraubt, erreichten sie nach Wochen ihr Ziel. Es wurden alle verbliebenen Deutschen vertrieben oder ermordet. Auch diejenigen, die während des Krieges geflohen und anschließend zurückgekehrt waren, ereilte dieses Schicksal.
2.1.4 Das Gesetz der Flucht
Ob geflohen oder vertrieben, die Ostdeutschen hatten einen langen Weg Richtung Westen vor sich, der viele Opfer forderte. Diesen beschwerlichen, millionenfach gegangenen Weg fasst Pfeil einfach in dem Begriff „Die Fluchtstraßen“ zusammen. „Es ging vieles vor sich auf diesen Straßen. Es wurde Gott verloren und Gott gefunden auf ihnen.“ (Pfeil 1948: 45) Im Straßengraben sah man erfrierende Menschen, gebärende Mütter und all das Gepäck, was auf der Flucht zu schwer geworden war, oder auf dem Wagen keinen Platz mehr fand. Achsen von Wagen brachen, Pferde verendeten, Nahrung ging zu Ende, Angehörige starben. Man sah das Nachbarschiff versinken oder den Wagen des Schicksalsgenossen auf dem Eis des Haffes einbrechen. Viele Trecks wurden vom Feinde eingeholt und im wahrsten Sinne des Wortes überrollt: Männer wurden verschleppt oder niedergeschossen, Frauen und Mädchen vergewaltigt und das letzte Hab und Gut, das man solange durchgebracht hatte, geplündert. (vgl. Pfeil 1948: 45) Auf die Frage, wie man mit diesen schrecklichen Eindrücken umging und wie man die Fluchtstraßen überlebte, antwortet Pfeil ganz selbstverständlich: „Man schaffte es einfach.“ Die Großmutter, die sonst den Weg ins Nachbardorf scheute, und für die es ein Wagnis gewesen war, bei Dunkelheit auf die Straße zu gehen, schaffte es einfach, als sei es schon immer in ihr gewesen. (vgl. Pfeil 1948: 31)
Die Flüchtlinge halfen sich gegenseitig auf und stützen einander. Doch es wurde auch niedergetreten und über Leichen gegangen. Pfeil wunderte sich, wie wenig Verlass auf den eigenen Charakter sei. „Unter der äußersten Bedrohung und Not zeigten sie ein anderes Gesicht. Wenn es um den letzten Platz im Lastkraftwagen geht, nur eine Familie noch mitkann; entweder wir oder sie, wird der Nachbar zum Feind.“ (Pfeil 1948: 35) Die Menschen entdeckten in dieser Notsituation eine Begabung zum Räuberleben, getreu dem Gesetz der Flucht: „Rette dein Leben und nimm was du brauchst.“ Moralauffassungen verloren ihre Gültigkeit und innere Kämpfe zwischen den alten Vorstellungen von Rechtlichkeit und dem Gesetz der Flucht brachen auf. Jeder musste für sich selbst entscheiden, wie viel er davon opfern wollte. Kaum einer der Flüchtlinge sei aber daran vorbeikommen, sich dem Gesetz der Flucht zu beugen, so Pfeil. In drei Schritten beschrieb sie die allmähliche Verrohung der Sitten, wenn es darum ging, das Lebensnotwendige zu besorgen.
1.) In der ersten Stufe nimmt man herumliegendes, herrenloses Gut an sich. Beispielsweise Heeresvorräte, die nun keine Verwendung mehr haben.
2.) In der zweiten Stufe steckt man Dinge ein, die sichtlich noch jemandem gehören, die der Besitzer aber nicht dringend braucht. Pfeil nennt das Beispiel eines Flüchtlings, der auf einem Fahrrad unterwegs ist, dessen Schlauch ein Loch hat, sodass er alle zwei Stunden von neuem aufgepumpt werden muss. Er nimmt sich von einem Anderen eine Luftpumpe, der sogar zwei Exemplare hat. Er wird die zweite Pumpe bestimmt nicht so dringend benötigen wie der Flüchtling, der wegen des Diebstahls trotzdem ein schlechtes Gewissen hat.
3.) In der dritten und letzten Stufe eignet man sich Sachen an, die jemand anderem gehören, und für den sie ebenso notwendig sind wie für einen selbst. Viele Mütter standen vor der Frage, ihre Kinder verhungern zu lassen, oder einer anderen Familie das zu nehmen, was ihnen genauso nötig war.
Nicht jeder Flüchtling habe die dritte Stufe erreicht, doch es sei merkwürdig, wie schnell man sich an das Gesetz der Flucht gewöhnt habe. Eine Entschuldigung vor sich selbst sei sehr bald nicht mehr nötig gewesen. (vgl. Pfeil 1948: 38ff.)
Schwierig gestaltete sich der Übergang vom Gesetz der Flucht zur Normalität. Mit dem Kriegsende brach ein Großteil der Normen und Verhaltensregeln zusammen. Die Not und der Hunger waren so groß, dass Eigentumsvergehen und Gewaltanwendungen zunahmen, was zu einer weiteren Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung führte. Allein im Bezirk Düsseldorf sind im Februar 1946 u. a. 1079 kg Butter, 1570 kg Margarine, 1836 kg Fleisch, und 4641 kg Mehl gestohlen worden. (vgl. Naujeck 1984: 28) Landwirte konnten die Felder nur unzureichend bestellen, weil die in den Boden gepflanzten Saatkartoffeln nachts wieder ausgegraben wurden. In der Silvesterpredigt 1946 rechtfertigte Kardinal Frings den Kohlenklau zur Existenzsicherung. Diese Aussetzung des biblischen Diebstahlverbots ging als Fringsen in den damaligen Wortschatz ein. (vgl. Naujeck 1984: 59) Der Gedanke, durch Raub, Diebstahl und Betrug sich im Westen eine neue Existenz aufzubauen, war nicht fremd. An einem Rechtfertigungsgrund mangelte es den Flüchtlingen ohnehin nicht, da sie doch alles verloren hatten und die Westdeutschen ihren Besitz horteten und nicht teilen würden. In einer Zeit, in der die staatliche Kontrolle fehlte und die Verhaltensregeln verschoben waren, nahmen sich manche das Recht heraus, die Besitzverteilung etwas zu korrigieren. (vgl. Pfeil 1948: 113)
2.1.5 Die Anzahl der Vertriebenen
Entsprechend der uneinheitlichen Begriffsbestimmungen und Statistiken schwankt auch die Anzahl der Vertriebenen in der Literatur erheblich. Es gibt aus mehreren Gründen keine verlässlichen Zahlen über die Vertriebenen. Als Grundlage gilt die Volkszählung von 1937. Jedoch wurden die Deutschen, die in Gebieten außerhalb des Deutschen Reiches wohnten, von der Volkszählung gar nicht erfasst. Man schätzte die gesamte deutsche Bevölkerung in Osteuropa auf 17 Millionen Menschen. (BMV 1966a: 8) Die Fortschreibung dieser Zahl war insofern ungenau, als verlässliche Angaben über Geburtenüberschuss, Kriegstote, Verluste während Flucht und Vertreibung und die Anzahl der nach dem Weltkrieg in der Heimat verbliebenen Deutschen fehlten. Hinzu kam die bewusste Verfälschung amtlicher Angaben durch die Alliierten, um das Problem zu verharmlosen (Vertreiberstaaten) oder besonders hervorzuheben (westliche Besatzungsmächte).
1946 führten die Alliierten eine Volkszählung durch, nach der sich insgesamt 9.593.800 Vertriebene in allen Besatzungszonen befanden. Sie verteilten sich zu 37,5 Prozent auf die sowjetische, zu 31,8 Prozent auf die britische, zu 28,6 Prozent auf die amerikanische, zu 0,8 Prozent auf die französische Besatzungszone und zu 1,2 Prozent auf Berlin. Demzufolge befanden sich 1946 nur 5,9 Mio. Vertriebene auf dem Gebiet der Westalliierten (ohne Berlin). (vgl. Jolles 1965: 92)
Als Momentaufnahme konnte diese Zahl als einigermaßen verlässlich angesehen werden. Es handelte sich jedoch um eine Mindestanzahl, die in den darauf folgenden Jahren jedoch ständig nach oben korrigiert wurde, was drei Gründe hatte. Erstens waren die Wanderbewegungen 1946 noch lange nicht abgeschlossen. Zweitens ließen sich immer mehr Vertriebene behördlich erfassen, weil nur registrierte Bewohner ein Anrecht auf Lebensmittelkarten und Bezugsscheine hatten. Drittens sprach das BVFG auch den Kindern von Vertriebenen, die im Westen geboren wurden, den Vertriebenenstatus zu. Dadurch ergab sich eine demographische Erhöhung der Anzahl der Vertriebenen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Statistische Bundesamt errechnete 1953 auf Grundlage der Volkszählung 1950 die stetig steigende Anzahl der Heimatvertriebenen im Bundesgebiet. Dieser Anstieg war, wie oben beschrieben, noch lange nicht abgeschlossen. Laut Bundesvertriebenen-ministerium befanden sich 1961 8.956.232 Vertriebene und 3.099.058 Flüchtlinge aus der SBZ/DDR in Westdeutschland. Es mussten also insgesamt über 12 Millionen Menschen versorgt werden, die mehr als 20 Prozent der westdeutschen Bevölkerung ausmachten. (vgl. BMV 1966a: 7)
Wegen der dynamischen Entwicklung, den unterschiedlichen Definitionen und der daher unübersichtlichen Quellenlage, wird in der vorliegenden Arbeit möglichst nicht auf absolute Zahlen zurückgegriffen, sondern auf Verhältnisse und Prozentangaben. Im Hinblick auf die Forschungsfrage genügt es, festzuhalten, dass es sich bei den Vertriebenen um einen großen Teil der Bevölkerung handelte und die sich daraus ergebenden Probleme der Integration Massenphänomene waren.
2.1.6 Die Verteilung der Vertriebenen
Bereits an den unterschiedlichen Begriffen und ständig steigenden Zahlen der Vertriebenen kann man ablesen, dass die Zwangsmigration nicht einheitlich verlief und über einen längeren Zeitraum andauerte. Es gab fünf sich zeitlich überschneidende Phasen, die für Westdeutschland zur Belastungsprobe wurden:
1.) Die Flüchtlingswelle, die bereits während des Krieges einsetzte.
2.) Die Vertreibung infolge des Zweiten Weltkrieges.
3.) Die Flüchtlinge aus der SBZ/DDR, bis zum Mauerbau 1961.[3]
4.) Die Kriegsheimkehrer aus den Arbeits- und Internierungslagern.
5.) Die Spätaussiedler, die größtenteils 1957/1958 nach Deutschland kamen.
Die Phasen verliefen mit unterschiedlicher Intensität, wobei die ersten beiden, die eigentliche Flucht- und Vertreibungsphase, durch ihre Konzentration am stärksten ins Gewicht fielen. Die Phasen drei bis fünf verliefen nicht geballt und hatten aufgrund der geringeren Menschenmassen ein vergleichsweise harmloses Ausmaß. Man darf jedoch nicht die psychische Wirkung übersehen, die dadurch entstand, dass die Entzerrung des Flüchtlingsstroms den Westdeutschen so vorkommen musste, als würde das Flüchtlingsproblem nicht abreißen. Seit 1990 kann man mit der Immigration von drei Millionen Deutschen aus Russland eine sechste Phase herausstellen, mit der sich diese Magisterarbeit jedoch nicht beschäftigt.
Analog zur zeitlichen, gab es auch eine ungleichmäßige räumliche Verteilung der Vertriebenen. Da der Flüchtlingsstrom aus dem Osten kam, ließen sich die Vertriebenen zuerst an den Osträndern der westlichen Besatzungszonen nieder. Sie stauten sich in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bayern. 1946 lag der Anteil der Vertriebenen an der Gesamtbevölkerung dort bei 23, 32 bzw. 19 Prozent. Im Vergleich dazu, lag der Vertriebenenanteil deutschlandweit bei nur 15 Prozent. Die genannten Regionen konnten daher als Hauptflüchtlingsländer bezeichnet werden. (siehe Anhang Nr. 2) Um den Flüchtlingsdruck einigermaßen abzubauen, gab es sehr früh Pläne zur Zerstreuung der Vertriebenen. Die in Anhang Nr. 3 befindliche Karte zeigt aber, dass sich bis 1956, trotz zahlreicher Umsiedlungsmaßnahmen, nicht viel an der einseitigen Verteilung der Vertriebenen geändert hatte. Da sich die französische Besatzungsmacht lange weigerte, Vertriebene in ihrer Besatzungszone aufzunehmen, lag die soziale Verantwortung des Staates, bis zur Gründung der BRD, allein in den Händen der Briten und US-Amerikaner.
Da der Wohnungsbestand in Westdeutschland durch Bombardierung erheblich zerstört oder beschädigt war[4], wurden die Vertriebenen hauptsächlich in ländlichen Gebieten untergebracht. Dort war zwar die Wohnraumversorgung geringfügig besser, es gab jedoch in den industriell unterentwickelten Regionen keine berufliche Perspektive.
2.1.7 Der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes
Die Verteilung und Umsiedlung der Vertriebenen erfolgte nicht nur aufgrund der Tragfähigkeit eines Gebietes, sondern oftmals aus Gründen der Familienzusammenführung. Bereits im Juni 1945 erteilten die britische und US-amerikanische Militärregierung dem Roten Kreuz die Genehmigung zur Versorgung der ankommenden Flüchtlinge. Das DRK betreute von 1945 bis 1949 13.136 ankommende Vertriebenentransporte und unterhielt 1.793 Flüchtlingslager mit 1.124.638 Insassen. Zudem wurden 70 Mio. Essensportionen ausgegeben und fünf Millionen Vertriebene ärztlich betreut. (vgl. Jolles 1965: 135)
Am 10.01.1946 bildeten das Evangelische Hilfswerk, der Deutsche Caritas Verband und das Deutsche Rote Kreuz einen gemeinsamen Suchdienst. Bis Ende desselben Jahres wurden 1,5 Mio. Menschen zusammengeführt, 3,5 Mio. Karteikarten bearbeitet und in München eine Zentralstelle der Heimatortskarteien eingerichtet. (vgl. Rudolph 1984: 148)
Zum fünfzigsten Bestehen des Bundes der Vertriebenen (im Folgenden „BdV“ abgekürzt) hielt Dr. Rudolph Seiters, Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, am 22.10.2007 ein Grußwort. Er erinnerte darin an die Flüchtlingsströme aus dem Osten, die auseinander gerissenen Familien und wie die von ihren Eltern auf der Flucht getrennten Kinder in ihrer großen Verzweiflung Hilfe suchten. In diesen Jahrzehnten habe das DRK mehr als 16 Mio. Menschen miteinander in Verbindung gebracht, eine große Zahl von Schicksalen aufgeklärt und hunderttausende von getrennten Familien wieder zusammengeführt. Heute arbeitet der Suchdienst des DRK weltweit, um nach vermissten Familienangehörigen zu suchen, wobei die Aufklärungsquote bei ca. 80 Prozent liegt.
2.2 Die Voraussetzungen auf dem Weg zur Integration
2.2.1 Der Wille zur Rückkehr in die Heimat
Wanderbewegungen und Vertreibungen hat es in der Geschichte immer gegeben. Aber was sich am Ende des Zweiten Weltkrieges in Osteuropa ereignete, war einmalig, abgesehen von der germanischen Völkerwanderung des 4. Jahrhunderts. Hier handelte es sich nicht um einzelne Bevölkerungsteile, die wie die Mennoniten, Salzburger oder Hugenotten ihre Heimat verlassen mussten, sondern das gesamte Deutschtum in den Ostgebieten sollte ausgelöscht werden.
„Alles ist in Bewegung geraten: Menschen, Güter, Vorstellungen, Werte …“, schrieb Elisabeth Pfeil. (vgl. Pfeil 1948: 11) Nicht nur materieller Besitz, Häuser, Mobiliar und Tiere gingen verloren, sondern auch Beziehungen lösten sich: Die Bande zwischen Schüler und Lehrer, zwischen Gutsherr und Gesinde, zwischen Freunden und Nachbarn.
Die Ostdeutschen begaben sich auf die Flucht, um sich in Sicherheit zu bringen, mit dem Ziel der Rückkehr. „Nach einer Umfrage von 1948 wünschten 90 Prozent der Flüchtlinge und Vertriebenen, in ihre Heimat zurückzukehren.“ (Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (im Folgenden „HdG“ abgekürzt) 2006: 115) Auch in früheren Kriegen ist man geflohen, hat Wertgegenstände im Wald vergraben und ist, nachdem Frieden geschlossen wurde, wieder zurückgekehrt. Im Ersten Weltkrieg, in dem die Rote Armee ebenfalls in Ostpreußen eingefallen war, flohen seine Bewohner bis nach Westpreußen, um anschließend heimzukehren. Warum sollte das jetzt anders sein? Der Gedanke, dass der gesamte deutsche Osten verloren gehen könnte, war den meisten Deutschen völlig fremd. Diejenigen, die es vielleicht geahnt haben, schwiegen, aus Angst vor den Nationalsozialisten. Es geht nicht darum, ob die Hoffnung auf Rückkehr in die Heimat objektiv berechtigt war, sondern um das Empfinden der Flüchtlinge. Nach Pfeil hätten die Flüchtlinge in ihrer Selbstwahr-nehmung keine besondere Schuld an ihrer Vertreibung. Die Vertreibung sei keine gerechte Strafe für begangene Schuld. Denn obwohl die Deutschen vorher unzähligen Slawen das gleiche Schicksal zugefügt hatten, rechtfertige es nicht die Vertreibung der Deutschen. (vgl. Pfeil 1948: 210ff.) Dass aus dieser einseitigen Betrachtung politische Forderungen erwachsen sollten und seitens der Politik betont wurde, dass die Flüchtlinge ein Anrecht darauf hätten wieder zurückzugehen, wird später weiter ausgeführt. Die meisten Flüchtlinge sahen sich in erster Linie als Evakuierte, die kurz im Westen verweilen sollten, bis sich die Lage in Ostdeutschland entspannt hatte. Auch als den meisten klar wurde, dass sie sich auf einen längeren Aufenthalt im Westen einrichten mussten, klammerten sie sich an den Gedanken der Rückkehr.
Von Anfang an gab es aber auch eine Gruppe unter den Ostdeutschen, die nicht mehr an eine Rückkehr in die Heimat glaubte. Es waren vor allem die Vertriebenen, die nach dem Krieg im Zuge von Umsiedlungsmaßnahmen ihre Heimat verlassen mussten und noch Zeugen der neu installierten polnischen oder russischen Gesellschaft wurden. Diejenigen, die sahen, wie polnische Bürger in ihr ehemaliges Haus einzogen, schätzten die Möglichkeit einer Rückkehr oder Restauration der alten Verhältnisse anders ein, als diejenigen, die noch mit der Vorstellung des unversehrten Hofes lebten, den sie verlassen hatten, als sie sich auf die Flucht begaben. (vgl. Rudolph 1984: 276)
2.2.2 Der Heimatbegriff
Der Gedanke an die Heimat, und die baldige Rückkehr dorthin, war vielen Vertriebenen ein Trost. Sie machten sich Gedanken, in welchem Zustand sie diese vorfinden würden, jetzt, wo doch niemand mehr da sei, der sie schützen könne. „Solange der Flüchtling auf Heimkehr hofft, sinnt er auf Wiederherstellung. Er macht Pläne, was er nach der Rückkehr tun würde, wie er sich in der alten Heimat neu einrichten würde.“ (Pfeil 1948: 72)
Heimat bedeutete für die Ostdeutschen eine vertraute Umgebung: Ein Gebiet, geprägt von einer bestimmten Landschaft, mit intakten Beziehungen, stabiler Ordnung und bekannten Regeln des Zusammenlebens. Heimat war der Raum, mit dem man eine einzigartige Sitte und Brauchtum verband und der Sicherheit gewährte. Es waren vor allem die vertrauten Mitmenschen, die Akzeptanz in einer bestimmten Gruppe und die gewohnte Umwelt, die Heimat werden ließen. Das verdeutlicht am besten das Beispiel der wenigen Daheimgebliebenen. Nachdem der Großteil der ostdeutschen Bevölkerung vertrieben war, wurde auch für sie die Heimat zur Fremde, obwohl sie am gleichen Ort geblieben waren. (vgl. Bendel 2003: 502) Die Bewahrung der Heimat und der legitime Gedanke an Rückkehr gab den Vertriebenen eine Identität.
Wir leben sicherlich nicht schlechter, als wir in unserer Heimat gelebt hätten. Aber unsere sozialen Bindungen sind zerstört, unsere kommunikativen Begegnungen sind weg; die Mundart stirbt aus, damit stirbt Kultur weg. […] Heimat ist nicht mehr das Land allein, in dem ich geboren wurde - das sind die Menschen, die die gleiche Wellenlänge haben wie ich. Da fühl ich mich wohl und das ist für mich Heimat. Und nicht das Stück Land allein – obwohl es wunderschön war. Ich bin ja erst vor einer Woche [von einer Schlesienfahrt] wiedergekommen. Warum fahren heute noch 300 Leute in Busfahrgemeinschaften mit 80 oder 85 Jahren nach Hause? Weil sie an diesem Stück Land hängen und sagen ‚das war mein Lebensbereich, das war meine Welt. Da konnte ich leben und hätte sterben können. Hier muss ich in fremder Erde beerdigt werden.’ (Gespräch mit P0608)
Man sollte den Heimatbegriff aber nicht übersteigern, warnte Pfeil. Sie beobachtete, dass sich die Heimat im Gedächtnis der Flüchtlinge immer mehr zu einem verlorenen Paradies wandle, in dem alles gut war, was jetzt schwierig sei. Die Landschaft, das Zusammenleben der Menschen, einfach alles, bekäme einen zauberhaften Schimmer und könne leicht zu Verzerrungen in der Wahrnehmung führen. Einige Vertriebene würden sich eine idealisierte Welt aufbauen, in der alles perfekt war, wo sie selbst bessere Menschen waren, und würden dabei vergessen, dass sie auch in der Heimat Schwierigkeiten gehabt haben. (vgl. Pfeil 1948: 108)
Die Problematik des Heimatbegriffs stellt sich nicht nur für die Vertriebenen, sondern auch für die ausgebombten und evakuierten Westdeutschen. Auch ihr Sozialgefüge wurde empfindlich gestört. Es besteht jedoch ein gewaltiger Unterschied zwischen Vertreibung aus der Heimat und ihrem Verlust durch Bombenangriffe.
Der Ausgebombte, der aus der Heimat gehen musste, hat immer das Bewusstsein: ‚Ich kann jederzeit wieder heimkehren, auch wenn die Heimat zerstört ist.’ Die Vertriebenen haben dieses Bewusstsein nicht. Sie haben nicht die Möglichkeit zurückzukehren. Das Recht dazu wird ihnen mit Gewalt verweigert. Gerade aus diesem Grunde ist unter ihnen das Bewusstsein, dass es ein Recht auf Heimat gibt, in besonderer Weise lebendig geworden. (Sladek 1978: 51f.)
Darüber hinaus, hätten die Vertriebenen ihre stammesmäßige, völkisch gebundene innerkulturelle Kontinuität verloren. (vgl. Sladek 1978: 51f.)
2.2.3 Die Bedeutung der Stammesgemeinschaft
Elisabeth Pfeil kam ebenfalls zu dem Schluss, dass Erkenntnisse über die stammespsychologischen Eigenheiten möglicherweise geholfen hätten, „[…] das Zusammenleben [der Vertriebenen und der Westdeutschen] in der ersten Generation und das Zusammenwachsen in der zweiten zu erleichtern.“ (Pfeil 1948: 57)
Vertriebene, die mit den Worten „Was wollen denn die Polacken hier?“ begrüßt wurden, bemerkten schnell, dass Rivalitäten zwischen den deutschen Volksstämmen existierten beziehungsweise konstruiert wurden. Konnte man als Reichsdeutscher dem Westdeutschen noch einigermaßen verständlich machen, dass man demselben Volk angehörte, traf man als Volksdeutscher auf weniger Verständnis.[5]
Max Weber behauptet, dass „[…] fast jede Art von Gemeinsamkeit und Gegensätzlichkeit des Habitus und der Gepflogenheiten Anlaß zu dem subjektiven Glauben werden kann, daß zwischen den sich anziehenden oder abstoßenden Gruppen Stammesverwandtschaft oder Stammesfremdheit bestehe.“ (Weber 1972: 237) Bereits Unterschiede der Lebensführung, der Bart- und Haartracht, Kleidung, Ernährungsweise, der Arbeitsteilung der Geschlechter und des Dialekts könnten Anlass zur Verachtung der Andersgearteten geben. Hinzu kam das ohnehin schreckliche Erscheinungsbild der Flüchtlinge bei ihrer Ankunft. Diese Verhaltensmuster müssen als Konventionen bzw. Symbole ethnischer Zugehörigkeit verstanden werden und wirken entweder abstoßend oder anziehend. Nach Weber könnten alle Unterschiede der „Sitten“ ein spezielles „Ehr- und Würde-Gefühl“ ihrer Träger speisen. (vgl. Weber 1972: 236) „Der so entstehende deutliche Kontrast der Lebensführung pflegt dann auf beiden Seiten die Vorstellung gegenseitiger ‚Blutsfremdheit’ zu wecken, ganz unabhängig vom objektiven Sachverhalt.“ (Weber 1972: 240)
Nicht jeder Vertriebene sah sich selbst als Ostdeutscher, sondern spezifisch als Schlesier, Pommer oder Ostpreuße, der sich nicht allgemein gegen die Westdeutschen zu behaupten hatte, sondern gegen Bayern, Westfalen oder Hessen. Im Kapitel über die Landsmannschaften wird die stammeseigene Identität nochmals aufgegriffen und es wird darin erläutert, warum die Bindung zum Landsmann und das regelmäßige Zusammenkommen so wichtig für einige Vertriebene war bzw. ist.
Wie oben beschrieben entsteht durch den Glauben an eine Blutsverwandtschaft ein ethnisch bedingtes Gemeinschaftshandeln. Wenn die Ebene der Volksstämme verlassen und das Phänomen Nation betrachtet wird, führt dieser Abstammungsglaube nicht zu einer Abschottung, sondern kann auch die Aufnahme und Integration der Vertriebenen begünstigen.
Gerade weil der Begriff der Nation schwer zu fassen ist, sei es leicht, Solidaritätsglauben zu entwickeln. Nach Weber ist das nationale Gemeinschaftsgefühl etwas Uneindeutiges, das aus vielen Quellen gespeist wird. Die gemeinsamen historischen Erinnerungen, Konfession, Sprache, Sitten, ein rassenmäßiger Habitus und die politische Macht seien Beispiele des „spezifischen ‚Massenkulturguts“, das eine Nation entstehen ließe. (vgl. Weber 1972: 238ff.) Im Nationalsozialismus bestimmte die Rassentheorie, wer Deutscher sein sollte und wer nicht. Vielleicht trug die Indoktrination der Leitsprüche „Du bist nichts, dein Volk ist alles!“ und „Volksgenosse ist Volksgenosse!“ mit dazu bei, eine Volkssolidarität gegenüber den ankommenden Flüchtlingen zu wecken. Vermutlich haben die gemeinsame Sprache, auch wenn sie in unterschiedlichen Dialekten gesprochen wurde, und das gegenseitige Verstehen die Aufnahme der Vertriebenen begünstigt.
[...]
[1] Im Zuge des Griechisch-Türkischen Krieges von 1922 kam es zu einer Massenflucht der 1,5 Mio. in der Türkei lebenden Griechen. Um die kleinasiatische Katastrophe einigermaßen in den Griff zu bekommen, wurde unter Federführung des Völkerbundes im Lausanner Abkommen ein Bevölkerungsaustausch vereinbart. Nach der Vorstellung eines homogenen Nationalstaates, mussten alle Christen die Türkei verlassen, im Gegenzug alle Muslime aus Griechenland emigrieren. Die anfänglich geordnete Umsiedlung verlief sich jedoch schnell wieder in Flucht und Vertreibung.
[2] „Dekret vom 19. Juni 1945 über die Bestrafung der nazistischen Verbrecher, der Verräter und ihrer Helfershelfer sowie über die außerordentlichen Volksgerichte.“ (BMV 1957: 211)
„Dekret vom 19. September 1945 über die Arbeitspflicht der Personen, welche die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft verloren haben.“ (BMV 1957: 259)
„Dekret vom 25. Oktober 1945 über die Konfiskation des feindlichen Vermögens und die Fonds der nationalen Erneuerung.“ (BMV 1957: 263)
[3] Bis zum Mauerbau 1961 verließen ca. 3 Millionen Menschen die SBZ / DDR. Das Bundesvertriebenenministerium ermittelte auf Grundlage der Anträge im Bundesnotaufnahmeverfahren einen Anteil der Vertriebenen an den SBZ-Flüchtlingen von ca. 25%. (BMV 1966a: 20)
[4] Von den im Jahre 1939 bestehenden 10,6 Mio. Wohnungen in Westdeutschland wurden bis 1945 2,2 Mio. vollständig und weitere 2 Mio. teilweise zerstört. (vgl. BMV 1966b: 15)
[5] Als Reichsdeutsche wurden Deutsche bezeichnet, die 1939 in den Grenzen des Deutschen Reiches lebten. In Abgrenzung dazu, lebten Volksdeutsche auch außerhalb dieser Gebiete, beispielsweise in den, infolge des Versailler Vertrages abgetrennten, Gebieten Posen, Westpreußen und Teilen von Oberschlesien. Volksdeutsche mussten mitunter eine andere Staatsbürgerschaft annehmen und waren bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges vom Baltikum bis zum Balkan weit verbreitet.
- Arbeit zitieren
- Magister Artium Markus Häßelbarth (Autor:in), 2008, Die Integration der deutschen Vertriebenen in Westdeutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115080
Kostenlos Autor werden


















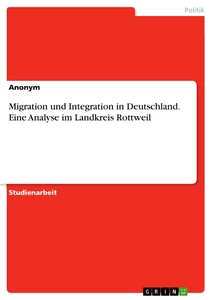



Kommentare