Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Was ist Recht?
3. Walter Benjamin: Die Paradoxie der Gewalt
3.1 Gewalt als Mittel und Bedrohung des Rechts
3.2 Rechtsetzende und rechtserhaltende Gewalt
3.3 Göttliche Gewalt
4. Jacques Derrida: Das Paradox des Ursprungs
4.1 Différance und Dekonstruktion
4.2 Die Dekonstruktion ist die Gerechtigkeit
4.3 Recht und Gerechtigkeit
5. Giorgio Agamben: Das Paradox der Souveränität
5.1 Der Ausnahmezustand
5.2 Ausnahme und Regel
5.3 Ausnahmezustand und „Lebens-Form“
6. Schlussbetrachtung
7. Literatur
1. Einleitung
Das Motto dieser Arbeit kann auf eine einfache Formel gebracht werden: drei Autoren – drei Paradoxien. Ausgehend von Kants Definition des Rechtsbegriffs werden drei Autoren behandelt, die gemeinsam eine kanonische Rezeptionsgeschichte schreiben: Jacques Derrida liest Walter Benjamin, Giorgio Agamben liest Jacques Derrida. Genau genommen rekurrieren aber Derrida und Agamben zuforderst auf Benjamin. Dessen Aufsatz Zur Kritik der Gewalt (1921) ist die Grundlage für Überlegungen zu dem Verhältnis von Recht, Gewalt und Gerechtigkeit. Derrida widmet diesem Aufsatz mit Gesetzeskraft. Der „mystische Grund der Autorität“ (1990) zwei ausführliche Vorträge, in denen er ihn einer dekonstruktivistischen Lektüre unterzieht. Für Agambens Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben (1995) hat er katalytische Wirkung. Er droht zwar, in der Fülle der referierten Textquellen unterzugehen. Es ist aber nicht zu übersehen, dass Agamben vor allem diesem, aber auch anderen Texten Benjamins viel verdankt.
In dieser Arbeit werden drei Paradoxien formuliert: die Paradoxie der Gewalt (Benjamin), die Paradoxie des Ursprungs (Derrida) und die Paradoxie der Souveränität (Agamben). Während Agamben seine Paradoxie explizit benennt und zum Titel der systematischen Vorüberlegungen seines Buches Homo sacer macht, formulieren Benjamin und Derrida lediglich, was ich jeweils als Paradoxie bezeichne. Die Lektüre der drei Autoren und der drei Kerntexte wird weitgehend unabhängig und in autonomen Blöcken stattfinden. Erst in der Schlussbetrachtung wird es zu übergreifenden Interpretationen kommen. Zunächst wird Benjamins Kritik der Gewalt insbesondere in Bezug auf die Unterscheidungen von rechtsetzender und rechterhaltender Gewalt dargelegt und interpretiert. Daran schließt sich Derridas Gesetzeskraft an. Es wird in groben Zügen in die Terminologie der Dekonstruktion eingeführt, um die Lektüre vor diesem Hintergrund verständlich zu machen. Schließlich wird Agambens Schlüsselfigur des homo sacer im Zusammenhang mit der Carl Schmitt entlehnten Souveränitätstheorie vorgestellt. Es werden vor allem Agambens struktur-theoretische Überlegungen dazu und die Auflösung dieser beiden Konzeptionen in der der „Lebens-Form“ referiert. Am Schluss der Arbeit stehen schließlich einige vergleichende Überlegungen zu dem Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit bei den drei Autoren und zu der Position, in der sie jeweils zu ihrem theoretischen Gegenstand stehen.
2. Was ist Recht?
Die allgemeine Beantwortung der Frage danach, was Recht sei, ist mit ähnlichen Schwierigkeiten verbunden, wie die der Frage nach der Wahrheit oder dem Sinn des Lebens. Darauf macht Kant am Anfang der Metaphysik der Sitten (1797) aufmerksam, bevor er dennoch eine Definition gibt. Danach ist Recht „der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit zusammen vereinigt werden kann.“[1]
Kant ist einer der ersten, die eine Definition des Rechts vornehmen. Mit seiner Rechtslehre formalisiert sich das Recht, d. h. es wird durch Abstraktion vergegenständlicht und so auf die Grundlage von Vernunftüberlegungen gestellt. Zugleich werden Recht und Gerechtigkeit begrifflich voneinander getrennt. Gerechtigkeit wird der Sittlichkeit (Moralität) zugeordnet, während das Recht (Legalität) davon unterschieden wird. Das Recht betrachtet z. B. allein die Handlung. Die Moralität fragt nach den Maximen, die die Handlung leiten.
In der Antike liegen Recht und Moral noch eng beieinander. Die Gesellschaft entwickelt und reguliert seine Überzeugungen von Gut und Böse selbst und leitet daraus ihre Rechtsordnung ab. Ulpian überliefert in den Digesten, Gerechtigkeit sei „der beharrliche und beständige Wille, jedem sein Recht zukommen zu lassen“[2], wobei das Recht „die Kunst des Guten und Gleichen“[3] sei. Recht ist noch keine formale Wissenschaft, sondern eine kunstvolle Auseinandersetzung mit Gerechtigkeit und Moral. Mit der Entstehung staatlicher Herrschaft rücken Recht und Moral weiter auseinander, während die Politik immer stärker an Einfluss gewinnt. Aufklärung und Säkularisierung besiegeln schließlich den Übergang des Rechts in die Obhut weltlicher Volksvertreter.
Nach der Definition Kants können zwei Merkmale bestimmt werden, die das Recht ausmachen. Danach lässt sich ableiten, dass das Recht der Titel eines Katalogs an „Bedingungen“ ist, die sich an ein soziales Leben in gleicher Freiheit aller richten. Kurz: Recht ist ein System von Normen. Dies gilt aber ebenso für die Moral. Um sich davon zu unterscheiden, bedarf es eines weiteren Merkmals. Kant verknüpft deshalb „jedermanns Freiheit“ zusätzlich mit Zwang: „Recht und Befugnis zu zwingen bedeutet also einerlei.“[4] Diese beiden Merkmale bilden die Grundlage für jede weitere Ausdifferenzierung z. B. in Natur- und positives, öffentliches und privates, objektives und subjektives Recht.
Für Kant ist Recht die Auslotung von Freiheit und Zwang. Die beiden Begriffe bilden einen logische Gegensatz, der wiederum im Rechtsbegriff abgebildet wird. Freiheit, die durch das Handeln eines anderen eingeschränkt wird, erfährt Zwang. Um diesen auszuräumen und das Gleichgewicht an Freiheit wieder herzustellen, bedarf es eines weiteren Zwanges, d. h. der Gewalt. In Anlehnung an das dritte Newtonsche Axiom (actio = ractio) bewegt sich der Mensch für Kant prinzipiell frei im Rechtsraum. Jede Kollision dieser aktiven Freiheit löst eine Reaktion in Form von Zwangsausübung aus. Zwang ist das Andere der Freiheit. Er ist illegitim, wenn er ein „Hindernis der Freiheit“ ist. Legitim ist er, wenn er die Freiheit daran hindert, ein solches Hindernis für eine andere Freiheit zu sein.
In der Einleitung der Rechtslehre betont Kant konsequent die Freiheit des Einzelnen und gesteht lediglich dem Zwang regulative Kraft zu. Am Übergang vom Privatrecht zum öffentlichen Recht wird aber deutlich, dass er zum einen den privatrechtlichen Zustand – also das unmittelbare Aufeinandertreffen von Individuen – als tendenziell gewalttätig ansieht. In ihm kann sich keiner seiner Freiheit und Unversehrtheit sicher sein. Zum anderen ist Recht in dem als Staat organisierten Rechtsraum die Ausübung von Gewalt. Es ist vertraglich gesichert und in drei Bereiche (Exekutive, Legislative, Judikative) aufgeteilt. Recht ist also grundsätzlich an Gewalt gebunden.
Dabei unterscheidet Kant die Gewaltsamkeit am Ursprung einer Rechtsordnung nicht explizit von der innerhalb eines bestehenden Rechtssystems. Er betont dagegen die Pflicht eines jeden, in einen staatlichen Rechtszustand einzutreten, wozu „jeder den anderen mit Gewalt antreiben darf.“[5] Die Einführung einer Rechtsordnung kann durchaus gewaltsam sein. Sie kann auch nachträglich legitimiert werden. Es sind jedenfalls keine „Vernünfteleien“[6] über den Ursprung des Rechts anzustellen. Die wie auch immer monopolisierte Gewalt garantiert dem Einzelnen schließlich die Sicherheit vor Gewalttätigkeit, der er sich durch sein Hinterfragen der Entstehung der Rechtsordnung wieder aussetzen würde. Einmal installiert, repräsentiert die Staatsgewalt die oberste aller Gewalten der Gesellschaft. Die Gewaltenteilung bringt zum Ausdruck, wie sich diese Gewalt zwischen dem Volk und seinem Repräsentanten aufteilt. Während die gesetzgebende Gewalt stets beim Volk verbleibt, verfügt die ausübende Gewalt in den Händen einer Regierung über dieses. Letztere bleibt aber ersterer untergeordnet und ist grundsätzlich austauschbar. Diesen Austausch stellt sich Kant als weitestgehend gewaltlos vor.[7]
Kants Überlegungen stehen stark unter dem Eindruck der Französischen Revolution. Sie geben das Spannungsfeld wieder, das zwischen dem Machtmissbrauch des Absolutismus und der Gewalttätigkeit der Revolution liegt, ohne dass die Frage der Gewalt eingehend erörtert wird. In der konstitutionellen und republikanischen Organisation des Gemeinwesens liegt für ihn der gute Grund, warum die Einführung einer Rechtsordnung gewaltsam sein kann. Eine derartige gesellschaftliche Verfasstheit bildet die nachträgliche Legitimation für einen zunächst illegitimen Gewaltakt. Innerhalb einer solchen Rechtsordnung stellt sich die Frage der Legitimität von Gewalt nicht mehr.
3. Walter Benjamin: Die Paradoxie der Gewalt
3.1 Gewalt als Mittel und Bedrohung des Rechts
Es ist das Verdienst Walter Benjamins, sowohl auf die enge Verbindung zwischen Recht und Gewalt als auch auf das Problem der Legitimierung von Gewalt hingewiesen zu haben. In seinem Aufsatz Zur Kritik der Gewalt macht er sich die Darstellung des Verhältnisses der Gewalt zu Recht und Gerechtigkeit zur Aufgabe. Seine „kritische“ Vorgehensweise ist dabei weniger eine Untersuchung der Grenzen des Vernunft- und Urteilsvermögens (Kant) sondern eher, im traditionell griechischen Sinne, ein unter- und entscheidendes Beurteilen (Platon, Aristoteles). Indem er die Gewalt einer Kritik unterzieht, will er eine „scheidende und entscheidende Einstellung“[8] ermöglichen, die zuverlässige Kriterien zur Beurteilung von Gewalt an die Hand gibt.
Die Methode Benjaminscher Kritik ist also prinzipiell das Treffen einer Reihe von Unterscheidungen. Am Anfang sind diese grundlegender und propädeutischer Natur. Benjamin unterscheidet zwischen Zweck und Mittel, Naturrecht und positivem Recht, rechtmäßiger und unrechtmäßiger Gewalt, Natur- und Rechtszweck und zwischen Gewalt innerhalb und außerhalb einer Rechtsordnung. Diese Unterscheidungen und die damit einhergehenden Fragen und Probleme sind spätestens seit Kant feste Bestandteile der Rechtsphilosophie. Sie können als allgemeine Einführung in die Problematik von Recht und Gewalt gelesen werden.
Wichtig ist Benjamins Hinweis auf das „Grunddogma“, das sich Naturrecht und positives Recht teilen und das diese Problematik auf paradigmatische Weise vor Augen führt. Demnach können gerechte Zwecke „durch berechtigte Mittel erreicht werden, berechtigte Mittel an gerechte Zwecke gewendet werden.“[9] Diesen Zirkel sieht Benjamin einer unausweichlichen Antinomie ausgesetzt, sollte sich herausstellen, dass gerechte Zwecke und berechtigte Mittel gar nicht unabhängig voneinander bestimmt werden können. Kann gezeigt werden, dass es für einen Teil dieses Zirkels keine gültigen Kriterien gibt, so wird das Dogma hinfällig.
Das bringt die Gewalt auf den Plan, deren Bestimmung Hinweise auf die Berechtigung von Mitteln liefern würde. Kriterien für Gewalt ließen Schlüsse auf die Rechtmäßigkeit von Mitteln allgemein zu. Mit der Gewalt als Mittel glaubt Benjamin zeigen zu können, dass zwischen dem Reich der Zwecke und dem Reich der Mittel ein „unvereinbare[r] Widerstreit“[10] gegeben ist, dass, mit anderen Worten, Gewalt als Mittel unmöglich in einer intendierten Beziehung zu gerechten Zwecken stehen kann. Mit der Festlegung auf die Untersuchung von Gewalt als Mittel scheidet Gewalt als (Selbst-)Zweck aus. Dies nicht zuletzt deswegen weil „Vernunftbestimmung gerechter Zwecke nach dem Kriterium der Formalität […] unmöglich“[11], Gewalt als Zweck also, wie sich zeigen wird, nur im Reich des Göttlichen zu finden ist.
Unrechtmäßige Gewalt stellt für jede Rechtsordnung eine Bedrohung von außerhalb dar. Es liegt daher im Interesse des Rechts im Allgemeinen, sich vor ihr zu schützen. Dies könnte es durch das grundsätzliche Untersagen von Gewalt (als Mittel) zu erreichen suchen. Dass das keine realistische Methode ist, verdeutlicht der performative Widerspruch, in den eine solche Forderung geraten würde. Wie, wenn nicht mit Gewalt, sollte sie durchgesetzt werden? Plausibler ist die Methode der Monopolisierung, was der Inklusion der Gewalt in die Rechtsordnung gleichkommt. Auf diese Weise wird individuelle Gewalt verboten und staatliche Gewalt legitimiert. Das Recht allein soll es sein, das über den Einsatz von Gewalt verfügt. Das positive Recht kennt diese Art der Sanktionierung von Gewalt als „historische Anerkennung ihrer Zwecke“.[12]
Damit ist die Bedrohung des Rechts aber nicht abgewendet. Wie Benjamin am Streik- und Kriegsrechts verdeutlicht, droht dem Recht auch und vor allem von rechtmäßiger Seite, d. h. von innerhalb der Rechtsordnung Gefahr. In beiden Fällen sanktioniert das Recht Gewalt für einzelne oder Gruppen von Rechtssubjekten. Dadurch aber wird diesen nicht nur die Möglichkeit gegeben, eine bestehende Rechtsordnung zu modifizieren, sondern auch, sie im Zweifelsfall zu beseitigen und durch eine neue zu ersetzen. Eskaliert ein Streik etwa zu einem „revolutionären Generalstreik“, so wird es der organisierten Arbeiterschaft möglich, eine neue staatliche Organisation zu erzwingen. Ein offizieller Friedensschluss stellt für Benjamin generell die Anerkennung neuer Rechtsverhältnisse, auch von der unterlegenen Seite, dar.
3.2 Rechtsetzende und rechtserhaltende Gewalt
Was die Unterscheidung von rechtmäßiger und unrechtmäßiger Gewalt impliziert, ist einmal der rechtserhaltende, vor allem aber der „rechtsetzende Charakter“[13] der Gewalt. Wenn sich die rechtmäßige Gewalt, weitestgehend monopolisiert in den Händen des Rechts, gegen externe und interne Bedrohung zur Wehr setzt, so genau deswegen, weil nicht einzelne Bestandteile der Rechtsordnung in Gefahr sind sondern die Rechtsordnung als Ganze. Die Sorge des Rechts, sich als Recht zu erhalten, leitet sich aus der fatalen Dimension ab, die in der Bedrohung vor allem durch es oder in ihm selbst liegt. Die Anerkennung dieser Bedrohung bedeutet daher die Anerkennung des rechtsetzenden Charakters der Gewalt. In diesem Sinne liegt das Wesen der Gewalt nicht in verbrecherischer und räuberischer Aktivität.[14] Es besteht auch nicht in der akzidentiellen Verabschiedung von Gesetzen, sondern vielmehr in der generellen Notwendigkeit, dies zu tun und so notwendigerweise das Recht zu errichten.
Damit ist eine der wichtigsten Unterscheidungen in Benjamins Kritik erwähnt: die Unterscheidung von rechtsetzender und rechtserhaltender Gewalt. Benjamin schließt seine differenzierende Propädeutik mit der Bemerkung ab: „Alle Gewalt ist als Mittel entweder rechtsetzend oder rechtserhaltend. Wenn sie auf keines dieser beiden Prädikate Anspruch erhebt, so verzichtet sie damit selbst auf jede Geltung.“[15] Rechtserhaltung kann auf Rechtsetzung zurückgeführt werden. Weil letztere möglich ist, ist erstere notwendig. Umgekehrt gilt, dass jede Setzung von Recht danach strebt, dieses dauerhaft zu sichern. Rechtsetzung und Rechtserhaltung überlagern sich also. „Jede Rechtserhaltung ist (auch) rechtsetzend, jede Rechtsetzung ist (auch) rechtserhaltend.“[16] Die Erlassung eines Gesetzes z. B. kann sowohl dazu dienen, in einem Präzedenzfall gegen eine Gesetzesübertretung vorzugehen, als auch dazu, die Rechtsordnung gegen weitere Rechtsbrüche dieser Art zu schützen. Solchermaßen setzt sich das Recht mit jeder rechtserhaltenden Maßnahme neu.
Durch die Repräsentation der Setzung in der Erhaltung und der Erhaltung in der Setzung wird die Gewalt innerhalb des Rechts kontinuierlich weitertransportiert. Letztlich ist sie im Recht stets „latent anwesend“.[17] Wesentlich deutlicher als bei Kant ist sie im Zentrum von Benjamins differenzieller Struktur des Rechts eingelagert. Die Überschneidung und gegenseitige Repräsentation von Setzung und Erhaltung zeigt aber, dass diese Unterscheidung formal gesehen die schwächste ist. Sie lässt sich nicht in jedem Fall aufrechterhalten. Etwas „Morsches im Recht“[18] kündigt sich an, wie Benjamin in bezug auf die Todesstrafe bemerkt. Diese nämlich diene nicht dazu, einen konkreten Rechtsbruch zu bestrafen, als vielmehr die bestehende Rechtsordnung und die darin monopolisierte Gewalt zu bekräftigen.
In ähnlicher Weise fallen in der Institution der Polizei im modernen Staat rechtsetzende und rechtserhalten Gewalt zusammen. Die moderne Polizei ist nicht nur rechtserhaltend, insofern sie das Gesetz anwendet. Sie ist gleichermaßen rechtsetzend, insofern sie Erlasse ergehen lässt – insbesondere da, wo keine eindeutige Rechtslage besteht. In ihr kündigt sich die „Unentscheidbarkeit aller Rechtsprobleme“[19] an, die auch die In-Frage-Stellung des erwähnten „Grunddogmas“ der Rechtstheorie besiegelt. Benjamin zeigt mit der Überlagerung von Rechtsetzung und Rechtserhaltung, dass die Zweck/Mittel-Relation nicht dienlich ist, das Problem des Rechts, d. h. die Frage nach seiner Legitimität zu klären. Wenn Gewalt im Recht immer – sei es latent oder akut – auf nicht entscheidbare Weise – sei es rechtsetzend oder rechterhaltend – anwesend ist, so kann nicht auf die Zweck/Mittel-Relation zurückgegriffen werden, um zu bestimmen, wann Mittel rechtens bzw. wann Zwecke gerecht sind. Die Unentscheidbarkeit, die die Gewalt in die Opposition von Setzung und Erhaltung des Rechts einführt, überträgt sich auf das Verhältnis von Zweck und Mittel.
Diese Einsicht geht auf Kosten eines konsequenten Abschlusses des bis dahin durchgeführten Unterscheidungskanons. Mit der logischen Ausweglosigkeit der Unterscheidung von Rechtssetzung und Rechtserhaltung erfährt dieser eine empfindliche Zäsur. Der „scheidenden und entscheidenden Einstellung“ der Kritik bleibt die letzte Entscheidung verwehrt. Benjamin hilft sich damit, die Frage neu zu formulieren. Sie lautet nicht mehr: Wann ist Gewalt als Mittel rechtens? sondern: Gibt es voneinander losgelöste Formen der Mittel und Zwecke? Gibt es andere Arten von Gewalt als die, die im (dogmatischen) Zirkel von Mittel und Zeck gefangen sind?
3.3 Göttliche Gewalt
Wenn zwischen berechtigten Mitteln und gerechten Zwecken ein Widerspruch entsteht und Gewalt sich stattdessen unmittelbar manifestieren kann, dann steht die Zweck/Mittel-Relation im Zeichen des Schicksals. Die „Schicksalsgewalt der Geschichte im Reich reiner zweckentbundener Vermittlung“[20] kann bewirken, dass eigentlich gewaltsame Mittel – etwa die Niederlegung der Arbeit im „proletarischen Generalstreik“[21] – das Prädikat „gewaltsam“ wieder verlieren. Dies aber nur deswegen, weil sie ihre Gewaltlosigkeit als „reine Mittel“ wiederum einer Gewalt verdanken: der „schicksalsmäßigen Gewalt“ der Geschichte, zu der sie aber in keiner vorentschiedenen Relation stehen. Das Schicksal waltet schließlich außerhalb jeder Zweck/Mittel-Relation. Das „reine Mittel“ verdankt seine Reinheit der Tatsache, dass die Gewalt des Schicksals es aus jedem Bezug auf (Rechts-) Zwecke befreit. Solchermaßen rein vermittelt es nichts mehr. Die ihm entsprechende Gewalt wirkt unmittelbar.
Genauso wenig bezieht sich die Gewalt in alltäglichen Ausbrüchen des Zorns auf einen bestimmten Zweck. „Sie ist nicht Mittel, sondern Manifestation.“[22] Die Mythologie hält, wie Benjamin an der Niobesage zeigt, weitere Beispiele für diese rein manifeste Gewalt bereit, weswegen er sie „mythische Gewalt“ nennt. Allerdings hat sie einen Makel. Sie ist trotz ihres manifesten Charakters rechtsetzende Gewalt. Liegt ihr auch mehr am singulären Exempel, am unüberhörbaren Machtwort als an der Verfolgung von Rechtszwecken, so will es das Schicksal doch, dass auch dabei Recht eingesetzt wird. Um also nicht wieder in das Paradox von Rechtsetzung und Rechtserhaltung zurückzufallen, trifft Benjamin eine letzte Unterscheidung: die von mythischer und göttlicher Gewalt.
Die Charakterisierung der göttlichen Gewalt ist – außer dass sie als „Gegensatz in allen Stücken“[23] zur mythischen Gewalt bezeichnet wird – äußerst dunkel. Das macht Benjamins Auflistung ihrer Merkmale deutlich: „Ist die mythische Gewalt rechtsetzend, so die göttliche rechtsvernichtend, setzt jene Grenzen, so vernichtet diese grenzenlos, ist die mythische verschuldend und sühnend zugleich, so die göttliche entsühnend, ist jene drohend, so diese schlagend, jene blutig, so diese auf unblutige Weise letal.“[24] Einige dieser Adjektive sind zum Gegenstand eingehender philologischer Analysen und Kontroversen geworden, was indirekt das Enigmatische dieser göttlichen Gewalt zum Ausdruck bringt.[25]
[...]
[1] Kant 1990: 66 f. (A 230).
[2] Wesel 1992: 393: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.
[3] Wesel 2001: 58: Ius est ars boni et aequi.
[4] Kant 1990: 69 (A 232).
[5] Kant 1990: 169 (A 312).
[6] Kant 1990: 177 (A 318).
[7] Vgl. Kant 1990: 203 f. (A 340). In einer ausführlichen Fußnote diskutiert Kant die gewaltsame Entthronung eines Monarchen und sieht diese durch das „Notrecht“ legitimiert. Vgl. Kant 1990: 179 f. (A 320 ff.), Anm.
[8] Benjamin 1977b: 202.
[9] Benjamin 1977b: 180 u. 196.
[10] Benjamin 1977b: 181.
[11] Figal 1979: 10.
[12] Benjamin 1977b: 182.
[13] Benjamin 1977b: 186.
[14] Dass Verbrechen an Gewalt wesentlich Anteil haben kann, zeigt Benjamin am Beispiel des „großen Verbrechers“, der mit seinen Verbrechen droht, neues Recht zu setzen. Vgl. Benjamin 1977b: 186.
[15] Benjamin 1977b: 190.
[16] Brokoff 2001: 56.
[17] Vgl. Benjamin 1977b: 190.
[18] Benjamin 1977b: 188.
[19] Benjamin 1977b: 196.
[20] Gehring 1997: 239.
[21] Vgl. Benjamin 1977b: 194. Zuvor hat Benjamin ausdrücklich den Zweifel ausgeräumt, beim Streik handele es sich nicht um einen gewaltsamen Akt. Vgl. Benjamin 1977b: 184 f.
[22] Benjamin 1977b: 196.
[23] Benjamin 1977b: 199.
[24] Ebd.
[25] Vgl. Schütz 2000: 124, der dem Leser seines englischen Textes ausführlich Benjamins „Entsühnung“ erklärt und B. Menke 1994: 255, die eine Fehlübersetzung eben dieser „Entsühnung“ bei Derrida entdeckt haben will oder LaCapra 1994: 152 u. 158, Haverkamp 1994: 170 f. und v. a. Derrida 1991, die versuchen, die Bedeutung des „Blutes“ als Distinktionsmerkmal der beiden Gewaltformen zu interpretieren. Insbesondere Derrida hat mit seiner Andeutung, es könne sich bei der „unblutigen“ und „letalen“ „göttlichen Gewalt“ um eine Vorahnung der Endlösung handeln, starke Kritik hervorgerufen.
- Arbeit zitieren
- Axel Schubert (Autor:in), 2003, Zur Genealogie des Rechts - Drei Paradoxien zum Verhältnis von Recht, Gewalt und Gerechtigkeit , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114292
Kostenlos Autor werden




















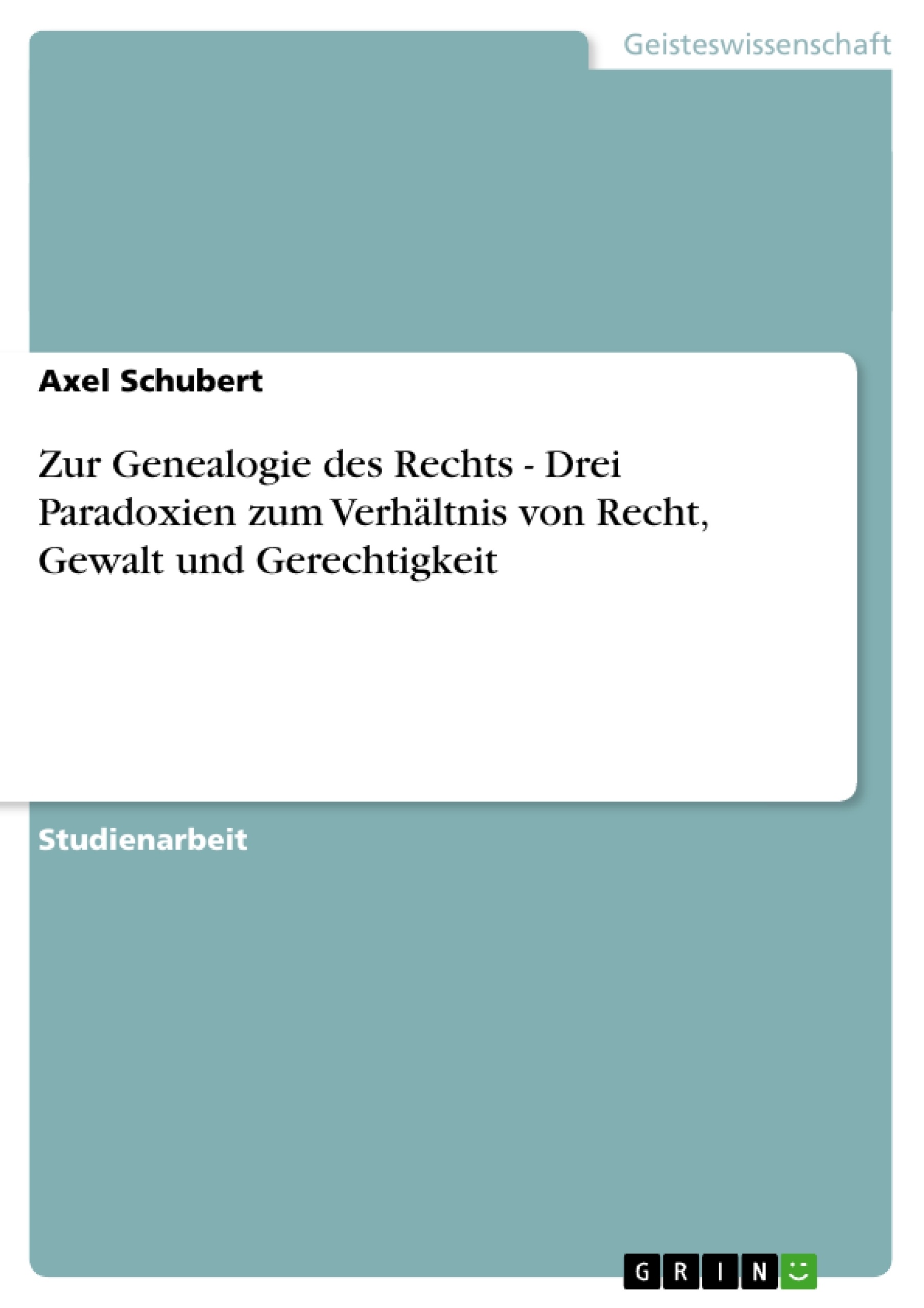

Kommentare