Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Gründung aus der Krise
1.1. Der deutsche Film zwischen Zusammenbruch und Aufbruch
1.2. Eine Doppelakademie für den deutschen Film
1.3. Welche Akademie braucht der deutsche Film?
1.4. Ein „Bauhaus für den Film“, im Rohbau fertig
2. Filmstu dium im Zeichen der Studentenproteste
2.1. Die Studentenproteste in Berlin
2.2. Die Probezeit der Filmstudenten
2.2.1. Sozialkritik und Experiment – erste Übungen
2.2.2. Am Ende der Probezeit
2.3. „Dziga- Wertow-Akademie (vormals dffb)“
2.3.1. Das kämpfende Kollektiv
2.3.2. Kämpfende Filme
2.3.3. Schlacht um die Akademie
3. Das filmkulturelle Erbe von „68“
3.1. Das Konzept „Zielgruppenfilm“
3.1.1. Schülerfilmprojekte
3.1.2. Vom Zielgruppenfilm zum engagierten Film
3.1.3. Der Berliner Arbeiterfilm
3.1.4. Zielgruppen-Distribution
3.2. Abseits des Zielgruppenfilms
3.2.1. Helke Sander und die Frauenfilmbewegung
3.2.2. Harun Farockis Guerillakino
3.3. Rückschauen der Studentenbewegten
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Filmverzeichnis
Einleitung
Im Herbst 2006 feierte die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb) ihr 40jähriges Jubiläum. Die geladenen Ehrengäste der obligaten Feierstunde wurden mit Hartmut Bitomski von jemandem begrüßt, der einst als Student von eben dieser dffb relegiert wurde, der er nun als Direktor vorstand. Es war im Herbst 1968, als die damalige dffb -Leitung auf einen Schlag etwa ein Drittel ihrer Studenten, 18 an der Zahl, vom Studium ausschloss. Selbst im Symboljahr der Studentenunruhen war eine solche Massenrelegation ein einmaliger Vorgang. Vorausgegangen war ihr eine anderthalb Jahre dauernde schwere Auseinandersetzung zwischen Studenten und Leitung, die die dffb fast an den Rand ihrer Schließung manövriert hätte, nach gerade Mal zwei Jahren des Bestehens.
Unter großem öffentlichem Interesse hatte im September 1966 mit der feierlichen Eröffnung der dffb als der ersten westdeutschen Filmschule die akademische Filmausbildung in der BRD überhaupt erst begonnen. Erstmalig in der BRD sollten 35 Ausgewählte eine akademische Filmausbildung erhalten. Dazu zählten zahlreiche später relevante Namen, etwa erwähnter Bitomski und Harun Farocki, beide maßgebend für den Essayfilm; Helke Sander, später eine Wortführerin des Frauenfilms; Christian Ziewer und Max Willutzki, Protagonisten des Arbeiterfilms und Jonathan Briel, dem maßgebende Wirkung für Literaturverfilmungen nachgesagt wird. Aber auch Namen, die sich weniger mit dem späteren Profil der dffb als Schule des politisch-engagierten Gegenwartsfilms verbinden, wie Daniel Schmidt, Wolf Gremm oder Wolfgang Petersen. Andere erlangten außerhalb des Films Bekanntheit, wie Gerry Schum, der mit seinen „Fernsehausstellungen“ und der „Videogalerie“ zu einem Vorreiter der Videokunst avancierte, oder der spätere RAF-Terrorist, Holger Meins. Die Studienzeit dieses Jahrgangs und die ersten Betriebsjahre der dffb fielen zusammen mit „68“. Bereits im Frühsommer 1967 kam es zu öffentlichen Angriffen und Rücktrittsforderungen gegenüber dem Direktor, Erwin Leiser. Die nach dem Mord an dem Studenten Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 durch einen Polizisten einsetzenden Studentenrevolten ergriffen auch die Filmakademie. Öffentliche Aktionen, wie die Besetzung der Akademieräume, und politisch radikale Filme der Studenten, etwa gegen die Springerpresse, verliehen der dffb den Ruf, ein „Hort linker Umtriebe“ zu sein. Die erwähnte Relegation bildete den Höhepunkt der Eskalation und gleichzeitig den Beginn einer Konsolidierung. Die ersten bundesdeutschen Filmstudenten zum Teil für die spätere Filmgeschichte nicht ohne Bedeutung blieben, waren also mehrheitlich „68er“ Proteststudenten. Da liegt die Vermutung nahe, dass sich darüber „68“ ins Filmwesen einschreibt.
Die Chiffre „68“ markiert neben der Wiedervereinigung 1990 die vielleicht wichtigste Zäsur in der Geschichte der BRD. Die spektakulären Ereignisse rund um die damalige Studentenbewegung vermochten es demnach innerhalb kürzester Zeit, eine vom Mentalitätsüberhang der NS-Zeit geprägte bundesdeutsche Gesellschaft zu reformieren. Von der konservativ-autoritären Adenauer-Ära des Nachkriegsjahrzehnts hin zur sozial-liberalen Modernität der siebziger Jahre vollzog sich in der BRD ein tiefgreifender politischer und gesellschaftlicher Wandel, der weitestgehend mit dem Datum 1968 assoziiert wird. Daneben wird das Datum aber auch mit dem RAF-Terror der siebziger Jahre assoziiert. Nach dem Auseinanderfallen der Einheit der APO strebte ein Teil der Studentenbewegung den gesellschaftlichen Wandel mittels militanter Aktionen an. In der Tat rekrutierte sich die erste Generation der „Roten Armee Fraktion“ aus dem Umfeld der Studentenbewegung. So erscheint 1968 als Auftakt des linksextremistischen Terrorismus, der bis in die achtziger Jahre hinein anhielt. Diese beiden unterschiedlichen Narrative bestimmten die nachfolgenden Deutungen des historischen Phänomens „68“, in denen sich die politische Konfrontation fortsetzte. Befürworter und einstige Akteure reklamierten den gesellschaftlichen Aufbruch als historische Leistung der Studentenbewegung, während die Gegner darin den Auftakt einer Gewaltserie sahen. Beide Seiten betrachten das Datum 1968 als spontanen Beginn einer Entwicklung und reduzieren das ganze Jahrzehnt auf „die Zeit um 1968“.
Nachdem das Interesse zwischenzeitlich nachließ, erwachte ab Ende der Neuziger Jahre ein erneutes histographisches Interesse an den 68ern, als mit der Regierung Schröder diese Generation den Gipfel der politischen Macht erreichte und ihren Machtanspruch nicht zuletzt mit ihrer einstigen historischen Leistung legitimierte. Diese neuere Forschung sei verstärkt um eine Historisierung und Entmythologisieren bemüht, so Detlef Siegfried.[1] In seiner Sammelrezension stellt er zudem drei Perspektiven dieser neuerlichen Annäherung an „68“ fest. Eine Reihe von Arbeiten historisiert das Ereignis, indem es das Datum in längere Zeitläufe einbettet, besonders in die so genannten „langen 60er Jahre“, zwischen 1958/59 und 1973/74. Zudem wird die politikgeschichtliche Perspektive häufig um moralische, kulturelle, lebensweltliche Blickwinkel erweitert. Eine andere Gruppe untersucht „68“ als historisches Ereignis in seiner internationalen Dimension und vergleicht die parallelen Ereignisse in verschiedenen Ländern. Im Gegensatz zur geographischen oder zeitlichen Makro-Perspektive nimmt eine dritte Gruppe von Arbeiten gleichsam eine Mikro-Perspektive ein und versucht eine Versachlichung durch Regionalisierung. Unterhalb der nationalen Ebene, aber auch unterhalb der ideologischen Fixierungen untersucht diese Strömung das Phänomen unter Berücksichtigung lokaler Besonderheiten, wie Institutionen, Mentalitäten und Personen. In diese Gruppe regionalisierter Untersuchungen reiht sich gewissermaßen auch die vorliegende Arbeit ein, indem sie das Phänomen 1968 anhand der Institutionengeschichte der West-Berliner Filmschule untersucht.
Anders als in der Zeitgeschichte ist 1968 in der Filmgeschichte nicht das entscheidende Zäsurdatum. Auch in der bundesdeutschen Filmgeschichte bilden die sechziger Jahre eine Umbruchphase, von „Papas Kino“ zum „Neuen deutschen Film“, um es auf die Kürze dieser Signaturen zu bringen. Schon um 1960, als in den meisten anderen Branchen noch ungebremstes Wachstum herrschte, geriet der Film in eine schwere wirtschaftliche Krise. Die Notwendigkeit zur Reform war somit im Film früher als anderswo erkennbar. Und früher als in anderen Feldern wurde der Wandlungsprozess lautstark artikuliert. 1962 meldete die Neuerungsbewegung im Oberhausener Manifest ihre Ansprüche an. Das Oberhausener Manifest markierte den Auftakt des „Jungen deutschen Film“, jener Neuerungsbewegung nach dem Vorbild der französischen Nouvelle Vague, wie es sie auch in anderen Länder gab: das ‚free cinema’ in Großbritannien oder die ‚New American Cinema Group’, sowie die Neuerungsbewegungen in einigen Ostblockländern. 1965 nahm das „Kuratorium junger deutscher Film“, ein filmpolitischer Erfolg der Neuerer, seine Arbeit auf. 1966 erschien mit Alexander Kluges „Abschied von Gestern“ die erste mit „Junger deutscher Film“ bezeichnete Produktion. Ihr folgten im Jahr darauf zahlreiche weitere. Der Transformationsprozess im Film machte sich als schon vor 1968 bemerkbar, so konnte das Datum filmgeschichtlich nie diese Bedeutung erlangen, die es für die Zeitgeschichte darstellt.
Was 1968 für die Zeitgeschichte, stellt für die Filmgeschichtsschreibung eher das Jahr 1962 dar: die entscheidende Zäsur, die eine Tradition begründet, die sich nicht aus dem bestehenden Filmwesen generierte. Teil dieser neu begründeten Tradition ist aber auch die systematische Filmgeschichtsschreibung selbst, die bis dato in Deutschland nicht existent war. Nicht zufällig sind ihre sämtlichen Standartwerke von der Generation der jungen Filmpublizisten der späten fünfziger und frühen sechziger Jahre, wie Ulrich Gregor, Enno Patalas oder Hans Helmut Printzler verfasst oder herausgeben worden. Die von der Zeitgeschichte abweichende filmgeschichtliche Periodisierung der Filmgeschichte stellte für die junge Filmgeschichtsschreibung gleichsam einen Legitimationsbeweis dar. Sie unterstreicht, dass die Geschichte des Films eigenständige Dynamiken aufweist und daher einer eigenständigen Untersuchungsdisziplin bedarf. So gesehen konnte die Filmgeschichte kaum ein Interesse daran haben, den Einfluss der zeitgeschichtlichen Zäsur auf den Film zu beleuchten. Wenn ‚1968’ in der Filmgeschichte zumeist nur als Randnotiz in Erscheinung tritt, so ist dabei auch die Rolle der deutschen Filmgeschichtsschreibung zu bedenken. Zudem pflegt die Filmgeschichtsschreibung einen stilgeschichtlichen Ansatz. Aus dieser Perspektive erscheint das historische Phänomen „68“ bestenfalls als gesellschaftlicher Hintergrund, der sich im Filmwerk lediglich vermittelt artikuliert.
Die vorliegende kulturgeschichtliche Arbeit setzt sich zum Ziel, unmittelbare Einflussfaktoren von „68“ auf die Filmkultur zu ermitteln. Einflüsse, die sich nicht im hermeneutischen Artikulieren eines zeitgeistlichen Hintergrunds erschöpfen. Die Idee der vorliegenden Arbeit ist es, den Einflüssen an einem Punkt nachzugehen, wo sich die betreffende Zeitgeschichte und die Filmgeschichte unmittelbar berühren: dort wo die Studentenbewegung von 1968 auf Filmstudenten trifft. Dabei verfolgt die Arbeit einen kulturgeschichtlichen Ansatz, um der stilgeschichtlichen Verengung auf werkimmanente Merkmale zu entgehen.
Im ersten Teil werde ich die Gründungsgeschichte der dffb zwischen 1962 und 1966 darstellen. Dabei werde ich zeigen, dass die erste deutsche Filmschule, trotz eines vierjährigen Vorlaufs als Provisorium oder wie es in einer Eröffnungsrede hieß, als „im Rohbau fertige Akademie“ begann. Den Anlass für die Initiative zur Gründung gab die schwere Existenzkrise des deutschen Films anfangs der sechziger Jahre, die auch einen tief greifenden Transformationsprozess auslöste. So ist die Gründung der dffb Ausdruck der Neuorganisation im Deutschen Film. These des ersten Teils ist es daher, dass angesichts der ungewissen Zukunft des deutschen Filmwesens und der an sie gestellten hohen Ansprüche die dffb ohne erkennbares Profil, nur mit einen Minimum an Struktur den Unterricht aufnahm.
Wie das unklare Lehrprofil dann zum Kern der Auseinandersetzung zwischen Studenten und Leitung wurde, soll Gegenstand des zweiten Teils dieser Arbeit sein. Er widmet sich den Studienjahren der ersten westdeutschen Filmstudenten, die sich ab 1967 mehrheitlich politisierten und so zu „68ern“ wurden. In den Übungsfilmen ist diese Politisierung überdeutlich zu sehen. Sind in den ersten Filmen bestenfalls sozialkritische Ambitionen erkennbar, hält 1967 schlagartig ein radikal agitatorischer Gestus Einzug in die studentischen Produktionen. Ich werde dabei die These vertreten, dass sich die dffb -Studenten, indem sie ihr Filmstudium, sprich ihre Übungsfilme, in den Dienst der Protestbewegung stellten, gleichzeitig ein filmästhetisches Ideal wählten und sich so ein eigenes Studienprofil schufen. Unterhalb der Ideologisierung kreisten die Auseinandersetzungen zwischen dffb -Studenten und dffb -Leitung so gesehen stets um die Frage nach einem Modell von Filmausbildung. Der politische Agitationsfilm wurde zu jener Studienvorgabe, die die Schule vermissen ließ. „68“ selbst wurde so gleichsam zur Filmschule dieser Studenten. Wenn auf diese Weise die Ausbildung dieser Filmstudentengeneration von „68“ geprägt worden ist, folgt notwendig die Frage auf dem Fuße, ob und wie sie die erworbene Praxis später als Filmemacher weiterführten und weiterentwickelten. Wenn dem so ist, beantwortet das die Frage nach einem Einfluss von „68“ auf die deutsche Filmkultur, der über das hermeneutische Sich-Ausdrückens eines zeitgeschichtlichen Hintergrunds hinausreicht.
Der dritte und abschließende Teil dieser Arbeit widmet sich also der Filmpraxis der betreffenden dffb -Absolventen. Der Begriff des Zielgruppenfilms bildet dabei die zentrale Kategorie. In ihm findet die innerhalb der Studentenbewegung erlangte Filmpraxis ihre konzeptuelle Formulierung. Den verschiedenen Weiterentwicklungen und Transformationen des Zielgruppenfilms folgend, lassen sich die davon ausgehenden Impulse zeigen, die in den politisch-engagierten Film, in die Medienpädagogik und in das Konzept der kommunalen Filmarbeit reichen. Deutlich wird aber auch, wie dieses Konzept im Massenmedium Fernsehen seine spezifischen, kommunikativen Charakter einbüßt und so an seine Grenzen stößt. Daneben verdienen mit Helke Sander und Harun Farocki zwei Erbstränge abseits des Zielgruppenfilms Beachtung. Denn auch Helke Sanders Initiativ-Engagement für den Frauenfilm als filmkulturelle Bewegung und Harun Farockis „Guerillakino“ als Ästhetisierung des Untergrundkampfes sind nur vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Erfahrung und Praxis während der Protestbewegung verständlich.
Die vorliegende Arbeit basiert wesentlich auf der zeitgenössischen Berichterstattung von 1962 bis 1968. Dabei konnte ich auf den dffb -eigenen Pressespiegel zurückgreifen, der im Archiv des Filmmuseum Berlin lagert und im betreffenden Zeitraum mehrere hundert Zeitungsartikel aus bundesweiten Zeitungen versammelt. Eine weitere wesentliche Grundlage bilden die Übungsfilme der damaligen Studenten. Auch sie lagern größtenteils im Filmmuseum Berlin, einige sind im Besitz der Macher, viele sind aber auch unauffindbar. Von etwa über hundert Titeln konnte ich gut die Hälfte sichten. Während die Darstellung der Gründungsgeschichte und der Studienjahre fast ausschließlich auf den genannten Archivrecherchen basieren, konnte ich für den dritten Teil der Arbeit auf einzelne filmgeschichtliche Arbeiten, sowie auf veröffentlichte Werkexemplare der Filme zurückgreifen.[2]
1. Gründung aus der Krise
Im Gegensatz zur Bundesrepublik hat im es im europäischen Ausland schon seit geraumer Zeit Filmhochschulen zur Ausbildung des künstlerischen Personals gegeben: In Moskau seit 1919, in Paris seit 1942, in Lodz seit 1946 und auch in Babelsberg (Ost-Berlin) seit 1954. In der BRD gab es lediglich das „Deutsche Institut für Film und Fernsehen“ (DIFF) in München, welches sich als Nachfolger der im Dritten Reich geschlossenen „Münchner Filmschule“ verstand. Die vom Land Bayern und der Stadt München aufgebrachten Mittel reichten aber nicht aus, um am DIFF eine produktionspraktische Ausbildung anzubieten. Zaghafte Versuche zur Errichtung einer nationalen Filmhochschule scheiterten Mitte der 50er Jahre an föderalen Zuständigkeiten.
Die sechziger Jahre bilden in der deutschen Filmgeschichte ein Scharnierjahrzehnt. Sie beenden die Ära der Heimat- und Schlagerfilme des Nachkriegskinos und münden in die international beachtete Blüte des „Neuen deutschen Films“. Zwischen diesen Epochen entspannt sich eine Zeit tiefgreifender wirtschaftlicher, filmpolitischer und ästhetischer Umwälzungen im deutschen Film, begleitet von teilweise scharfen Konflikten und Polarisierungen. Die Gründung der ersten westdeutschen Filmhochschule fiel nicht zufällig in diese Zeit des Umbruchs, sondern ist ein Ausdruck jener Umorientierung und Umorganisation im deutschen Film dieses Jahrzehnts.
In diesem ersten Teil der Arbeit will ich die Gründungsgeschichte der ersten westdeutschen Filmakademie während des filmhistorischen Umbruchs bis zur Eröffnung inmitten einer unabsehbaren Entwicklung aufzeigen. These dieses Kapitels ist es, dass unter den gegebenen Umständen eine filmästhetische und filmpolitische Positionierung des neuen Instituts notgedrungen unterbleiben musste, was dann zum Kern der Auseinandersetzungen in den ersten Studienjahren werden konnte.
1.1. Der deutsche Film zwischen Zusammenbruch und Aufbruch
Ab 1958 erlebte die deutsche Filmbranche existenzbedrohende, wirtschaftliche Einbrüche. Die Kinobesuche brachen jährlich um 10% ein, von über 800 Millionen im Jahr 1958 auf etwas über 200 Millionen Mitte der sechziger Jahre. Ein regelrechtes „Kinosterben“ war die Folge. Auch die Verleihfirmen gerieten in Not. Teils mussten sie, um zu überleben, fusionieren, oder sie gingen pleite, wie die die „Ufa-Filmhansa“ oder „Union-Film“. Da es im deutschen Nachkriegskino übliche Praxis war, die Herstellung der Filme über Verleihgarantien vorzufinanzieren, war auch die Produktionsstruktur der Filmwirtschaft erschüttert. Die Zahl der produzierten Filme halbierte sich innerhalb weniger Jahre auf 60 Filme im Jahre 1962. Geradezu als Fanal wirkte der Bankrott der Ufa-Filmproduktion, die - ob positiv oder negativ - als Inbegriff des deutschen Films gegolten hatte. Zwar stiegen die Zuschauerzahlen Anfang der siebziger Jahre wieder leicht an, erreichten aber nie mehr auch nur annähernd die Größenordnung der fünfziger Jahre. Der wirtschaftliche Niedergang der Nachkriegsfilmwirtschaft in den sechziger Jahren war zu einem Gutteil eine Marktanpassung.[3]
Zeitgleich trat das Fernsehen seinen Siegeszug an. Die Zahl der Fernsehgeräte wuchs jedes Jahr um mehr als eine Million, von 2 Millionen Anfang 1960 auf rund 13 Millionen in 1969. In 84% aller Haushalte stand nun ein Fernsehgerät, Fernsehen war zum Allgemeingut geworden. Auch das Programmangebot vermehrte sich: ab 1961 gab es zwei Programme, zunächst ein zusätzliches ARD-Programm, ab 1963 das Programm des ZDF. Ab 1964 kamen nach und nach die Dritten Programme der Regionalsender hinzu.
Das Fernsehen war zwar nicht die alleinige Ursache für die Existenzkrise des Films, doch es hatte erheblichen Anteil daran. Der Einzug des Fernsehens wirkte tief in das Alltagsleben hinein. Besonders bei den Neuteilnehmern gruppierte sich nicht selten das Freizeitleben um den Fernsehkonsum herum. Das Fernsehen war Teil einer umfassenden Technisierung des Privathaushaltes, welche dazu beitrug, dass immer mehr Freizeit im Privathaushalt verbracht wurde. Knut Hickethier spricht von einer „Verhäuslichung“[4] der Freizeit. In diesem Prozeß wandelte sich der Kinobesuch von einer selbstverständlichen zu einer besonderen Freizeitaktivität. Bestand das Fersehprogramm zu Beginn ausschließlich aus Bildungs- und Informationssendungen, wuchs mit zunehmendem Zuschauerkreis und mit der Konkurrenzsituation zwischen ARD und ZDF im Laufe der sechziger Jahre der Unterhaltungsanteil immer weiter an. Damit trat das Fernsehen vermehrt in direkte Konkurrenz zum Kino als audiovisuellem Unterhaltungsmedium.
Zur materiellen Konkurrenz kam eine ideelle Frontstellung zwischen den beiden audiovisuellen Medien hinzu. Auf einer modernen Technologie basierend, verstand sich das Fernsehen als fortschrittliches Medium, als Kommunikator gesellschaftlichen Fortschritts. Mit dem Anwachsen der Branche kamen vermehrt liberale Vertreter der sogenannten „45er Generation“ in leitende Positionen. Das Fernsehen war ein Motor des Wandels vom „Konsensjournalismus“ der Nachkriegsära zum „sozialkritischen Journalismus“.[5] Demgegenüber nahm sich die etablierte Filmwirtschaft konservativ aus. Der deutsche Film nach 1945 war nicht nur ein unkritischer, die gegenwärtige Realität kam so gut wie überhaupt nicht vor und korrespondierte so mit dem „Konsensgebot“ der Adenauerära. Zudem stammten die maßgeblichen Vertreter der Filmwirtschaft vielfach noch aus der Ufa - Zeit vor 1945.
Die aufsehenerregenste filmhistorische Konfrontation der sechziger Jahre war die zwischen der etablierten Filmwirtschaft und den jungen „Oberhausenern“. Die Krise des deutschen Films war nicht nur materieller, sondern auch qualitativer Natur. Die 1957 gegründete Zeitschrift „Filmkritik“ bemängelte seither regelmäßig die fehlende künstlerische Qualität deutscher Produktionen. 1961 erschien mit Jo Hembus’ „Der deutsche Film kann gar nicht besser sein“[6] eine umfassende Abrechnung mit dem bundesdeutschen Filmschaffen. Diesem fehle es an allem, was dem deutschen Stummfilm dereinst zu künstlerischem wie wirtschaftlichen Erfolg verholfen hatte: Kreative Filmschaffende, risikobereite Produzenten, filmische Innovationen, eine lebendige Filmpublizistik, ein anspruchsvolles Publikum sowie ein anregendes künstlerisches Gesamtklima hatten in den zwanziger Jahren den deutschen Film zum besten der Welt gemacht. Der deutsche Nachkriegsfilm stelle demgegenüber das genaue Gegenteil dar: In provinziellen Klima fehlte jeglicher Austausch und Impuls aus anderen Sparten. Selbst die „großen deutschen Regisseure“ seien nur mittelmäßige Inszenierungshandwerker, von denen keine Innovationen zu erwarten seien. Zudem scheuten die deutschen Produzenten jegliches Risiko. Das Filmwesen in Nachkriegsdeutschland, so das titelgebende Fazit, sei einfach nicht fähig, bessere Filme zu produzieren als die mittelmäßigen, die es herstellte. Jede Hilfsmaßnahme für das bestehende Filmwesen sei daher zwecklos. Alle Hoffnung ruhe daher auf dem Nachwuchs, geradezu eine Aufforderung an die späteren Oberhausener.
Auch von gleichsam offizieller Seite wurde dem deutschen Film eine scharfe Absage erteilt. 1961 vergab die Bundesfilmpreisjury ausdrücklich keinen Preis für den besten Film und die beste Regie, da unter der gesamten Vorjahresproduktion, wie es hieß, keine preiswürdigen Filme gewesen seien. Spätestens nach dieser Zeichensetzung der Bundesfilmpreisjury konnte das negative Urteil über den deutschen Film nicht länger als eine Außenseitermeinung gelten.
Diese Stimmung machten sich im Februar 1962 einige Nachwuchsregisseure zunutze, als sie während des Internationalen Oberhausener Kurzfilmfestivals gegen das etablierte Filmwesen zu Felde zogen. „Der Zusammenbruch des konventionellen deutschen Films entzieht einer von uns abgelehnten Geisteshaltung endlich den wirtschaftlichen Boden“ heißt es im berühmten Oberhausener Manifest. Gleichzeitig zum Ende von „Papas Kino“ erklärten sie ihren Anspruch, „den neuen deutschen Film zu schaffen“.[7]
Dieser neue deutsche Film, den die Oberhausener schaffen wollten, sollte ein Autorenfilm sein. Ein Konzept, das mit der bestehenden Produktionsweise unvereinbar war, die auch Hembus als „Zutatenfilm“ schmähte: Ein angesagtes Sujet in eine standardisierte Handlung verpackt, imagekonform besetzt aus dem Angebot der beliebten Stars, produziert unter Rückgriff auf das Repertoire gängiger Ausdruckmittel. Diese Produktionsweise wurde von den Produzenten beherrscht, die über die „Zutaten“ bestimmten und die Filme von Filmhandwerkern fertigen ließen. Stattdessen propagierte Hembus den „Filmschöpfer“, der einem Film seine individuelle Sichtweise und Handschrift verlieh. Während ein „Filmschöpfer“ allerdings für Hembus’ ausdrücklich nicht zwingend der Regisseur sein musste, konstatierte Alexander Kluge, der Vordenker des Jungen deutschen Films, unmissverständlich: „Der Autor des Films ist sein Regisseur“. Nach Kluges Vorstellung sollte die Kontrolle über alle Bereiche der Filmherstellung allein dem Regisseur zufallen, während dem Produzenten lediglich die Beschaffung der benötigten Produktionsmittel zukam. Kluges Autorenfilm war sogesehen die Umkehr der Produktionsweise von „Papas Kino“.
Die Verwirklichung ihres Autorenfilmkonzeptes war für die Oberhausener nur abseits der bestehenden Filmwirtschaft denkbar. Folglich ließen die Autorenfilmproduktionen zunächst auf sich warten, denn Produktionsmöglichkeiten abseits der Filmindustrie mussten sich die Autorenfilmer erst schaffen. Dies gelang mit dem "Kuratorium junger deutscher Film", das schließlich am 1. Februar 1965 seine Arbeit aufnahm. Besonders an diesem Kuratorium war, dass die Förderung an die Person des Regisseurs, nicht des Produzenten gebunden war. "Gemäß dem 'Oberhausener Manifest' war die Grundidee des Kuratoriums, eine Förderungsart zu institutionalisieren, die den Filmemacher aus seiner Situation als weisungsgebundener Regisseur befreite und zum autonomen und freien Gestalter seiner Filmidee machte."[8] Diese Förderung ermöglichte den Oberhausenern ihre ersten langen Autorenfilme, welche ab 1966, hauptsächlich aber 1967/68, also nach der Eröffnung der dffb, in die Kinos kamen.
Die etablierten Filmproduzenten drängten ihrerseits auf eine Filmförderung, die ihre Interessen berücksichtigte. Diese kam 1968 in Form des neuen Filmfördergesetzes, das vornehmlich eine so genannte Referenzförderung vorsah. Den Plan hierfür hatte der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kulturpolitik und Publizistik, Berthold Martin, bereits 1963 vorgelegt. Eine Förderprämie erhielten demnach jene deutschen Filme, welche im Kino mehr als 500.000 DM (bzw. 300.000 DM mit Prädikat „besonders wertvoll“) einspielten. Während das Kuratorium wirtschaftlich riskante, innovative bis experimentelle Produktionen als Beitrag zur künstlerischen Verbesserung ermöglichen wollte, belohnte das Filmfördergesetz wirtschaftlich erfolgreiche Produktion als Beitrag zur Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des deutschen Films. Die beiden Förderinstrumentarien spiegeln eine Frontstellung zwischen wirtschaftlichen und künstlerischen Interessen, zwischen „Kunst oder Kasse“ wieder.
Der Filmpublizist, Urs Jenny, bemerkte 1969, im deutschen Film hätte sich eine Differenzierung ausgeprägt, die sich in älteren Kunstsparten wie der Literatur und dem Theater schon vor Längerem vollzogen hatte: die Unterscheidung zwischen einem trivialen und einem künstlerisch anspruchsvollen Segment.[9] „Wilder Karneval und stille Zeremonie, bunte Mädchen und karge Skizzen, das sind die Extreme im Kino dieses Jahrzehnts“[10], charakterisiert der Filmhistoriker Norbert Grob die sechziger Jahre. Die etablierten Filmproduzenten suchten ihr Heil in gesteigerter Attraktion. Die wirtschaftlich erfolgreichsten Produktionen waren drei Filmserien: die Winnetou-Filme, die Edgar Wallace-Verfilmungen, sowie den Jerry Cotten-Filmen. Alle diese Serien setzten auf trivial-literarische Vorlagen, greifen mit dem Western und der „Schwarzen Serie“ Genres des amerikanischen Kinos auf, sie verlassen Deutschland als Handlungsort, spielen im Amerika des vorherigen Jahrhunderts, in London oder in New York. Diese Filmproduktionen sollten ihre Herkunft vergessen machen. Die Filmwirtschaft wandte sich sozusagen vom diskreditierten Label „Deutscher Film“ ab, während es die Oberhausener als „Jungen deutschen Film“ als ein erneuertes formulierten, obgleich die filmischen Beispiele Mitte der sechziger Jahre noch auf sich warten ließen.
1.2. Eine Doppelakademie für den deutschen Film
Als 1962 die Krise des deutschen Films unübersehbar geworden war, nahm sich auch die Politik des Patienten „deutscher Film“ an. Im Mai 1962 lud der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kulturpolitik und Publizistik, Berthold Martin, zum zweitägigen „Forums-Gespräch“ über die Existenzkrise des deutschen Films in Bonn ein. Daran nahmen neben Ausschussmitgliedern, zahlreiche Filmschaffende, von Produzenten über Regisseure, Schauspieler bis hin zu Verleihern und Filmpublizisten teil. Die Lebensfähigkeit des deutschen Filmwesens, so referierte Martin, gelte es unbedingt zu erhalten. Martin erkannte die wirtschaftliche wie die künstlerische Krise und konstatierte, es gelte "den Film, künstlerisch und finanziell neu zu organisieren". Als konkrete Hilfsmöglichkeiten nannte Martin neben einer Erhöhung des Prämienfonds und der Abschaffung der Vergnügungssteuer für Spielfilme auch die Gründung einer deutschen Filmakademie.[11] Von dieser Initiative nimmt die Gründungsgeschichte der dffb ihren Anfang.
"Gründung im November" meldet die Wetzlarsche Neue Zeitung im September 1962. In der Tat konnte es zunächst nach einer zügigen Gründung aussehen. Noch auf diesem Forumsgespräch wurden erste Weichenstellungen angeregt. So regte der FDP-Abgeordnete Mertens eine gemeinsame Akademie für Film und Fernsehen an und plädierte dafür, diese nicht als staatliche, sondern als private Einrichtung zu errichten, um so der Dynamik der Branche besser gerecht zu werden. Dagegen wurde von Seiten der SPD die private Finanzierbarkeit einer solchen Ausbildungsstelle bezweifelt. Im Grunde aber begrüßten alle Beteiligten den Vorschlag und so wurde die Bildung einer Kommission vereinbart, die präzisere Vorschläge erarbeiten sollte.[12] Diese Kommission legte in zwei Sitzungen im Sommer 1962 die wesentlichen Eckpunkte der neuen Einrichtung fest. Es sollte eine "im freien Raum zwischen Staat und Gesellschaft"[13] stehende Institution werden, an der die Bundesregierung, die Kultusministerkonferenz, die Filmwirtschaft, die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten und die Länderanstalt des ZDF beteiligt sein sollten. Diese künftige Akademie sollte als eine für Film und Fernsehen entstehen und sich ausschließlich der künstlerischen Ausbildung widmen. Die wissenschaftliche Forschung hingegen solle bei den Universitäten verbleiben, allerdings sollte die Akademie einer generalistischen Ausbildung den Vorzug vor einer technisch spezialisierten geben. Das Bundesinnenministerium reservierte noch im laufenden Jahreshaushalt 1962 für die geplante Filmakademie 700.000 DM, aufstockbar auf eine Million.
Doch gab es im Herbst 1962 auch noch zwei wesentliche Unklarheiten: zum Einen hatte sich die Kultusministerkonferenz noch überhaupt nicht geäußert. Ihr aber oblag die eigentliche Beschlussgewalt über die Gründung der geplanten Akademie. Zum anderen war auch der Standort noch offen. Die Martin- Kommission hatte sich in dieser Frage auf die Nennung einiger allgemeiner Standortvoraussetzungen beschränkt.
Um den Sitz der deutschen Filmakademie bewarben sich München, Berlin und Wiesbaden, wobei Wiesbaden trotz der umfangreichsten deutschen Fachbibliothek die geringsten Aussichten hatte. München konnte mit dem DIFF auf eine bereits bestehende Ausbildungsstätte im Filmbereich als institutionelle Basis verweisen. Ein veritables Filmarchiv sollte durch den Ausbau der Filmabteilung des Stadtmuseums München entstehen. Im bayerischen Landeshaushalt wurden 300.000 DM für die künftige Filmakademie eingestellt. In Berlin führte man den geplanten Neubau der Schule für Filmtechnik und Optik als mögliche Herberge für die künftige Akademie ins Feld. Es bestand die Option, mit dem Ankauf einer Privatsammlung den Grundstock eines Filmarchivs, der späteren Kinemathek, zu legen. Eine Summe von 400.000 DM waren im Berliner Haushalt für die Akademie bereits eingeplant.
Um einem drohenden Bewerbungswettbewerb zu entgehen, verständigten sich München und Berlin, zunächst informell, auf die Option einer Doppelakademie mit dem Schwerpunkt Fernsehen in München und Film in Berlin, sowie auf eine Art Stillhalteabkommen bis zu einer Entscheidung der Kultusministerkonferenz. Dessen ungeachtet trieben beide Städte ihre Bewerbungsbemühungen voran. So veranstaltete die Stadt München Ende November 1962 einen Kongress zum Thema "Fernsehen", ausdrücklich in Zusammenhang mit der geplanten Gründung einer Fernsehakademie in München. Auch der Kulturreferent Münchens sprach öffentlich über die Pläne für eine Fernsehakademie. Angesichts dessen sah sich in Berlin „Der Tagesspiegel“ zur Warnung der dortigen Akteure veranlasst.[14] Als dort einige Wochen später die „Deutsche Kinemathek in Berlin“ eröffnet wurde, die zwei vom Land Berlin aufgekaufte Privatsammlungen betreuen sollte, erregte der damalige Volksbildungssenator Aufsehen, als er nicht nur die Eröffnung der Deutsche Film- und Fernsehakademie in Berlin für Oktober 1963 ankündigte, sondern gleichzeitig verlauten ließ: "Berlin ist kein Ort für Filialbildungen".[15]
In Schlichtungsverhandlungen zwischen Vertretern beider Bewerber wurde der Plan nun in einer formellen Vereinbarung festgeschrieben. Darin hieß es: "Die Städte München und Berlin beabsichtigen, Einrichtungen zu schaffen, die organisatorisch unabhängig voneinander sind, die sich aber koordinieren wollen durch ständigen Gedankenaustausch in Bezug auf die Unterrichtspläne und die Dozentenschaft, um eine möglichst einheitliche Ausbildung des Film- und Fernsehnachwuchses zu gewährleisten."[16] Zudem wurde vereinbart, dass sich die beiden Einrichtungen die bereitgestellten Bundesmittel teilen würden. In ihrer Sitzung am 21. Februar 1963 akzeptierte die Kultusministerkonferenz diesen Vorschlag und beschloss, die Film- und Fernsehakademie teils in München und teils in Berlin zu errichten.
Im selben Atemzug, in dem sie den einen Konflikt entschärften, eröffneten die versammelten Landes-Kultusminister einen neuen, als sie gleichzeitig die verfassungsgemäße Kulturhoheit der Länder betonten und erklärten, die Errichtung der Film- und Fernsehakademie sei alleinige Aufgabe der Länder. Das Bundesinnenministerium, nicht bereit als bloßer Zahler ohne Mitsprache zu fungieren, strich daraufhin die bereits eingeplanten Haushaltsmittel. Die weggefallenen Bundesmittel mussten somit von den Ländern gemeinschaftlich aufgebracht werden. Doch dazu waren einige nicht beteiligte Länder nicht bereit und die Konferenz der Länderfinanzminister verweigerte Ende 1963 die gemeinschaftliche Finanzierung der geplanten Film- und Fernsehakademie. Das Vorhaben der einen großen nationalen deutschen Film- und Fernsehakademie war damit gescheitert. Auch der Plan der Doppelakademie in München und Berlin war damit obsolet geworden, bezweckten die beiden Städte mit diesem Vorschlag doch vor allem, auf jeden Fall wenigstens Teil-Standort der geplanten exklusiven Einrichtung zu werden. Nach dem Aus für diesen Plan bestand auch für eine Kooperation der beiden Bewerber keine zwingende Notwendigkeit. Und so trieb man in Berlin und München fortan die Gründung einer Filmschule getrennt voneinander voran. Geblieben ist vom Plan der Doppelakademie lediglich der Name „Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin“, ungeachtet dem Fehlen des geplanten Schwesterinstituts.
Nach dem Aus für die nationale Option geriet die institutionelle Akademiegründung im Jahr 1964 notgedrungen ins Stocken, da die Gründung ohne die gestrichenen Bundesmittel nicht möglich war. Erst durch die Freigabe dieser Mittel ein Jahr später für das Haushaltsjahr ´65 gab es für die Akademiegründung endlich grünes Licht. In der Zwischenzeit rückten nun inhaltliche Fragen nach Modell und Profil der künftigen Filmausbildung ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit und Debatte.
1.3. Welche Akademie braucht der deutsche Film?
Eine klare Vorstellung wie eine Filmausbildung aussehen sollte hatten die Oberhausener. Noch im Jahr des Oberhausener Manifestes gründeten sie unter der Leitung von Alexander Kluge, Edgar Reitz und Detten Schleiermacher innerhalb der "Hochschule für Gestaltung" in Ulm das "Institut für Filmgestaltung". Das Ulmer Modell setzte konsequent auf eine Ausbildung zum Filmautor und orientierte sich wesentlich an den Vorstellungen Alexander Kluges. Nach dessen Forderungskatalog für die Filmausbildung sollten künftige Ausbildungsstätten keine Spezialisten für Kamera, Drehbuch, Produktion, Regie usw. ausbilden, sondern Gesamtautoren. Im Sinne linker Ästhetiktheorien, vor allem Sigfried Kracauers, unterschied Kluge den Filmautoren vom bürgerlichen Künstlertum: "Filmausbildung sollte nicht vom freien Künstlerstandpunkt ausgehen, sondern ein Verantwortungsgefühl entwickeln, das darauf beruht, dass der Film eine Massenbasis hat.“[17] Der bekannte Spielfilm wurde in Ulm kategorisch abgelehnt, ebenso die Fernsehpraxis. Ulm wollte, ganz im Sinne von Oberhausen, einen neuen Film kreieren und dazu bedurfte es eines Experimentierfeldes. „Ohne die Frage nach neuen filmischen Methoden bleibt eine Filmausbildung steril. Neue Inhalte und neue Ausdrucksformen aber brauchen ihre Inkubationszeit in formellen oder informellen Bildungseinrichtungen."[18] Ulm verstand sich als Experimentierwerkstatt für den neuen Film. Dieses „Ulmer Modell“ war im deutschen Film aber nicht konsensfähig, und schied daher als Vorbild aus.
In einer Bilanz der Bemühungen in der Zeitschrift „Die Information“ regte Karl H. Kaesbach[19] 1963 eine für alle Beteiligten gemeinsame Untersuchung der bereits erfolgreich arbeitenden ausländischen Filmschulen an. Dieser Aufgabe nahm sich Heinz Rathsack an, damals Referent für Film- und Erwachsenenbildung im schleswig-holsteinischen Kultusministerium. Er untersuchte das „Centro Sperimentale di Cinematografia“ in Rom, das „Institut des Hautes Etudes Cinématographiques“ (IDHEC) in Paris und die „Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna i Filmowa“ im polnischen Lodz. Seine Ergebnisse legte Rathsack 1964 in einer Broschüre[20] vor, sowie in Kurzform in der „Filmkritik“[21].
Das „Centro Sperimentale di Cinematografia“ galt als geistiges Zentrum des italienischen Films. Rathsack zeigte sich beeindruckt von der umfassenden Auseinandersetzung mit allen Aspekten des Films an der römischen Filmschule. Sie war Ausbildungsstätte, filmhistorische Forschungsinstitut und Experimentierwerkstatt in einem und hatte wesentlichen Einfluss auf das international angesehene italienische Filmschaffen und die gesamte italienische Filmkultur. Die Hoffnung auf eine Deutsche Film- und Fernsehakademie als Zentrum des filmkulturellen Diskurses fand in Rom eine exzellente Bestätigung. Wer hoffte, mit einer zentralen Filmschule dem deutschen Film neue Impulse zu verleihen und ihm zu größerem Ansehen zu verhelfen, durfte sich durch das Beispiel Lodz bestärkt fühlen. Dort hatte man sich konsequent für eine Ausbildung zum Film-Künstler nach dem Vorbild von Kunsthochschulen entschieden. Seit der Gründung des „Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna i Filmowa“ 1947 hat sich das bis dato nicht existente Filmland Polen zu einer international anerkannten, spezifischen Filmnation auf hohem Niveau entwickelt, wobei alle diesen Aufstieg herbeiführenden Filmemacher aus der Filmschule in Lodz hervorgegangen waren. Das Pariser „Institut des Hautes Etudes Cinématographiques“ (IDHEC) schließlich war im Hinblick auf die finanzielle Ausstattung interessant. Denn die Etats in Rom und Lodz überstiegen bei weitem die in Deutschland bis dato eingeplanten Mittel, während das Französische Institut mit einem Etat auskam, wie er auch für Berlin realistisch erschien. Trotz bescheidener Ausstattung hatte sich das IDHEC aber einen internationalen Ruf erarbeitet und seine Ausbildung wurde in Frankreich unangefochten akzeptiert. So zeigte sich der Verwaltungsmann Rathsack begeistert von der mittels geschickter Organisation und Disziplin erreichten effizienten Ausnutzung der knappen Ressourcen in Paris. Ein unmittelbares Modell für die künftige deutsche Filmakademie indes konnte keines der untersuchten Beispiele abgeben, zu sehr unterschieden sich die Umstände in Deutschland von denen in Italien, Frankreich und Polen. Trotzdem vermochte jedes der drei Beispiele auf unterschiedliche Weise die Ambitionen in Deutschland zu bestätigen.
Eine solche Bestätigung der Akademiebefürworter schien 1964 auch geboten. Mit dem Aus für die bundespolitische Initiative wurde nämlich vermehrt Skepsis gegenüber dem Projekt Filmakademie laut. Kurt Habernoll, ein die Geschichte der dffb begleitender Journalist, stellte im Sommer 1963 als einer der Ersten die "Grundsatzfrage nach Sinn und Nutzen einer Film- und Fernsehakademie"[22]. Sinnvoll, so Habernoll, sei eine Filmakademie nur dort, wo auch eine leistungsfähige Filmwirtschaft existiert. Die aber fehlte im Deutschland der 60er Jahre. Allein könnten die "Film-Akademiker" die Krise der Filmwirtschaft nicht beheben, vielmehr müsse man sich, angesichts des desolaten Zustands des deutschen Films, um deren spätere Berufsaussichten sorgen. Dies insbesondere, da die bundesdeutsche Filmwirtschaft traditionell wenig Interesse an einer Nachwuchsförderung zeigte, erst recht in der aktuellen Krise. Auch die Fernsehanstalten hielten sich zurück, sie hatten teilweise bereits eigene Ausbildungsprogramme eingerichtet, so etwa der NDR unter der Leitung des späteren dffb -Dozenten Egon Monk.[23] Die Rundfunk- und Fernsehunion beim DGB kritisierte denn auch, die Akademieplanung liege in den Händen von interessierten Politikern, Filmwissenschaftlern und -publizisten, sowie einigen Filmleuten, die späteren Abnehmer bzw. Arbeitgeber der Absolventen aber, die Fernsehanstalten und die Filmwirtschaft seien bislang nicht beteiligt.
[...]
[1] Vgl. Siegried 2003
[2] Zu Dank verpflichtet bin ich an dieser Stelle Gerd Conradt, der mich auf den Gegenstand der Arbeit aufmerksam machte, mir eine Liste der damaligen Studenten gab, die Ausgangpunkt der Recherchen wurde, und der mir auch den Zugang zum Archiv im Filmmuseum wesentlich erleichterte.
[3] Vgl. Gregor 1978, S. 122f.
[4] Hickethier 1998, S.113
[5] vgl. Hodenberg 2004
[6] Hembus 1981 (Das Buch von 1961 ist darin enthalten.)
[7] Zit. n. Pflaum, Prinzler 1979
[8] Hembus 1981, S. 102
[9] Vgl. Jenny 1968, S. 109f.
[10] Grob 2004, S. 211
[11] Vgl. FAZ, 15.05.1962
[12] vgl. FAZ, 15.05.1962
[13] zit. n. Wetzlarsche Neue Zeitung, 29.09.1962
[14] vgl. Der Tagesspiegel, 11.11.1962
[15] vgl. Der Tagesspiegel 18.12.1963
[16] Süddeutsche Zeitung, 9./10.2.1963
[17] Kluge, Alexander: Die Utopie Film. In: Film (Velber), Jg. 1966. Zit. n. Koch 1995, S. 106
[18] ebd.
[19] Kaesbach 1963
[20] Rathsack 1964b
[21] Rathsack 1964a
[22] Habernoll 1963
[23] Schwarzer 1964, S. 5
- Arbeit zitieren
- Dipl. kuwi Karl-Heinz Stenz (Autor:in), 2007, Kampfplatz Kamera. Die filmkulturelle Bedeutung der filmstudierenden '68er Generation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113795
Kostenlos Autor werden















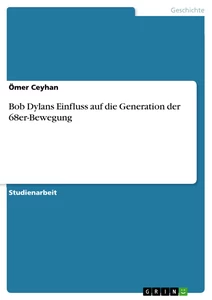


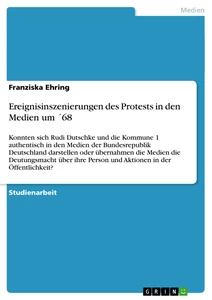
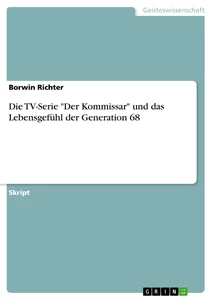
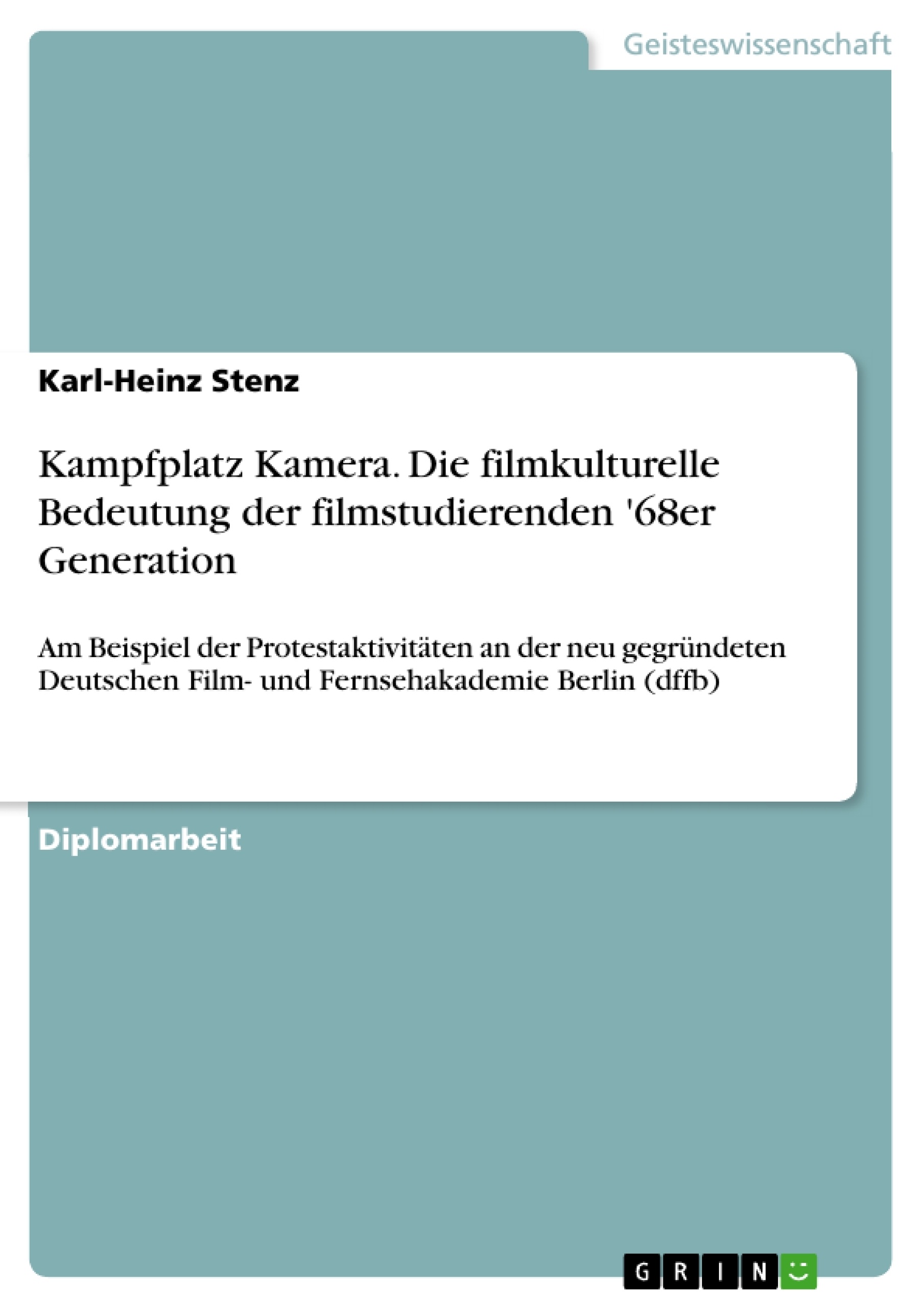

Kommentare