Leseprobe
Inhalt
1. Einleitung
1.1. Denkmodell für die Untersuchung – Menschliches Handeln in der Umwelt
1.2. Die Korrespondenz zwischen Klima und Bevölkerung
1.3. Begründung des zeitlichen Rahmens
1.4. Der enge Nahrungsspielraum
1.5. Keine Produktivität durch zu große AckerS
2.1. Primäre und sekundäre Folgen von Klimaveränderung
2.2. Gunst- und Ungunstphasen
3.1. Bodennutzung in humanökologischen Gunstphasen (1530 – 1564)
3.2. Vergetreidung
3.3. Klimatische Gunstphasen – ungünstig für die Natur?
4.1. Bodennutzung in Ungunstphasen
4.2. Mensch und Boden
5. Schlussbetrachtung
6. Literatur
7. Anhang
1. Einleitung
Die Arbeit versucht eine Brücke zwischen dem Phänomen der „kleinen Eiszeit“ von und der Entwicklung der Bodennutzung zu schlagen. Die spezielle Abhängigkeit dieser beiden Parameter lässt sich nur schwer einzeln herauskristallisieren, wie sich noch zeigen wird. Gerade die viel besagte Theorie der Malthusianischen Krise spricht eine andere Sprache. Insofern soll es gelingen, dem Faktor Klima seinen Stellenwert in dem von vielen Variablen bestimmten Gefüge der Bevölkerungsentwicklung bzw. der Bodennutzung beizumessen.
Christian Pfister hat auf diesem Gebiet hervorragende disziplinübergreifende Forschungsarbeit geleistet, so dass die Schweiz vorerst das am besten untersuchte Gebiet ist. In vielen Fällen betrachtet diese Arbeit Stückwerk von verschiedenen Autoren und versucht daraus eine Vogelperspektive entstehen zu lassen, die allgemeine Aussagen zulassen, den Einzelfall jedoch unberücksichtigt lassen.
Zunächst wird die theoretische Herangehensweise vorgestellt. Nach einer Begründung des ausgewählten Zeitraumes und der Begriffsklärung „günstiger“ und „ungünstiger“ Jahre nähert sich der Text dem Kernproblem: der Menschlichen Reaktion auf die Kapriolen des Klimas. Denn besonders während der „kleinen Eiszeit“ kann man von Kapriolen sprechen, die für bestimmte Jahre verheerenden Charakter angenommen hatten.
1.1. Denkmodell für die Untersuchung – Menschliches Handeln in der Umwelt
Es sind in der jüngeren Wissenschaft verschiedene Verhaltensmodelle des Menschen in Bezug auf seine Umwelt erarbeitet worden. Besonders das possibilistische Modell nach Paul Vidal de la Blache (1845 – 1918), der unterschiedlichen Lebensformgruppen von Menschen – z.B. Landwirte -, die „genres de vie“ auf ihre aktiven raumwirksamen Handlungen hin untersuchte.
Der Focus der Betrachtung lag dabei auf der Wahlfreiheit des menschlichen Willens[1], welcher jedoch durch von der Natur gesetzten festen Rahmenbedingungen, den physischen Möglichkeiten und Grenzen des Raumes, in seinen Entscheidungen beeinflusst wird. So werden regionale landwirtschaftliche Strukturen, auf die ich weiter unten zu sprechen komme, als „Ergebnis einer aktiven, freien, also possibilistischen Anpassung an die Naturräume“[2] interpretiert. Die Formulierung schließt eine Veränderung der natürlichen Rahmenbedingungen grundsätzlich nicht aus.
Dieses Denkmodell muss Pate stehen, will man sich die Nutzung der Landschaft bzw. des Bodens durch den darin handelnden Menschen als Funktion des Klimas als Unterform der natürlichen Rahmenbedingungen untersuchen.
Wetterphysiologische Einflüsse im weitesten Sinne können freilich nur eine von vielen Variablen sein, die den Menschen in seinen landschaftsbezogenen Handlungen umgeben. Die Vertreter der auch aus Frankreich stammenden „Annales-Schule“[3] um die Mitte des 20 Jahrhunderts fanden in der Fluktuation des Klimas einen geeigneten initialen Grund für die weltweit ähnlich verlaufende demographische Entwicklung. Fehlten den Vertretern wie Braudel (1949, 1979) oder Mols (1979) noch die meteorologischen Beweise für die Hypothesen, war dennoch die starke Abhängigkeit der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft von Witterungseinflüssen argumentiert worden.
Dem muss hinzugefügt werden, dass der Mensch fortlaufend neue Rahmenbedingungen für das Wirtschaften mit Boden schafft, sei es neue raumwirksame Techniken wie den Beetpflug oder die Annäherung an ökonomische bzw. demographische Grenzen.
1.2. Die Korrespondenz zwischen Klima und Bevölkerung
Wir finden nun aber im 20. Jahrhundert neben dem Klima weitere Erklärungsmuster, die den periodischen Schwund an „Bevölkerungsüberschüssen“ zu erklären versucht.
Für das 16. bis 18. Jahrhundert belegte Mols (1979), dass die Kongruenz zwischen Klimagunst und Bevölkerungswachstum an dem engen Nahrungsspielraum dieser Zeit liegt. Die Landwirtschaft hatte die Tendenz, auf einen steigenden bedarf an Nahrungsmitteln infolge des Bevölkerungswachstums gegen Ende des 13. oder 16. Jhts. mit dem Ausdehnen der kultivierten Flächen zu reagieren.[4] Zwar wuchs die Landwirtschaft allen voran in die Breite, doch fand auch, wie W. Abel herausstellt[5], eine Vertiefung (intensivierung) derselben statt. Mit der Einführung der Dreifelderwirtschaft – Im Vergleich zur Feldgraswirtschaft eine Steigerung um etwa 15 bis 50%[6]. Die zwanzigmonatige Brachezeit in drei Jahren war ausreichend für die Erholung des Ackers. Einen Stickstoffaufbau durch Leguminosen kannte man nicht. Allerdings brachte die Beweidung mit dem Zugvieh – meist Ochsen und Kühe – einen gewissen Eintrag an Dung.
Der britische Nationalökonom Robert Malthus (1766-1834) bemühte in seinem berühmte „Essay on the Principles of Population“ (1798) die These, dass durch das relative Ungleichgewicht im Wachstum der Bevölkerung (geometrisch) – als abhängige Variable – zum Wachstum der Produktion (arithmetisch) – als unabhängiger Variable – regelmäßig zu Hungerkrisen führen musste, die das Gleichgewicht zwischen Produktion und Bevölkerungszahl gleichwohl wiederherzustellen vermochten. In diesem Fall wird von einer Malhusianischen Krise gesprochen.[7] Behringer[8] macht die Einschränkung, dass der „genaue Zeitpunkt der Krise nicht nur durch innergesellschaftliche Enticklungen bestimmt [war], sondern auch durch das Klima.“
Diese Theorie, die schon um 1800 entwickelt worden ist hat ihren Geltungsbereich laut Hansjörg Küster[9] „immer wieder im ausgehenden Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Sie ähneln sich so stark […]“[10]
Nach dem krisenbedingten Zusammenbruch der gesellschaftlichen ökonomischen und demographischen Verhältnisse näherte sich die „menschliche Populationen nach dem ökologischem „Grundgesetz“ nicht anders zu erwarten – stabilen Verhältnissen“[11]
Boserup[12] (1965) findet in der Intensität der Bodennutzung einen Faktor für die relative Unabhängigkeit von klimatischen Einflüssen. Diese wird durch Bevölkerungswachstum zwar stimuliert, die deutlichste Emanzipation von Umwelteinflüssen durch die Verbesserung des Wirkungsgrades mit intensiverem Kapitaleinsatz auf dem Gebiet der westlichen Industriestaate findet dennoch erst im 18. Jh. im Zuge der Agrarrevolution statt. Ab dieser Zeit beginnt sich die Entwicklung der Ernten relativ von den klimatischen Phänomenen abzukoppeln.
1.3. Begründung des zeitlichen Rahmens
Für diese Untersuchung ist es nahezu unmöglich, für die Zeit nach 1700 Aussagen zu treffen, die auf der Abhängigkeit der langfristigen landwirtschaftlichen Ergebnisse von klimatischen Einflüssen beruht. Zu stark wäre das klare Bild[13] durch Interferenzen gestört, die die neuen Bewirtschaftungsmethoden im Zeitalter der Aufklärung in den Getreidescheunen hinterlassen. Rückschlüsse die sich erlauben den Faktor Klima exklusiv heranzuführen sind nicht mehr praktikabel.
Es muss also ein Zeitraum vor der Agrarrevolution im 18. Jahrhundert gewählt werden, damit die Korrelation zum Klima und Wetter noch vorhanden ist.
Doch allzu weit erlaubt die Quellenlage nicht zurückzublicken, da die Sicht in weiter vergangene Epochen trüber wird. Das ist auch nicht nötig, findet man doch von 1500 bis 1700 einen anschaulichen Rahmen für die Entwicklung einer Bevölkerung an ihre jeweilige Bedarfs-Ertragsgrenze mit finaler Klimaschwankung und deren Auswirkungen.
1.4. Der enge Nahrungsspielraum
Über 70 % der Bevölkerung waren in der Landwirtschaft tätig, Die Bodenbewirtschaftung war vor den bezeichnenden Krisen im 15. und ende des 17. Jhts. enorm arbeitsintensiv.
Dennoch war die Produktivität des Ackerbaus nach heutigen Maßstäben gering. Pro Flächeneinheit wurde ein sehr kleiner Ertrag erwirtschaftet.
Für die Menge an eingesätem Getreide erntete man etwa die dreifache[14] Menge. Wenn eine Familie mit 3 ha Land also 100 kg einsäte, waren also 200 kg pro Anbauperiode für den Verbrauch bestimmt.
Nach heutigen Maßstäben ist das unzureichend aber für die Bevölkerung des ausgehenden Mittelalters nicht weiter problematisch, denn der Bedarf an Nahrungsmitteln pro Flächeneinheit war bei der dünnen Besiedlungsdichte so gering, dass eine weniger intensive Bodenbearbeitung noch ausreichend war.
Der Einsatz von Kapital war bis weit ins 18. Jh. nicht üblich, weil zunächst das notwendige Wissen fehlte, neue Techniken zu nutzen. Mit dem entsprechenden Wissen hatte sich der Stand des Fortschritts dennoch nicht maßgeblich verbessert, da der Einsatz von Kapital – Wenn es denn zu kleinen Kreditvergaben in dieser Branche – nicht üblich war. Es gab außerdem kaum Banken. Solche Kredite kamen lediglich als Erhaltungsmaßnahme nach schlechten Ernten in Frage und spiegelten so das existenzielle Minimum wieder.[15] Damit wurde im Ernstfall Getreide gekauft, um sich zu ernähren bzw. für die Aussaat.
Für produktive Investitionen aus eigener Kraft war der Bauer nicht im Stande, produzierte er doch zum größten Teil für den Eigenverbrauch und die Abgaben an den Lehnsherrn. Es lag somit in der Hand des Lehnsherren, wie stark er seinen Hintersassen Produktionsmittel zur Verfügung stellte, die über das übliche Maß der Betriebserhaltung hinausgingen.
„…war der Stand der Landwirtschaft gegen Ende dieser Periode (14-15. Jh.) kein glänzender und besonders wurde es dem Bauern nicht möglich, die Vorzüge des Fortschrittes recht zu genießen. Die ewig geldbedürftigen weltlichen und geistlichen Herren sogen ihn systematisch aus.“[16]
Ebenso war die Bodenpolitik so restriktiv und starr angelegt, dass Verbesserungen nicht ohne weiteres Einzug in die Nutzung halten konnten. Die Bewirtschaftung der Fläche zum Beispiel unterlag der Entscheidung der ganzen Dorfgemeinschaft, einzelne Parzellen wurden im Rotationsprinzip weitergegeben und auf Zeit bewirtschaftet. Raum für private Dispositionen gab es in diesem Sinne genauso wenig, wie es privates Eigentum an Grund und Boden gegeben hat.
Allerdings war die an alten Traditionen festhaltenden Bewirtschaftungsformen, die kein Produktivitätswachstum ermöglichten, auch dem Bedürfnis der Gesellschaft nach Versorgungssicherheit geschuldet. Weniger die bis in die frühe Neuzeit reichende generelle Angst vor Neuerungen, sondern mehr die Übervorsicht gegenüber Versorgungsenpässen nach Ernteausfällen, wie sie jeder Zeitgenosse durchlebt hatte, ließen die Menschen in alten Strukturen verharren. Nach der Erfahrung der alten brachte ein kleiner Acker wenig, und ein großer Acker viel Getreide in die Scheune. Dieses Denken wurzelte so tief, dass auf Neuerungen, die die Reduktion des Ackerlandes forderten auf Unglauben oder Ablehnung trafen. Die sichere Versorgung hatte oberste Priorität und mögliche Risiken wurden eher versucht zu streuen als sie bewusst einzugehen. Das belegt „ein breites Spektrum der angebauten Kulturpflanzen [wie die] gartenbeetgrossen Getreideäcker in klimatisch ungünstigen Lagen im Berggebiet, den Einbezug archaischer Getreidesorten wie Einkorn und Emmer in die Fruchtfolge oder das Festhalten an weniger produktiven, aber robusten Tierrassen“[17].
Die Anbauform der Dreifelderwirtschaft produzierte zu wenig Mist, und reichte in schlechten Jahren teilweise nicht einmal, um dem Vieh ausreichend Winterfutter zur Verfügung stellen zu können. Mist war ein teures Gut, so dass unterwegs verlorener Dung nicht einfach liegen gelassen wurde, sondern eingesammelt und mit in den heimischen Stall getragen wurde. Streitfälle, in denen die Verwendung des auf fremden Boden gefallenen Kuhdunges behandeln, bezeugen die Knappheit dieses Rohstoffes.
Auch die dörfliche Gemeinschaft leistete Ihren Beitrag zum Bestand der landwirtschaftlichen Strukturen. Mit dem Flurzwang, den durch den Dorfschulze überwacht wurde, und dem sich jeder Bauer unterordnen musste, um Nachteile für die ganze Gemeinschaft zu verhindern,
konnten erstens ertragssteigernde Methoden nicht eingebracht werden, und zweitens war dem Einzelnen Bauern keine unabhängige, flexible Methode bzw. Bearbeitungsform z.B. als Reaktion auf Wind und Wetter nicht möglich.[18] Die gesamte Flur eines Dorfes (ca. 100 ha) wurde nicht nur im gleichen Zeitraum bearbeitet, sondern auch in der gleichen Fruchtfolge. Diese Maßnahmen zielten auf die vollständige Nutzung der wertvollen Ackerfläche in der Gemengelage ab. Dieses Prinzip lässt hingegen die Streuung des Ernterisikos außer Acht. Verschiedene Einsaattermine bzw. unterschiedliche Fruchtfolgen hätten die Gefahr eines Totalverlustes stark herabsetzt.
Gleichwohl war Die Höhe und Art der Naturalabgaben vom Grundherrn festgelegt und gab auf diese Weise der Nutzung einen sperrigen Rahmen.
1.5. Keine Produktivität durch zu große Äcker
Der weitaus größte Sperrriemen an der Produktivitätssteigerung war aber das geringe Verständnis in die Funktion der Allmende als Rückgrat der Ackerbaulichen Leistungsfähigkeit. Im Sommer diente Sie als Weide (zusammen mit den temporären Stoppelfeldern und den Wäldern der Gemeinde) und zur Heugewinnung. Das eingebrachte Heu war notwendig, um die Tiere zu überwintern.
Die Größe der Allmende war folglich der limitierende Faktor für die Herdengröße. Aufgrund der zu kleinen Herden – die wiederum auf die begrenzte Menge an Winterfutter zurückgehen – viel entsprechend wenig Mist an, der es erlaubt hätte, auf die weitere Vergrößerung der Ackerflächen zu verzichten, und den Boden dafür intensiver zu nutzen.
Dieser Kreislauf ging stark zu Lasten der Weideflächen, und der Allmende, da Äcker vergrößert wurden, um den steigenden Bedarf zu decken. Trotz des enormen Angebots an Boden waren die Menschen in der misslichen Lage, „den Bedarf der Bevölkerung nur in guten Jahren ausreichend zu decken“[19]
Insofern kann man davon ausgehen, dass die angelegten Vorräte nicht länger als eine Missernte ausgleichen konnten, da die komplette Produktion der meisten Jahre auch vollständig verbraucht wurde.
Dieser jahrhundertlangen Nullsummenproduktivität ist es geschuldet, dass sich der Spielraum der Bevölkerung sehr dicht an der subsistenziellen Ertragsleistung bewegte.
Zugleich hingen die Erträge durch die ineffiziente Nutzung stark vom Klima ab. Durch das Streben der Bevölkerung schneller als die Produktivität zu wachsen (Malthus) wird in zweiter Instanz die Abhängigkeit von der Variable Klima umso gewichtiger.
Es soll aber unter keinen Umständen die oberflächliche Schlussfolgerung gezogen werden, die Bevölkerung sei demographisch vom Klima abhängig. Da durch das übermäßige Wachstum der Bevölkerung bei gleich bleibender Produktivität gewisse demographische Einbrüche vorprogrammiert waren, können wir keine reine Abbildfunktion des Klimas in der Bevölkerungsstatistik postulieren. Man kann kompromissartig davon ausgehen, dass klimatische Faktoren den Zeitpunkt der Krise bestimmten, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass Krisen auch bei optimalen Klimaverlauf eingetreten wären.
[...]
[1] Heineberg S. 23
[2] Ebd. S. 23 nach G. Hard 1973 S. 195
[3] Pfister S. 16
[4] „Die expansive Ausbreitung der wirtschaftlichen Kultur zur Zeit der germanischen Kolonisation hatte im XIV. Jh. ihren Höhepunkt erreicht. Seitdem machte sich schon eine intensivere Ausnutzung des Bodens bemerkbar.“ Kretschmer S. 498
[5] Abel: “Massenarmut und Hungerkrisen..”
[6] Küster S. 181 - 186.
[7] Die Krisen im 14. Jh., Mitte des 16. Jh. und 1800 gehorchen den Paradigmen von Malthus.
[8] Behringer S. 150
[9] Küster S. 246
[10] Küster gibt das Klima nicht als Ursachenfaktor an:
An der Küste kommt es zu Deichkatastrophen, durch den enormen Holzbedarf waren die Städte von Energiekrisen bedroht, Hungersnote werden von Heuschreckenschwärmen hervorgerufen (wobei das Klima hier unmittelbaren Einfluss nimmt) oder von schlechten Ernten durch Frost usw. , Erosionsschäden durch Plaggenhieb und intensive Beweidung, Wehsandflächen und Wanderdünen, Die hygienischen Verhältnisse in den Städten waren katastrophal weil verunreinigtes Trinkwasser aus den Seen entnommen wurde. Letztendlich brachte die Pest größtes Unheil und wurde zumindest für das ausgehende Mittelalter zum sichtbarsten Ausdruck der Krise.
[11] Küster S. 246 aus ökologischer Sicht regulierten auch Kriege die Population (30 jähriger Krieg)
[12] Ester Boserup (1965), The conditions of agricultural growth.
[13] Vor der Agrarrevolution. Besondere Beachtung gilt der Entwicklung von chemischen Düngemitteln, Landwirtschaftlichen Maschinen und nicht zuletzt dem Einsatz von bodenaufbauenden Früchten.
[14] Abel S. 17 (3 Epochen) Ein Hof mit 3 ha bewirtschafteter Fläche in Norddeutschland kommt auf einen Ertrag von 1500 kg bei einer Aussaatmenge von 600 kg. Durch die Plaggendüngung ist der Wert bei diesem Beispiel wahrscheinlich überdurchschnittlich groß.
[15] Vgl. Pfister (gelb) S. 12 „In Notzeiten stellte die Aufnahme von Krediten auf den Boden ein letztes Mittel dar, um den sozialen Absturz zu vermeiden“
[16] Kretschmar S. 498
[17] Pfister „Haushälterischer…“ S. 9
[18] Woit S. 46 „Alle Maßnahmen von der Saat bis zur Ernte wurden gleichzeitig und gemeinsam
durchgeführt, da der Zugang zu den Parzellen nur über die Nachbarparzellen möglich war.
Die Parzellen lagen als Gewanne gruppenweise parallel nebeneinander. Mehrere Gewanne
bildeten eine Zelge, innerhalb derer sie alle der gleichen Fruchtfolge unterworfen waren.“
[19] Pfister „Haushälterischer…“ S. 9
- Arbeit zitieren
- Johannes Schulz (Autor:in), 2007, Bodennutzung und Klima in der kleinen Eiszeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113311
Kostenlos Autor werden

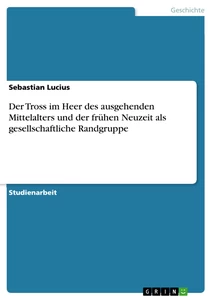



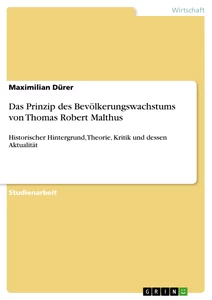









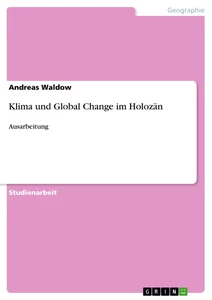
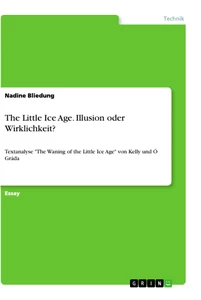



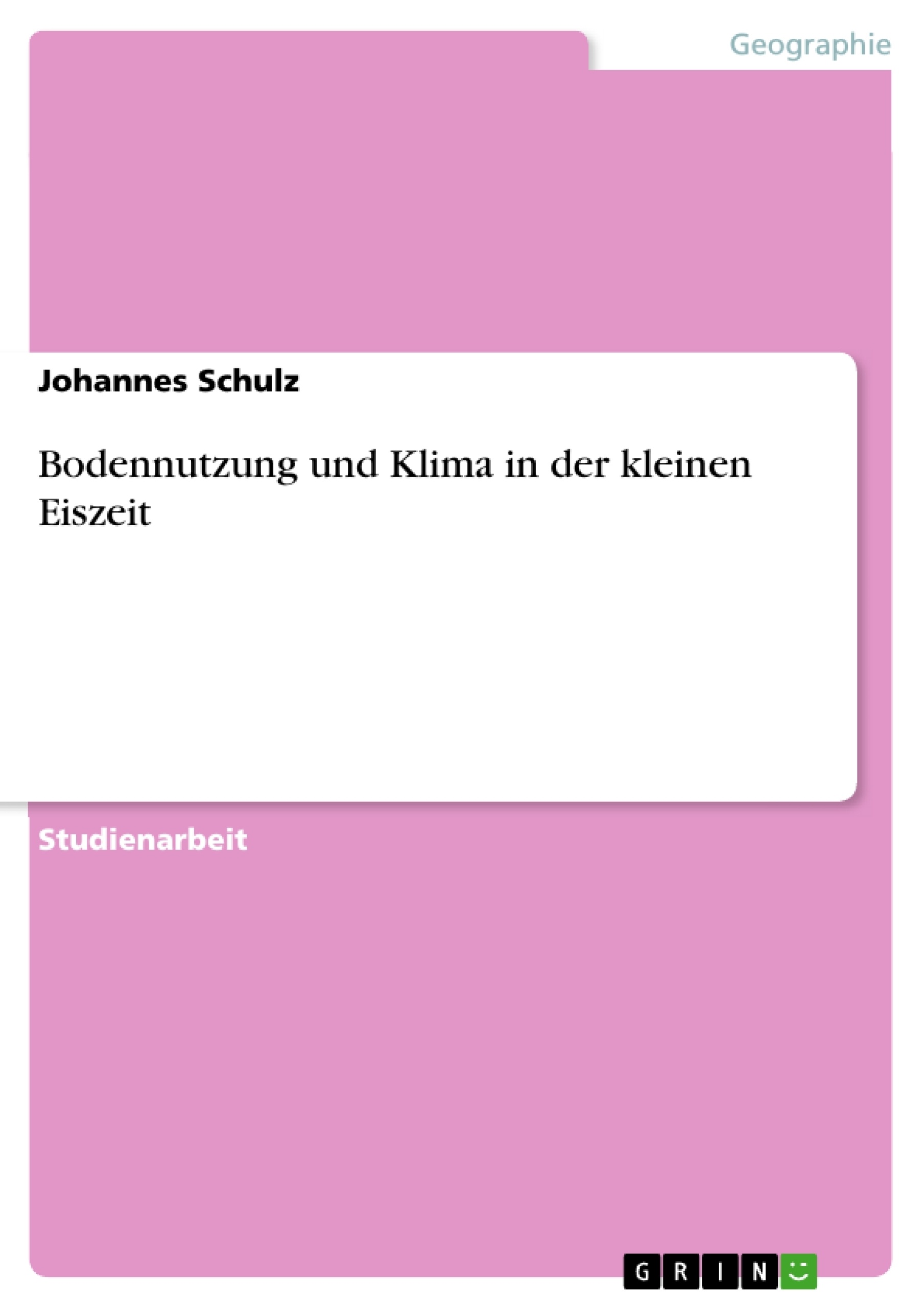

Kommentare