Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Gedankenexperimente – personale Identität als metaphysisches Problem
2.1 Die Debatte über die personale Identität in der analytischen Metaphysik – ein kurzes Resümee
2.2 Bernard Williams: "Das Selbst und die Zukunft"
2.2.1 Ein Körpertausch zweier Personen – oder doch nicht?
2.2.2 Bernard Williams: Gedankenexperiment aus der Innenperspektive – ein Appell an das 'Cartesianische Ego' des Lesers
2.3 John Perry: "Kann das Ich sich teilen?"
2.3.1 Ein weiteres Gedankenexperiment
2.3.2 Personale Identität als logisches und sprachphilosophisches Problem
2.4 Robert Nozick: "Personale Identität in der Zeit"
2.4.1 Die Theorie des direkten Nachfolgers
2.4.2 Das Paradox zweier gleichberechtigter Nachfolger
2.5 Christine M. Korsgaard: "Personale Identität und die Einheit des Handelns: Eine Kantianische Antwort auf Parfit"
2.5.1 Die Person als Handlungssubjekt
2.5.2 Wie frei bin ich außerhalb paternalistischer Übergriffe? Ein Exkurs in die Moralphilosophie
2.6 Abschließende Worte
3 Philosophie des Geistes
3.1 Überleitung: Innenperspektive (erste Person-Perspektive)
3.2 Descartes, Skeptizismus, Dualismus und Realismus
3.3 Idealismus
3.4 Materialismus und Physikalismus
3.5 Empirismus und Rationalismus
3.6 Stellungnahme
3.7 Einordnung der Problematik im Zusammenhang mit der personalen Identität
4 Naturalismus und empirische Erklärungsansätze der personalen Identität
4.1 Vorwort
4.2 Was ist Naturalismus?
4.3 Naturalismus, Apriorismus in der Erkenntnistheorie und Intuition als Mittel zur Erkenntnis
4.4 Kathleen Wilkes' "Real People"
4.4.1 Gedankenexperimente
4.4.2 Die sechs Bedingungen der Personalität von Daniel Dennett
4.4.3 Grenzfälle von Personen: Neugeborene und Föten
4.4.4 Grenzfälle von Personen: Geisteskranke
4.4.5 Einheit und Kontinuität des Bewusstseins
4.4.6 Grenzfälle von Personen: Multiple Persönlichkeiten
4.4.7 Kommissurotomie und zwei Bewusstseine
4.4.8 Über die Begriffe 'Geist' und 'Bewusstsein'
4.5 Dualismus, Geist und Bewusstsein aus Sicht der Neurophysiologie
4.6 Die Person als soziales Wesen in Dialektik mit ihrer Umwelt
4.7 'Person' als normativer Begriff
5 Fazit
6 Literatur
Als ich auf dem Fußboden inmitten von Porzellansplittern zu mir kam, bemerkte ich dicht vor mir die Beine eines über mir stehenden Menschen.
"Steh auf", sagte er und hob mich an, "hast du dir etwas getan?"
"Nein", erwiderte ich, während ich mich mit den Händen aufstützte, weil mir schwindlig war. "Von welchem Wochentag bist du?"
"Vom Mittwoch", antwortete er. "Gehen wir rasch die Steuerung ausbessern, schade um die Zeit!"
"Und wo ist der vom Montag?" fragte ich.
"Der ist nicht mehr, das heißt... der bist offenbar jetzt du."
"Wieso ich?"
"Na, weil der vom Montag in der Nacht vom Montag zum Dienstag der vom Dienstag geworden ist, und so weiter."
"Verstehe ich nicht!"
"Macht nichts, du bist es nur nicht gewohnt. Aber komm, schade um die Zeit!"
(Stanislaw Lem, Sterntagebücher, siebte Reise)
1 Einleitung
Unser Interesse an einem klaren Personenbegriff bzw. -konzept ist primär moralischer und rechtlicher Art und entsteht aus Problemen bei der Zuschreibung von Verantwortung und Schuldfähigkeit. Kann eine Person für eine frühere Handlung verantwortlich gemacht werden, und wenn ja, wie begründet man die Entscheidung, dass es sich um die gleiche und nicht etwa um eine andere Person handelt? Einem anderen wichtigen Aspekt des Themas personale Identität begegnen wir in der Abtreibungs- und Euthanasiedebatte, nämlich wann ein Wesen als Person zu betrachten ist, und was die Bedingungen dafür sind.
Wir berühren somit, wenn wir über personale Identität sprechen, im Grunde drei Themen:
1. Was ist eine Person?
Welche Wesen zählen zur Klasse der Personen?
2. Was ist Identität?
Hier können wir noch einmal unterscheiden zwischen:
2a. Identität im sozialpsychologischen Sinn; dabei wird das Thema unter einem praktischen Aspekt behandelt, nämlich unter der Frage, wie sich die konkrete Identität (im Sinne von Wesen, Eigenart, Charakter, Biografie) einer einzelnen Person durch Sozialisation u.a. konstituiert.
Und
2b. Identität der Person als metaphysisches Problem: Wie kann etwas, obwohl es sich verändert, dennoch über die Zeit hinweg das gleiche bleiben? Hier steht die Frage nach der diachronen Identität, d.h. der Identität einer Person durch die Zeit im Mittelpunkt (Griech. dia = durch; Chronos = die Zeit). Identität wird hier als strenge (im Sinne einer mathematisch-logischen Relation) aufgefasst (einige Autoren sprechen in diesem Zusammenhang auch von "numerischer Identität", vgl. Nida-Rümelin, 2001, 199 f.).
Man muss bei der Behandlung des Themas personale Identität genau darauf achten, diese drei Fragestellungen nicht zu vermischen, obwohl sie natürlich zweifelsohne in Zusammenhang miteinander stehen: Was eine Person ist (Frage 1) berührt beispielsweise auch die Frage nach der diachronen Identität (inwiefern gehört es zum Konzept der Person, dass sie als ein und dieselbe Sache durch die Zeit angesehen wird; Frage 2b). Dennoch glaube ich, dass es sinnvoller ist, diese drei Fragestellungen getrennt voneinander zu behandeln. Die Abtreibungsfrage (ab wann beginnt das personale Leben?) z.B. berührt Frage 1 und nicht Frage 2b. Ich werde im folgenden das Problem aus allen drei Perspektiven beleuchten, halte 1 und 2a aber für die aussichtsreichsten Kandidaten, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was eine Person ist, die auch in praktischer und ethischer Hinsicht tauglich ist.
Im nächsten Kapitel (Kapitel 2) werde ich mich daher erst Frage 2b widmen, d.h. das Thema personale Identität in der analytischen Metaphysik betrachten. Die dazugehörige Debatte wurde hauptsächlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geführt, und ist wie kaum eine andere in der Philosophie durch die Verwendung von Gedankenexperimenten geprägt. Einige der rätselhaften Fragen sind dabei: Wie kann etwas, das sich beständig verändert, wie ein Mensch im Laufe seines Lebens, dennoch zu verschiedenen Zeitpunkten das Gleiche sein? Ist das Ich teilbar? Was gibt uns das Recht und die Sicherheit zu behaupten, eine bestimmte Person sei zum Zeitpunkt t die gleiche Person gewesen, wie zu einem späteren Zeitpunkt t'? Welches sind die Kriterien, die diesen Schluss sinnvoll oder eben nicht sinnvoll erscheinen lassen? Im Rahmen der Diskussion über diese Fragen wurde eine Reihe von Gedankenexperimenten ersonnen, von denen ich in Kapitel 2 auf einige eingehe.
In Kapitel 3 werde ich dann zur Diskussion stellen, ob es nicht fruchtbarer ist, das theoretische Problem der personalen Identität aus der Innenperspektive der Person (erste Person-Perspektive) heraus zu betrachten, oder ob man sich damit in eine 'Cartesianische Robinsonade' oder gar in eine solipsistische Sackgasse manövriert. Macht man sich damit möglicherweise sämtliche Probleme des Dualismus zum Wegbegleiter, die mit der Annahme eines vom Körper getrennten Geistes verbunden sind? Der Rekurs auf klassische Fragen der Philosophie des Geistes ist in diesem Zusammenhang – aber auch in der gesamten Debatte über die personale Identität – unvermeidlich.
Diese Überlegungen wiederum führen mich zur direkten Betrachtung der empirischen Bedingungen personaler Identität: Da alle Gedankenexperimente in der analytischen Metaphysik offensichtlich ad absurdum geführt werden können, und auch die Einbeziehung der Innenperspektive keine zusätzlichen Erkenntnisfrüchte abwirft, stellt sich mir die Frage, ob wir beim momentanen Stand der Debatte die Erklärung dessen, was eine Person ist, nicht besser den Naturwissenschaften überlassen – oder doch zumindest Anleihen bei ihnen machen – und das Problem der personalen Identität naturalistisch angehen sollten. Ich werde mich in diesem Teil meiner Arbeit stark auf Kathleen Wilkes' Buch "Real People" berufen, in dem sie die These vertritt, dass der Mensch (im Sinne des biologischen Begriffes Homo Sapiens) unser Paradigma für eine Person ist.
Der Argumentationsweg meiner Arbeit wird also in drei Phasen verlaufen: Zuerst werde ich die Debatte über die personale Identität in der analytischen Metaphysik am Beispiel ausgewählter Gedankenexperimente eingehender darstellen (Frage 2b). Über diese Betrachtungen gelange ich zu einigen zentralen Fragen aus dem Bereich der Philosophie des Geistes, auf die ich in Kapitel 3 eingehen werde. In Kapitel 4 sollen dann stärker empirische Ansätze zur Klärung des Personenbegriffes (Frage 1 und 2a) thematisiert werden. Im abschließenden Kapitel 5 werde ich zu meiner eigenen Beurteilung der Thematik gelangen.
Zunächst jedoch noch eine Anmerkung zur Methode, um Unklarheiten von vornherein zu beseitigen und mir nicht den Vorwurf der Inkonsistenz einzuhandeln: Ich werde dafür argumentieren, dass es für uns intuitiv nicht vorstellbar ist, dass unser Bewusstsein sich teilen und auf mehrere Körper im Raum verteilt sein kann. Diese Prämisse ist Teil eines taktischen Schachzuges, um bestimmte Ansätze in Bezug auf die Erklärung personaler Identität von vornherein verwerfen zu können. Anschließend werde ich die Folgerungen aus der Auffassung erläutern, dass wir so etwas wie ein einheitliches und unteilbares Bewusstsein haben. Diese Folgerungen führen mich direkt zu bestimmten theoretischen Annahmen aus dem Bereich der Philosophie des Geistes, die ihrerseits neue Inkonsistenzen und Paradoxien zur Folge haben, so dass ich diese Theorien ebenfalls als untauglich für meine Zwecke verwerfe. Hieran schließe ich dann meine (an Kathleen Wilkes angelehnte) Argumentation für eine stärkere Berücksichtigung empirischen Wissens in der Frage nach der personalen Identität an. Zu diesem Zweck wird das Thema 'Einheit und Kontinuität des Bewusstseins' erneut eine Rolle spielen – dieses Mal allerdings richte ich mich dann explizit gegen die (theoretische) Vorstellung eines einheitlichen und unteilbaren Bewusstseins, die sich unserer Intuition aufdrängt. Damit möchte ich jedoch im Umkehrschluss nicht für die eingangs geschilderten metaphysischen Theorien personaler Identität argumentieren, im Gegenteil: Ich plädiere gerade dafür, den Bereich der Metaphysik zur Klärung des Personenbegriffes zu verlassen und spreche mich für eine stärkere Berücksichtigung und Einbeziehung empirischer Erkenntnisse aus. Denn gerade die m.E. realitätsfernen Gedankenexperimente aus der analytischen Metaphysik möchte ich vermeiden, obwohl in ihnen – genau wie in der empirischen Betrachtungsweise – die Einheit und Kontinuität des Bewusstseins in Frage gestellt wird. Nur wird sie dort aus anderen Gründen in Frage gestellt, nämlich, um die theoretische Möglichkeit bestimmter Sachverhalte beweisen zu können (die nicht bewiesen werden könnten, wenn man so etwas wie Einheit und Kontinuität des Bewusstseins annehmen würde), und nicht aus Gründen, die die Praxis – die Empirie – uns nahe legt.
2 Gedankenexperimente – personale Identität als metaphysisches Problem
Kaum eine Debatte ist in der Philosophie so stark am Beispiel von Gedankenexperimenten geführt worden, wie die über die personale Identität. Einige dieser Gedankenexperimente muten jedoch aus der Perspektive des gesunden Menschenverstandes sehr merkwürdig an, scheinen sie doch stark von einem Identitätsbegriff auszugehen, wie er in der Logik oder Mathematik angewendet wird (und der sich u.a. durch Transitivität und Eineindeutigkeit auszeichnet), oder lediglich eine apriorische Analyse des Begriffes der personalen Identität zu sein, die weit von der Empirie – und damit der Realität – entfernt ist.
Ich möchte mich im folgenden mit einigen solcher Gedankenexperimente näher auseinander setzen und diese diskutieren, um mich im übernächsten Kapitel dann eher empirisch-orientierten Erklärungsansätzen des Personen- sowie des Begriffes der personalen Identität zu widmen (Frage 1 und 2a; vgl. Einleitung).
Dabei gehe ich zuerst auf einen imaginären Fall von Bernard Williams ein, den er in seinem Aufsatz "Das Selbst und die Zukunft" beschreibt, dann auf ein Gedankenexperiment von John Perry, in welchem er der Frage nachgeht "Kann das Ich sich teilen?", anschließend auf die Theorie des 'direkten Nachfolgers' von Robert Nozick und zum Abschluss auf einen Beitrag von Christine M. Korsgaard, in dem sie nicht die passive Komponente des mentalen Verknüpfseins einer früheren mit einer späteren (Personen-)Entität in den Mittelpunkt stellt, sondern die aktive (praktische) Komponente, bei welcher diese Entität als Handlungseinheit in der Zeit begriffen wird. Hierzu möchte ich die einzelnen Beiträge zuerst jeweils kurz zusammenfassen, und anschließend jeden Beitrag für sich diskutieren.
2.1 Die Debatte über die personale Identität in der analytischen Metaphysik – ein kurzes Resümee
Die Debatte um die personale Identität erfuhr in den letzten fünfzig Jahren hauptsächlich im angelsächsischen Raum einen enormen Aufschwung (es geht dabei um die personale Identität im Sinne von Frage 2b; vgl. Einleitung). Was gibt uns die Sicherheit zu behaupten, eine bestimmte Person XY sei zum Zeitpunkt t die gleiche Person gewesen, wie zu einem späteren Zeitpunkt t'? Welches sind die Kriterien, die diesen Schluss sinnvoll oder eben nicht sinnvoll erscheinen lassen? Der praktische, genauer gesagt juristische Bezug dieses Ansatzes besteht darin zu begründen, ob eine Person für eine frühere Handlung verantwortlich gemacht werden kann, und warum es sich um die gleiche und nicht etwa eine andere Person handelt.[1] Auslöser für die jüngere Debatte über die personale Identität war ein Zitat aus John Lockes "Essay Concerning Human Understanding" aus dem Jahr 1694, auf welches sich die meisten der späteren Beiträge beziehen:
[W]e must consider what Person stands for; which, I think, is a thinking intelligent Being, that has reason and reflection, and can consider it self as it self, the same thinking thing in different times and places; which it does only by that consciousness, which is inseparable from thinking, and as it seems to me essential to it: It being impossible for any one to perceive, without perceiving, that he does perceive. When we see, hear, smell, taste, feel, meditate, or will any thing, we know that we do so. Thus it is always as to our present Sensations and Perceptions: And by this every one is to himself, that which he calls self: It not being considered in this case, whether the same self be continued in the same, or divers Substances. For since consciousness always accompanies thinking, and 'tis that, that makes every one to be, what he calls self; and thereby distinguishes himself from all other thinking things, in this alone consists personal Identity, i.e. the sameness of a rational Being: And as far as this consciousness can be extended backwards to any past Actions or Thought, so far reaches the Identity of that Person; it is the same self now it was then; and 'tis by the same self with this present one that now reflects on it, that that Action was done. (Locke, 1975, 335 – Lockes Hervorhebungen)
Mit dieser Definition führt Locke das sog. Erinnerungskriterium in die Debatte ein, welches seiner Meinung nach die Grundlage für die diachrone Identität bildet (vgl. Quante, 1999, 12), d.h. dass die Erinnerungen einer Person konstitutiv für deren Identität sind. An dieses Erinnerungskriterium anknüpfend formuliert Williams 1960 einen Einwand, der dazu führt, dass die Debatte von Lockes empirischer Betrachtungsweise in die Richtung einer analytisch-metaphysischen Untersuchung des Begriffs personale Identität gelenkt wird. Williams macht sich dabei einerseits für das Körperkriterium stark, worauf ich im nächsten Abschnitt näher eingehen werde, andererseits führt er das Eineindeutigkeitsprinzip[2] ein:
Sehr grob ausgedrückt, besagt das meinem Argument zugrunde liegende Prinzip, daß Identität eine eineindeutige Relation ist und daß kein Prinzip ein Identitätskriterium für Dinge des Typs T sein kann [mit 'Dinge des Typs T' meint Williams hier eine bestimmte Person zu verschiedenen Zeitpunkten, oder auch ein bestimmtes 'Personenstadium' – d. Verf.], wenn es, logisch gesehen, auf einer einmehrdeutigen oder einer nichteindeutigen Relation zwischen Dingen des Typs T beruht. Der Fehler des vermeintlichen Identitätskriteriums für Personen, das nur auf beanspruchten Erinnerungen beruht, besteht gerade darin, daß 'zur aufrichtigen Äußerung von Erinnerungen disponiert sein, die genau dem Leben von – entsprechen.' keine eineindeutige, sondern eine mehreindeutige Relation und folglich in logischer Hinsicht unmöglich ein angemessenes Identitätskriterium ausmachen kann. [...] Das genannte Prinzip legt eine notwendige Bedingung für beliebige Identitätskriterien fest. Offensichtlich drückt es keine hinreichende Bedingung aus und stellt erst recht keine hinreichende Bedingung dafür auf, daß etwas in bezug auf einen bestimmten Gegenstandstyp T als philosophisch befriedigendes Identitätskriterium gilt. Insbesondere [...] gilt kein Prinzip P als philosophisch befriedigendes Identitätskriterium für T's, wenn es nur durch eine ganz willkürliche Vorkehrung davor bewahrt wird, mehreindeutige Relationen zwischen T's zuzulassen. (Williams, 1978c, 40 – meine Hervorhebungen)[3]
Dies stellt die Basis zu Williams' 'Verdopplungseinwand' dar. Der Verdopplungseinwand besagt, dass wenn es logisch möglich ist, die Erinnerungen einer Person in einen anderen Körper zu verpflanzen, es logisch auch möglich ist, dies mehrmals zu tun. Mit Hilfe dieses Einwands versucht Williams nun, das Erinnerungskriterium ad absurdum zu führen und für das Körperkriterium zu argumentieren. Hieran anknüpfend entwirft Sidney Shoemaker 1963 ein berühmtes Gedankenexperiment, den Fall Brownson:
Brown und Robinson unterziehen sich beide einer Operation, bei der ihr Gehirn aus dem Schädel entfernt werden muß, um einen Gehirntumor entfernen zu können. Anschließend werden die Gehirne wieder eingesetzt. Aufgrund eines Versehens wird aber dem Patienten Brown das Gehirn von Robinson eingesetzt, und dem Patienten Robinson das Gehirn von Brown. Während der Patient mit Robinsons Gehirn und Browns Körper direkt nach der Operation stirbt, erlangt der andere Patient (Browns Gehirn in Robinsons Körper) sein Bewußtsein zurück. 'Brownson', wie man ihn nun nennen könnte, erinnert sich an alle Vorgänge aus Browns Leben, erkennt z.B. Browns Frau und Kinder wieder, während er über keine Erinnerung an Robinsons vergangenes Leben verfügt. (Quante, 1999, 13)
Shoemaker ist trotz des von ihm geschilderten Ausgangs dieses Falles nicht der Ansicht, dass die Erinnerung ein notwendiges oder hinreichendes konstitutives Kriterium für Identität ist oder aus diesem Grund dem Körperkriterium vorzuordnen sei. In der nächsten Phase der Debatte ist der Punkt gekommen, an dem das Körperkriterium lediglich auf das Gehirn eines Menschen beschränkt wird[4]. Man spricht auch vom Gehirnkriterium:
Damit wird das Gehirn als der kausale Träger des mentalen Lebens einer Person konstitutiv für die Person, und die Bedingungen diachroner Identität für das Gehirn werden zu konstitutiven Bestandteilen der Bedingungen diachroner Identität von Personen. [...] Die [...] geforderte kausale Kontinuität verweist auf die Kontinuität meines Körpers, speziell meines Gehirns. Im Fall Brownson ist diese Bedingung erfüllt, da Browns Gehirn als ganzes in den Körper von Robinson transplantiert worden ist, so daß das Erinnerungskriterium und das Körperkriterium [...] gleichermaßen erfüllt sind. (Quante, 1999, 15)
Der Konflikt zwischen Körper- und Erinnerungskriterium ist damit überwunden, da das eine seine physikalische Basis in dem anderen hat. Der von Williams vorgebrachte Verdopplungseinwand ist damit jedoch noch nicht aus der Welt geschafft, denn es wäre ja möglich, Browns Gehirn in zwei Hälften zu teilen, die jeweils andere Hälfte zu duplizieren und die beiden neu entstandenen Gehirne in jeweils einen Körper einzupflanzen (auf ein ähnliches Gedankenexperiment werde ich in 2.3 eingehen), woraufhin beide Browns wieder Bewusstsein erlangen. Hält man am Eineindeutigkeitsprinzip fest, ergibt sich hier die folgende Schwierigkeit: Entweder, es gibt Brown nun zwei Mal, oder es gibt keine Person, die mit Brown identisch ist. Dies ist jedoch insofern seltsam, führt man sich vor Augen, dass – sobald einer der Brown-Nachfolger stirbt – wir behaupten würden, es gäbe jemanden, der mit Brown identisch ist – nämlich seinen noch lebenden Nachfolger. Sobald es also (mindestens) einen Konkurrenten hinsichtlich des Identitätsanspruches gibt, besteht keine Identität mehr zwischen Brown und seinen Nachfolgern. "Solche Theorien sind in dem Sinne 'extrinsisch', als sie das Bestehen der Identitätsrelation zwischen X und Y von Fakten abhängig machen, die Entitäten betreffen, die mit X und Y nicht identisch sind. Schon wenn man nur negativ die Bedingung aufnimmt, daß es keinen solchen Konkurrenten geben darf, hat man einen extrinsischen Bezug hergestellt." (Quante, 1999, S. 16) Ob eine bestimmte Person zu einem früheren Zeitpunkt die gleiche ist, wie zu einem späteren Zeitpunkt hinge also von Fakten außerhalb dieser Person ab, also z.B. von anderen Personen, die die vermeintlich gleiche Identität haben. Als die Debatte über die personale Identität an diesem Punkt angekommen ist, veröffentlicht Bernard Williams 1970 seinen Aufsatz "Das Selbst und die Zukunft", auf den ich nun ausführlicher eingehen möchte.
2.2 Bernard Williams: "Das Selbst und die Zukunft"
2.2.1 Ein Körpertausch zweier Personen – oder doch nicht?
In diesem Szenario spielt Williams die Möglichkeit eines Körpertausches von zwei Personen durch. Der besondere Clou hierbei besteht darin, dass Williams dies nicht nur aus der Außenperspektive (dritte Person-Perspektive) tut, sondern denselben Vorgang auch aus der Innenperspektive (erste Person-Perspektive) schildert, d.h. er versucht darzustellen, wie sich dasselbe Ereignis anfühlt, wenn mir etwas derartiges passieren würde. Williams will damit aufzeigen, wie paradox das von Shoemaker in die Debatte eingebrachte Gedankenexperiment über den Fall 'Brownson' tatsächlich ist, wenn einem ein derartiges Ereignis selbst zustoßen würde. Williams führt hier ein neues Element in die Debatte ein: die Sorge um die eigene Zukunft, d.h. die Sorge darum, was meinem Körper in der Zukunft wiederfahren wird (bisher lag der Fokus in der Debatte über die personale Identität eher auf den Erinnerungen einer Person und war damit hauptsächlich an deren Vergangenheit ausgerichtet). Die interessante Frage ist hierbei, ob es sich tatsächlich um die eigene oder nicht doch die Zukunft (irgend)einer anderen Person handelt. Elementarer Bestandteil von Williams' Gedankenexperimentes ist daher die Angst vor einer (möglichen) Folter.
Der gedankliche Versuchsaufbau sieht folgendermaßen aus: Zwei Personen – A und B – haben sich zu einem Versuch bereit erklärt, bei dem sie sich mittels einer neuartigen Maschine einem Körpertausch unterziehen werden (dabei werden die Informationen beider Gehirne entnommen, in der Maschine gespeichert und anschließend in das jeweils andere Gehirn eingespeist). Das bedeutet, dass sich A's Erinnerungen, Charakter und Geschmack hinterher in B's Körper und B's Erinnerungen, Charakter und Geschmack hinterher in A's Körper befinden sollen. Dann werden beide gebeten, sich vor dem Versuch zu entscheiden, welcher der beiden Körper nach dem Versuch gefoltert werden soll, und welcher der beiden Körper eine große Geldsumme erhalten soll, "wobei diese Entscheidung (wenn möglich) aus eigennützigen Gründen zu treffen ist." (Williams, 1978b, 81) Der Versuch wird durchgeführt und hinterher entscheidet das Los, welche der beiden Personen gefoltert wird, und welche das Geld erhält. Williams spielt nun die verschiedenen Ausgangsmöglichkeiten dieses Experiments durch und kommt zu dem Schluss (da A und B sich – bei der gegebenen Klassifizierung des Versuchs als 'Körpertausch' – vernünftigerweise am Erinnerungskriterium und nicht am Körperkriterium orientieren werden), dass A sich vor dem Versuch dafür entscheiden wird, dass der B-Körper das Geld erhält und der A-Körper gefoltert wird, B hingegen sich vor dem Versuch genau umgekehrt entscheiden wird und sich wünscht, dass der B-Körper gefoltert wird, während der A-Körper das Geld erhalten soll. Das Körperkriterium verwirft Williams also vorerst, als Grund hierfür führt er den folgenden Sachverhalt ins Feld: Person A (vor dem Körpertausch) wird von Angstzuständen gequält, während Person B unter schrecklichen Erinnerungen leidet. Nach dem Versuch stellt die B-Körper-Person fest, dass sie von Angstzuständen gequält wird, während die A-Körper-Person durch den Körpertausch nun B's schreckliche Erinnerungen habe. Hiermit sei bewiesen, dass das Körperkriterium nicht der ausschlaggebende Punkt für die personale Identität sein kann.
Nun geht Williams dazu über, denselben Fall aus der Innenperspektive zu schildern. Er vollzieht diese Schilderung in sechs Schritten. Ausgangssituation ist folgende: Ich bin Gefangene eines bösen Herrschers und diesem auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.
- Im ersten Schritt wird mir schlicht mitgeteilt, dass ich morgen gefoltert werde. Natürlich habe ich Angst vor der bevorstehenden Folter.
- Im zweiten Schritt teilt man mir mit, dass ich nicht nur gefoltert werde, sondern vorher auch noch meine Erinnerung an den heutigen Tage (an dem man mir von der Folter berichtet hat) verloren haben werde, mich in der Situation selbst also nicht mehr daran erinnern können werde, dass ich vorher Angst hatte. So lange ich jetzt jedoch um die Folter weiß, werde ich sie dennoch fürchten.
- Im dritten Schritt wird mir gesagt, dass ich während der Folter nicht nur die Erinnerung an die schlechte Nachricht über die bevorstehende Folter verloren haben werde, sondern alle meine Erinnerungen. Auch dies macht mich nicht glücklicher, denn jetzt fürchte ich nicht nur die Folter, von der ich im Augenblick immer noch weiß, dass sie mir bevorstehen wird, sondern jetzt bin ich zusätzlich auch noch deshalb unglücklich, weil ich offensichtlich durch irgendeinen Vorgang mein Gedächtnis verlieren werde.
- Im vierten Schritt erfahre ich, dass ich zum Zeitpunkt der Folter nicht nur alle meine (mir lieben und wertvollen) Erinnerungen an mein bisheriges Leben verloren, sondern auch noch ganz andere, mir zum aktuellen Zeitpunkt völlig neue und unbekannte Erinnerungen haben werde. Die Aussicht auf eine Folter wird dadurch nicht weniger furchteinflößend.
- Im fünften Schritt wird mir gesagt, dass mir nicht irgendwelche Erinnerungen eingegeben werden, sondern die einer zu diesem Zeitpunkt konkret existierenden Person (B genannt).
- Im letzten Schritt erfahre ich schließlich, dass ich nicht nur die Erinnerungen dieser mir völlig unbekannten Person B haben werde, sondern dass diese Person durch ein wunderliches Verfahren auch alle meine Erinnerungen haben wird, diese Erinnerungen also nicht für immer verloren gehen werden. Ich habe natürlich immer noch Angst vor der Folter.
Williams ist der Ansicht, dies sei lediglich eine alternative Beschreibung desselben Szenarios, das anfangs aus der dritten Person-Perspektive als Körpertausch von A und B beschrieben wurde. Allerdings unter etwas anderen Rahmenbedingungen, denn zum einen habe ich mich im letzten Fall nicht freiwillig diesem Versuch unterzogen, zum anderen ist mir die Person, deren Erinnerung ich erhalten soll, völlig unbekannt, was natürlich für den Ausgang des Falls selbst keine große Rolle spielt. Worauf Williams hinaus möchte ist, dass ich während keinem dieser sechs Schritte die Folter weniger fürchten werde, als ich sie schon im ersten Schritt gefürchtet habe, im Gegenteil. "Sollte dies richtig sein, so ist das ganze Problem jetzt anscheinend völlig im dunkeln." (Williams, 1978b, 88) Die Situation, was in solch einem Fall mit einer Person geschehen würde, ist begrifflich unentscheidbar. "Daraus folgt, daß ich nicht die mindeste Klarheit darüber gewonnen habe, welches der Angebote man klugerweise annehmen sollte, wenn sie vor dem Versuch gemacht werden. Dies finde ich sehr beunruhigend." (Williams, 1978b, 102)
2.2.2 Bernard Williams: Gedankenexperiment aus der Innenperspektive – ein Appell an das 'Cartesianische Ego' des Lesers
Williams hat die Debatte also in die Aporie geführt indem er gezeigt hat, dass offensichtlich beide Kriterien – Körper- und Erinnerungskriterium – als konstitutive Kriterien für personale Identität (im Sinne von 2b, vgl. Einleitung) nicht taugen. Worauf Williams hier jedoch eigentlich anspielt, ist die Intuition des Lesers – er appelliert an dessen 'Cartesianisches Ego'. Auch wenn der Begriff selbst in diesem Zusammenhang nicht fällt und Williams selbst sogar sagt, dass er ihn zu vermeiden wünscht, so gibt es doch die eine oder andere Anspielung auf etwas derartig beschaffenes. Beispielsweise sagt Williams: "Insbesondere werden die eventuellen Eindrücke meiner Vergangenheit keine Wirkung darauf haben, ob ich Schmerzen empfinde oder nicht." (Williams, 1978b, 89) Das ist durchaus richtig. Aber was bleibt dann von mir übrig, wenn alle meine Erinnerungen mir genommen sind? Mir scheint es, als wenn hier tatsächlich auf eine tieferliegende Entität angespielt wird, eben das unanzweifelbare Cartesianische Ego (siehe 3.2), mein Bewusstsein (von mir), bei dem ich davon ausgehen kann, dass es mich auch in meine Zukunft begleiten wird.
Insgesamt drängte sich mir hier die Frage auf, was Williams im Sinn hat, wenn er von der Übertragung von Informationen von einem Gehirn in das andere spricht – beinhaltet dies dann lediglich die Erinnerungen oder auch den Charakter der anderen Person, so dass nur so etwas wie ein Ich-Bewusstsein, ein Cartesianisches Ego zurück bleibt? Oder ist mein Charakter untrennbar mit meinem Ich-Bewusstseinsein verbunden, so dass – wenn mein Charakter tatsächlich übertragen werden könnte – automatisch auch mein Ich-Bewusstsein in dem neuen Körper wohnt?[5] Verhielte es sich nicht so, wären schlicht meine Erinnerungen das einzige, was übertragen worden wäre. Aber genau das bestreitet Williams:
Es bleibt immer noch schwierig zu erkennen, warum dies [er meint die Tatsache, daß die neuen Erinnerungen und Charakterzüge von einer zu diesem Zeitpunkt wirklich existierenden Person stammen – d. Verf.] für den in die Zukunft Blickenden den Unterschied zwischen der Erwartung von Schmerzen und der Erwartung keiner Schmerzen bedeuten soll. Dies sei durch das Beispiel der Charakterzüge veranschaulicht: Wenn A dazu fähig ist, Schmerzen zu erwarten, so ist er auch dazu in der Lage, Schmerzen zu erwarten, denen eine Veränderung seiner Neigungen und Veranlagungen vorhergeht, und es ändert nichts an dieser Erwartung, falls diese Änderung in seinen Neigungen denen einer anderen Person nachgebildet oder sogar durch sie bewirkt ist. (Williams, 1978b, 94)
Diese Ausführungen legen m.E. den Schluss nahe, dass Williams der Ansicht ist, Charakter- und Erinnerungsinformationen könnten übertragen werden, mein Ich-Bewusstsein (das sich in diesem Fall vor den zu erwartenden Schmerzen fürchtet) jedoch nicht[6]. Ich müsste mich mir selbst in der Zukunft also mit einem anderen Charakter vorstellen. Dies entzieht sich jedoch der menschlichen Vorstellungskraft. Zwar wünsche ich mir im Alltag vielleicht gelegentlich, 'in jemandes Haut zu stecken', in seiner Situation zu sein, sein Wissen oder seinen wirtschaftlichen Besitz oder was auch immer ihm eigenes zu haben. Dennoch kann ich es mir nur schwer vorstellen, wie es wirklich ist, er zu sein, d.h. seinem Charakter und seinen Dispositionen gemäß zu handeln (und nicht etwa an meinen eigenen Maßstäben orientiert jedoch in seiner Lebenssituation).
Ich kann mir nur insofern vorstellen, jemand anders zu sein, als dass ich versuche, mich in ihn hineinzuversetzen. Dies heißt, ich male mir aus wie es ist, in seinem Körper und in seiner (Lebens-)Situation zu sein. Ich kann mir aber nicht vorstellen, er zu sein![7] Möglicherweise kann ich mir noch vorstellen, jemandes Erinnerungen zu haben und zu glauben, dies seien meine Erinnerungen; aber ich kann mir nicht vorstellen, er zu sein, insofern, dass ich auch seinen Charakter habe (d.h. wenn ich von Natur aus dazu neige, großzügig zu sein, kann ich es mir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, jemand zu sein, der von Natur aus geizig ist). Auf ähnliche Weise kann ich mich jedoch in mich selbst in der Zukunft (oder Vergangenheit) hineinversetzen. Selbstverständlich kann ich mich um so besser in eine Person hineinversetzen ('hineindenken'), je mehr Informationen ich über sie habe, und natürlich habe ich über mich selbst die meisten Informationen, da ich mein sämtliches Tun und alle meine Gedanken jederzeit vergleichsweise gut (im Vergleich zu anderen Menschen) einsehen kann. Insofern fällt es mir nach wie vor leichter, mich in ein früheres eigenes Ich hineinzuversetzen (oder durch Extrapolation meiner Kenntnisse über mich selbst mich in meine eigenen zukünftiges Ichs hineinzuversetzen), als in eine andere Person. Hätte ich beispielsweise jedoch alles über Lady Di gelesen, sie möglicherweise sogar persönlich gut gekannt, ihr Verhalten, ihr Benehmen, ihre Reaktionsweisen, und welche Angewohnheiten sie hat, genau beobachtet, dann fiele es mir leichter, mir vorzustellen, ich wäre sie oder sie zu spielen, d.h. so zu tun, als wäre ich sie. Würde ich behaupten, ich wäre Lady Di und gleichzeitig aktiv meinen Beruf als Schlächterin ausüben, so würde mir vermutlich niemand auch nur annähernd glauben, dass ich die englische Prinzessin bin. Das Ganze wirkte dann grotesk und lächerlich. Man würde in so einem Fall wohl sagen, es handelt sich um eine Neurose, also um ein psychologisches und nicht um das philosophische Problem, dass hier eine Person auf wundersame Weise ihre Identität gewechselt hat (auf dieses Problem werde ich in 4.4.6 noch einmal ausführlicher zu sprechen kommen).
Aber kehren wir wieder zu Williams' ursprünglichem Beispiel zurück und nehmen wir an, es handelt sich nicht um eine Neurose, sondern während sie schlief hat sich ein verrückter Neurochirurg am Gehirn einer bestimmten Person zu schaffen gemacht und ihr entsprechendes 'Datenmaterial' aus Lady Dianas Gehirn überspielt. In diesem Fall würde die Person, die vorher Schlächterin war, ihren Beruf wohl augenblicklich aufgeben, da er nicht zu ihrem neuen Wesen, ihrer neuen Persönlichkeit (ihrer neuen Identität im Sinne von 2a; vgl. Einleitung) passt. Aber ist es die Persönlichkeit allein, die eine Person konstituiert? Ich denke nicht, jedenfalls nicht ausschließlich. Persönlichkeit ist zu fragil und zu leicht veränderbar, als dass sie ein hinreichendes Kriterium für personale Identität im Sinne von 2b (vgl. Einleitung) sein könnte. Daher denke ich, es muss noch so etwas wie ein aus der Innenperspektive empfundenes Selbstbewusstsein hinzukommen, und ich meine, dies ist es auch, worauf Williams mit seiner Darstellung anspielen möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich nicht schon im dritten Schritt meiner obigen Darstellung verloren hätte, erst recht gilt dies natürlich für den vierten Schritt, denn ich hätte spätestens dann eine andere Identität, sofern man diese nur am 'Informationskriterium'[8] fest macht.
Vermutlich hätte ich sogar mehr Angst vor dem Vorgang, bei dem mir alle Informationen, die mich konstituieren, abhanden kommen sollen, als vor der Folterung, da ich eben nicht weiß, ob ich dabei nicht meine Identität (im Sinne von 2a, vlg. Einleitung) und damit mich selbst total verlieren würde! Ich kenne diese Person ja nicht einmal, deren Erinnerung ich anschließend haben werde, wie soll ich mir da vorstellen, dass ich sie sein werde? Mir mich selbst als mit anderem Charakter und anderen Erinnerungen vorzustellen, ist nicht möglich! Ich kann mir mich nicht als jemand anders denken!
Auch wenn er dies an anderer Stelle bestreitet, zielt Williams hier zielstrebig auf einen intuitiven Begriff eines Ich-Bewusstseins ab, das sich einfach in die Zukunft extrapolieren lässt. Dieser Kunstgriff – der Appell an die Intuition des Lesers – macht es nicht weiter schwierig, die Frage, ob das Körper- oder Erinnerungskriterium für personale Identität konstitutiv ist, ad absurdum zu führen[9]. Eine Lösung des Problems hat man somit leider nicht, sondern lediglich die negative Bestimmung, was personale Identität nicht ist.
Williams selbst schlägt am Ende seines Aufsatzes eine Lösung vor, die sich gegen die Vorstellung von geisterhaften Personen in Körpern, also gegen eine substanzdualistische Auffassung von Personen (vgl. 3.2) richtet. Er beruft sich auf die seiner Meinung nach künstliche Darstellung des ersten Falles als den Fall eines Körpertausches, welche um der Klarheit des Versuches willen vom (fiktiven) Versuchsleiter gegeben wurde. "Hätten wir nun ein Modell von geisterhaften Personen in Körpern, die man durch bestimmte Verfahren in gewissem Sinne tatsächlich hin und her bewegt, so könnten wir den klaren Versuch einfach als den gelungenen betrachten: als die Methode, die wirklich dazu führt, daß geisterhafte Personen ihren Ort wechseln, ohne zerstört oder zerstäubt zu werden oder daß sonst etwas mit ihnen geschieht. Wir können uns aber nicht im Ernst eines solchen Modells bedienen." (Williams, 1978b, 103 ff. – Williams' Hervorhebung).[10] Ich möchte jedoch kritisch anmerken, dass es Williams selbst ist, der sich das Versuchsergebnis (B-Körper-Person hat nun A's Angstzustände und A-Körper-Person B's schreckliche Erinnerungen) ausgedacht hat und den Ausgang des Experiments damit von vornherein so festgelegt hat (vgl. Williams, 1978b, 86) – gleichzeitig stellt er aber immer wieder in Frage, ob die gegebene Bezeichnung des Versuches als 'Körpertausch' richtig und angemessen ist. Wir wissen nicht, ob es sich in Wirklichkeit nicht möglicherweise anders verhalten würde, da ein solches Experiment in der Praxis undurchführbar ist. Insofern ist das Gedankenexperiment tautologisch, da genau das bewiesen wird, was vor dem Versuch als Ergebnis desselben vorausgesetzt wurde (nämlich dass ein Körpertausch stattgefunden hat); aber dies ist nicht der Punkt, um den es geht. Schließlich ist auch Williams sich dieses Problems bewusst.[11]
Ferner finde ich es widersprüchlich, dass Williams doch in der zweiten Darstellung des Falles eindeutig an die 'Cartesianische Intuition' des Lesers appelliert, mit dem Ziel, diesem seine alternative Darstellung des Falles plausibler zu machen (und Dualismus damit Tür und Tor öffnet), während er nun jedoch gegen eine dualistische Weltsicht argumentiert. Ihm erscheint es jetzt vielmehr so, dass "das Prinzip, daß Furcht künftigen Schmerzen gelten kann, welche psychischen Veränderungen ihnen auch immer vorhergehen mögen, unmittelbar einleuchtend" (Williams, 1978b, 104) sei. Daher solle "Person A, die eigennützig zu entscheiden hat, vielleicht die Entscheidung treffen, die Schmerzen der B-Körper-Person zuzuschieben. Dies wäre riskant, und daß es hier Raum für den Begriff des Risikos gibt, ist selbst ein wesentliches Merkmal dieses Problems." (ebd. – Williams' Hervorhebung) Ich denke jedoch, dass diese Schlussfolgerung keine befriedigende Lösung des Problems darstellt. Denn wenn die Vorstellungskraft laut Williams nicht zum Verständnis des logisch Möglichen taugt, das Dilemma in seinem Beispiel aber auf unserer Vorstellungskraft beruht und uns in eine entsprechende Sackgasse führt – wäre es dann nicht sinnvoller, entweder solchen Beispiele keine weitere Beachtung zu schenken und stattdessen über das faktisch Mögliche nachzudenken, oder das logisch Mögliche mit anderen Mitteln als mit unserer Vorstellungskraft zu untersuchen?
2.3 John Perry: "Kann das Ich sich teilen?"
2.3.1 Ein weiteres Gedankenexperiment
Ausgangspunkt für John Perrys Aufsatz von 1972 ist ein Gedankenexperiment, das dem bereits 1963 von Sidney Shoemaker diskutierten Fall 'Brownson' weitestgehend gleicht:
Brown, Jones und Smith gehen in die Klinik, um sich einer Gehirnverjüngungskur zu unterziehen. (Bei einer Gehirnverjüngungskur wird das Gehirn entnommen, seine Verschaltungen werden von einer sagenhaften Maschine analysiert, und ein neues Gehirn, das in allen relevanten Hinsichten genauso beschaffen ist wie das alte, nur daß es aus einer frischeren Hirnmasse besteht, wird in den Schädel zurückverpflanzt. Nach einer Gehirnverjüngungskur fühlt man sich besser, man kann klarer denken und sich deutlicher erinnern, wobei aber die Inhalte der Erinnerungen und Überzeugungen nicht verändert werden.) Die Gehirne der drei werden entnommen und auf das Gehirn-Wägelchen gelegt. Durch einen dummen Zufall schmeißt der Krankenpfleger das Wägelchen um; die Gehirne von Smith und Brown sind hinüber. Damit sein tragischer Mißgriff nicht entdeckt wird, läßt der Krankenpfleger Jones' Gehirn dreimal durch die sagenhafte Maschine laufen und bringt dann die Duplikate zurück in den Operationssaal. Zwei dieser Duplikate werden in die ehedem Brown und Smith gehörenden Schädel verpflanzt. Jones' altes Herz hat versagt, und nach einer Weile wird er für tot erklärt. Nach ein paar Stunden erwachen jedoch zwei Individuen, die beide behaupten Jones zu sein, die beide froh sind, endlich ihre Kopfschmerzen los zu sein, die aber etwas bestürzt sind über die drastischen Veränderungen, die sich offenbar an ihren Körpern vollzogen haben. Wir werden diese Personen 'Smith-Jones' und 'Brown-Jones' nennen. Die Frage lautet: Wer sind sie? (Perry, 1999, 121)
Fest steht für Perry, dass es sich um zwei verschiedene Personen handelt. Um diesen Schluss zu rechtfertigen, argumentiert er damit, dass zwischen Smith-Jones und Brown-Jones keine Einheit des Bewusstseins vorliege: "Was Smith-Jones sieht, denkt, wünscht usw. kann Brown-Jones nicht aufgrund von Introspektion feststellen und umgekehrt." (Perry, 1999, 122) Dennoch haben sie die gleichen Erinnerungen und behaupten beide, Jones zu sein. Dies führt zu folgendem Widerspruch:
(1) Smith-Jones ist nicht dieselbe Person wie Brown-Jones. [...]
(2) Smith-Jones ist dieselbe Person wie Jones;
(3) Brown-Jones ist dieselbe Person wie Jones.
Aufgrund der Symmetrie und der Transitivität der Identität erhalten wir aus (2) und (3) aber (4):
(4) Smith-Jones ist dieselbe Person wie Brown-Jones
(2) und (3) bringen uns somit zu (4), von dem man so sicher weiß, daß es falsch ist, wie man weiß, daß (1) wahr ist. (Perry, 1999, 123)
Perry versucht nun im weiteren, dieses Dilemma mit Hilfe einer logischen Analyse zu klären. Sein Ziel ist es, das Intrinsitätsprinzip der personalen Identität nicht preis zu geben (vgl. Quante, 1999, 26), und an den logischen Eigenschaften der Identitätsrelation fest zu halten. Dies sind: Transitivität, Reflexivität und Symmetrie. Er ist jedoch der Ansicht, dass nicht die Relation der strikten (numerischen) Identität die richtige Relation ist, um personale Identität zu charakterisieren, sondern die der (zeitlichen Einheit), welche jedoch die gleichen logischen Eigenschaften besitzt. Diese Erkenntnis löse jedoch noch nicht die Probleme der sich teilenden Ichs. Die bisherigen philosophischen Beiträge über Teilungsfälle von Personen kommen einhellig zu dem Schluss, dass die Transitivität der Identitätsrelation bei Personen aufgegeben werden muss. Perry ist im Bezug auf diese Fälle jedoch der Meinung, dass nicht die Transitivität der Identitätsrelation in Gefahr ist, sondern dass es falsch ist, dass Smith-Jones Jones ist, und dass es falsch ist, dass Brown-Jones Jones ist – denn es ist ja offensichtlich falsch, dass Smith-Jones und Brown-Jones Teile der gleichen Entität sind, womit ja gerade die Transitivität der Relation in Frage gestellt wurde. These (2) und (3) stimmen also nicht. Stattdessen sind sowohl Jones als auch Smith-Jones und Brown-Jones keine Personen, sondern Personenstadien. Personenstadien sind die zeitlichen Teile einer Person. Wenn wir uns mit Eigennamen auf Personen beziehen, beziehen wir uns in Wirklichkeit gar nicht auf Personen, sondern auf Personenstadien. 'Jones' war ein (zeitliches) Personenstadium sowohl von Smith-Jones, als auch von Brown-Jones. "Obgleich also meine Analyse jener Relation, die für Personenstadien gilt, wenn sie Stadien einer einzelnen Person sind, nicht logisch transitiv ist, muß ich deshalb doch nicht absurderweise die Transitivität der Identität leugnen" (Perry, 1999, 130).
Anschließend erläutert Perry die These, dass es sich bei unserer Sprache um eine 'Zweig-Sprache' handeln könnte. Mehrere Personenstadien bilden einen Personenzweig. Wenn wir von Personen sprechen, meinen wir in Wirklichkeit solche Zweige. Nach dieser Theorie "bilden alle vermeintlichen Personenstadien von Jones plus alle post-operativen Stadien von Smith-Jones einen Zweig, und alle vermeintlichen Personenstadien von Jones plus alle post-operativen Stadien von Brown-Jones bilden einen anderen Zweig. Die Menge, die alle Personenstadien beider Zweige enthält, ist selbst kein Zweig." (Perry, 1999, 131 f.). Das der Zweig-Sprache zugrundeliegende Modell lässt sich folgendermaßen skizzieren:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1
Zwischen Personen und Zweigen gibt es eine eineindeutige Relation, wir können also sagen, Personen sind Zweige. "Namen werden Personenstadien zugeordnet – etwa bei der Taufe. Der Name benennt die Person (den Zweig), von der dieses Personenstadium ein Element ist." (Perry, 1999, 132). Perry befindet die Zweig-Sprache jedoch nicht für sinnvoll, "denn ihr zufolge ist möglich, was nicht sein kann: daß nicht vollkommen eindeutig ist, daß wir vor der Operation, als wir mit Jones sprachen, mit einer Person sprachen" (Perry, 1999, 143 – Perrys Hervorhebung).
Im nächsten Schritt ist es Perrys Ziel zu zeigen, dass es nach der Operation unzulässig ist, den Namen 'Jones' in der Weise zu gebrauchen, wie wir in vor der Operation gebraucht haben. D.h. dass die Bezeichnung einer bestimmten Entität mit 'Jones' "vor der Operation zulässig, nach der Operation aber unzulässig war" (Perry, 1999, 133 – Perrys Hervorhebungen). Aufgrund dieses Befundes wären wir dann in der Lage, (2) und (3) verwerfen zu können, dafür aber (2') und (3') zu behaupten:
(2') Vor der Operation war Smith-Jones Jones;
(3') Vor der Operation war Brown-Jones Jones.
Mit (2') und (3') läßt sich die verständliche Frage beantworten. 'Welche vor der Operation existierenden Personen waren diese beiden Personen?' Sie waren beide die Person Jones. (2') und (3') führen dann nicht direkt zum unannehmbaren (4) [...] Sie führen lediglich zu:
(4') Vor der Operation war Smith-Jones dieselbe Person wie Brown-Jones. (Perry, 134)
Jedoch führen auch (2'), (3') und (1) zu einem Selbstwiderspruch, wie Perry im folgenden beweist (vgl. Perry, 1999, 134 ff.). Anschließend zeigt er die Züge auf, die man machen muss, um diesem Selbstwiderspruch zu entgehen; "bei diesen Zügen handelt es sich tatsächlich einfach um Folgerungen aus der Auffassung, daß 'Jones' das eine Mal zulässig, das andere Mal unzulässig sein kann." (Perry, 1999, 135). Der nun folgende Beweis verliert durch die Übersetzung vom Englischen ins Deutsche leider an Beweiskraft (vgl. auch Anm. des Übersetzers auf S. 136): diese beruht hier auf der Bedeutung von Zeitadverbien in Satzanfangspositionen. Dabei kommt das Englische dem Logiker syntaktisch in seinem Ansinnen entgegen, das Deutsche jedoch nicht. (Wenn ein Beweis allerdings lediglich auf der grammatikalischen Beschaffenheit einer Sprache beruht, und schon durch eine Übersetzung an Beweiskraft verliert, dann kann er meiner Meinung nach kein geeigneter Beweis sein.) Es gibt zwei Rollen, die Zeitadverbien spielen können: einmal können sie in der Anfangsposition eines Satzes stehen (in diesem Fall liegt die Betonung auf dem Zeitadverb, nicht auf dem Subjekt des Satzes) oder in anderen Positionen innerhalb des Satzes (in diesen Fällen liegt die Betonung auf dem Subjekt des Satzes, nicht auf dem Zeitadverb). Im Folgenden erörtert Perry also recht ausführlich, warum die Bezeichnung 'Jones' das eine Mal zulässig, das andere Mal unzulässig ist. Dies rührt seiner Meinung nach daher, dass sie "zu verschiedenen Zeiten und im Wirkungsbereich verschiedener Zeitadverbien [...] verschiedene Entitäten benennen können." (Perry, 1999, 136) "Es ist aber weder klar, warum man ein Zeitadverb braucht, um den Namen 'Jones' zu 'vervollständigen', noch wie das genau geht" (Perry, 1999, 137 – Perrys Hervorhebungen). Dies zu erörtern ist Perrys Vorhaben in den nächsten beiden Abschnitten, in denen er zwei Alternativen zu unserer Sprache skizziert, "die jeweils erklären, wie Zeitadverbien und Namen funktionieren, und [...] den fraglichen Sätzen Wahrheitsbedingungen zuordnen." (Perry, 1999, 137). Es handelt sich hierbei um die 'Personenstadien-' und die 'Lebenszeit-Sprache', wobei die von ihm präferierte Variante die Lebenszeit-Sprache ist.
Personen sind zeitlich ausgedehnte Objekte, die sich aus Personenstadien zusammensetzen, die durch die sog. 'Relation R ' miteinander in Beziehung stehen:
die Worte 'diese Person' bezeichnen aber nicht das Personenstadium, das zum betreffenden Zeitpunkt auftritt, sondern das größere Ganze, von dem es in gewissem Sinne ein Teil ist. [...] Jedesmal, wenn wir einen Personennamen verwenden, beziehen wir uns in Wirklichkeit auf ein bestimmtes Personenstadium. Personen sind einfach Personenstadien und nicht die 'vier-dimensionalen' Objekte, die sich daraus zusammensetzen. Wenn ich sage: 'Die Person, mit der du gestern abend getanzt hast, ist die Person, die auf dem Sofa sitzt', dann drückt das 'ist' keine Identität aus, sondern einfach die Relation R. Der Satz besagt, daß diese Relation zwischen zwei Personen besteht, nämlich dem-Mädchen-mit-dem-du-gestern-abend-getanzt-hast und dem-mädchen-das-auf-dem-Sofa-sitzt. Wenn wir das 'ist' verwenden, um Identität auszudrücken, dann ist das Mädchen, mit dem du gestern abend getanzt hast, nicht das Mädchen, das auf dem Sofa sitzt. In solchen Kontexten würden wir aber 'ist' nicht auf diese Weise verwenden, sondern einfach um R auszudrücken. In diesem Sinne ist das eine Mädchen das andere. (Perry, 1999, 138)
Wie funktioniert aber die Verwendung von Namen in der Personenstadientheorie, wenn diese nicht einzelne Gegenstände (Personen), sondern lediglich Personenstadien benennen und damit nicht eindeutig sind?
Der Name 'Hilda' ist systematisch mehrdeutig; er benennt zu verschiedenen Zeiten verschiedene Personen, daher ist er mehrdeutig, doch die Personen, die er benennt, tragen diesen Namen aufgrund der Tatsache, daß sie zu einer bestimmten Person (einem bestimmten Personenstadium), etwa Die-Hilda-getauft-wird, in Relation R stehen; und daher wird der Name in einer Weise systematisch und kohärent verwendet, die uns leicht zu der Annahme verleitet, daß er eine einzelne Entität benennt. [...] Der Name benennt zu allen Zeitpunkten, zu denen er geäußert wird, oder wenn er im Wirkungsbereich eines beliebigen Zeitadverbs steht, nur diejenigen Personenstadien, die zum Zeitpunkt der Äußerung oder zu der durch das Zeitadverb angegebenen Zeit auftreten und zum bezeichneten Stadium in R stehen. (Perry, 1999, 139)
Namen benennen hier also keine Zweige (wie in der Zweig-Sprache), sondern (die Menge aller) Personenstadien, die zum bezeichneten Stadium in R stehen. Daher ist (4) vor der Operation wahr, da das Personenstadium, das den Namen Smith-Jones trägt, das gleiche Personenstadium bezeichnet, das den Namen Brown-Jones trägt.[12] Nach der Operation sind Smith-Jones und Brown-Jones jedoch zwei verschiedene Personenstadien. Die Personenstadien-Sprache lässt sich folgendermaßen darstellen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2
Trotzdem ist es laut Perry ein schwerer Irrtum, anzunehmen, dass es sich beim Deutschen um eine Personenstadien-Sprache handelt und unser Begriff der Person in Wirklichkeit der Begriff eines Personenstadiums sei.
Die Personenstadien-Sprache bietet demnach keine Lösung des Teilungsproblems. Daher schlägt Perry die 'Lebenszeit-Sprache' vor, die eine Mischung aus Zweig- und Personenstadien-Sprache darstellt, und die Vorteile beider in sich vereinigt. Das Modell der Lebenszeit-Sprache sieht etwa folgendermaßen aus:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3
Die prä-operativen Stadien von Jones gehören hiernach also zu drei Lebenszeiten: zur Y-förmigen Struktur und zu jedem der Zweige.
Wie lautet nun die Antwort auf die berechtigte Frage: 'Wieviele Personen waren vor der Operation in Jones' Zimmer (Zimmer 100)?' Einerseits scheint die richtige Antwort 'Eine' zu lauten; denn es war nur eine einzige Person im Zimmer, nämlich Jones. Andererseits waren sowohl Smith-Jones wie auch Brown-Jones da; es sieht also so aus, als wäre 'Zwei' die richtige Antwort. Schließlich aber ist das Personenstadium in Zimmer 100 in drei Lebenszeiten enthalten (dem Smith-Jones-Zweig, dem Brown-Jones-Zweig und der Y-förmigen Struktur); es hat also den Anschein, als würde die Antwort 'Drei' lauten. (Perry, 1999, 147)
Die Antwort auf diese Frage hängt in der Lebenszeit-Sprache vom Zeitpunkt ab, zu dem sie gestellt wird. Wird die Frage "Wie viele Personen sind in Zimmer 100?" vor der Operation gestellt, lautet die korrekte Antwort "Eine" (ebenso bei der zu jedem beliebigen Zeitpunkt gestellten Frage: "Wie viele Personen waren vor der Operation in Zimmer 100?"). Gleiches gilt für nach der Operation: Wird die Frage "Wie viele Personen waren vor der Operation in Zimmer 100?" nach der Operation gestellt (oder lautet die Frage zu jedem beliebigen Zeitpunkt: "Nach der Operation waren wie viele Personen vor der Operation in Zimmer 100?"), dann lautet die richtige Antwort "Zwei". Es gibt aber in diesem Modell drei Lebenszeiten. Jedoch gibt es keinen Zeitpunkt, zu dem die richtige Antwort auf die Frage "Wie viele Personen waren vor der Operation in Zimmer 100?" "Drei" lautet. Daher lautet die richtige Frage zu dieser Antwort: "Zu jeder Zeit waren wie viele Personen vor der Operation in Zimmer 100?" (vgl. Perry, 1999, 148) Mit dieser Frage wird gewissermaßen eine 'überzeitliche' Perspektive eingenommen, d.h. es handelt sich um eine Frage, die unabhängig vom Zeitpunkt ist, zu dem sie gestellt wird.
"Daß es sich bei Personen um Lebenszeiten handelt (oder jedenfalls um Entitäten, die mit Lebenszeiten eineindeutig korreliert sind) erweist sich somit als ein überzeugender Vorschlag. Im Normalfall sind die Lebenszeiten einfach Zweige." (Perry, 1999, 149) Die Lebenszeitsprache ermöglicht es, die Transitivität der betroffenen Relation (die der Einheit) beizubehalten.
Die Lebenszeit-Sprache – oder genauer: die Theorie, daß Deutsch eine Lebenszeit-Sprache ist – entspricht also sowohl unseren sprachlichen wie auch unseren semantischen Intuitionen. Darüber hinaus hat sie etwas Natürliches. Wer ist Jones? Diejenige Person, die in Jones' Vergangenheit sämtliche Dinge getan hat, und die in seiner Zukunft sämtliche Dinge tun wird. Jones' Zukunft schließt sowohl die von Brown-Jones wie auch die von Smith-Jones ein, denn auf Jones trifft zu, daß er all die Dinge tun wird, die sie tun. (Perry, 1999, 149 ff.)
Perry hat untersucht, ob der Begriff der personalen Identität vor dem Hintergrund (der logischen Möglichkeit) von Teilungsfällen bestehen kann; seiner Meinung nach kann er das, allerdings in abgeschwächter Variante als Relation der Einheit (nicht der strikten Identität). Die Transitivität kann somit in der Lebenszeit-Sprache (ebenso wie in der Zweig-Sprache, nicht aber in der Personenstadien-Sprache) beibehalten werden. "Ob der Begriff selbst weiterbestehen könnte, würde oder sollte, wenn jene logische Möglichkeit in unserer Wirklichkeit zu etwas Alltäglichem würde, ist eine andere Frage." (Perry, 1999, 151)
2.3.2 Personale Identität als logisches und sprachphilosophisches Problem
John Perrys Beitrag stellt meiner Ansicht nach einen sehr anschaulichen Versuch dar, den Begriff der personalen Identität mittels Logik bzw. einer logischen Sprachanalyse zu erklären. Lassen sich Entitäten wie 'Identität' oder 'Person' jedoch überhaupt (sinnvoll) in logische Termini operationalisieren?[13] Oder handelt es sich möglicherweise um ein empirisches Problem und bei den Begriffen 'Person' und 'personale Identität' um empirische Begriffe?[14]
Intuitiv betrachtet erschien mir der Weg, den Perry zur Klärung des Begriffes der personalen Identität gegangen ist, etwas merkwürdig, denn er geht meiner Meinung nach nicht darauf ein, was wirklich elementar für diesen Begriff ist. Vielmehr erweckt er in mir den Eindruck, dass es bei der personalen Identität um etwas Statisches geht, da sie die Anforderungen der Transitivität und Eineindeutigkeit erfüllen muss, und da am Intrinsitätsprinzip des Begriffes festgehalten wird. Diesen Ansatz halte ich für falsch. Ich denke, dass die Identität einer Person etwas Dynamisches ist, das sich im Laufe der Zeit wandelt. Somit sind sowohl die strikte Identität als auch die Relation der Einheit, für die Perry argumentiert, m.E. die falschen Relationen, um diesen Sachverhalt adäquat zu beschreiben. Allerdings scheint mir der Begriff des Personenstadiums, den Perry anführt, dennoch relativ gut zur Darstellung des Problems der personalen Identität geeignet zu sein (auch wenn ich von ihm nur den Begriff übernehmen möchte und nicht die Theorie, die er mit diesem verbindet): Erstreckt sich das Leben einer Person linear auf einem Zeitstrahl, kann man jeden beliebigen Punkt heraus greifen, an dem ein neues Personenstadium (oder ein neuer Lebensabschnitt) der betreffenden Person anfängt. Insofern können These (1) und (4) stimmen ("Smith-Jones ist nicht dieselbe Person wie Brown-Jones." und "Smith-Jones ist dieselbe Person wie Brown-Jones."), obwohl es zuerst widersinnig erscheint: Smith-Jones und Brown-Jones waren vor der Operation dieselben, genauer gesagt gab es diese beiden Personen davor gar nicht. Sie waren nach der Operation nicht dieselben Personen, es wurden quasi zwei neue Personen 'geboren'. Diese haben beide die Erinnerungen von einer weiteren, dritten Person namens 'Jones', sind jedoch nicht mit dieser Person identisch. Diese Person, die Jones heißt, gibt es nicht mehr in der Form, in der es sie vor der Operation gab, man könnte sagen, sie ist – zumindest in der Form, in der sie vorher existierte, nämlich mit einem eigenen Körper – 'gestorben' (auch, wenn mir das etwas zu radikal formuliert zu sein scheint, dann würde ja jeder von uns zu jedem Zeitpunkt sterben und eine andere Person im jeweils nächsten Zeitpunkt neu geboren werden; besser formuliert wäre: Die Person Jones, wie sie vor der Operation existierte, hat aufgehört in der Weise zu existieren, wie sie vor der Operation existierte).
Ich möchte nun kurz ein Modell skizzieren, wie ich mir den Sachverhalt vorstelle: Eine Person konstituiert sich aus einer Kette von in der Zeit sukzessive aufeinander folgenden 'Dingen'. Diese Dinge können z.B. Erlebnisse der Person sein (aus der Binnenperspektive der Person würden wir dies wohl so nennen), neutral formuliert könnten wir von 'Ereignissen' sprechen. Dabei muss die Kette nicht einmal aus Ereignissen bestehen, ja nicht einmal aus Momenten (in einem diskreten Sinne) – da die Zeit stetig ist, ist auch die Erlebniskette stetig und nicht diskret und ein Erlebnis kann theoretisch in unendlich viele, atomisch kleine einzelne Erlebnisse 'zerlegt' werden, die sich auf dem Zeitstrahl nur einen Bruchteil lang erstrecken (das ist zwar theoretisch möglich, macht praktisch aber nicht viel Sinn). Das folgende Diagramm soll dies veranschaulichen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4
Zwischen den einzelnen Ereignissen gibt es Lücken; die Lücken könnten Phasen sein, in denen wir nicht bei Bewusstsein sind, z.B. im Schlaf oder während der Narkose. Man könnte nun in jeder Lücke ansetzen (sofern die Lücke der aktuelle Moment ist) und den Teil links vom 'Jetzt' vervielfältigen, da er schon geschehen ist. Die Vergangenheit einer Person als im Gehirn gespeicherte Informationen lässt sich dabei als Datenmaterial begreifen, das man beliebig vervielfältigen kann.
Das Bewusstsein (als Wachzustand verstanden, in dem die Person von sich selbst sagen würde, sie sei sich ihrer jetzt voll bewusst, d.h. sie steht nicht etwa unter Drogen o.ä.) bewegt sich auf dem Zeitstrahl linear in eine Richtung und ist immer nur auf einem Punkt; alles vor diesem Punkt (Erinnerung) kann also beliebig oft vervielfältigt und anderen Datenträgern (Körpern, Gehirnen, Maschinen) eingegeben werden. Das macht den Fall Smith-Brown-Jones besonders einfach erklärbar, da es hier einen Moment gibt, in dem alle drei Beteiligten nicht bei Bewusstsein sind – nämlich während der Narkose vor der OP. Damit ist personale Identität keine streng eineindeutige Relation, da es theoretisch mehrere Menschen mit den gleichen Erinnerungen geben kann, die trotzdem verschiedene Personen sind, weil jeder von ihnen ein eigenes Bewusstsein und einen eigenen Körper hat.
Interessanter ist die Frage, die sich ergibt, wenn man das 'Folterbeispiel' aus Williams Gedankenexperiment auf diesen Fall anwendet. Angenommen, ich bin in Jones' Position und weiß bereits über den Ausgang der Operation bescheid (vielleicht handelt es sich ja um ein geplantes Experiment, von dem man den drei Männern erzählt hat, und das man – möglicherweise auch gegen ihren Willen – mit ihnen durchführt): muss ich vor einer Folter Angst haben, die mindestens einem meiner beiden Nachfolger (Smith-Jones oder Brown-Jones) wiederfahren wird?
Eine Antwort auf die Frage wäre: Ja, natürlich muss ich Angst haben (das gebietet schon der gesunde Menschenverstand). Allein die Tatsache, dass ich rational weiß, dass ich die Person sein werde, in die ich mich da hineinversetze (nicht irgendeine andere Person), und die in der Zukunft Schmerzen haben wird – d.h. dass die betreffende Person meine Erinnerungen, meinen Charakter usw. hat – macht mir Angst. Auch die Überlegung, dass nur vielleicht ich es bin, reicht aus, um mir in diesem Fall Angst zu machen. Denn gerade die Angst vor Schmerzen ist so eine starke Emotion, dass ich im Zweifelsfall – also wenn ich es nicht mit Sicherheit ausschließen kann, dass es mein Bewusstsein sein wird, das bei Bewusstsein (im Sinne von 'wach') ist, während ich gefoltert werde – immer Angst haben werde![15]
Ich nehme jedoch den Standpunkt ein, dass diese Frage unbeantwortbar ist, da die Situation meine Vorstellungskraft sprengt. Hinzu kommt die Tatsache, dass ich mich selbst in meine zukünftigen Bewusstseinszustände nur annähernd hineinversetzen kann, und zwar auf Grundlage meiner vergangenen Erfahrungen; ich extrapoliere meine Erfahrung und meine Art und Weise, mit bestimmten Erlebnissen umzugehen, unkritisch in die Zukunft (unkritisch in dem Sinne, dass ich nicht alle möglichen Szenarien mit einbeziehe, sondern davon ausgehen, dass die äußeren Parameter, die bisher mein Leben bestimmten, weitestgehend gleich bleiben).
Ferner ist das Hineinversetzen in mich in einem zukünftigen Zustand vom Grundprinzip der gleiche mentale Vorgang, wie das Hineinversetzen in eine andere Person zu einem beliebigen Zeitpunkt (vgl. 2.2.2); einziger Unterschied ist das Wissen darum, dass in einem Fall ich es sein werde, im anderen Fall nicht. Angenommen, ich wäre Jones (vor der Operation), dann gleicht die Hoffnung, Brown-Jones und Smith-Jones werden u.U. nicht mein Ich-Bewusstsein haben, das ich jetzt habe, der Erwartung, dass das Ich-Bewusstsein, das ich morgen (oder irgendwann anders in der Zukunft) haben werde, nicht mein aktuelles Ich-Bewusstsein ist, denn dieses ist immer auf den aktuellen Moment beschränkt (auf diesem Gedanken beruht ja das gesamte skeptische Problem, auf das ich im nächsten Kapitel kurz eingehen werde). Der Gedanke "Ich bin dann vielleicht jemand anders, wenn ich Brown-Jones oder Smith-Jones bin!" gleicht vom Prinzip her dem Gedanken "Morgen bin ich jemand anders, als heute!"
Mein Bewusstsein kann nie auf zwei Punkten des Zeitstrahls gleichzeitig sein, genauso wenig wie das gleiche Bewusstsein zur gleichen Zeit in verschiedenen Körpern (verschiedenen Gehirnen), also an verschiedenen Stellen im Raum sein kann. Im letzteren Fall handelt es sich dann um zwei verschiedene Bewusstseine, auch, wenn die Erinnerungen usw., welche zu diesen beiden Bewusstseinen gehören, früher einmal zu einem Bewusstsein gehörten d.h. von einem Bewusstsein gemacht wurden.
Erneut stellt sich die Frage: Kann man in Anbetracht dieser Tatsachen dem Problem der diachronen Identität von Personen mit Logik und logischen Begriffen beikommen? Sollte man in den von Shoemaker und Perry diskutierten Teilungsfällen die Frage nicht eher aus ersten Person-Perspektive, der Innenperspektive stellen? Sie lautete dann: Wo wird mein Ich-Bewusstsein morgen, nach der Teilung sein? Ich kann nicht zwei Ich-Bewusstseine in verschiedenen Körpern haben, d.h. ich kann nicht in zwei Körpern und damit an zwei Stellen (räumlich) gleichzeitig bei Bewusstsein sein.[16] Nach der Operation werden beide meiner zukünftigen Ichs diese Zeilen lesen und sich damit identifizieren und sagen: "Ja, ich war es, die dies schrieb." Auch werden sie die gleichen Gedanken und Sorgen haben, wie ich in diesem Augenblick. Aber wird es mein Ich-Bewusstsein sein? Oder stirbt dies im Augenblick der Operation? Käme ich nach der Gehirnverjüngungskur wieder in meinen alten Körper zurück, wäre alles in Ordnung (weil vertraut) und ich würde wohl sagen: "Oh ja, das bin ich." Aber allein aufgrund der Tatsache, dass ich nun einen anderen Körper habe, an dessen Aussehen und Befindlichkeit ich mich erst noch gewöhnen muss, mache ich einen Entwicklungssprung in meiner Persönlichkeitsentwicklung[17] und bin nicht mehr die Person, die ich vor der Operation war (oder nicht mehr im gleichen Personenstadium). Gleiches würde jedoch auch für einen schweren Unfall gelten, oder wenn ich plötzlich eine Beinprothese bekäme – natürlich bin ich noch ich (ich habe die gleichen Erinnerungen wie vorher, und ich weiß, dass es mein Ich-Bewusstsein war, das die Erfahrungen gemacht hat, die jetzt meine Erinnerungen sind[18] ), aber ich bin dennoch eine andere Person, als ich vor der Prothese war (vielleicht bin ich jetzt verbitterter, ernster, entschlossener etc.). Insofern kann ich mich in ein solches, zukünftiges Ich-Bewusstsein (ich selbst mit einer körperlichen Behinderung) ebenso schlecht hineinversetzen, wie in eines, das in einem anderen Körper (oder auch einfach: in anderen Lebensumständen) steckt, denn ich kenne die Einwirkungen solch (zukünftiger) Ereignisse auf meinen Charakter, mein Wesen und damit mein Bewusstsein jetzt noch nicht – ich kann sie nur vermuten. Genauso verhält es sich auch bei dem Gedankenexperiment, in welchem sich die Erinnerung einer Person – und damit auch das Bewusstsein, so die implizit unterstellte Annahme – vervielfältigt und in verschiedene Körper eingesetzt wird.
Ich denke, dass es sich im Fall des sog. 'Verdopplungsproblems' also folgendermaßen verhält: Wird irgendein menschlicher Körper K zwei Mal geklont und jedem der beiden entstandenen Klone das duplizierte Gehirn einer Person A (genauer gesagt ein Gehirn mit allen Informationen aus dem Gehirn der Person A) eingesetzt[19], so sind diese beiden Körper K1 und K2 die gleiche Person, bevor sie das erste Mal nach der Operation (genauer gesagt nach dem Klonvorgang) wieder Bewusstsein (im Sinne von: Wachzustand) erlangen.[20] Sobald sie aber anfangen, zu handeln (und sei es nur, dass sie die Augen aufschlagen) sind es zwei verschiedene Personen, da sie zwei verschiedene Bewusstseine haben. Sie können gar nicht mit der Person vor der Operation identisch sein, da Identität bei Personen immer nur auf einen atomisch kleinen Moment beschränkt sein kann. Schon im nächsten Moment ist eine Person nicht mehr die gleiche, wie noch im Moment davor, d.h. die Relation der logischen Identität (die transitiv, symmetrisch und eineindeutig sein muss) ist im Zusammenhang mit Personen nicht die geeignete Relation, da es sich bei ihnen um empirische (und nicht etwas metaphysische) Gegenstände handelt. Es kann – außer theoretisch – gar keine diachrone Identität geben, da alle in der wirklichen Welt existierenden Gegenstände sich immerwährend verändern, auch wenn wir Menschen diese Veränderungen vielleicht nicht ohne weiteres wahrnehmen können. Perry bringt am Anfang seines Aufsatzes das Beispiel von Alf, der nicht weiß, was die Identität eines Tisches bedeutet. Alf soll daraufhin veranschaulicht werden, was diachrone Tisch-Identität ist, also was es heißt, dass ein Tisch über die Zeit hinweg derselbe Gegenstand bleibt.
Nehmen wir aber an, wir zeigen auf einen Tisch und fragen ihn: 'Ist dieser Tisch da braun?' Er antwortet: 'Ja.' Wir schieben den Tisch in ein anderes Zimmer, streichen ihn grün und fragen: 'Ist dieser Tisch da grün?'. In beiden Fällen gibt er die richtige Antwort. Wir fragen ihn dann: 'Gibt es einen Tisch, der braun war und jetzt grün ist?'. Alf zuckt mit den Schultern; er kann darauf nicht antworten. [...] Wieder weiß er, in welcher Relation der Tisch, der braun war, zu dem Tisch, der grün ist, stehen muß, wenn die richtige Antwort auf die Frage 'Ja' sein soll. Die Relation ist natürlich die der Identität. (Perry, 1999, 126 – Perrys Hervorhebung)
[...]
[1] Die nun folgende Darstellung der Debatte ist eng an jene angelehnt, die Michael Quante in der Einleitung des von ihm herausgegeben Sammelbandes zur personalen Identität gibt. Siehe auch: Quante, 1999, 9 – 24.
[2] Eineindeutigkeit ist eine Beziehung, die umkehrbar eindeutig ist, indem A sich nur auf B bezieht und B sich nur auf A. "Mein Auto hat die Fahrgestellnummer 876127816523kx" ist eineindeutig, denn das Auto mit der Fahrgestellnummer 876127816523kx ist meins. Einmehrdeutig wäre folgende Aussage: "Mein Auto ist blau." Diese Aussage ist nicht eineindeutig, weil man zwar von meinem Auto auf die Farbe blau schließen kann, aber nicht umgekehrt von der (blauen) Farbe eines Autos darauf, dass dieses Auto mir gehört.
[3] Inwiefern ich die hier von Williams angedeutete Vorgehensweise der Begriffsbestimmung der personalen Identität nach logischen Kriterien für angebracht halte oder nicht, werde ich in den kommenden Abschnitten noch eingehender erläutern.
[4] Man nimmt dabei an, dass die mentalen Zustände einer Person ihre materielle bzw. physikalische Basis im Gehirn derselben haben und damit kausal aus letzterem erwachsen. Das Mentale superveniert auf dem Physikalischen, es entsteht als emergentes Produkt aus ihm (vgl. 3.4).
[5] Ganz zu schweigen von der Frage, wie es sich mit 'praktischem Wissen' verhält. Wenn ich ein guter Schuster bin und die zum Schusterhandwerk gehörigen Körperbewegungen wie im Schlafe verinnerlicht habe – kann ich diese Fähigkeiten dann auch mitnehmen, wenn ich mich entscheide, in einen komplett anderen Körper zu 'wandern'? Und was, wenn der Körper nicht die entsprechenden physischen Voraussetzungen mitbringt? Ich bin z.B. Artist und schlüpfe in einen 150 kg schweren Körper. Kann ich die Artistik, die konstitutives Merkmal meiner Identität ist, dann noch ausüben? Nimmt man auch dieses praktische Wissen als unabdingbaren Bestandteil der Identität einer Person an, dann hat sich die Frage schon beantwortet, ob die Erinnerungen allein konstitutiv für personale Identität sein können.
[6] Dies wiederum legt den Schluss nahe, dass mein Ich-Bewusstsein offenbar stärker an meinen Körper als an meine Erinnerungen gekoppelt ist.
[7] Williams benutzt an anderer Stelle (Williams, 1978e) das Wort 'verstehen' statt 'vorstellen': "Vielleicht kann man es [...] erklären, warum man sich zwar gewiß vorstellen kann, Napoleon zu sein [...], aber dennoch nicht versteht und auch unmöglich verstehen kann, was es bedeutet, selbst Napoleon zu sein" (Williams, 1978e, 77); ich halte das für Wortklauberei. Ich jedenfalls meine das gleiche wie er (dass wir uns lediglich vorstellen können, die Rolle Napoleons zu spielen, nicht aber, er zu sein; vgl. ebd.). Allerdings schließt Williams daraus, "daß die Vorstellungskraft zumindest im Hinblick auf das Selbst eine zu heikle Sache ist, als daß sie ein verläßlicher Weg zum Verständnis des logisch Möglichen sein könnte." (ebd.). Ich hingegen stehe in dieser Frage eher auf dem Standpunkt, dass das logisch Mögliche praktisch eben nicht möglich ist (ich werde nie Napoleon sein) und eine Diskussion darüber sowieso irrerelevant ist – erst recht, wenn sie dazu noch unsere Vorstellungskraft auf diese Weise sprengt.
[8] Dieser Begriff stammt von mir. Ich meine damit – in Abgrenzung zum Erinnerungskriterium – nicht nur Erinnerungsinformationen, sondern auch Informationen über Charakter, Geschmack u.ä.; dieser Ansicht liegt die Prämisse zugrunde, dass alle unsere im Gehirn gespeicherten Dinge über uns selbst, unser Leben und unsere Eigenarten sich in binäre Informationen übertragen und somit beliebig vervielfältigen lassen.
[9] Weiter hinten spielt Williams durch, welche Haltung ich der zukünftigen, furchterregenden Situation gegenüber einnehmen soll – ob ich "projektiv oder nichtprojektiv" (Williams, 1978b, 100) über sie nachdenken soll. "Die Frage, wie sich in meinen Erwartungen eine Situation spiegeln kann, in der es begrifflich unentscheidbar ist, ob ich in ihr vorkomme, hält uns anscheinend hartnäckig zum Narren." (Williams, 1978b, 101 – meine Hervorhebung) Vielleicht zeigt jedoch genau diese Paradoxie, dass eine solche Frage nicht begrifflich zu lösen ist, da das ihr zugrundeliegende Szenario unsere Vorstellungskraft sprengt.
[10] Williams unterstellt damit, dass der 'Geist' lediglich aus Informationen besteht, die sich physikalisch abspeichern und wiedergeben lassen. Ist diese Vorstellung angemessen? Vgl. hierzu Kapitel 3.
[11] "Die scheinbar endgültigen Argumente der ersten Darstellung, die darauf hindeuteten, A solle sich mit der B-Körper-Person identifizieren, hingen davon ab, mit welcher außerordentlichen Klarheit diese – wenn überhaupt eine – Situation der Beschreibung 'Körpertausch' gerecht wurde. Doch diese Klarheit ist im Grunde künstlich." (Williams, 1978b, 103; vgl. auch 78 ff. und 81)
[12] "Wenn wir uns für eine zeitlose Perspektive entscheiden, müssen wir in die von uns zugeschriebene Eigenschaft Zeitangaben einfließen lassen." (Perry, 1999, 142)
[13] Man muss hier zweierlei unterscheiden: Einerseits die Darstellung von bestimmten Entitäten in der logischen Formelsprache, was zur Vereinfachung der Darstellung von Sachverhalten dient, und andererseits die Verselbstständigung dieser Formelsprache, die zur Folge haben kann, dass sich ein ursprünglich empirischer Begriff immer weiter von der Realität, d.h. der Empirie entfernt und nur noch innerhalb dieses logischen Begriffsapparates (der ursprünglich zur Vereinfachung der Darstellung eingeführt wurde) untersucht wird. Innerhalb dieses Begriffsapparates bzw. Systems ergeben sich dann möglicherweise Widersprüche, die sich in der Praxis nie ergeben würden.
[14] Dies entspräche dann einer Analyse der personalen Identität im Sinne von 1 und 2a (vgl. Einleitung).
[15] Das gesteht auch Williams zu; er spricht von der egoistischen Sorge, "die nun einmal im Gefühl der Furcht enthalten ist" (Williams,1978b, 97) und ist ebenfalls der Ansicht, dass selbst in dem Fall, in dem ich begrifflich nicht klar entscheiden kann, ob ich in einer bestimmten (mit Schmerzen verbundenen) Situation sein werde oder jemand anders, ich mich im Zweifelsfall immer fürchten werde. "Augenblicke der unmittelbaren Furcht sind darauf gerichtet, daß wirklich ich es sein werde" (ebd.). Christine M. Korsgaard, auf deren Beitrag ich in 2.5 zu sprechen kommen werde, ist dagegen der Ansicht, dass Williams' Beispiel nicht zeigt, wie sehr wir uns mit unserem Körper identifizieren, sondern "wie sehr wir uns mit dem Tier identifizieren, das wir (auch) sind. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, daß jeder von uns sowohl eine Tier-Identität wie auch unsere spezifisch menschliche Identität besitzt, und daß einige der bedeutendsten Probleme personaler Integration darin ihren Grund haben. [...] Die Schmerzbeispiele zeigen uns, wie sehr wir durch unsere Tier-Identität in unserer menschlichen Identität verletzt werden können." (Korsgaard, 1999, 222 f., Fußnote 36)
[16] Gegen diesen Sachverhalt werde ich in 2.4.2 noch ausführlicher argumentieren.
[17] Ich denke, man könnte in so einem Fall beinahe von so etwas wie einem 'traumatischen Erlebnis' sprechen (vgl. auch 2.5.2)
[18] Sidney Shoemaker führt in seinem Aufsatz "Personen und ihre Vergangenheit" den Begriff der 'Quasi-Erinnerung' ein. Eine Quasi-Erinnerung gleicht in jeglicher Hinsicht eigenen Erinnerungen an frühere sensorisch-kognitive Zustände, bis auf den Fakt, dass sie von einer anderen Person als von mir gemacht wurden. Daher können selbst Erinnerungen in der ersten Person dem Irrtum der Fehlidentifikation unterliegen. Quasi-Erinnerung an eine Handlungssequenz oder Handlungskette (x ist gefolgt von y) bietet keine Gewähr dafür, dass x und y von der gleichen Person ausgeführt wurden. Denn da ein Ereignis im Grunde auch als eine zeitliche Aneinanderreihung von mehreren (Klein-)Ereignissen (oder Ereignissequenzen) begriffen werden kann, bietet dies ebenfalls keine Garantie dafür, dass diese in zeitlicher oder räumlicher Nähe zueinander eintraten, da es logisch nicht ausgeschlossen ist, dass sich auch an räumlich und zeitlich anderer Stelle im Universum so etwas ereignen kann. Quasi-Erinnerungen können aus verschiedenen kausal nicht miteinander verbundenen und raum-zeitlich voneinander entfernten Elementen zusammengesetzt sein (vgl. das Beispiel von Shoemaker in Shoemaker, 1999, 49).
[19] Nach diesem Vorgang gibt es drei Personen: Die Originalperson O, sowie die Klone K1 und K2, die beide das gleiche Gehirn wir Person A haben (Person A selbst existiert nicht mehr). Mich interessieren in diesem Fall nur die beiden Klone, da im Falle nur eines Klons und des Originals diese beiden keinen Gleichstand im Bezug auf die Direktheit der Nachfolge hätten (vgl. Robert Nozicks Beitrag "Personale Identität in der Zeit", dem ich mich im nächsten Abschnitt widme).
[20] Jeder andere Fall (also eine Duplizierung meines Gehirns bei vollem Bewusstsein) übersteigt unsere Vorstellungskraft und es kann daher nichts über ihn ausgesagt werden, so lange solche Fälle in Wirklichkeit nicht möglich sind.
- Arbeit zitieren
- M.A. Claudia Hoppe (Autor:in), 2004, Personale Identität - Vom Gedankenexperiment zur naturalistischen Sichtweise, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112805
Kostenlos Autor werden




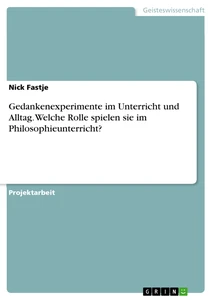
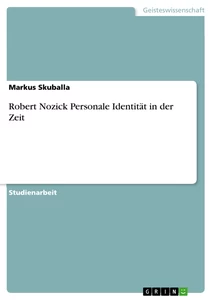
















Kommentare