Leseprobe
Inhalt
Einleitung
I. Emotionen
1.1 Paradigmata der Emotionsforschung
1.2 Emotions- und Handlungsregulation
1.3 Die emotionale Entwicklung
1.3.1 Im Säuglings- und Kleinkindalter
1.3.2 Im Kleinkind- und Vorschulalter
1.3.3 Im Schulalter
1.3.4 Im Jugendalter
1.4 Interindividuelle Unterschiede in der Emotions- und Handlungsregulation
II. Die Bindungstheorie
2.1 Die Entstehung der Bindungstheorie
2.1.1 John Bowlby
2.1.2 Bindungstheorie und Psychoanalyse
2.1.3 Ethologische Einflüsse
2.2 Die Bindungstheorie
2.2.1 Bindungs- und Explorationsverhalten
2.2.2 Unterschiedliche Bindungsmuster in der „Fremden Situation“
2.2.3 Das Konzept der „inneren Arbeitsmodelle“
2.2.4 Ursachen für die Ausbildung unterschiedlicher Bindungsqualitäten
III. Bindungstheorie und Emotionsentwicklung
3.1 Innere Arbeitsmodelle und emotionale Entwicklung
3.2 Bindungsspezifische Emotionsentwicklung
3.2.1 Sicher gebundene Kinder und Jugendliche
3.2.2 Unsicher-ambivalent gebundene Kinder und Jugendliche
3.2.3 Unsicher-vermeidend gebundene Kinder und Jugendliche
IV. Implikationen für die psychologische Praxis
V. Fazit
Literaturverzeichnis
Einleitung
Im Verlauf der menschlichen Ontogenese erwirbt der zunächst noch unreife Säugling zahlreiche Fähigkeiten, Strategien und Verhaltensweisen, welche ihm eine gelungene Interaktion mit der Umwelt erleichtern und nicht zuletzt sein Überleben sichern. Viele dieser Entwicklungsschritte sind genetisch vorgege-ben, andere werden, vollständig oder auch nur teilweise, durch die Interaktion mit anderen Menschen in dyadischen oder Gruppenstrukturen erworben. Eine zentrale Entwicklungsaufgabe, die sich dem jungen Menschen stellt, ist der Aufbau eines funktionalen Emotionssystems. Im Zuge der emotionalen Ent-wicklung lernt der Mensch, seine Emotionen auszudrücken und sie zu benen-nen, er erwirbt die Fähigkeit zur Emotions- und Handlungsregulation und baut mit zunehmendem Alter ein immer komplexeres Emotionswissen auf. Jedoch gelingt nicht allen Menschen die Erfüllung dieser Entwicklungsaufgabe im gleichen Maße. Während einige Menschen emotionsgenerierende Situationen realistisch bewerten und ihre Emotionen dazu nutzen können, die gegebenen Umstände durch gezielte Handlungen ihren Zielen und Motivationen dienlich zu beeinflussen, sind andere zu einer solch objektiven Situationsanalyse und situationsspezifischen, flexiblen Handlungen nicht in der Lage. Zudem sind nicht alle Menschen in gleicher Weise zu der effektiven Regulation ihrer Emo-tionen fähig. Ebenso treten Unterschiede in der Qualität und Organisation des deklarativen Emotionswissens auf.
Es stellt sich daher die Frage, welche Ursachen diesen interindividuell ver-schiedenen Entwicklungsverläufen und -ausgängen zugrunde liegen. Basis für eine Erklärung dieser Unterschiede kann selbstverständlich nur eine Theorie der ontogenetischen Emotionsentwicklung sein. Die Bindungstheorie, welche auf die Erforschung der engen Bindungsbeziehung zwischen Kind und Bezugs-person, sowie deren Folgen im Verlauf der Ontogenese fokussiert, bietet einen interessanten Ansatz zur Erklärung solcher interindividuellen Unterschiede in der Emotionsentwicklung. Im Rahmen der Bindungsforschung konnten ver-schiedene Interaktionsmuster von Mutter-Kind Dyaden identifiziert werden, welche sich mit bestimmten Tendenzen in der emotionalen Entwicklung in Verbindung bringen lassen.
In dieser Arbeit soll der bindungstheoretische Erklärungsansatz zur Entstehung interindividueller Unterschiede in der Emotionsentwicklung dargestellt wer-den. Dabei wird von Kindern ausgegangen, die nicht aufgrund von Entwick-lungsstörungen oder psychisch kranken Eltern erhöhten Entwicklungsrisiken ausgesetzt sind. Im ersten Teil wird zunächst ein kurzer Einblick in das Kon-zept der Emotion selbst und verschiedene Paradigma der Emotionsforschung gegeben, wobei auch auf die Bedeutung der Emotion in der menschlichen Verhaltensorganisation eingegangen wird. Anschließend soll anhand eines bindungstheoretisch orientierten Entwicklungsmodells die Emotionsentwick-lung vom Säuglings- bis zum Erwachsenenalter aufgezeigt werden, bevor kurz auf interindividuelle Unterschiede in dieser Entwicklung eingegangen wird. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Bindungstheorie. Es wird ein Überblick über die zentralen Annahmen der Theorie vor dem Hintergrund ihrer Entstehung gegeben, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem Kon-zept der „inneren Arbeitsmodelle“ liegt. Im dritten Teil soll zunächst gezeigt werden, auf welche Weise die verschiedenen, von der Bindungstheorie klassifi-zierten Bindungsmuster mit interindividuellen Unterschieden in der Emotions- und Handlungsregulation in Verbindung stehen. Abschließend sollen mögliche Pfade emotionaler und sozialer Entwicklung für Personen mit unterschiedlich-en Bindungsmustern dargestellt werden, bevor auf mögliche Interventions-maßnahmen zur Verbesserung der emotionalen Entwicklung hingewiesen wird.
I. Emotionen
Bislang konnte unter Emotionsforschern noch kein Konsens über eine genaue Definition des Begriffs „Emotion“ erlangt werden. Dies liegt vor allem in der Verschiedenartigkeit der Emotionstheorien und der Komplexität der Thematik begründet. Es gibt einige zum Teil stark divergierende Ansätze in der Emo-tionsforschung, die sich jedoch hauptsächlich in der Wahl des Forschungs-fokusses unterscheiden (Traue & Kessler, 2003, S. 24). Zunehmend werden aber auch solche Emotionstheorien entwickelt, die versuchen, möglichst viele wissenschaftliche Ansätze und Emotionsaspekte zu integrieren.[1] Nach Traue und Kessler besteht jedoch eine Übereinstimmung der Wissenschaftler darin, dass Emotionen „subjektive Erlebnisse“ sind, „die in bestimmten Situationen von verschiedenen Personen in ähnlicher Weise empfunden werden“ (Traue & Kessler, 2003, S. 22).
1.1 Paradigmata der Emotionsforschung
Im Lauf der Emotionsforschung entstanden drei wesentliche Forschungs-paradigma, auf welche im Folgenden kurz eingegangen werden soll. Das „strukturalistische Emotionsparadigma“ fokussiert auf die Form und Struktur der Emotionen. Im Mittelpunkt stand lange Zeit die Identifikation verschie-dener Komponenten, welche die Emotion definieren und von anderen psy-chischen Phänomenen abgrenzen können und deren spezifische Ausprägungen zudem die exakte Identifikation der verschiedenen Emotionsqualitäten möglich machen sollte.[2] Bislang konnten jedoch keine solchen Komponentenkonfigura-tionen nachgewiesen werden, welche die Definition bestimmter Emotionen zweifelsfrei ermöglichen. Dennoch ist eine derartige Unterteilung der Emotion in verschiedene, wenn auch sehr eng miteinander verknüpfte, Aspekte weiter-hin sinnvoll, um dem komplexen Forschungsgegenstand eine gewisse Struktur zu geben und bestimmte Teilbereiche der Emotionen genauer untersuchen zu können.
In den 80er Jahren fand in der Emotionsforschung ein Paradigmenwechsel zugunsten einer funktionalistischen Sichtweise statt. Dieses Forschungs-paradigma betont besonders den dynamischen Aspekt der Emotion, welcher zuvor oft vernachlässigt wurde. Aufgabe der Emotion ist die Überwachung und Sicherstellung der Befriedigung individueller Motive und Ziele. Die Emotion ist dementsprechend als eine Modifikation der Handlungsbereitschaft definiert, die auf eine Änderung der Mensch-Umwelt-Beziehung ausgerichtet ist (Friedlmeier & Holodynski, 1999a, S. 8). Diese Handlungsregulation ist durch die Bewertung der Situation, die emotionalen Handlungsbereitschaften und die dadurch ausgelösten Bewältigungshandlungen charakterisiert. Eine onto-genetische Funktionsentwicklung ist möglich, wenn das Kind neue Emotions-formen realisiert oder bei anderen Menschen wahrnimmt. Da sich diese Er-fahrungen von Kind zu Kind unterscheiden, entwickeln sich interindividuelle Unterschiede in den Emotionsformen und –funktionen (Friedlmeier & Holodynski, 1999a, S. 9ff; Papoušek & Papoušek, 1999, S. 144).
Das dritte „kontextualistische Paradigma“ beschäftigt sich mit der Emotions-entwicklung. Diesem Ansatz zufolge entstehen Emotionen im Verlauf des Erziehungs- und Sozialisationsprozess in der Interaktion zwischen Kind und Sozialisationspartner. Die Emotion wird somit als „kokonstruierte psychische Entität“ verstanden. Ein besonderer Fokus dieses Paradigmas ist die Ent-wicklung kulturspezifischer Emotionsmuster. Interindividuelle Unterschiede in der Emotionsentwicklung sind diesem Paradigma entsprechend auf individuelle und soziokulturelle Unterschiede in der Interaktion zwischen Kind und Bezugsperson zurückzuführen (Friedlmeier & Holodynski, 1999a, S. 16ff).
Die drei genannten Paradigmata fokussieren jeweils nur auf einen Teilaspekt der Emotion. Ein umfassender Ansatz zur Emotionsforschung sollte, neben einer Definition der Emotion, sowohl ihre Funktion in der menschlichen Verhaltensorganisation, als auch eine Theorie ihrer Entstehung berück-sichtigen.
1.2 Emotions- und Handlungsregulation
Emotionen dienen, dem funktionalistischen Paradigma entsprechend, dazu, die eigenen Handlungen oder diejenigen einer anderen Person motivorientiert zu regulieren: Sie initiieren, verändern und unterbrechen menschliches Verhalten (Traue & Kessler, 2003, S.31). Emotionen fungieren zudem als interindividuel-les und intraindividuelles Signalsystem. Sie appellieren über das Emotionserle-ben an die Person selbst und durch den Emotionsausdruck an andere, bestimm-te motivdienliche Handlungen bzw. Bewältigungshandlungen zur Zieler-reichung auszuführen (Holodynski, 1999, S. 35, S 38). Lazarus und Folkman (1984) unterscheiden zwischen zwei Formen der Bewältigungshandlung. Als „problembezogenes Coping“ kann sie darauf ausgerichtet sein, den Kontext, in dem die Emotion entsteht, zu verändern. Als „emotionsbezogenes Coping“ kann sie aber auch direkt auf die eigene Emotion abzielen, indem diese durch eine Veränderung der Bewertungsprozesse beeinflusst wird. Emotionen regulieren also nicht nur die Handlungen des Individuums, sondern können ebenfalls durch Handlungen reguliert werden (Friedlmeier & Holodynski, 1999a, S. 13f). Dieser interdependente Prozess wird oft unter der Bezeichnung Emotionsregulation zusammengefasst. Da beide Regulationsarten in engem Zusammenhang stehen, jedoch nicht immer identisch sind, wird im Folgenden für das problembezogene Coping der Begriff „Handlungsregulation“ und für das emotionsbezogene Coping der Begriff „Emotionsregulation“ verwendet (Friedlmeier & Trommsdorff, 2001, S. 205).
Die Handlungsregulation besteht aus der Bewertung der aktuell gegebenen Situation, dem ausgelösten Emotionszustand und den dadurch initiierten Be-wältigungshandlungen. „Die auf das Individuum einströmenden Umweltreize in Form von Ereignissen, Personen, Gegenständen und ihre wahrgenommenen Konsequenzen werden fortlaufend daraufhin bewertet, inwiefern sie für die Befriedigung der Motive förderlich oder abträglich sind.“ (Friedlmeier & Holodynski, 1999a, S. 9) Diese Einschätzung kann sowohl bewusst, als auch unbewusst erfolgen. Das Ergebnis des Bewertungsprozesses bestimmt die Qualität der resultierenden Emotion. Diese Emotion, bestehend aus Ausdrucks-, Erlebens- und physiologischer Komponente, wird daraufhin aktiviert. Eine wenig bedeutsame Situation oder ein Problem, für welches bereits ein gut funktionierendes Bewältigungsschema existiert, wird dabei weniger intensive Emotionen auslösen als eine unbekannte Situation. In einem gegebenen Kontext können individuell verschiedene Emotionen entstehen, je nachdem auf welche Weise ein Individuum eine Situation im Hinblick auf ihre eigenen Ziele und Motive, sowie ihre eigene Handlungswirksamkeit subjektiv bewertet. Abhängig von der empfundenen Emotion werden solche Bewälti-gungshandlungen ausgewählt, die dem Individuum als motivdienlich erschei-nen. Anschließend kann der Regulationsprozess im Rahmen der zielkorrigier-ten Selbststeuerung evaluiert werden. Dabei werden Ursache und Qualität des erlebten Gefühls, sowie die Effektivität und Angemessenheit der Verhaltens-reaktion überprüft und im Hinblick auf die Wirksamkeit bezüglich der Ziel-erreichung bewertet (Holodynski, 1999, S. 30; Zimmermann, 2002b, S. 157).
Die Emotionsregulation setzt bei den Antezendenzen einer Emotion, den Be-wertungen und den emotionalen Reaktionen an. So können Situationen, welche spezifische Emotionen wahrscheinlich machen, gesucht, gemieden oder gene-riert werden, sowie die Aufmerksamkeit gezielt auf bestimmte Emotionen, oder eben von ihnen weg, gelenkt werden. Ebenso können emotionsgenerieren-de Situationen verschieden gedeutet oder umgedeutet werden und unterschied-liche emotionale Reaktionen gezeigt werden (von Salisch & Kunzmann, 2005, S. 2f). Diese Handlungsoptionen ermöglichen dem Menschen, aktiv mit den eigenen Emotionen umzugehen und Einfluss auf sie zu nehmen.
Welche der beiden Regulationsstrategien in einer Situation angemessener ist, hängt von der Kontrollierbarkeit der Umstände ab. Je geringer die Möglichkeit ist, die Situation durch eigene Handlungen zu beeinflussen, desto sinnvoller sind emotionsbezogene Strategien (Friedlmeier, 1999, S. 211). Neben der Un-terscheidung in Emotions- und Handlungsregulation bestehen, abhängig von der ausführenden Person, weiterhin zwei verschiedene Regulationsarten. Regu-liert die Person ihre Emotionen und Handlungen selbst, spricht man von intra-psychischer oder innerpersonaler Regulation, geschieht dies mit Hilfe einer anderen Person, z.B. durch Eltern, Freunde oder Partner, wird von interpsy-chischer oder interpersonaler Regulation gesprochen (Holodynski, 2002, S. 235).
Obwohl bereits Neugeborene bestimmte Regulationsfähigkeiten besitzen, müssen die meisten Strategien der Emotions- und Handlungsregulation im Zuge der emotionalen Entwicklung, welche im folgenden Abschnitt dargestellt werden soll, erlernt werden. Im Verlauf dieser Entwicklung entstehen in Ver-bindung mit den kindlichen Prädispositionen interindividuelle Regulations-unterschiede in der Situationsbewertung, dem erworbenen Emotionsrepertoire und den bevorzugten Bewältigungshandlungen.
1.3 Die emotionale Entwicklung
Emotionsforscher haben in den vergangenen Jahrzehnten verschiedenste Theorien zur emotionalen Entwicklung im Verlauf der Ontogenese entwickelt, welche sich zum Teil beträchtlich in den angenommenen Einflüssen von genetischen Anlagen und Umwelteinflüssen unterscheiden. Manfred Holodynski schlägt ein „Internalisierungsmodell der Emotionsentwicklung“[3] vor, welches die drei genannten Forschungsparadigma verbindet und sowohl Aspekte intrapsychischer als auch interpsychischer Emotionstheorien berück-sichtigt. Somit verbindet diese Theorie viele grundlegende Annahmen der Emotionsforschung und schließt biologische wie auch soziale bzw. kulturelle Aspekte mit ein. Dieser Ansatz wurde auch deshalb gewählt, weil er einige Basisannahmen, besonders bezüglich der ontogenetischen Bedeutung früher Interaktionen zwischen Säugling und primärer Bezugsperson, mit der Bin-dungstheorie teilt.
Dem Internalisierungsmodell entsprechend findet im Laufe der Ontogenese eine Internalisierung dyadischer Kommunikation statt: eine Entwicklung von der dyadischen interpsychischen Emotionsregulation zur autonomen intra-psychischen Emotionsregulation. Manfred Holodynski unterscheidet fünf Phasen der ontogenetischen Entwicklung, wobei jede dieser Phasen durch spezifische Entwicklungsaufgaben charakterisiert wird (Holodynski, 2002, S. 233). Da der Fokus dieser Arbeit auf der frühen dyadischen Kommunikation und der daraus resultierenden Entwicklung im Kindes- und Jugendalter liegt und auch Holodynski in seinem Modell bislang noch stark auf die Emotions-entwicklung in der Kindheit fokussiert, werden im Folgenden besonders die ersten vier Phasen der ontogenetischen Emotionsentwicklung beschrieben. Die emotionale Entwicklung vollzieht sich selbstverständlich nicht isoliert, sondern steht mit der kognitiven und sozialen Entwicklung in Verbindung und sollte somit als Teil der Entwicklung einer umfassenden Verhaltensorganisation ver-standen werden (Friedlmeier, 1999, S. 205).
1.3.1 Im Säuglings- und Kleinkindalter
Kernthese des Internalisierungsmodells ist, dass „den emotionalen Ausdrucks-zeichen in den Interaktionen zwischen Bezugspersonen und Kind [bei der menschlichen Emotionsentwicklung] eine herausgehobene Vermittlungsfunk-tion“ zukommt: sie ermöglichen der Mutter-Kind Dyade ihre Emotionen zu kommunizieren (Holodynski, 2002, S. 233). Unter dem Begriff „Ausdruck“ versteht Holodynski Mimik, Körperduktus, Gestik, den vokalen Klang der Stimme, das Blickverhalten, das Berühren und das Verhalten im Raum (Holodynski, 2002, S. 237). Dabei geht Holodynski nach Sroufe (1996) und dem soziokulturellen Paradigma entsprechend davon aus, dass die Fähigkeit zur Interpretation emotionaler Ausdruckszeichen nicht angeboren ist, sondern ihnen im Kommunikationsprozess eine kulturell geprägte Bedeutung zuge-wiesen wird, so dass kulturspezifische Emotionen erlernt werden (Holodynski, 2002, S. 233). Sroufe (1996) zufolge besitzen Neugeborene noch keine genuinen Emotionen, sondern vielmehr „Vorläuferemotionen“, welche als biologischer Ausgangspunkt für die Emotionsentwicklung dienen (Holodynski, 1999, S. 34).[4] Diese Vorläuferemotionen zeichnen sich im Gegensatz zu echten Emotionen zum einen dadurch aus, dass sie durch physikalische Reizschwellen und nicht durch eine erworbene Situationseinschätzung ausgelöst werden und zum anderen dadurch, dass die Ausdrucks- und Körperreaktionen zum Teil reflexhaft und nicht auf die Situation abgestimmt gezeigt werden (Holodynski, 2002, S. 238). Holodynski geht von fünf Vorläuferemotionen aus: „Distress“, „Ekel“ und „Erschrecken“, welche Mangelzustände bzw. Beeinträchtigungen der körperlichen Unversehrtheit signalisieren, sowie „Interesse“ und „endogen bewirktes Wohlbehagen“, welche dem Aufbau von Repräsentationen der Umwelt dienen (Holodynski, 2002, S. 238).
Säuglinge verfügen lediglich über sehr begrenzte Mittel, ihre Vorläufer-emotionen selbst zu regulieren. So können sie sich durch Saugen beruhigen oder den Blick von einer überstimulierenden Reizquelle abwenden. Diese Strategien sind jedoch nur bis zu einem gewissen Erregungsniveau funktional. Sie sind somit auf die Regulation ihrer Emotionen durch eine andere Person angewiesen (Holodynski, 1999, S. 43). Im Säuglingsalter findet daher eine vorwiegend interpsychische Emotionsregulierung statt. Da die Säuglinge noch nicht in der Lage sind, ihre Bedürfnisse selbst zu befriedigen, signalisieren sie diese als emotionalen Ausdruck an ihre Bezugsperson, welche daraufhin ver-sucht, die Ausdruckssignale des Säuglings als „authentische Signale seines aktuellen Gefühls“ zu interpretieren und die Bedürfnisse des Kindes zu be-friedigen (Holodynski, 2002, S. 235).
In der ersten Entwicklungsphase, welche sich über die ersten zwei Lebensjahre erstreckt, bauen die Säuglinge und Kleinkinder ein funktionstüchtiges Emo-tionsrepertoire auf und erwerben verschiedene Bewältigungshandlungen zur Emotionsregulation (Oerter & Montada, 2002, S. 573f). Ausgehend von den Vorläuferemotionen entwickeln sich im Alter von sechs bis zwölf Monaten in der interpsychischen Regulation mit der Bezugsperson aus den zunächst un-gerichteten Ausdrucksreaktionen „emotionsspezifisch organisierte Ausdrucks-zeichen mit eindeutigem Appellcharakter“ (Holodynski, 2002, S. 240). Diese Ausdruckszeichen ermöglichen es den Säuglingen, gezielt Bewältigungshand-lungen bei der Bezugsperson auszulösen, da sie im Gegensatz zu den Vor-läuferemotionen durch entsprechende Körperreaktionen in ihrer Wirkung unterstützt werden und sowohl ohne zeitliche Verzögerung auf den Anlass folgen, als auch auf den jeweiligen Kontext abgestimmt sind (Oerter & Montada, 2002, S. 574).
Die Emotionsentwicklung findet simultan auf der motorischen und der seman-tischen Ebene statt. Zeigt der Säugling einen Emotionsausdruck, versucht die Bezugsperson aus diesem Ausdruck, in Verbindung mit ihren Kenntnissen über die Situation und ihrem Personenwissen über das Kind, dessen Emotionen und Intentionen zu erschließen. Intuitiv spiegelt sie den erkannten Affekt in einer möglichst prägnanten und konventionalisierten Weise (Holodynski, 2002, S. 241). Dabei werden vor allem positive Affektausdrücke gespiegelt, während negative Ausdrücke zum Teil durch positive ersetzt werden. Diese Handlungen der Bezugsperson geschehen unbewusst, als Teil einer „intuitiven elterlichen Didaktik“.[5] Der Säugling wiederum ist in der Lage, visuell wahrgenommene motorische Muster unbewusst nachzuahmen (Holodynski, 2006, S. 93f). Gleichzeitig reagiert die Bezugsperson mit Bewältigungshandlungen. Ob diese Handlungen Wirkung zeigen, kann sie wiederum am Ausdruck des Säuglings ablesen. Sowohl durch das affektreflektierende Spiegeln als auch durch die prompt auf den Ausdruck folgenden Bewältigungshandlungen erfährt das Kind Kontingenzen zwischen Emotionsanlass, Ausdruck, Gefühl und Bewältigungs-handlungen. Durch diese Kontingenzen, für welche das neugeborene Kind eine besondere Sensibilität besitzt, entstehen einerseits emotionsspezifische Ein-schätzungsmuster und andererseits der Symbolgebrauch von Ausdruckszeichen und die bewusste Gefühlswahrnehmung (Holodynski, 2002, S. 241). Da die Deutung der kindlichen Emotionsausdrücke durch die Eltern auch kulturell geprägt ist, erlernt das Kind in der Interaktion ebenfalls kulturspezifische Besonderheiten im Ausdruck von bzw. Umgang mit Emotionen (Friedlmeier, 1999, S. 218). Wesentlich für diesen Prozess ist die elterliche Feinfühligkeit[6], also die Fähigkeit der Eltern, die Ausdrücke und Körperreaktionen ihrer Kinder richtig zu deuten und prompt auf diese zu reagieren (Holodynski, 2006, S. 95). In der interpsychischen Emotionsregulation entwickeln sich demnach aus den Vorläuferemotionen funktionsfähige, motivdienliche Emotionen und die Kin-der lernen, bei angemessenen Bewältigungshandlungen seitens der Bezugs-person, gerichtete und intentionale Ausdruckszeichen zu verwenden. Im Verlauf der Ontogenese findet so „eine Synchronisation der Ausdruckszeichen zwischen Bezugsperson und Säugling statt“, was auch die Qualität und Effizienz interpersoneller Emotionsregulation in den Dyaden verbessert (Holodynski, 1999, S. 40).
Die Strategien der interpsychischen Regulation werden zudem von den Kleinkindern in steigendem Maße selbständig zur intrapsychischen Emotions-regulation verwendet. Während sechs Monate alte Kinder lediglich über ein sehr begrenztes Repertoire an autonomen Bewältigungsstrategien verfügen, haben ältere Kinder bereits mehr Möglichkeiten zur Emotionsregulation (Mangelsdorf, et al., 1995, S. 1824ff). Kinder können sich gegen Ende des zweiten Lebensjahrs zunehmend besser selbst beruhigen und haben neben dem Blickabwenden weitere Ablenkungsstrategien entwickelt. Die motorische Ent-wicklung erlaubt es ihnen nun, beispielsweise, sich von einer Reizquelle zu entfernen. In diesem Alter sind ebenfalls erste kognitive Umdeutungen von emotionsgenerierenden Situationen zu finden. Des Weiteren lernen die Kinder, die Bezugspersonen aktiv um Regulationsunterstützung in solchen Situationen zu bitten, welche die eigenen Bewältigungsstrategien überfordern (Friedlmeier & Holodynski, 1999a, S. 22).
Auch die emotionale Eindrucksfähigkeit der Säuglinge entwickelt sich weiter. Mit vier Monaten können Säuglinge bereits die mimischen Ausdruckszeichen der Bezugsperson unterscheiden und reagieren mit Distressverhalten, wenn diese die mimische Interaktion unterbricht. Zwischen dem sechsten und dem neunten Monat beginnen sie, den Ausdruck der Bezugsperson auch als Handlungsbereitschaft zu interpretieren, da sie lernen, den Grund für einen Emotionsausdruck des Interaktionspartners mit dem Ausdruck assoziieren. Zudem ist ab diesem Alter eine Gefühlsansteckung nicht mehr nur über vokale, sondern auch über mimische Ausdruckszeichen möglich. Diese Entwicklungen ermöglichen die soziale Bezugnahme[7] (Holodynski, 1999, S. 45).
1.3.2 Im Kleinkind- und Vorschulalter
Die Fähigkeit zur intrapsychischen Emotionsregulation wird in der zweiten Entwicklungsphase, im Kleinkind- und Vorschulalter, weiter entwickelt. Dabei ist es durchaus wahrscheinlich, dass in einer emotionsrelevanten Situation sowohl intra- als auch interpsychische Regulierungsprozesse stattfinden (von Salisch & Kunzmann, 2005, S. 6). Der Anteil interpersoneller Emotions-regulation sinkt von 79% bei vierjährigen Kindern auf 10% bei sechsjährigen Kindern (Holodynski, 2002, S. 243). Die Bezugsperson unterstützt diese Entwicklung, indem sie eine zunehmend selbstständigere Regulation der Hand-lungen und Emotionen von dem Kind fordert. Durch das Erlernen der Sprache ist die interpsychische Emotions- und Handlungsregulation sowie das Ver-mitteln von Regulationsstrategien nun nicht mehr nur auf Verhaltensebene, sondern auch auf sprachlicher Ebene möglich (von Salisch & Kunzmann, 2005, S. 18f). Die Kinder können Regulationsstrategien jetzt ebenfalls aus direkten Anweisungen, Angeboten zur Umdeutung des Anlasses und Gesprächen über Emotionen lernen (Holodynski, 2006, S. 143). Neben dem selbstständigen Ausführen motivdienlicher Handlungen sind die Ausbildung selbstbewertender Emotionen und die Aneignung weiterer Emotionsregulationsstrategien die Entwicklungsaufgaben dieser Phase (Holodynski, 2002, S. 242).
Auch entwickelt sich die emotionale Eindrucksfähigkeit weiter. Sind Säuglinge lediglich zur Gefühlsansteckung fähig, so zeigen bereits kleine Kinder Empathie und die Bereitschaft einer traurigen Person zu helfen (Holodynski, 1999, S. 41f; Bischof-Köhler, 2000, S. 54f). Obwohl die Kinder zunehmend zur intrapsychischen Emotions- und Handlungsregulation fähig sind und die auftretenden Emotionen immer mehr als Appell an sich selbst anstatt an andere interpretieren, sind sie bis zum Vorschulalter nicht in der Lage, eine emotionale Situation allein zu durchleben ohne sich Unterstützung z.B. in Form der sozialen Bezugnahme zu suchen. Veranlasst durch die Bindung an die Bezugsperson, suchen jüngere Kinder permanent deren Nähe, damit sie, falls nötig, zur interpsychischen Regulation zur Verfügung steht (Holodynski, 2002, S. 243).
Kinder im Kleinkind- und Vorschulalter erfahren zudem, dass eine sofortige Befriedigung der eigenen Motive nicht immer möglich ist, sondern dass diese mit dem sozialen Umfeld koordiniert werden muss. Die Kinder erwerben auf diese Weise die Fähigkeit der reflexiven Emotionsregulation. Sie lernen, einen Handlungsimpuls sozialen Normen entsprechend aufzuschieben oder ganz auf die entsprechende Motivbefriedigung zu verzichten. So können sie mit den neu erworbenen Regulationsstrategien Intensität und Qualität der Emotionen selbst-ständig an soziale Normen und situative Anforderungen anpassen. In diesem Zusammenhang entstehen auch die neuen Emotionen Stolz, Scham und Schuld, welche das normgerechte Handeln lenken. Zu den dafür benötigten neu er-worbenen Regulationsstrategien zählen weitere Möglichkeiten der Ablenkung und Selbstberuhigung, sowie Umdeutung der Situation und die zeitliche Hierarchisierung konfligierender Motive (Holodynski, 2002, S. 243f).
1.3.3 Im Schulalter
Ab dem Schulalter sind die Kinder in der Lage, ihre Emotionen selbstständig zu regulieren. Zwar benötigen sie in emotional stark belastenden Situationen immer noch die Unterstützung ihrer Eltern, doch fordern sie diese in den be-treffenden Situationen auch aktiv ein. Die Kinder verwenden ein vielfältiges Repertoire an Regulationsstrategien, wobei mentale Strategien mit der fort-schreitenden kognitiven Entwicklung und dem steigenden Emotionswissen eine immer größere Rolle spielen (Friedlmeier, 1999, S. 211). In dieser dritten Entwicklungsphase beginnt zudem die von Holodynski postulierte Inter-nalisierung der emotionalen Ausdruckszeichen. Ab dem sechsten Lebensjahr zeigt sich eine Entkopplung von objektivem Ausdruck und subjektivem Gefühl. Während die Emotionen jüngerer Kinder permanent an deren Aus-druck erkennbar sind, zeigen Erwachsene nicht bei jeder Emotion den ent-sprechenden Emotionsausdruck. Der Ausdruck verschwindet jedoch nicht einfach, sondern er wird Holodynski zufolge, internalisiert; es entsteht eine „mentale Ebene des Ausdrucks, Sprechens und Handelns“ (Holodynski, 2002, S. 245). Die Ausdrucksminiaturisierung ist ein länger andauernder Entwick-lungsprozess. Vorschulkinder zeigen noch den gleichen Ausdruck in solchen Situationen in denen sie allein sind wie in Kommunikationssituationen. Bei Achtjährigen ist der Emotionsausdruck in der Alleinsituation bereits geringer. Der „Desomatisierungsprozess“ setzt sich im Verlauf der Ontogenese weiter fort, sodass die Emotion bei Erwachsenen unter Umständen nur noch subjektiv wahrnehmbar ist. Dies gilt selbstverständlich nicht für Kommunikations-situationen oder besonders starke Emotionserlebnisse. Außerdem wird von gravierenden interindividuellen Unterschieden in der Ausdrucksminiaturisie-rung ausgegangen (Holodynski, 2006, S. 82, S. 157). Die Loslösung des Aus-drucks von der gefühlten Emotion ermöglicht das Entstehen einer privaten Gefühlswelt sowie das intentionale und symbolische Einsetzen von Emotions-ausdrücken, ohne dass zugleich ein Erleben der gezeigten Emotion gegeben sein muss (Oerter & Montada, 2002, S. 580; Holodynski, 1999, S. 50).
[...]
[1] Zum Beispiel das Internalisierungsmodell von Holodynski oder das integrative Konzept von Traue und Kessler.
[2] Ein solches Komponentenmodell wurde beispielsweise von Scherer (1984) entwickelt. Er unterschied fünf Subsysteme: ein “information processing subsystem“, ein „support subsystem“, ein „executive subsystem“, ein „action subsystem“ und ein „monitoring subsystem“ (Scherer, 1984, S. 42ff).
[3] Siehe Holodynski (2006)
[4] Viele Emotionsforscher (z.B. Schachter, Singer) teilen diese Auffassung. Andere Emotionsforscher, wie Davidson, halten die Existenz von „echten“ Emotionen bei Neugeborenen durchaus für möglich (Schmückler, 2003, S. 119ff).
[5] Dieser Begriff wurde von Papoušek & Papoušek (1987) eingeführt und bezeichnet eine Reihe von Verhaltensweisen, welche Eltern kulturunabhängig in der Interaktion mit ihren Säuglingen zeigen. Besonders wichtig ist dabei die Anpassung der Elternbotschaften an die kindliche Wahrnehmungsbeschränkung (siehe Papoušek & Papoušek, 1999, S.149).
[6] Zur genaueren Erläuterung des Konzepts der Feinfühligkeit siehe Abschnitte 2.2.2 und 2.2.4.
[7] Die Begriffe „Rückversichernder Blick“, “soziale Bezugnahme“ oder „emotionale Bezugnahme“ beschreiben ein bestimmtes Verhalten des Kleinkindes: ist sich das Kind der Bedeutung einer Situation nicht gewiss, sucht es aktiv Blickkontakt zur Bezugsperson, um sich an deren Emotionsausdruck zu orientieren. Reagiert die Bezugsperson innerhalb weniger Sekunden auf den rückversichernden Blick mit einem Emotionsausdruck, wird dieser vom Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls gezeigt. Bei einem positiven Ausdruck der Bezugsperson wird sich das Kind einer unbekannten Reizquelle eher nähern als bei einem ängstlichen Gesichtsausdruck. Der Emotionsausdruck der Bezugsperson wird vom Kind also als Symbol für einen Handlungsappell aufgefasst (Friedlmeier, 1999, S. 208).
- Arbeit zitieren
- Lena Linden (Autor:in), 2008, Interindividuelle Unterschiede in der Emotionsentwicklung - Eine bindungstheoretische Perspektive, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112597
Kostenlos Autor werden






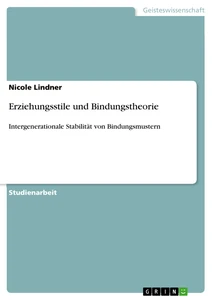













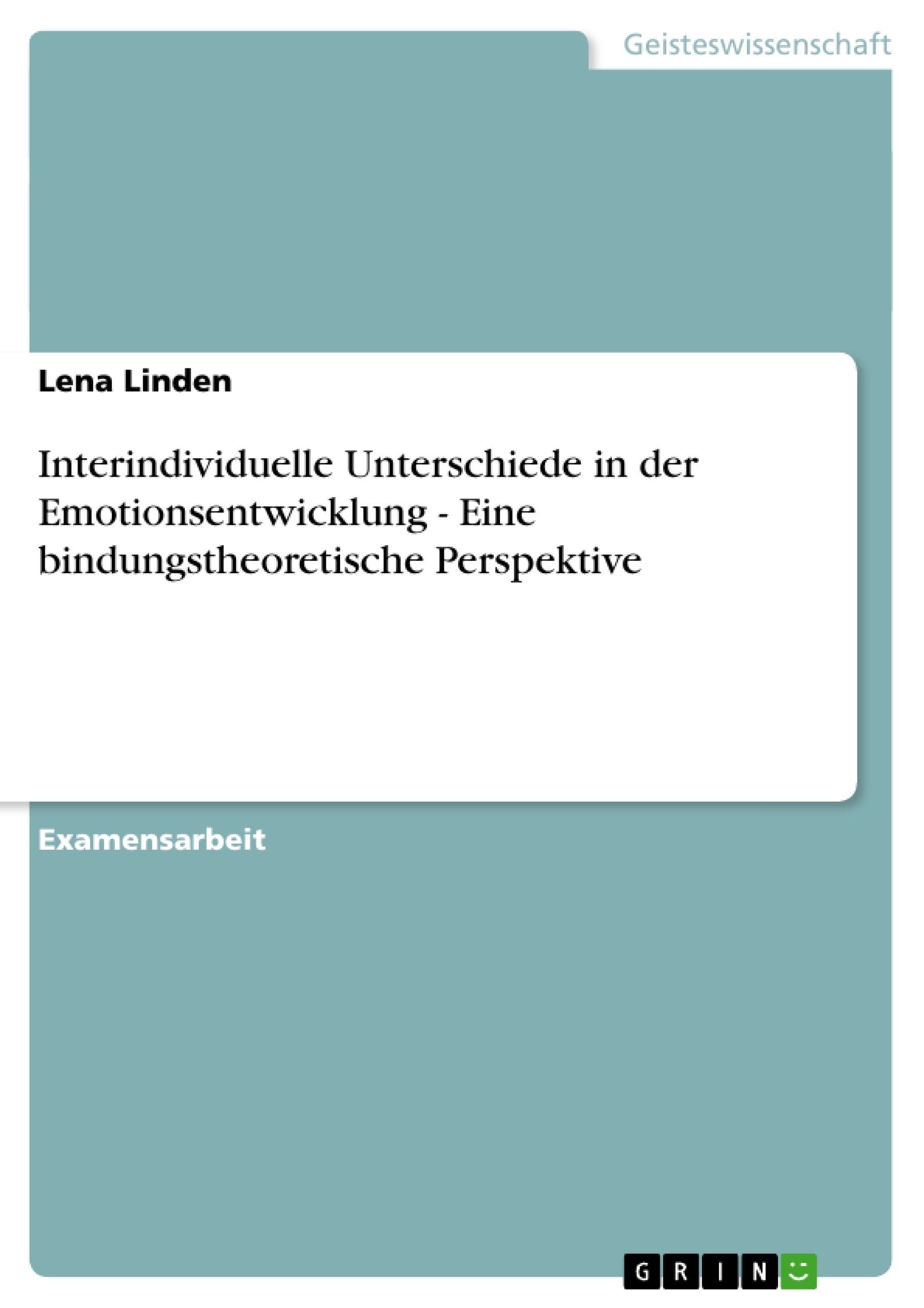

Kommentare