Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Situation der Heimerziehung in Deutschland heute
2.1. Heimerziehung im Kontext des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
2.2. Aufgaben und Ziele von Heimerziehung
2.3. Formen von Heimerziehung
2.4. Heimerziehung in Zahlen
2.5. Wirksamkeit von Heimerziehung
3. Die Familie von Heimkindern
3.1. Familiäre Situation von Heimkindern
3.2. Familie als System
3.3. Systemisches Problemverständnis
3.4. Heimerziehung als Lösungsversuch
4. Elternarbeit in der Heimerziehung
4.1. Definition von Elternarbeit
4.2. Notwendigkeit und Ziele von Elternarbeit
4.3. Rahmenbedingungen von Elternarbeit
4.4. Qualifikation der Heimmitarbeiter für Elternarbeit
4.5. Zusammenarbeit zwischen Heimmitarbeitern und Eltern
4.5.1. Haltung der Mitarbeiter
4.5.2. Eltern als Partner oder Konkurrenten im Erziehungsprozess?
4.5.3. Mitarbeit der Eltern
4.5.4. Elternarbeit in der Praxis
5. Formen und Methoden der Elternarbeit
5.1. Gespräche
5.2. Elterngruppen
5.3. Elternarbeit als Trauerarbeit
5.4. Elternarbeit ohne Eltern
5.5. Elternarbeit als Familientherapie
6. Hindernisse und Grenzen der Elternarbeit
7. Fazit
8. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Der Mythos vom Heim als totale Institution, in der Kinder und Jugendliche „aufbewahrt“ werden, entspricht schon lange nicht mehr den Zuständen stationärer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in Deutschland. Vielmehr hat auch hier eine Modernisierung stattgefunden, die zu einer ausdifferenzierten Heimlandschaft beigetragen hat. Nichtsdestotrotz sind Heime auch heutzutage vor allem Lebensorte für Kinder, deren Eltern mit der Erziehung überfordert sind und deshalb staatlicher Unterstützung bedürfen.
Heimkinder waren in ihrer Herkunftsfamilie häufig schwierigsten Bedingungen ausgesetzt, die einen dortigen Verbleib unmöglich gemacht haben. Wenn Heimmitarbeiter[1] von den teils traumatischen Erlebnissen der Kinder erfahren, sind sie leicht dazu geneigt, einseitig für das Kind Partei zu ergreifen und sich damit gegen die Eltern des Kindes zu stellen[2]. Die Einbeziehung der Eltern ist dabei für sie nicht mit dem Kindeswohl vereinbar, schließlich haben sich die Eltern durch ihre schädigenden Handlungen das Recht auf die Pflege und Erziehung ihres Kindes verwirkt. Doch eine derart starre Haltung der Fachkräfte, kann vor dem Hintergrund der aktuellen rechtlichen Lage nicht aufrecht erhalten werden, da die Heime einen gesetzlichen Auftrag haben, der sie zur Elternarbeit verpflichtet[3].
Wie eine solche Kooperation zwischen Fachkräften und Eltern zu gestalten ist, darüber herrscht bisher noch Uneinigkeit, da es begünstigt durch die Formenvielfalt der Heime bisher keine einheitlichen Standards zur Umsetzung dieser Aufgabe gibt.
In dieser Arbeit wird die Frage diskutiert, ob die Einbeziehung der Eltern bei stationären Hilfen wirklich notwendig ist. Um ein besseres Verständnis für die familiären Zusammenhänge und für die Entstehung von Problemen in diesem System zu erlangen, beziehe ich grundlegende Gedanken der systemischen Theorie mit ein. Dies ermöglicht, den Blick vom Kind als Symptomträger auf das gesamte Eltern-Kind-System zu erweitern[4]. Eine solche Sichtweise kann helfen, die Eltern als Teil der Problemlösung anzuerkennen und damit ihre Bedeutung für den Hilfeprozess zu würdigen. Sind Verhaltensänderungen bei den Kindern demnach nur möglich, wenn die Heime mit den Eltern zusammenarbeiten?
Eine höhere Effektivität der Heime versprechen sich auch die Jugendämter, die von den Einrichtungen verstärkt Elternarbeit fordern. Davon erhoffen sie sich eine Reduzierung der Aufenthaltsdauer in Heimen und somit sinkende Ausgaben für den stationären Bereich der Kinder- und Jugendhilfe[5]. Doch führt Elternarbeit zwangsläufig zu einer schnelleren Rückführung von Heimkindern? Werden Jugendämter in Zukunft noch mehr Druck auf die Heime ausüben, um sie zu einer intensiveren Elternarbeit zu bewegen?
Diesen hohen Erwartungen der öffentlichen Jugendhilfe stehen nicht selten Heime gegenüber, die personell unzureichend ausgestattet sind und Mitarbeiter beschäftigen, die für diese Aufgabe nur mangelhaft qualifiziert sind. In meinen Ausführungen werde ich nachweisen, dass gerade die Qualifikation der für die Elternarbeit zuständigen Mitarbeiter bedeutend für die Kooperation mit den Eltern ist, da diese die Einstellung der Fachkräfte und deren methodische Fertigkeiten entscheidend beeinflusst. Eine Möglichkeit, um Heimmitarbeiter besser zu qualifizieren, sind Fort- und Weiterbildungen. Daneben gibt es aber auch Forderungen von Experten, wonach Elternarbeit eine Aufgabe von Spezialisten, wie z.B. Familientherapeuten, sein sollte, da Heimmitarbeiter durch die Betreuung des Kindes zu sehr in Konflikte involviert sind und somit für die Durchführung von Elternarbeit ungeeignet seien[6]. Die Frage, wer Elternarbeit leisten soll, wird im Folgenden ebenfalls diskutiert.
Im Zentrum meines Interesses steht also zum einen die Frage, ob Elternarbeit in der Heimerziehung notwendig ist. Daneben leitet mich aber auch ein persönliches Interesse, da ich im Anschluss an mein Studium in einer stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung tätig sein werde. Aus diesem Grund erwarte ich von der Bearbeitung dieses Themas, dass ich im Umgang mit den Eltern von Heimkindern mehr Handlungssicherheit erwerbe. Mich interessiert, wie ich die Beziehung zu den Eltern gestalten muss, um möglichst effektiv mit ihnen zu arbeiten und somit auch positive Veränderungen beim Kind unterstützen kann. Mit welcher Haltung muss ich den Eltern dabei begegnen? Welche Methoden eignen sich besonders für die Elternarbeit im Kontext der stationären Erziehung? Um diese Fragen zu klären und dem Leser einen umfassenden Überblick über dieses Thema zu geben, habe ich meine Arbeit folgendermaßen aufgebaut:
In Kapitel 2 wird zunächst die aktuelle Situation der Heimerziehung dargestellt, da die Heimlandschaft in Deutschland, wie bereits erwähnt, inzwischen sehr differenziert ist. Neben der rechtlichen Einordnung erfolgt hier auch eine Auseinandersetzung mit den Aufgaben und Zielen von Heimerziehung. An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass sich die Zielsetzung abhängig vom Alter der Kinder stark unterscheiden kann. Da dies vor allen Dingen auch für die Aufgabe der Elternarbeit gilt, erscheint es mir erforderlich, die Zielgruppe näher einzugrenzen. Deshalb beziehe ich mich im Folgenden vorwiegend auf Kinder unter 14 Jahren, bei denen noch nicht die Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben im Vordergrund steht. Auch herrscht für Kinder dieser Altersgruppe weitgehend Einigkeit darüber, dass die Eltern für deren Entwicklung wichtig sind. Bei Jugendlichen wird die Bedeutung der Eltern dagegen zu oft verkannt[7], weshalb ich auf die Notwendigkeit von Elternarbeit für diese Altersgruppe nur kurz in Kapitel 4.2. eingehen werde. Daneben werde ich in Kapitel 2 statistische Daten einbeziehen, um dem Leser zu verdeutlichen, welchen Stellenwert Heimerziehung in der Kinder- und Jugendhilfe besitzt und wie wirksam diese Erziehungshilfe ist.
Anschließend wird in Kapitel 3 die familiäre Situation von Heimkindern thematisiert. Studien zeigen, dass die Mehrzahl der Heimkinder aus belasteten Verhältnissen kommt[8]. Nicht selten sind diese Kinder durch problematische Verhaltensweisen in ihrem sozialen Umfeld auffällig geworden. Um nachzuweisen, dass der einseitige Blick auf die Kinder als Symptomträger zu kurz greift, ziehe ich die systemische Theorie heran. Diese dient auch dazu, die Entstehung von Problemen innerhalb des Familiensystems zu erklären und zu diskutieren, ob Heimerziehung in diesem Kontext einen angemessenen Lösungsversuch darstellt.
Nachfolgend widmet sich Kapitel 4 der Elternarbeit in der Heimerziehung und bildet damit den Schwerpunkt meiner Ausarbeitung. Da die Elternarbeit in der Praxis von informellen Kontakten bis zu intensiven familientherapeutischen Sitzungen reicht, wird der Begriff Elternarbeit an dieser Stelle zunächst einmal definiert. Danach folgt eine differenzierte Auseinandersetzung zur Notwendigkeit von Elternarbeit, wobei diskutiert wird, was ohne die Einbeziehung der Eltern erreicht werden kann und wofür die Eltern im Hilfeprozess zwingend erforderlich sind. Um die Qualität der geleisteten Elternarbeit von Einrichtungen bewerten zu können, sollen die Rahmenbedingungen, unter denen die Heimmitarbeiter tätig sind, betrachtet werden. Daran wird auch deutlich, welchen Stellenwert Elternarbeit in einem Heim genießt, denn schwierige Arbeitsbedingungen können eine intensive Elternarbeit unmöglich machen und sich damit negativ auf die Qualität der Elternarbeit auswirken. Des Weiteren setze ich mich an dieser Stelle mit der Qualifikation der Fachkräfte auseinander und wie diese die Haltung der Mitarbeiter gegenüber den Eltern beeinflusst.
In Kapitel 5 steht die praktische Arbeit mit den Eltern im Vordergrund und wie diese methodisch planvoll gestaltet werden kann. Da die ganze Bandbreite der vielfältigen Formen und Methoden der Elternarbeit in diesem Rahmen nicht dargestellt werden kann, habe ich einige meines Erachtens nach wichtige ausgewählt, die im Bereich der stationären Kinder- und Jugendhilfe eine Rolle spielen.
Um ein differenziertes Bild von Elternarbeit in der Heimerziehung zu erhalten, kann nicht darauf verzichtet werden, sich mit den Grenzen dieser Arbeit auseinander zu setzen. Wann Elternarbeit nicht leistbar ist bzw. durch ungünstige Bedingungen erschwert wird, findet der Leser in Kapitel 6.
Abschließend werde ich in Kapitel 7 offene Fragen benennen und die wichtigsten Gedanken zu diesem Thema in einem kurzen Fazit zusammenfassen.
2. Situation der Heimerziehung in Deutschland heute
Die Erziehung im Heim wird auch heute noch häufig als „letztes Mittel“[9] stigmatisiert. Bevor ein Kind im Heim untergebracht wird, versucht die Jugendhilfe in der Regel mit ambulanten oder teilstationären Hilfen, eine Herausnahme des Kindes aus der Familie zu verhindern. Doch was bedeutet Heimerziehung eigentlich genau? Um diese Frage zu klären, wird zunächst ein Überblick über diese Hilfeform gegeben.
2.1. Heimerziehung im Kontext des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
Mit dem Inkrafttreten des Sozialgesetzbuches (SGB) VIII[10] in den Jahren 1990/1991 wurden die Rechte der Eltern eindeutig gestärkt. Lebensweltorientierung[11] und Partizipation stellen seitdem die Leitnormen dieses Gesetzes dar[12]. Dieses präventive, angebotsorientierte Gesetz enthält einen differenzierten „Leistungskatalog“ an ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen.
Heimerziehung ist eine der Erziehungshilfen, auf die Personensorgeberechtigte bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen einen rechtlichen Anspruch haben. Dabei steht Heimerziehung als eine stationäre Hilfe gleichberechtigt neben den anderen Angeboten[13].
Die Erziehung der Kinder ist laut Grundgesetz das natürliche Recht der Eltern[14]. Damit werden die Stellung und der Wert der Familie hervorgehoben, denn die Familie ist vor staatlichen Eingriffen geschützt. Jedoch „wacht die staatliche Gemeinschaft“[15] darüber, ob die Erziehung zum Wohl des Kindes ausgeführt wird. Jugendhilfe setzt ein, wenn Eltern Schwierigkeiten bei der Erziehung ihrer Kinder haben, um sie bei der Erfüllung dieser Aufgabe zu unterstützen. So sollen die Erziehungsfähigkeit der Eltern gestärkt und die Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien verbessert werden.
Hilfe zur Erziehung zählt zu den Leistungen der Jugendhilfe. Personensorgeberechtigte haben einen Anspruch darauf, „wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist“[16]. Mit Erreichen der Volljährigkeit sind Jugendliche selbst anspruchsberechtigt und müssen einen Antrag auf Hilfe zur Erziehung stellen[17].
Da die Trennung der Kinder von der Familie einen massiven Eingriff bedeutet, ist bei jeder Hilfe zur Erziehung zu prüfen, ob „nicht ein Verbleib des Kindes in der Familie als die weniger schädliche Alternative anzusehen ist“[18]. In den letzten Jahren wurde das Angebot an ambulanten Hilfen stark ausgebaut. Dies ist auch mit dem Wandel des Selbstverständnisses der Jugendhilfe begründet, nämlich weg von der Eingriffsbehörde hin zur Jugendhilfe als soziale Dienstleistung. Ziel ist es, dass soziale Umfeld der Kinder zu erhalten, die familialen Ressourcen zu aktivieren und diese für die Lösung von Schwierigkeiten zu nutzen. Doch „reichen Qualität und Kapazität der elterlichen Erziehung nicht aus oder ist die Erziehung durch sie überhaupt nicht verantwortbar, ist eine ambulante Hilfe zur Erziehung ungeeignet“[19]. In diesem Fall kann eine Heimerziehung des Kindes sinnvoll sein. Diese
„Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern“[20].
Dabei soll Heimerziehung keine familienersetzende, sondern eine familienergänzende Hilfe darstellen. Die Eltern verlieren mit der Fremdunterbringung ihres Kindes nicht alle ihre elterlichen Rechte, sondern werden in den Hilfeprozess und dessen Gestaltung intensiv miteinbezogen. Dies wird schon an der Einleitung der Hilfe deutlich, denn nur in seltenen Fällen werden die Kinder gegen den Willen der Eltern, d.h. aufgrund eines gerichtlichen Sorgerechtsentzug, stationär untergebracht. Demnach stellen die meisten Eltern einen Antrag und erklären sich faktisch mit der Hilfe einverstanden. Dass diese Freiwilligkeit der Eltern in der Praxis häufig auf Druck des Jugendamtes hin erreicht wird, d.h. die Hilfe im Zwangskontext stattfindet, muss bei der Betrachtung sicherlich berücksichtigt werden[21].
Neben der Lebensweltorientierung ist die Partizipation, also die Beteiligung der Betroffenen, ein wichtiges Prinzip des KJHG. Diesem wird beispielsweise mit dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern entsprochen. So haben Personenberechtigte und das Kind bzw. der Jugendliche ein Mitspracherecht bei der Auswahl der Einrichtung, wobei diesem Wunsch zu entsprechen ist, wenn dadurch nicht unverhältnismäßige Mehrkosten entstehen[22]. Da es sich bei der Heimerziehung meistens um eine längerfristig zu leistende Hilfe handelt, die eine Hilfeplanung voraussetzt, finden in regelmäßigen Abständen Hilfeplangespräche statt, an denen die Eltern und das Kind teilnehmen[23].
Die Beteiligung der Eltern am Hilfeprozess zeigt, dass die Eltern „jetzt Partner mit Rechtsanspruch auf Hilfe“[24] sind. Dadurch bleiben diese auch bei einer Fremdunterbringung für das Kind präsent und die Bedeutung der Eltern-Kind-Bindung wird geachtet.
2.2. Aufgaben und Ziele von Heimerziehung
Kinder und Jugendliche, die im Heim leben, waren in ihrer Herkunftsfamilie häufig großen Belastungen ausgesetzt. Untersuchungen haben ergeben, dass Heimkinder aufgrund desolater frühkindlicher Erfahrungen sehr oft eine unsichere Bindungsorganisation entwickelt haben[25]. Diese beeinflusst die Haltung und Erwartung, mit denen sie anderen Menschen gegenübertreten.
Ein Heim soll diesen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, korrigierende Erfahrungen zu machen. So erleben Heimkinder durch soziales Lernen in der Gruppe die Bedeutung von Regeln, die Übernahme von Verantwortung u.v.m.. Voraussetzung dafür ist ein strukturierter Tagesablauf mit klaren Regeln und Grenzen, da gerade Heimkinder in ihrer Familie wenig Sicherheit und Orientierung erlebt haben und deshalb feste Strukturen benötigen. Ziel sollte sein, dass jedes Heimkind die Möglichkeit hat, eine sichere Bindung zu mindestens einer verlässlichen Bezugsperson aufzubauen, denn nachweislich sind sicher gebundene Kinder sozial kompetenter[26].
Die Arbeit im Heim zielt darauf ab, die Kinder und Jugendlichen zu fördern und deren Sozialisationsdefizite abzubauen. Dazu ist es notwendig, ein Heim so zu gestalten, dass ein Lernfeld entsteht, in dem sich diese Kinder günstig entwickeln können.
Das KJHG weist Heimen die Aufgabe zu, Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erziehen[27]. „Gemeinschaftsfähig“ bedeutet unter anderem auch, dass die Kinder zu sozial angemessenem Verhalten in der Lage sind. Da viele Heimkinder aggressives oder deviantes Verhalten zeigen, geraten sie häufig in Konflikte mit anderen. Ein Heim schützt somit in gewisser Weise die Gemeinschaft vor den externalisierenden Störungen dieser Kinder und Jugendlichen[28].
Je älter die Kinder bei der Aufnahme im Heim sind, desto schwieriger ist die Erziehungsaufgabe, denn diese Kinder sind durch die familiäre Sozialisation in ihrem Verhalten schon sehr geprägt. Die Erwartung, dass Heimerziehung die Erziehungsschwierigkeit der Jugendlichen mit zumeist deprimierenden Lebensgeschichten beheben kann, erscheint utopisch und naiv[29]. Sinnvoller erscheint es deshalb, die relative Verbesserung ihrer Lebenssituation anzuerkennen und somit auch kleinere Erfolge wertzuschätzen.
Daneben ist das Heim ein Ort, an dem diese Kinder ihre oftmals traumatischen Erlebnisse verarbeiten können. Hierbei kommen pädagogische oder therapeutische Maßnahmen zur Anwendung.
In Krisensituationen bietet Heimerziehung die Möglichkeit, eine Distanz zwischen dem Kind und seiner Familie zu schaffen. Diese dient dazu, die angespannte Situation zu entschärfen und für eine Entlastung im Familiensystem zu sorgen[30]. Konflikte können so nicht weiter eskalieren und es wird eine Ausgangsbasis geschaffen, um die weitere Perspektive des Kindes zu klären. Ziel einer Erziehung im Heim ist in der Regel die Rückführung des Kindes in seine Herkunftsfamilie[31]. Um dieses Ziel zu verwirklichen, gehört es zu den Aufgaben der Heimerziehung, die Erziehungsfähigkeit der Eltern zu stärken und die Entwicklungsbedingungen des Kindes im familiären Milieu zu verbessern[32]. Hierfür ist es allerdings notwendig, dass jedes Heim Elternarbeit durchführt. Die Arbeit eines Heimes ist also familienorientiert, denn ohne eine Veränderung der familiären Kommunikations- und Interaktionsmuster kann eine Rückführung auf Dauer nicht gelingen.
Stellt sich während des Heimaufenthalts heraus, dass eine Rückführung zu den Eltern des Kindes nicht möglich ist, muss das Heim mit den Betroffenen an der Loslösung des Kindes von den Eltern arbeiten. Erst wenn ein Kind seinen Heimaufenthalt akzeptiert, wird es bereit sein, an einer neuen Lebensperspektive zu arbeiten. Dies kann bedeuten, die Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten, aber auch eine auf Dauer angelegte Heimerziehung ist möglich. Bleibt das Heim längerfristig der Lebensort, sollten den Kindern Lebensbedingungen geboten werden, in denen sie sich positiv entwickeln können. Ältere Heimkinder sind auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Dazu gehören die Beratung und Unterstützung von Jugendlichen in Ausbildungsfragen sowie in Fragen der allgemeinen Lebensführung[33].
Es wird deutlich, dass an Heime hohe Erwartungen gestellt werden und sie deshalb sehr vielfältige Aufgaben erfüllen müssen. Zu diesen Aufgaben gehört auch die Arbeit mit den Eltern und Familien der Heimkinder, die den Schwerpunkt meiner Ausarbeitung bildet. Da sich die Voraussetzungen für Elternarbeit in den verschiedenen Einrichtungen aber unterscheiden, wird zunächst ein Überblick über die Vielfalt der Heimerziehungsarrangements gegeben.
2.3. Formen der Heimerziehung
Würde man in Deutschland eine Umfrage zum Thema „Heimerziehung“ durchführen, kämen mit großer Wahrscheinlichkeit Äußerungen, die an das veraltete Bild der stationären Unterbringung erinnern. Obwohl die gegenwärtige Heimerziehung mit der kritisierten Anstaltserziehung nicht mehr zu vergleichen ist, hat Heimerziehung noch immer mit einem Negativimage zu kämpfen[34]. Dabei kann man in Deutschland gar nicht mehr von dem Heim sprechen, sondern es stellt eher einen Sammelbegriff für verschiedene Formen der Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen dar[35]. Seit der Heimkritik vor ca. 40 Jahren, hat sich die Heimlandschaft in Deutschland völlig verändert. Allgemeingültige Aussagen lassen sich kaum treffen, da sich die verschiedenen Formen der Heimerziehung stark unterscheiden.
Um die Entwicklung der modernen Heimerziehung zu beschreiben, hat WOLF Prinzipien benannt, die diese kennzeichnen[36]. Dazu zählt er Dezentralisierung, Entinstitutionalisierung, Entspezialisierung, Regionalisierung, Professionalisierung und Individualisierung. Doch was verbirgt sich hinter diesen Schlagwörtern?
Die Heimkritik führte dazu, dass die durchschnittliche Platzzahl in den Heimen sank und diese dadurch kleiner wurden. So entstanden durch die Dezentralisierung der Heime auch Außenwohngruppen, die einen weniger stigmatisierenden Charakter haben, da das Leben dort mehr an das Leben außerhalb der Wohngruppe angeglichen ist. Die Dezentralisierung der Heime bedeutet somit eine Auslagerung von Gruppen, d.h. die Gruppen befinden sich in Häusern außerhalb eines zentralen Heimgeländes.
Der Begriff Entinstitutionalisierung steht für die Abkehr von einer zentralen Versorgung beispielsweise durch Wäschereien oder Großküchen. Eine solche ist in heutigen Heimen wohl kaum noch anzutreffen, steht sie doch dem Konzept der Alltagsorientierung entgegen und hemmt die Selbstständigkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen. Wohngruppen sind somit autonomer und können flexi-bler arbeiten[37].
Wie bereits erwähnt, spielt die Lebensweltorientierung als Leitnorm der Jugendhilfe eine bedeutende Rolle. Das soziale Umfeld soll in die Arbeit miteinbezogen werden, d.h. Eltern- und Familienarbeit wird von den Heimmitarbeitern erwartet. Eine kontinuierliche, enge Zusammenarbeit ist allerdings nur möglich, wenn der Wohnort der Eltern nicht zu weit vom Heim des Kindes entfernt ist. Das Einzugsgebiet eines Heimes sollte unter diesen Gesichtspunkten regional ausgerichtet sein. Bundesweite Aufnahmen von Kindern und Jugendlichen finden heutzutage vorrangig in Spezialeinrichtungen (z.B. Heime für misshandelte Mädchen, Mutter-Kind-Einrichtungen etc.) statt.
Daneben lässt sich in den Heimen eine Professionalisierung des Personals feststellen. Ungelernte Heimmitarbeiter wurden durch pädagogische Fachkräfte ersetzt oder haben sich in Fort- und Weiterbildungen schulen lassen. Als Betreuer sind meistens Erzieher, Sozialpädagogen, Diplom-Pädagogen o.ä. qualifizierte Mitarbeiter tätig[38]. Ziel ist es, dass Heimerzieher nicht „aus dem Bauch heraus“ handeln, sondern pädagogisch begründete Entscheidungen treffen, erlernte Methoden anwenden, ihre Arbeit reflektieren können und somit die Qualität der Arbeit steigt. Eine solche Professionalisierung ist angesichts der Problemlagen und Störungen vieler Heimkinder auch nötig, um erfolgreich zu arbeiten.
Ein weiteres wesentliches Prinzip der Heimerziehung ist die Individualisierung. Die Angebote der stationären Jugendhilfe sollen sich am Einzelfall orientieren und für die Kinder und Jugendlichen individuell passend sein. Es kann demnach in der modernen Jugendhilfe keine Heimform geben, die pauschal für alle Kinder und Jugendlichen und deren spezifischen Lebensgeschichten geeignet ist. Aus diesem Grund wird vor einer Heimunterbringung auch eine individuelle Hilfeplanung von den Jugendämtern durchgeführt, um den Bedarf abzuklären und möglichst die am besten passende Heimeinrichtung zu finden[39].
Das Angebot der erzieherischen Hilfen ist inzwischen sehr vielfältig. So gibt es nicht nur zusätzliche ambulante und teilstationäre Angebote, sondern auch die Heime haben sich differenziert. Diese Entwicklung hat der Gesetzgeber berücksichtigt und ins KJHG übernommen, so ist neben „Heimerziehung“ auch von dem Begriff „sonstige betreute Wohnform“[40] die Rede.
Die traditionelle Form der Heimerziehung stellen heute Zentralheime dar. Mit einer Kapazität von 50 bis 60 Plätzen gelten sie als große Einrichtungen. In solchen Heimen gibt es mehrere Innenwohngruppen, in denen jeweils ca. acht Kinder oder Jugendliche wohnen. Diese meist altersgemischten Wohngruppen werden in der Regel von vier pädagogischen Heimmitarbeitern im Schichtdienst sowie zusätzlichem hauswirtschaftlichen Personal betreut. Die altersgemischte Gruppenform verspricht viele Vorteile. Die Kinder lernen, sich an Gruppenregeln zu halten, ältere Kinder nehmen Rücksicht auf Jüngere und diese wiederum haben andere Rechte und Pflichten als die älteren Bewohner usw. Doch diese Heimform wird auch heftig kritisiert. So wird ihr vorgeworfen, dass ein Leben dort zu künstlich sei und wenig mit einem Leben außerhalb des Heimes vergleichbar sei. Durch die Ballung vieler Kinder mit belastenden Lebenserfahrungen entwickeln sich dysfunktionale Strategien, die wenig zu einer positiven Entwicklung dieser Kinder beitragen. Außerdem behindern solche Zentralheime eine Öffnung nach außen schon aufgrund ihrer Struktur, denn heiminterne Schulen, Sportgruppen und Therapien lassen wenig Raum für Außenkontakte. Freundschaften werden dadurch meistens zwischen den Heimbewohnern geschlossen. Da es in großen Heimen naturgemäß häufiger zu Neuaufnahmen und Entlassungen von Kindern kommt, können sich jedoch kaum feste Freundschaften entwickeln. Auch die Heimbetreuer werden selten als verlässliche Bezugspersonen angesehen, sind sie doch, bedingt durch den Schichtdienst, sehr unregelmäßig für die Kinder verfügbar. Erschwerend kommt hinzu, dass der gesamte Heimbereich von einer Mitarbeiterfluktuation betroffen ist, was mit dem geringen gesellschaftlichen Ansehen dieser Arbeit, der hohen Arbeitsbelastung und der relativ geringen Entlohnung zusammenhängt. Obwohl also gerade Heimkinder ein stabiles Umfeld und verlässliche Bezugspersonen brauchen, erleben sie auch dort immer wieder Beziehungsabbrüche. Korrigierende Beziehungserfahrungen können somit kaum gemacht werden. Aufgrund der vielen Nachteile können zentrale Gruppen auf mittlere Sicht wohl als Auslaufmodell angesehen werden[41].
Durch die Dezentralisierung der Heime sind vielfach Außenwohngruppen entstanden. Diese befinden sich außerhalb des zentralen Heimgeländes und sind oftmals in normale Wohngegenden integriert. Da sie auf den ersten Blick nicht als Heime erkennbar sind, entfällt auch der stigmatisierende Charakter dieser Einrichtungen[42]. Zudem bemühen sich solche Wohngruppen viel stärker um Außenkontakte, z.B. finden Nachbarschaftsfeste statt, es gibt Kooperationen mit Sportvereinen, Jugendzentren etc.. Außenwohngruppen haben somit weniger starre Grenzen, womit eine Normalisierung der Lebensbedingungen verbunden ist. Wesentlicher Vorteil gegenüber den Wohngruppen im Zentralheim ist auch, dass weniger Kinder mit problematischen Verhaltensweisen aufeinandertreffen und auch Konflikte aus anderen Wohngruppen nicht auf die eigene Gruppe übertragen werden. Der Gruppenalltag ist somit weniger anfällig für Störungen. Ein wichtiges Prinzip in Außenwohngruppen ist die Selbstversorgung, wodurch die Mitarbeiter flexibler arbeiten können. Doch dies führt auch dazu, dass Alltagsaufgaben noch stärker von den pädagogischen Mitarbeitern übernommen werden müssen und damit weniger Zeit für die eigentlichen Aufgaben bleibt, wie die Förderung der einzelnen Kinder oder eine intensive Elternarbeit. Hinzu kommt, dass auch hier die Heimmitarbeiter im Schichtdienst tätig sind, was mit den oben beschriebenen Problemen einhergeht. Die Selbständigkeit und größere Flexibilität in der Arbeit bringt zwar größere Freiräume mit sich, dafür sind die Mitarbeiter häufig auf sich gestellt und sind über längere Zeit allein im Dienst. Da es wenig Kontakte zum Zentralheim gibt, spielt das eigene Team eine wichtige Rolle, denn die Mitarbeiter sind zwar häufig allein im Dienst tätig, müssen sich aber bei den regelmäßigen Teamsitzungen oder bei der Dienstübergabe gut absprechen, damit sie sich von den Kindern nicht „gegeneinander ausspielen“ lassen. Auch für die Reflexion der eigenen Arbeit sind diese kontinuierlichen Treffen sehr bedeutend.[43]. Im Unterschied zu selbstständigen Wohngruppen sind Außenwohngruppen aber weiterhin mit dem Zentralheim verbunden, wie beispielsweise durch die Nutzung von therapeutischen Angeboten auf dem Stammgelände[44].
Eine weitere Form der Heimerziehung sind Kleinstheime. Diese bestehen in der Regel aus nur einer Wohngruppe mit fünf bis acht Bewohnern. Durch diese geringe Anzahl an Plätzen entsteht wesentlich schneller als in größeren Einrichtungen ein Belegungsdruck[45]. Bekommt ein Kleinstheim mit aktuell geringer Auslastung beispielsweise eine Anfrage vom Jugendamt für eine Neuaufnahme, so wird das Heim selbstverständlich eher bereit sein dieser zuzustimmen, auch wenn dieser neue Bewohner möglicherweise für diese Einrichtung aufgrund seines Störungsbildes ungeeignet ist. Doch wer will Heimmitarbeitern eine solche Entscheidung verdenken, wenn davon deren Arbeitsplätze abhängen? Für den Kostenträger kann es deshalb sinnvoll sein, Entscheidungen der Heimmitarbeiter kritisch zu hinterfragen, denn nicht selten sind diese eher finanziell als pädagogisch begründet. Da in einem Kleinstheim nur wenige Mitarbeiter tätig sind, stellen kollegiale Beratung sowie regelmäßige Team- und Fall-Supervisionen sehr wichtige Komponenten dar, um eine fachlich qualifizierte Arbeit zu ermöglichen[46].
Ein Angebot für Jugendliche und junge Volljährige stellt das Betreute Wohnen dar. Dieses schließt sich entweder an einen Heimaufenthalt an oder existiert als spezifische Betreuungsform. Ziel ist die Verselbstständigung des Jugendlichen und die Erleichterung des Übergangs in ein Leben nach dem Heim. Die Regeln und Strukturen sind geringer, die Autonomie der Bewohner entsprechend größer[47]. Da die Elternarbeit beim Betreuten Wohnen in der Praxis jedoch eine untergeordnete Rolle spielt, werde ich mich im Folgenden nicht auf diese Betreuungsform beziehen. Diese Eingrenzung bedeutet aber in keinem Fall, dass Elternarbeit bei Jugendlichen vernachlässigt werden kann. Gerade im Hinblick auf Ablösungsprozesse in der Adoleszenz ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie für eine positive Entwicklung wichtig. Die geringe Bedeutung, die Heimmitarbeiter der Elternarbeit bei Jugendlichen beimessen[48], steht damit in einem markanten Widerspruch zu den theoretischen Erkenntnissen.
Neben der stationären Unterbringung in Wohngruppen gibt es auch familienähnliche Erziehungsformen. Bei diesen sogenannten „Erziehungsstellen“, die zwischen der Heimerziehung und der Erziehung in einer Pflegefamilie angesiedelt sind, handelt es sich um pädagogisch ausgebildete Fachkräfte, die fremduntergebrachte Kinder in ihrer eigenen Familie betreuen. Diese Kinder haben meistens besonders starke Entwicklungsdefizite und müssen pädagogisch speziell gefördert werden, so dass eine „normale“ Heimerziehung dies nicht leisten könnte[49]. Im Gegensatz zu den bisher genannten Heimformen gibt es in Erziehungsstellen keinen Schichtdienst, da die Kinder Rund um die Uhr von derselben Fachkraft betreut werden. Zwischen Kind und Betreuer entwickelt sich eine viel intensivere Beziehung und da es weniger Aufnahmen bzw. Entlassungen von Kindern gibt, kommt es auch wesentlich seltener zu Beziehungsabbrüchen[50]. So haben fremduntergebrachte Kinder meiner Meinung nach eine bessere Chance, korrigierende Beziehungserfahrungen zu machen, als dies in einer Wohngruppe möglich ist. Gemessen an der Gesamtzahl der fremduntergebrachten Kinder spielen Erziehungsstellen mit einer durchschnittlichen Kapazität von zwei Plätzen allerdings eine untergeordnete Rolle. Auch bezogen auf das Thema meiner Arbeit, ist diese spezielle Betreuungsform kaum vergleichbar mit der Heimerziehung, weshalb ich in der nachfolgenden Betrachtung zur Elternarbeit Erziehungsstellen unberücksichtigt lasse.
Diese Darstellung zeigt, dass sich die Heimerziehung in Deutschland sehr differenziert hat. So sind Kombinationen zwischen den genannten Heimformen möglich und auch konzeptionell gibt es große Unterschiede[51].
Damit es bei dieser Vielfalt an Heimerziehungsarrangements überhaupt möglich ist, vergleichbare Aussagen zur Elternarbeit in diesem Kontext zu machen, erscheint es mir notwendig, den Begriff einzugrenzen. Im nachfolgenden Text wird deshalb nur die Erziehung in Innen- und Außenwohngruppen sowie in selbstständigen Wohngruppen mit dem Begriff „Heimerziehung“ gleichgesetzt.
2.4. Heimerziehung in Zahlen
Hierbei werde ich mich auf das Geschlechterverhältnis, die Anzahl der Heimkinder in Deutschland, deren Altersstruktur sowie die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Kindern und Jugendlichen in Heimen beziehen.
In Heimen sind Jungen gegenüber Mädchen mit einem Verhältnis von 3:1 überrepräsentiert[52]. Eine mögliche Hypothese dafür ist, dass Jungen häufiger durch externalisierende Störungen, wie z.B. dissoziales Verhalten, in ihrem sozialen Umfeld auffällig werden und ihre Familien dadurch schneller Kontakt zum Jugendamt haben.
Die stationäre Hilfe zur Erziehung gemäß §34 SGB VIII ist im Vergleich zu den anderen Erziehungshilfen die kostenintensivste Maßnahme[53]. Aus fiskalischen Gründen sind die Jugendämter deshalb bemüht, weniger Fremdunterbringungen zu veranlassen und die Aufenthaltsdauer der Kinder in Heimen zu verkürzen. Um die Kosten für stationäre Unterbringungen zu reduzieren, wurde deshalb seit dem Inkrafttreten des KJHG das Angebot an ambulanten und teilstationären Hilfen stark ausgebaut. So haben sich beispielsweise die Hilfen in Tagesgruppen zwischen 1991 und 2000 mehr als verdoppelt, wie auch die Anzahl der Familien, die eine sozialpädagogische Familienhilfe erhalten[54].
Um so mehr überrascht die quantitative Entwicklung der Heimerziehung seit dem Jahr 1991. Die Zahl fremduntergebrachter Kinder konnte nicht, wie erhofft, drastisch gesenkt werden. Gab es 1991 noch 68190 stationär untergebrachte junge Menschen bis 21 Jahren, erhöhte sich diese Zahl 1995 sogar auf 69969 Heimkinder. Seitdem stagnieren die Zahlen auf relativ hohem Niveau, 2005 lebten immer noch 61806 Kinder und Jugendliche in Heimen[55].
Insgesamt lässt sich feststellen, dass trotz des massiven Ausbaus des nichtstationären Sektors die angestrebte Reduzierung der stationären Fremdunterbringungen ausgeblieben ist[56]. Sind die Bemühungen der Jugendhilfe etwa wirkungslos geblieben? Wenn das der Fall wäre, können ambulante Hilfen dann nicht wieder abgebaut werden?
Die Gründe für die anhaltend hohe Zahl fremduntergebrachter Kinder sind sicherlich vielfältig. So scheinen zunehmend sozialstrukturelle Belastungsfaktoren, wie Arbeitslosigkeit, Armut und Scheidung, in unserer Gesellschaft zu einem wachsenden Bedarf an erzieherischen Hilfen zu führen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Erziehungsleistung der Eltern und damit der gesellschaftliche Druck auf sie. Aus diesen Erkenntnissen lässt sich aber nicht der Schluss ziehen, dass Familien, die belastenden Verhältnissen ausgesetzt sind, „unvermeidbar zu Adressaten von Jugendhilfeleistungen“[57] werden. Ebenso abwegig wäre es, zu behaupten, dass in Heimen ausschließlich Kinder aus sozial schwachen Familien leben. Nichtsdestotrotz steigt das Risiko des Scheiterns, wenn Familien in schwierigen Verhältnissen leben und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Eltern Erziehungshilfen benötigen, nimmt zu[58].
Man kann also davon ausgehen, dass ambulante Hilfen sehr wahrscheinlich wirkungsvoll sind, der Effekt aber in den Statistiken nicht sichtbar wird, weil dieser durch den steigenden Unterstützungsbedarf ausgeglichen wird[59]. Die Frage, ob ambulante Hilfen aufgrund mangelnder Effektivität wieder abgebaut werden können, ist also klar zu verneinen, denn würden diese präventiven Maßnahmen entfallen, müssten mit großer Sicherheit viel mehr Kinder fremduntergebracht werden.
Weitere Gründe für die hohe Nutzung von stationären Erziehungshilfen können ein verbessertes Image der Jugendhilfe sowie ein leicht zugängliches Hilfesystem sein[60]. Die Inanspruchnahme stationärer Erziehungshilfen hängt demnach nicht unmittelbar mit der Verfügbarkeit von Angeboten im nichtstationären Bereich zusammen, sondern wird von vielfältigen anderen Faktoren beeinflusst[61].
Allerdings sollte die quantitative Entwicklung differenzierter betrachtet werden, denn bei der Altersstruktur der Kinder und Jugendlichen in Heimen werden große Unterschiede deutlich. Bei den im Jahr 2005 neu in einem Heim oder einer sonstigen betreuten Wohnform aufgenommenen jungen Menschen, bilden Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren mit fast 70% die Hauptklientel. Auch über die Volljährigkeit hinaus können Fremdunterbringungen zum Zweck der Verselbstständigung von den Kostenträgern weiter bewilligt werden. So befanden sich unter den Neuaufnahmen im Jahr 2005 immerhin 6,6% der Jugendlichen, die 18 Jahre und älter waren. Dagegen wirkt der Anteil der Kinder bis 12 Jahre mit 25% aller Neuaufnahmen eher ging[62]. Das liegt unter anderem daran, dass für Familien mit jüngeren Kindern vermehrt ambulante Hilfen gewährt werden, um eine drohende Herausnahme des Kindes zu vermeiden. Heimmitarbeiter kritisieren diesen Trend jedoch und fordern, dass Kinder früher im Heim untergebracht werden sollten. Ihrer Meinung nach sind die Verhaltensstörungen bei älteren Kindern nämlich schon so weit verfestigt, dass die Möglichkeiten von Heimerziehung äußerst begrenzt sind[63]. Wenn also immer mehr ältere und damit stärker problembelastete Kinder ins Heim kommen, wird es zukünftig erforderlich sein, die Angebote der Heimerziehung an diese Zielgruppe anzupassen.
In einer solchen Diskussion sollte allerdings die Funktion von ambulanten Hilfen beachtet werden, denn nicht immer werden diese als Alternative zu einer stationären Maßnahme installiert. Vielmehr können sie auch der Klärung der weiteren Perspektive eines Kindes dienen oder dazu beitragen, innerhalb der Familie die Bereitschaft für eine stationäre Erziehungsmaßnahme zu fördern[64]. Die negative Bewertung des Anstiegs von ambulanten Hilfen sollte deshalb kritisch hinterfragt werden.
Die von der Jugendhilfe beabsichtigte Verkürzung der Aufenthaltsdauer in Heimen ist dagegen erreicht worden. Die durchschnittliche Verweildauer in stationären Erziehungshilfen lag im Jahr 1994 noch bei 3 Jahren und 5 Monaten[65]. Dagegen verbrachten Kinder und Jugendliche im Jahr 1998 nur noch durchschnittlich 29 Monate im Heim. Bei ca. 37% dieser Kinder wurde die Maßnahme sogar schon innerhalb eines Jahres beendet[66]. Zu dieser Entwicklung haben sicherlich auch die regelmäßig stattfindenden Hilfeplangespräche beigetragen, muss doch die Notwendigkeit und Eignung einer Hilfe halbjährlich neu geprüft werden.
Aus Sicht der Jugendämter ist eine Heimunterbringung im Idealfall also eine zeitlich begrenzte Hilfe mit dem Ziel einer baldigen Rückkehr des Kindes in die eigene Familie. Ob dieser Trend zu kürzeren Heimaufenthalten jedoch wirklich einen Fortschritt bedeutet, wird nachfolgend kurz diskutiert.
2.5. Wirksamkeit von Heimerziehung
Die quantitative Entwicklung der stationären Hilfen weist darauf hin, dass Heimerziehung weiterhin eine wichtige Rolle in der Jugendhilfe spielt und auch in Zukunft notwendig sein wird. Alternativen, wie Pflegefamilien stehen nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung und eignen sich bei den meisten jungen Menschen aufgrund ihres Alters oder der Schwere der Verhaltensstörung nicht[67]. Hinzu kommt, dass Eltern einer Unterbringung ihres Kindes in einer Pflegefamilie seltener zustimmen[68].
[...]
[1] Zum vereinfachten Lesen verwende ich in dieser Ausarbeitung bei Personen ausschließlich die männliche Form, wobei natürlich immer beide Geschlechter gemeint sind.
[2] vgl. Conen, M.-L. 2002, S. 98
[3] vgl. §37 Abs. 1 SGB VIII
[4] vgl. Schulze-Krüdener, J. 2005, S. 20f.
[5] vgl. Conen, M.-L. 1990, S. 248
[6] vgl. Vonderbank, W. 2005, S. 382f.
[7] vgl. Conen, M.-L. 1992, S. 10
[8] vgl. Hamberger, M. 1998, S. 208 ff.
[9] Conen, M.-L. 1992, S. 20
[10] Da in der Praxis der Sozialen Arbeit die Bezeichnung „Kinder- und Jugendhilfegesetz“ (KJHG) gebräuchlich ist, werde ich im Text überwiegend diese Bezeichnung verwenden.
[11] „Lebensweltorientierung bedeutet konsequente Hinwendung zu und Orientierung an den Lebenslagen und Lebensverhältnissen sowie den Deutungsmustern der Adressatinnen und Adressaten. Sie sind Ausgangspunkt und Angelpunkt der Angebote und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe“ (BMFSFJ 2002a, S.63)
[12] vgl. Günder, R. 2007, S. 217
[13] vgl. §§28-35
[14] vgl. Art. 6 Abs. 2 GG
[15] Art. 6 Abs. 2 GG
[16] §27 Abs. 1 SGB VIII
[17] vgl. §41 Abs. 2
[18] Winkler, M. 2007, S.215
[19] Post, W. 1997, S. 69
[20] §34 SGB VIII
[21] vgl. Conen, M.-L. 2002, S. 14
[22] vgl. §5 SGB VIII
[23] vgl. §36 Abs. 2 SGB VIII
[24] Späth, K. 1992, S. 150
[25] vgl. Schleiffer, R. 2007, S. 115
[26] vgl. Grossmann, K./ Grossmann, K.E. 2006, S. 371ff.
[27] vgl. §1 Abs. 1 SGB VIII
[28] vgl. Schleiffer, R. 2007, S. 217f.
[29] Ebd., S. 198
[30] vgl. Teuber, K. 2003, S. 10
[31] vgl. Haug-Schnabel, G. 2003, S. 70
[32] vgl. §37 Abs. 1 SGB VIII
[33] vgl. §34 SGB VIII
[34] vgl. Günder, R. 2007, S.14
[35] vgl. Bürger, U. 2003, S.19
[36] vgl. Wolf, K. 1993, S. 12ff.
[37] vgl. Janze, N./ Pothmann, J. 2003, S. 101f.
[38] Ebd., S. 108
[39] vgl. Wolf, K. 1993, S. 12ff.
[40] §34 SGB VIII
[41] vgl. Wolf, K. 2003, S. 20f.
[42] vgl. Günder, R. 2007, S. 77
[43] vgl. Freigang, W. 2003a, S. 216ff.
[44] vgl. Günder, R. 2007, S.78
[45] vgl. Freigang, W. 2003a, S. 221f.
[46] Ebd., S. 222f.
[47] vgl. Wolf, K. 2003, S. 22f.
[48] vgl. Conen, M.-L. 1992, S.10
[49] vgl. Günder, R. 2007, S.79f.
[50] vgl. Wolf, K. 2003, S. 22
[51] Ebd., S. 23
[52] vgl. BMFSFJ 2002b, S. 448
[53] vgl. Wolf, K. 2003, S. 26
[54] vgl. Janze, N./Pothmann, J. 2003, S.113
[55] vgl. http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/ Sozialleistungen/KinderJugendhilfe/Tabellen/Content50/AusserhalbElternhaus,templateId= renderPrint.psml (18.11.2007)
[56] vgl. Bürger, U. 2003, S. 23
[57] Bürger, U. 2004, S. 27
[58] vgl. Bürger, U. 2004, S. 27
[59] vgl. Trede, W. 2003, S. 74
[60] Ebd., S. 74
[61] vgl. Bürger, U. 2004, S. 27
[62] vgl. Statistisches Bundesamt 2006
[63] vgl. Freigang, W. 2003b, S. 43
[64] vgl. Bürger, U. 1998, S. 292
[65] vgl. Hamberger, M. 1998, S. 222
[66] vgl. Statistisches Bundesamt 2000
[67] vgl. Schleiffer, R. 2007, S. 82
[68] Die Hintergründe dieser ablehnenden Haltung können hier nicht weiter thematisiert werden.
- Arbeit zitieren
- Annika Duderstadt (Autor:in), 2008, Die Erziehung im Kinderheim unter Einbezug der Eltern. Zur (problematischen) Kooperation zwischen Eltern und Erziehern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112257
Kostenlos Autor werden









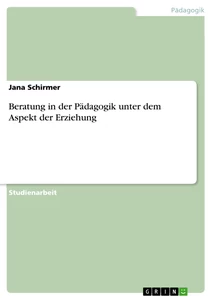





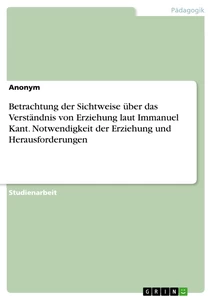




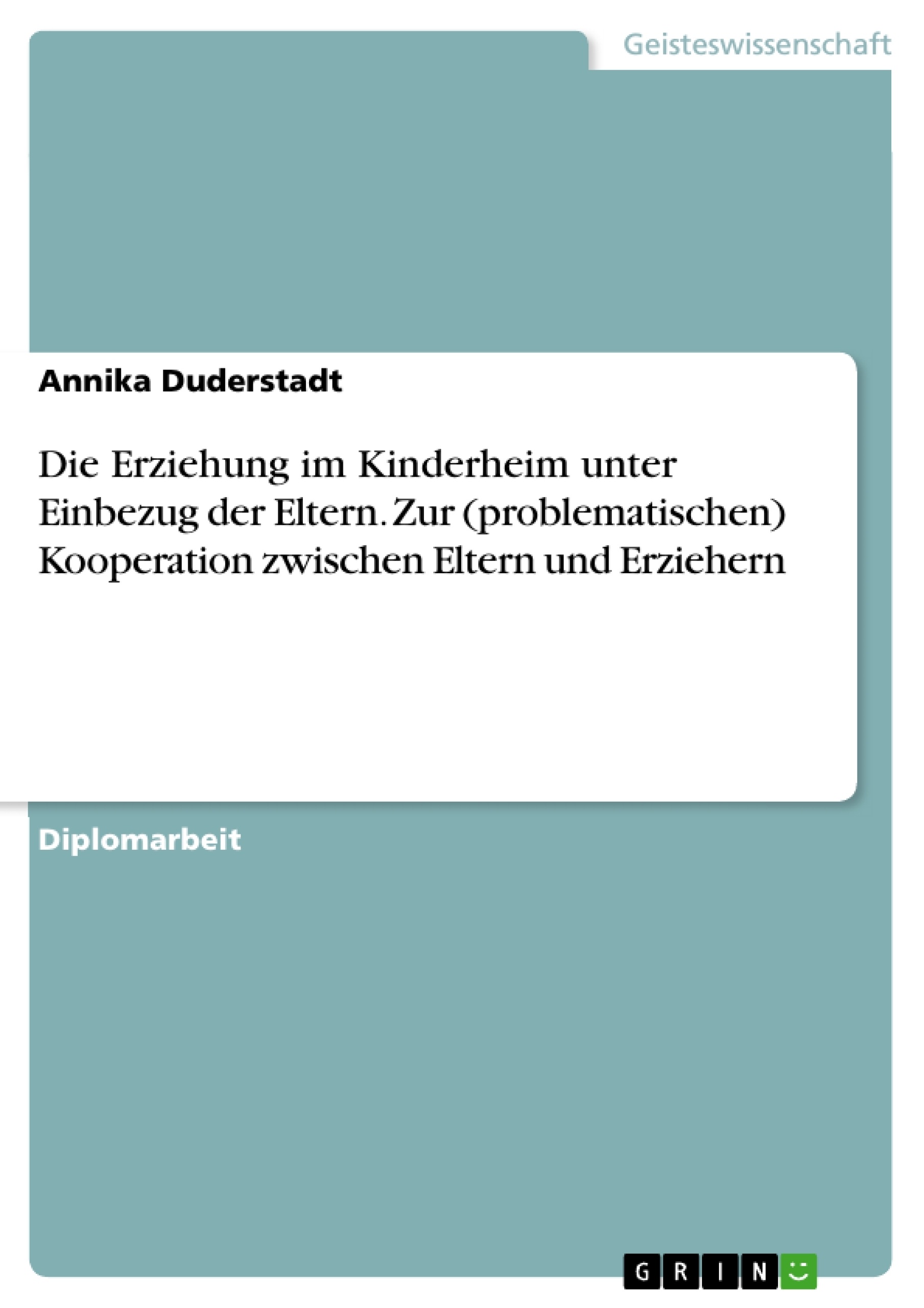

Kommentare