Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Entwicklung der Grundschule
2.1 Historischer Kurzabriss
2.2 Die „alte“ Schuleingangsstufe
3 Der Schulanfang
3.1 Die besondere Bedeutung des Schulanfangs
3.2 Kooperation am Schulanfang
3.3 Theoretische Betrachtungen zum Schulanfang – von der Schulreife zur Schulfähigkeit
3.3.1 Das Schulreifekonzept
3.3.2 Schulfähigkeit auf der Grundlage der Lerntheorie
3.3.3 Schulfähigkeit aus ökosystemischer Sicht
3.4 Veränderte Kindheit und die Auswirkungen auf einen kindgerechten Schulanfang
3.5 Gesetzliche Bestimmungen zum Schulanfang
3.5.1 Einschulungsalter, Zurückstellung und vorzeitige Einschulung
3.5.2 Die aktuelle Einschulungssituation in den Bundesländern
4 Die neue Schuleingangsstufe
4.1 Gründe für die Neugestaltung der Schuleingangsphase
4.2 Merkmale der neuen Schuleingangsphase
4.2.1 Einschulung aller Kinder in die neue Schuleingangsstufe mit jahrgangsübergreifenden Lerngruppen
4.2.1.1 Vorteile des jahrgangsübergreifenden Lehrens und Lernens
4.2.1.2 Differenzierung und Individualisierung des Unterrichts
4.2.1.3 Herausforderungen und Rahmenbedingungen beim jahrgangsübergreifenden Lernen
4.2.2 Flexible Verweildauer und halbjährige Einschulung
4.2.3 Kooperation und Förderdiagnostik
4.2.3.1 Zusammenarbeit mit dem Kindergarten
4.2.3.2 Förderdiagnostik und Zusammenarbeit mit Sozial- und Sonderpädagogen
4.2.3.3 Zusammenarbeit mit den Eltern
4.3 Stand der Neugestaltung der Schuleingangsphase in den Bundesländern
4.3.1 Schulversuche zur neuen Schuleingangsstufe
4.3.2 Wissenschaftliche Begleitung
4.3.3 Stand nach den Schulversuchen in den Bundesländern
4.4 Erfolge und Schwachstellen des neuen Schuleingangsstufenkonzepts
5 „Schulanfang auf neuen Wegen“– die veränderte Schul- eingangsphase in Baden-Württemberg
5.1 Ziele des Projekts „Schulanfang auf neuen Wegen“
5.2 Merkmale der neuen Schuleingangsphase
5.3 Modelle der neuen Schuleingangsphase
5.4 Phasen und Ergebnisse des Projekts „Schulanfang auf neuen Wegen“
5.5 Unterstützung der Modellschulen während des Projekts
5.6 Wissenschaftliche Begleitung des Modellversuchs
5.6.1 Aufgaben und Ziele der wissenschaftlichen Begleituntersuchung
5.6.2 Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleituntersuchung
5.7 Erfolge des Projekts „Schulanfang auf neuen Wegen“
5.8 Weiterführung und Umsetzung der neuen Schuleingangsstufe
6 Die neue Schuleingangsstufe – eine Möglichkeit für einen kindgerechten Schulanfang?
6.1 Die neue Schuleingangsstufe als Modell für einen kindgerechten Schulanfang
6.2 Notwendige Rahmenbedingungen für die Umsetzung des neuen Schuleingangs- stufenkonzepts
7 Resümee
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Der Schulanfang ist für jedes Kind ein besonderes Ereignis, denn mit dem Schuleintritt beginnt ein neuer und bedeutsamer Lebensabschnitt mit vielen Veränderungen, neuen Anforderungen und Herausforderungen sowie vielfältigen Erfahrungen und Erlebnissen. In dieser Zeit gewinnt das Kind seine ersten Eindrücke vom Leben und Lernen in der neuen Institution Schule. Es entstehen die persönlichen Einstellungen zur Schule und zum Lernen, welche die weitere Lernbiographie des Kindes und damit sein weiteres Leben prägen.
Seit der Gründung der Grundschule stellt die erfolgreiche Gestaltung des Schulanfangs ein besonderes Anliegen und zugleich eine Herausforderung für Bildungspolitik und Lehrer dar. Auf der Grundlage der jeweils vorherrschenden wissenschaftlichen Erkenntnisse und Theoriepräferenzen wurde versucht, den Kindern einen optimalen Schulanfang zu ermöglichen. Aufgrund zu hoher Zurückstellungsquoten und steigendem Einschulungsalter sowie einer zunehmenden Heterogenität unter den Schülern bezüglich ihrer Entwicklungs- und Lernvoraussetzungen bzw. Lebenslagen und –hintergründe wird seit Anfang der 90er Jahre versucht, durch eine Neustrukturierung der Schuleingangsphase den gewandelten gesellschaftlichen und bildungspolitischen Bedingungen gerecht zu werden und den Schulanfang für alle Kinder so erfolgreich wie möglich zu gestalten. In den einzelnen Bundesländern werden diesbezüglich verschiedene Modellversuche durchgeführt, denen das Konzept der „Neuen Schuleingangsstufe“ zugrunde liegt.
Im Rahmen meiner Arbeit möchte ich mich mit der Gestaltung eines kindgerechten Schulanfangs beschäftigen. In diesem Sinne werde ich das Konzept der neuen Schuleingangsstufe darlegen und beispielhaft den baden-württembergischen Modellversuch vorstellen, um am Ende nach der Eignung des neuen Schuleingangsstufenkonzepts für einen kindgerechten und erfolgreichen Schulanfang zu fragen.
Ausgehend von einem historischen Abriss über die Entwicklung der Grundschule seit ihrer Gründung werde ich in Kapitel zwei auf die bereits in den 70er Jahren angestrebte Reform der Schuleingangs- phase eingehen und einen Kurzüberblick über die „alte Schuleingangsstufe“ geben.
Das dritte Kapitel wird sich der besonderen Situation des Schulanfangs und der Einschulung widmen. Hier soll zuerst die besondere Bedeutung des Schulanfangs für die Kinder und die eines bruchlosen Übergangs vom Kindergarten zur Schule herausgestellt, aber auch auf die Wichtigkeit der Zusammen- arbeit beider Institutionen zum Schulanfang und deren Schwierigkeiten und Probleme verwiesen werden. Im weiteren Verlauf werden ich mich mit dem Thema „Schulfähigkeit“ beschäftigen und die drei Theorien vorstellen, die in den letzten Jahrzehnten die theoretische Diskussion um die Entwicklung von Schulfähigkeit in Deutschland maßgeblich bestimmten. Anhand der Darstellung von Aspekten veränderter Kindheit werde ich auf die sich verändernden Aufgaben der Grundschule
hinsichtlich eines kindgerechten Schulanfangs eingehen und zum Ende des Kapitels die gesetzlichen Bestimmungen zum Schulanfang sowie die aktuelle Einschulungssituation aufzeigen.
Im Rahmen des Kapitels vier werde ich das Konzept der neuen Schuleingangsstufe vorstellen. Nach der Begründung für die Neugestaltung der Schuleingangsphase werden ausführlich die einzelnen Konzeptbausteine mit ihren Intentionen, Inhalten und Vorzügen beschrieben. Danach werde ich einen Überblick über den derzeitigen Stand der Modellversuche zur Neugestaltung des Schulanfangs in den Bundesländern geben sowie Erfolge und Schwachstellen bei der Konzeptumsetzung aufzeigen.
Das Kapitel fünf widmet sich dem baden-württembergischen Modellprojekt „Schulanfang auf neuen Wegen“. Hier soll der bisher umfangreichste Modellversuch zur Neugestaltung des Schulanfangs vorgestellt werden. Neben den Zielen, den Merkmalen und der Umsetzung des Projekts werde ich auf die wissenschaftliche Begleituntersuchung und deren Ergebnisse eingehen sowie Erfolge des Modellversuchs herausstellen.
Im Mittelpunkt des sechsten Kapitels steht der kindgerechte Schulanfang. Durch die Zusammen- fassung wichtiger Aussagen und Ausführungen der vorherigen Kapitel zum Schulanfang und zum Konzept der neuen Schuleingangsstufe soll hier zum Abschluss der Arbeit der Frage nachgegangen werden, inwieweit die Umsetzung dieses Konzepts einen kindgerechten Schulanfang ermöglichen kann.
Die in dieser Arbeit vorkommenden Ausdrücke „neue Schuleingangsstufe“, „Schuleingangsphase“ oder „neue Eingangsstufe“ verwende ich synonym.
2 Die Entwicklung der Grundschule
2.1 Historischer Kurzabriss
Eine gemeinsame Grundschule für alle Kinder unabhängig von ihrem Sozialstatus und ihrer Begabung konnte erst nach dem 1. Weltkrieg in Deutschland realisiert werden. Auf der rechtlichen Grundlage der Weimarer Reichsverfassung von 1919 und des „Reichsgrundschulgesetzes“ von 1920 wurde die gemeinsame Grundschule für alle Kinder (mit Ausnahme behinderter Kinder) eingeführt. Ihre Aufgabe bestand darin, jedem Kind eine grundlegende Schulbildung zu vermitteln, die ihm grundsätzlich die Chance ermöglicht, eine weiterführende Schule zu besuchen.
Vor der Gründung der Grundschule war das Bildungswesen in Deutschland ständisch geprägt. Es existierte ein höheres und niederes Schulwesen. Soziale und regionale Herkunft sowie Geschlecht und Konfession bestimmten nachhaltig den Bildungserwerb der Kinder. Während das höhere Schulwesen eine zweckfreie Bildung und die Berechtigung zum Studium zum Ziel hatte, war das Ziel des niederen Schulwesens schlicht eine herrschaftskonforme Untertanenerziehung zu gewährleisten. Das Elementarschulwesen war ebenfalls von dieser ständischen Aufteilung betroffen. Es gab vor allem in
Preußen ab den 1830er Jahren an hö]heren und mittleren Lehranstalten gut ausgestattete Vorschulen, die von Kindern aus höheren Schichten besucht wurden, um dort auf den Besuch des Gymnasiums vorbereitet zu werden (Götz/Sandfuchs 2005, S.14). Im Gegensatz dazu waren die Anfangsklassen der Volksschule, in denen die Kinder ärmerer Eltern unterrichtet wurden, dafür nicht konzipiert. Der Besuch des Gymnasiums durch Schüler der Volksschule war zwar prinzipiell möglich, aber abhängig von einer Aufnahmeprüfung, dem Umfang freier Plätze sowie der Förderung und Unterstützung eines Lehrers (Sandfuchs 1998, S.4f.).
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts geriet die Vorschule des höheren Schulwesens immer mehr in die Kritik. Der Deutsche Lehrerverein prangerte sie als Standesschule des gehobenen Bürgertums an und warf ihr vor, die Förderung und den Ausbau der Volksschule zu behindern. Ab 1885 wurde die Forderung des Deutschen Lehrervereins nach einer Einheitsschule und damit der Anerkennung der Volksschule als allgemeine Grundschule für alle immer stärker. Es kam zu heftigen Auseinander- setzungen zwischen Befürwortern und Gegnern der Grundschule. Die Gegner kamen hauptsächlich aus den Reihen des höheren Schulwesens und führten u.a. als Argumente an, dass die gemeinsame Beschulung von Kindern aus geistig hochstehenden Schichten mit Kindern aus einfachem oder sogar ungepflegtem Milieu außerordentlich bedenklich sei. Überdies könne nicht aus zwei völlig verschiedenen Schulsystemen (höheres Schulwesen und Volksschule) mit unterschiedlichen Zielen (zweckfreie Bildung und Untertanenerziehung) eine Schule für alle konstruiert werden. (Götz/ Sandfuchs 2005, S.15). Für die Befürworter der Grundschule (z.B. der Deutsche Lehrerverein) waren es insbesondere soziale Gesichtspunkte, die für eine Einheitsschule sprachen. Die Anlagen und Fähig- keiten aller Kinder sollten entwickelt und gefördert sowie Chancengleichheit in Bezug auf höhere Bildung erreicht werden. Eine gemeinsame Grundbildung wurde präferiert. Ein weiteres Anliegen war, dass die Grundschule zu einer kinderfreundlichen Schule werden sollte, genau zum Gegenteil der bisherigen Pauk- und Drillschule (Knörzer/Grass/Schumacher 2007, S.17f.).
Nach dem Ende des 1. Weltkriegs und dem politischen Systemwechsel in Deutschland konnten, trotz heftiger Konflikte beim Entwurf des Gesetzes über Pflichtcharakter, Dauer und weltanschauliche Neutralität, auf der Grundlage der Weimarer Verfassung von 1919 und dem „Reichsgrundschulgesetz“ von 1920 endlich die gesetzlichen Grundlagen für eine gemeinsame Grundschule geschaffen werden. Entsprechend dem Artikel 146 der Weimarer Verfassung wird die einzuführende Grundschule zur Grundlage für das mittlere und höhere Schulwesen gemacht und stellt „ ... in struktureller Hinsicht eine Einheitsschule dar, mit deren für alle Kinder verpflichtenden Besuch eine egalitäre Ausgangslage für die Zuweisung zu weiterführenden Schulen geschaffen werden soll“ (Götz/ Sandfuchs 2005, S.17). Leistung und Begabung eines Schülers sollen von nun an über seinen Bildungsweg entscheiden und nicht mehr der soziale Status oder die Konfession.
Das große Grundschulgesetz (1920) untermauert im Folgenden den Alleinanspruch der Grundschule zur Ableistung der Schulpflicht. Die Grundschule wird institutionell der Volksschule zugeordnet und ihre Dauer auf vier Jahre festgelegt. Sie erhält die Aufgabe, eine grundlegende Bildung für alle zu
vermitteln, aber auch die erforderlichen Grundlagen für den Besuch von weiterführenden Schulen zu schaffen. Diese Doppelfunktion verkörpert eine Aufgabe, „ ... die das spannungs- und konfliktreiche Verhältnis von Gleichheit und Differenz, von Fördern und Auslesen einschließlich der gesamten Übergangsproblematik beinhaltet“ (Götz/Sandfuchs 2005, S.18) und die Grundschularbeit bis heute noch begleitet.
Die Schulreform umfasste aber nicht nur die äußere Form der Volksschule, auch die innere Gestaltung und das Verständnis von Schule veränderten sich. Die neue pädagogische Konzeption war in sehr hohem Maße durch die Reformpädagogik geprägt und fand ihren Niederschlag in neuen Grundschullehrplänen. Die Schule wollte nicht mehr nur eine Unterrichtsstätte sein, sondern auch ein Lebensraum für die Kinder. Das Gemeinschaftsprinzip erhielt eine große Bedeutung. Durch den Unterricht sollten alle kindlichen körperlichen und geistigen Fähigkeiten gefördert und der schulische Leistungsanspruch an den alterstypischen Entwicklungsstand angepasst werden. Bildungsinhalte sollten nicht nur angeeignet, sondern erlebt und selbstständig erworben werden. Die Weimarer Grundschule hatte den Anspruch, ein Ort grundlegender und kindgemäßer Bildung zu sein (vgl. Neuhaus-Siemon 1991, Knörzer/Grass/Schumacher 2007).
In den folgenden Jahren etablierte sich die Grundschule und wurde zu einer allgemein anerkannten Institution. Das ist vor allem auf die überzeugende pädagogische Arbeit der Grundschullehrer zurückzuführen und die Tatsache, dass sich wider Erwarten der Hoffnung der Befürworter der Grund- schule die soziale Zusammensetzung der Schüler in höheren Schulen nicht wesentlich veränderte (vgl. Neuhaus 1994). Die erhoffte Chancengleichheit konnte unter den damaligen Bedingungen der Grund- schule nicht verwirklicht werden.
In der Zeit des Nationalsozialismus wurden die vier ersten Jahrgänge der Grundschule zur obligatorischen Pflichtschule erklärt. In den „Richtlinien für Unterricht in den vier unteren Jahrgängen der Volksschule“ wurden 1937 reichseinheitliche curriculare Regelungen für die Grundschule festgelegt und verankert. Sie erhielt keinen eigenen Bildungsauftrag und wurde in den curricularen Gesamtzusammenhang der Volksschule eingeordnet. Der Grundschule „ ... bleibt die Vermittlung von grundlegenden Fertigkeiten und Kenntnissen als Aufgabe erhalten, der aber eine die individuelle Persönlichkeitsbildung negierende edukative Zielsetzung vorgeordnet wird“ (Götz/Sandfuchs 2005, S.22). Die pädagogische Arbeit setzte sich aus traditionellen Teilen der Weimarer Grundschule, z.B. dem Gesamtunterricht und spezifisch nationalsozialistischen Elementen, wie z.B. der Aufwertung körperlicher Ertüchtigung als schullaufbahnentscheidendes Auslesekriterium am Ende der Grund- schulzeit zusammen. Die gesamte Grundschulerziehung erfuhr eine zunehmende Ideologisierung (vgl. Götz/Sandfuchs 2005).
Nach dem 2. Weltkrieg waren sich die Siegermächte einig in ihrer Forderung nach einer demokratischen Schulreform. Nationalsozialistisches Gedankengut und Lehrpersonal wurden aus den Schulen entfernt. Ein gestuftes Schulsystem sollte aufgebaut werden, in dem Elementarbildung und
weiterführende Bildung zwei aufeinanderfolgende Schulabschnitte darstellen. Unentgeltlicher Unterricht und Chancengleichheit waren weitere Schwerpunkte der Reformbestrebungen. In diesem Zusammenhang wurde auch immer wieder die Verlängerung der Grundschulzeit zum zentralen Diskussionsthema. Leider kam aber in der Folgezeit im Rahmen des „Kalten Krieges“ die Einheitsschule unter Kommunismusverdacht und aufgrund der zurückhaltenden Politik der westlichen Besatzungsmächte diesbezüglich konnten konservative Kräfte und deren Interessen wieder erstarken. Angestrebte Reforminhalte wurden daraufhin teilweise zurückgenommen und das traditionell gegliederte Schulwesen mit der vierjährigen Grundschule in Westdeutschland wiederbelebt (Götz/ Sandfuchs 2005, S.23f.).
In beiden deutschen Staaten wurde die Grundschule für alle Kinder verpflichtend und verfassungsrechtlich garantiert, dennoch verlief ihre Entwicklung unterschiedlich.
In der DDR war sie geprägt von einer marxistisch-leninistischen Orientierung und der Zielsetzung, ein einheitliches Bildungssystem zu schaffen. Mit der Einführung der zehnklassigen Polytechnischen Oberschule 1959 wurden die Klassen 1 bis 3 zu deren Unterstufe und die Klasse 4 als Übergangsjahr zur Mittelstufe etabliert. Die Unterstufe war u.a. dadurch gekennzeichnet, dass fast alle Schulanfänger eine vorschulische Förderung im Kindergarten durchlaufen hatten. Der gesamte Unterricht wurde durch Lehrplanvorgaben und dem Einfluss schulpolitischer Führungsorgane bestimmt (Sandfuchs 1998, S.14f.).
Im westlichen Teil Deutschlands knüpfte die Grundschule an die pädagogische Konzeption der Weimarer Grundschule an. Im Mittelpunkt stand die Grundschule als Lebensstätte für die Kinder, in der eine ganzheitliche Bildung und Erziehung angestrebt wird. Die Grundschule wurde zum
„ ... Schonraum, in dem die Schulkinder beim Wachsen und Reifen Hilfe und Unterstützung finden“ (Sandfuchs 1998, S.12). Bis Mitte der sechziger Jahre wurde die Grundschule in Westdeutschland als die Schulform angesehen, in der nichts Entscheidendes mehr verbessert werden musste. Lediglich die Konsequenzen der Auslesepraxis bezüglich weiterführender Schulen wurden vom Deutschen Ausschuss kritisiert (vgl. Sandfuchs 1998).
In den sechziger und siebziger Jahren waren Kritik und Reform der Grundschule in West- deutschland Teil der Modernisierung von Schule und Gesellschaft.
Die Volksschule wird 1964 in Grund- und Hauptschule aufgegliedert. Dadurch wird die Grundschule zu einer eigenständigen Institution. Ab 1965 nehmen der Modernisierungsdruck im Bildungswesen und die Kritik an der Grundschule stetig zu. Die „ ... Kritik rüttelt am pädagogischen, organisatorischen, inhaltlichen und methodischen Selbstverständnis der Grundschule insgesamt und in allen Teilen und stellt alle traditionellen Auffassungen in Frage“ (Sandfuchs 1998, S.13).
Ein bedeutender Kritiker dieser Zeit war Erwin Schwartz. Er kritisierte die Grundschule als rückständig und reformbedürftig. Sie war konfessionell zersplittert, gewährleistete keine soziale Integration und keine Förderung von individueller Lernfähigkeit. Die Auslese für weiterführende Schulen stand im Vordergrund. Die Schulorganisation war undifferenziert und genügte nur einem
formalen Gleichheitsprinzip. Verschiedene Befunde wie die Untersuchungen zum Zusammenhang von Sozialschicht, Sprachniveau und Bildungschancen oder den Nachteilen des Gesamtunterrichts untermauerten diese Kritik (Götz/Sandfuchs 2005, S.25). Forschungsergebnisse zeigten, dass Kinder aus verschiedenen soziokulturellen Umwelten unterschiedliche Lernprozesse durchlaufen und somit unterschiedlich günstige Voraussetzungen für den Schulerfolg haben. Bereits zum Schulanfang ist die Schülerschaft bezüglich ihrer Lernvoraussetzungen durch starke Heterogenität gekennzeichnet. Unter den herrschenden Bedingungen der Grundschule konnte die angestrebte Chancengleichheit immer noch nicht verwirklicht werden. Schulleistungen waren in hohem Maße abhängig von sozio- ökonomischen und soziokulturellen Bedingungen im Elternhaus (Neuhaus-Siemon 1991, S.18).
Neben der Kritik an mangelnder Chancengleichheit beeinflussten weiterhin die sich wandelnden wissenschaftlichen Vorstellungen in der Entwicklungs-, Lern- und Begabungspsychologie grund- legend die Grundschule und ihre Arbeit und waren Anstoß für Reformbestrebungen. Begabung wurde nicht mehr vorrangig als genetisch vorgegebene statische Größe verstanden. Ausgegangen wurde jetzt von einem Begabungsprozess, in dem neben den Anlagen auch die Umweltbedingungen und Lernchancen in der Kindheit eine große Rolle für die Intelligenzentwicklung spielten (Knörzer/Grass/ Schumacher 2007, S.19f.).
Der Strukturplan des Deutschen Bildungsrats (1970) und die Empfehlungen der Kultusminister- konferenz (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister 1970) spiegeln deutlich die Reformbestrebungen dieser Zeit wider. Der Deutsche Bildungsrat schlägt im Rahmen seines Strukturplans für den Grundschulbereich die Einschulung nach dem vollendeten fünften Lebensjahr mit anschließender zweijähriger Eingangsstufe vor. Diese Eingangsstufe war u.a. durch eine stärkere Individualisierung und Differenzierung, Wissenschafts- und Lernzielorientierung der Curricula oder selbstständiges, kooperatives und entdeckendes Lernen gekennzeichnet. Die Kultusminister der Länder unterstützten diesen Vorschlag, denn ihr oberstes Ziel war die Förderung von Gleichheit der Bildungschancen und damit die Berücksichtigung der individuellen Lernvoraussetzungen eines jeden Schülers (Götz/Sandfuchs 2005, S.25).
Diese Neukonzeption des Schulanfangs wird in der Literatur (vgl. Götz 2004, 2005) auch als die „alte“ Schuleingangsstufe bezeichnet.
2.2 Die „alte“ Schuleingangsstufe
Im Rahmen der umfassenden Bildungsreform Ende der 60er Jahre in Westdeutschland sollte die Gestaltung der Schulanfangsphase erneuert und verbessert werden. Ziel dieser Reformbestrebung war es, den Übergang vom Kindergarten (als vorschulische Einrichtung) zur Grundschule so zu optimieren, dass jedem Kind ein erfolgreicher Start in Schulleben ermöglicht wurde (Götz 2005, S.82).
Als Gründe für die Neugestaltung des Schulanfangs sind zum einen die sich wandelnden pädagogisch- psychologischen Erkenntnisse bezüglich des Verlaufs und der Beeinflussbarkeit kindlicher Ent- wicklung zu nennen. Die bis dahin von „ ... der Psychologie und Pädagogik bevorzugte nativistische Begabungstheorie, die eine anlagebedingte Konstanz und Stabilität der menschlichen Intelligenz annahm, wurde durch die milieuorientierte Begabungstheorie abgelöst“ (Götz 2005, S.83). Kindliche Intelligenz wird als in den ersten Lebensjahren sehr flexibel und stark beeinflussbar sowie abhängig vom soziokulturellen Milieu betrachtet. Dem Vorschulkind wird daraus resultierend eine höhere Lernkapazität und –fähigkeit zugeschrieben, was der wissenschaftlichen Legitimation für die Neubewertung von Einschulungsalter und –standards und damit der Erneuerung der Schuleingangs- stufe diente. Damit wird die Zeit vor dem Schuleintritt sehr bedeutsam, da hier bereits wichtige Grundlagen für das spätere Lernen gelegt werden. Infolge dieser Erkenntnisse bekamen Vorschul- erziehung und Frühförderung einen großen Stellenwert. Zusammenarbeit und Austausch zwischen dem Elementar- und Grundschulbereich wurden zu wesentlichen Kriterien für die neukonzipierte Schuleingangsstufe und sollten Kontinuität zwischen den beiden Bildungsbereichen schaffen (vgl. Götz 2005).
Zum anderen lieferten gesellschaftspolitische Motive einen Anlass für die Neugestaltung des Schulanfangs. Durch empirische Untersuchungen wies die Sozialisationsforschung der damaligen Zeit darauf hin, dass die Schullaufbahn eines Kindes abhängig ist von seinem sozialen Herkunftsmilieu. Außerdem wurde belegt, dass höhere Bildungseinrichtungen zumeist nur von sehr wenigen Kindern aus dem Arbeitermilieu, vom Land oder von Mädchen besucht wurden. Die im europäischen Vergleich niedrige Abiturientenquote war ein weiteres Indiz für die Reformbedürftigkeit des deutschen Bildungssystems. Mit der angestrebten Bildungsreform sollte dieses Problem bewältigt sowie endlich Chancengleichheit verwirklicht und gewährleistet werden können. Für dieses Anliegen galt „ ... die Einrichtung der Schuleingangsstufe als eine besonders erfolgversprechende Maßnahme, weil mit ihr nicht erst im Verlauf, sondern bereits am Beginn der Schullaufbahn durch die soziale Herkunft bedingte Bildungsbarrieren abgebaut werden konnten“ (Götz 2004, S.256).
Aufgabe der „alten“ Schuleingangsstufe war es, eine Kontinuität des Bildungsgangs schulstrukturell abzusichern und „ ... eine zeitlich ausgedehnte Zone des Übergangs zwischen freiem Spiel und ziel- orientierter Arbeit, zwischen situativem vorschulischen und systematischem schulischen Lernen ...“ zu schaffen (Götz 2004, S.258). Damit sollte sie eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Schullaufbahn schaffen und einen harmonischen Übergang ermöglichen. Während der Zeit des Lernens in der Eingangsstufe sollen durch gezielte Förderung Unterschiede zwischen den Kindern minimiert oder abgebaut und Unzulänglichkeiten in den Lernvoraussetzungen, wie z.B. eine wenig ausgeprägte Lernmotivation oder unterentwickelte Sprachfähigkeit ausgeglichen werden. Die angestrebte Entwicklungs- und Leistungshomogenität der Lerngruppe sollte Chancengleichheit ermöglichen. Die Schulfähigkeit wird in der Eingangsstufe hergestellt, indem Lernbereitschaft und Lernfähigkeit gefördert und eine Diskontinuität in der Lernbiographie der Fünf- und Sechsjährigen verhindert wird.
Durch entsprechende kompensatorische Förderprogramme sollen herkunftsbedingte Bildungsnach- teile frühzeitig ausgeglichen werden (Götz 2004, S.258f.). Weitere Ziele, die durch die Neukonzeption erreicht werden können, waren z.B. einen weitgehend konfliktfreien Beginn des Lernens in der Schule ohne die übliche Auslese durch Schulreifetests oder eine den individuellen Voraussetzungen und Möglichkeiten angemessene Förderung zu ermöglichen (vgl. Horn 1991).
In der Eingangsstufe arbeiten Grundschullehrer und Sozialpädagogen (zumindest teilweise) in einem Zweipädagogensystem zusammen und ergänzen sich gegenseitig. Aufgrund der Wichtigkeit eines erfolgreichen Übergangs zwischen Elementar- und Primarbereich und der Herstellung von Kontinuität zwischen den Bildungsgängen sind die Zusammenarbeit des Personals der verschiedenen Bildungsbereiche sowie die Abstimmung und Angleichung von pädagogischen, didaktischen und curricularen Maßnahmen wesentliche Kriterien der Neugestaltung des Schulanfangs (Götz 2005, S.84f.).
Der Deutsche Bildungsrat und die Kultusministerkonferenz (KMK) konnten sich aber nicht auf ein einheitliches Strukturmodell für die Schuleingangsstufe einigen. Über die institutionelle Zuordnung der Fünfjährigen wie über die Dauer der Eingangsstufe herrschte Uneinigkeit. Beide Gremien konzipierten unterschiedliche Modellvarianten. Das Modell des Deutschen Bildungsrates und eine Modellvariante der KMK sahen eine zweijährige Eingangsstufe vor, in der die Fünf- und Sechs- jährigen ohne Alterstrennung zusammengefasst wurden. Diese Eingangsstufe war institutionell der Grundschule zugeordnet und bildete eine organisatorische wie pädagogische Einheit. Ihr folgte nach Vorstellung des Bildungsrates eine zweijährige Grundstufe, die KMK wollte eine dreijährige Grundstufe anschließen. Die zweite Modellvariante der KMK stellte der obligatorischen vierjährigen Grundschule eine einjährige Eingangsstufe voran, die von den Fünfjährigen besucht und als Vorklasse bezeichnet wurde (vgl. Götz 2004).
Über eine bundesweite Einführung der neukonzipierten Eingangsstufe wollte die Bildungspolitik erst nach einer praktischen Erprobung der einzelnen Modelle entscheiden. Zwischen 1971 und 1975 wurde dementsprechend eine Vielzahl von Modellversuchen durchgeführt. Das Ergebnis der wissen- schaftlichen Begleitung dieser Versuche war eine Fülle von Einzelbefunden, die aufgrund unter- schiedlicher Anlage, Ziele und Dauer aber nicht vergleichbar waren.
1976 zieht die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung aus den 46 Modellversuchen den Generalbefund, dass der Besuch einer vorschulischen Einrichtung mit entsprechender Förderung für die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit der Kinder wichtiger sei als die Art der jeweiligen Einrichtung (vgl. Bund-Länder-Kommission 1976). Einen eindeutigen Aufschluss und empirischen Nachweis darüber, ob die Einführung einer Schuleingangsstufe notwendig sei, konnte mit den Modellversuchen nicht erbracht werden. Auch über die organisatorische Zuordnung der Fünfjährigen zum Elementar- oder Primarbereich konnte die Auswertung keine eindeutigen Anhaltspunkte
erbringen. Die Erwartung, herkunftsbedingte Bildungsnachteile ausgleichen zu können, hatte sich unabhängig von den Modellvarianten nur im geringen Maße erfüllt (Götz 2004, S.259f.).
Auf der Grundlage dieser Ergebnisse kam es zu keiner Vorverlegung der Schulpflicht und die Betreuung der Fünfjährigen verblieb beim Kindergarten. Eine bundesweite Einführung der Eingangs- stufe fand nicht statt. Die Bund-Länder-Kommission (1976) resümierte, dass das angestrebte Ziel, eine Beständigkeit zwischen vorschulischer und schulischer Bildung zu schaffen, nicht verwirklicht werden konnte. In der Folgezeit wurde dieses Ziel schulstrukturell dann auch nicht mehr in Angriff genommen. Stattdessen kam es zu einer bildungsadministrativ verordneten Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule, die leider dazu führte, dass „ ... die Herstellung von Bildungs- kontinuität abhängig von regionalen sozialräumlichen Bedingungen wie vom Engagement und der Initiative der Grundschullehrerinnen und Erzieherinnen vor Ort ...“ wurde (Götz 2004, S.261).
Erst Anfang der 90er Jahre gerät aufgrund bildungspolitischer Interessen und gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse die Schulanfangsphase wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Im Zuge der Reformbestrebungen der vorherrschenden Einschulungspraxis wurden die Gedanken der alten Schuleingangsstufe wieder reaktiviert.
3 Der Schulanfang
3.1 Die besondere Bedeutung des Schulanfangs
„Die Einschulung stellt im Erleben des Kindes ein bedeutsames Ereignis und den Beginn eines neuen Lebensabschnittes mit neuem Erfahrungsraum dar“ (Walper/Ross 2001, S.30). Die Schule wird mit der Einschulung zum wesentlichen Bestandteil im Leben jedes Kindes. Zum Schulbeginn bringen die Kinder bereits ein relativ festes Welt- und Selbstbild sowie eine eigene Theorie des Lebens und Denkens mit, die ihr künftiges Lernen beeinflussen wird (vgl. Gardner 1993). Der größte Teil der Kinder freut sich auf die Schule und ist bereit, sich auf die neue Situation einzulassen. Die Schulanfänger werden in der Schule mit neuen Ereignissen und Situationen konfrontiert. Sie erleben neue Anforderungen in sozialer, kognitiver und motorischer Hinsicht und müssen sich in ein kompliziertes System von Schul- und Unterrichtsorganisation einfügen. Probleme und Schwierig- keiten bleiben mitunter nicht aus und es kann passieren, dass ein Kind seine anfängliche Lernfreude verliert und ein negatives Schulbild aufbaut. Aus diesem Grund dürfen Ursachen für Probleme und Krisen nicht einseitig bei den Kindern gesucht werden, denn sie entstehen meist aus der gegenseitigen Beziehung von kindlichen Voraussetzungen und schulischen Anforderungen (Schorch 2007, S.65).
Aus dem Blickwinkel des symbolischen Interaktionismus (vgl. Mead 1985) wird dieses kritische Lebensereignis als Identitätskrise verstanden. Bezogen auf den Schuleintritt „ ... bestünde die Identitätskrise dann darin, dass die bisherige gefundene Identität durch die neuen sozialen Erwartungen gestört und durch Veränderungen der bisherigen personalen Identität erst wieder ins
Gleichgewicht gebracht werden muss“ (Knörzer/Grass/ Schumacher 2007, S.172). Die neue Situation
„Schule“ ist mit den bisher gewohnten Handlungsabläufen der Kinder nicht mehr ausschließlich zu bewältigen und erfordert neue Handlungsmuster von ihnen. Die Bewältigung dieses neuen Lebensabschnitts stellt somit eine große Herausforderung für jedes Kind dar und ist für seine weitere Entwicklung bedeutsam. Das Erleben des Übergangs vom außerschulischen in den schulischen Bereich bleibt dem Kind lebenslang in Erinnerung und legt die Grundlage für seine folgende Schulkarriere.
Die neue Lebenssituation führt zu teils großen Veränderungen im Leben der Kinder und ihrer Familien, u.a. ändern sich das Raum- und Zeiterleben, die sozialen Beziehungen der Kinder oder die Verhaltensanforderungen und –verpflichtungen. So wird beispielsweise nach der Einschulung den meisten Kindern der Umgang mit der Zeit zum ersten Mal bewusst und erfahrbar gemacht. Die Zeiteinteilung in der Schule ist durch einen festen Rhythmus geprägt, welcher bestimmt, wann gelernt, gespielt, gegessen oder Pause gemacht wird. Für den Schulanfänger beginnt das Leben nach der Uhr. Die Kinder müssen lernen mit Zeit umzugehen. Weiterhin verändern sich in der Schule die sozialen Beziehungen zu den anderen Kindern. Ist die Kindergartengruppe altersheterogen zusammengesetzt, so wird in der Schule mit der Jahrgangsklasse Homogenität angestrebt. Alle Kinder gelten als „gleich“ in der Klasse und so sind Rivalitäten und Konkurrenz vorprogrammiert. Eine besondere Stellung in der Gruppe als „der Ältere“ oder ähnliches gibt es nicht mehr. Hinzu kommt, dass Erzieherinnen erfahrungsgemäß einen größeren Zeitrahmen als die Lehrerinnen zur Verfügung haben, um sich jedem Kind zu widmen. Das bedeutet, dass der Kampf um die Zuwendung der Lehrerin härter wird und die Enttäuschung umso größer ist, falls es nicht klappt (Knörzer/Grass/ Schumacher 2007, S.174f.).
Da jedes Kind verschieden ist, wird der Übergang auch unterschiedlich von ihnen erlebt und durchlebt. Jeder muss seinen eigenen Weg für die Übergangssituation und den neuen Erfahrungsraum Schule finden. Gelingt das dem Kind, so können u.a. Leistungsbereitschaft und Freude gestärkt, Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert werden. Sind die Anforderungen zu hoch, kann es schnell zu Misserfolg und krisenhaften Entwicklungen, wie z.B. Schulunlust oder aggressivem Verhalten kommen (Knörzer/Grass/Schumacher 2007, S.171f.). Der Schuleintritt wird letztendlich zu einem normativen und entscheidenden Lebensabschnitt. Das erfordert eine Gestaltung des Schulanfangs, die es dem Kind ermöglicht, die neuen Anforderungen in sein Welt-/Selbstbild und Handlungsrepertoire aufzunehmen und zu bewältigen. Die Kernaufgabe des Schulanfangs besteht darin, eine „ ... früh- zeitige „Verbildung der kindlichen Lernbereitschaft“ zu verhindern und die Vermittlung zwischen Kindsein und Schülersein in den Vordergrund zu stellen“ (Schorch 2007, S.65).
3.2 Kooperation am Schulanfang
Um den Kindern einen kindgerechten und vor allem bruchlosen Übergang vom Kindergarten in die Grundschule zu ermöglichen, ist u.a. eine gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen erforderlich. Probleme und Schwierigkeiten am Schulanfang und in den ersten beiden Schuljahren
können dadurch gemindert werden. Eine gute Zusammenarbeit ermöglicht ein besseres Kennenlernen und Eingehen auf die neuen Kinder sowie eine individuellere Förderung. Leider ist Kooperation beim Übergang zur Schule nicht selbstverständlich. Sie vollzieht sich oft nur im administrativ vorgegebenen Mindestrahmen. Schorch resümiert, „dieses Aufgabenfeld ist ein Musterbeispiel für die Abhängigkeit pädagogischen Handlungsbedarfs und pädagogischer Handlungsmöglichkeiten von institutionellen Rahmenbedingungen und bildungspolitischen Entscheidungen ...“ (2007, S.142).
Sucht man nach Gründen für diesen Missstand, so müssen neben geschichtlichen Entwicklungen auch aktuelle Probleme betrachtet werden. Geschichtlich gesehen haben sich Grundschule und Kinder- garten nach 1920 zu voneinander unabhängigen, eigenständigen Institutionen entwickelt und die Integration des Kindergartens in das Bildungssystem wurde versäumt. Abstimmung und Zusammen- arbeit fanden damals nur innerhalb administrativer Vorgaben statt. 1970 schlug der Deutsche Bildungsrat vor dem Hintergrund der Bildungsreform in seinem Strukturplan eine Neukonzeption des Schulanfangs mit einer eigenen Eingangsstufe vor. Mit dem Konzept der „alten“ Eingangsstufe (vgl. Kap.2.2) sollte u.a. auch eine Annäherung zwischen Kindergarten und Grundschule ermöglicht werden. Im Strukturplan heißt es, dass großer Wert darauf gelegt wird, „ ... dass der Übergang vom nichtschulischen zum schulischen Lernen in der Eingangsstufe als eine besondere pädagogische Aufgabe gesehen wird“ (Deutscher Bildungsrat 1970, S.22). Der Deutsche Bildungsrat missachtete aber mit seinem Vorhaben die historisch gewachsenen Strukturen. Er ordnete den Vorschulbereich einfach dem Bildungssystem zu und unterschätzte das Beharrungsvermögen dieser Strukturen erheblich. Der Elementarbereich leistete massiven Widerstand gegen das neue Konzept. Die vorgesehene Zuordnung der Fünfjährigen zum Grundschulbereich und damit die Beschränkung der Kindergartengruppen auf die Betreuung der Drei- bis Vierjährigen führte zum Streit und belastete die Beziehung zwischen beiden Institutionen lange Zeit. Erst gegen Ende der 70er Jahre entspannte sich die Situation, auch infolge der Nichtumsetzung des Eingangsstufenkonzepts. Man war sich wieder einig, dass nur durch Kooperation die Kontinuität der Lern- und Erziehungsprozesse gesichert werden konnte, um das Ziel eines möglichst bruchlosen Übergangs zur Schule zu gewährleisten (Horn 1991, S.79).
Aktuell möchte man den Problemen am Schulanfang durch eine organisatorische Koordination und Kooperation zwischen den benachbarten Einrichtungen und im Idealfall sogar deren Verflechtung begegnen (Hacker 1998, S.85). Leider hemmen oft noch Schwierigkeiten zwischen Lehrern und Erziehern im organisatorischen wie im persönlichen Bereich die mögliche Zusammenarbeit.
Nach Hacker (1998, S.87) gibt es drei Problembereiche, die einer guten Kooperation im Wege stehen:
-die Kompetenz der Beteiligten,
-Organisationsprobleme sowie
-Vorurteile und Statusfragen zwischen den Beteiligten.
Im Zusammenhang mit der Kompetenzfrage der Beteiligten geht es um das Wissen zum Sachverhalt und die Einschätzung der Bedeutung des Problems „Übergang“. Durch ein entsprechend umfassendes
Wissen wird die Bedeutung des Problems für die Betroffenen bewusster. Ein entsprechendes Angebot an Fortbildungsveranstaltungen und eine thematische Verankerung in der Erzieher- wie Lehrer- ausbildung sind diesbezüglich dringend notwendig. Auch im organisatorischen Bereich gibt es einige Dinge zu bemängeln. So sind u.a. die Einzugsgebiete von Kindergarten und Grundschule oft nicht deckungsgleich und führen zu unübersichtlichen Kooperationsstrukturen. Viele Schulen können nicht zeitig genug die Lehrer für die Anfangsklassen benennen. Oftmals unterrichten diese zuvor eine vierte Klasse und sind dementsprechend mit dem Übergang der Kinder in die weiterführenden Schulen beschäftigt. Für Hospitationen in den Kindergärten zum Kennenlernen der neuen Kinder bleibt dann nur noch wenig Zeit. Des Weiteren sind in den Köpfen der Beteiligten oftmals Vorurteile über die jeweilige andere Berufsgruppe angesiedelt. Es fehlt an Verständnis füreinander. „Unterschiedliche Ausbildungsgänge und Arbeitsbedingungen und das unterschiedliche Bild, das sich die Öffentlichkeit von den beiden Institutionen (...) macht, haben in den Köpfen der Betroffenen zu Unterschieden im Status, im Selbstverständnis und damit auch im Selbstbewußtsein geführt“ (Portmann 1988, S.148). Dem kann nur begegnet werden, wenn auf beiden Seiten die Bereitschaft wächst, sich offen und neugierig für die andere Seite zu zeigen und eine Kooperation bewusst angestrebt wird (vgl. Hacker 1998). Prinzipiell müsste das gelingen, da beide Seiten das gleiche Ziel haben, den Kindern einen kindgerechten Übergang vom Kindergarten zur Schule sowie eine optimale Förderung zu ermöglichen.
Grundsätzlich ist die Kooperation von Kindergarten und Grundschule in den einzelnen Bundesländern durch Empfehlungen und gesetzliche Richtlinien, zum Teil unterschiedlich geregelt. In Bremen ist die Zusammenarbeit gesetzlich festgeschrieben und Nordrhein-Westfalen schreibt regelmäßige Gesprächskreise vor. In den anderen Bundesländern wird das Thema Kooperation im Rahmen von Empfehlungen und entsprechenden Maßnahmen gehandhabt. Um eine bessere Kooperation zu ermöglichen und praktisch realisieren zu können, hat Berlin z.B. die Einzugsbereiche von Vor- und Grundschule vereinheitlicht und in Baden-Württemberg gibt es Beauftragte für Beratung und Förderung von Kooperation (Hacker 1998, S.86f.). Als Möglichkeiten der Zusammenarbeit werden in ministeriellen Empfehlungen u.a. gegenseitige Besuche zum Kennenlernen und gemeinsame Konferenzen oder die Einbeziehung der Erzieherin in Fragen der Schulfähigkeit sowie eine spiel- orientierte Gestaltung des Anfangsunterrichts genannt (Schorch 2007, S.145).
Eine optimale Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen kann auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. In der Schule und im Kindergarten können für die Schulanfänger direkte Aktionen und Aktivitäten angeboten werden, d.h. im Kindergarten werden u.a. Rollenspiele und Gespräche über den Schulanfang geführt und die Schule ermöglicht z.B. eine Besichtigung der Schule und deren Klassenräume, des Pausenhofs und der Turnhalle. Im Rahmen von Elternarbeit können beide Institutionen ebenfalls zusammenarbeiten. „Elternabende oder andere Informationsveranstaltungen dienen einer besseren Vorbereitung, der Beantwortung von Fragen und einer Aktualisierung der
Vorstellungen von Schule“ (van Risswick 2006, S.65). Eine weitere Kooperationsebene betrifft den Austausch von Informationen zwischen Lehrern und Erziehern. Hier sind gegenseitige Hospitationen oder gemeinsame Aktionen in Vorbereitung auf die Schule möglich. In gemeinsamen Konferenzen kann die Übergangsproblematik besprochen und Lösungen gefunden werden (van Risswick 2006, S.64f.).
Für die Umsetzung dieser Kooperationsmöglichkeiten sind bestimmte Rahmenbedingungen notwendig. So müssen Kindergarten und Schule ihre Kooperation ständig weiterentwickeln und sich gegenseitig über Organisationen und Konzepte informieren. Im weiteren Kontext gedacht, wäre ein gemeinsamer Ausbildungsort für Erzieher und Lehrer wie in anderen Ländern vorteilhaft (Knauf 2003, zit. nach van Risswick 2006, S.65).
Kritisch merkt Hacker (2001, S.82) an, dass es zwar eine Fülle von Erfahrungsberichten und Publikationen über diverse Kooperationsmöglichkeiten gibt, die eine Motivationsquelle für interessierte Nachahmer sind, dass diese aber keine Antwort auf die Frage liefern, inwieweit tatsächliche Aktivitäten in der Praxis stattfanden und ob diese halfen Übergangsprobleme abzubauen. Empirische Daten sind ebenfalls kaum vorhanden. Bei 8 - 10 % der Schüler gelingt die Einschulung immer noch nicht altersgemäß, das führen Gernand/ Hüttenberger (1989) u.a. darauf zurück, dass die kooperativen Übergangsaktivitäten nur sehr wenig nützlich sind. Zu häufig beschränken sie sich nur auf gegenseitige Besuche, gemeinsame Elternabende oder Patenschaften. Diese sind zwar wichtig, aber nicht in der Lage, die unterschiedliche Sozialtypik von Kindergarten und Grundschule aufzubrechen. Nur Aktivitäten, die wirklich gemeinsame Planung, Handlung und Reflexion zur Maxime der Kooperation machen, können Veränderungen bewirken (Gernand/ Hüttenberger 1989, zit. nach Hacker 2001, S.82).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zeit vor der Einschulung für den Schulanfänger bedeutsam ist, weil hier das Bild von Schule entsteht, welches ihn prägt und in der Eingewöhnungszeit begleitet. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule begünstigt diesen Prozess, denn „ um ein realistisches und gleichzeitig positives Bild von Schule entstehen zu lassen, muss das Kind vielfältige Informationen erhalten, und es muss ihm ein besonderes Angebot bereitgestellt werden“ (Hacker 1998, S.108). Positives oder negatives Erleben des Übergangs ist stark abhängig von den Handhabungen des Kindergartens und der Grundschule sowie von Lehrern, Erziehern und Eltern. „Nur eine enge Kooperation schafft in Kenntnis der konkreten Verhältnisse jene Voraussetzungen, die den Start ins Schulleben erleichtern“ (Hacker 1998, S.108).
3.3 Theoretische Betrachtungen zum Schulanfang – von der Schulreife zur Schulfähigkeit
In der Schulgeschichte wird der Schulanfangsproblematik noch nicht allzu lange Bedeutung zugemessen, denn die Problemzone Übergang stellt sich als ein Folgeproblem der gemeinsamen
Grundschule von 1920 dar. Vorher existierten niederes und höheres Schulwesen unabhängig voneinander und es gab kaum Auslese, Verteilungs- und Verzweigungsprobleme (Hacker 1998, S.17). Nach der Einführung der Weimarer Grundschule wurde Leistung statt sozialer Status zum ausschlag- gebenden Kriterium für Schulerfolg und den Besuch von weiterführenden Schulen. Es gab bereits ein beachtliches Leistungsprofil, dem auch damals ein Teil der Kinder nicht gerecht werden konnte. Da die Nachfrage nach höherer Bildung noch gering war, war das zunächst noch nicht problematisch. Die Grundschule war Teil einer homogenen Volksschule mit wenigen Übertrittsschülern.
Im Rahmen der sich entwickelnden Industriegesellschaft wurden im Bildungssystem immer mehr und höhere Anforderungen an die Schüler gestellt und die Nachfrage nach weiterführender Bildung wurde größer. Es rückten jetzt auch in der Grundschule Leistungsorientierung, Auslese sowie das Problem der Chancengerechtigkeit in den Vordergrund. Schwierigkeiten, die bereits am Schulanfang auftraten, wurden kritisch betrachtet und erforderten Lösungswege. Es entstanden Forderungen nach einem einheitlichen „Einstiegsniveau“ und der Schulfähigkeit des Kindes zum Schulanfang. Die Gestaltung des Schulanfangs und der Erwerb von Schulfähigkeit wurden für Wissenschaft und Öffentlichkeit immer bedeutender (vgl. Hacker 1998).
Wie ein Kind schulfähig wird und was Schulreife bzw. Schulfähigkeit ausmacht, wurde im Laufe der Zeit anhand verschiedener theoretischer Vorstellungen und Konzeptionen dargestellt und beschrieben. Im Folgenden werden die drei Theorien genauer vorgestellt, die in den letzten 55 Jahren in Deutschland die theoretische Diskussion um die Entwicklung von Schulfähigkeit maßgeblich bestimmten. Neben der Beschreibung der Konzepte wird auch auf die jeweilige Entwicklung der Schuleingangsdiagnostik eingegangen.
3.3.1 Das Schulreifekonzept
In den 50er Jahren wurde auf der Grundlage entwicklungspsychologischer Erkenntnisse und Theorien der Reifezustand eines Kindes als Hauptfaktor für den Schulerfolg angesehen. Übergangsprobleme wurden als Einschulungsprobleme betrachtet, die durch Schwierigkeiten am Schulanfang sichtbar wurden. Hauptvertreter des Schulreifekonzepts war der Heidelberger Professor Arthur Kern (1902- 1988). Er befasste sich mit der Schulsituation der damaligen Zeit (vgl. Kern 1958). In seinen Untersuchungen stellte er fest, dass verhältnismäßig viele Schüler keinen Schulabschluss erlangten und die Anzahl der „Sitzenbleiber“ beträchtlich war (1/3 der Schüler einer Schulklasse innerhalb der achtjährigen Schulzeit). Gerade in den ersten beiden Schuljahren war die Versagensquote sehr hoch. Die Hauptschuld am Versagen der Kinder trug seiner Auffassung nach die herrschende Einschulungs- praxis. Kern erklärte, dass die Kinder nicht aufgrund ihrer Begabung scheiterten, sondern weil ihnen die nötige Schulreife fehlt und resümiert, „ ... wenn wir mit der Einschulung eines Kindes warteten, bis es den geforderten Entwicklungspunkt erreicht hätte, dann wäre jedem Kind ein relativ leichtes und erfolgreiches Beschreiten und Durchschreiten der Schulbahn möglich“ (Kern 1958, S.67). Seiner Ansicht nach erlangt ein Kind seine Schulreife durch den biologischen Reifungsprozess von allein und
braucht keine Förderung. Grundlage dieser Auffassung ist das in den 50er Jahren dominierende entwicklungspsychologische Verständnis von Entwicklung, die durch endogene Reifeprozesse bestimmt wird und in einzelnen aufeinanderfolgenden Phasen oder Stufen erfolgt. Schulreife ist demnach das Resultat endogen gesteuerter Reifeprozesse. Aufgrund der Annahme einer gleich- schrittigen Kompetenzentwicklung des Kindes wurde von einem Entwicklungsmerkmal auf das andere geschlossen, z.B. von der körperlichen Reife auf die kognitive Reife (Kucharz 2001, S.70).
Ein Nachweis von Schulreife und damit des Entwicklungsstandes des Kindes waren für Kern die visuelle Gliederungsfähigkeit sowie bestimmte körperliche Merkmale (z.B. der Zahnwechsel, Gestaltwandel). Zur Feststellung von Schulreife entwickelte er eigens einen Test, der sich auf die zu erwartenden schulischen Anforderungen bezog, den Grundleistungstest (GLT). Im Mittelpunkt dieses Tests stand die visuelle Gliederungsfähigkeit als Kriterium für den gesamten Entwicklungsstand und als zentrale Grundleistung schulischer Anforderungen. Mit dem GLT wurden drei Bereiche unter- sucht: die Umweltgestaltung, die Auseinandersetzung mit komplizierten Gestalten sowie das Gebiet der Mengen und Zahlen (Hacker 1998, S.24). Für Kinder, denen aufgrund des Tests die erforderliche Reife noch fehlte, forderte Kern eine Zurückstellung vom Schulbesuch um 1 Jahr. Ziel war es, den Kindern Zeit zu geben, die nötige Reife zu erlangen, um dadurch Misserfolg, Schulschwierigkeiten und Versagen zu vermindern. Kerns Erkenntnisse und sein Grundleistungstest hatten einen großen Einfluss auf die Schuleingangsdiagnostik. Der GLT fand rasche und umfangreiche Verbreitung und diente lange Zeit dazu, die noch nicht schulreifen Kinder zu diagnostizieren und vom Schulbesuch zurückzustellen (Prengel 1999, S.67). In den 50er und 60er Jahren wurde er an 2,5 Millionen Kindern durchgeführt und war außerdem Modell für weitere Schulreifetests (van Risswick 2006, S.46f.). Kritisch ist im Hinblick auf den Grundleistungstest und alle folgenden Schulreifetests anzumerken, dass sie hauptsächlich kognitive Fähigkeiten erfassen und aufgrund einseitiger Leistungskriterien der Selektion dienen. Sie sind normorientiert und nehmen ein abstrakt erdachtes „Normalkind“ zum Maßstab. Bei einem schlechten Testergebnis können sie beim jeweiligen Kind zu einer negativen Leistungserwartung führen, die das Kind auf Dauer in seinem Selbstkonzept prägt (Burgener Woeffray 1996, S. 33f.). Schulreifetests können die Zahl der Schulversager außerdem nicht verringern und bieten viel Raum für Fehldiagnosen. Das heißt, Kinder können fälschlicher Weise als schulunreif diagnostiziert und von der Schule ferngehalten werden. Da die Entwicklung gerade im sechsten Lebensjahr sehr beachtliche Fortschritte macht, kann ein negatives Testergebnis ein paar Monate später widerlegt sein. Das Kind hat eventuelle Rückstände aufgeholt und kann die schulischen Anforderungen genau wie seine Mitschüler erfüllen (vgl. Krapp/Mandl 1977).
Die entwicklungspsychologischen Konzepte der damaligen Zeit sind heute überholt und durch neue Erkenntnisse widerlegt. Dennoch war Arthur Kern ein wichtiger Wegbereiter für die Schulanfangs- diskussion, denn „ ... zum ersten Mal wird der Schulanfang in seiner Besonderheit und Schlüssel- stellung für die Schullaufbahn herausgestellt und damit pädagogisch und bildungspolitisch mit
besonderer Aufmerksamkeit bedacht“ (Hacker 1998, S.25). Auf der Grundlage von Kerns Untersuchungsergebnissen und seinem Schulreifekonzept wurden bildungspolitische Entscheidungen getroffen. Das Einschulungsalter wurde zweimal (1955 und 1964) durch die Kultusministerien zeitweilig heraufgesetzt und die Schulpflicht auf das vollendete sechste Lebensjahr festgeschrieben. Ziel war es, dass möglichst alle Kinder am Schulanfang voll schulreif sind, um den neuen Anforderungen gerecht werden zu können. Die Zahl der „Sitzenbleiber“ und Schulversager sollte verringert werden. Der Entwicklungsstand des Kindes wurde somit zur wichtigen Orientierungsgröße im Hinblick auf die schulischen Anforderungen am Schulbeginn.
3.3.2 Schulfähigkeit auf der Grundlage der Lerntheorie
1962 konnten Kemmler und Heckhausen in ihren Untersuchungen nachweisen, dass die visuelle Gliederungsfähigkeit trainierbar war und damit eine Verbesserung durch Übung und Förderung möglich ist. Die als Schulreifekriterium angesehene Fähigkeit war demnach weder eine Persönlichkeitseigenschaft noch abhängig von einem Reifungsprozess. Die Untersuchungen konnten belegen, dass das Anregungspotenzial in den ersten 6 Wochen nach Schulbeginn so hoch war, dass sich die visuelle Gliederungsfähigkeit eines Schulanfängers enorm verbesserte (Topsch 2004, S.45). Die Lernumgebung war folglich entscheidend für die Schulfähigkeit eines Kindes.
Aufgrund dieser Erkenntnis über die Beeinflussbarkeit der visuellen Gliederungsfähigkeit durch Lernvorgänge sowie weiterer empirischer Untersuchungen war das Schulreifekonzept nicht mehr tragbar. In der Entwicklungspsychologie vollzog sich daraufhin in den 60er Jahren ein Paradigmen- wechsel und es setzte sich eine lerntheoretische Betrachtung von „Schulfähigkeit“ durch, die das Konzept der Schulreife ablöste. Lernvorgänge wurden als maßgebend für die Entwicklung des Kindes definiert und beim Erwerb von Schulfähigkeit betont (Kammermeyer 2001, S.98). Defizite sollten durch fördernde Lernprozesse ausgeglichen werden oder durch präventive Förderung gar nicht erst entstehen. Die schulorganisatorische Konsequenz daraus war, dass nicht-schulfähige Kinder gefördert und nicht vom Schulbesuch zurückgestellt werden sollten (Hacker 1998, S.74). Aufgrund der Tatsache, dass die Schule selbst durch ihre Lehrziele die Anforderungen festlegt, die an ein Kind gestellt werden, wenn es eingeschult wird, konnte die Schulfähigkeit von da an nicht mehr nur vom Kind abhängig gemacht werden. Bei der Feststellung von Schulfähigkeit müssen auch die Anforderungen und Anregungen der Schule einbezogen werden. Das führte zu einer Relativierung des Schulfähigkeitsbegriffes. Schulfähigkeit wurde nicht mehr als absolute Größe betrachtet (vgl. Kammermeyer 2000). Weigert/Weigert sehen in der Schulfähigkeit keinen genau definierbaren Entwicklungsstand, „ ... sondern das Zusammenwirken von persönlichen Voraussetzungen und Vor- erfahrungen mit den jeweiligen schulischen Bedingungen und Anforderungen“ (1997, S.22).
Aufgrund der Erkenntnis, dass zwischen den Kindern am Schulanfang bezüglich ihrer unter- schiedlichen Entwicklungsstände Ungleichheit herrscht, wurden die neuen Erkenntnisse über die Beeinflussbarkeit von Entwicklung durch Lernen zum Anlass genommen, geeignete Maßnahmen zu
ergreifen, um Gleichheit unter den Kindern am Schulanfang zu ermöglichen. Organisierte und gezielte Lernprozesse sollten in der Zeit vor dem Schulbeginn bereits die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schulstart aller Kinder schaffen und Schulfähigkeit herstellen. Im Verlauf der 60er Jahre führte das zu einer umfassenden Förderung der Vorschulerziehung und Frühförderung. Der Bereich vor dem Schulbeginn sollte schulvorbereitenden Charakter und Vorschulförderung einen didaktischen Rahmen sowie feste organisatorische und institutionelle Formen haben (vgl. Hacker 1998). Auch das Konzept der „alten“ Schuleingangsstufe hatte die Intention, Unterschiede zwischen den Kindern zu nivellieren und damit Gleichberechtigung, im Sinne einer Pädagogik der Gleichheit, herzustellen.
Nickel kritisierte diesbezüglich, dass zu Zeiten der Präferenz biogenetischer Entwicklungsmodelle die Chancen einer pädagogisch-psychologischen Entwicklungsförderung unterschätzt wurden, nun aber die Gefahr einer Überbewertung, speziell der kognitiven Frühförderung bestand und nichtkognitive Aspekte wie, z.B. Sozialverhalten oder Motivation, bei der Beurteilung von Schulfähigkeit ausgeklammert wurden (Nickel 1991, S.90).
Aufgrund der neuen lerntheoretischen Betrachtung von Schulfähigkeit veränderte sich die Ein- schulungsdiagnostik ebenfalls. „Ausgangspunkt und Ziel der diagnostischen Erhebung sind nicht mehr lediglich die Fähigkeiten, über die ein Kind verfügt oder nicht, sondern der bis dahin ausgebildete Entwicklungs- und Fähigkeitsstand eines Kindes im Hinblick auf die Lernziele, die die Schule festlegt und die das Kind zu erfüllen hat“ (Burgener Woeffray 1996, S.41). Diesbezügliche Verfahren werden in der Literatur unter dem Begriff „Pädagogische Diagnostik“ zusammengefasst. Inhaltlich beziehen sie sich auf die Erfassung von schulischen Lernvoraussetzungen, Lernprozessen, Lernergebnissen sowie Lernumwelten (vgl. Schwarzer 1979). Neben den obligatorischen kognitiven Fähigkeiten werden jetzt auch nicht-kognitive berücksichtigt. Die Tests erbringen Informationen über die Veränderungen durch Lernen und Bedingungen für das Lernen. Anstatt der Selektion von nicht schulreifen Kindern ist jetzt Modifikation das Ziel. Der entwicklungspsychologische Stand der Kinder soll ermittelt und deren bestmögliche Förderung daraus erschlossen werden (van Risswick 2006, S.49). Der Wechsel der Bezugsnorm ist ein Hauptkriterium dieser Diagnostik. Die Leistungen der Kinder werden nicht mehr in Beziehung gesetzt zu den Leistungen der Kinder ihrer Gruppe, sondern zu einem Lerngegenstand (Schwarzer 1979, S.46). Damit konnte die Schulfähigkeitsdiagnostik der neuen Ansicht gerecht werden, dass Schulfähigkeit nicht nur vom Kind abhängt, sondern auch von den Anforderungen der Schule selbst (van Risswick 2006, S.49).
3.3.3 Schulfähigkeit aus ökosystemischer Sicht
In den 80er Jahren entwickelte und modifizierte insbesondere Nickel eine bis heute anerkannte Sichtweise von Schulfähigkeit. Er betrachtet den Schulanfang aus ökosystemischer Sicht und bezeichnet Schulfähigkeit als interaktionistisches Konstrukt (Kammermeyer 2001, S.99). Während in reifungs- und lerntheoretischen Konzepten Maßnahmen zur Feststellung und Beschreibung von Schulreife bzw. Schulfähigkeit hauptsächlich individuumzentriert sind, richtet sich bei der öko-
systemischen Sichtweise auf Schulfähigkeit die Aufmerksamkeit nicht nur auf den Schulanfänger und die Schule, sondern auch auf die gesamte Umwelt des Kindes. Da beim Übertritt vom Kindergarten zur Schule das Kind einen wichtigen Teil seiner Umwelt wechselt, um sich neuen Anforderungen zu stellen, die fremdbestimmt, verbindlich und unausweichlich sind, muss bei der Betrachtung von Schulfähigkeit immer die gesamte Umwelt des Kindes und die sich daraus ergebenden Wechsel- wirkungen berücksichtigt werden. „Schulfähig zu sein, hängt von nun an nicht nur von genetischen Anlagen und dem körperlichen Entwicklungsstand ab, sondern zum größten Teil von der Anregungs- umgebung (Milieu) der sozialen und kulturellen Umwelt des Kindes“ (van Risswick 2006, S.51).
In seinem ökosystemischen Schulreifemodell benennt Nickel (1988, S.48) vier Teilsysteme, die für die umfassende Betrachtung von Schulreife wichtig sind und die sich gegenseitig beeinflussen.
Diese vier Teilsysteme sind:
-die Schule, mit ihren spezifischen Strukturen, Anforderungen und Lernbedingungen,
-der Schüler, mit seinen individuellen Lernvoraussetzungen in körperlicher und psychischer Hinsicht,
-die Ökologie, im Sinne der schulischen, vorschulischen und häuslichen Umwelt und
-die gesamtgesellschaftliche Situation, als vorgegebene Rahmenbedingung des Gesamtsystems.
Aus den wechselseitigen Beziehungen dieser Komponenten kann Schulreife erschlossen werden. Sie ist das Resultat der Interaktion zwischen Schüler, Schule und Ökologie vor dem jeweiligen gesamtgesellschaftlichen Hintergrund, mit seinen allgemein anerkannten Ziel- und Wertvorstellungen sowie den sozialen und ökonomischen Strukturen (Nickel 1991, S.92).
Zu beachten ist, dass Nickel in seinem Ansatz auf den „alten“ Begriff der Schulreife zurückgreift, ihn aber mit seinem Ansatz neu definiert. Der Begriff Schulreife im ökosystemischen Ansatz ist demnach nicht mit dem der reifungstheoretischen Konzepte gleichzusetzen. Kammermeyer kritisiert diesen verwirrenden Gebrauch und fordert auf, weiterhin den Begriff Schulfähigkeit zu verwenden, wenn es nicht um reifungstheoretische Vorstellungen geht (2001, S.101).
Als Begründung für sein ökosystemisches Schulreifemodell führt Nickel verschiedene Befunde an. Er beschreibt u.a., dass Schüler, die in traditionellen Tests gleiche Punktwerte erzielt haben, in verschiedenen Schulen oder sogar Parallelklassen unterschiedliche Leistungen erbrachten. Verant- wortlich für diese variierenden Erfolgschancen der Schüler macht er die unterschiedlichen Anforderungsniveaus der Schulen, die Qualität des Anfangsunterrichts und den Verhaltensstil des Lehrers. Die schulischen Anforderungen können von Bundesland zu Bundesland, von Schule zu Schule, ja sogar von Klasse zu Klasse erheblich variieren, was sich z.B. an der ungleichen Zahl von Zurückstellungen oder Klassenwiederholungen zeigt. Nickel erklärt, dass es durchaus möglich ist, ohne das Konstrukt der Schulreife auszukommen. Seiner Ansicht nach sind Schulen, die z.B. nach dem Montessori-Konzept arbeiten dafür ein gutes Beispiel. Durch ihren stark individualisierenden
Unterricht, der sich den Voraussetzungen des einzelnen Schülers anpasst, wird eine Feststellung von Schulreife unnötig (vgl. Nickel 1988).
Im Rahmen einer ökosystemischen Perspektive auf Schulfähigkeit muss sich auch die Ein- schulungsdiagnostik ändern, sie sieht sich komplexeren und anspruchsvolleren Anforderungen gegenüber. Die Einschulungsdiagnostik kann Entwicklung nicht mehr eindimensional betrachten, sondern muss Informationen aus verschiedenen Verfahren (z.B. Beobachtung, Anamnese) und allen Teilsystemen involvieren (Kammermeyer 2000, S.25). In diesem Sinne müssen sich Lehrer und Schule ständig mit ihrem Unterricht und ihrer Vorgehensweise auseinandersetzen, um den individuellen und wechselnden Lernbedingungen und –voraussetzungen eines jeden Schülers gerecht werden zu können. Ziel der Einschulungsdiagnostik ist es, „ ... dem Lehrer angemessene Entscheidungshilfen für den Einsatz differenzierender Unterrichtsmaßnahmen im Sinne einer Förder- diagnostik zu liefern“ (Nickel 1991, S.95).
Ein Einschulungsverfahren, was den Forderungen der ökosystemischen Betrachtungsweise von Schul- fähigkeit weitgehend entspricht, ist das „Kieler Einschulungsverfahren“ von Fröse, Mölders und Wallrodt (1986). Es ist Mitte der 80er Jahre erschienen, aber immer noch das neueste formelle Verfahren in der Schuleingangsdiagnostik. Das „Kieler Einschulungsverfahren“ ist kein Test im Sinne eines Schulreifetests, sondern ein Verfahren, in dessen Mittelpunkt die Wünsche von Praktikern an ein Einschulungsverfahren stehen. Klassische Gütekriterien spielen keine Rolle. In der Praxis erfreut es sich großer Akzeptanz. Es dient keinem selektiven Zweck, denn durch das Verfahren sollen Informationen für den Anfangsunterricht gewonnen werden. Dem Konzept liegt eine umfassende Sicht der Persönlichkeit des Kindes zugrunde. Neben kognitiven Aspekten werden weitere wichtige Kompetenzen, wie z.B. Sprache, phonologisches Bewusstsein oder Leistungsmotivation erfasst. Das Verfahren besteht aus vier Bausteinen, dem Elterngespräch, dem Unterrichtsspiel (Lehrer arbeitet mit einer Gruppe von Kindern an verschiedenen Aufgaben und eine zweite Lehrkraft fungiert als Beobachter), einem Gespräch mit der Erzieherin der Kindergartengruppe und bei Bedarf einer Einzel- untersuchung. Durch den gestuften Aufbau des Verfahrens ist für die meisten Kinder nur der erste Teil, das Elterngespräch relevant. Erst in Zweifelsfällen kommen die anderen Teile des Verfahrens zur Anwendung. Das Kieler Einschulungsverfahren ist so gestaltet, dass es einen positiven Eindruck von Schule beim Kind hinterlässt und keinen Prüfungsdruck vermittelt. Neu ist an diesem Konzept, dass die pädagogische und psychologisch-prognostische Kompetenz des Lehrers mit einbezogen wird. Der Lehrer schließt aus der Vielfalt der Informationen unter Berücksichtigung schulischer Bedingungen und der häuslichen Situation auf die Schulfähigkeit des Kindes. Allerdings ist das auch der größte Kritikpunkt am Verfahren, die Abhängigkeit der Einschulungsentscheidungen von subjektiven Sichtweisen der beteiligten Lehrkräfte und damit das Fehlen der klassischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität (Kammermeyer 2001, S.121f., Knörzer/Grass/Schumacher 2007, S.129f.).
Heute wird Schulfähigkeit als von vielfältigen Faktoren abhängig betrachtet und nicht mehr als Hürde für die Einschulung verstanden. Sie wird nicht mehr einseitig am Kind festgemacht, sondern entwickelt sich aufgrund von Anregungen aus Familie und Kindergarten sowie den Anforderungen und Bedingungen im ersten Schuljahr. Das Erreichen von Schulfähigkeit beschreibt Kammermeyer als eine gemeinsame Aufgabe aller an der Erziehung des Kindes Beteiligten (2004, S.57).
3.4. Veränderte Kindheit und die Auswirkungen auf einen kindgerechten Schulanfang
In den letzten drei bis vier Jahrzehnten haben sich enorme gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen vollzogen. Diese Veränderungen aufgrund von gesellschaftlichen Individualisierungs- und Pluralisierungstendenzen haben sich auf fast alle Lebensräume der Kinder ausgewirkt. Das, was die Gesellschaft als Maßstäbe für die Kinder und das Leben der Kinder festlegt sowie das, was die Kinder durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen beeinflusst, ist immer wieder einem Wechsel von Veränderungen unterworfen (van Risswick 2006, S.31). In der Kindheits- und Sozialisationsforschung wird daher auch von einer veränderten Kindheit gesprochen.
In nahezu allen Lebensbereichen der Kinder herrscht eine Vielfalt und Unterschiedlichkeit von möglichen Lebensformen. Diese Vielfalt an denkbaren Lebensumständen, z.B. in Familienformen und Schulverhältnissen, in der Wohnumwelt, in der Freundschaft zu Gleichaltrigen, in der Freizeit und Nutzung der Medien, in räumlichen und zeitlichen Strukturen des Alltags sowie in den Ausprägungen ethnischer und kultureller Lebenseinstellungen führt zu einer großen Heterogenität unter den Schülern (Faust-Siehl 1996, S.17f.). Für den Lehrer in der Anfangsklasse ist es in dieser Hinsicht sehr wichtig, diese vielfältigen Erfahrungs- und Lebenshintergründe zu berücksichtigen, um die Schüler zu verstehen und ihnen gerecht werden zu können.
Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, werde ich beispielhaft auf die Veränderungen in den Bereichen Familie und Medien eingehen, um die veränderten Lebensbedingungen der Kinder zu verdeutlichen. Weitere Lebensbereiche der Kinder, die durch die gesellschaftlichen Veränderungen betroffen sind und damit Auswirkungen auf den Schulanfang bzw. die Arbeit der Grundschule haben, sind u.a. das Spiel- und Freizeitverhalten, die Umwelt der Kinder oder das Leben in einer multi- kulturellen Gesellschaft (vgl. Krause-Hotopp 2003, van Risswick 2006, Schorch 2007).
[...]
- Arbeit zitieren
- M.A. Claudia Lippert (Autor:in), 2008, Die Neugestaltung der Schuleingangsphase als Möglichkeit für einen kindgerechten Schulanfang, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111987
Kostenlos Autor werden















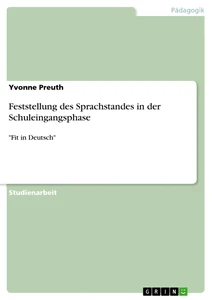




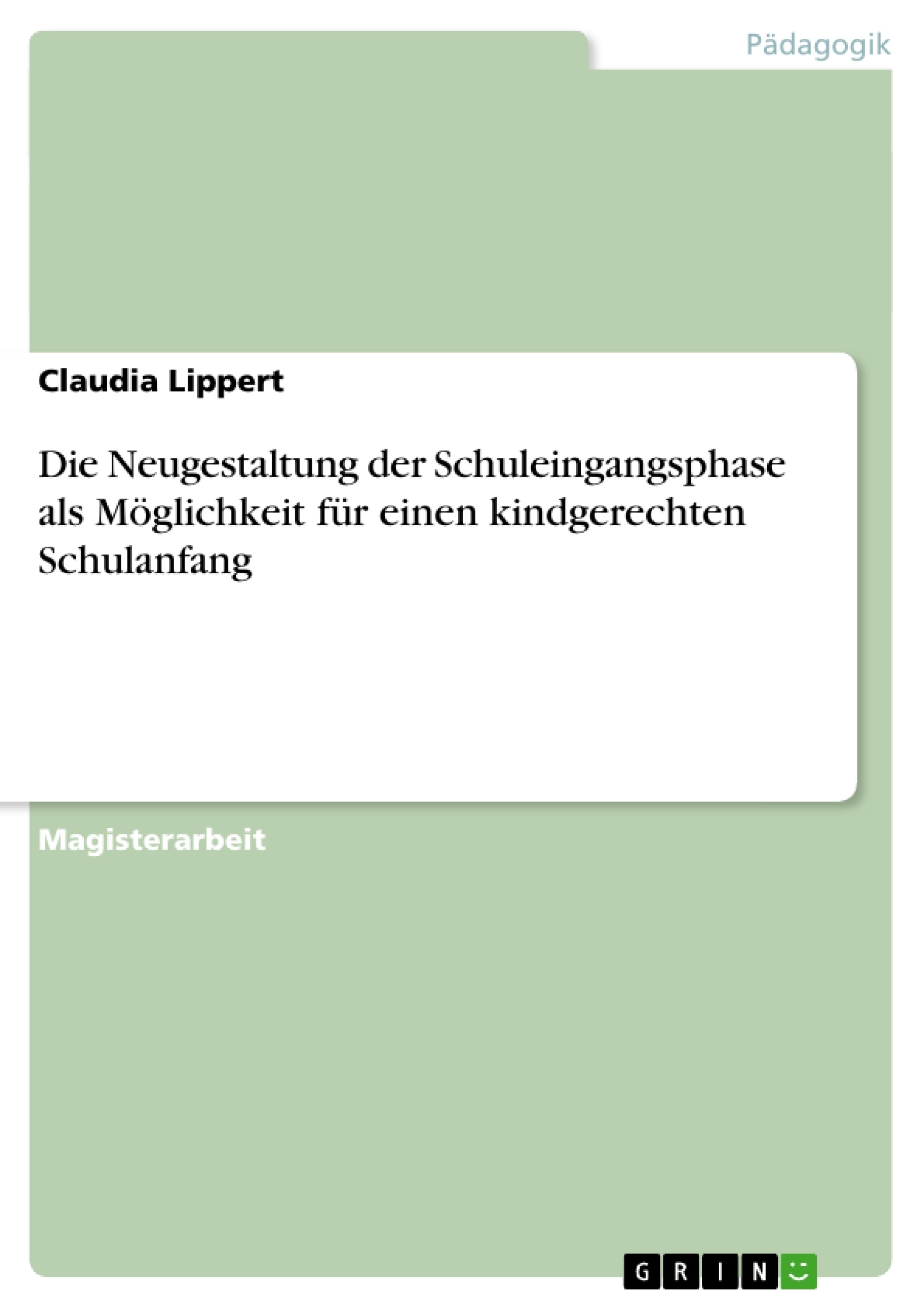

Kommentare