Leseprobe
INHALT
1 Einleitung
1.1 Thema und Fragestellung
1.2 Stand der Forschung
2 Theorie und Begriffsdefinitionen
2.1 Was ist Sozialisation?
2.1.1 Dimensionen der Sozialisation
2.1.2 Phasen des Sozialisationsprozesses
2.1.3 Sozialisationstheorien
2.2 Sozialisation im Kulturvergleich
2.2.1 Kulturbegriff
2.2.2 Enkulturation und Akkulturation
2.2.3 Individualismus vs. Kollektivismus
2.3 Familie als wichtigste Sozialisationsinstanz
2.4 Erziehung als Unterbegriff von Sozialisation
2.4.1 Erziehungsziele
2.4.2 Erziehungsstile
2.5 Bedeutung der Sprache im Sozialisationsprozess
3 Situation der Russlanddeutschen in der ehemaligen Sowjetunion
3.1 Die Geschichte der Russlanddeutschen in Russland/Sowjetunion
3.2 Entscheidung und Motive der Ausreise aus der ehemaligen Sowjetunion .
3.3 Erziehung im Herkunftsland und mit gebrachte Sozialisation
3.3.1 Familienpolitik in der Sowjetunion
3.3.2 Struktur der Familie und geschlechtsspezifische Erziehung
3.3.3 Frauenzentriertheit in der Familie
3.3.4 Die Theorie der Kollektiverziehung nach Makarenko
3.3.5 Erziehung in den öffentlichen Institutionen
4 Situation der Aussiedler in Deutschland
4.1 Definition der Begriffe Aussiedler und Spätaussiedler
4.2 Zuwanderungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland
4.3 Integrationsbegriff und Phasen des Migrationprozesses
4.4 Die Bedeutung der Familie im Integrationsprozess
4.5 Neuorientierungen der Eltern in Bezug auf die Erziehung ihrer Kindern .
4.5.1 Erziehungseinstellung der Aussiedlerinnen in Deutschland
4.5.2 Neue Rahmenbedingungen der Vaterschaft
4.5.3 Kindergarten und Schule
5 Zusammenfassung
6 Literaturverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung
Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten Schriften entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht.
Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch an keiner anderen Prüfungsbehörde Vorgelegen.
Aachen, den 10. September 2007 (Lilli Petel)
Abbildungeverzeichnis
2.1 Unterschiedlicher Erziehungsstile
3.1 Im Herkunftsland Wichtiges (Mehrfachnennungen in % der Befragten) .
3.2 Grundstruktur des Bildungswesens in der ehemaligen UdSSR bzw. in GUS
4.1 Zuzug von Aussiedlern in die BRD nach Herkunftsländern
4.2 Altersstruktur der Aussiedler und der Gesamtbevölkerung in %
4.3 Phasen des Migrationsprozesses nach Eisenstadt
4.4 Familiensprache der Jugendlichen Aussiedler, in %
Tabellenverzeichnis
2.1 Phasen des Sozialisationsprozesses
2.2 Sozialisationsakzente in kollektivistischen und individualistischen Kulturen
3.1 Deutsche in der UdSSR: Verteilung nach Republiken
3.2 Mitwirkung der jugendlichen Aussiedler bei der Ausreise
3.3 Die Gründe für die Migration (Mehrfachantworten)
4.1 Aussiedlerstatistik seit 1950
4.2 Daten über die Bevölkerung Deutschlands und über die Aussiedler
1 Einleitung
1.1 Thema und Fragestellung
Die vorliegende Magisterarbeit beschäftigt sich mit dem Thema “Sozialisation und Erziehung in Aussiedlerfamilien aus der ehemaligen Sowjetunion”. Seit den fünfziger Jahren ist Deutschland zu einem Einwanderungsland geworden. Zunächst waren die Aussiedler neben Arbeitsemigranten, Flüchtlingen und Asylanten nur ein Teil der Migrationbewegung. Ihre Integration in die deutsche Gesellschaft verlief bis Ende der achtziger Jahre unauffällig und galt als unproblematisch. Durch die politische Entwicklung in der Sowjetunion (Perestroika und Glasnost) ist die Zahl der Aussiedler aus der ehemaligen UdSSR seit 1989 stark angestiegen und erreichte in den neunziger Jahren ihren Höhepunkt. Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit Aussiedlerfamilien in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt, die aus der vormaligen Sowjetunion zu Beginn der neunziger Jahre in die Bundesrepublik eingereist sind. Die andere Aussiedlergruppen werden hier nicht weiter betrachtet.
In Deutschland haben Aussiedler aufgrund ihrer Geschichte als angehörige der deutschen Minderheit in der ehemaligen Sowjetunion das Anrecht auf die deutsche Staatsangehörigkeit und haben nach dem Gesetz der Bundesrepublik ein Recht darauf in Deutschland zu leben. Somit erhalten Aussiedler bzw. Spätaussiedler “einen Sonderstatus unter den Einwanderern” (Ingenhorst 1997: 10). Dennoch werden sie von einheimischen Deutschen häufig nicht als “Deutsche” angenommen, sonder als Fremde bzw. als “Russen”, sich selber nennen viele Aussiedler als “Russlanddeutsche”. Um demnach die Begriffsunklarheit zu vermeiden wird im folgenden Verlauf dieser zu untersuchenden Gruppe auch als “Russlanddeutsche” bezeichnet.
In der vorzunehmenden Arbeit sollen Einblicke in das Leben der Russlanddeutschen gegeben werden. Dabei wird nicht nur der Aufenthalt in Deutschland, sondern es werden auch ihre Lebenssituation und die Sozialisationsbedingungen im Herkunftsland untersucht. Auf diese Thematik wird im Kapitel 3 eingegangen. 1 Vor allem ist hier die Frage zu klären, welche Erfahrungen die Eltern und ihre Kinder im Herkunftsland gemacht haben. Diese Aspekte sind aus dem Grund von besonderem Interesse, weil ein Großteil der Sozialisation der Aussiedler in ihrer alten Heimat stattgefunden hat, und diese Prägungen das Denken und Handeln dieser Menschen auch nach ihrer Ausreise aus der ehemaligen Sowjetunion mitbestimmen. Da die Familie der Ort ist, an dem sich die zentralen Prozesse der Sozialisation und der Erziehung der Kinder abspielen, wird im Kapitel 3 vor allem auf die elterlichen Erziehungsstile, Erziehungskonzepte und auf die Bedeutung der Familie in sowjetischer bzw. postsowjetischer Gesellschaft näher angegangen. Desweiteren wird die Bedeutung der staatlichen Erziehungseinrichtungen auf die kindliche Erziehung und Sozialisation angesprochen, und auch die Geschichte der Russlanddeutschen in der Sowjetunion sowie deren Motive, Hintergründe der Ausreise und Migrationsentscheidung mit einbezogen.
Nach der Aussiedlung in die Bundesrepublik müssen Aussiedler und Aussiedlerinnen sich in der neuen Umwelt neu orientieren und zurechtfinden. Aber nicht nur Eltern haben diese Herausforderung in der neuen Situation, sondern auch ihre Kinder. Sie erleben Migration “als einen biographischen Bruch” (Dietz 1999b: 11) indem sie eine ihnen vertraute Welt und ihre Freunde verlassen und in ein neues unbekanntes Land umziehen. Deshalb befasst sich diese Arbeit im Kapitel 4 hauptsächlich mit den neuen Bedingungen der Erziehung, der Sozialisation in Aussiedlerfamilien und deren Auswirkungen auf die elterlichen Erziehungsstile. In diesem Zusammenhang ist es interessant zu untersuchen, in wiefern sich Erziehungsmethoden und Erziehungseinstellung der Eltern nach der Migrationerfahrung in einer neuen Lebenssituation verändert haben. Ebenfalls soll herausgefunden werden, wie Eltern ihre Kinder nach der Migration unterstützen, was sie zum Gelingen der Integration der Kinder in die Aufnahmegesellschaft beitragen und welche Bedeutung dabei die Familie in Integrationsprozess spielt.
Zunächst aber wird ausführlich auf den Forschungsstand zum Thema Migration und Integration der Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion eingegangen und einige wichtige Studien bzw. Projekte vorgestellt. Dann werden im zweiten Kapitel die grundlegenden Begriffe definiert und wichtige Theorien erläutert, die in einem engen Zusammenhang mit dem behandelten Thema stehen. Nach den Kapiteln 3 und 4 werden abschließend die theoretisch ermittelten Ergebnisse präsentiert, zusammengefasst und diskutiert.
1.2 Stand der Forschung
Bis Mitte der achtziger Jahren galten Aussiedler bzw. Spätaussiedler und besonders deren Kinder in Deutschland als angepasst und integriert. Spätestens seit Anfang der neunziger Jahre hat sich dieses Bild verändert (vgl. Dietz/Roll 1998: 13). In dieser Zeit ist die Zahl der Einwanderer stark angestiegen, allein im Jahr 1990 erreichte Einreisezahl der Aussiedler fast 400.000 Personen. Die meisten Aussiedler kamen aus dem Gebiet der vormaligen Sowjetunion und Nachfolgestaaten der UdSSR, überwiegend aus Kasachstan und Russland.
Aufgrund dieser hohen Einwanderungszahl von Aussiedlern wurde seit Beginn der neunziger Jahre die Aussiedlerforschung zu einem “Zentralbereich der Migrations- und Integrationsforschung in Deutschland” (Bade/Oltmer 1999: 40). Dieses Thema hat damals bei vielen Forschern großes Interessen geweckt und war sehr aktuell. Den Medienberichten zufolge hatten Aussiedlerfamilien und besonders die Jugendlichen, unter ihnen die Anfang der neunziger Jahre eingereist sind, aufgrund fehlender Sprachkenntnisse, Arbeitslosigkeit, sozialer Isolation sowie durch Alkohol- und Drogenprobleme große Schwierigkeiten bei der Integration in die deutsche Gesellschaft (vgl. Dietz/Roll 1998: 13). Deshalb wurden seit dieser Zeit mehrere Forschungsprojekte durchgeführt, die sich mit Aussiedlern bzw. Spätaussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion sowie mit deren Integration- und Sozialisationsbedingungen in Deutschland befasst haben.
Bis Anfang der neunziger Jahre war über Sozialisations- und Lebensbedingungen der russlanddeutschen Familien in ihrem Heimatland nicht nur in Deutschland, sondern auch in der vormaligen Sowjetunion nur sehr wenig bekannt. Laut sowjetischer Publikationen lebten Deutsche gleichberechtigt als “Sowjetdeutsche” neben den anderen Nationalitäten. Dieses in der Öffentlichkeit transportierte Bild der Gleichberechtigung entsprach nicht ganz der Wahrheit. Bis Mitte der achtziger Jahre war das Thema der Deutschen in sowjetischen Gesellschaft tabuisiert. Es wurde darüber nicht öffentlich gesprochen. Erst seit dem Ende der achtziger Jahre unter dem Präsidenten Michail Gorbatschow und nach dem Zusammenbuch der UdSSR konnte über die Situation der Russlanddeutschen öffentlich diskutiert werden (vgl. Hilkes “Nach dem Zerfall der Sowjetunion” 1994, unter: http://www.uni-koeln.de/phil-fak/soeg/ethnos/inhalte/inhalte4/hilkes.htm, Zugriff am 08.09.2007).
In Deutschland befassten sich viele Wissenschaftler (um einige zu nennen: Barbara Dietz, Heike Roll, Klaus J. Bade, Leonie Herwartz-Emden, Manuela Westphal, Reiner Strobl und Wolfgang Kühnei) mit diesem bald sehr aktuellem Thema. Es wurden unterschiedliche Interviews und Umfragen mit Jugendlichen und auch Erwachsenen durchge- führt und Fragenbogen verteilt, die einen tieferen Blick in die Lebenswelten von Russlanddeutschen ermöglichten (vgl. Ingenhorst 1997: 131). Später kamen dann nur noch wenige Tausend Spätaussiedler aus der Nachfolgestaaten der UdSSR mit ihren Familienangehörigen in die Bundesrepublik (seit dem Jahr 2000 weniger als 100.000 Personen, im Jahr 2006 nur noch 7.747 Personen), folglich wurden in den letzten Jahren im Vergleich zu den neunziger Jahren nicht so viele Forschungsprojekte zum Thema Migration und Integration von Spätaussiedlern durchgeführt.
Die Grundlagen für diese Arbeit lieferten die empirischen Untersuchungen des Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) an der Universität Osnabrück und des Osteuropa-Instituts München (OEI).
Im Folgenden werden einige wichtige Forschungsprojekte und Studien benannt, auf die in dieser Arbeit Bezug genommen wird.
Die größten und umfangsreichsten Untersuchungen im “Bereich der Folgen von Migration und Einwanderung für Erziehung und Sozialisation” (Oltmer “Einführung: Migrationsforschung und Interkulturelle Studien - zehn Jahre IMIS”: 32, unter: http://www.imis. uni-osnabrueck.de/pdffiles/Einleitung_IMISll.pdf, Zugriff am 08.09.2007) wurden in den neunziger Jahren im Institut für Migrationsforschung und Inter kulturelle Studien (IMIS) durchgeführt. Im Zentrum dieser Untersuchungen stand das Forschungsprojekt FAFRA “Familienorientierung, Frauenbild, Bildungs- und Berufsmotivation von eingewanderten und westdeutschen Frauen und Familien in interkulturell-vergleichender Perspektive”. Bis dahin gab es keine umfangreichen empirischen Untersuchungen zum Themengebiet Erziehung in Aussiedlerfamilien.
Das FAFRA-Projekt wurde im Programm des Forschungsschwerpunktes FABER “Folgen der Arbeitsmigration für Bildung und Erziehung” der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Universität Osnabrück durchgeführt und von der DFG finanziert. Dieses Forschungsprojekt bestand aus drei Teilprojekten und begann im Jahr 1991 unter der Leitung von Leonie Herwartz-Emden. Ebenfalls gehören zum Forschungsteam die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Dr. Sedef Gümen, Dr. Manuela Westphal und Dipl.Soz. Heike Ritterbusch. Ende 1997 wurde das FAFRA-Projekt erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt leistete eine Grundlagenforschung im Bereich der Fragestellungen Erziehung und Sozialisation unter der Bedingung von Migration und Einwanderung. Im Vordergrund standen dabei unter anderem auch die Sozialisationsbedingungen und Erziehungseinstellungen in den Familien. In Rahmen dieses Projektes waren zunächst drei Gruppen (Aussiedlerinnen aus der ehemaligen Sowjetunion, Arbeitsmigrantinnen aus der Türkei und westdeutsche Frauen) anhand von Fragebogen, Interviews und Gruppendiskussio- nen untersucht und miteinander verglichen worden. Im zweiten Teil des Projektes waren drei Gruppen von Männern (Aussiedler, Arbeitsmigranten aus der Türkei und westdeutsche Männer) zum Thema “Vaterschaft und Erziehung” befragt worden. Zum Schluss, in der dritten Forschungsphase, wurden mit einer Gruppe von männlichen und weiblichen Jugendlichen Interviews durchgeführt (vgl. Forschung im Bereich Familie, unter: http://www.philso.uniaugsburg.de/lehrstuehle/paedagogik/paed3/medienverzeichnis/ soz- akkfamilie.pdf, Zugriff am 08.09.2007). In der vorgelegten Arbeit werden nur die Ergebnisse der Befragungen von Aussiedlen und Aussiedlerinnen aus der ehemaligen Sowjetunion betrachtet, auf zwei andere befragte Gruppen wird hier keinen Bezug genommen. Die genaue Beschreibung und Ergebnisse des FAFRA- Forschungsprojekts wurden im Jahr 2000 in den IMIS-Schriften Band 9 von Leonie Herwartz-Emden herausgegeben.
Ein Jahr früher wurden in den Schriften des Instituts für Migrationforschung und Interkulturelle Studien Band 8 “Aussiedler: deutsche Einwanderer aus Osteuropa” von Klaus J. Bade und Jochen Oltmer veröffentlicht. Alle Beiträge in diesem Band beruhen auf empirischen Untersuchungen und befassen sich aus der Sicht unterschiedlicher Forschungsrichtungen vor allem mit Aspekten und Problemen in zwei Bereichen: die Eingliederung jugendlicher Aussiedler und die Aussiedlerintegration (vgl. Bade/Oltmer 1999: 8).
Ein weiteres wichtiges Forschungsprojekt zur Situation der Aussiedlerjugendlichen wurde zwischen 1995 und 1997 von Barbara Dietz und Heike Roll durchgeführt und von der Volkswagen-Stiftung im Forschungsschwerpunkt “Das Eigene und das Fremde” finanziert (vgl. Dietz/Roll 1998: 11). An einer bundesweiter Befragung, die im Winter 1995/96 vom Osteuropa-Institut in München (OEI München) durchgeführt wurde, nahmen insgesamt jeweils 253 Aussiedler und einheimische Jugendliche im Alter von 15 bis 25 Jahre teil. Alle befragten Aussiedler kamen zwischen 1990 und 1994 aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland. Ziel dieses Forschungsprojektes war es die Integrationsbedingungen der jugendlichen Aussiedler, die Anfang der neunziger Jahre eingewandert sind, zu untersuchen und einen Überblick über ihre Integrationschancen und -risiken zu geben (vgl. Dietz 1999a: 154). Die Darstellung der Umfrage und die Ergebnisse des Projektes sind in Barbara Dietz und Heike Roll “Jugendliche Aussiedler-Porträt einer Zuwanderergeneration” 1998 zu finden.
Eine weitere empirische Untersuchung wurde von Heinz Ingenhorst 1992 anhand von Fragebögen in Übergangswohnheimen und in Sprachkursen in Münster durchgeführt. Ziel dieser Befragung war es, “mehr über den Alltag vor und nach der Aussiedlung, über Einstellungsmuster, ihre Ursachen und Folgen sowie Hoffnungen und Ängste der Aussiedler zu erfahren” (Ingenhorst 1997: 14).
Wichtige Schlussfolgerungen zu Situation und Integrationschancen von Aussiedlernjugendlichen lieferte auch eine empirische Untersuchung, deren methodische Konzeption sowie die Präsentation der Ergebnisse in Rainer Strobl und Wolfgang Kühnei “Dazugehörig und ausgegrenzt” gut dargestellt sind.
Die oben genannten Studien befassten sich mit den Lebensbedingungen der Russlanddeutschen in den Herkunftsländern sowie in Deutschland und haben dabei folgende Themengebiete untersucht: Geschichtlicher Hintergrund, Motive und Ausreisegründe, Aufnahmebedingungen in der Bundesrepublik, Sprachkenntnisse, Integrationsprobleme und Integrationschancen von Aussiedlern unterschiedlichen Alters und Geschlechtes.
2 Theorie und Begriffsdefinitionen
In diesem Kapitel wird ein Einblick in das große Feld der Sozialisation gegeben und dabei die wichtigsten Begriffe definiert, die zur Verständigung dieser Arbeit hilfreich sind. Im ersten Abschnitt werden mehrere Definitionen zu dem Begriff Sozialisation vorgestellt. Danach wird auf drei Dimensionen der Sozialisation nach Albert Scherr, auf Phasen der Sozialisation sowie auf soziologische Theorien der Sozialisation eingegangen. Als nächstes wird Sozialisation im Kulturvergleich dargestellt und weitere wichtige Definitionen von Kultur, Enkulturation und Akkulturation sowie auch Individualismus vs. Kollektivismus erläutert. Des weiteren wird über die Familie gesprochen, denn sie ist die wichtigste Sozialisationsinstanz und ist darum für die primäre Sozialisation eines Individuums verantwortlich. Neben der Sozialisation ist der Begriff Erziehung von großer Bedeutung und wird daher als Unterbegriff von Sozialisation beschrieben. Weiterhin werden in diesem Zusammenhang die Erziehungsziele der Eltern verdeutlicht sowie unterschiedliche Erziehungsstile analysiert. Zum Schluss wird auf die Bedeutung der Sprache im Sozialisationsprozess eingegangen.
2.1 Was ist Sozialisation?
Kinder werden überall auf der Welt ais hilflose Lebewesen geboren und sind deswegen auf ständige Pflege und Betreuung von Erwachsenen angewiesen. Sie ahnen noch nichts von den kulturellen Sitten und Gebräuchen und wissen nichts von den Fähigkeiten und Kenntnissen, die man als Erwachsener nötig hat. Trotzdem werden überall aus Kindern Erwachsene, die mehr oder weniger wissen, welche Fähigkeiten und Kenntnisse sie brauchen, damit sie in der Gemeinschaft als vollgültiges Mitglied anerkannt werden (vgl. Müller 2002: 8). Denn jeder Mensch durchläuft seit der Geburt einen Prozess, in dem er in die ihn umgebende Gesellschaft und Kultur hineinwächst und zu einem gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekt wird (vgl. Schäfers 2003: 319). Dieser Prozess ist sehr umfangreich, und man kann ihn im weitesten Sinne als Sozialisation und Erziehung bezeichnen, wobei Sozialisation ein primär soziologischer Begriff ist, der den Prozess des Hineinwachsens in die Selbstverständlichkeit einer sozialen Gruppe betont. Allerdings ist Sozialisation nicht nur ein soziologischer Begriff, sondern auch ein “Gegenstand aller Wissenschaften, die sich mit den Verhalten des Menschen beschäftigen” (Schäfers 2003: 320), wie zum Beispiel Psychologie, Anthropologie und Pädagogik.
Ursprünglich stammt der Begriff der Sozialisation aus der Soziologie bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts. Der französische Soziologe Emile Durkheim hat den Begriff der Sozialisation als einer der ersten in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt und gilt daher als der eigentliche Begründer dieses Begriffes. Durkheim versteht unter Sozialisation alle “Einwirkungen der Erwachsenengeneration auf diejenige, die noch nicht reif sind auf das Leben in der Gesellschaft” (Korte/Schäfers 2002: 46). Demnach umfasst Sozialisation “die Gesamtheit der Prozesse, durch die die nächste Generation gesellschaftsfähig in dem Sinne gemacht wird, dass das einzelne Mitglied der Gesellschaft die Grammatik des sozialen Handels dieser/ seiner Gesellschaft lernt” (Scholz/Euler “Einführung in die Allgemeine Pädagogik” 2005, unter: http://www.staff. uni-oldenburg.de/wolf.d.scholz/download/Sozialisation-Kurz2005.DOC, Zugriff am 08.09.2007).
Seit Dürkheims Zeit gibt es sehr viele wissenschaftliche Definitionen des Sozialisationsbegriffes, allerdings haben fast alle den gleichen Kerngedanken. Eine allgemeinere Definition des Begriffes Sozialisation lieferte Klaus Hurrelmann. Nach ihm wird mit Sozialisation “der Prozess der Entstehung und Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit in Abhängigkeit von und in Auseinandersetzung mit den sozialen und den dinglich-materiellen Lebensbedingungen verstanden, die zu einem bestimmten Zeitpunkt der historischen Entwicklung einer Gesellschaft existieren. Sozialisation bezeichnet den Prozess, in dessen Verlauf sich der mit einer biologischen Ausstattung versehene menschliche Organismus zu einer sozial handlungsfähigen Persönlichkeit bildet, die sich über den Lebenslauf hinweg in Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen weiterentwickelt” (Hurrelmann 1998: 14).
Nach Hurrelmann erlebt der Mensch durch den Prozess der Sozialisation eine sozusagen zweite soziokulturelle Geburt und wird zur sozialen, gesellschaftlich handlungsfähigen Persönlichkeit, indem er in gesellschaftliche Struktur- und Interaktionszusammenhänge hineinwächst (vgl. Hurrelmann 1998: 275).
Pflaum beschreibt dagegen das Stichwort Sozialisation als “Prozeß der sozialen Eingliederung, durch den ein Mensch seine elementaren Begriffe von Gerechtigkeit, Pflichten, Rechten, Idealen, moralischen Forderungen bekommt, durch den er zu den fundamentalen Bedingungen menschlichen Zusammenlebens erzogen wird, und der den Grundstock für jede spätere Ausweitung der sozialen Kontakte und Verantwortung legt”. Nach seiner Meinung geschieht dies durch die “Erziehung und Überlieferung in der Familie und in anderen primären Gruppen” (Haeberlin 1971: 31). Demzufolge spielen die Primärgruppen in dem Sozialisationsprozess eine wesentliche Rolle und in der Regel bildet für jede Person die Familie eine primäre Gruppe.
2.1.1 Dimensionen der Sozialisation
Die Sozialisationsforschung interessiert sich in erster Linie für die Auswirkung sozialer Strukturen und Prozesse auf die individuelle Entwicklung, dabei befasst sich der Begriff Sozialisation mit der Fragestellung, “wie Menschen durch ihre gesellschaftlichen Lebensbedingungen in ihrem Empfinden, Denken und Handeln beeinflusst werden, sich aber zugleich auch zu von allen anderen unterscheiden, besonderen und einzigartigen Individuen sowie zu eigensinnigen, selbstbestimmungsfähigen und eigenverantwortlich handlungsfähigen Einzelnen entwickeln” (Scherr 2002: 46).
Laut seiner Definition von Sozialisation unterscheidet Albert Scherr (vgl. Scherr 2002: 53) drei verschiedene Dimensionen, die als Elemente eines Zusammenhanges zu sehen sind. Die erste Dimension Personalität bezeichnet “die gesellschaftliche Bestimmtheit der Einzelnen durch übernommene Rollen, Werte, Normen, Erwartungen, Gewohnheiten usw.”, die zweite Dimension Individualität befasst sich mit Eigenschaften und Besonderheiten der Individuen, durch die sie sich von anderen Personen unterscheiden. Schließlich beschreibt Scherr die dritte Dimension als Subjektivität, damit ist die gemeinsame Sprach-, Handlungs- und Selbstbestimmungsfähigkeit aller Individuen gemeint. Da diese drei Dimensionen in einem Prozess der Sozialisation ineinander verschränkt sind, können sie nur analytisch voneinander unterschieden werden.
2.1.2 Phasen des Sozialisationsprozesses
Viele Soziologen gehen davon aus, dass Sozialisation ein Prozess ist, der das ganze Leben hindurch andauert. Dieser Prozess lasst sich grob in folgende drei Phasen einteilen: primäre, sekundäre und tertiäre. Es wird unterschieden zwischen der primären Sozialisation, vor allem in der Familie, “bei der es um die ersten, aber um so prägenden Festlegungen geht” (Esser 2001: 372), der sekundären Sozialisation, “die über die Familie hinausgreift und andere Bezugsumgebungen mit ihren Anforderungen einbezieht” (Esser 2001: 372) und tertiäre Sozialisation, z.B. durch Berufsausbildung, Beruf, die wesentlichen Einfluss auf die weitere Entwicklung junger Menschen hat. Die Entwicklungsschritte in jeder einzelnen Lebensphase bilden die Voraussetzung für die darauf folgende.
Die Wissenschaftler der Entwicklungspsychologie haben sich lange mit der Frage befasst, welche Altersabschnitte aufgrund einer gemeinsamen Lebensthematik sinnvoll zu Phasen zusammengefasst werden können, dabei sind sie zu dem Entschluss gekommen, dass Lebensphasen immer auch durch gesellschaftliche Bedingungen definiert werden. Die Tabelle 2.1 liefert eine Unterscheidung zwischen Säugling bis ca. 1. Lebensjahr, früher Kindheit zwischen 2. und 4. Lebensjahr und Kindheit von 5. bis 11. Lebensjahr. Danach, etwa mit dem 13. Lebensjahr, beginnt die Jugendphase, deren Übergang zum Erwachsenenalter zeitlich jedoch nicht exakt fixiert werden kann (vgl. Tillmann 2006: 21). In jeder Lebensphase haben unterschiedliche Institutionen wie Familie, Kindergarten, Schule und etc. für die Entwicklung einer Persönlichkeit eine enorme Bedeutung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2.1: Phasen des Sozialisationsprozesses Quelle: Tillmann 2006: 21
In weiterem Verlauf folgt die kurze Beschreibung der drei Phasen des Sozialisationsprozesses. Der Schwerpunkt dieser Arbeit richtet sich jedoch in erster Linie auf die primäre Sozialisation, weil sie grundsätzlich innerhalb der Familie stattfindet und die Familie für die heranwachsende Generation die wichtigste Sozialisationsinstanz ist.
a) Primäre Sozialisation
Peter L. Berger und Thomas Luckmann definieren primäre Sozialisation als “erste Phase, durch die der Mensch in seiner Kindheit zum Mitglied der Gesellschaft wird” (Scherr 2002: 47). Die primäre Sozialisation bzw. frühkindliche Sozialisation erfasst den Zeitraum der ersten drei Lebensjahren, ab der Geburt bis zum Eintritt in den Kindergarten. In dieser frühen Sozialisationsphase “werden die Grundstrukturen der Persönlichkeit in den Bereichen Sprache, Denken und Empfinden herausgebildet und die fundamentalen Muster für soziales Verhalten entwickelt”. Diese Prozesse finden in der frühen Kindheit überwiegend in der Familie statt, wo auch die sozialen Regeln und Umgangsformen erlernt werden (vgl. Hurrelmann 1998: 277). Die wichtigste Bezugspersonen dabei sind Mutter, Vater und Geschwister. “Die primäre Sozialisation ist die wichtigste Phase der Sozialisation, insofern als dort jene Grundstrukturen des Wissens und der Werte vermittelt werden, auf denen jede weitere Sozialisation aufbauen muss und von deren Hintergrund alle späteren Einflüsse gefiltert sind” (Esser 2001: 373).
b) Sekundäre Sozialisation
Die sekundäre Sozialisation ist nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann “jener spätere Vorgang, der eine bereits sozialisierte Person in neue Ausschnitte der objektiven Welt ihrer Gesellschaft einweist” (Scherr 2002: 47). Sie beginnt etwa nach Vollendung des dritten Lebensjahres, es muss jedoch dazu noch gesagt werden, dass die Grenzen zwischen den Phasen der primären und sekundären Sozialisation sehr fließend sind. In dieser Phase lernt die Person, welche Verhaltensweisen in einer bestimmter Situation von ihr erwartet werden, tolerierbar sind oder Tabus verletzen. Es werden außerdem “Formen des sozialen Umgangs, soziale Regeln, die Interaktionsmuster der Rollen sowie Denkweisen und Einstellungen vermittelt” (Hurrelmann 1998: 277). Hier übernehmen die sekundäre Sozialisationsinstanzen wie Kindertagesstätten, Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hochschulen und sozialpädagogische Institutionen die Aufgabe der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen (vgl. Hurrelmann 2002: 33).
c) Tertiäre Sozialisation
Für die Sozialisation im Erwachsenenalter wird der Begriff “tertiär” benutzt. “Die tertiäre Sozialisation schließt an die sekundäre an und bezieht sich auf die im Erwach- senenalter stattfindenden Entwicklungs-, Lern-, Gestaltungs- und Krisenbewältigungsprozesse. Wichtig sind hier vor allem das berufliche Umfeld, Lebenspartner, Organisationen oder Freundschaften.” (Begriffsdefinitionen: 10, unter: http://www.paed.uni- muenchen.de/~paed / content / material/material^eckert / ma^eckert/m_eckert2/VL_ 13 _04.pdf, Zugriff am 08.09.2007).
In dieser Phase finden folgende wichtige Prozesse statt wie Eintritt in Berufstätigkeit, Gründung eines eigenen Haushaltes bzw. einer eigenen Familie und der eventuelle Auszug der eigenen Kinder (vgl. Tabelle 2.1).
2.1.3 Sozialisationstheorien
Die Sozialisationstheorien beschäftigen sich mit der Entwicklung des Menschen. Sie versuchen zu erklären, wie Individuen zu Mitgliedern einer Gesellschaft werden, wie sie sich da verhalten und wie die Gesellschaften es schaffen ihre Werte, Normen und Regeln an die nach wachsende Generationen weiterzugeben.
Die Fachliteratur zur Sozialisation bietet zwei große klassische Theoriebereiche an. Es wird zwischen psychologischen und soziologischen Theorien der Sozialisation unterschieden. Aus der Perspektive der Psychologie handelt es sich um Lern- und Entwicklungsprozesse des Individuums in einer sozialen Umwelt. Psychologische Theorien beschreiben deren innerpsychische Voraussetzungen, Verläufe und Folgen (vgl. Scherr 2002: 46). Die soziologischen Theorien untersuchen vor allem den Einfluss von sozialen Lebensbedingungen auf die Persönlichkeitsentwicklung und geben eine “Analyse des Prozesses der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner inneren und äußeren Realität” (Hurrelmann 2002: 82). Die bedeutsamsten soziologischen Sozialisationstheorien sind die Systemtheorie von T. Parsons und N. Luhmann, die Handlungstheorie von G. H. Mead und die Gesellschaftstheorie von J. Habermas. Bekannte psychologische Theorien der Sozialisation sind, um einige zu nennen, die Lerntheorie von A. Bandura, die psychoanalytische Theorie von S. Freud und E. H. Erikson und die Entwicklungstheorie von J. Piaget (vgl. Hurrelmann 1998: 276L).
In den folgenden Abschnitten wird ein kurzer Überblich über drei soziologische Theorien gegeben. Auf psychologische Ansätze wird in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen.
a) Systemtheorie
Die soziologische Systemtheorie hat ihre Vorläufer in der funktionalistischen Theorie, die sich am “organismischen” Modell der Beziehung zwischen Person und Umwelt orientiert.
Nach strukturell-funktionaler Sichtweise von Gesellschaft haben Sozialisationsprozesse eine gesellschaftsstabilisierende Funktion. Wie oben schon erwähnt, ist der amerikanische Soziologe Talcott Parsons der Hauptvertreter der Struktur- funktionalen Systemtheorie, die von ihm entwickelt und geprägt wurde (vgl. Hurrelmann 1998: 40). Partson unterscheidet verschiedene Systeme, wobei das umfassendste System das der Gesellschaft ist. Das Hineinwachsen in die Gesellschaft geschieht durch das Erlernen von Rollen. Somit bestimmt Partson Sozialisation als “den Prozeß, durch den die Individuen die Dispositionen erwerben, die erforderlich sind, um die in der Gesellschaft vorgegebenen Rollen als Akteure spielen zu können. Diese Rollen sind durch Normen definiert, die aus allgemeinen, in der Gesellschaft institutionalisierten Werten abgeleitet ..., und in Interaktionssystemen reziprok aufeinander bezogen” sind (Schäfers 2003: 322).
Also ist die Sozialisation im Begriffsverständnis von Parsons der Vorgang der Übernahme und Verinnerlichung der Wertsetzungen und Rollennormen der sozialen Umwelt, dabei geht es inhaltlich um Sozialisation in der Familie, in der Gleichaltrigengruppe und während der Jugend. “Im Prozeß der Sozialisation nimmt der Handelnde schrittweise die Erwartungen und Verhaltensmaßstäbe des sozialen Systems auf ...” und “der Prozeß der Sozialisation endet mit der Verinnerlichung des umfassendsten sozialen Systems, des Systems der Gesellschaft” (Hurrelmann 1998: 42). Dazwischen liegen schrittweise die Aneignungsprozesse normativer und sozialer Strukturen, die in bestimmten Lebensphasen über jeweils zeitweise stabile Gleichgewichtszustände aufeinander aufbauen (vgl. Parsons 1981: 169).
Es ist allerdings kritisch anzumerken, dass Sozialisation von Parsons von vornherein unter dem Gesichtspunkt der Systemstabilität betrachtet wird und “den Beitrag des Individuums, die autonome Stellungnahme und kritische Auseinandersetzung des Individuums mit seinen Rollen, weitgehend ausblendet” (Schäfers 2003: 323). “Der Mensch wird nicht als aktiver Erschließer und Gestalter seiner Umwelt verstanden, sondern er steht einer übermächtigen Gesellschaft gegenüber, deren Einflüsse er sich kaum erwehren kann” (Hurrelmann 1998: 44f.).
Niklas Luhmanns erweiterte die Systemtheorie von Parsons und definierte Sozialisation mit wesentlich stärkerem Bezug auf “selbstgesteuerte und potentiell selbstbezogene Mechanismen” (Hurrelmann 1998: 42). Nach seiner Auffassung ist Sozialisation immer “Selbstsozialisation”: “Sie erfolgt nicht durch “Übertragung” eines Sinnmusters von einem System aufs andere, sondern ihr Grundvorgang ist die selbstreferentielle Reproduktion des Systems, das die Sozialisation an sich selbst bewirkt und erfährt” (Luhmann 1984: 327).
b) Handlungstheorie
Anders als bei struktur-funktionaler Systemtheorie, die ein sehr passives Menschenbild unterstellt, konzentriert sich Handlungstheorie auf die direkte Interaktion zwischen den Subjekten. Sozialisation vollzieht sich im Rahmen von Kommunikation und Interaktion (vgl. Schäfers 2003: 323). George Herbert Mead, der Begründer der Handlungstheorie, geht vom offen beobachtbaren Verhalten des Menschen aus, konzentriert seine Analyse aber zugleich auf die subjektive und intersubjektive Interpretation der sozialen Umwelt. Dabei wird interaktives “Handeln” als sinnhaft aufeinander bezogene Aktionen von mindestens zwei Menschen verstanden. Handeln wird in diesem Sinne als eine durch Beziehungen zwischen Akteuren geregelte Folge von Aktionen definiert, die in sozialen Situationen stattfindet, normativer Regelung unterliegt und der Motivation der Akteure folgt. Sozial wissenschaftliche Theorien, die von diesem Entwurf ausgehen, werden allgemein Handlungstheorien genannt.
Nach Mead entsteht die Persönlichkeit aus zwei Größen, der sozialen Komponente des “Me”, die Vorstellung dessen repräsentiert, wie andere Menschen ein Individuum sehen, und der psychischen Komponente “I”, die eine unabhängige Größe der Persönlichkeit darstellt. Identität im Sinne von Selbstsein und Selbstempfinden (“Seif”) entsteht als ein Produkt aus diesen beiden Größen (vgl. Hurrelmann 2002: 92f.). Das Vorhandensein von allgemein anerkannt signifikanten Symbolen (v. a. die Sprache) im Handlungsprozess ist für Mead die Voraussetzung für soziale Interaktionen. Besondere Bedeutung kommt dabei der im Sozialisationsprozess erworbenen Fähigkeit zur Rollenübernahme zu. Im Sozialisationsprozess lernt das Individuum sich in die Rolle anderer zu versetzen, aber auch sich selbst aus der Perspektive anderer Menschen zu sehen. Dieser Lernprozess ist von zentraler Bedeutung für den Aufbau des Selbst (“Seif” von Identität). Die handlungstheoretische Konzeption der Sozialisation von Mead geht vom “Modell eines kreativen, produktiv seine Umwelt verarbeitenden und gestaltenden Menschen” aus. Der Mensch ist in der Lage, sich mit den Augen des anderen zu sehen, seine soziale Welt zu konstituieren, und auf diesem Wege entwickelt er Bewusstsein und Selbstbild (vgl. Hurrelmann 1998: 50L).
c) Gesellschaftstheorie
Die Gesellschaftstheorien gehen auf Karl Marx und Friedrich Engels zurück und fassen verschiedene Theorieströmungen zusammen, die die wechselseitigen Beziehungen zwi- sehen Mensch und Individuum von makrosozialen Prozessen und Strukturen analysieren und interpretieren. Diese Theorien betonen die ökonomische, politische und kulturelle Strukturierung der Wechselbeziehungen zwischen Person und Umwelt. Durch die Beziehung zur Natur und zu anderen Menschen reflektiert sich der einzelne selbst und bildet ein Bewusstsein der eigenen Person (vgl. Hurrelmann 1998: 54 - 56).
Die Gesellschaftstheorien sind sehr wertvoll für die Sozialisationstheorie, “da sie intensiver als die andere Theorien den Versuch unternehmen, makrosoziale Strukturanalysen in die Analyse der Beziehungen zwischen Person und Umwelt, zwischen Mensch und Gesellschaft, einzubeziehen” (Hurrelmann 1998: 59).
Einer der wichtigen Vertreter der Gesellschaftstheorie ist der Jürgen Habermas. Er legte eine Theoriekonzeption vor, die sehr wichtig für die Sozialisationsforschung ist, denn diese Konzeption verbindet soziologische und psychologische Traditionen miteinander. Hierbei orientiert sich Habermas an der Gesellschaftstheorie von Marx und ergänzt diese theoretischen Vorgaben mit der Handlungs- und Rollentheorie, mit dem Ziel zu erklären, wie Menschen ihre Handlungsfähigkeit entwickeln und ihre Identität aufbauen (vgl. Hurrelmann 2002: 108f.).
Ein wichtiges Element in der Sozialisationstheorie von Habermas ist die Entwicklung der menschlichen Persönlichkeitsbildung. Hier unterscheidet er grob zwischen “natürlicher Identität”, “Rollenidentität” und “Ich-Identität”. Die erste Stufe einer “natürlichen Identität” verläuft in den ersten sechs Lebensjahren. Das Kind ist noch nicht im Stande, bewusst das Innenleben zu empfinden und hat noch keine Fähigkeit, sich in die Perspektive eines anderen gedanklich zu vertiefen. Ab dem sechsten Lebensjahr folgt die zweite Stufe der “Rollenidentität” und “führt zu einer Fähigkeit des operationalen Denkens und der konventionellen moralischen Urteilsfähigkeit” (Hurrelmann 2002: 112). Und schließlich erreicht der Heranwachsende nach der Pubertät die höchste Stufe der “Ich-Identität”. “Die Ich-Identität des Erwachsenen bewährt sich in der Fähigkeit, neue Identitäten aufzubauen... Eine solche Ich-Identität ermöglicht jene Automatisierung und zugleich Individuierung, die in der Ich-Struktur schon auf der Stufe der Rollenidentität angelegt ist” (Habermas 1976: 94). Nach Habermas wird “Ich-Identität” mit dem Begriff “Kommunikative Kompetenz” gleichgesetzt. Nach Tillmann bezeichnet kommunikative Kompetenz die “Fähigkeit zum flexiblen und zugleich prinzipiengeleiteten Rollenhandeln wie auch die Fähigkeit, in Diskursen in kompetenter Weise über Geltungsansprüche verhandeln zu können” (Tillmann 1994: 221, zitiert nach: Gugjons 2006: 161).
2.2 Sozialisation im Kulturvergleich
Unter Sozialisation wird auch ein Prozess verstanden, “über den die Kultur einer Gesellschaft in die Identität der neuen Mitglieder - Kinder oder Fremde - vermittelt wird” (Esser 2001: 371). Wenn man von einer lebenslang stattfindenden Sozialisation ausgeht, so finden bei der Übersiedlung einer Familie in eine fremde Kultur bei allen Familienmitgliedern die Sozialisations- und Akkulturationsprozesse statt. Die Mitglieder der ganzen Familie sind in mehr oder weniger starkem Mafie gezwungen, neue sozialrelevante Verhaltens- und Denkweise zu erlernen, die ihnen ein Einleben und auf Dauer befriedigendes Leben in der fremden Kultur ermöglichen (vgl. Trommsdorff 1989: 178). Beim Kulturvergleich von Sozialisation geht es darum, verschiedene Kulturen aufzusuchen, um die Varianz der dort präsentierten Phänomene unter theoretischen Fragestellungen zu erweitern (vgl. Trommsdorff 1989: 12). Aber was versteht man unter dem Begriff Kultur? Die Antwort auf diese Frage wird im nächsten Abschnitt gegeben.
2.2.1 KulturbegrifF
Die Literatur bietet zahlreiche Definitionen vom Kulturbegriff, denn es handelt sich hier um einen Begriff mit hohem Abstraktionsniveau, und es müssen gleichzeitig viele andere Phänomene umschrieben werden. Deshalb ist es sehr problematisch, den Kulturbegriff zu definieren.
Ursprünglich stammt der Begriff Kultur aus dem lateinischen Verb colere, was so viel bedeutet wie “pflegen” und würde zunächst im Sinne von “agricultura” = Bodenbau verstanden. Später verstand man unter “cultura” eine umfassende Lebensgestaltung im Umgang mit der inneren und äußeren Natur. Heute versteht man unter Kultur die “Gesamtheit gemeinsamer materieller und ideeller Hervorbringungen, internalisierter Werte und Sinndeutungen sowie institutionalisierter Lebensformen von Menschen” (Schäfers 2003: 198). Nach Gisela Trommsdorff beinhaltet Kultur “die von einer sozialen Gruppe verwendeten Deutungs- und Handlungsmuster, Wissen, Sprache und Techniken zur Bewältigung von Anpassungsproblemen im Umgang des Menschen mit seiner Umwelt” (Trommsdorff 1989: 12). Allgemein kann man unter Kultur dem gemeinsamen Lebensstil einer Gruppe von Menschen verstehen. In jeder Kultur werden durch Prozesse der Sozialisation Werte und Normen vermittelt, die sowohl unser Verhaltensmuster als auch die Wahrnehmung unserer Umwelt beeinflussen, deshalb empfinden Menschen, die in verschiedenen Kulturen aufwachsen, die gleichen Situationen auch unterschiedlich.
2.2.2 Enkulturation und Akkulturation
Unter dem Bergriff Enkulturation versteht Hubert einerseits “Prozesse der Vermittlung von Kultur durch Sozialisationsinstanzen und andererseits die Übernahme von Kultur durch das Individuum, das sich in einem aktiven Prozess der Selbststeuerung in die kulturelle Umwelt integriert” (Trommsdorff 1989: 1). In erste Linie geht es bei der Enkulturation um den Erwerb kultureller Elemente der Gesellschaft, in die man hineingeboren wurde, im Prozess der frühkindlichen Sozialisation. Dieser Prozess ist eng verwoben mit Vorgängen und Institutionen der Sozialisation. Nach Fend hat die Enkulturation also “die allgemeine Bedeutung von Lernen der Kultur, Lernen von Kulturmustern, Lernen des Werte- und Normensystems, Lernen der kulturspezifischen Technologien, der Sprache, der Fertigkeiten, des kulturspezifischen Denkens, der kulturspezifischen Gefühlswelt usw.” (Haeberlin 1971: 31).
Von dem Begriff der Enkulturation ist der Begriff Akkulturation zu unterscheiden. Unter Akkulturation versteht man allgemein den “Prozess der Übernahme von Elementen einer bis dahin fremden Kultur durch Einzelpersonen, Gruppen oder ganzen Gesellschaften” (Schäfers 2003: 1). Diese Übernahme betrifft Wissen, Werte, Normen, Institutionen, Gewohnheiten, tatsächliches Verhalten und insbesondere die Sprache. Die Akkulturation findet auf der Basis der Enkulturation statt, d.h. für Personen, die den Prozess der Enkulturation hinter sich haben, “wird jede Aneignung einer neuen Kultur auf bereits bestehende kognitive und moralische Koordinaten treffen” (Esser 2001: 372). Dabei ist die Prägung der Person bei der Akkulturation grundsätzlich nicht so stark wie bei der Enkulturation. Damit eine Akkulturation stattfindet, muss irgendeine Form des Kulturkontaktes bestehen. Wichtige Anlässe für diesen Prozess sind zum Beispiel Migration und Tourismus. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Problem der Eingliederung von Migranten ist der Begriff der Akkulturation von großer Bedeutung (vgl. Schäfers 2003: lf.).
In vorgelegter Arbeit ist Akkulturation insofern bedeutsam, weil es sich hier um eine Gruppe von Menschen handelt, die in eine für sie bis dahin fremde Kultur hineinkommen und der Kontakt mit dieser Kultur für sie eine Veränderung bedeutet. Diese Veränderung bedeutet für sie einen Prozess der Anpassung an die neuen Lebensbedingungen. Wie die Familien, dabei besonders die Kinder und Jugendlichen diese Veränderung durchleben und wie ein Prozess der Anpassung dieser Familien in einer neuen Kultur verläuft, wird in den nächsten Kapiteln ausführlich diskutiert.
2.2.3 Individualismus vs. Kollektivismus
Die kulturvergleichenden Untersuchungen zu Werthaltungen von Prof. Geert Hofstede ergaben eine Dimension, die Gesellschaften deutlich nach zwei “Werte-Typen” unterscheidet. Diese Kulturdimension “Individualismus” vs. “Kollektivismus” beschreibt die Beziehung zwischen den Angehörigen einer Gesellschaft. Nach Trommsdorff sind mit Individualismus Werte gemeint, “die sich primär auf das Individuum und die Erfüllung individueller Ziele und Bedürfnisse beziehen”. Mit Kollektivismus dagegen sind die Werte gemeint, “die sich auf die soziale Gruppe und auf die Erfüllung von Gruppenzielen (unter Hintanstellung individueller Interesse) beziehen” (Trommsdorff 1989: 101f.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2.2: Sozialisationsakzente in kollektivistischen und individualistischen Kulturen Quelle: Hofstede 1989: 167
In Tabelle 2.2 findet man einige empirisch gefundene Unterschiede von Sozialisationsinstanzen in kollektivistischen gegenüber individualistischen Kulturen. Gegenüber dem Kollektivismus beschreibt Individualismus das “Ausmaß der Integration von Individuen in Gruppen” (Hofstede 1989: 166). Auf der linken Seite (Kollektivistische Kulturen) befinden sich Gesellschaften, in denen die Menschen von Geburt an in starke, zusam- menhängende Gruppen (z.B. Großfamilien) integriert sind, die ihnen Unterstützung im Austausch gegen “uneingeschränkte Loyalität” geben. Dabei ist die Familie die wichtigste Sozialisationsinstanz, bei der die Erziehung zum “Wir-Gefühl” eine zentrale Bedeutung hat. Auf der rechten Seite finden wir Gesellschaften, in denen die Bindungen zwischen Individuen locker sind: jeder kümmert sich eher um sich selbst und die eigene Familie. Die Kinder werden in der Familie zum “Ich-Bewusstsein” erzogen und es wird von Individuen eine eigene Meinung erwartet. In Kollektischstischen Kulturen werden dagegen Meinungen von der Gruppe festgelegt (vgl. Hofstede 1989: 166L). An dieser Stelle muss jedoch erwähnt werden, dass die meisten realen Kulturen irgendwo dazwischen liegen und keineswegs alle Kriterien entweder kollektivistischer oder individualistischer Kulturen erfüllen.
2.3 Familie als wichtigste Sozialisationsinstanz
Zu den wichtigsten Instanzen der Sozialisation gehören Familien, Bildungseinrichtungen sowie Pflege- und Hilfseinrichtungen. Dabei hat die Familie die zentrale Aufgabe, den Kindern die gesellschaftlichen Normen und Werte zu vermitteln. Vor allem ist sie die erste Gruppe, mit der das Kind in Kontakt kommt und sie bildet eine Umgebung, in der das Kind die meiste Zeit verbringt.
Eltern sind die wichtigste Bezugspersonen für das Kleinkind und tragen für seine gelungene Sozialisation die Verantwortung. “Parents are usually the most potent socialising force working on the individual in the early stages of childhood” (White 1977: 1).
Der Begriff Familie ist eine aus dem Französischen “famille” übernommene Bezeichnung für eine familiale Lebensform, die sich im städtisch-bürgerlichen Lebensraum des 19 Jh.s ausprägte. Allgemein weist eine familiale Lebensform als Kern zumindest eine relativ dauerhafte und legitimierte Beziehung zwischen einer/einem Erwachsenen und einem Kind auf, wobei der/dem Erwachsenen die Hauptverantwortung für die Fürsorge und die Sozialisation des Kindes obliegt (vgl. Schäfers 2003: 81). Die Soziologin Nave-Herz bietet noch eine plausible Charakterisierung der Familie. Sie definiert Familie als “eine Verbindung, in der Eltern oder ein Elternteil mit ihren bzw. seinen Kindern Zusammenleben, zumindest in einer Haushaltsgemeinschaft. Nave-Herz unterscheidet Drei-Generationen-Familie (Großeltern, Eltern, Kinder), Eltern-Familie und Ein-Eltern-Familie, hier wiederum die Mutter- und die Vater-Familie” (Rolff/Zimmermann 2001: 19).
Leonie Herwartz-Emden unterstreicht noch einmal die Bedeutung der Familie im Sozialisationsprozess. “Die Familie, wie auch immer sie sich zusammensetzt, ist in den ersten Lebesjahren eines Kindes der wichtigste Sozialisationsort und bleibt dies auch viele Jah- re” (Herwartz-Emden “Sie sollen es besser haben”, unter: http://www.ms.niedersachsen.de/master/C767163_L20_D0_I674.html, Zugriff am 08.09.2007).
Für die Sozialisation des Nachwuchses ist die Familie also von höchster Bedeutung.
Zum einen ist es Aufgabe der Eltern, die gesellschaftlichen Normen und Werten an ihre Kinder zu übermitteln. Denn das Kind wird sozialisiert, indem es Normen und Werten der Gesellschaft, in die es geboren wird, übernimmt. Die Normen werden besser erlernt, wenn sie aus vielen Begegnungen nicht mit wechselnden, sondern mit den gleichen Personen erschlossen werden. Genau das ermöglicht “die Institution der Familie, indem sie eine Sozialstruktur schafft, in der die Eltern das neugeborene Kind aus seiner Hilflosigkeit herausführt” (Meulemann 2006: 227).
Somit ist für die Kinder die Familie nach zeitlicher Dauer und Intensität die wichtigste Sozialisationsinstanz, in der die Grundwerte und Normen der Gesellschaft an die nachwachsende Generation weitervermittelt werden. Außerdem werden durch die Familie die “intellektuellen, emotionalen und moralischen Aspekte des Lebens von Kindern geprägt” (Gudjons 2006: 163f.). Die Beziehung zu den Eltern und Geschwistern hilft die Emotionen auf unterschiedliche Personen zu richten, Frustrationen auszuhalten und Differenzierungen wahrzunehmen. Im alltäglichen Umgang miteinander übt die Familie moralische Sichtweisen und Praktiken ein, wie zum Beispiel Respekt, Verantwortung, aber auch das Gegenteil davon (vgl. Gudjons 2006: 164).
Bei diesen Prozessen spielen die Erziehungsmethode und Erziehungsstile der Eltern eine maßgebliche Rolle. Die unterschiedliche Erziehungsstile werden im nächsten Abschnitt genauer besprochen.
2.4 Erziehung als Unterbegriff von Sozialisation
Der Begriff Erziehung bezeichnet als Unterbegriff von Sozialisation alle Vorgänge, “bei denen bewusst ein Handeln mit dem Ziel in Gang gesetzt wird, die Persönlichkeitsentwicklung positiv beeinflusst, d.h. bestimmte Verhaltensdispositionen zu entwickeln oder vorhandene zu verändern” (Schäfers 2003: 320). Durch Erziehung versuchen die Menschen auf die Persönlichkeitsentwicklung anderer Menschen Einfluss zu nehmen. Der entscheidende Unterschied zwischen Sozialisation und Erziehung liegt darin, dass Erziehung an Absicht gebunden ist und mehr oder weniger bewusst verläuft, während Sozialisation überwiegend ungeplant und unbeabsichtigt geschieht (vgl. Gugjons 2006: 150). Durck- heim setzte den Begriff Sozialisation in “enge Beziehung zum Begriff Erziehung, indem er Erziehung als das wichtigste gesellschaftliche Mittel der Sozialisation des menschlichen Nachwuchses bezeichnete, durch das die bei der Geburt “asozialen” menschlichen Wesen zum “sozialen Leben” geführt würden” (Hurrelmannl998: 13). Nach Durckheim lässt sich die Erziehung soziologisch als “socialisation me thodique”, d.h. als geplante und absichtsvolle Sozialisation, bestimmen. Somit ist das ein Hinweis dafür, dass Erziehung in der Perspektive der Soziologie nur ein bestimmter Ausschnitt des Sozialisationsgeschehens ist und keineswegs der alleinige Weg, auf dem gesellschaftliche Einflüsse auf heranwachsende Personen ausgeübt werden (vgl. Scherr 2002: 49).
2.4.1 Erziehungsziele
Die Erziehung von Kindern vollzieht sich in der Regel zunächst innerhalb der Herkunftsfamilie, die Erziehung im Elternhaus bildet daher einen Schwerpunkt. Eltern bemühen sich darum dem Kind Normen und Werte, Fähigkeiten und Überzeugungen, die in der Gesellschaft mehr oder weniger verbindlich sind, zu vermitteln. Zwar sind die Eltern sehr wichtig für die kindliche Entwicklung, aber sie sind nur eine Sozialisationsinstanz unter vielen. Denn auch andere Personen (z.B. Verwandte, Freunde, Lehrer) und Institutionen (z.B. Kindergarten, Schule) nehmen auf die Erziehung und auf das Hineinwachsen von jungen Menschen in die Gesellschaft einen Einfluss (vgl. Zimbardo/Gerrig 1999: 484).
Erziehungsziele der Eltern drücken ihre Vorstellungen über die Persönlichkeitsmerkmale, Fähigkeiten und Einstellungen des Kindes aus und entsprechen damit den wünschens- und erstrebenswerten Verhaltensweisen, die für ein Kind als wertvoll angesehen werden. Für die meisten Eltern sind Werte wie Ehrlichkeit, Selbständigkeit und Selbstvertrauen, Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft und Leistungsfähigkeit bei der Kindererziehung besonders wichtig. Auf die früher hoch bewerteten Vorstellungen von Ordnung und Unordnung legen heutzutage dagegen viele Eltern weniger Wert, als noch vor fünfzig Jahren (vgl. Hurrelmann 2002: 156f.). In der Regel wollen Eltern ihren Kindern eine optimale Entwicklung ermöglichen, so dass sie als Erwachsene in der Lage sind, die Aufgaben, die ihnen Gesellschaft und Kultur stellen, erfolgreich zu bewältigen. Diese Aufgaben können sich von Gesellschaft zu Gesellschaft und erst recht von Kultur zu Kultur unterscheiden (vgl. Zimbardo/Gerrig 1999: 484).
Die verschiedene Kulturen unterscheiden sich darin, welche Erziehungsziele für Eltern die oberste Priorität haben und als Orientierung dienen, was nicht heißen soll, dass in einer Kultur ganz andere Werte wichtig sind als in anderen Kulturen. In westlichen Industriekulturen neigen Eltern dazu, individualistische Ziele zu betonen und Werte zu vermitteln, die sich primär auf das Individuum und die Erfüllung individueller Ziele und Bedürfnisse beziehen2 In manchen anderen Kulturen dagegen haben Kompetenzen wie die Fähigkeit zur Kooperation in Gruppen und innerhalb der Familie, das Anerkennen von Autorität und das respektvolle Verhalten gegenüber Autoritäten und die Eingliederung in die Gesellschaft höchste Priorität (vgl. Levendecker/Drießen: “Erziehungsvorstellungen von jungen Eltern: Wie soll mein Kind einmal werden?”, unter: http://familienhandbuch- test.bayern.de/cms/Erziehungsfragen-Erziehungsvorstellungen.pdf, Zugriff am 08.09.2007). “Diese Erziehungsziele spiegeln sich auch in den Erziehungspraktiken der Eltern und in den Anweisungen, die sie den Kindern mit auf den Weg geben, wider” (Levende- cker/Drießen: “Erziehungsvorstellungen von jungen Eltern: Wie soll mein Kind einmal werden?”, unter: http://familienhandbuch-test.bayern.de/cms/Erziehungsfragen- Erziehungsvorstellungen.pdf, Zugriff am 08.09.2007).
Eines der Ziele der schulischen Erziehung ist dagegen, dass alle Bürger “über eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Grundwissen verfügen und folglich an überregionaler Kommunikation teilnehmen können” (Scherr 2002: 50).
2.4.2 Erziehungsstile
Klaus Hurrelmann definiert “Erziehungsstile” als beobachtbare und verhältnismäßig überdauernde tatsächliche Praktiken der Eltern, mit ihren Kindern umzugehen.
In der Forschung werden die Ausprägungen des Erziehungsverhaltens der Eltern zu bestimmten Gruppen zusammengefasst und als “Erziehungsstile” bezeichnet (vgl. Hurrelmann 2002: 157). Die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes innerhalb der Familie wird einerseits durch die bewussten und gezielten Erziehungsstile der Eltern geprägt, und andererseits auch durch ihr gesamtes Verhalten, z.B. durch ihre Einstellungen und Gesten. “Die bewusst praktizierten Erziehungsverhaltensweisen der Eltern spiegeln ihre Erfahrungen und Eindrücke aus ihrem gesamten gesellschaftlichen Umwelt” (Hurrelmann 2002: 156) wieder.
Es ist allgemein bekannt, dass Eltern ihre Kinder sehr unterschiedlich erziehen und einen eigenen Erziehungsstil haben. Die Frage ist, welcher Erziehungsstil erweist sich als günstig und welcher als ungünstig für die Entwicklung von Kindern? Um eine Antwort auf diese Frage geben zu können, werden erst einmal unterschiedliche Erziehungsstile dargestellt. Nach Klaus Hurrelmann gibt es grundsätzlich vier verschiedene Erziehungsstile, den autoritären, den permissiven, den überhütenden und den vernachlässigenden Erziehungsstil (vgl. zum Folgenden Hurrelmann 2002: 158-163).
1. Der autoritäre Erziehungsstil
Der autoritäre Erziehungsstil Der autoritäre Erziehungsstil orientiert sich stark an der Autorität der Eltern. Im Vordergrund steht, dass die Eltern, “ohne groß die Selbständigkeit des Kindes zu beachten, strikte Disziplinierungsmaßnahmen anwenden” (Zimbardo/Gerrig 1999: 488). Das heißt, es wird auf die Kinder eine starke Kontrolle ausgeübt. Sie werden von den Eltern stark eingeengt, so dass die Kinder nur wenig Möglichkeiten haben sich frei zu entwickeln.
Die Anhänger dieses Stils plädieren dafür, dass Eltern mit ihrer Autorität gezielt in die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes eingreifen, ihm klare Orientierungen und Wertvorstellungen vermitteln und es auf die gesellschaftlichen Anforderungen vorbereiten. Dabei setzt sich der autoritärer Erziehungsstil oft über die Bedürfnisse der Kinder hinweg. Nicht selten reagieren Kinder aggressiv und gewalttätig auf die körperliche Züchtigung, die zum gewöhnlichen Verhalten der Eltern gehört. Leistungsstärke, Selbständigkeit und soziale Verantwortung werden sehr selten und wenig gefördert.
2. Der permissisve Erziehungsstil
Der permissive Erziehungsstil (“laisser-faire”) orientiert sich stark an den Bedürfnissen des Kindes, dabei versuchen die Eltern in die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern nicht einzugreifen, um den Eigenwillen des Kindes nicht zu unterdrücken. Beim permissiven Erziehungsstil gelingt es den Eltern nicht, dass Kinder etwas über soziale Rollen lernen, mit denen sie leben müssen. Das Verhalten der Eltern gegenüber ihren Kindern ist nicht fordernd und weniger lenkend und es existieren in der Familie keine festen Regeln. Das führt dazu, dass Kinder sich irritiert und verwirrt fühlen. Die Regellosigkeit wird von ihnen oft als Lieblosigkeit und mangelnde Aufmerksamkeit empfunden. Die Entwicklung der Selbständigkeit wird bei diesem Stil nicht gesichert.
Verschiedene Untersuchungen zur Wirkung dieser beiden Erziehungsstile haben gezeigt, dass sie nicht zu dem Ziel führen, Kinder zu selbsttätigen, leistungsfähigen und gesellschaftlich verantwortungsbereiten Persönlichkeiten zu erziehen. Deshalb sind der autoritäre und der permissive Erziehungsstil nicht wünschenswert. Die Abbildung 2.1 unterscheidet zwei Dimensionen von Erziehungsstilen nach dem Grad “der Einsatz elterlicher Autorität” und der “Berücksichtigung kindlicher Bedürfnisse”. Es wir deutlich, dass noch zwei mögliche Erziehungsstile existieren, die sich aus der Kombination von entweder extrem starken oder besonders schwacher Orientierung ergeben.
3. Der überhütende Erziehungsstil
Beim überhütenden Erziehungsstil sind elterliche Autoritätseinsatz als auch Bedürfnisorientierung des Kindes sehr stark. Diese Kombination erschwert erheblich eine Entfaltung der persönlichen Eigenschaften des Kindes und seine selbständige Entwicklung von
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Verhaltensweisen.
4. Der vernachlässigende Erziehungsstil
Beim vernachlässigenden Erziehungsstil bekommen Kinder wenig Wertschätzung. Es gibt in der Familie nur wenige Regeln und Konsequenzen. Dieser Stil ist am nachteiligsten für das Kind, weil die Eltern zu wenig Lenkung und Zuwendung gegenüber ihren Kindern zeigen und emotionales Desinteresse am Kind zum Ausdruck bringen. Das führt dazu, dass Kinder sieh nicht nur allein gelassen, sondern auch missachtet fühlen.
Wie man sicht, erweisen sieh diese beiden Stile auch nicht als wünschenswert. Die Abbildung 2.1 veranschaulicht, wie sieh aus vier extremen Erziehungsstilen ein ganz neuer, ein autoritativ-partizipativer Stil ergibt. Der autoritativ-partizipative Erziehungsstil hat sieh für die Entwicklung von Kindern als günstig erwiesen. Autoritativer Stil, weil er die Autorität der Eltern zurückhaltend und umsichtig einsetzt. Partizipativcr Stil, weil er auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht. Autoritative Eltern stellen angemessene Anforderungen an ihre Kinder, zeigen ihnen ihre Aufmerksamkeit, fördern die Fähigkeit zur Selbstregulierung, Selbstständigkeit und Autonomie, stärken ihre soziale Verantwortlichkeit und Leistungsfähigkeit.
2.5 Bedeutung der Sprache im Sozialisationsprozess
Nach Claessens ist die Sozialisation ein Prozess der “zweiten, soziokulturellen Geburt”, “in dessen Verlauf ein Individuum zu einem potentiell handlungsfähigen Mitglied seiner Gesellschaft wird, ist auf eine grundlegende und umfassende Weise an die Entwicklung der sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten im heran wachsenden Kinde und Jugendlichen gebunden” (Miller/Weissenborn 1991: 531). Der Erwerb einer oder mehrerer Sprachen verläuft bereits in der primären Sozialisation bzw. in der frühen Kindheit ab. Jedes Kind eignet sich in den ersten Lebensjahren die spezifischen sprachlichen Gewohnheiten der Gruppe an, in die es hineingeboren wurde. Dies ist eine der größten geistigen Leistungen, die jeder Mensch vollbringen muss. “Es ist für das Kind eine äußerst schwierige Aufgabe, die Konventionen der Erwachsenen beim Klassifizieren der Phänomene der Realität zu erlernen, und es ist andererseits faszinierend, die Entwicklung von den ersten unscharfen, nicht konventionellen Ausdrücken zu den von der Umgebung sanktionierten Begriffe zu verfolgen” (Francescato 1973: 7).
Die Rasanz, mit der die Kinder das hoch komplexe System Sprache erlernen, zeigt, wie sehr der Mensch darauf angewiesen ist, die Welt zu verstehen und mehr noch, mit seinen Mitmenschen zu kommunizieren. Einige Beispiele von Kindern, die in den Wäldern aufgewachsen sind (vgl. z.B. die Fallrekonstruktion zum “wilden Jungen von Aveyron” von Shattuck 1980) zeigen die Notwendigkeit des Spracherwerbs in einer sozialen Umwelt (vgl. Miller/Weissenborn 1991: 534).
Für den Sozialisationsprozess und für das soziale Zusammenleben ist die Sprache von großer Bedeutung, denn sie dient nicht nur zum Zweck der Mitteilung und Verständigung. “Vielmehr enthalten Sprachen die grundlegenden Muster der Wahrnehmung, Deutung und Bewertung, innerhalb deren Individuen sich selbst sowie ihre soziale und natürliche Umwelt erleben. Unterschiede der Sprache, die in sozialen Gruppen gesprochen und erlernt wird, bedingen folglich auch Differenz des jeweiligen Selbst- und Weltverständnisses” (Scherr 2002: 61). Obwohl Kinder über eine natürliche Fähigkeit zum Spracher- werb verfügen, sind jedoch Sprachentwicklung und Spracherwerb nur durch Teilnahme an sprachlicher Interaktion möglich. Grammatik und Vokabular einer Sprache erwerben Kleinkinder erst im Sozialisationsprozess. Um zu erklären, wie sie im Sozialisationsprozess ihre Sprachfähigkeit entwickeln, werden hier einige Grundannahmen von Scherr zur Sprachentwicklung zusammengefasst (vgl. zum Folgenden Scherr 2002: 61): -
- Die Kinder werden von Anfang an in der Interaktion von ihren primären Bezugspersonen als Wesen behandelt, die zu sprachlicher Verständigung grundsätzlich fähig sind.
- Es werden gemeinsame Handlungen mit dem Kind sprachlich kommentiert und die Gesten und lautsprachlichen Äußerungen des Kindes werden als verstehbare Mitteilungen behandelt.
- Dadurch, dass Erwachsene in der Interaktion mit dem Kind über ihr eigenes Erleben und Handeln, über das Empfinden und Handeln des Kindes sprechen, lernen Kindern erste sprachliche Deutungen und Beschreibungen und sind später in der Lage Ereignisse, Personen und Dinge mit sprachlichen Äußerungen zu verbinden.
- Die primären Bezugspersonen wirken auf die Verfestigung und den Ausbau der sprachlichen Fähigkeiten des Kindes hin, indem sie aus kindlichen Lauten Wörter formen, sprachlich korrekte Äußerungen wiederholen oder unvollständige Sätze vervollständigen.
Somit ist die Sprache “die bedeutendste Errungenschaft im Leben eines Menschenkindes ... sie ist unser wichtigstes Organ zur Aneignung der Welt” (Butzkamm/Butzkamm 1999: 7).
3 Situation der Russlanddeutschen in der ehemaligen Sowjetunion
Von der Situation der Aussiedlerfamilie im Herkunftsland und von ihrem individuellen Hintergrund hängt es ab, wie die Familie und besonders die Kinder die neue Situation und die Veränderungen in dem Aufnahmeland erleben und verarbeiten. Denn Sozialisation und die soziale Prägungen im Herkunftsland sind für den erfolgreichen Integrationsprozess und Akkulturation im Aufnahmeland von großer Bedeutung. Um den Verlauf der Integration der Aussiedler und ihrer Kinder in Deutschland nachvollziehen zu können und Veränderungen in der Kindererziehung herauszufinden, wird in diesem Kapitel zuerst einmal auf die Geschichte der Russlanddeutschen in den Heimatländern und auf die Motive und Hintergründe der Ausreise eingegangen. In Abschnitt 3.3 wurde über Erziehung und Sozialisation der Kinder im Herkunftsland berichtet, unter anderem über Familienpolitik in der Sowjetunion, über Familienstruktur, die Frauenrolle in der Familie, sowie über familiäre und institutioneile Erziehung in der vormaligen Heimat der russlanddeutschen Familien. Desweiteren wurde kurz die Theorie der Kollektiverziehung von Makarenko erwähnt und ihre Bedeutung für die sowjetische Familien- und Vorschulpädagogik erläutert.
3.1 Die Geschichte der Russlanddeutschen in Russland/Sowjetunion
Die lange Geschichte der Deutschen im Osten geht bis in das 17. Jahrhundert zurück4. Schon Zar Peter der Große öffnete Russland für eine kleine Gruppe von Einwanderern. Die meisten kamen aus der Oberschicht und siedelten sich zunächst in den großen Städten Moskau und St. Petersburg an (vgl. Strobl/Kühnel 2000: 18).
Seit Anfang des 18. Jahrhunderts kamen weiterhin viele Deutsche freiwillig nach Russland, um eine neue Existenz aufzubauen. Grundlagen dafür boten die Manifeste Katarinas II, die Deutschen religiöse und soziale Privilegien garantierten. Es wurden im Wolgagebiet und im Schwarzmeergebiet zahlreiche deutsche Siedlungen aufgebaut. Mit der Zeit gründeten die deutschen Kolonien eine Autonome Republik.
Die Einwanderer lebten fast vollständig isoliert von ihrer russischen Umwelt, hatten eigene Schulen, Theater, Bibliotheken, sowie eigene deutsche Zeitungen und Zeitschriften.
Die Amts- und Umgangssprache war Deutsch, das Land gehörte aber nicht den deutschen Siedlern5.
Die Geschichte der Sowjetunion begann bereits mit dem 7. November 1917, als die Bolscheviken unter Lenin6 die Macht ergriffen und sie an einen Rat von Kommissären (Sowjet) übertrugen. Am 30. Dezember 1922 wurde durch den Zusammenschluss von allen sowjetischen sozialistischen Republiken die “Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken” gegründet (kurz UdSSR oder Sowjetunion). Kurz danach, im Jahr 1924, kam Stalin an die Macht, das hatte verheerende Folgen nicht nur für Angehörige der nationalen deutschen Minderheit, sondern auch für alle sowjetische Bürger (vgl. “Russische Geschichte bis heute”, unter: http://www.studyrussian.com/history/geschichte.html, Zugriff 08.09.2007).Viele Deutsche waren in den dreißiger Jahren “Opfer der stalinistischen Säuberungen und Rekrutierung für die Zwangsarbeit” (Strobl/Kühnel 2000: 22).
Nach dem Überfall Hitlers ließ Stalin die Angehörigen des deutschen Volkes verschleppen, bevor noch die Wehrmacht die Siedlungen erreichte, das führte dazu, dass zahlreiche deutsche Siedlungsgebiete an der Wolga und am schwarzen Meer, wo Deutsche vor dem zweiten Weltkrieg zum größten Teil lebten, aufgelöst wurden (vgl. Knott/Hamm/Jung 1991: 9).Bei Kriegsausbruch kam es erneut zu Zwangsumsiedlungen und Vertreibungen nach Westsibirien und Mittelasien (Kasachstan, Kirgisien, Tadschikistan und Usbekistan).
Nach dem zweiten Weltkrieg hat sich die Situation der Deutschen, die jetzt überall in Osteuropa und Mittelasien lebten, dramatisch verschlechtert. Die Rückkehr in die früheren Wohngebiete wurde den Russlanddeutschen nicht gestattet, sie standen “unter lokaler Kommandantur, d.h. sie mussten sich in regelmäßigen Abständen bei den Behörden melden und durften ihre Wohnorte nicht verlassen” (Schneider: “Die Geschichte der Russlanddeutschen” 2005, unter: http://www.bpb.de/themen/AAlQ8R,3,0,Die_Geschichte_der_Russlanddeutschen.html#art3, Zugriff am 08.09.2007). So lebten Russlanddeutsche, wie die Tabelle 3.1 zeigt, als kleine Gruppe zwischen Russen und Angehörigen anderer, zum größten Teil asiatischer Völker (vgl. Kotzian 1991: 109).
Nicht selten haben viele Russlanddeutsche in der Sowjetunion Diskriminierungen erduldet. Fast bis Mitte der siebziger Jahre war der deutschen Bevölkerung die Ausübung ihrer Religion verboten, es gab zunächst keine deutsche Zeitung, wer deutsch sprach, galt nach wie vor als “Faschist”. Aus diesem Grund haben Eltern, um ihren Kindern diese Diskriminierungen in der Öffentlichkeit zu ersparen, mit ihnen nur Russisch gesprochen7. Russische Sprache wurde allmählich zur alltäglichen Umgangssprache und gehörte immer mehr zur Normalität des Alltags der deutschen Bevölkerung in der Sowjetunion (vgl. Ingenhorst 1997: 60f.). Bis in die sechziger Jahre war Deutschen verboten in der Öffentlichkeit die deutsche Sprache zu benutzen, aber auch noch später haben die meisten Deutschen ihre Muttersprache Deutsch aus Furcht, dadurch diskriminiert zu werden, nicht benutzt. Nur innerhalb der Familie und meistens von älteren Generationen wurde die deutsche Sprache benutzt. Unter solchen Bedingungen gingen nicht nur die Deutschkenntnisse verloren sondern auch die deutsche Kultur geriet in Vergessenheit (vgl. Dietz/Roll 1998: 23).
“Die anhaltende Diskriminierung der Deutschen war ein maßgeblicher Grund für die soziale und politische Auslese beim Zugang zu Hochschulen, Universitäten sowie höheren Positionen in Wirtschaft, Politik und Militär” (Strobl/Kühnel 2000: 23).
Alle Versuche der Deutschen, an der Wolga wieder eine autonome Republik einzurichten, sind gescheitert. Aus diesem Grund bemühten sich viele Angehörige der deutschen Minderheit immer wieder das Land zu verlassen und in die Bundesrepublik auszureisen, was jedoch zu keinem Erfolg führte. Die ersten zwanzig Jahre nach dem zweiten Weltkrieg hatten die Russlanddeutschen fast keine Möglichkeit die Sowjetunion zu verlassen.
Erst als Michael Gorbatschow im März 1985 zum Generalsekretär der KPdSU ernannt wurde und dann im Jahr 1989 zur Öffnung der Grenze beigetragen hat, lockerten sich die Ausreisebedingungen aus der ehemaligen Sowjetunion, was dazu führte, dass zahlreiche Deutschstämmige Familien in die Bundesrepublik ausreisten, da sie in der Sowjetunion keine Zukunft mehr sahen (vgl. dazu Schneider: “Die Geschichte der Russlanddeutschen” 2005, unter: http://www.bpb.de/themen/AAlQ8R,·4,0,Die_Geschichte_derß_Russlanddeutschen.html#art4, Zugriff am 08.09.2007).
Unter Gorbatschow begann in der Sowjetunion die Perestrojka (Erneuerung) und Glasnost (Öffnung). Im Jahr 1991 tritt Gorbatschow jedoch als Präsident der Sowjetunion zurück, noch im gleichen Jahr wird die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) aufgelöst. Ab dem Jahr 1991 gründete Russland mit zehn ehemaligen Sowjetrepubliken die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS).
Diese Informationen sind für das Verständnis dieser Arbeit insofern wichtig, als es hier um die Aussiedlerfamilien geht, die in Zeiten der Auflösung der Sowjetunion und aus Nachfolgestaaten der UdSSR, vor allem aus Russland und Kasachstan nach Deutschland ausgewandert sind8. Nach der Volkszählung von 1989 (vgl. Tabelle 3.1) lebten fast ca. 850 000 Russlanddeutsche in der Russischen Föderation (bzw. RSFSR) und fast eine Million in Kasachstan (vgl. Kotzian 1991: 102).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3.1: Deutsche in der UdSSR: Verteilung nach Republiken Quelle: eigene, veränderte Darstellung nach Kotzian 1991: 102
In dem Zeitraum von 1989 bis 1995 war die Zahl der Zuwanderer Aussiedler aus der vormaligen Sowjetunion bzw. der Nachfolgestaaten der UdSSR in der Bundesrepublik am höchsten (siehe dazu Abschnitt 4.2).
3.2 Entscheidung und Motive der Ausreise aus der ehemaligen Sowjetunion
Barbara Dietz weist darauf hin, dass die jugendlichen Aussiedler besonders schwer von der Ausreise aus ihrem Heimatland betroffen wurden, weil sie ihre vertraute Umbebung in einem Alter verlassen mussten, in dem “sie sich in einer seelischen und körperlichen Umbruchsituation befinden” (Dietz/Roll 1998: 30). Ihre Situation ist insofern kompliziert, da viele Jugendliche kaum selbst mitentscheiden durften und mit ihren Eltern nach Deutschland ausgereist sind, ohne dass sie es gewünscht haben. Bereits in den achtziger Jahren wiesen einige Aufsätze darauf hin, dass bei vielen Familien die Migrationentscheidung allein von Eltern, ohne die Einbeziehung der Jugendlichen und Kinder, getroffen wurde. In den neunziger Jahren wurden die jugendliche Aussiedler sogar als “mitgenommene Generation” bezeichnet, denn es wurde angenommen, dass sie bei der Ausreise kein Mitspracherecht hatten. Allerdings gibt es dazu kein empirisches Material, dass die Unfreiwilligkeit der Ausreise von Jugendlichen, die in den neunziger Jahre zugewandert sind, hinreichend belegt. Im Gegenteil zeigen einige Studien, dass die Mehrheit der Jugendlichen an der Ausreiseentscheidung mitgewirkt haben, außerdem konnte es empirisch belegt werden, dass Mitentscheidung und “Freiwilligkeit der Ausreise positive Auswirkungen auf die Befindlichkeit der Aussiedler in der Bundesrepublik hat” (Dietz/Roll 1998: 31).
Eine Interviewstudie von Barbara Dietz mit Jugendlichen aus der ehemaligen Sowjetunion zeigte, dass mehr als die Hälfte der Jugendlichen gemeinsam mit der Familie entschieden haben oder den Entschluss der Familie nach Deutschland auszureisen sehr unterstützt haben. Immerhin haben ca. 22,5% der Befragten entweder keine wesentliche Rolle bei der Entscheidung gespielt oder wurden gar nicht gefragt. Nur 5,5% der Interviewer wollten gar nicht ausreisen. Die einzelnen Angaben zu dieser Studie sind in Tabelle 3.2 aufgelistet (vgl. dazu Dietz/Roll 1998: 31f.).
Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass der größte Teil der jugendlichen Aussiedler nicht unfreiwillig mit ihren Familien in die Bundesrepublik ausgereist ist, im Gegensatz dazu haben die meisten Jugendlichen zur Ausreiseentscheidung beigetragen und nur wenige hatten das Gefühl, einfach mitgenommen zu sein. Meistens aber beruht die Zuwande-
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3.2: Mitwirkung der jugendlichen Aussiedler bei der Ausreise Quelle: Dietz/Roll 1998: 32
rung von ganzen Familien auf einer “eigenständigen und freiwilligen Ausreiseentscheidung mit dem Ziel eines dauerhaften Aufenthaltes und einer Lebensplanung in Deutschland” (Westphal 1999: 127).
Wenn die Jugendlichen nach dem Grund für den Entschluss auszureisen gefragt wurden, nannten die meisten an ersten Stehe ökonomische Gründe, “der Wunsch nach einer Verbesserung der materiellen Situation” (Dietz/Roll 1998: 33). Jedoch zeigen die Ergebnisse einer quantitativen Studie (vgl. Strobl/Kühnel 2000: 84f.), dass die Gründe und Motive für eine Migration sehr vielfältiger sind. Besonders vier Hauptaussiedlungsgründe spielen bei der Migrationentscheidung eine bedeutende Rohe. Als wichtigstes Motiv für die Eltern zu emigrieren, war die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für ihre Kinder. Denn “vor dem Hintergrund der ungünstigen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen in ihren Herkunftsländern ist zu erklären, dass für viele Aussiedler die Zukunftsperspektiven ihrer Kinder, worunter neben wirtschaftlichen und sozialen Faktoren auch eine funktionierende Gesundheitsvorsorge und intakte Umwelt verstanden wird, ein wichtiges Ausreisemotiv darsteht. Daneben steht nach wie vor der Wunsch, dass die Kinder ohne ethnische Diskriminierung “als richtige Deutsche” aufwachsen können” (Dietz 1999b: 15). Danach folgen Motive der Familienzusammenführung, Rückkehr ins Abstammungsland der Familie, und an vierter Stelle die Hoffnung auf materielle Verbesserung. Ein weiterer Grund, der häufig von der älteren Generation genannt wird ist der Wunsch “als Deutscher unter Deutschen zu leben”. Die Altere standen meistens an der Spitze der Familienhierarchie und wollten das über Generationen weitergegebene Ziel “als Deutscher unter Deutschen zu leben” für sich und ihre Kinder und Enkelkinder verwirklichen. Da sie wussten, dass sie auch nach Auflösung der Sowjetunion keine autonome Deutsche Republik bekommen würden, wollten sie ihr Ziel durch Aussiedlung in die Bundesrepublik erreichen (vgl. Ingenhorst 1997: 204).
Wie die Tabelle 3.3 zeigt, spielten dagegen die Gründe wie die Vermeindung des Armeedienstes sowie kriegerische Auseinandersetzungen im Herkunftsland für die Entscheidung auszureisen nur eine kleine Rolle.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3.3: Die Gründe für die Migration (Mehrfachantworten)
Quelle: Strobl/Kühnel 2000: 85
Es ist noch zu erwähnen, dass nach den Zusammenbruch der UdSSR die Lebenserwartung vieler Russlanddeutscher drastisch gesunken ist. Steigende Arbeitslosigkeit, hohe Inflationsrate, nicht ausbezahlte Arbeitslöhne, Finanzielle Begrenzung für Öffentliche Leistungen (insbesondere schlechte Finanzierung von Schulen, Bildungseinrichtungen so wie des Gesundheitswesens) führten dazu, dass viele deutschstämmige Familien den Entschluss gefasst haben in die Bundesrepublik auszureisen. Die wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Umstrukturierung in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion sowie ständige Angst vor ausbrechenden Nationalitätenkonflikten waren weitere Motive für die Entscheidung das Heimatland zu verlassen (vgl. Westphal 1999: 127).
3.3 Erziehung im Herkunftsland und mitgebrachte Sozialisation
3.3.1 Familienpolitik in der Sowjetunion
Bei der Entwicklung der sowjetischen Gesellschaft spielt die Familie, insbesondere bei der Erziehung der jungen Generation, eine bedeutende Rolle. Aus diesem Grunde waren Partei und Staat, wie überhaupt die ganze sowjetische Gesellschaft stets bestrebt, die Ehe- und Familienbeziehungen zu festigen (vgl. Ahlberg 1969: 178).
Das russische Lehrbuch “Einführung in die Soziologie” von Asp nennt wichtige Aufgaben der Familie und Erwartungen, die die sowjetische Gesellschaft an die Institution der Familie hat:
“Как от социалпного института от свмпи ожидают, чтобы ona соответствовала требованиям общества, которые (требования), в свою очередп, основываются на ценностях общества. Семпя “отвечает” за воспроизводство населения, т.е. за рождение и воспитание детеи, а так же за их социализацию” (Acn: “Введение в социологию” 1998, unter: http://www.i-u.ru/biblio/archive/asp_vvedenie/02.aspx, Zugriff am 08.09.2007).
Das heißt, von der Familie, wie von einem sozialen Institut, wird erwartet, dass sie den Forderungen der Gesellschaft entspricht. Diese Forderungen werden, seinerseits, auf Werte der Gesellschaft gegründet. Die Familie ist verantwortlich für die Reproduktion der Bevölkerung , für die Geburt und die Erziehung der Kinder, sowie für ihre Sozialisation.
“Несмотря на болпшое число институтов, участвующих в социализации личности, централпное место в этом процессе безусловно занимает семпя. Это обпясняется прежде всего тем, что именно в семпе осуществляется первичная социализация индивида, закладываются оснобы его формирования как личности” (Фролов: “Инситут СемЪи” Социология: Учебник, unter: http://mx4.ru/frolov_sociology/33/09/, Zugriff am 08.09.2007).
Der russische Soziologe Sergej Frolov (Сергеи Фролов) unterstreicht noch einmal die Bedeutung der Familie im Sozialisationsprozess. Er meint, dass unabhängig von der großen Zahl der Institute, die an der Sozialisation der Persönlichkeit teilnehmen (in Abschnitt 3.3.5 wird erläutert, dass dies eine sehr große Rolle bei der Erziehung von Kindern in Sowjetzeiten spielt), nimmt die Familie jedoch eine zentrale Stelle in diesem Prozess ein. Denn das ist der Ort, an dem die primäre Sozialisation des Individuums verläuft und wo die Grundlagen seiner Persönlichkeitsbildung gelegt werden (vgl. dazu auch Abschnitt 2.3 Familie als wichtigste Sozialisationsinstanz).
Der folgende Textabschnitt aus dem Programm der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (kurz KPdSU) zeigt, welcher Stellenwert einer Familie in der UdSSR in Zeiten der Perestrojka und Regierung von Gorbatschow zugeschrieben wird:
“Die KPdSU betrachtet die verstärkte Sorge um die Familie als ein Anliegen von großer staatlicher Bedeutung. Die Familie spielt eine große Bedeutung bei der Festigung der Gewährleistung des sozialen und ökonomischen Fortschritts der Gesellschaft sowie bei der Verbesserung der demographischen Prozesse. In dem Familie prägen sich die Grundzüge des Charakters des Individuums und seine Einstellung zur Arbeit, zu den moralischen, ideologischen und kulturellen Werten aus. Die Gesellschaft ist zutiefst an einer stabilen, geistigen und moralisch gesunden Familie interessiert. Davon ausgehend, erachtet es die Partei für notwendig, die Familie zu festigen und bei der Führung ihrer sozialen Funktionen und bei der Erziehung der Kinder zu unterstützen sowie, die, materiellen, die Wohnverhältnisse und sonstigen Lebensbedingungen der Familie mit Kindern und jungen Ehepaaren zu verbessern. - Es gilt, das Zusammenwirken von Familie, Schule, und Arbeitskollektiv zu vertiefen sowie die Verantwortung der Eltern für die Erziehung der Kinder ebenso wie, die Verantwortung der Kinder für das Wohlergehen der Eltern, ihr gesichertes und sorgenloses Leben im Alter, zu erhöhen’’ (Textpassage aus dem revidierten Programm der KPdSU, 218 in Liegle 1987: 83).
In Zeiten des Sozialismus sah sich der Staat als Erziehungsstaat und “Träger aller aufierfamiliären Erziehungs- und Bildungseinrichtungen” (Liegle 1987: 71). Die Kinder wurden in der Sowjetunion als Zukunftsträger der Gesellschaft angesehen. Von daher sorgte der Staat besonders für die vorschulische und schulische Ausbildung der Kinder und unterstützte damit Familien im Erziehungsbereich (vgl. Ruttner in “Die mitgenommene Generation” 2002: 82, unter: http://www.dji.de/bibs/_5_Aussiedlerjugendliche_l.pdf, Zugriff am 08.09.2007).
Die Staat bemühte sich Frauen aller Nationalitäten, in ländlichen und städtischen Regionen “unter der staatlichen Emanzipationsideologie zu vereinigen und ihre Lebensbedingungen zu verallgemeinern” (Westphal 1999: 129). Das verlief zunächst durch Einbezug der Frauen in das Erwerbsystem. Seit 1970 erhielten die Frauen nicht selten ein höheres Bildungsniveau als ihre Männern und waren fast in allen Bereichen der beruflichen Arbeit integriert, allerdings war das Lohnniveau der weiblichen Arbeitskräfte viel geringer als das der männlichen. Der Durchschnittslohn der Frauen war 65-70% gerin- ger als der Lohn vergleichbarer Kollegen. Dennoch war die Erwerbsquote der Frauen in der ehemaligen Sowjetunion sehr hoch, das zeigt die Befragung der Russlanddeutschen vom Osteuropa-Institut München, sie ergab, dass ca. 80-90% der Frauen vor ihrer Abreise berufstätig waren.Dabei haben viele Frauen nicht nur aus finanzieller Notwendigkeit gearbeitet, vielmehr gab ihnen die Berufstätigkeit persönliche Zufriedenheit und wirtschaftliche Unabhängigkeit.
Neben dem Ziel, die Frauen in das Erwerbssystem einzubeziehen, hatte die sowjetische Staatspolitik vor, familiäre Aufgaben zu vergesellschaften. Das bedeutet, die Familien sollten von ihren wichtigsten traditionellen Aufgaben wie Haushalt und Kindererziehung durch öffentliche familienergänzende Erziehungsinstitutionen entlastet werden. Das geschah einmal durch Errichtung von Volkskantinen und durch ständigen Ausbau der staatlich organisierten Kinderbetreuung. Die öffentliche Erziehungseinrichtungen sollten die Versorgung und Betreuung der Klein- und Schulkinder übernehmen und gleichzeitig zur Entlastung der berufstätigen Mütter beitragen. In der Regel waren die Öffnungszeiten der Kinderkrippen und Kindergärten den normalen Arbeitszeiten der Eltern angepasst, so dass beide Eltern tagsüber ihrem Beruf nachgehen konnten (vgl. Westphal 1999: 133).
Im Jahr 1981 setzte der Staat weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Familien in der Erziehung und führte das Erziehungsgeld und den Erziehungsurlaub ein, allerdings waren nur die Mütter Anspruchsberechtigte, Väter hatten keinen Anspruch darauf (vgl. Liegle 1987: 65).
Im Gegensatz zu westlichen Gesellschaften, in denen erzieherischen Aufgaben in der Regel von Familien übernommen werden, lagen in der sowjetischen Gesellschaft diese Aufgaben teilweise in staatlicher Hand. Die Erziehungsziele orientierten sich sowohl in öffentlichen Erziehungsinstitutionen als auch in der Familie an der hierarchisch aufgebauten, dem Kollektiv verpflichteten Sozialstruktur (vgl. Dietz 1999b: 15f.).
Die Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 brachte einige Veränderungen für die Familien im Bereich Frauenerwerbstätigkeit und Kinderbetreuung mit sich. Im Verlauf der wirtschaftlichen Umstrukturierung in Perestrojkazeit verloren viele Frauen ihre Arbeitsplätze. Es kam zu dramatischem Anstieg der Erwerbslosigkeit und eine Verschlechterung der materiellen Lebenslage vieler Familien. Zudem waren der Kündigungsschutz für schwangere Frauen und Mütter mit Kindern weggefallen “da ein Zuwachs an ungeschützten und befristeten Arbeitsverhältnissen zu verzeichnen war” (Westphal 1999: 133). Die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung der Frauen verschlechterten sich dramatisch, sowie auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die alltägliche Doppelbelastung der Frauen wurde durch diese Veränderungen verschärft. Viele Familien hatten große Schwierigkeiten ihr Alltagsleben zu organisieren und den Lebensunterhalt zu sichern.
Zahlreiche betriebliche Sozialleistungen wie, Betriebskindergärten und Ferienlager für Kinder sind weggefallen. Wegen finanzieller Schwierigkeiten wurden einige staatliche Kinderbetreuungseinrichtungen und Bildungswesen geschlossen (vgl. Westphal 1999: 132134). Die Erziehungsaufgaben zwischen Staat und Familie in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion sind nicht mehr klar definiert. Die kollektiv ausgerichtete Erziehung existiert nicht mehr, stattdessen treten individualistische Wertvorstellungen und Erziehung an Autonomie in den Vordergrund. Jedoch fühlten sich viele Familien und Erziehungsinstitutionen mit dieser Veränderung überfordert (vgl. Dietz 1999b: 16). “Mit Blick auf Erziehungsziele und -aufgaben ist eine tiefe Verunsicherung festzustellen, die im Grunde die Orientierungskrise der postsowjetischen Gesellschaft widerspiegelt” (Dietz 1999b: 16).
Bis 1991 war die Sowjetunion “der größte Flächenstaat der Erde, mit mehr als hundert Nationalitäten” (Westphal 1999: 128) und obwohl die Russlanddeutschen in der ehemaligen UdSSR als Minderheit lebten, waren sie von den wesentlichen Entwicklungsmerkmalen der Sowjetgesellschaft sowie von der Postsowjetischen Gesellschaft genauso betroffen wie alle andere Bürger (vgl. Herwartz-Emden 2000: 33).
Ausgehend von politischen, wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten nach dem Zusammenbruch der UdSSR und anderen Problemen, die den Alltag der russlanddeutschen Familien in der nachsowjetischen Gesellschaft kennzeichneten (vgl. Abschnitt 3.2), kam es in den neunziger Jahren zu einer große Auswanderungswelle von Russlanddeutschen in die Bundesrepublik Deutschland.
3.3.2 Struktur der Familie und geschlechtsspezifische Erziehung
An dieser Stelle wird die Struktur der Familie in der ehemaligen Sowjetunion durch traditionelle Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, das Zusammenleben der Generationen und durch geschlechtsspezifische Erziehung dargestellt. Außerdem wird kurz auf die Bedeutung der Familie für die Russlanddeutschen in ihrer Heimat eingegangen. Allerdings muss es hier erwähnt werden, dass “diese traditionellen familiären Strukturen spätestens seit dem gesellschaftlichen Umbruch in den Nachfolgestaaten der UdSSR nicht mehr durch gesellschaftlichen Konsens getragen werden” (Dietz/Roll 1998: 81).
Ein wesentliches Charakteristikum der sowjetischen Gesellschaft war, dass alle Frauen, unabhängig von ihrem Familienstatus und der Kinderzahl, berufstätig waren, außerdem mussten sie die ganze Verantwortung für Familienhaushalt und Kindererziehung alleine tragen. Obwohl ein hoher Anteil der Frauen der Berufstätigkeit nachging, herrschte zwischen Männern und Frauen eher eine traditionelle Rollenverteilung vor. Für die Frau bedeutete das, dass “sie in ihrer Eigenständigkeit als berufstätige Frau anerkannt wurde, aber zugleich traditionell weiblichen Aufgaben in ihrem Alltag verpflichtet war” (Herwartz-Emden 2000: 32).
Von den Frauen wurde erwartet, dass sie in erster Linie die Verantwortung für die Kindererziehung, für die Familie sowie für die Organisation des Alltags und des sozialen Lebens übernahmen. Dabei muss noch berücksichtigt werden, dass der Haushalt vor allem auf dem Land mit sehr viel Arbeit verbunden war und somit viel Zeit beanspruchte (vgl. Dietz/Roll 1998: 84). Die empirischen Untersuchungen in der vormaligen Sowjetunion haben gezeigt, dass die Haushaltspflichten einer unverheirateten Frau sich im Zeitbudget einer Woche auf 13,30 Stunden beliefen. Im Vergleich dazu brauchte eine verheiratete Frau ohne Kinder 17,35 und eine verheiratete Frau mit Kindern 28,10 Stunden in der Woche nur für den Haushalt. Demzufolge führte das Zusammenleben mit einem Mann als auch mit Kindern zu einer Mehrbelastung der Frauen.
Laut dieser Untersuchungen investierten Männer bzw. Väter nur ca. 11 Stunden in der Woche für Hausarbeit (vgl. Liegle 1987: 63L). Jedoch trifft das eher zu, wenn Familien in städtischen Siedlungsgebieten lebten. Dagegen gab es bei Familien, die in ländlicher Gegend lebten und eigene Privatwirtschaft hatten mehr Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern. Das bedeutet, dass auch Männer sich neben der berufliche Arbeit mehr für den häuslichen Bereich einsetzen mussten. Hauptsächlich waren Männer für die traditionelle schwere Männerarbeit außerhalb des Hauses und am Haus zuständig. Zu diesen Arbeiten zählten z.B. die Reparaturenarbeiten, die Viehversorgung und die Landwirtschaft.
Diese geschlechtspezifische Arbeitsteilung wurde begründet “mit der biologisch gegebenen Geschlechterdifferenz, die wiederum die geschlechtsspezifische Sozialisation und Erziehung legitimierte” (Herwartz-Emden 2000: 32).
Die Kinder sind in der ehemaligen Sowjetunion ganz selbstverständlich damit aufgewachsen, dass alle Mütter ganztags berufstätig waren und sich gleichzeitig um Familie und Haushalt kümmerten. Ferner wurden die Kinder selbst bereits sehr früh in die häusliche Frauen- bzw. außerhäusliche Männerarbeit einbezogen (vgl. Dietz/Roll 1998: 84L). Die Eltern übertrugen den Kindern eine ganze Reihe von Aufgaben. Zum Beispiel übernahmen die Töchter selbstverständlich einige Aufgaben im Haushalt oder sie betreuen ihre jüngere Geschwister. Es wurde vor allem von Töchtern erwartet, dass sie dem traditionellen weiblichen Rollen Verständnis entsprachen (vgl. Dietz 1999b: 29).
Als gesellschaftlich erwünschte weibliche Eigenschaften gelten Schönheit, Geschichtlichkeit, Bescheidenheit, Fleiß sowie Mietgefühl. Dagegen zeichnet sich ein Mann durch Stärke, Tapferkeit, Mut und Ehrlichkeit aus. Es ist üblich, dass Jungen ständig an der Seite ihres Vaters sind und von ihm die typischen Männer arbeiten erlernen. Es wird ihnen von klein auf von Vater vorgelebt Verantwortung zu übernehmen, schwere Last zu tragen und die Familie zu beschützen. Diese Geschlechtsspezifische Erziehung im Elternhaus wurde zum Beispiel auch durch unterschiedliche Spielsachen sowie Rollenspiele gelenkt und setzte eine spätere Familiengründung als selbstverständlich voraus (vgl. Ruttner in “Die mitgenommene Generation” 2002: 86, unter: http://www.dji.de/bibs/_5_Aussiedlerjugendliche_l.pdf, Zugriff am 08.09.2007).
Kinder wurden in der Familie mit großer Liebe, aber auch ziemlich streng, eher traditionell und autoritär erzogen,9 sie sollten immer die Anweisungen der Erwachsenen (Autoritärpersonen: Eltern, Großeltern, Erziehern, Lehrer) folgen. Was die Eltern sagten, war für Kinder das Gesetz, somit hatten die Eltern in der Familie bei grundlegenden Entscheidungen immer das letzte Wort. Gehorsam und Respekt vor Erwachsenen war der primäre Erziehungsziel. In russlanddeutschen Familien war es üblich die Eltern und Großeltern als Zeichen des Respekts mit “Sie” anzusprechen. Die Autorität der Eltern und Großeltern wurde von Kindern nie in Frage gestellt und immer akzeptiert. Denn, der autoritär ausgerichtete sowjetische Erziehungsstil verlangte von Kindern in erster Linie Gehorsam und “die Unterordnung unter die Autorität der Erwachsenen”. Dabei verlangte die geschlechtsspezifische Erziehung von den Mädchen Anpassung an das andere Geschlecht (vgl. Herwartz-Emden 2000: 32L).
Unter elterlicher Autorität wurde in Familien nicht nur die strenge Erziehung verstanden, sondern es kam auch Fürsorge und Verantwortlichkeit für das Kind zum Ausdruck.
Für die Russlanddeutschen bedeutete die Familie in der UdSSR nicht nur die ElternKind-Verbindung (Kleinfamilie), sondern es wurden auch die Großeltern und nahstehende Verwandte mit einbezogen. Besonders für die russlanddeutschen Familien waren enge und gute Kontakte und Beziehungen zu anderen Verwandten von großer Bedeutung, der Zusammenhalt der Familie war sehr wichtig. Die Deutstämmigen “sehen sich als Gemeinschaft, deren Zusammenhalt für die einzelnen Familienmitglieder von existentieller Bedeutung ist” (Dietz/Roll 1998: 80). Von daher war ein starker Familienzusammenhalt und ein ausgeprägter Familiensinn charakteristisch für russlanddeutsche Familien. Wegen der begrenzten Wohnsituation war es üblich, dass Kinder bis zur Heirat bei den Eltern wohnten und sogar mit eigener Familie die Wohnung der Eltern teilen mussten, da es sehr schwierig war, in der Sowjetzeit eine eigene Wohnung zu bekommen. So war es keine Seltenheit, dass die Dreigenerationenfamilie (Großeltern-Eltern-Enkelkinder) unter einem Dach lebten. Andererseits waren die beiden Generationen in bestimmten Situationen auf einander angewiesen, die ältere Generation brauchte finanzielle Unterschützung und die jüngere die Unterschützung in Haushalt und Kinderbetreuung.
Aufgrund einiger Probleme des Alltags in der sowjetischen Familie (wie z.B. unzureichende Angebote an Kindertagesstätten, zeitliche Überlastung der jungen Frauen wegen ihrer Berufstätigkeit und ihrer geringeren Entlastung durch die Ehemänner, sowie große Schwierigkeiten eine eigene Wohnung zu finden) ist die Unterstützung von Seiten der Eltern und Verwandten sehr wichtig für das normale Funktionieren der jungen Familie. Aus oben genannten Gründen, war es also nichts selten, dass die Großeltern ein Teil der Haushaltsführung, sowie Betreuungs- und Erziehungsaufgaben übernahmen, um das Leben der jungen Familie zu erleichtern (vgl. Liegle 1987: 77f.). Somit hatten die Großeltern eine große Verpflichtung und Verantwortung in der Erziehung der Enkelkinder. Unter diesen Umständen mussten die Kinder von klein auf lernen gemeinschaftlich orientiert zu handeln und sich der Gruppe anzupassen. “In den Familien waren die Strukturen, Funktionsabläufe und die Erziehungs- und Fürsorgekonzepte in hohem Grade moralischemotional ausgerichtet” (Herwartz-Emden 2000: 33).
Nach Ludwig Liegle zeichnet sich der Alltag der Familie in der sowjetischen Gesellschaft dadurch aus, dass er “sozial-räumlich ausgegrenzt und zeitlich stark reduziert ist” (Liegle 1987: 74). Der Tagesablauf der Eltern wird demnach bestimmt durch ihre Erwerbstätigkeit, durch zeitaufwändiges Einkäufen und durch notwendige Haustätigkeiten. Die Kinder verbringen die meiste Zeit in öffentlichen Erziehungsinstitutionen (Kinderkrippe, Kindergarten, Schulen ect.) oder werden von den Großeltern betreut. Die gemeinsam verbrachte Zeit beschränkt sich meistens auf Mahlzeiten, Arbeiten im Haushalt und Freizeitaktivitäten. “Dennoch bildet der gemeinsame Familienalltag die wesentliche sozial-emotionale Lebensgrundlage für Erwachsenen und Kinder” (Liegle 1987: 75). Trotz der zeitlichen Begrenzung der Eltern-Kind-Interaktion bleibt für viele Jugendliche die Familie die wichtigste soziale Bezugsgruppe. Vor allem die jüngere Generation erinnert sich in Deutschland an eine “fast durchgängig schöne und problemlose Kindheit” und an alles, was sie damit verbinden: Ein intaktes (Groß-)Eltern-Kind-Verhältnis, Naturerleben, nahen und täglichen Kontakt mit Tieren, sowie ein eigenes Haus mit Garten (vgl. Ingenhorst 1997: 137).
Nach Aussage erwachsener Aussiedler aus der UdSSR, was für sie im Herkunftsland das Wichtigste war, kann man festhalten, dass für die meisten Befragten die Kinder und ein harmonisches, glückliches Familienleben (wobei viele unter den Begriffen Haus und Hof auch das Familienleben verstehen) in der Sowjetunion den Lebensmittelpunkt stellten.
“Sie waren zentral wichtig und zeigten eine sehr starke Fixierung auf den eigenen Fa- milienverband” (Ingenhorst 1997: 135). Wie die Abbildung 3.1 zeigt, war ein sicheres Arbeitsplatz für ein Viertel der Befragten wichtig. Erfolg im Beruf zu haben, Sparen und Alterssicherung spielten ebenfalls keine große Rolle. Dagegen spielten die Kinder und ein sicherer Arbeitsplatz für Frauen eine bedeutende Rolle und für Männer waren Haus und Hof, so wie ein besserer Lebensstandart und die Gesundheit wichtig (vgl. Abbildung 3.1). Fest steht aber, dass die Familie für die Russlanddeutschen in der Sowjetunion ein einprägenden Mittelpunkt des Lebens darstellte. Wobei der Begriff Familie sich nicht nur auf Eltern-Familie oder Drei-Generationen-Familie bezieht, sonder auf die ganze Verwandtschaft.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3.1: Im Herkunftsland Wichtiges (Mehrfachnennungen in % der Befragten)
Quelle: Ingenhorst 1997: 135
Besonders nach dem Ende der ehemaligen Sowjetunion, in Zeiten staatlicher Ohnmacht und damit verbundenen Funktionsverlust, hatte die Familie noch höheren Stellenwert, “sie blieb der zentrale und verlässliche Orientierungspunkt im Leben” und “garantierte unter den schwierigen gesellschaftlichen Bedingungen emotionalen Rückhalt und Stabilität” (Tulinow in “Die mitgenommene Generation” 2002: 113, unter: http://www.dji.de/bibs/_5_Aussiedlerjugendliche_l.pdf, Zugriff am 08.09.2007). Sie war der Ort, an dem die Auseinadersetzung mit den veränderten Werten und Normen stattfinden konnten.
3.3.3 Frauenzentriertheit in der Familie
Wie oben schon erwähnt, trugen die Mütter im Vergleich zu den Vätern mehr Zuständigkeit und Verantwortung für die Kindererziehung, obwohl fast alle Frauen ganztags berufstätig waren. Diese Mutterzentriertheit oder die Erziehungseinstellung “mütterliche Kontrolle” in der sowjetischen Familie war sehr verbreitet: “Erziehung ist die Frauensache, wenn die Mutter arbeitet, dann ist das nächste weibliche Familienmietglied zuständig” (Herwartz-Emden/Westphal 2000: 113).
Verschiedene sowjetische Untersuchungen zeigten, dass die Mütter viel mehr die Zeit mit ihren Kindern verbrachten als die Väter. Nur ein Viertel der Väter nahmen aktiv an der Betreuung und Erziehung der Kinder teil. Es sind Mütter, die in sehr viel höherem Mafie die Gesprächspartner für Kinder in Angelegenheiten der Familie, der Freizeit und der Gesellschaft darstellten. Dementsprechend wendeten sich Kinder mit ihren Freuden und Sorgen viel häufiger an ihre Mütter als an ihre Väter (vgl. Liegle 1987: 64f.).
Die im Rahmen einer anderen Studie Befragten gaben an, dass die Erziehung der Kinder bei neun von zehn Befragten von der Mutter und daneben bei zwei Dritteln vom Vater geleistet. Jeder zehnte wurde von Babuschka (Großmutter) erzogen, was weiter nicht sehr verwunderlich ist, denn die empirische Untersuchungen zeigten, dass etwa 40 Prozent der jungen Familien in der vormaligen Sowjetunion mit ihren Kindern und Eltern zusammen in einem Haushalt lebten (vgl. Ingenhorst 1997: 136).
Die gesellschaftlichen Erziehungsinstitutionen zählten zwar neben der Familie zu einem wichtigen Erziehungsfaktor. Allerdings gab es nicht immer ausreichend Plätze für alle Kinder in den Kindertagesstätten. So waren diejenigen Familien, die für ihr Kind keinen Platz bekommen hatten, auf die Hilfe der Großmutter oder einer weiblichen Verwandten angewiesen. Trotzt unzureichender Anzahl von Kinderkrippenplätzen, haben die Mütter mit kleinen Kindern nicht aufgehört zu arbeiten, viele waren sogar ohne Unterbrechungen berufstätig. Dass sowjetische Frauen in das Erwerbssystem voll integriert waren, bedeutete für sie allerdings keinesfalls eine Entlastung von Kinderbetreuung und Haushalt. Vielmehr waren sie durch Berufstätigkeit und Haushalt doppelt belastet, denn es war nicht einfach, Familie und Beruf zu vereinbaren. Das lag zum einen daran, dass es in der UdSSR in vielen Familien die traditionelle geschlechtsspezifische Arbeitsteilung gab und die Frauen zum größten Teil alleine die Haushalt geführt haben. Zum anderen stellte sich die Führung von Haushalt als sehr mühsam und zeitintensiv dar. Die Gründe dafür waren zum Beispiel Mangel an Dienstleistungsbetrieben wie Reinigung, Restaurants, Schneidereien sowie eine mangelnde Ausstattung mit elektrischen Haushaltsgeräten. Entsprechend war die Erledigung von Hausarbeiten mit viel Zeit verbunden (vgl. Westphal 1999: 129-132).
Die Frauenzentriertheit in dem Familienhaushalt und Mutterzentriertheit in der Familienerziehung in der ehemaligen Sowjetunion kann einerseits “als ein Relikt von Jahrhunderte alter Tradition im Bewusstsein und Handeln der Menschen interpretiert werden” (Liegle 1987: 65), andererseits kann sie aber auch als das Ergebnis einer “traditionellen” Politik verstanden werden. Als Beispiel dafür können die Maßnahmen des Staates zur Förderung der Erziehung in der Familie genannt werden, denn es waren ausschließlich die Mütter die Anspruch auf Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub hatten, Väter waren nicht anspruchsberechtigt (vgl. Liegle 1987: 65).
3.3.4 Die Theorie der Kollektiverziehung nach Makarenko
In diesem Abschnitt möchte ich kurz auf die Bedeutung des Sozialisationsmodells von Makarenko und die von ihm entwickelte Theorie der Kollektiverziehung auf die sowjetische Pädagogik eingehen.10
Anton Semjonowitsch Makarenko (1888-1939) ist einer der bekanntesten sowjetischen Pädagogen und Schriftsteller. Er entwickelte ein wichtiges sozialistisches Sozialisationsmodell und beeinflusste damit die Grundlagen der sowjetischen Familien- und Vorschulpädagogik. Makarenko unterstrich den Platz der Familie im Erziehungsprozess und “weist auf die Wichtigkeit der familiären und elterlichen Autorität für die moralische Erziehung der Kinder hin” (Carrére ďEncausse 1979: 28).
Mit einem seiner bedeutendsten Werke “Buch für Eltern” machte Makarenko “den Anfang für eine dringend notwendige Pädagogik der sozialistischen Familie” (Kolbanowski 1952: 15). Es handelt sich in diesem Buch um die Erziehung des Vorschulkinders in der Familie, denn die vorschulische Erziehung gilt in der Sowjetunion als wichtige Vorbereitungsstufe für den Eintritt in das Schulkollektiv und in die kommunistische Gesellschaft (vgl. Liegle 1970: 98). Dabei verfolgte Makarenko das Ziel, den Eltern bei der Erziehung in der Familie zu helfen und ihnen seine pädagogischen Erfahrungen zu vermitteln. Nach seiner Meinung ist die Familie im Lande des Sozialismus ein “wichtiger Faktor der Erziehung. Selbst wenn man bedenkt, dass die Kinder in Kinderkrippen und Kindergärten betreut werden und die Schule besuchen müssen, verbringen sie nicht weniger als zwei Drittel ihres Kinderlebens in der Familie. Daher ist es für die sozialistische Sowjetgesellschaft wichtig zu wissen, welche Erziehung das Kind in der Familie erhält” (Kolbanowski 1952: 14L).
Dennoch, die Rolle der Familie im Erziehungsprozess nach Makarenko bedarf einer Erläuterung, denn zum einen geht er davon aus, dass die Autorität der Familie über das Kind vom Staate übertragen ist und zum anderen besteht er auf der Übereinstimmung zwischen den Werten der Familie und der Gesellschaft. “Die Werte der Familie sind der Gesellschaft entnommen und können mit deren Werten nicht in Konflikt geraten” (Carrére ďEncausse 1979: 28). Nach Makarenkos Meinung ist die Familie zwar das primäre Kollektiv der Gesellschaft, allerdings entwickele sich die Persönlichkeit des Kindes erst durch viele weitere gesellschaftliche Kollektive, die jedoch denselben Prinzipien folgen. Die familiäre Erziehung wird durch die Erziehung in anderen Gemeinschaften (Kindergarten, Schule, Pionierorganisationen usw.) ergänzt. Was Makarenko betrifft, ist der sozialistische Wettbewerb das wesentliche sowjetische Erziehungsprinzip. Zum Aufbau sozialistischer Erziehung sind daher folgende Prozesse zu nennen:
- starker Einsatz von peer-Kollektiven (dabei besteht aber die Gefahr, dass diese Kollektive mit der Familie konkurrieren und sie als primären Sozialisationsfaktor ausstechen)
- Wettbewerb zwischen Gruppen
- starke Beziehung zwischen individuellen und kollektiven Zielen und Erfolgen
- kollektive Bewertung von individuellem Verhalten
- und öffentliche Kritik (Gruppenkritik) und Selbstkritik (vor der peer group) als wichtigste Formen sozialer Kontrolle.
Demzufolge werden Eltern von der Gesellschaft beauftragt, ihre Kinder entsprechend der Normen der sowjetischen Gesellschaft zu erziehen und sich an diese Normen zu halten. Anderenfalls, wenn die Eltern sich von den Normen und Verhaltensmustern, die ihre Kinder in peer-Kollektiven lernen, abweichen, gelten Kinder ihren Eltern als entfremdet (vgl. Carrére ďEncausse 1979: 28f.).
Nach Makarenko hat jeder Einfluss von Erwachsenen nicht nur in den ersten Lebensjahren eine große Wirkung auf die Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes. Eltern tragen “die ganze Verantwortung für die von ihnen vermittelten geistigen Einstellungen” (vgl. Carrére ďEncausse 1979: 29) und sollen daher, als primäre Erzieher, sich immer Mühe geben, den Kindern durch ihr eigenes Verhalten ein Vorbild zu sein. Denn ein “tiefes Moralgefühl und die gemeinsamen Erfahrungen des Familienkollektivs sind die absolut notwendige Voraussetzung der sowjetische Erziehung” (Makarenko 1952: 65).
Nach Meinung der Makarenko ist ein vollwertiger Mensch jemand, “dessen Bedürfnisse und Wünsche den Bedürfnissen und Wünschen des Kollektivs entsprechen” (Makarenko 1952: 65) und in erster Linie ist die “Familie an der Erziehung zu einem solchen Kollektivismus beteiligt” (Makarenko 1952: 65). Denn in der Familie sollten die Kinder lernen sich an das Leben in einem Kollektiv anzupassen.
Makarenkos Theorie der Kollektiverziehung hatte große Bedeutung für die sowjetische Familien- und Vorschulpädagogik und beeinflusste stark die Erziehung der Kinder nicht nur in der Familie sondern auch in den öffentlichen Institutionen.
3.3.5 Erziehung in den öffentlichen Institutionen
In der ehemaligen Sowjetunion übernahmen die Staatliche Erziehungsinstitutionen (Kindergarten, Schulen ect.) viele Aufgaben bei der Erziehung von Kindern. Diese spielten neben der Familie eine wesentliche Bedeutung für die Erziehung der Kinder und Jugendlichen und waren somit eine sehr wichtigen Sozialisationsinstanzen. “Der Ausbau öffentlicher Erziehungseinrichtungen für Klein- und Vorschulkinder gehört zu jenen Maßnahmen des Sowjetstaates, die der Entlastung der berufstätigen Mütter dienen” (Liegle 1987: 76). Dabei hatten die öffentlichen Erziehungseinrichtungen die Aufgabe, Kinder möglichst früh im Sinne des Sozialismus zu erziehen. Aufgrund der Berufstätigkeit beider Elternteile waren die Kindern von klein auf entweder in einer öffentliche Erziehungsinstitution oder bei den Großeltern untergebracht.
Einige empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder, die Kindergärten besuchten im Gegensatz zu Kindern, die von der alleine Familie erzogenen wurden, bessere Forschritte in der Entwicklung machten. Deshalb galt in der Sowjetunion für verantwortungsbewusste Eltern die Pflicht, die Erziehung ihrer Kindern den dafür ausgebildeten Spezialisten zu überlassen. Weil die Eltern keine angemessene Ausbildung für die Kindererziehung hatten, wurden sie vom Staat indirekt für erziehungsunfähig erklärt.
Das Ziel des Staates war es, möglichst alle Kindern die gleiche Erziehung in staatlichen Einrichtungen durchlaufen, die auf gesellschaftliche Bedürfnisse (wie Kollektiv, Arbeitserziehung und Disziplin) ausgerichtet waren (vgl. Ruttner in “Die mitgenommene Generation” 2002: 88, unter: http://www.dji.de/bibs/_5_Aussiedlerjugendliche_l.pdf, Zugriff am 08.09.2007).
Die Kindertagesstätten bzw. die Vorschuleinrichtungen bestanden je nach dem Alter der Kinder aus mehreren Gruppen. Wie die Abbildung 3.2 zeigt, konnte man die Kindertagesstätten grob in zwei Einrichtungen wie folgt unterscheiden: Kinderkrippen (ясли / jasli) für Kleinkinder von sechs Monaten bis zum drittem Lebensjahr und Kindergärten (детский сад / detski sad) für Vorschulkinder. Außerdem gabt es Vorbereitungsklassen für die Kinder, die keinen Kindergarten besuchten (vgl. Grant 1966: 91).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3.2: Grundstruktur des Bildungswesens in der ehemaligen UdSSR bzw. in GUS
Quelle: Das Schulsystem in Russland, unter: http://ddi.in.tum.de/filcadmin/matcrial/Lchrvcranstaltungcn/04- ü5/Oberseminar/Das-Schulsystem_-in-Russland-Vortragl.doc, Zugriff am 08.09.2007
Zu den Aufgaben des Personals in Kinderkrippen gehörten in erster Linie die Überwachung von Spiel und Mittagsschlaf der Kinder. Der Unterricht kam erst später im Kindergarten dazu. Laut Statistik, besuchten ca. 70% aller Kinder in der UdSSR einen Kindergarten, was angesichts der großen Anzahl berufstätiger Frauen nicht sehr verwunderlich ist. Die Öffnungszeiten der Kindergärten richteten sich je nach der Arbeitszeit der Eltern, die meisten Einrichtungen waren bis zu 12 Stunden am Tag geöffnet. Somit waren Kinder zum größten Teil einer staatlichen Institution überlassen und haben die meiste Zeit in einer großen Gemeinschaft verbracht (vgl. Ruder: “Institutioneile Erziehung”, unter: http://www.sw.fh-koeln.de/Lernwerkstatt/kultur/oe_erziehung.htm, Zugriff am 08.09.2007) .
Die sowjetischen Pädagogen waren vom Wert einer vorschulischen Erziehung im Kindergarten überzeugt, denn bereits in frühen Alter der Kinder ergab sich für Erzieher die Gelegenheit, die soziale, moralische und sogar politische Entwicklung des Kindes zu beeinflussen. Außerdem war die Vorschulerziehung sehr bequem für die Eltern, die beide berufstätig waren und aus diesem Grund nicht viel Zeit mit dem Kind verbringen konnten (vgl. Grant 1966: 94).
Zu Hauptaufgaben der Vorschuleinrichtungen gehören zum einen die Entlastung der berufstätiger Mütter und zum andern die Vorbereitung der Kinder auf den Schuleintritt. Desweiteren waren die “frühzeitige Sozialisation entsprechend den allgemeinen Erziehungszielen” (Bütow 1986: 436f.) und die Vermittlung der moralischen Normen der sozialistischen Gesellschaft weitere wichtige Aufgaben von Vorschuleinrichtungen.
“Eine der zentralen Aufgaben der Vorschulerziehung in der UdSSR war neben der Vorbereitung auf den Schulunterricht und der Anhebung des allgemeinen Entwicklungsniveaus die Heranbildung hoher moralischen Eigenschaften der Kinder. Im Kindergarten sollten so früh wie möglich Grundlagen für moralische Qualitäten Erwachsener gelehrt werden, um die Kinder auf ihre späteren gesellschaftlichen Aufgaben vorzubereiten” (Kienbaum 1995: 87).
Bereits im Kindergarten wurden Kinder durch ein Lehrprogramm auf die Grundschule vorbereitet. Der Tagesablauf war sehr gut organisiert und folgte genauen Regeln, deshalb wurden von den Kindern wenig Eigeninitiative gefordert (vgl. Dietz 1999b: 18). Besonders wichtig waren die Arbeiten in Gruppen. Wegen der großen Altersunterschiede wurden Kinder in einzelnen Altersgruppen eingeteilt. Der Unterricht fand dann in Gruppen statt und beschränkte sich auf die ersten Grundlagen der Schulbildung.
Die Kinder wurden altersgerecht in verschiedenen Bereichen gefördert. Die elementare Kunsterziehung bezog sich auf freies Zeichen und Malen, der Musikunterricht beschränkte sich auf das Erlernen von Kinderliedern und Musikspielen. Hauptsächlich bemühte man sich im Kindergarten durch Nach erzählen von Geschichten und Märchen, den Wortschatz der Kinder zu erweitern und die Muttersprache zu vertiefen. Außerdem lernten Kinder der älteren Gruppen (vom fünften bis siebten Lebensjahr) die ersten Grundlagen des Lesens und Schreibens (Alphabet) und das Lösen von einfachen Rechenaufgaben. Große Aufmerksamkeit wurde dem Sport, ausgeglichener Nahrung, dem Mittagsschlaf und der Hygiene gewidmet. Die erzieherische Zusammenarbeit zwischen Kinderinstitutionen und Familie spielten bei der sowjetischen Vorschulpädagogik eine wichtige Rohe (vgl. Grant 1964: 91-94).
Die Mitarbeiter der Kindertagesstätten hatten oft engen Kontakt zu den Eltern, es fanden regelmäßig Elternabende und Beratungen statt, außerdem könnten Eltern nach Wunsch bei jeder Aktivität in der Kindertagesstätte teilnehmen und waren nicht selten an der Arbeit des Kindergartens beteiligt. Bei täglichen Besuchen im Kindergarten (beim Hinbringen und Abholen des Kindes) konnten Eltern sich bei dem Erzieher über das Verhalten ihres Kindes in der Gruppe erkundigen und sich Rat für die Erziehung holen (vgl. Kühne “Kindergartenerziehung in der früheren Sowjetunion”, unter: http://www.kindergartenpaedagogik.de/931.html, Zugriff am 04.08.2007).
Nach dem Schema, das in der Abbildung 3.2 darsteht ist, begann der schulische Alltag in der UdSSR in der Regel erst mit dem siebten Lebensjahr (später in Nachfolgestaaten der Sowjetunion ab dem sechsten Lebensjahr). Da die Kinder zum größten Teil vor Schuleintritt Kindertagesstätten besucht hatten, sind Persönlichkeit und Neigungen des Kindes bereits geformt. Deshalb war die Schule nur eine Institution von vielen die auf Charakterbildung und Entwicklung des Kindes Einfluss nahmen.
Außerhalb der Schule hatte die Familie zweifellos den größten Einfluss auf ihre Kinder. Angesicht dieser Tatsache bemühte sich die Schule ständig an der Zusammenarbeit mir der Familie. Dies verlief zum Beispiel durch Gründung von Elternkomitees, durch Eltern Versammlungen, Einbeziehung der Eltern in den Schulbetrieb, sowie Familienbesuche und Gespräche zwischen Eltern und Erziehern. Die Hausbesuche gehörten zu den selbstverständlichen Aufgaben der Lehrer, sie begannen bereits in den unteren Klassen und hörten erst mit der Schulentlassung des Schülers auf. Durch diese Hausbesuche konnte sich der Lehrer Einblick in die häuslichen Verhältnisse seiner Schüler verschaffen und Formen der Familienerziehung kennenlernen. Außerdem gaben die Familienbesuche den Eltern Gelegenheit mit dem Lehrer in einer unverbindlichen Umgebung zu sprechen und sich von ihm beraten zu lassen. Meistens war die Beziehung zwischen Eltern und Lehrern herzlich und respektvoll und manchmal konnte man sogar von einer Partnerschaft reden, denn die beiden Seiten versuchten zur Erziehung des Kindes beizutragen. Die Lehrkräfte genossen Autorität und wurden respektiert. Verständlicherweise verlief die Zusammenarbeit Lehrer-Eltern nicht immer problemlos. Es waren bestimmt nicht alle Eltern mit so einer starken Einmischung der Schule in das Familienleben einverstanden. Dennoch waren die meisten Eltern zum größten Teil wegen der Sorge um die Zukunft ihrer Kinder be- reit zur Zusammenarbeit mit der Schule (vgl. Grant 1966: 69-74). In einer erzieherischen Zusammenarbeit haben sich Erzieher und Eltern bemüht “familiale und institutioneile Erziehung, individuelles Eingehen auf das Kind bzw. seine Eltern und kollektivistische Orientierung der Erziehung harmonisch zu vereinen” (Liegle 1970: 91).
Eine der wichtigen Funktionen der Schule in der UdSSR war, die Integration der Jugend in die sowjetische Gesellschaft. Diese Ingeration verlief durch Bildung und Erziehung der Schüler. Somit übernahm die sowjetische Schule gegenüber den anderen Erziehungsträgern im Erziehungsbereich eine führende Rolle und hatte eine große Verantwortung für die gelungene Sozialisation und Erziehung der Kinder und Jugendlichen, (vgl. Bach 1981: 20).
Besonders großen Wert wurde in sowjetischen Erziehungseinrichtungen auf moralische Erziehung der Kinder und Jugendlichen, auf Kollektiverziehung als auch auf Zusammengehörigkeit gelegt. Aus diesem Grund hatten alle Kinder die gleichen Hefte und hatten Schuluniformpflicht. Das Schulsystem in ehemaligen Sowjetunion war stark auf das Lernen im Kollektiv und auf das gesellschaftlichen Nutzen ausgerichtet. “Erziehung im Sinne des Kollektivs sei notwendig, da der Mensch in der Gemeinschaft lebe” (Ruttner in “Die mitgenommene Generation” 2002: 97, unter: http://www.dji.de/bibs/_5_Aussiedlerjugendliche_l.pdf, Zugriff am 08.09.2007).
Entsprechend war es auch üblich, dass die Klasse auf kleinere Gruppen aufgeteilt war, “jede Gruppe wurde als eine Einheit angesehen, jedes Mitglied war für den anderen verantwortlich, folglich wurde auch die ganze Gruppe für jeden Einzelnen bestraft oder ausgezeichnet. ... Ein Klassenlehrer hatte die Aufgabe die Leistungen der Klasse und jeder einzelnen Gruppe zu kontrollieren und zu fördern” (Ruder “Institutioneile Erziehung”, unter: http://www.sw.fh-koeln.de/Lernwerkstatt/kultur/oe_erziehung.htm, Zugriff am 08.09.2007) .
In Verlaufe der Schulzeit wurden die Schüler in der ehemaligen Sowjetunion “zu kollektivem Verhalten, zur Achtung vor der Arbeit und vor den werktätigen Menschen, zur Liebe zur Arbeit, zu Diszipliniertheit, Optimismus und zum Glauben an die Zukunft erzogen. Sie sehen den Sinn ihres Lebens darin, ehrlich und treu zum Wohle der sowjetischen Gesellschaft zu arbeiten” (Marjanko 1975: 13).
Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde das ganze Schulsystem reformiert, innerhalb der Pädagogik hat auch ein Umdenken stattgefunden. Dadurch hat sich in Bildungseinrichtungen der Nachfolgestaaten der UdSSR einiges verändert. Bis Mitte der achtziger Jahren übernahmen die staatliche Einrichtungen viele erzieherische Aufgaben. Nach der Auflösung der UdSSR gabt es keine am Kollektiv ausgerichtete Erziehung mehr, die gesell- schaftlichen Erziehungsaufgaben sind nicht mehr deutlich festgelegt. Stattdessen treten “individualistische Wertvorstellungen sowie die Erziehung zur Autonomie” (Dietz 1999b: 16) stärker in den Vordergrund, so dass viele Familien und Erziehungseinrichtungen sich in einer neuen Situation überfordert fühlten. Es entstand eine Verunsicherung und Orientierungslosigkeit bezüglich neuer Erziehungsziele und -aufgaben (vgl. Dietz 1999b: 16).
Zum einen haben sich einige Erziehungsvorstellungen verändert und somit auch die Art des Schulunterricht, zum anderen herrschten teilweise immer noch die alten Erziehungsideale und Unterrichtsformen. “So dominiert an vielen Schulen in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion bis heute Disziplin und Lehrerautorität im Schulunterricht und das an strikten Vorgaben orientierte Lernen” (Dietz/Roll 1998: 57). Es wird immer noch hauptsächlich ein autoritärer Stil vertreten, allerdings “ohne jegliche Referenz an kommunistische Ideale oder sozialistische Prinzipien” (Ruder “Institutioneile Erziehung”, unter: http://www.sw.fh-koeln.de/Lernwerkstatt/kultur/oe_erziehung.htm, Zugriff am 08.09.2007) .
Da es nach dem sozialen und wirtschaftlichen Umbruch in den Nachfolgestaaten der UdSSR keine neuen Erziehungskonzepte in den Institutionen gab, versuchten einigen engagierte Lehrer neue Lerninhalte einzusetzen und einen demokratischen Unterrichtsstil einzuführen. Allerdings müssten viele Bildungseinrichtungen mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfen. Schulen und Kindertagesstätten fehlten einfach die finanziellen Mittel für Unterrichtsmaterial und besonders zur Bezahlung von Lehrern. Durch diese Umstände verloren die staatlichen Schulen zunehmend an Autorität und Prestige (vgl. Dietz/Roll 1998: 57).
Durch Privatisierung staatlicher Bildungseinrichtungen würden die Vorschuleinrichtungen nicht einmal von der Hälfte der Kinder in Anspruch genommen. In der Zeit der UdSSR dagegen besuchten fast alle Kinder die Kindertagesstätten, die man kostenlos nutzen konnte. Abgesehen davon müssten viele Einrichtungen aus finanziellen Gründen schließen (vgl. Schulsystem Russland, unter: http://www.bqm-handbuch.de/site/html/cms.php?cont=138&PHPSESSID= 89aa46850a3e41979924ba9bded8796e, Zugriff am 08.09.2007).
“Die Privatschulen gewährleisten zwar eine Ausbildung auf hohem Niveau, sie stehen aber nur wenigen Schülern mit zahlungskräftigen Eltern offen. Damit verlieren die staatlichen Bildungsinstitutionen tendenziell ihre in der vormaligen UdSSR traditionelle Rolle als gesellschaftlicher Integrationsfaktor” (Dietz 1999b: 17).
Trotz all der finanziellen Schwierigkeiten des Bildungssektors war die Ausbildung in vielen Schulen der Nachfolgestaaten der UdSSR im internationalen Vergleich immer noch bemerkenswert. Aber im “Vergleich zu westlichen Unterrichtsformen dominiert nach wie vor das an strikten Vorgaben orientierte Lernen und die Wahrung von Disziplin und Lehrerautorität im Schulunterricht” (Dietz 1999b: 18).
Die Kinder und Jugendlichen, die mit ihren Familien nach Deutschland ausgereist sind, haben dieses sowjetische Schulsystem durchlaufen oder haben es mit ihrer Abreise unterbrochen, so dass sie bereits mit einer schulischen Sozialisation im Herkunftsland nach Deutschland gekommen sind.
4 Situation der Aussiedler in Deutschland
Kapitel 4 beschäftigt sich vor allem mit der Familiensituation der Aussiedler in der Bundesrepublik Deutschland sowie mit Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen und der damit verbundenen Veränderungen in der Aufnahmegesellschaft. Zunächst werden die Begriffe Aussiedler und Spätaussiedler definiert. Die beiden Begriffe werden im Verlauf der Arbeit synonym verwendet. Seit Beginn der neunziger Jahre hatten sich die Aufnahmebedingungen in Deutschland für Aussiedler stark geändert. Diese Bedingungen werden im Abschnitt 4.2 dargestellt, ferner wird in diesem Abschnitt erklärt, wie viele Aussiedler in den letzten Jahrzehnten in die Bundesrepublik aufgenommen wurden und aus welchen Staaten die meisten eingereist sind. Nach einer kurzen Bestimmung des Integrationsbegriffs folgt dann die Erläuterung des Migrationprozesses nach Eisenstadt. Daraufhin wird die Bedeutung der Familie für die Kinder und Jugendlichen bei der Orientierung und Integration in der neuen Gesellschaft besprochen und diskutiert. Dabei wird im nächsten Abschnitt Bezug auf die Ergebnisse des FAFRA-Forschungsprojektes genommen und analysiert, inwieweit sich die Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen in Deutschland geändert haben und wie diese Veränderungen die Erziehungseinstellungen der Eltern beeinflusst haben. Anschließend wird auf die Auseinandersetzung der Eltern und Kinder mit dem Kinderbetreuungssystem und dem Schulsystem in Deutschland eingegangen.
4.1 Definition der Begriffe Aussiedler und Spätaussiedler
Im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sind Aussiedler und Spätaussiedler als Deutsche definiert. Aufgrund ihrer Geschichte und als Angehörige der deutschen Minderheit in der ehemaligen Sowjetunion haben sie in der Bundesrepublik das Anrecht auf die deutsche Staatsbürgerschaft (vgl. Dietz/Roll 1998: 15).
Das Bundesvertriebenengesetz (das Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge) kurz BVFG bietet zu den Begriffen Aussiedler und Spätaussiedler folgende Definitionen:
“Aussiedler sind deutsche Staatsangehörige oder Volkszugehörige, die vor dem 8. Mai I945 ihren Wohnsitz in den ehemaligen deutschen Ostgebieten bzw. in Danzig, Estland, Lettland, Litauen, der ehemaligen Sowjetunion, Polen, der ehemaligen Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien, Albanien oder China hatten und diese Länder nach Abschluss der allgemeinen Vertreibungsmaßnahmen vor dem 1. Juli 1990 oder danach im Wege des Aufnahmeverfahrens bis zum 31. Dezember 1992 verlassen haben (§1 Abs.2 Nr.3 В VFG).”
Menschen, die ab 1993 nach Deutschland gekommen sind, werden als Spätaussiedler bezeichnet.
“Spätaussiedler sind in der Regel deutsche Volkszugehörige, die die Aussiedlungsgebiete nach dem, 31. Dezember 1992 im Wege des Aufnahmeverfahrens verlassen haben und innerhalb von sechs Monaten ihren ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich des Gesetzes (also in der Bundesrepublik, d.V.) genommen haben (§4 BVFG)” (aus: Geschichte der Russlanddeutschen, unter: http://www.russlanddeutschegeschichte.de/deutsch4/aussiedler_gesetzliche_regelungen.htm, Zugriff am 08.09.2007).
Zwar wurde die Bezeichnung Aussiedler seit 1993 offiziell durch Spätaussiedler ersetzt, dennoch werden in dieser Arbeit diese beide Begriffe synonym verwendet.
4.2 Zuwanderungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland
Seit 1950 kommen Aussiedler und Aussiedlerinnen zusammen mit ihren Familien aus osteuropäischen Ländern und der vormaligen Sowjetunion nach Deutschland. Hier werden sie auf der Basis des Grundgesetzes (Art. 116, Abs. 1) als deutsche Staatsbürger aufgenommen:
“Deutscher im, Sinne dieses Grundgesetzes ist, vorbehaltlich, anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit, oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom, 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat,” (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in Dietz/Roll 1998: 17).
Dieses Grundgesetz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg formuliert, als viele Deutsche aus osteuropäischen Ländern fliehen mussten oder vertrieben wurden. Die Bundesregierung ging bis zum Beginn der neunziger Jahren davon aus, dass die Russlanddeutschen in ihren Heimatländern vom Vertreibungsdruck bedroht waren, deshalb mussten die Aussiedler nicht beweisen, dass sie aufgrund ihrer nationalen Zugehörigkeit benachteiligt worden sind. Das hat sich mit dem Inkrafttreten des Kriegsfolgenbereinigungsgesetzes (KfbG) ab dem 1.1.1993 geändert, alle Einwanderer aus den Staaten Osteuropas mussten individuell naehweisen, dass sie als Deutschstämmige in den Herkunftsgebieten unter Vcrtrcibungsdruek gestanden haben. Lediglich die Deut sehstämmigen aus der ehemaligen Sowjetunion müssten hierfür keinen Nachweis crbringcn(vgl. Strobl/Kühncl 2000: 29).
Nach dem Kricgsfolgcnbcrcinigungsgcsctzcs wird zwischen Aussicdlcrn nach §1 Abs.2 Nr.3 BVFG und Spätaussiedlern gernäfs §4 BVFG unterschieden. Als Aussiedler gelten alle, die bis zum 31.12.1992 in die Bundesrepublik eingereist sind und als Spätaussiedler, diejenige, die vor dem 1.1.1993 geboren wurden und ab 1993 nach Deutschland gekommen sind (siche dazu Bcgriffsdcfinitioncn im Abschnitt 4.1).
Durch die politischen Veränderungen in der UdSSR und ab 1991 in den Nachfolgestaaten ist die Zahl der Aussiedler in Deutschland dramatisch gestiegen. Infolgedessen begrenzte das Kricgsfolgcnbcrcinigungsgcsctzcs im .Jahr 1993 den Zuzug der Spätaussiedler auf höchstens 225.000 Personen pro .Jahr.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4.1: Zuzug von Aussicdlcrn in die BRD nach Herkunftsländern
Quelle.: Bundesverwaltungsamt. Migrationsbericht 2005, S. 47, unter: http://www.bundcsrcgicrung.dc/Contcnt/DE/Publikation/IB/Anlagcn/migrationsbcrieht- 2005,property publieationFilc.pdf, Zugriff am 08.09.2007
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 4.1: Aussiedlerstatistik seit 1950 Quelle: Bundesverwaltungsamt, unter: http://www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/spaetaussl.php3, Zugriff am 08.09.2007, eigene Zusammenstellung
Seit dem Ende der achtziger Jahren ist die Zahl der Zuwanderer in der Bundesrepublik stark gestiegen. Durch politische Veränderungen (Fall des Eisernen Vorhangs 1989) wurden die Aussiedlungsverfahren der Deutschen aus der vormaligen Sowjetunion und Nachfolgestaaten der UdSSR vereinfacht und beschleunigt. Viele Familien haben das Land in dem sie geboren wurden, verlassen und sind mit der ganzen Familie nach Deutschland ausgewandert. Die Folgen davon zeigt die Abbildung 4.1. Im Jahr 1987 lag die Zahl der Aussiedler noch bei 78.488 Zuwanderern, im Jahr 1988 ist die Zahl auf 202.645 gestiegen und erreichte dann in den Jahren 1989 mit 377.055 Personen und 1990 mit 397.073 Personen ihren Höhepunkt. Bis Anfang der neunziger Jahren kamen die meisten Aussiedler aus Polen und Rumänien (siehe dazu Abbildung 4.1 und Tabelle 4.1), ab 1990 kommen überwiegend Aussiedler aus den Nachfolgestaaten der UdSSR (vor allem aus Russland und Kasachstan) nach Deutschland. Seit dem Jahre 1993 zogen über 90% aller Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion zu, seit 1994 sind es sogar 95%.
Nachdem der Zuzug von Aussiedlern im Jahr 1990 mit 397,073 Personen den Höhepunkt erreicht hatte, ging die Zuwanderungszahl kontinuierlich zurück (vgl. Abbildung 4.1 und Tabelle 4.1). Zunächst blieb die Zahl der Aussiedler bis 1995 ziemlich stabil, dann ging sie im Jahr 1996 um 18% im Vergleich zum Vorjahr zurück (von 217,898 auf 177,751 Personen). 1997 verringerten sich die Zahlen um 22% im Vorjahrs ver gleich (von 177,751 auf 134,419 Personen). Für diesen Zahlenrückgang ist zum Teil die Einführung der sogenannten Sprachtests im Heimatland, die ab 1996 durchgeführt wurden, verantwortlich. Nach Angaben des Bundesverwaltungsamtes haben ca. 30% der Antragsteller diesen Sprachtest nicht bestanden und verloren dadurch das Anrecht auf Zuwanderung (vgl. Dietz/Roll 1998: 17-20).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 4.2: Daten über die Bevölkerung Deutschlands und über die Aussiedler Quelle: : Prieb: “Russlanddeutsche - aus jeder Diskussion über Ausländer ausgeklammert und in Ausländerhass eingeklammert” 2000: 3, unter: http://www.literatúr-viktor- prieb.de/Statistik2000.pdf, Zugriff am 08.09.2007
So sind im Jahre 1998 103.080 Personen und 1999 104,916 Spätaussiedler in die Bundesrepublik eingewandert. Seit dem Jahr 2000 sinkt die Zahl der Zuwanderer zum ersten Mal auf unter 100.000 Personen und in jedem weiteren Jahr kommen immer weniger
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4.2: Altersstruktur der Aussiedler und der Gesamtbevölkerung in %
Quelle.: Vorurteile / Klischees / Stereotypen / Parolen. Priv.jet-Projekt 2001, unter: http://www.mucnstcr.org/privjct/inhaltc/info/infohtml/vorurtcilc.htm, Zugriff am 08.09.2007
Spätaussiedler nach Deutschland. Im .Jahr 2005 waren cs noch 35.522 Personen und im 2006 ist die Zahl sogar unter 10.000 gesunken und betrug 7.747 Personen. Somit sind seit dem .Jahr 1988 bis heute insgesamt rund drei Millionen Aussiedler bzw. Spätaussiedler nach Deutschland eingereist. Die meisten von ihnen kommen, wie oben erwähnt, aus der ehemaligen Sowjetunion und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), überwiegend aus der Russischen Föderation und Kasachstan.
In der Regel verlassen die Russlanddeutsehen ihr Heimatland im Gegensatz zu vielen Arbeitsemigranten für immer, und man kann davon ausgehen, dass die meisten von ihnen dauerhaft in Deutschland bleiben. Ein Großteil der Aussiedler kommt mit der ganzen Familie (Eltern, Kinder, Großeltern) in die Bundesrepublik. Dabei sind die Aussiedler im Vergleich zur bundesdeutschen Bevölkerung “eine bedeutend jüngere Population mit einem hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen” (Dictz/Roll 1998: 20).
Die Altersstruktur der Aussiedler im Vergleich zur Gesamtbevölkerung Deutschlands kann man in der Abbildung 4.2 und Tabelle 4.2 sehen. Zum Beispiel waren im Jahr 1994 zugereiste Aussiedler ca. 37% jünger als 20 Jahren, dagegen betrug dieser Anteil bei der bundesdeutschen Bevölkerung nur ca. 22% (vgl. Abbildung 4.2).
4.3 Integrationsbegriff und Phasen des Migrationprozesses
In der Allgemeinen Soziologie bezeichnet der Begriff Integration die (Wieder-) Herstellung eines einheitlichen Ganzen (vgl. Strobl/Kühnel 2000: 41). Eine genauere Definition bietet Münch, nach ihm ist Integration ein “Zustand der Gesellschaft, in dem alle Teile fest miteinander verbunden sind und eine nach außen abgegrenzte Einheit bilden” (Münch 1997: 66). Somit ist das Ziel der Integration “das Hineinwachsen in ein System höherer Ordnung mit wechselseitigen Abhängigkeit, die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der sich integrierenden Teilsysteme einschränken” (Ingenhorst 1997: 12). Oft wird der Begriff Integration mit dem Eingliederungsbegriff synonym als “Sammelbezeichnung für unterschiedliche Forschungsansätze zur Assimilation, Absorption oder Akkulturation von Migranten verwendet” (Strobl/Kühnel 2000: 47). Nach Eisenstadt hängt die Form der Eingliederung stark von dem Migrationsprozess ab, der in drei Phasen verläuft. Daher wird an dieser Stelle kurz auf diese drei Phasen des Migrationprozesses von Samuel N. Eisenstadt eingegangen, dazu bietet die Abbildung 4.3 eine zusammengefasste Übersicht über diese drei Phasen (vgl. zum Folgenden Strobl/Kühnel 2000: 48-52).
Der ersten Phase des Migrationprozesses liegt irgendeine Form von Unsicherheit, Unzufriedenheit oder Frustration wegen der Situation im Herkunftsland zugrunde. Hier unterscheidet Eisenstadt vier wesentliche Problembereiche, die als Grund für die Unsicherheit und Frustration in Frage kommen: fehlende Möglichkeit eine physische Existenz zu sichern, man sieht keine Wege eigene Ziele zu verwirklichen und man fühlt sich dem sozialen Leben oder kulturellen Zielen entfremdet. Dann entsteht eine Wanderungsmotivation und es wird nach irgend einer Gelegenheit zur Migration gesucht. Die Person hofft, dass zumindest einige ihrer Probleme im neuen Land gelöst werden, dabei hat sie bestimmte Erwartungen an die Aufnahmegesellschaft.
Die Übersiedlung und die erste Zeit im neuen Land bilden laut Eisenstadt die zweite Phase. Hier spielen die sozialen Veränderungen die entscheidende Rolle. Zunächst kommt es zu einer “Einschränkung der Möglichkeiten sozialer Teilhabe und zu einem Verlust von bisher innegehabten sozialen Rollen” (Strobl/Kühnel 2000: 50). Die Migranten sind in dieser Zeit stark auf ein eigenes soziales Netz (ebenfalls ausgereiste Familie, Verwandte, Nachbarn) angewiesen. Dieses sozialer Netz ermöglicht nur ein beschränktes Rollenrepertoire. Außerdem haben die Zuwanderer durch ihr eigenes soziales Netz meist keinen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4.3: Phasen des Migrationsprozesses nach Eisenstadt
Quelle: Strobl/Kühncl 2000: 49
Zugang zu den sozialen Systemen der Einheimischen, somit wird ihr Interaktionsraum eingeschränkt und sic erleiden einen Verlust an Sozialstatus und ihrem frühren Ansehen. Diesen Prozess nennt Eisenstadt “Dcsozialisation”. Diese unzufriedene Situation erzeugt ein Gefühl der Unsicherheit und der Angst. Die Person ist dann motiviert diese Situation zu verändern und diese Gefühle zu überwinden, indem sic die neuen Werte akzeptiert und neue Verhaltensmuster erlernt.
Die Phasen eins und zwei bilden den Ausgangspunkt für die dritte Phase. Diese Phase nennt Eisenstadt die Absorption in die Aufnahmegesellschaft. Statt eines Assimilationsbegriffes verwendet Eisenstadt synonym den Begriff Absorption mit der wörtlichen Bedeutung “Aufsaugen”, “In-sich-Aufnehmen”. Dieser Begriff “beinhaltet neben der kulturellen Anpassung auch die Aspekte der Anpassung der Persönlichkeit und der sozialen Teilhabe” (Strobl/Kühnel 2000: 49).
In der Absorptionsphase findet der eigentliche Eingliederungsprozess in die Aufnahmegesellschaft statt. Es wird in dieser Phase zwischen drei Dimensionen unterschieden: Akkulturation, Anpassung der Persönlichkeit und Dispersion. “Akkulturation” bezeichnet “den Wandel der kulturellen Verhaltensmuster in Richtung auf Angleichung an das Aufnahmesystem” (Strobl/Kühnel 2000: 51). Dazu zählt die Aneignung neuer Rollen, neuer Sitten, Normen und Gebräuchen sowie von Wissen über die Besonderheiten der neuen Umwelt. Desweiteren findet hier der Erwerb von neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie zum Beispiel das Erlernen der Landessprache (siehe dazu Abschnitt 2.2.2).
In der zweiten Dimension “Anpassung der Persönlichkeit” erfolgt die Aneignung neuer Werte, der Wiederaufbau von sozialem Status und auch die Umformung des Selbstbildes. Diese zwei Dimensionen Akkulturation und Anpassung der Persönlichkeit stehen laut Eisenstadt für die zweite Sozialisation bzw. für die Resozialisation. Die dritte Dimension “Dispersion” beschreibt den Prozess der Verteilung der Migranten auf wichtigste institutioneilen Bereiche der Aufnahmegesellschaft und es stellt sich die Frage, ob diese Verteilung gleichmäßig über alle Ebenen verläuft. Nach Eisenstadt ist die Erreichung von vollständiger Absorption nur dann möglich, wenn es innerhalb der Sozialstruktur der Aufnahmegesellschaft keine Gruppen mehr gibt, die sich von anderen abgrenzen. Aber beträchtlich einer größeren Zahl von Einwandern ist dieser Zustand kaum möglich, in der Regel kommt es vielmehr zu gewissen Gruppenbildungen von Einwanderern und zu einer zunehmenden Pluralisierung der Gesellschaft.
4.4 Die Bedeutung der Familie im Integrationsprozess
Für Russlanddeutsche nimmt die Familie den zentralen Stellenwert in ihrem Leben ein. Sie hat für jedes Familienmitglied eine wichtige Bedeutung im Alltag sowie im emotionalen Überlebenskampf. Nach der Befragung von Familien aus der ehemaligen UdSSR weisen die Ergebnisse des Forschungsprojektes FAFRA auf eine “ausgeprägte, positivfamiliäre Orientierung in verschiedenen thematischen Bereichen”. Somit ist die Familie für die Aussiedler aus der ehemaligen UdSSR “Ressource, Schutzraum und Rückhalt für den Einzelnen in der Minoritätenlebenslage” (Herwartz-Emden 1997). Besonders für die Kinder und Jugendlichen stellt die Familie nach der Migration den bedeutendsten Kontinuitätsfaktor dar. Durch die Migration ändern sich die Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen der Kinder und Jugendlichen dramatisch. Es findet für sie ein “großer Umbruch statt, der sich in der Konfrontation von sozialistisch-kollektivem Denken und der Orientierung am Gemeinwesen mit der leistungsorientierten, individualistisch ausgerichteten westlichen Erziehung ausmachen lässt” (Herwartz-Emden 1997).
Einerseits verläuft die Migration für Kinder und Jugendliche einfacher als für Erwachsene. Denn sie erlernen schneller die deutsche Sprache, die sozialen Bindungen in der Schule begünstigen den Spracherwerb, außerdem gewöhnen sich Kinder und Jugendliche an die neue Lebenssituation im allgemeinen leichter als ihre Elter und Großeltern. Andererseits müssen Kinder und Jugendliche nach der Einreise erst einmal eine Reihe der Integrationsleistungen in Kindergarten, Schulen oder Spielgruppen erbringen, dabei bleiben ihnen einige Schwierigkeiten nicht erspart (vgl. Dietz 1999b: 20). Sowohl aufgrund anfänglicher Sprachdehzite, schüchterner Persönlichkeitsstruktur, als auch durch Verlust der gewöhnten Umgebung und der Freunde erfahren sie in Deutschland migrationbedingte Schwierigkeiten. Um so mehr sind Kinder und Jugendliche in dieser, für sie nicht einfachen Zeit, stark auf die Unterstützung der Eltern sowie insgesamt auf familiäre und verwandtschaftliche Bezugsrahmen angewiesen.
Nach Meinung der befragten Eltern, ist die positive Entwicklung ihrer Kinder nach der Einwanderung dann erfolgreich, wenn sie freundschaftliche Kontakte zu anderen und besonders zu einheimischen Kindern und Jugendlichen schließen. Viele Befragte gaben an, dass ihre Kinder nach gewisser Zeit erwartete Kontaktschwierigkeiten überwältigt haben. Wenn aber der Kontaktherstellung ihrer Kinder zur einheimischen nicht problemlos verlief, waren die Eltern enttäuscht und haben mit Schuldgefühlen gegenüber ihren Kindern gekämpft. Manche hatten sogar Rückkehrgedanken (vgl. Westphal 2000: 163).
Festzustehen ist, dass die Familie für Russlanddeutschen nach wie vor ihre wichtigste Sozialisationsinstanz bleibt. Sie stellt nach der Einreise in das Aufnahmeland für Kinder und Jugendliche “den wichtigsten emotionalen Bezugspunkt in einer fremden Umwelt dar”(Dietz/Roll 1998: 80). Die Familiäre Situation und die Reaktion der Familie auf das neue soziale Umfeld spielt für die Aussiedlerkinder und -jugendlichen eine entscheidende Rolle bei den ersten Schritten der Integration in die deutsche Gesellschaft (vgl. Herwartz- Emden 1997).
Die Aussiedlerfamilien kommen aus kollektivistisch orientierten Kulturen, mit stark ausgeprägter Orientierung an Familie und Gemeinschaft. Dort stand die Sorge um die Gemeinschaft im Vordergrund, die primären Ziele der Erziehung waren daher Anpassung und Gehorsam. Folglich wurde die persönliche Autonomie der Jugendlichen erst später angestrebt. In Deutschland dagegen herrscht eher eine individualistische, an persönlichem Erfolg und Autonomie des Einzelnen orientierte Gesellschaft. Hier erreichen die Jugendlichen persönliche Autonomie schon zu einem früheren Alter (vgl. SchmittRodermund/Silbereisen 1999: 186).
Nach der Einreise werden die Erwachsenen, aber auch Kinder und Jugendlichen, mit den in Deutschland herrschenden Wertorientierungen zuerst einmal konfrontiert. Dabei ist besonderes ein Aspekt der Migrationserfahrung zu nennen, die unterschiedlich schnelle Akkulturation der Generationen innerhalb einer Familie. Kinder und Jugendliche verändern ihre Werthaltungen und orientieren sich plötzlich an den Werten der deutschen Gesellschaft, schon durch das schnelle Erlernen der Sprache und die sozialen Kontakte in der Schule akkulturieren sie sich früher als ihre Eltern. Sie gewinnen an Autonomie, haben in der Familie mehr zu sagen und werden sogar zum Mittler zur Aufnahmegesellschaft (vgl. Silbereisen/Lantermann/Schmitt-Rodermund 1999: 18). Nicht selten übernehmen Kinder die Rolle der Dolmetscher. Infolgedessen steigt ihre Position in der Familie, aber gleichzeitig steigt auch die Verunsicherung der Eltern. “Der erzieherische Einfluss der Eltern wird geringer. Solange es altersgemäß geht, wird befohlen, wenn dies nicht mehr zieht, lässt man die Jugendlichen laufen” (Süss 1995: 141).
Verunsicherung der Eltern liegt zum größten Teil auch daran, dass die Eltern durch eigene Integrationsprobleme (Sprach- und Orientierungslosigkeit) zumindest in der ersten Zeit nach der Migration ihren Kindern keine Orientierungshilfe in der deutschen Gesellschaft anbieten können (vgl. Herwartz-Emden 1997). In dieser Situation besteht Gefahr, dass Eltern ihre Autorität und Kompetenz verlieren. Dennoch spielt eine starke familiäre Zusammenhalt “im Hinblick auf die Integration der Aussiedlerkinder in die deutsche Gesellschaft” (Dietz 1999b: 30) weiterhin eine wichtige Rolle. Einerseits kann die Familie den Kindern eine emotionale Unterstützung bei der Eingewöhnung in die neue Situation bieten, andererseits kann “die familiäre Bindung auch zu sozialer Isolation führen” (Dietz 1999b: 30).
Es scheint manchmal so zu sein, dass Kinder nach der Einreise nur schwer neue Freunde in Deutschland finden bzw. nur Kontakt zu anderen Aussiedlerkindern haben. Das kommt dann vor, wenn Familienmitglieder ihre sozialen Kontakte auf den engsten Familien- und Bekanntenkreis beschränken, oder sich sogar zurückziehen (vgl. Dietz 1999b: 30). Zwar halten viele “Aussiedler soziale und freundschaftliche Beziehungen zu Einheimischen für bedeutend” (Dietz 1999b: 26), dennoch fällt es den meisten schwer, die Kontakte zur ein- heimischen Bevölkerung zu knüpfen und freundschaftliche Beziehung aufzubauen. Manchmal aber stoßen sie auch auf ablehnende Haltung der Einheimischen. So verbringen sehr viele Aussiedler ihre Freizeit hauptsächlich im Kreis der Familie (Verwandtschaft) sowie im Bekanntenkreis mit anderen Übersiedlern, was ihre Eingliederung und die ihrer Kinder in Deutschland nur noch erschwert, denn der soziale Faktor spielt für die Integration der ganzen Familie eine bedeutsame Rolle. Die soziale Integration entscheidet, ob die Familie in der deutschen Gesellschaft eingebunden wird oder nicht (vgl. Dietz 1999b: 25f.).
Zudem wird in den letzte Jahren beobachtet, dass Aussiedler oft nicht mehr sehr interessiert sind, sich schnell und möglichst gut an die deutsche Gesellschaft anzupassen. Das wurde bereits in den neunziger Jahren durch die Entstehung russischsprachiger Infrastruktur (Geschäfte, Reisebüros, Zeitung) ersichtlich (vgl. Dietz 1999b: 25f.).
Hinzu kommt die Tatsache, dass in Aussiedlerfamilien noch lange Zeit nach der Einreise die russische Umgangssprache gepflegt wurde. Das bestätigt auch eine im Jahr 1996 durchgeführte Befragung von Jugendlichen, die zwischen 1990 und 1994 mit der Familie aus der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten nach Deutschland kamen. Die Ergebnisse zeigten, dass nur sehr wenige, gerade 8%, in der Familie ausschließlich die deutsche Sprache benutzten, 45,6% der befragten Jugendlichen gaben, als Familiesprache Russisch an und 46,4% erklärten sich auf Deutsch und Russisch zu unterhalten (vgl. Abbildung 4.4). Es stehet aber auch fest, dass je länger die Familie in Deutschland lebt, um so seltener ausschließlich nur auf Russisch gesprochen wird (vgl. Dietz/Roll 1998: 81f.).
Es lässt sich an dieser Stelle feststellen, dass der familiäre Zusammenhalt für Kinder und Jugendliche auch nach der Einreise von genau so großer Bedeutung ist, wie im früheren Heimatland. Dennoch hat sich die Situation der ganzen Familie in Deutschland stark verändert. Einerseits sind die Kinder in der neue Umgebung noch mehr auf die emotionale Unterstützung durch die Familie angewiesen, andererseits verläuft ihre Ak- kulturation in die neue Gesellschaft schneller als bei Erwachsenen, sie gewinnen mehr an Autonomie und orientieren sich schnell an Werten der deutschen Gesellschaft. Diese Übernahme der neuen Werte führt nicht selten zu Konflikten zwischen den Generationen. Die Aussiedlereltern “vertreten in vielen Fällen unter dem Einfluß der kollektivistischen Erziehungsideale der Herkunftsländer die Ansicht, dass Jugendliche ihre Lebensziele im Einklang der Familie, der Schule und gesellschaftlichen Institutionen entwickeln sollen” (Dietz/Roll 1998: 82).
Dagegen wir in Deutschland viel Wert auf die individuelle Entfaltung der Jugendlichen gelegt. Dadurch, dass Jugendliche sich nicht mehr an mitgebrachten Werten und Normen orientieren und individuelle Freiheit beanspruchen, bekommen sie keine richtige
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4.4: Familiensprache der Jugendlichen Aussiedler, in %
Quelle: Dietz Holl 1998: 81
Hilfeleistung von ihren Eltern, weil das mit deren Wertvorstellungen nicht übereinstimmt. Gleichzeitig können die Eltern durch eigene Intcgrationsproblcmc und Orientierungslosigkeit in der neuen Gesellschaft den Kindern nicht immer die gewohnten Orientierungshilfen anbieten. In manchen Familie herrscht sogar wegen der Probleme, die die Eltern in Deutschland haben, “ein großes Mafii an Gleichgültigkeit der Entwicklung der Jugendlichen gegenüber” (Dietz/Roll 1998: 82). Angesichts dieser Aspekte besteht die Gefahr, dass Autorität und erzieherischer Einfluss der Eltern geringer wird.
Es ist zu vermuten, dass ein freier Erziehungsstil die Integration der Jugendlichen weit mehr unterstützt als konservative und autoritäre Erziehung. Vielen Jugendlichen, deren Eltern auf mitgebrachten traditionellen Werte bestehen, fällt cs schwer, sich in der Schule, im Berufsleben und in der gleichaltrigen Gruppe zu integrieren und gleichzeitig mit den Vorstellungen der Eltern zurcchtzukommcn (vgl. Dietz/Roll 1998: 83). Auch die Jugendlichen selbst behaupten in der durchgeführten Befragung, dass ein freier, offener bzw. permissiver Erziehungsstil ihrer Eltern und deren Verhalten, “welches den Jugendlichen bei der Problembewältigung Gestaltungsspielräume zugesteht und sie emotional begleitet” einen positiven Einfluss auf ihre Integration in die deutsche Gesellschaft hat ( vgl. Herwartz-Emden/Westphal: “Integration junger Aussiedler: Entwicklungsbedingungen und Akkulturationsprozesse”: 9, unter: http://www.philso.uniaugsburg.de/lehrstuehle/paedagogik/paed3/bibliothek/ Integration_junger_Aussiedler.pdf, Zugriff am 08.09.2007).
Eine Studie mit 300 Jugendlichen zur “emotionalen Befindlichkeit jugendlichen Aussiedler” hat gezeigt, dass drei Viertel der Befragten nach vier Jahren in Deutschland keine großen integrationsbedingten Probleme haben. Dagegen waren ein Viertel der befragten Jugendlichen mit Problemen belastet, wie depressive Stimmung, schlechte Noten in der Schule, Verständnisprobleme, sowie durch übermäßigen Alkoholkonsum. Solche dauerhaften Probleme sind charakteristisch für Jugendliche, die unfreiwillig nach Deutschland ausgereist sind, die jetzt große Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme zu einheimischen Jugendlichen haben, bedingt auch durch schlechte Sprachkenntnisse. Ihnen fehlt vor allem ausreichender Rückhalt und Unterstützung seitens der Familie ( vgl. HerwartzEmden/Westphal: “Integration junger Aussiedler: Entwicklungsbedingungen und Akkulturationsprozesse”: 8, unter: http://www.philso.uniaugsburg.de/lehrstuehle/paedagogik/paed3/bibliothek/ Integration_junger_Aussiedler.pdf, Zugriff am 08.09.2007).
Des Weiteren zeigte diese Studie, dass es vielen Aussiedlereltern nicht leicht fällt, ihren Kindern so viel Freiheit und Freizügigkeit zuzugestehen, wie einheimische Jugendliche hier genießen. Sie sehen das mit großer Besorgnis und haben Angst um ihre Kinder (vgl. Dietz/Roll 1998: 83). Jedoch, wenn Eltern “den Kindern eine freiere Hand lassen, könnte für das Wohlbefinden der betroffenen Jugendlichen positive Auswirkungen haben” (Schmitt-Rodermund/Silbereisen/Wiesner 1996: 375) und sie bei der Integration in die Aufnahmegesellschaft unterstützen. Schließlich geht es bei der Integration der Kinder und Jugendlichen hauptsächlich darum, ihnen ein “neues Selbstwertgefühl zu vermitteln” (Kotzian 1991: 90). Es muss das Ziel der Eltern sein, eine geistig-kulturelle Eingliederung zu unterstützen, “die es ermöglicht, positive traditionelle Werte der eigenen Herkunft weiterzubewahren, der neuen Umgebung gleichzeitig zukunftsorientiert gegenüberzustehen” (Kotzian 1991: 90).
4.5 Neuorientierungen der Eltern in Bezug auf die Erziehung ihrer Kindern
In den folgenden zwei Abschnitten werden im Bezug auf die elterliche Erziehung folgende wichtige Fragen behandelt: in wiefern haben sich die Erziehungseinstellungen und Erziehungsstile der aus der ehemaligen Sowjetunion zugewanderten Mütter und Väter nach Umsiedlung in die neue Heimat geändert? Oder ist in der Familie im Bereich Erziehung alles beim Alten geblieben? Wie setzen sich die Männer mir ihrer Vaterrolle auseinander und wie reagieren sie als Väter auf die Veränderungen in der neuen Familiensituation nach Migrationsehrfahrung?
Antwort auf diese Fragen geben hauptsächlich die Ergebnisse des Forschungsprojekts FAFRA von Leonie Herwartz-Emden, das im Rahmen des Forschungsschwerpunktprogramms FABER in den Jahren 1991-97 an der Universität Osnabrück durchgeführt wurde. Im Zentrum des Projekts stand die Frage nach der Erziehung und Sozialisation unter der Bedingung von Migration und Einwanderung. Untersucht wurden dabei Sozialisationsbedingungen, Erziehungseinstellungen sowie Elternschaftskonzepte in Aussiedlerfamilien aus der ehemaligen Sowjetunion11 (vgl. Herwartz-Emden 2000: 7).
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden einige Aussagen der vom FAFRA - Forschungsteam befragten Aussiedler und Aussiedlerinnen aus der frühen Sowjetunion zitiert und diskutiert. Im Abschnitt 4.5.1 zitierte Äußerungen stammen aus einer Gruppendiskussion, die im Jahr 1993 mit fünf Aussiedlerinnen durchgeführt wurde. Die Frauen kamen Anfang der neunziger Jahre nach Deutschland, sie waren zu dem Zeitpunkt der Diskussion zwischen 35 und 45 Jahre alt, verheiratet und Mütter von jeweils zwei Kindern (vgl. Herwartz-Emden/Westphal 2000: 113).
Im Abschnitt 4.5.2 werden die Ergebnisse einer im Sommer 1994 bis Frühjahr 1995 durchgeführten Befragung von Männern dargestellt. In Interviews wurden 33 Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion unter anderem zu dem Thema Vaterschaft und Erziehung befragt. Zur Zeit der Befragung waren alle Männer zwischen 30 und 60 Jahre alt, berufstätig, verheiratet, Väter von mehreren Kindern und lebten in vorwiegend traditionell strukturierten Familienformen. Zum Befragungszeitpunkt waren ihre Ehefrauen von berufstätig oder in Teilzeitarbeit beschäftigt (vgl. Westphal 2000: 134). Die Ergebnisse dieser Befragungen mit Aussiedlern und Aussiedlerinnen, sowie die genaue Beschrei- bug des Forschungsprojekts FAFRA sind im Buch “Einwandererfamilien” von Leonie Herwartz-Emden nachzulesen.
4.5.1 Erziehungseinstellung der Aussiedlerinnen in Deutschland
Vor der Ausreise nach Deutschland waren fast alle Frauen in der Sowjetunion bzw. in den Nachfolgestaaten der UdSSR ganztags erwerbstätig, sie waren nie für längere Zeit nur Hausfrauen. Ihre Kinder waren entweder in öffentlichen Erziehungseinrichtungen oder von Großeltern betreut, so dass Frauen Familienleben und Beruf miteinander gut vereinbaren konnten. Sie definieren “ihre Zuständigkeit und Verantwortung für Beruf und Familie als Selbstverständlichkeit und Normalität” (Westphal 1999: 144). Somit schloss ihre Berufsorientierung die Familienorientierung nicht aus.
In Deutschland hat sich die Situation der Frauen grundsätzlich geändert. Sie mussten sich mit beiden Frauenbildern, mit dem der Hausfrau und dem der berufstätigen Frau zuerst einmal auseinandersetzen und die Erfahrungen der beruflichen Neuorientierung verarbeiten (vgl. Westphal 1999: 144f.), denn viele russlanddeutschen Frauen wurden nach Einreise in Deutschland erstmals nicht berufstätig und zum ersten Mal nur Hausfrauen und Mütter. Viele Frauen konnten sich mit dieser Nicht-Berufstätigkeit nur schwer abfinden, wie eine Aussiedlerin in einem Interview berichtet:
“Wir sind daran gewöhnt zu arbeiten. Wir können unser Leben ohne Arbeit nicht vorstellen. Und in Russland war es so, dass eine Frau stark war und ihre eigene Stimme hatte, wenn sie richtig im Beruf war. Aber hier in Deutschland sitzen viele Frauen zu Hause und meinen, dass es normal ist”{Aussiedlerin im Interview, Westphal 1999: 144).
Die Frauen aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion hatten sich daran gewöhnt ihr ganzes leben lang zu arbeiten, aus diesem Grund haben sie auch nach der Zuwanderung in die Bundesrepublik den Wunsch und das Ziel, wieder erwerbstätig zu sein. Für sie bedeutet das Dasein als nur Hausfrau eine finanzielle Abhängigkeit von dem Mann und keine eigene Rentenabsicherung, außerdem beschreiben sie diese Situation als Belastung und Isolation, in der sie keine richtige Möglichkeit zum Spracherwerb, der für ihre Integration von wichtiger Bedeutung ist, haben. So äußert sich zum Beispiel dazu eine Aussiedlern im Interview: “Man verliert die Sprache und lernt nichts Neues, verliert eher das, was man schon gelernt hat” (vgl. Westphal 1999: 145).
Eine Datenanalyse des Sozioökonomischen Panels (Daten nach SOEP 1995-96) zeigt, dass nur 32% der Frauen und dagegen 55% der Männer zwei Jahre nach der Einreise in die Bundesrepublik wieder berufstätig waren. Allerdings weisen die Zahlen darauf hin, dass ungefähr 50% bis 70% aller berufstätigen Aussiedlerinnen Arbeitsstellen einnehmen, für die sie überqualifiziert sind. Mit Hilfe beruflicher Umschulungen gelingt es nur wenigen Frauen (ca. 30%), die in ihrem Heimatland eine hohe berufliche Qualifizierung hatten, in Deutschland wieder in ihr Berufsfeld einzusteigen (vgl. Westphal “Gut qualifiziert und cháncenlos - Aussiedlerinnen in Deutschland” 2006: 16, unter: http://www.ostwestfalen- lippe.de/_regional/veranstaltungen/Regionen_Staerken_Frauen/Westphal.pdf, Zugriff am 16.08.2007). Da die Aussiedlerinnen viel stärker von der Erwerbslosigkeit betroffen sind als Aussiedler, werden viele russlanddeutsche Frauen nach der Ankunft in der Bundesrepublik zunächst Hausfrauen.
Im weiteren Verlauf werden einige Ergebnisse der Gruppendiskussion mit Frauen aus der ehemaligen Sowjetunion vorgestellt und diskutiert (vgl. zum Folgenden HerwartzEmden/Westphal 2000: 113-117).
Ein anderes Problem, außer den großen Schwierigkeiten eine Arbeitstelle zu bekommen, besteht für die russlanddeutschen Frauen darin, Familie und Beruf (falls sie einen Arbeitsplatz haben) zu vereinbaren. Im Herkunftsland hatten sich die staatlichen Kinderbetreuungseinrichtungen oder Großmütter um die Kinder gekümmert, so dass die Frauen Familie und Beruf gut vereinbaren konnten. In Deutschland erweist sich die Kinderbetreuung wegen fehlender oder zum Teil zu teuerer Betreuungseinrichtungen als sehr problematisch und auf die Hilfe der älteren Generation wollen die Frauen hier nicht mehr zurückgreifen. Zum einen liegt das daran, dass in Deutschland die verheirateten Paare mit Kindern in einer eigenen Wohnung, getrennt von den Eltern, leben, denn in Deutschland ist es nicht üblich, dass eine Dreigenerationenfamilie zusammenlebt. So werden aus Großfamilien Kleinfamilien. Zum anderen bekommen die Eltern nach der Einreise in die Bundesrepublik andere Vorstellungen von der Erziehung ihrer Kinder und sind daher mit den Erziehungsvorstellungen der älteren Generation nicht immer einverstanden. Die Einstellung der älteren Generation zur Erziehung wird im folgenden Interview mit einer Aussiedlerin deutlich gezeigt:
“In meiner Familie hätte ich nie meinen Eltern widersprechen dürfen. Heute sage ich etwas dagegen. Und jetzt sind meine Schwiegereltern enttäuscht. - Wenn ich etwas mache, wie ich es meine, dann finden sie das nicht gut. f...]Die Großeltern sagen, dass man seine Kinder falsch erzieht, ganz falsch. So darf man seine Kinder nicht erziehen. [...] Im allgemeinen ist es auch so, dass, wenn die Mutter zu wenig mit den Kindern schimpft, dass z.B. ältere Leute die Mutter nicht in Ordnung finden. Dass eine Mutter den Kindern mehr Freiheiten gibt, sie weniger bestraft, sie weniger oder gar nicht in der Ecke stehen lässt, dann ist nach Ansicht der älteren Leute diese Frau keine gute Mutter.” (Aussiedlerin im Interview, Herwartz-Emden/ Wetphal 2000: 114).
Diese Vorstellung dieses Bildes von der Frau und Mutter “gute Mutter = strenge Mutter” kann man auf das sozialistische Erziehungssystem zurückführen. Nach der Einwanderung wird dieses Mutterbild und die neue Einstellung der Eltern zur Erziehung “zum zentralen Thema der Auseinandersetzung zwischen den Generationen innerhalb der Familie, zwischen Mutter und Vater sowie zwischen Familie und Umwelt” (HerwartzEmden/Westphal 2000: 114). Die Frauen setzen sich mit dem westdeutschen Erziehungssystem auseinander und hinterfragen dabei kritisch den autoritären Erziehungsstil und ihre Rolle als Mutter, die sie in ihrem Heimaltland erfahren und ausgeübt haben.
“Früher war es so, die Kinder müssen das machen, sie haben ihre Pflicht. Jetzt höre ich mehr auf das, was sie sagen.’’ (Aussiedlerin im Interview, Herwartz-Emden/ Wetphal 2000: 115).
Aussiedlerinnen überdenken in Deutschland ihre Rolle als autoritäre und strenge Mutter und ändern oft die Erziehungshaltung gegenüber ihren Kindern, dabei gehen sie bestimmte Kompromisse zwischen ihren eigenen Überzeugungen und dem Integrationsdruck ein. Das bedeutet, sie verändern ihre Haltung zugunsten der erfolgreichen Integration der Kinder in die neue Gesellschaft, aber sie ändern nicht unbedingt ihre eigene Erziehungseinstellung.
“Das ist ein Opfer von der Mutter, ich gebe nach, damit es für die Kinder besser ist, sie müssen sich anpassen. [] Ja hier, man kommt praktisch in eine andere Gesellschaft und wenn sie [die Kinder] kommen und sagen plötzlich: Mama weißt du was, so und so - , irgendwie passt es nicht mit meinen Vorstellungen zusammen, aber ich muss nachgeben, weil sie sich nicht so unterscheiden sollen von den anderen Kindern.’’ (Aussiedlerin im Interview, Herwartz-Emden/Wetphal 2000: 116).
Nach der Einreise findet fast bei allen Müttern eine Auseinandersetzung zwischen autoritären und permissivem (nachgiebigen) Erziehensstil statt. Bei dieser Auseinandersetzung steht für sie die erfolgreiche Integration der Kinder und der Familie im Vordergrund, dabei werden eigene Interesse und Ansprüche zunächst einmal zurückgestellt.
Die Aussiedlerinnen nehmen die Erziehung ihrer Kinder als neuen Aufgabenbereich wahr. Sie werden in der ersten Zeit mit neuen Aufgaben im Rahmen der Kinderbetreuung, anderen Schulsystemen und anderen Erziehungsmethoden konfrontiert. Nach der Einwanderung machen viele Frauen sehr bald die Erfahrung, dass sie aus unterschiedlichen Gründen, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit bzw. Teilzeitbeschäftigung viel mehr Zeit für ihre Kinder haben als früher. Die Diskussion mit den Aussiedlerinnen macht deutlich, dass sie froh sind, jetzt viel Zeit mit ihren Kindern verbringen zu dürfen, um sie bei der Integration in die deutsche Gesellschaft zu unterstützen und mehr Verantwortung für ihre Erziehung übernehmen zu können. Es scheint so zu sein, dass einige Frauen ein schlechtes Gewissen gegenüber ihren Kindern haben und darunter leiden, dass sie früher in ihrem Heimatland, so wenig Zeit mit ihren Kindern verbracht haben. So zum Beispiel berichtet eine Mutter aus der ehemaligen Sowjetunion, wie sich ihre Erziehungshaltung gegenüber ihrem Sohn in Deutschland geändert hat:
“Ich nehme mir mehr Zeit und setze mich mit ihm hin und spreche mit ihm, lese mit ihm. - Ich leide darunter, daß ich das früher nicht gemacht habe. [] Man muß sich total umstellen. Einerseits hat man vielleicht mehr Verantwortung als Mutter. Andererseits - früher war es so, dass ich wusste, mein Sohn geht zur Schule und die Schule regelt da.
Die Schule macht schon. Er muß auf das hören, was der Lehrer sagt und wenn er gut mitmacht, dann wird es gut. Und hier habe ich meine Verantwortung. Ich weiß, dass Erziehung jetzt meine Sache ist’’ (Aussiedlerin im Interview, Herwartz-Emden/Wetphal 2000: 116).
Durch die im Herkunftsland erfahrenen Bedingungen für Kindererziehung, ergibt sich für russlanddeutschen Frauen in Deutschland ein tiefer “Umbruch im Bereich Erziehung und Sozialisation”. Das bedeutet für sie die “Konfrontation von sozialistisch-kollektivem Denken (...] mit der leistungsorientierten, individualistisch ausgerichteten westlichen Erziehung eine zusätzliche, alltägliche Herausforderung” (Herwartz-Emden/Westphal 2000: 102).
In Folge dieser Konfrontation ändert sich meistens die Meinung der Mütter zum autoritärem Erziehungsstil. Sie vermuten, dass ein freier Erziehungsstil den Kindern eher die Möglichkeit gibt, sich an die neuen Lebensbedingungen anzupassen. Andererseits fällt es auch Kindern schwer “mit den Anforderungen der deutschen Gesellschaft und den Wünschen der Familie gleichzeitig zurechtzukommen” (Dietz 1999b: 32).
In der Literatur wird den russlanddeutschen Familien eher eine traditionell-kollektivistische Erziehungseinstellung mit autoritärem Erziehungsstil zugeschrieben. Dagegen geht man davon aus, dass in westdeutschen Familien eher demokratische und permissive Erziehungspraktiken praktiziert werden. Die vom FAFRA-Forschungsteam befragten Aussiedlerinnen “stimmten einer sogenannten ’kontrollierenden’ Erziehungseinstellung (unter der autoritärbestimmende Verhaltensweisen mit erfasst sind) stark zu, aber zugleich dem eher dem westlichen Kontext zuzuordnenden Stil der Permissivität (Nachgiebigkeit)” (Herwartz-Emden 1997).
Die Frauen erkennen, dass der in Deutschland meist herrschende permissive Erziehungsstil viel mehr positive Auswirkung für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes hat als von ihnen früher ausgeübter autoritärer bzw. kontrollierender Stil. So äu- fiert sich zum Beispiel eine von FAFRA-Forschungsteam befragte Mutter zu permissivnachgiebigen Erziehungsstil:
“Die autoritäre Erziehung in Russland hat sehr viel Negatives. Die Kinder denken ja überhaupt nicht selber. Die Eltern und die, Lehrer sagen etwas und die Kinder warten nur. Hier sind die Kinder doch mehr eigenständige Personen, sie müssen selbst entscheiden. [] Jetzt habe ich mich geändert. Ich finde das sogar viel, viel besser; denn wenn man sehr streng ist und nach diesen Mustern geht, die in Wirklichkeit kein Mensch braucht - man verletzt die Seele des Kindes. [] Sie [die Kinder] entscheiden - das muss man sagen, das ist sehr positiv. Zu meinem, Erstaunen, ja ich dachte, man kommt mit der Freiheit nicht so gut zurecht.” (Aussiedlerin im Interview, Herwartz-Emden/Wetphal 2000: 117).
Es lässt sich zusammenfassend sagen, dass die erfolgreiche Integration der Kinder in die deutsche Gesellschaft für russlanddeutsche Frauen von großer Bedeutung ist. Sie gingen davon aus, dass die traditionell-autoritäre Erziehung den Kindern und Jugendlichen die Anpassung an die neue Umgebung (Schule und Freizeit) erschwere. Um die Integration der Kinder in die Aufnahmegesellschaft zu erleichtern waren sie bereit bestimmte Kompromisse einzugehen und neue Erziehungspraktiken und Haltungen, die in Deutschland vorherrschen, auszuprobieren. Sie setzen sich heute intensiv sowohl mit autoritärem als auch mit dem permissivem Erziehungsstil auseinander und erkennen, dass permissive Erziehungshaltung nicht nur die Selbständigkeit ihrer Kinder fordert, sondert auch positive Auswirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes hat. Desweiteren haben die Frauen durch Arbeitslosigkeit sowie schlechte Bedingungen in der Kinderbetreuung wesentlich mehr Zeit für ihre Kinder und tragen viel mehr Verantwortung für die Erziehung als in altem Heimatland, in dem ein Teil der Erziehung in staatliche Hand lag.
4.5.2 Neue Rahmenbedingungen der Vaterschaft
In diesem Abschnitt stehen folgende Fragen im Vordergrund: in wieweit haben sich die Rahmenbedingungen der Vaterschaft in Deutschland verändert? Wie setzen sich die Männer aus der ehemaligen Sowjetunion mit den veränderten Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen ihrer Kinder in der neuen Heimat auseinander? Wie sehen sie sich in der Vaterrolle und wie hoch ist ihre Beteiligung an der Kindererziehung nach der Erfahrung der Migration?
Es wir hier Bezug auf die Befragung der Aussiedler in Rahmen des Forschungsprojekts FAFRA genommen.
Die befragte Männer kamen Anfang der neunziger Jahre nach Deutschland und leben vorwiegend in traditionell-organisierter Familienstruktur. Nach der Einwanderung in die BRD wurden die Aussiedler mit den Vaterschaftsstrukturen der Aufnahmegesellschaft konfrontiert und sie müssten sich damit auseinandersetzen.
Das FAFRA - Forschungsteam geht davon aus, dass “die subjektive Erziehungspraxis von Vaterschaft in Deutschland von materiellen, zeitlichen, räumlichen und personalen Bedingungen bestimmt ist und sich entlang dieser Bedingungen beschreiben lässt” (Westphal 2000: 137). Anhand dieser vier Bedingungen werden im folgenden die Grundvoraussetzungen von Vaterschaft in traditionell organisierten Familien untersucht und diskutiert (vgl. zum Folgenden Westphal 2000: 136-146).
Die Materielle Bedeutung von Vaterschaft: Ausgehend vom traditionellem Bild des Mannes als Familienernährer und Familien ver sorger, kann man sagen, dass seine Hauptaufgabe darin besteht, die Familie materiell abzusichern und gut zu versorgen.
Durch die Befragung der Aussiedler stellte sich heraus, dass materielle und finanzielle Versorgung der Familie für sie in Deutschland viel leichter fällt als im Herkunftsland: “In Deutschland gibt es damit kein Problem” (Aussiedler im Interview, Westphal 2000: 138). In Deutschland fühlen sich viele Männer in der Lage als alleinige Familienernährer ohne Unterstützung ihrer Frauen für die Familie sorgen zu können.12
Im Herkunftsland mussten Väter viel Zeit für die Versorgung der Familie investieren, denn neben dem Beruf haben viele Männer sich auch um Haus, Garten und Stall gekümmert. Für Russlanddeutsche, besonders für die, die in der vormaligen Sowjetunion auf dem Land lebten, war die private Landwirtschaft die wichtigste Quelle der familiären Versorgung. Die Selbstversorgung mit landwirtschaftlichen Produkten spielte daher neben dem Einkommen eine bedeutende Rolle (vgl. Dietz/Hilkes 1992: 66).
Allerdings definieren sich die Aussiedler in Deutschland nicht als alleinige Familienernährer. Für viele Aussiedler ist es selbstverständlich, dass die Frau weiterhin berufstätig ist und zum Familieneinkommen beiträgt, vorausgesetzt, dass die Frau selber arbeiten will und dass die passende Kinderbetreuung gefunden wird. Die Berufstätigkeit ihrer Frauen bleibt für Männer wichtig, nicht aus finanziellem Grund, sonder viel mehr wegen anderer Kriterien, wie gelungene Eingliederung in Deutschland, soziale Kontakte, berufliche Beständigkeit und Zufriedenheit der Frau.
Die zeitliche Bedeutung der Vaterschaft: Wegen kürzerer Arbeitszeiten und keiner Notwendigkeit zur Selbstversorgung haben die Väter in Deutschland mehr Zeit zur Verfü- gung. In der alten Heimat galt für viele Männer, dass sie aufgrund ihres langen Arbeitstages für die Familie kaum noch oder gar keine Zeit hatten. Darüber hinaus fehlt durch die Migration das gewohnte soziale Umfeld der Familie (Freunde, Arbeitskollegen, Verwandtschaft etc.). Besonders in der ersten Zeit nach der Einreise rückt die Familie enger zusammen, die Familienmitglieder sind mehr aufeinander angewiesen.
Von daher wollen die Männer in Deutschland diese zusätzlich freie Zeit gezielt mit der Familie verbringen. Denn, um seine Position in der Familie zu finden und zu erhalten, muss der Vater sich Zeit für die Familie nehmen: “Sich Zeit für Familie und Kinder nehmen, bedeutet zum Erhalt der (emotionalen) Familienstabilität beizutragen und die Position des Vaters in der Familie zu stützen” (Westphal 2000: 140). Das ist für die positive Entwicklung der Kinder insofern von großer Bedeutung, da sie in der Erziehung beide Elternteile, Mutter und Vater, brauchen. Demzufolge sehen die Männer ein, dass sie sich bewusst mehr Zeit für ihre Kinder nehmen sollten. Ein weiterer wichtiger Grund dafür, ist die Integrationserwartung an die Kinder. Väter aus der ehemaligen UdSSR erfahren, meistens über ihre Kinder/Frauen, dass die einheimische Väter viel mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und mit ihnen verschiedene Aktivitäten unternehmen, so erzählt ein Vater im Interview:
“Er (Sohn) kommt zu mir und sagt, und du machst es nicht richtig. Die Väter hier verbringen viel Zeit mit ihren Söhnen, sie machen das und dies, jeden Samstag oder Sonntag, und du machst mit mir nicht so. Das hat er mir vorgeworfen. Ja. Er hat Recht, aber meistens bin ich müde oder ich habe keine Zeit für ihn. Aber das ist nicht richtig. Ich muss mich mehr mit ihm beschäftigen. Das ist besser. Und er sieht es und ich will auch so.” (Aussiedler im Interview, Westphal 2000: 140).
Diese gestiegene Beteiligung und Mitwirkung der Väter an der Erziehung der Kinder wird unter anderem mit ihrer Motivation begründet, Kindern bei der Integration und Assimilation in die neue Gesellschaft zu unterstützen:
“Jeder muß sich an das neue Leben anpassen. [¡Nicht ganz die Regeln annehmen, aber ein bisschen anpassen.” (Aussiedler im Interview, Westphal 2000: 140).
Die räumliche Bedeutung der Vaterschaft: Ein charakteristisches Merkmal der russlanddeutschen Familie im Heimatland war die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Erziehung innerhalb der Familie. Die befragten Aussiedler definieren die Arbeiten “draußen” (außerhalb des Hauses und am Haus) selbstverständlich als typische Männerarbeit oder als ihre Hausarbeit. Die Frau war dann für die Arbeiten “drinnen” (innerhalb des Hauses) zuständig. Die Arbeiten “draußen” waren für viele Väter zugleich mit ihrer Erziehungsaufgabe verbunden. Dadurch konnten Männer sich mit ihren Kindern, besonders mit den Sonnen, beschäftigen, ihnen Männertätigkeiten beibringen und sie auf ihre zukünftige Rolle als Mann und Vater vorbereiten. “Der Sohn muß immer neben dem Vater sein” so die Meinung vieler Väter aus der ehemaligen Sowjetunion. In Deutschland ist dieser Erziehungsraum “draußen” weggefallen, zumindest bei vielen russlanddeutschen Familien, aus diesem Grund soll sich der Vater immer bemühen dem Sohn andere neuen Tätigkeiten anzubieten. Da es für Väter und Söhne insgesamt nicht so viel Hausarbeit (außerhalb des Hauses) gibt, werden sie deshalb in der Familie immer öfter mit Aufgaben der Mütter und Mädchen konfrontiert. Sie werden aufgefordert deren Aufgaben zu übernehmen oder sie im Haushalt mehr zu unterstützen. Diese Veränderung des männlichen Erziehungsraums wir in folgender Aussage eines Vaters aus der vormaligen UdSSR deutlich:
“Dort war es so. Die Frauenarbeit war immer im Haus drin, kochen, aufräum,ем, Staub saugen, waschen, nur mit Mädchen zusammen. Und Jungs waren mit mir, wenn ich die Arbeit draußen machen sollte. So war es verteilt. [] Aber hier ist wenig Arbeit draußen für Jungs. Da müssen sie auch Geschirr abwaschen hier. [] Wir haben zwar Spülmaschine, aber die Jungs müssen auch mithelfen, sagen die Mädchen. Ja die Jungs müssen mithelfen.” (Aussiedler im Interview, Westphal 2000: 143).
Personale Bedeutung von Vaterschaft: In diesem Punkt geht das FAFRA - Forschungsteam von der Überlegung aus, dass die Erziehungspraxis des Vaters letztendlich davon bestimmt wird, wie er seine Kinder wahrnimmt. Aussiedler berichten, dass sie ihre Kinder in Deutschland als sehr verändert erleben. Sie sind durch die Migrationerfahrung viel freier, selbständiger und erwachsener geworden.
Der Ausgangspunkt der Veränderung der Kinder liegt nach Meinung der befragten Männer an der anfänglichen Unsicherheit (z.B. wegen mangelnder Sprachkenntnisse) und an der Orientierungslosigkeit der Familie bzw. des Vaters. Die Kinder erfuhren ihre Eltern im neuen Heimatland anders als im Herkunftsland, besonders der Vater verlor durch die Unsicherheit in der Einwanderungssituation seine Autorität und Stärke. Dadurch änderte sich auch die Beziehung zwischen dem Vater und seinem Kind. Weiterhin nennen die Väter einen weiteren Grund für die Veränderung ihrer Kinder. Die Veränderung wird auf den außerfamiliären Einfluss in der schulischen Erziehung und auf den Kontakt mit einheimischen Kindern und Jugendlichen zurückgeführt. Aussiedler beschreiben die Erziehung in deutschen Schulen und Familien als “frei”. Durch diese freie Erziehung in der Schule werden die Kinder selbstbewusster, sie beanspruchen “die Durchsetzung diverser Ansprüche, Rechte und Verhaltensweisen für sich und in der Familie” (Westphal 2000: 145).
Aus der Sicht einiger Väter, haben sich die Kinder in negativer Weise verändert, dadurch sind Spannungen und Konflikte in der Vater-Kind-Beziehung nicht ausgeschlossen. Wiederum betrachten viele Väter zwar das Erziehungspraxis in deutschen Schulen und ihren Einfluss auf die Kinder kritisch, trotzdem bemühen sie sich “eine Balance zwischen ihren eigenen Verhaltenserwartungen und denen der Schule herzustellen” (Westphal 2000: 145f.). Denn ihnen ist ein unproblematischer Kontakt und eine gute Beziehung zu ihren veränderten Kindern sehr wichtig.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen der Vaterschaft für Männer aus der ehemaligen Sowjetunion sich nach der Einreise in die Bundesrepublik stark verändert haben. Diese Veränderungen erfordern von den Männern eine Umstellung in der Beziehung und im Verhältnis zu ihren Kindern, damit die Anpassung der Kinder an die neue Gesellschaft besser verläuft:
“Wir müssen uns weiter umstellen. Wir können unsere Kinder hier nicht so erziehen, wie wir es dort gemacht haben und überall draußen läuft das Leben ganz anders.’’ (Aussiedler im Interview, Westphal 2000: 157).
4.5.3 Kindergarten und Schule
Wie im Abschnitt 3.3 bereits erwähnt, spielten die institutioneilen Erziehungseinrichtungen in der vormaligen Sowjetunion und den Nachfolgestaaten bei der Erziehung von Kindern neben der Familie eine sehr wichtige Rolle. Die Schule war eine der wichtigsten Sozialisationsinstanzen und unterstützte die Eltern bei der Erziehung der Kinder, die fast den ganzen Tag in den schulischen Einrichtungen verbracht haben. Trotz der neuen Schulreform nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist das Bildungssystem überwiegend kollektiv-orientiert geblieben. Disziplin und Respekt vor Lehrkräften hatten nach wie vor einen hohen Stellenwert (vgl. Tulinow in “Die mitgenommene Generation” 2002: 114, unter: http://www.dji.de/bibs/_5_Aussiedlerjugendliche_l.pdf, Zugriff am 08.09.2007) .
Nach der Ankunft der Aussiedlerfamilien in der Bundesrepublik wurden Eltern und Kinder mit neuen Bedingungen der Kinderbetreuung im Kindergarten sowie mit einem ihnen fremden Schulsystem konfrontiert. “Aussiedler kommen aus einem stark gelenkten Schulsystem, in dem Lernen auf das Kollektiv, den gesellschaftlichen Nutzen hin ausgerichtet war. In der Bundesrepublik hingegen ist das schulische Lernen auf den Einzelnen und seine Leistung abgestellt, auf Selbstverantwortung und Eigeninteresse, aber auch auf Konkurrenzdenken” (Herwartz-Emden 1997).
Die bisherigen Erfahrungen der Aussiedlerfamilien im Heimatland unterscheiden sich also sehr stark von denen in Deutschland. Es hat in der Art der Kinderbetreuung große Veränderungen gegeben. In der alten Heimat waren die Eltern daran gewöhnt, dass Kinder ganztags im Kindergarten oder in der Schule untergebracht und betreut waren, außerdem stand ihnen die ältere Generation zur Verfügung. Hier erwarten viele Eltern, dass die Kinderbetreuung auch so abläuft wie in der alten Heimat, mit dem geregelten Tagesablauf, genauen Vorgaben beim Spiel, Vorbereitung auf die Schule usw., dagegen scheinen ihnen die deutsche Kindergartenkonzepte zu wenig strukturiert und ungewohnt (vgl. Dietz 1999b: 34).
In Deutschland werden Kinder meistens nur halbtags betreut, Eltern werden damit gezwungen, ihre Kinder täglich selbst zu betreuen, ihre Freizeit zu gestalten, individuelle Entwicklung zu fordern und mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Kinder und Eltern müssen ein anderes Zeitmanagement erlernen, die Erziehungsaufgaben der Eltern werden demnach umdefiniert (vgl. Herwartz-Emden 1997).
Obwohl Eltern das deutsche Schulsystem nur unzureichend kennen und sich daraus resultierende Perspektiven für ihre Kinder nicht richtig abschätzen können, versuchen sie dennoch so gut, wie es in dieser Situation geht, ihre Kinder zu unterstützen.
Nach Ergebnissen der FAFRA-Forschung verhalten sich Eltern aus der ehemaligen Sowjetunion “unterstützend hinsichtlich aller Unternehmungen ihrer Kinder, die auf Assimilation und Erfolg in der Aufnahmegesellschaft gerichtet sind und erbringen hier funktionale Anpassungsleistungen” (Herwartz-Emden 1997). Diese unterstützende Haltung seitens der Eltern ist für die Aussiedlerkinder sehr wichtig, denn sie erleben in deutschen Schulen einen ganz anderen Ablauf des Schultags als sie gewohnt sind. Die Beziehung zwischen Schülern und Lehrern ist hier wenig von der Lehrerautorität geprägt, nach Meinung der Kinder bieten die Lehrer ihnen zu wenig Unterstützung an, es wird von Lehrkräften mehr Anleitung und Hilfestellung erwartet, denn die Aussiedler kinder sind gewöhnt, sich an klare Anforderungen und an stark strukturiertem Schulalltag zu orientieren. Dass der Lehrstoff genau vorgegeben wird, dass Eigeninitiative verlangt wird, war in altem Heimatland wenig gefragt.
Im Gegensatz zu einheimischen Schülern haben die Aussiedlerschüler nicht gelernt im Schulalltag eigene Entscheidungen zu treffen. Deshalb müssen sie in deutschen Schulen nicht nur die sprachlichen Schwierigkeiten überwinden, sondern sich auch die neuen Regeln des sozialen Miteinanders aneignen (vgl. Dietz 1999b: 37L). Das ist wichtig, denn die “Integration von Aussiedlerkindern in das deutsche Schulsystem bedeutet in weiterem Sinne die Integration in einen neuen sozialen Kontext, in dem das Schulsystem eingebettet ist” (Dietz 1999b: 38).
5 Zusammenfassung
Das Ziel dieser Arbeit war, einen Blick auf die Sozialisation und die Erziehung in den Aussiedlerfamilien, die Anfang der neunziger Jahre aus der ehemaligen UdSSR nach Deutschland ausgewandert sind, zu werfen, um die Erziehungseinstellungen der Eltern durch den Einfluss der Migration zu untersuchen.
Die empirische Basis der vorgelegten Arbeit sind verschiedene Forschungsprojekte und Studien, die in den neunziger Jahren durchgeführt wurden. Hauptsächlich wurde auf das FAFRA- Forschungsprojekt von Leonie Herwartz-Emden und auf Studien von Barbara Dietz Bezug genommen.
Aufgrund der Ergebnisse dieser Studien kann man den Schluss ziehen, dass für Russlanddeutsche eine intakte Beziehung innerhalb der Familie und zu Verwandten im Herkunftsland sehr wichtig war. Nach der Einreise in die BRD änderten sich zwar die familiären Strukturen, vielfach wurden aus Großfamilien Kleinfamilien, dennoch blieb die Familie (Verwandte sind miteingeschlossen) im Einwanderungsland aufgrund der gemeinsamen Erfahrungen im Herkunftsland von sehr großer Bedeutung. Laut Leonie Herwartz- Emden konnte der “häufig propagierte “Zerfall” der Familie, der, so die Annahme, durch moderne Lebensbedingungen hervorgerufen werde” nicht bestätigt werden (Herwartz- Emden “Sie sollen es besser haben”, unter: http://www.ms.niedersachsen.de/master/C767163_L20_D0_I674.html, Zugriff am 08.09.2007) .
Aber es konnte bestätigt werden, dass die Familienmitglieder nach der Migration noch stärker aufeinander angewiesen sind und die Familie weiterhin wichtig bleibt. Andererseits, kann eine zu starke Familienbindung und -Orientierung zur Verzögerung der Integration in die Aufnahmegesellschaft, nicht nur für Erwachsene, sondern auch für ihre Kinder, führen. Das ist dann der Fall, wenn sich die Familienmitglieder in den Kreis der Familie und den engsten Freundeskreis (bestehend ebenfalls aus Übersiedlern) zurückziehen und sich deshalb von der deutschen Gesellschaft isolieren.
Neben dem Wunsch “als Deutsche unter Deutschen” zu leben, war für die meisten Russlanddeutschen die größte Motivation auszureisen, ihren Kindern in Deutschland ein besseres und sicheres Leben bieten zu können, nach dem Motto: “Sie sollen es besser haben” ( Her war tz-Emden “Sie sollen es besser haben”, unter: http://www.ms.niedersachsen.de/master/C767163_L20_D0_I674.html, Zugriff am 08.09.2007) .
Die Aussiedlerfamilien kamen aus Ländern der GUS, die in der Zeit von Perestrojka und Glasnost von wirtschaftlichen, sozialen und politischen Krisen stark betroffen waren. In Folge dessen waren die Russlanddeutschen von den gesellschaftlichen Veränderungen und Orientierungskrisen der postsozialistischen Gesellschaft geprägt. Besonders betroffen waren dabei die Kinder und die Jugendlichen, denn zunächst beeinflussten gesellschaftliche Veränderungen im Heimatland ihren Sozialisationsprozess und dann müssten sie sich nach der Einwanderung im neuen Land zurechtfinden.
In Deutschland, wo Umgebung und Sprache für sie fremd waren, waren sie deshalb noch stärker auf die familiäre Unterstützung angewiesen. Meist erwies sich das als problematisch, denn die Eltern waren nach der Einreise auch mit eigenen Integrationsproblemen beschäftigt und konnten ihren Kindern bei deren Orientierungslosigkeit in der neuen Gesellschaft nicht wirklich helfen und ihnen keine emotionale Stabilität bieten. Hinzu kommt noch, dass Aussiedler meist unter sich bleiben und viel langsamer die deutsche Sprache erlernen als ihre Kinder. Die russische Sprache blieb sogar häufig jahrelang die Familiensprache, was natürlich für die Integration in die Aufnahmegesellschaft nicht vorteilhaft sein konnte, denn die Sprache ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Gelingen einer Integration.
Nach der Migration in die Bundesrepublik verlief die Akkulturation der Aussiedlerkinder meist schneller als bei den Erwachsenen. Durch schnelles Erlernen der deutschen Sprache gewannen die Kinder mehr Autonomie innerhalb der Familie. Sie orientieren sich schon nach kurzer Zeit an neuen Werten und Normen der deutschen Gesellschaft, die mitgebrachten Werte und Normen verloren nach der Migration an Bedeutung. Es fand ein Wandel von Wertorientierungen statt. Die gewohnten Verhaltensweise und Regeln galten in Deutschland nicht mehr. Die Forderungen der Eltern wurden von den Kindern nicht mehr selbstverständlich erfüllt. Dadurch kam es oft zu Konflikten zwischen den Generationen. Von den Kindern wurde weiterhin Akzeptanz der elterlichen Autorität erwartet, stattdessen erwiesen viele Kinder und Jugendliche in Deutschland den Erwachsenen gegenüber weniger Respekt als früher. Der erzieherische Einfluss der Eltern wurde immer kleiner. Allerdings zeigte die empirische Untersuchung von Barbara Dietz und Heike Roll, dass elterliche Autorität in vielen Familien aus der ehemaligen Sowjetunion immer noch einen hohen Stellenwert hat. Obwohl sie “durch soziale Desintegrationsprozesse in den Herkunftsländern und durch die Probleme bei der Integration nicht mehr unhinterfragt aufrecht erhalten werden kann” (Dietz/ Roll 1998: 93).
In Bezug auf die Erziehung und Sozialisation in Aussiedlerfamilien lässt sich folgendes festhalten. In der ehemaligen Sowjetunion galt in den Familien eher ein autoritärer aber zugleich liebevoller Erziehungsstil. Gehorsam und Respekt gegenüber Erwachsenen, Anpassungsbereitschaft und Zurückhaltung waren die primären Erziehungsziele in der Familie, aber auch in der Schule. Zwischen Mann und Frau herrschte meist traditionelle Rollenverteilung vor, dabei stellte die Mutter die primäre Erziehungsperson dar. Die Aussiedlerfamilien kamen aus kollektivistisch orientierten Kulturen, mit stark ausgeprägter Orientierung an Familie und Gemeinschaft. Die Erziehung war somit, nicht nur in der Familie, sondern auch in staatlichen Erziehungseinrichtungen, stark von den kollektivistischen Erziehungsidealen des Staates gekennzeichnet. Wegen Berufstätigkeit der Frauen übernahmen die öffentlichen Erziehungsinstitutionen viele Aufgaben bei der Erziehung der Nachwuchsgeneration und waren somit neben der Familie eine sehr wichtige Sozialisationsinstanz.
Nach der Migration haben sich im Bereich von Sozialisation und Erziehung viele Veränderungen gegeben. Es findet eine Konfrontation zwischen sozialistisch-kollektiven Erziehungseinstellungen der Eltern mit der “individualistisch ausgerichteten westlichen Erziehung” statt (Herwartz-Emden/Westphal 2000: 102). Besonders Mütter betrachten ihre bisher praktizierten Erziehungspraktiken kritisch und stellen ihre Erziehungskonzepte in Frage. Sie setzen sich mit dem permissiven Erziehungsstil und mit in Deutschland üblichen Erziehungsmethoden auseinander. Dabei kann es Vorkommen, dass beide Erziehungsstile (autoritäre und permissive) miteinander vermischt werden, oder dass Eltern sich mit dem Erziehungsstil der individualistisch geprägten deutschen Gesellschaft überfordert fühlen.
Aus dem FAFRA-Projekt geht hervor, dass Aussiedlerinnen zugunsten des Gelingens der Integration ihrer Kinder versuchen, mit sich einen Kompromiss zu schließen, indem sie ihre Handlungen aber nicht unbedingt ihre Einstellungen im Bereich Erziehung ändern. Die Forschungs- und Interviewergebnisse zeigen, dass “Aussiedlerinen sich sowohl in starker kritischer Auseinandersetzung und Vermittlung der von der ehemaligen Sowjetunion geprägten Mutterschafts- und Erziehungsvorstellungen erleben, als auch in Auseinandersetzung mit den Vorstellungen in Deutschland” (Westphal 1999: 141).
Auch die Männer sind mit veränderten Rahmenbedingungen der Vaterschaft und veränderten Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen in der Aufnahmegesellschaft konfrontiert. Sie versuchen sich allmählich auf die veränderten Rahmenbedingungen einzustellen und widmen sich ihren väterlichen Aufgaben. Aussiedler definieren “ihre Vater- Schaft und Erziehungspraxis (in Deutschland) weit über die Versorger- und Ernährerrolle hinaus” (Westphal 2000: 196) und betonen, dass sie mehr Zeit für ihre Kinder nehmen wollen und müssen, da es für die erfolgreiche Integration ihrer Kinder von großer Bedeutung ist.
Durch den Wegfall von Erziehungsfunktion von Schulen und staatlicher Betreuung der Kinder, sind Eltern gefordert ihre Kinder individuell zu fördern, sie zu unterstützen und sich mit ihnen intensiv zu beschäftigen. Die Erziehungsaufgabe der Eltern werden somit in Deutschland neu definiert (vgl. Herwartz-Emden 1997).
In Deutschland erleben Aussiedlereltern, dass sie (bedingt durch kürzere Arbeitszeiten sowie Arbeitslosigkeit) für ihre Kinder viel mehr Zeit haben und mehr Verantwortung für sie tragen müssen als im Herkunftsland.
Im Hinblick auf die elterliche Erziehung in der Migrationssituation kann man also festhalten, dass Eltern nach der Einwanderung in Deutschland nicht nur mit veränderten Rahmenbedingungen der Erziehung und der Sozialisation in Familie und Schule konfrontiert sind, sondern auch mit neuen Aufgaben im Bereich der Betreuung, Erziehung, Bildung und Zukunftsplanung ihrer Kinder. Dennoch zeigen die Ergebnisse der FAFRA- Forschung, dass Aussiedler und Aussiedlerinnen große Erwartungen bezüglich der gelungenen Integration ihrer Kinder in die deutsche Gesellschaft haben und deshalb bereit sind, ihre eigenen Erziehungseinstellungen zu überprüfen, sich mit dem neuen Erziehungsstil auseinanderzusetzen und neue Erziehungspraktiken und Haltungen auszuprobieren.
Abschließend ist noch zu vermerken, dass die aus durchgeführten Studien erhaltenen Ergebnisse sich nicht auf alle Aussiedlerfamilien verallgemeinern lassen.
Nach Meinung des Prof. Dr. Hans-Joachim Wenzel, ehemaligen Direktors des Forschungsinstituts IM IS an der Universität Osnabrück, gibt es “sehr differenzierte Strukturen” bei den Familien aus der ehemaligen Sowjetunion. Es gibt verschiedene Faktoren, die unterschiedliche Familientypen beschreiben lassen, zum Beispiel: Herkunft der Familie, Alter der Eltern und Kinder, Kinderzahl in der Familie, Zeitpunkt der Migration, Berufliche Qualifikation der Eltern sowie ihre Erwerbstätigkeit in Deutschland. Fest steht aber, dass die Aussiedlerfamilien sich nach der Migration in Deutschland großenteils mit einem toleranten und freizügigen Erziehungsstil auseinandersetzen, während in ihrem alten Heimatland (in der ehemaligen UdSSR und Ländern der GUS) in Familien und Erziehungseinrichtungen eher noch der konservative und autoritäre Erziehungsstil herrschte13.
6 Literaturverzeichnis
Ahlberg, R. (Hrsg.), 1969: Soziologie in der Sowjetunion. Freiburg im Breisgau.
Bach, U., 1981: Kollektiverziehung als moralische Erziehung in der sowjetischen Schule 1956-1976. Wiesbaden.
Bade, K. J./Oltmer, J. (Hrsg.), 1999: Aussiedler: deutsche Einwanderer aus Osteuropa. (IMIS-Schriften, Bd. 8), Osnabrück.
Butzkamm, W./Butzkamm, J., 1999: Wie Kinder sprechen lernen. Kindliche Entwicklung und die Sprachlichkeit des Menschen. Tübingen.
Bütow, H. G. (Hrsg.), 1986: Länderbericht Sowjetunion. München.
Carrére ďEncausse, H., 1978: Politische Sozialisation in der UdSSR unter besonderer Berücksichtigung der nicht russischen Nationalitäten. S. 25-43 in: Anweiler, O. (Hrsg.): Erziehungs- und Sozialisationsprobleme in der Sowjetunion, der DDR und Polen. Konferenzmaterialien. Hannover.
Dietz, В., 1999a: Jugendliche Aussiedler in Deutschland: Risiken und Chancen der Integration. S. 153-176 in: Bade, K. J./Oltmer, J. (Hrsg.): Aussiedler: deutsche Einwanderer aus Osteuropa. (IMIS-Schriften, Bd. 8), Osnabrück.
Dietz, В., 1999b: Kinder aus Aussiedlerfamilien: Lebenssituation und Sozialisation. S. 9-52 in: Dietz, В./Holzapfel, R. (Hrsg.): Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund. (Materialien zum 10. Kinder- und Jugendbericht des DJI, Bd.2). München.
Dietz, B./Hilkes, P., 1992: Rufilanddeutsche: Unbekannte im Osten. Geschichte, Gegenwart und Zukunftsperspektiven. München.
Dietz, В./Roll, H., 1998: Jugendliche Aussiedler - Porträt einer Zuwanderergeneration. Frankfurt am Main/New York.
Esser, H., 2001: Soziologie. Spezielle Grundlagen. Band 6: Sinn und Kultur. Frankfurt am Main/New York.
Francescato, G., 1973: Spracherwerb und Sprachstruktur beim Kinde. Stuttgart.
Grant, N., 1966: Schule und Erziehung in der Sowjetunion. Bern.
Gudjons, H., 2006: Pädagogisches Grundwissen: Überblick - Kompendium - Studienbuch. 9., neu bearbeitete Auflage. Bad Heilbrunn.
Habermas, J., 1976: Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus. Frankfurt am Main.
Haeberlin, F., 1971: Zwischen Flucht und Integration: Die Eingliederung junger Flüchtlinge als Problem der Spätsozialisation. (Zeitpolitik; 9). Stuttgart.
Herwartz-Emden, L. (Hrsg.), 2000: Einwandererfamilien: Geschlechterverhältnisse, Erziehung und Akkulturation. (IMIS-Schriften, Bd. 9), Osnabrück.
Herwartz-Emden, L., 1997: Erziehung und Sozialisation in Aussiedlerfamilien: Einwanderungskontext, familiäre Situation und elterliche Orientierung, In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, В 7-8, S. 3-9.
Herwartz-Emden, L./Westphal, M., 2000: Konzepte mütterlicher Erziehung. S. 99-120 in: Herwartz-Emden, L. (Hrsg.): Einwandererfamilien: Geschlechterverhältnisse, Erziehung und Akkulturation. (IMIS-Schriften, Bd. 9), Osnabrück.
Hofstede, G., 1989: Sozialisation am Arbeitsplatz aus kulturvergleichender Sicht. S. 156 - 173 in: Trommsdorff, G. (Hrsg.): Sozialisation im Kulturvergleich. Reihe Der Mensch als soziales und personales Wesen, Bd. 10. Stuttgart.
Hurrelmann, K., 1998: Einführung in die Sozialisationstheorie. 6. Auflage. Weinheim.
Hurrelmann, К., 2002: Einführung in die Sozialisationstheorie. 8. vollständig überarbeitete Auflage. Weinheim.
Ingenhorst, H., 1997: Die Rufilanddeutschen. Aussiedler zwischen Tradition und Moderne. Frankfurt am Main / New York.
Kienbaum, J., 1995: Sozialisation von Mitgefühl und prosozialem Verhalten: Ein Vergleich deutscher und sowjetischer Kindergartenkinder. S. 83-107 in: Trommsdorff, G. (Hrsg.): Kindheit und Jugend im Kultur vergleich. Weinheim.
Knott, H., Hamm, H. und W. Jung, eds., 1991: Heimat Deutschland? Lebensberichte von Aus- und Übersiedlern. Pfafienweiler.
Kolbanowski, W., 1952: Vorwort. S. 14-31 in: Makarenko, A. S.: Ein Buch für Eltern. Berlin.
Kotzian, O., 1991: Die Aussiedler und ihre Kinder. Eine Forschungsdokumentation über die Deutschen im Osten der Akademie für Lehrerfortbildung Dillingen und des BukowinaInstituts Augsburg. 2. Auflage. (Sonderdruck des Modellversuchs Aussiedler"). Dillingen.
Liegle, L., 1970: Familienerziehung und sozialer Wandel in der Sowjetunion. Berlin.
Liegle, L., 1987: Welten der Kindheit und Familie. Beiträge zu einer pädagogischen und kulturvergleichenden Sozialisationsforschung. Weinheim.
Luhmann, N., 1984: Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main.
Makarenko, A. S., 1952: Ein Buch für Eltern. Berlin.
Marjenko, I. S. (Hrsg.), 1975: Kommunistische Erziehung der Schüler in der Sowjetunion: Empfehlungen zur Gestaltung des Systems der Erziehung in der sowjetischen allgemeinbildenden Schule. Berlin.
Meulemann, H., 2006: Soziologie von Anfang an. 2. Auflage. Wiesbaden.
Miller, M./ Weissenborn, J., 1991: Sprachliche Sozialisation. S. 531-549 in: Hurrelmann, K./ Ulich, D. (Hrsg.): Neues Handbuch der Sozialisationsforschung. Weinheim.
Müller, E. K./ Tremi, K. A. (Hrsg.), 2002: Wie man zum Wilden wird. Ethnopädagogi- sche Quellentexte aus vier Jahrhunderten. Berlin.
Münch, R., 1997: Elemente einer Theorie der Integration moderner Gesellschaften. Eine Bestandsaufnahme. S. 66-109 in: Heitmeyer, W. (Hrsg.): Was hält die Gesellschaft zusammen? Frankfurt am Main.
Parsons, T., 1981: Sozialstruktur und Persönlichkeit. Fachbuchhandlung für Psychologie (amerik. Original 1964). Frankfurt am Main.
Rolff, H.-G./Zimmermann, P., 2001: Kindheit im Wandel. Eine Einführung in die Sozialisation im Kindesalter. 6. Auflage. Weinheim.
Scherr, A., 2002: Sozialisation, Person, Individuum. S. 45-66 in: Korte, H./Schäfers, B. (Hrsg.): Einführung in Hauptbegrifie der Soziologie. 6. Auflage. Opladen.
Schmitt-Rodermund, E./ Silbereisen, R. K., 1999: Differentielle Akkulturation von Entwicklungsorientierungen unter jugendlichen Aussiedlern. S. 185-202 in: R.K. Silbereisen,
E. D. Lantermann und E. Schmitt-Rodermund (Hrsg.): Aussiedler in Deutschland. Akkulturation von Persoenlichkeit und Verhalten. Opladen.
Schmitt-Rodermund, E./Silbereisen, R. K./Wiesner, M., 1996: Junge Aussiedler in Deutschland: Prädiktoren emotionaler Befindlichkeit nach der Immigration. In: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie 28: 357-379.
Schäfers, B. (Hrsg.), 2003: Grundbegriffe der Soziologie. 8. überarbeitete Auflage. Opladen.
Silbereisen, R. K., Lantermann, E. D. und Schmitt-Rodermund, E. (Hrsg.), 1999: Aussiedler in Deutschland: Akkulturation von Persönlichkeit und Verhalten. Opladen.
Strobl, R./Kühnel, W., 2000: Dazugehörig und ausgegrenzt. Analysen zu Integrationschancen junger Aussiedler. Weinheim und München.
Süss, W., 1995: Zur psychosozialen Situation der Aussiedlerkinder und -jugendlichen. In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis 18, 2: 131-146.
Tillmann, K.-J., 2006: Sozialisationstheorien: Eine Einführung in den Zusammenhang von Gesellschaft, Institution und Subjektwerdung. 14. Auflage. Reinbek bei Hamburg.
Trommsdorff, G. (Hrsg.), 1989: Sozialisation im Kulturvergleich. Reihe Der Mensch als soziales und personales Wesen. Bd. 10. Stuttgart.
Westphal, M., 1999: Familiäre und berufliche Orientierungen von Aussiedlerinnen. S.127- 152 in: Bade, K. J./Oltmer, J. (Hrsg.): Aussiedler: deutsche Einwanderer aus Osteuropa. (IMIS-Schriften, Bd. 8), Osnabrück.
Westphal, M., 2000: Vaterschaft und Erziehung. S. 121-204 in: Herwartz-Emden, L. (Hrsg.): Ein wander erfamilien: Geschlechterverhältnisse, Erziehung und Akkulturation. (IMIS-Schriften, Bd. 9), Osnabrück.
White, G., 1977: Socialisation. Lecturer in Sociology University of Liverpool. London und New York.
Zimbardo, P. G./Gerrig, R. J., 1999: Psychologie. 7. neu übersetzte und bearbeitete Auflage. Berlin.
Internetquellen
Anders, Fred: Gemeinsam schaffen wir das schon. Erziehung in Aussiedler-Familien. In: Zeitschrift der Ausländerbeauftragten des Landes Niedersachsen. 1/2002.
Online im Internet unter: http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C3600759_L20.pdf (Zugriff am 08.09.2007)
Begriffsdefinitionen. Online im Internet unter:
http://www.paed.uni-muenchen.de/~paed / content / material / material_eckert / ma_eckert / m_eckert2/VL_ 13_04.pdf (Zugriff am 08.09.2007)
Bundesverwaltungsamt. Migrationsbericht 2005. Online im Internet unter:
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Publikation/IB / Anlagen / migrationsbericht-
2005,property=publicationFile.pdf (Zugriff am 08.09.2007)
Bundesverwaltungsamt. Online im Internet unter:
http://www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/spaetaussl.php3 (Zugriff am 08.09.2007) Das Schulsystem in Russland. Online im Internet unter:
http://ddi.in .tum.de / fileadmin / material/Lehrveranstaltungen /04-05/ Oberseminar/Das- Schulsystem_-in-Russland-Vortragl.doc (Zugriff am 08.09.2007)
Forschung im Bereich Familie. Online im Internet unter:
http://www.philso.uniaugsburg.de/lehrstuehle/paedagogik/paed3/medienverzeichnis/ sozakkfamilie.pdf (Zugriff am 08.09.2007)
Geschichte der Russlanddeutschen. Online im Internet unter:
http://www.russlanddeutschegeschichte.de/deutsch4/aussiedler_gesetzliche
_regelungen.htm (Zugriff am 08.09.2007)
Herwartz-Emden, Leonie/Westphal, Manuela: Integration junger Aussiedler: Entwicklungsbedingungen und Akkulturationsprozesse. Online im Internet unter: http://www.philso.uni-augsburg.de/lehrstuehle/paedagogik/paed3/bibliothek/Integration _junger_Aussiedler.pdf (Zugriff am 08.09.2007)
Herwartz-Emden, Leonie: Sie sollen es besser haben. Online im Internet unter:
http://www.ms.niedersachsen.de/master/C767163_L20_D0_I674.html (Zugriff am 08.09.2007)
Hilkes, Peter: Nach dem Zerfall der Sowjetunion. In: Ethnos-Nation 2 (1994) H. 2: 61-73. Online im Internet unter: http://www.uni-koeln.de/phil-fak/soeg/ethnos/inhalte/inhalte4/ hilkes.htm (Zugriff am 08.09.2007)
Kühne, Norbert: Kindergartenerziehung in der früheren Sowjetunion. In: Martin R. Textor (Hrsg.): Kindergartenpädagogik. Online im Internet unter: http://www.kindergartenpaedagogik.de/931.html (Zugriff am 08.09.2007)
Levendecker, Birgit / Driefien, Ricarda: Erziehungsvorstellungen von jungen Eltern: Wie soll mein Kind einmal werden? Online im Internet unter:
http://familienhandbuch-test.bayern.de/cms/Erziehungsfragen-Erziehungsvorstellungen.pdf (Zugriff am 08.09.2007)
Meyers Lexikon. Online im Internet unter: http://lexikon.meyers.de/meyers/Assimilation (Zugriff am 08.09.2007)
Oltmer, Jochen: Einführung: Migrationsforschung und Interkulturelle Studien - zehn Jahre IMIS. Online im Internet unter:
http://www.imis.uni-osnabrueck.de/pdffiles/Einleitung_IMISll.pdf (Zugriff am 08.09.2007)
Prieb, Viktor: Russlanddeutsche - aus jeder Diskussion über Ausländer ausgeklammert und in Ausländerhass eingeklammert. 2000.
Online im Internet unter: http://www.literatur-viktor-prieb.de/Statistik2000.pdf (Zugriff am 08.09.2007)
Ruder, Lisjena: Institutioneile Erziehung. Online im Internet unter: http://www.sw.fh- koeln.de/Lernwerkstatt/kultur/oe_erziehung.htm (Zugriff am 08.09.2007)
Russische Geschichte bis heute. Online im Internet unter: http://www.studyrussian.com/history/geschichte.html (Zugriff am 08.09.2007)
Ruttner, Elvira: Vorschulpädagogik in Russland - Was können wir daraus für den Umgang mit Kindern aus Aussiedlerfamilien lernen? In: Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention (Hrsg.): Die mitgenommene Generation. Aussiedler jugendliche - eine pädagogische Herausforderung für die Kriminalitätsprävention. München 2002.
Online im Internet unter: http://www.dji.de/bibs/_5_Aussiedlerjugendliche_l.pdf (Zugriff am 08.09.2007)
Schneider, Jan 2005: Die Geschichte der Russlanddeutschen. Online im Internet unter: http://www.bpb.de/themen/AAlQ8R,3,0,Die_Geschichte_der_Russlanddeutschen.html#art3 (Zugriff am 08.09.2007)
Scholz, Wolf-Dieter / Euler, Mark 2005: Einführung in die Allgemeine Pädagogik.
Online im Internet unter: http://www.staff. uni-oldenburg.de/wolf.d.scholz/download/Sozialisation-Kurz2005.DOC (Zugriff am 08.09.2007)
Schulsystem Russland. In: BQM-Hamburg. 2005. Online im Internet unter: http://www.bqm- handbuch.de/site/html/cms. php?cont=138&PHPSESSID=89aa46850a3e41979924ba9bded8796e (Zugriff am 08.09.2007)
Spätaussiedler sind von Arbeitslosigkeit besonders stark betroffen. In: (idw) Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) 2007.
Online im Internet unter: http://www.uni-protokohe.de/nachrichten/id/134590/ (Zugriff am 08.09.2007)
Tulinow, Larissa: Elternarbeit mit Aussiedlern - Herausforderungen und Perspektiven.
In: Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention (Hrsg.) 2002: Die mitgenommene Generation. Aussiedlerjugendliche - eine pädagogische Herausforderung für die Kriminalitätsprävention. München. Online im Internet unter: http://www.dji.de/bibs/_5_Aussiedlerjugendliche_l.pdf (Zugriff am 08.09.2007)
Vorurteile / Klischees / Stereotypen / Parolen. Privjet-Projekt 2001.
Online im Internet unter:
http://www.muenster.org/privjet/inhalte/info/infohtml/vorurteile.htm (Zugriff am 08.09.2007)
Acn: Введение в социологию. 1998. Online im Internet unter: http://www.i-u.ru/biblio/archive/asp_vvedenie/02.aspx (Zugriff am 08.09.2007)
Фролов, Сергеи: Институт семЬи. Социология: Учебник.
Online im Internet unter: http://mx4.ru/frolov_sociology/33/09/
(Zugriff am 08.09.2007)
[...]
[...]
1 Hier möchte ich darauf hinweisen, dass im Kapitel drei teilweise auch die ältere Publikationen benutz wurden, die die Lebenssituation der Russlanddeutschen zur Sowjetzeiten gut darstellten.
2 Vgl. dazu Abschnitt 2.2.3 “Individualismus vs. Kollektivismus”
3 Die Wanderungsbewegung der Deutschen lässt sich noch weiter zurück verfolgen.
4 An dieser Stelle überspringe ich ein Teil der Geschichte und komme direkt zur Lebenssituation der Russlanddeutschen in der Sowjetunion. Ausführliche Beschreibung der Wanderungsgeschichte der Deutschen in Osteuropa findet der/die Leser/in bei Dietz (1992: 13-34, 1997: 22-23), Ingenhorst (1997: 17-66), Strobl (2000: 18-28).
5 “Lenin” ist Pseudonym, der volle Name ist Vladimir Ilich Ulyanov. Deutschunterricht in der Schule wurde erst später als Zweitsprache eingeführt.
6 ‘‘Deutschunterricht in der Schule wurde erst später als Zweitsprache eingeführt.
7 Begriffe “Sowjetunion” und “UdSSR” beziehen sich auf die Zeit bis Dezember 1991. Nach dieser Zeit werden neben “ehemalige/vormalige Sowjetunion/UdSSR” Bezeichnungen benutzt, wie “Nachfolgestaaten der Sowjetunion/UdSSR” und “Gemeinschaft Unabhängiger Staaten/GUS”.
8 Hierzu siehe Abschnitt 2.4.2 Erziehungsstile
9 An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass hierzu ältere Literatur verwendet wurde, die sich mit der Theorie von Makarenko beschäftigt hat.
10 In dem FAFRA Projekt wurden außer Aussiedlerfamilien aus der ehemaligen Sowjetunion auch die Arbeitsemigranten aus der Türkei und westdeutsche Frauen und Männer befragt. Allerdings werden in dieser Arbeit nur Ergebnisse der Befragung von Aussiedlern und Aussiedlerinnen aus der ehemaligen UdSSR betrachtet und analysiert.
11 Es sollte berücksichtigt werden, dass diese Befragung in der Mitte der neunziger Jahre durchgeführt wurde und die Spätaussiedler damals nicht so stark von der Arbeitslosigkeit betroffen waren, wie heute (vgl. “Spätaussiedler sind von Arbeitslosigkeit besonders stark betroffen” 2007, unter: http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/134590/, Zugriff am 08.09.2007).
12 Siehe dazu auch Fred Anders “Gemeinsam schaffen wir das schon” Erziehung in AussiedlerFamilien. In: Zeitschrift der Ausländerbeauftragten des Landes Niedersachsen. 1/2002: 13, unter: http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C3600759_L20.pdf, Zugriff am 08.09.2007.
- Arbeit zitieren
- Master of Arts Lilli Petel (Autor:in), 2007, Sozialisation und Erziehung in Aussiedlerfamilien aus der ehemaligen Sowjetunion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111609
Kostenlos Autor werden








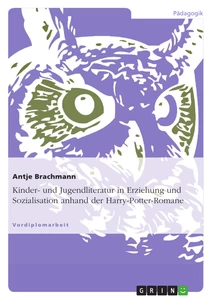







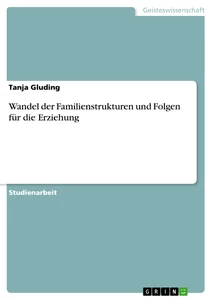
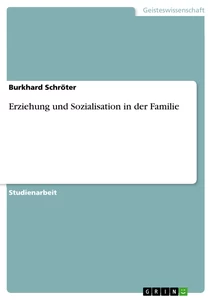



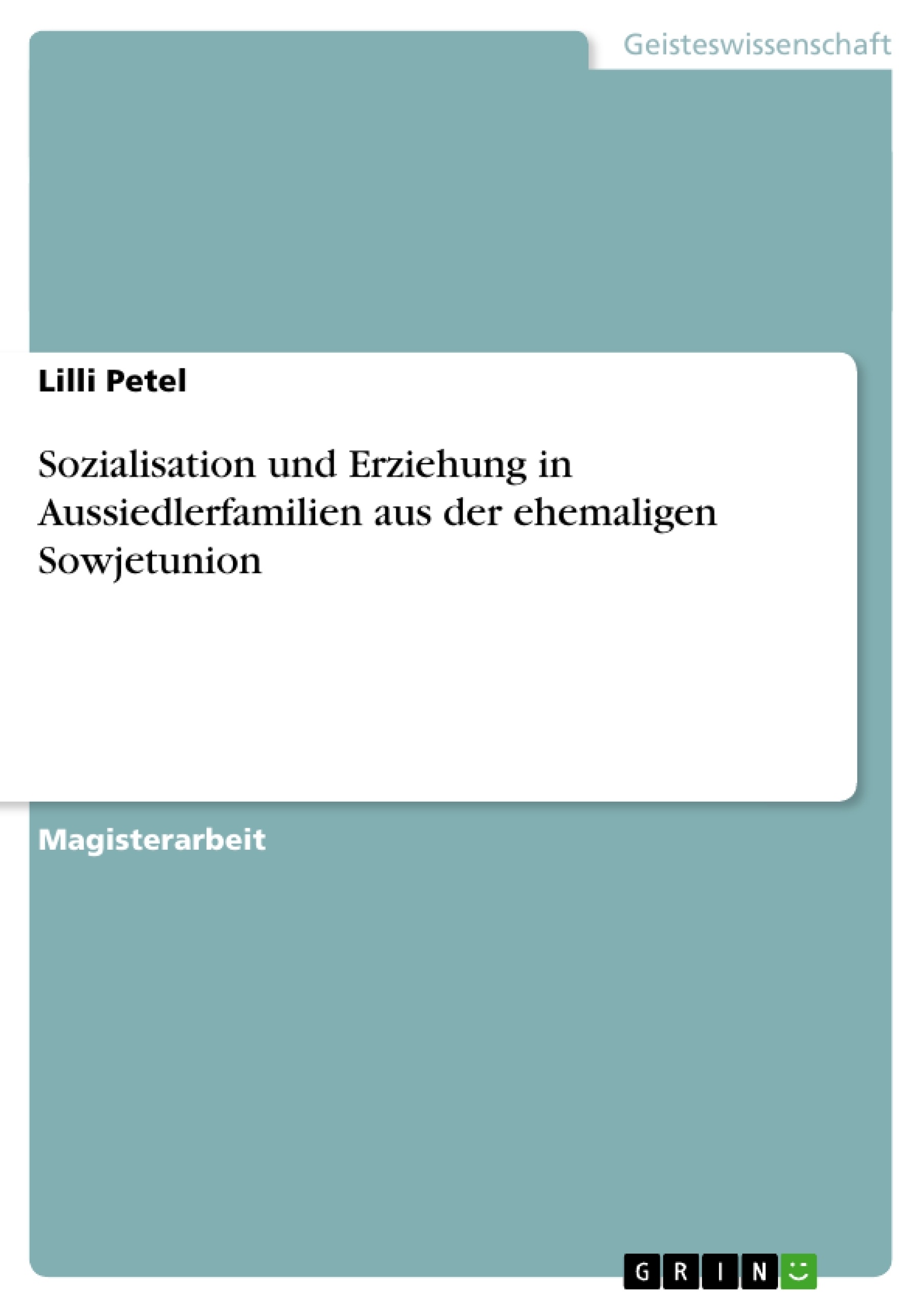

Kommentare